Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Historischer Kontext
2.1. Presse im Nationalsozialismus
2.2. Kriegsberichterstattung im Zweiten Weltkrieg
2.3. Die „Schlacht von Stalingrad“
2.4. Die Bremervörder Zeitung
3. Methodik
4. Die vier Phasen der Berichterstattung
4.1. Phase
4.2. Phase
4.3. Phase
4.4. Phase
5. Die Modifikation des Raumes
6. Der Wandel des Soldatenbildes
7. Die Art und Weise der Berichterstattung
8. Die Funktion der Berichterstattung
9. Fazit
10. Literaturverzeichnis
10.1. Bibliographie der Artikel der Bremervörder Zeitung
10.2. Sekundärliteratur
11. Anhang
1. Einleitung
Immer wieder wird in der Literatur Stalingrad als Mythos, als Legende, als das prägende Ereignis der Deutschen im Verlauf des Zweiten Weltkrieges dargestellt.[1] Wie kam es dazu, dass dieser Mythos entstand? In der „Schlacht von Stalingrad“ (Kumpfmüller 1995) haben Teile der deutschen Bevölkerung zumindest einen „Wendepunkt des Krieges“ gesehen, wie es die „Meldungen aus dem Reich“ des Sicherheitsdienstes der SS zu Protokoll gaben (vgl. Kaufmann 1996, S. 373). Aus diesem Grund wird Stalingrad als psychologischer Wendepunkt des Krieges, nicht aber zwingend als militärischer angesehen. Es stellte sich in großen Teilen der Bevölkerung das Gefühl ein, dass Stalingrad „der Anfang vom Ende“ sein könnte (Förster 1992, S. 35).
Die „Schlacht von Stalingrad“ gilt in der Forschung als Beispiel für die vernichtende Niederlage im Osten und für einen „missverstandenen Gehorsam“ gegenüber Adolf Hitler (Ueberschär 2003, S. 42). Ueberschär spricht davon, dass Stalingrad „die Unmenschlichkeit und Verantwortungslosigkeit des NS-Regimes bei der Verfolgung der größenwahnsinnigen und verbrecherischen Ziele auch gegenüber den Bürgern des eigenen Landes in aller Deutlichkeit“ offenbarte (ebd.).
Die Frage ist, wie die „Schlacht von Stalingrad“ der Bevölkerung vermittelt wurde und wie die Wirkung entstehen konnte, dass es sich hierbei um den psychologischen Wendepunkt des Krieges handelte. Um diese Frage zu beantworten, hat sich die Forschung bislang überwiegend nur allgemein mit der Vorgehensweise der NS-Propaganda während der Kämpfe befasst. Der Fokus lag dabei nicht auf der konkreten Ausgestaltung der Berichterstattung in Presse und Rundfunk, sondern vielmehr auf den Anweisungen der obersten NS-Führung. So untersuchte beispielsweise Brendel die „Schlacht von Stalingrad als Problem der NS-Propaganda“ (1985) und Wette widmete sich dem „Massensterben als ‚Heldenepos’. Stalingrad in der NS-Propaganda“ (2003). Dabei wird Stalingrad unter anderem als „die entscheidende Kommunikationsschwelle“ (Wette 2003, S. 47) bezeichnet, womit gemeint ist, dass der NS-Propaganda ab Beginn des Jahres 1943 nicht mehr geglaubt wurde. Die NS-Führung versuchte allerdings durch ihre Propaganda, die „Destabilisierung des NS-Regimes“ (ebd., S. 44) zu verhindern.
Die vorliegende Arbeit fragt daher nicht nach dem Vorgehen der NS-Führung im Allgemeinen, sondern geht vielmehr der Frage nach, wie versucht wurde, die „Destabilisierung des NS-Regimes“ zu verhindern. Dabei soll vor allem die Berichterstattung über Stalingrad in einer Heimatzeitung für eine ländlich geprägte Region im nationalsozialistischen Deutschland betrachtet werden. Aus diesem Grund wurde als Untersuchungsobjekt die „Bremervörder Zeitung“ gewählt. Sie stellt eine vormals bürgerlich-konservative Heimatzeitung dar, die während der NS-Diktatur vereinnahmt wurde.[2] Auch der Erscheinungsort im ländlich geprägten Elbe-Weser-Dreieck spricht für die Analyse dieser Zeitung, da somit nachvollzogen werden kann, wie die Bevölkerung fernab der großen Städte informiert wurde.
Die Frage nach der konkreten Ausgestaltung der tagesaktuellen Berichterstattung in Zeitungen wurde bislang erst zwei Mal in der Forschung gestellt. So untersuchte Hans-Jürgen Burgard 1993 die Berichterstattung über Stalingrad im „Iserlohner Kreisanzeiger“, während Werner Faulstich 2010 zum gleichen Thema den „Völkischen Beobachter“ analysierte. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher mit einem bislang wenig erforschten Gebiet und leistet einen Beitrag zur weiteren Analyse dieses Bereichs.
Um allgemein nachprüfbare Ergebnisse zu gewinnen und diese dann ausführlich interpretieren zu können, wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Sie soll detailliert darüber Aufschluss geben, wie die Berichterstattung in der Bremervörder Zeitung erfolgte. Dafür wurden die Zeitungsausgaben, die während der Kämpfe um Stalingrad erschienen, ausführlich ausgewertet und interpretiert.
Neben der allgemeinen Frage nach der Ausgestaltung der Berichterstattung soll der Frage nachgegangen werden, wie Propagandarichtlinien in einer kleinen Zeitung umgesetzt wurden. So soll festgestellt werden, ob die „Bremervörder Zeitung“ als ein vergleichsweise kritisches Blatt oder ein eher der NS-Propaganda loyales Blatt angesehen werden kann. Das wiederum wirft die Frage nach der vermeintlichen Absicht der Verantwortlichen und nach der Wirkung bei den Leserinnen und Lesern[3] auf.
Um dies nachvollziehen zu können, wird zunächst der historische Kontext betrachtet. Dabei wird auf die funktionale Ausgestaltung der Presse im Nationalsozialismus eingegangen, um zu verstehen, unter welchen Voraussetzungen die „Bremervörder Zeitung“ entstanden ist. Hierbei wird die allgemeine Presselandschaft unter der NS-Diktatur dargestellt sowie die Art und Weise, wie die Presselenkung während dieser Zeit funktionierte. Im nächsten Schritt wird der Fokus auf die Funktionsweise der Kriegsberichterstattung im nationalsozialistischen Deutschland gelegt. Dabei sollen die Strukturen und Handlungsabläufe im Kriegsalltag erläutert werden, um die Entstehungsbedingungen während der Kämpfe um Stalingrad besser verstehen zu können. Anschließend werden die in der Forschung festgestellten militärischen Abläufe der „Schlacht von Stalingrad“ dargestellt, um schließlich die Geschichte der „Bremervörder Zeitung“ wiederzugegeben. Dabei wird ein Blick auf die Geschichte der Zeitung geworfen, um deren politische Ausrichtung vor und während der NS-Diktatur zu betrachten.
Das Kernstück dieser Arbeit bildet die in den weiteren Abschnitten erläuterte qualitative Inhaltsanalyse. Zunächst soll die Methode an sich näher vorgestellt werden, um dann die konkrete Umsetzung der Analyse darzulegen und zu begründen. Anschließend erfolgt die umfassende Interpretation der Ergebnisse, die die Inhaltsanalyse hervorgebracht hat. Diese werden in fünf verschiedenen Abschnitten dargestellt, die inhaltlich aufeinander aufbauen. Zunächst werden die Phasen der Berichterstattung erläutert. Anschließend folgen die detaillierten inhaltlichen Merkmale wie die Modifikation des Raumes und der Wandel im Soldatenbild. Danach wird die Art und Weise der Berichterstattung erläutert, um schließlich auf ihre Funktion einzugehen. Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse mit der dargestellten Fragestellung zusammenfassend in Verbindung gesetzt.
Um einen Überblick zu gewinnen, wie die bisherige Forschung zur Berichterstattung über Stalingrad in Zeitungen aussieht, sollen die Studien von Faulstich und Burgard kurz vorgestellt werden. Dies soll die Vergleichbarkeit bei der Interpretation der Ergebnisse erleichtern. Im Folgenden werden jedoch nur jene Punkte dargestellt, die keine Ergebnisse dieser Arbeit vorwegnehmen.
Wie bereits erwähnt, war die Berichterstattung über Stalingrad in Zeitungen bislang nur zwei Mal Thema von Forschungsarbeiten. Die offizielle Parteizeitung der NSDAP, den „Völkischen Beobachter“ [4] (kurz: VB), analysierte Werner Faulstich . Dabei führte er eine Inhaltsanalyse durch, welche die Berichterstattung in der Zeit vom 22. August 1942 bis zum 14. Februar 1943 untersucht.
Die Berichterstattung im VB lässt sich laut Faulstich in drei Phasen einteilen. Für die erste Phase nennt Faulstich den Zeitraum von Beginn der Berichte am 22. August bis zum 14. September 1942. Er begründet diese Einteilung mit einer Zäsur, die der 14.09.1942 darstelle, denn damit sei die erste Phase der Berichterstattung abrupt zu Ende gegangen (vgl. Faulstich 2010, S. 3). Die Berichte seien von diesem Tage an durch „Sprachfloskeln, informationsleere[s] Hinhalten oder schlicht d[ie] Aussparung des Themas Stalingrad“ geprägt (ebd.). Als Begründung führt Faulstich zahlreiche Beispiele in der Sprache an. Zudem stellt er den Bezug zu den militärischen Fakten her. Faulstich ist der Ansicht, dass die Verantwortlichen in der NS-Führung von den Rückschlägen „offensichtlich völlig überrascht“ gewesen seien. Außerdem bezeichnet er diese Phase als „Ausdruck völlig verfehlter Krisen-PR“ (ebd., S. 4).
Eine zweite Zäsur sieht Faulstich in der Berichterstattung ab dem 17. Januar 1943. Der Leser würde ab diesem Zeitpunkt propagandistisch auf die Niederlage in Stalingrad eingestimmt. Faulstich sieht für diese Phase eine Verdichtung der Propaganda zu einer drei-gliedrigen Formel (vgl. ebd., S. 6f.). Da diese allerdings das in diesem Punkt ähnliche Ergebnis der Analyse der „Bremervörder Zeitung“ vorgreifen würde, wird sie hier nicht näher erläutert, sondern erst im Bezug auf die Berichterstattung in Bremervörde.[5]
Die zweite Forschungsarbeit zur Berichterstattung über Stalingrad in Tageszeitungen stammt von Hans-Jürgen Burgard, der 1993 den „Iserlohner Kreisanzeiger“ [6] (kurz: IKZ) hinsichtlich seiner Meldungen zu Stalingrad untersucht hat. Zunächst stellt er den Forschungsstand über die militärische Lage dar, den er als „Die Wirklichkeit“ überschreibt (vgl. S. 108ff.). Im zweiten Abschnitt seines Aufsatzes zeichnet er die Berichterstattung in Iserlohn nach. Burgard führt allerdings keine standardisierte Inhaltsanalyse durch, sondern gibt den Verlauf der Berichterstattung chronologisch wieder. Er stellt zwar Veränderungen im Verlauf der Kämpfe fest, kann sie aber nur durch Zitate und nicht durch eine konkrete Auswertung belegen. Dennoch lassen sich bei ihm ebenfalls Phasen erkennen, die er zwar nicht bezeichnet, aber aufgrund qualitativer Eindrücke und Veränderungen in der Wortwahl darstellt. Burgard setzt die Berichte unmittelbar in Beziehung zu den in der Forschung bekannten Vorgaben durch die NS-Führung. Außerdem interpretiert er die Meldungen in der Zeitung vor allem in Hinblick auf die Wirkung beim Leser. Burgard unterstellt der Bevölkerung dabei durchaus, die Fähigkeit und das Bedürfnis „zwischen den Zeilen“ zu lesen sowie sich durch andere Quellen, wie Feldpostbriefe und das Abhören von „Feindsendern“, ein umfangreicheres Bild über die Lage vor Ort zu machen. Dadurch kommt er immer wieder zu dem Schluss, dass der Leser schon sehr viel früher als von der NS-Propaganda vorgegeben, von Problemen und einer Niederlage bei Stalingrad ausgegangen sein könnte (vgl. Burgard 1993).
Die Artikel, die im IKZ abgedruckt wurden, finden sich überwiegend auch in der „Bremervörder Zeitung“. Dies liegt vermutlich an der im folgenden Abschnitt ausführlich erläuterten Gleichschaltung der Presse. Burgard weist darauf hin, dass es „völlig abwegig“ sei, die Schriftleiter oder Verleger für die Berichte verantwortlich zu machen oder daraus Rückschlüsse auf die politische Anschauung der Zeitung sowie deren Angestellte zu ziehen (vgl. Burgard 1993, S. 113). Da die Berichterstattung nahezu deckungsgleich scheint, soll hier zunächst nicht weiter auf die Erkenntnisse über die Berichterstattung im IKZ eingegangen werden.[7]
2. Historischer Kontext
Im Folgenden soll der historische Kontext der Presse im Nationalsozialismus, der Kriegsberichterstattung im Zweiten Weltkrieg, den militärischen Kämpfen um Stalingrad sowie der „Bremervörder Zeitung“ dargelegt werden, um einen Überblick dafür zu bekommen, unter welchen Voraussetzungen die zeitgenössische Berichterstattung über Stalingrad in der „Bremervörder Zeitung“ entstanden ist. Dafür werden ausgewählte Forschungsergebnisse zu der jeweiligen Thematik vorgestellt und mit der Bedeutung für diese Arbeit in Beziehung gesetzt.
2.1. Presse im Nationalsozialismus
Um die Entstehungsbedingungen verstehen zu können, ist zunächst ein Blick darauf zu werfen, wie die Presse[8] im Nationalsozialismus organisiert und reglementiert war. In der Forschung wurde dieser Themenkomplex bereits ausführlich behandelt.[9] Hier sollen nun nicht sämtliche Forschungsergebnisse darlegt werden, sondern nur jene, die für die Analyse der „Bremervörder Zeitung“ von Bedeutung sind.
Hans-Dieter Kübler schreibt zur Presse im Nationalsozialismus, dass „im NS-Staat [...] ein Geflecht von ‚Gleichschaltung, Selbstanpassung und Resistenz‘“ (2009, S. 150) gewirkt habe, das bis zur bereitwilligen Unterwerfung geführt habe (vgl. ebd.). Einige Forscher sprechen deshalb nicht von der Presse im Nationalsozialismusm sondern von der Presse des Nationalsozialismus (vgl. Stöber 2010, S. 275). Die NS-Führung machte demnach, wie Kübler es schreibt, aus der Presse ein „funktionales Manipulations- und Steuerungsinstrument“ (Kübler 2009, S. 150), das jedoch nicht immer beherrschbar gewesen sei (vgl. ebd.). Worin die Spielräume der Berichterstattung lagen, wird im Laufe dieses Abschnittes erläutert.
Bereits kurz nach der Machtergreifung sorgten die Nationalsozialisten durch verschiedene Maßnahmen dafür, dass die Presse getreu der NS-Politik funktionierte. So wurden die sozialistischen und kommunistischen Parteiblätter bereits im Frühjahr 1933 verboten. Am 04.10.1933 trat dann das neue Schriftleitergesetz in Kraft (vgl. Stein 1994, S. 85). Dies war ein einschneidendes Gesetz für die Presse in Deutschland, denn von nun an musste sich jeder Schriftleiter (heutzutage: Redakteur) in eine von der gleichgeschalteten Journalistengewerkschaft „Reichsverband der deutschen Presse“ (kurz: RDP) geführten Liste eintragen lassen. Eine weitere Auflage, um den Beruf des Schriftleiters auszuüben, war die Mitgliedschaft in der „Reichspressekammer“[10] (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 26). Wenn ein Journalist nicht auf der Schriftleiterliste stand bzw. wieder gestrichen wurde, wirkte es wie ein Berufsverbot. Die Journalisten wurden durch das Gesetz zwar unabhängiger von den Verlegern, da sie formell nur dem Gesetz unterstellt waren, jedoch machte die permanente Bedrohung, den Beruf aufgeben zu müssen, eine Vorzensur im Grunde überflüssig (vgl. Stöber 2010, S. 281). Stöber fasst es bereits für die spätere Kriegszeit wie folgt zusammen:
„Wo Selbstgleichschaltung und loyales Verhalten sich nicht unmittelbar ergaben, sorgte das Damoklesschwert existenzbedrohender Strafmaßnahmen von der Entlassung bis zur Frontversetzung für die gewünschte Systemkonformität.“ (2010, S. 284)
Auch die Verleger waren dem Druck des Systems unterworfen. So mussten sie dem gleichgeschalteten „Reichsverband Deutscher Zeitungsverleger“ beitreten. Insgesamt wurde Kübler zufolge erreicht, dass die Pressefreiheit verhöhnt und zu einer „Verpflichtung der unbedingten Loyalität“ (Kübler 2009, S. 151) umgedeutet wurde. Die Presse sollte dabei der „Volkserziehung“ dienen (vgl. ebd.).
Zwischen der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 und dem 21. April 1937 sorgten 74 Gesetze, Anordnungen, Verordnungen und amtliche Bekanntmachungen von „Reichspressekammer“ und „Reichsschrifttumskammer“ dafür, dass die Presse nach der Vorstellung des Regimes neu organisiert wurde (vgl. ebd., S. 153). Zu den einschneidenden Erlassen und Gesetzen gehört zweifelsohne auch die Errichtung des „Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda“ (im Folgenden: RMVP). Das Amt des Ministers übernahm am 13. März 1933 der bisherige Gauleiter von Preußen und Reichspropagandaleiter der NSDAP, Josef Goebbels (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 25). Dieser stand in der folgenden Zeit in einem ständigen Konkurrenzkampf um die Richtlinienkompetenz in Propagandafragen. Ein wichtiger Gegenspieler war dabei der Reichspressechef der NSDAP, Otto Dietrich. Der Konflikt zeigte sich vor allem während des Krieges, wobei es bereits unmittelbar nach Kriegsbeginn verschiedene Auffassungen über das richtige Vorgehen in der Propaganda gab (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 100ff.).[11]
Während der NS-Herrschaft kam es auch zu einer Einschränkung der Pressevielfalt. Neben der sozialistischen und kommunistischen Presse, die, wie bereits erwähnt, unmittelbar nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler verboten wurde, hatten auch viele bürgerliche Verleger der so genannten „Heimatpresse“ (Stein 1994, S. 82) Schwierigkeiten sowohl organisatorischer als auch politischer Art und mussten ihre Zeitungen einstellen. Dies lag zum einen an dem Schriftleitergesetz, das die Arbeitsbedingungen der Journalisten erschwerte, zum anderen an den so genannten „Amannschen Anordnungen“ vom 24. April 1935 (vgl. ebd., S. 85). Der Präsident der „Reichspressekammer“ und Direktor des parteieigenen Eher-Verlags[12] Max Amann beseitigte damit von den Nationalsozialisten angeblich festgestellte „ungesunde Wettbewerbsverhältnisse“. Das bedeutete, dass in kleineren Orten mit mehreren Zeitungen nur noch ein Blatt weiterexistieren durfte. Diese Maßnahme betraf vor allem Verlage im privaten Besitz eines bürgerlichen Verlegers. Die Entscheidung, welche der Zeitungen geschlossen wurde, ging dabei nicht nach der Größe der Auflage, sondern oft nach der politischen Loyalität, wovon meist die im Eher-Verlag untergebrachten NS-Zeitungen profitierten (vgl. Kohlmann-Viand, S. 53). Weitere Zeitungsschließungen gab es während des Krieges. Diese wurden mit Papierknappheit und Personalmangel begründet und führten zu einer weiteren Konzentration auf dem Medienmarkt.[13]
Neben der ständigen Bedrohung durch den Entzug der Berufsgenehmigung wurde die Systemkonformität der Zeitungen auch dadurch erreicht, dass die beiden großen Nachrichtenagenturen der Weimarer Republik, nämlich „Wolff’s Telegraphisches Büro“ (WTB) und der Hugenbergsche „Telegraphen-Union Internationaler Nachrichtendienst GmbH“ (TU), zum „Deutschen Nachrichten Büro“ (kurz: DNB) zusammengelegt wurden (vgl. Stöber 2010, S. 283; Kohlmann-Viand 1991, S. 109). Durch das DNB konnte die NS-Führung konsequent und einfach ihre Propaganda streuen, da sämtliche Artikel des DNB bereits vorzensiert waren und somit ohne weiteres von den Zeitungen abgedruckt werden konnten. Dieses Angebot wurde von den Schriftleitern gerne angenommen, da aufgrund der Personalknappheit vor allem während des Krieges Engpässe und Zeitdruck bei der Produktion der Zeitung herrschten. Besonders in den kleinen Provinz- und Heimatzeitungen war dies der Fall (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 64).[14]
Die Strukturen, die sich auf der Reichsebene fanden, lassen sich auch auf die jeweiligen Gaue herunterbrechen. So gab es in jeder Gauhauptstadt Zweigstellen des RMVP, die so genannten „Reichspropagandaämter“. Diese waren ab 1937 Reichsbehörden, die allerdings die Ressourcen der schon vorhandenen NSDAP-eigenen „Gaupropagandaämter“ nutzten. So kam es immer wieder zu Interessenskonflikten zwischen dem Gauleiter, der die Aufsicht über die Gaupropagandaämter hatte, und den Anweisungen Goebbels für das RMVP und somit für die Reichspropagandaämter. Gleichzeitig übernahm der Leiter der beiden Behörden noch die Funktion des jeweiligen Landeskulturwarts, d.h. er hatte zusätzlich noch die Leitung der lokalen Aufsichtsbehörde der Reichskulturkammer inne (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 76ff). Die entstandenen Interessenskonflikte fasst Zimmermann folgendermaßen zusammen:
„Kompetenzstreitigkeiten zwischen Ministerium und Partei schlugen auch in der Provinz durch: Reichspropagandaämter gegen Gaupropagandaämter führten dazu‚ dass der Aufwand des Presselenkungsapparats in keiner Relation mehr stand zu seinen Ergebnissen. [...] Intention und Resultat der Lenkungsmaßnahmen [liefen] immer weiter auseinander.’“ (Zimmermann 2007, S. 89)[15]
Wie der folgende Abschnitt ebenfalls noch zeigen wird, prägten im NS-Staat Kompetenzstreitigkeiten zwischen den verschiedenen Personen das Bild. Zimmermann stellt deshalb fest, dass das Wort „Gleichschaltung“ völlig an der Realität vorbeiführe (vgl. ebd., S. 90).
2.2. Kriegsberichterstattung im Zweiten Weltkrieg
Um die Berichterstattung über Stalingrad in der „Bremervörder Zeitung“ genauer zu analysieren, ist es zunächst wichtig, die Kriegsberichterstattung im Zweiten Weltkrieg im Allgemeinen näher zu betrachten. Im folgenden Abschnitt sollen deshalb die Entstehungsbedingungen und Abläufe während des Krieges vorgestellt werden. Dabei werden jene Forschungsergebnisse erläutert, die für das Verständnis der Entstehungsbedingungen einer Lokalzeitung notwendig sind.
Forschungsberichte, die sich speziell mit der Kriegsberichterstattung während des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen, sind nicht so zahlreich wie zur Presse im Nationalsozialismus im Allgemeinen.[16] Allerdings wird in den Überblickswerken auch auf die Zeit von 1939-1945 geblickt und sich damit kritisch auseinandergesetzt.
Die im vorherigen Abschnitt beschriebene Presselenkung durch das Schriftleitergesetz, die vorproduzierten und vorzensierten Nachrichten des DNB sowie die Weisungen und Kontrollen des RMVP verschärfte sich zu Beginn des Zweiten Weltkriegs weiter. Nun hob vor allem Goebbels die Wichtigkeit die Propaganda in Kriegszeiten hervor. So unterzeichneten das Oberkommando der Wehrmacht (im Folgenden: OKW) und Goebbels für das RMVP das „Abkommen über die Durchführung der Propaganda im Krieg“, nachdem sie sich zuvor über die Richtlinien der Kriegsberichterstattung gestritten hatten. Das RMVP wollte zivile Berichterstatter, das OKW jedoch militärische, die der Wehrmacht direkt unterstellt waren (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 46). Im Abkommen vom 19. August 1938 wurde dann folgender Grundsatz festgehalten:
„Der Propagandakrieg wird als wesentliches, dem Waffenkrieg gleichrangiges Kriegsmittel anerkannt. Der Waffenkrieg wird verantwortlich von der Wehrmacht, der Propagandakrieg vom RMVP geführt. Letzteres führt ihn im Heimatgebiet völlig selbständig, im Operationsgebiet in Abstimmung mit dem OKW." (zit. nach ebd., S. 39)
Außerdem wurden in diesem Abkommen auch Vereinbarungen über die Aufstellung, den Einsatz und die Arbeit so genannter „Propagandakompanien“ getroffen.
Diese „Propagandakompanien“ (kurz: PK) spielten in der Berichterstattung während des Krieges eine wichtige Rolle, da die Nationalsozialisten so die Kriegsberichterstattung vergangener Kriege umwandelten. Es waren nicht länger wie in früheren Kriegen zivile Journalisten, die zur Front fuhren, um die Kämpfe zu beobachten und ihre gewonnenen Eindrücke den Lesern in der Heimat zu schildern. Die neue Form der Berichterstattung bestand vielmehr darin, dass die PKs ein Teil der Armee waren und dem OKW unterstanden. Die Schriftleiter, die als Kriegsberichterstatter an die Front geschickt wurden, waren gleichzeitig Soldaten und kämpften mit ihren Kameraden. Goebbels fasste die Aufgabe eines Kriegsberichterstatters folgendermaßen zusammen:
„Der PK-Mann ist kein Berichterstatter im herkömmlichen Sinne, sondern ein Soldat. Neben Pistole und Handgranate führt er noch andere Waffen mit sich: die Filmkamera, die Leica, den Zeichenstift oder den Schreibblock. Er ist in der Truppe ausgebildet worden, er lebt als Soldat unter Soldaten, kennt ihr Milieu, weil es das Seine ist, spricht die Sprache, denkt in ihrem Denken und fühlt in ihrem Fühlen." (zit. nach Kohlmann-Viand 1991, S. 46)
Auch ein Aufsatz in der journalistischen Verbandszeitschrift „Deutsche Presse“ lässt keinen Zweifel daran aufkommen, welche Aufgabe Schriftleiter an der Front im Zweiten Weltkrieg zu erfüllen hatten. Dort heißt es unter anderem, dass der Journalist nicht wie früher ein Literat sei, der für ein Publikum schreibe, sondern dass er nun vielmehr ein Soldat sei, der „einberufen wie jeder andere, [...] ausgebildet wie jeder andere [und] eingesetzt wie jeder andere“ werde. Er kämpfe „wie jeder andere für sein Volk“ (zit. nach ebd.). Zum Schluss des Aufsatzes heißt es:
„Man steht nicht für eine Zeitung, dafür schreibt man; man steht nicht für eine Bildfolge, dafür photographiert man; man steht nicht für eine Wochenschau, dafür filmt man. Aber man steht für sein Volk als Soldat. Und der PK-Mann ist Soldat." (Hervorhebungen im Original; zit. nach ebd.)
Die NS-Führung versprach sich von diesem Vorgehen in der Berichterstattung eine höhere Authentizität. In einer Betrachtung aus dem Jahr 1944 werden sie als „Feldpostbriefe für ein ganzes Volk“ bezeichnet. Außerdem waren die so genannten PK-Berichte für die Zensur leichter zu steuern. Die politische Zensur erfolgte dabei durch den Kompaniechef, die militärische Zensur durch einen Zensuroffizier des Oberkommandos der Armee (vgl. ebd., S. 47). Die PKs[17] erledigten für die NS-Führung verschiedene Aufgaben. Für das RMVP lieferten sie das Material zur eigenen Propaganda über das aktuelle Kampfgeschehen und für die Bevölkerung in der Heimat sowie für die feindlichen Armeen schufen sie unmittelbare Aktivpropaganda, da ihre Berichte zum Teil direkt in der Zeitung abgedruckt wurden. Bei der Bevölkerung erfreuten sie sich größter Beliebtheit, da sie als authentisch und ungeschönt galten und damit ein genaueres und realistischeres Bild auf die tatsächliche Lage gaben. Dies galt auch während der Berichterstattung über Stalingrad.[18]
Ein weiterer wichtiger Teil der Kriegsberichterstattung, wenn nicht sogar der Wichtigste, war der so genannte OKW-Bericht (auch Wehrmachtbericht genannt). Dieser wurde täglich vom Oberkommando der Wehrmacht, präziser von der dort ansässigen Abteilung Wehrmachtpropaganda (kurz: WPr), veröffentlicht. Diese Abteilung wurde wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs am 01. April 1939 ins Leben gerufen. Zuvor existierte bezüglich der Direktiven der Propagandaarbeit noch eine ständige Konkurrenzsituation verschiedener Abteilungen aus unterschiedlichen Ministerien und Parteibehörden.[19] Diese wurden spätestens mit der Gründung der Abteilung WPr zum großen Teil beseitigt, denn nun lag dort die Oberhoheit für alle Fragen der Propaganda, zumindest wenn der militärische Teil davon betroffen war (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 37ff).
Damit hatte diese Abteilung eine sehr wichtige Funktion in der Kriegspropaganda. Sie filterte aus den eingehenden Berichten der Armeen an der Front jene Meldungen heraus, die für die Propaganda verwendet werden sollten und schrieb sie in einer bestimmten Form und Norm zusammen. Anschließend wurden sie vor der Veröffentlichung noch von verschiedenen Stellen gegengelesen und verändert. Die letzte Entscheidungsgewalt, den Wortlaut und den Umfang des Wehrmachtberichts betreffend, hatte immer Adolf Hitler selbst. Als letzter Schritt wurde der zu veröffentlichende OKW-Bericht vom Reichspressechef Dietrich an die Presse übermittelt. Das RMVP hingegen hatte die Aufgabe, den Wehrmachtbericht an den Rundfunk weiterzugeben. Dort wurde er in der Mittagszeit und jeweils vor den Nachrichten verlesen. In seinem Umfang variierte der OKW-Bericht während des Krieges zwischen mehreren Seiten und dem Satz „Keine besonderen Ereignisse“ (vgl. ebd., S. 40f).
Der offizielle OKW-Bericht war in der Zeitung vor allem dadurch zu erkennen, dass er standardisiert mit den Worten „Aus dem Führerhauptquartier (Datum). Das Oberkom-mando der Wehrmacht gibt bekannt“ begann. Die Abteilung WPr des OKW gab aber nicht nur den täglichen OKW-Bericht heraus, sondern auch Sondermeldungen bei besonderen Kriegsereignissen und ergänzende Meldungen zu bestimmten Frontabschnitten (vgl. ebd., S. 43).
Für die Veröffentlichung des Wehrmachtberichts in der Zeitung gab es strikte Vorgaben. So durfte am Wortlaut nichts verändert werden, zudem durfte er nicht mit anderen Meldungen zusammengefasst werden. Außerdem musste der OKW-Bericht deutlich von den restlichen Artikeln abgehoben sein. Während des Krieges wurde „aus aktuellem Anlass“ immer wieder darauf hingewiesen, dass der Wehrmachtbericht vollständig zu veröffent-lichen sei (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 41f).
Damit die Propagandarichtlinien des RMVP und des Reichspressechefs auch in den Redaktionen ankamen, gab es täglich drei verschiedene Konferenzen in Berlin. In ihnen wurden die Weisungen, die unter anderem die genauere Darstellung der Kriegsereignisse betrafen, erarbeitet und anschließend den Journalisten kundgetan. Neben der eigentlichen Hauptpressekonferenz, der so genannten „Mittagspressekonferenz“ für die wichtigsten Hauptstadtjournalisten in Berlin, gab es vorher zwei Konferenzen, in denen separat auf bestimmte Propagandarichtlinien hingewiesen werden sollte (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 69ff.). Die einzelnen Konferenzen und ihre Bedeutung sollen im Folgenden kurz erläutert werden.
Die erste Konferenz des Tages war die so genannte „Ministerkonferenz“ des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda, Josef Goebbels. Sie wurde kurz nach Kriegsbeginn eingeführt und fand bis zum 21. April 1945 fast täglich vormittags statt. Dort gab Goebbels seine Direktiven für die künftige Berichterstattung bekannt. Er nahm dabei Bezug auf den zumindest im Entwurf vorliegenden Wehrmachtbericht und gab Weisungen, wie mit einzelnen Meldungen umzugehen sei, welche herausgehoben werden sollten bzw. wo Zurückhaltung erfordert sei. Goebbels hatte damit, zumindest zu Beginn des Krieges, großen Einfluss auf die Meldungen in Presse und Rundfunk. Er rügte Journalisten oder ganze Zeitungen, falls die bisherige Berichterstattung nicht seinen Vorstellungen entsprach und gab Anweisungen für die kommende Zeit. An der gesamten Konferenz nahmen ungefähr zwanzig Personen aus dem Ministerium teil. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges erhöhte sich die Zahl auf bis zu fünfzig Teilnehmer. Nach einer halben bis dreiviertel Stunde endetet die „Ministerkonferenz“ bereits und die Ergebnisse wurden anschließend in der „Mittagspressekonferenz“ als Anweisungen an die Presse weitergegeben. Goebbels konnte hierdurch gezielten Einfluss auf die Berichterstattung nehmen und seine persönlichen Propagandarichtlinien durchsetzen (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 69).
Am 01. November 1940 änderten sich jedoch die Machtverhältnisse in Propagandafragen, da ab diesem Zeitpunkt eine weitere Konferenz hinzukam, die entscheidenden Einfluss auf die Berichterstattung in der Presse haben sollte. Von nun an wurde dem Reichspressechef Dietrich deutlich mehr Macht zugestanden. In dieser ebenfalls fast täglichen Konferenz wurde die neu geschaffene „Tagesparole des Reichspressechefs“ bekanntgegeben bzw. näher ausgearbeitet. An ihr nahmen Vertreter verschiedener Ministerien teil, die Anweisungen an die Presse geben wollten sowie die Leiter der verschiedenen Abteilungen der NSDAP für Presse und Rundfunk. Dietrich selbst war nur selten anwesend, da er sich meist im Führerhauptquartier in unmittelbarer Nähe zu Hitler aufhielt. Er wurde aber während der Konferenz mehrmals telefonisch unterrichtet und Anweisungen wurden mit ihm abgesprochen (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 69f.).
Dadurch, dass es zwei verschiedene Konferenzen gab, zum einen des Reichspressechefs der NSDAP und zum anderen vom Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, divergierten zum Teil auch die Anweisungen. Dietrich hatte allerdings den Vorteil, dass „seine“ Konferenz nach der „Ministerkonferenz“ stattfand und er somit Anweisungen Goebbels’ ändern oder abschwächen konnte (vgl. Brendel 1985, S. 41). Dies ist einer der Gründe, warum dem Reichspressechef in der Literatur mehr Kontrolle über die Zeitungen zugesprochen wird als Goebbels.[20] So schreibt Brendel, dass es Dietrich gelungen sei, den Einfluss Goebbels auf die Presse weitgehend einzuschränken. Nur in der Wochenzeitung „Das Reich“ konnte der Propagandaminister Einfluss nehmen, da er dort die Leitartikel verfasste (vgl. ebd.). Ansonsten hatte das RMVP mit Goebbels an der Spitze weiterhin die Oberhoheit über den zentral gesteuerten Rundfunk.
Die dritte Konferenz des Tages war schließlich die bereits erwähnte „Mittagspressekonferenz“, in der den anwesenden Korrespondenten der großen Zeitungen und des Rundfunks die Anweisungen erläutert wurden. Zudem bestand die Möglichkeit für Nachfragen. Nach der „Mittagspressekonferenz“ übermittelten die Berliner Vertreter der großen Blätter die Anweisungen per Brief oder Fernschreiber an die Redaktionen. Kohlmann-Viand stellt fest, dass ab dem Kriegsbeginn die Pressekonferenz für die Journalisten eigentlich keine wirkliche Konferenz mehr war, da nur noch die Anweisungen und Informationen aus den Ministerien und dem OKW vorgetragen wurden und sie somit „eher langweilig“ gewesen sei (vgl. S. 73ff.).
Nicht jede Redaktion hatte jedoch einen Korrespondenten in Berlin. Damit die An-weisungen Goebbels und Dietrichs sowie der anderen Ministerien auch die kleinen Provinz- und Heimatzeitungen erreichen konnten, wurde ein amtliches Protokoll erstellt, welches anschließend in der Presseabteilung gesammelt wurde. Hier lag es zur Einsicht bereit und diente als Grundlage für die Informationen, die dann an die kleinen Zeitungen übermittelt wurden. Dies geschah über die Reichspropagandaämter, die bereits im vorherigen Abschnitt erläutert wurden. Dort wurden noch lokale Informationen und Weisungen hinzugefügt und anschließend an die Hauptschriftleiter der Redaktionen übermittelt. Diese so genannten „Vertraulichen Informationen“ unterlagen eigentlich strengster Geheimhaltung und sollten nur von der Hauptschriftleitung und von Schriftleitern gelesen werden, die persönlich davon betroffen waren. Allerdings wurde diese Regelung in den Redaktionen nicht immer sehr streng gehandhabt. Aus diesem Grund wurden 1940 die Hauptschriftleiter dazu verpflichtet, ein Tagebuch über den Zugang und den Verbleib der „Vertraulichen Informationen“ zu führen (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 95).
Mit den „Vertraulichen Informationen“ hatte die NS-Führung in Partei und Staat die Möglichkeit, die Berichterstattung vor allem während des Krieges gezielt zu steuern. Da es aber, wie hier ausführlich dargestellt wurde, große Kompetenzstreitigkeiten verschiedener Personen und Ämter gab, kann von einer einheitlichen Steuerung von Presse und Rundfunk nicht gesprochen werden, wie sich auch bei der Berichterstattung über Stalingrad zeigen wird.
2.3. Die „Schlacht von Stalingrad“
Im Folgenden soll die allgemeine Forschungslage zur „Schlacht von Stalingrad“ exemplarisch dargestellt werden, um in der Analyse der „Bremervörder Zeitung“ nachvollziehen zu können, inwieweit die Berichterstattung von den in der Forschung herausgefundenen militärischen Begebenheiten abweicht.[21]
Der Vormarsch auf die Stadt an der Wolga begann im Sommer 1942, als die Heeresgruppe Süd zunächst in ihrer Gesamtheit den Angriff auf die südrussische Front startete. Sie wurde jedoch kurzfristig durch einen Befehl Hitlers in zwei separate Heeresgruppen aufgeteilt, um einen zeitgleichen Vormarsch zu den Ölvorkommen im Kaukasus (Heeresgruppe A) und der Industriestadt Stalingrad (Heeresgruppe B) zu erreichen. Der auf Stalingrad zumarschierenden Heeresgruppe mit der 6. Armee und der 4. Panzerarmee wurde dabei ein Großteil des für sie vorgesehenen Betriebsstoffes entzogen und für den Angriff auf den Kaukasus umgeleitet (vgl. Ueberschär 2003, S. 20f.). Ein weiterer Nachteil war laut Ueberschär, dass die Flanken während des Angriffs nur von ungenügend ausgerüsteten Truppen der mit Deutschland alliierten Italiener und Rumänen gesichert werden konnte (vgl. ebd.).
Auch die Taktik des Gegners sorgte dafür, dass die deutschen Verbände Stalingrad nicht so schnell wie von Hitler gedacht einnehmen konnten. Im Gegensatz zur deutschen Sommeroffensive im Jahr 1941 gingen die sowjetischen Truppen bei den Kämpfen, in denen die Deutschen überlegen waren, keine verlustreichen Schlachten mehr ein, sondern gewannen Zeit durch kleinere Gefechte, um sich geordnet zurückziehen zu können. Dadurch drangen die deutschen Truppen einerseits langsamer vor, andererseits verlor die sowjetische Armee nicht so viele Soldaten und Material und konnte dadurch neue Truppen heranführen und die Verteidigungsstellungen Stalingrads ausbauen (vgl. ebd.; Knjazkov 1992, S. 48ff.). Dennoch kam der Vormarsch auf die Wolgastadt zunächst relativ schnell voran und überschritt im August 1942 den Don.[22] Am 19. August gab der General der 6. Armee Paulus den Befehl zum Angriff auf Stalingrad, der einen Tag später begann. Schon nach wenigen Tagen erreichten die ersten Verbände die Wolga nördlich der Stadt und ab dem 30. August marschierte eine weitere Division von Süden her auf Stalingrad zu. Doch schon in der folgenden Zeit geriet der Angriff ins Stocken, denn nun begann der Kampf um die Verteidigungsstellungen im Raum von Stalingrad und in der Stadt selbst. Hier ging der Kampf nur sehr schleppend voran (vgl. Brendel 1985, S. 16).
Nachdem in den ersten Septemberwochen die massiven Bombardements begannen, rückten die deutschen Truppen in das Stadtgebiet ein. Dort geriet der Angriff einmal mehr ins Stocken, da die Stadt nur in Häuserkämpfen eingenommen werden konnte. Brendel zeichnet dabei ein charakteristisches Bild dieser Kämpfe. So konnte es bei der Unübersichtlichkeit der Fronten in der Stadt passieren, dass deutsche Truppen bereits im Keller eines Gebäudes saßen, während sowjetische Truppen den ersten Stock besetzt hielten (vgl. S. 17).
Ende September verlagerten sich die Kämpfe in den Nordteil der Stadt und Mitte Oktober begann eine dritte Offensive, diesmal gegen das Industriegebiet mit den Anlagen „Roter Oktober“, „Rote Barrikade“ und „Dscherschinski“. Bei beiden Offensiven ging es weiterhin nur sehr langsam vorwärts und die Stadt war immer noch nicht vollständig eingenommen (vgl. ebd). Hitler sprach in seiner Rede am 08. November zwar davon, dass die Stadt bald genommen sei und es nur so lange dauere, weil man kein zweites Verdun haben wolle, aber die tatsächliche Lage war eine andere (vgl. Kumpfmüller 1995, S. 39f.).
Statt einer baldigen Einnahme Stalingrads durch die 6. deutsche Armee sammelten die sowjetischen Streitkräfte neue Verbände, um eine Gegenoffensive zu starten, die lange Zeit sorgfältig vorbereitet und erfolgreich streng geheim gehalten wurde. Am 19. und 20. November begann die Rote Armee mit dem Unternehmen „Uranus“, durch welches die deutschen Truppen in Stalingrad eingeschlossen werden sollten. In einer großen Zangenbewegung griffen die sowjetischen Armeen die deutschen und verbündeten Verbände an den Flanken an und schlossen sie am 22. November vollständig ein. General Paulus gab keinen Befehl zum Ausbruch, obwohl sich Teile der Führung der 6. Armee dafür aussprachen. Er forderte zwar Handlungsfreiheit, doch Hitler verbot jeden Ausbruch und gab stattdessen den Befehl, sich in der Stadt „einzuigeln“. Paulus und der Chef des Generalstabes leisteten diesem Befehl Folge (vgl. Ueberschär 2003, S. 21ff.; Brendel 1985, S. 18f.).
Von diesem Zeitpunkt an sollte die eingeschlossene Armee durch die Luft versorgt werden. Die Luftwaffe unter Leitung Hermann Görings schaffte es jedoch nicht, eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten. Eigentlich hätten täglich 500 Tonnen an Brennstoff, Munition, Bekleidung und Verpflegung in den Kessel geflogen werden müssen (vgl. Ueberschär 2003, S. 24f.).[23] Tatsächlich konnten im Durchschnitt nur 116 Tonnen transportiert werden und an manchen Tagen war eine Luftversorgung nahezu unmöglich (vgl. Brendel 1985, S. 19). Die Luftbrücke sollte eigentlich nur vorübergehend sein, denn Hitler strebte eine Entsatzoffensive für die 6. Armee an, durch die ein Versorgungskorridor geschaffen werden sollte. Eine Aufgabe Stalingrads wurde von Hitler nicht in Erwägung gezogen (vgl. Ueberschär 2003, S. 24f.).
Die Entsatzoffensive „Wintergewitter“ startete am 12. Dezember unter der Leitung des Oberbefehlshabers der 4. Panzerarmee, Generaloberst Hoth. Diese sollte von außen zum Rand des Kessels vordringen. Da sie aber nur unzureichende Luftunterstützung bekam (vgl. Ueberschär 2003, S. 26), an starkem sowjetischen Widerstand scheiterte oder mangels eigener Stärke zusammenbrach, musste die Offensive abgebrochen werden. Außerdem bedrohte eine sowjetische Gegenoffensive die Front bei Rostow, welche einen völligen Einschluss der gesamten Kaukasus- und Wolga-Front zur Folge gehabt hätte (vgl. Brendel 1985, S. 20f.). Gleichzeitig sollte eigentlich die 6. Armee mit dem Unternehmen „Donnerschlag“ den Einschlussring von innen sprengen, wenn die 4. Panzerarmee nah genug an den Rand des Kessels vorgedrungen wäre. Da das „Wintergewitter“ bis zum 18. Dezember allerdings nur bis auf 48 km an den Kessel herankam und Hitler den einseitigen Ausbruch unter Aufgabe Stalingrads verbot, wurde die Entsatzoffensive am 23. Dezember abgebrochen, um eine andere Front zu stabilisieren. Bereits einen Tag später ging einer der wichtigsten Flugplätze für die Versorgung der 6. Armee im Kessel verloren (vgl. ebd.).
Die Lage der eingeschlossenen Soldaten verschlechterte sich nun zusehends. Durch die mangelhafte Luftversorgung ging der 6. Armee die Verpflegung aus. Außerdem waren die Soldaten nur unzureichend mit Winterkleidung ausgerüstet, so dass viele Soldaten nicht im Kampf, sondern an Erschöpfung starben oder erfroren (vgl. Ueberschär 2003, S. 29ff.). Die Rote Armee stellte den eingeschlossenen deutschen Truppen am 08. Januar 1943 ein Ultimatum zur „ehrenhaften“ Kapitulation, welches jedoch von der Führung der 6. Armee abgelehnt wurde. Zwei Tage später begann die Schlussoffensive der Sowjets, die nun konzentrisch angriffen und den Kessel somit immer weiter verkleinerten. In den nächsten Wochen gingen weitere Flugplätze verloren, bis am 22. Januar auch der letzte an die Rote Armee fiel. Eine Versorgung war ab diesem Zeitpunkt nur noch durch Verpflegungsbomben möglich, die ihr Ziel aber oft verfehlten (vgl. Brendel 1985, S. 22f.). In dieser Phase dachte das Armeeoberkommando in Stalingrad über eine Kapitulation nach. Doch auch diesmal verweigerte Hitler die Zustimmung. Die 6. Armee sollte „sich bis zuletzt“ (zit. nach Ueberschär 2003, S. 33) verteidigen. Wie schon kurz nach der Schließung des Kessels und bei der Entsatzoffensive gehorchte Paulus. Er rief seine Soldaten auf, „um jeden Fußbreit Boden zu kämpfen“ und „sich bis zum Äußersten zu wehren, sich unter keinen Umständen gefangen zu geben, sondern standzuhalten und zu siegen“ (zit. nach ebd., S. 34). Die Kämpfe dauerten weiter an.
In der letzten Phase der „Schlacht von Stalingrad“ rückten die sowjetischen Verbände immer weiter vor und verkleinerten somit den Kessel. Weiterhin wollte Paulus nicht den Befehl zur Gesamtkapitulation der 6. Armee geben. Er stellte es aber jetzt jedem Kommandierenden frei, eigenständig den Kampf einzustellen. Am 24. Januar 1943 wurde nach einem weiteren Vorstoß der Gesamtkessel in zwei Teilkessel aufgeteilt, die in den folgenden Tagen einzeln kapitulierten. Im südlichen Teilkessel wurden die Kampfhandlungen am 31. Januar 1943 unter dem Befehl des zu diesem Zeitpunkt bereits zum Generalfeldmarschall beförderten Paulus eingestellt.[24] Am 02. Februar 1943 kapitulierte schließlich auch der Nordkessel unter General Strecker. Im Kessel von Stalingrad starben über 80.000 Soldaten, 25.000 wurden ausgeflogen und 90.000 bis 180.000 Soldaten gerieten in sowjetische Gefangenschaft,[25] von denen nur etwa 6.000 Soldaten wieder nach Deutschland zurückkehrten (vgl. Brendel 1985, S. 24; Lehmann 2003, S. 179).
2.4. Die Bremervörder Zeitung
Die „Bremervörder Zeitung“ [26] war im Gegensatz zu den größeren Zeitungen im Nationalsozialismus[27] bislang nur einmal ausführlicher Teil einer Forschungsarbeit. In seinem Buch über die nordostniedersächsischen Tageszeitungen widmet sich Peter Stein 1994 auch dem Zeitungsort Bremervörde und darin der „Bremervörder Zeitung“. Ansonsten beschränkt sich die Forschungslage nur auf die allgemeine Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung sowie auf einzelne Hinweise zur allgemeinen Situation und Bedeutung der Lokal-, Provinz- bzw. Heimatzeitung. Dennoch lassen sich durch die Forschung von Stein sowie durch zeitungseigene Angaben auf der Homepage der BZ und in Jubiläumsausgaben Rückschlüsse auf die Entstehungsbedingungen während der NS-Zeit sowie auf das Selbstverständnis vor und während der Nazi-Diktatur schließen.
Zum ersten Mal erschien die BZ im Dezember 1853 als „Wochenblatt für die Amtsgerichtsbezirke Bremervörde, Beverstedt und Zeven“. In den folgenden Jahren änderte sie mehrfach ihren Namen, um von 1857 bis ins Jahr 1911 als „Hannoverscher Volksbote“, ab 1855 zusätzlich als offizielles Kreisblatt zu erscheinen. Mit dem Namen „Hannoverscher Volksbote“ lässt sich auch das Selbstverständnis des ab 1911 „Bremervörder Zeitung“ heißenden Blattes beschreiben (vgl. Stein 1994, S. 388). Wie die anderen Blätter in der Region kann auch die BZ bis zur NS-Diktatur als bürgerliche Heimatzeitung[28] für den zum ehemaligen Königreich Hannover bzw. den dann zur preußischen Provinz gehörenden Kreis Bremervörde[29] verstanden werden.
Veranlasst hatte die Umbenennung in „Bremervörder Zeitung“ der neue Verleger Bernhard Borgardt, der aus dem ungefähr 40 Kilometer entfernten Neuhaus/Oste nach Bremervörde kam und auch die Erscheinungsweise von viermal wöchentlich in werktäglich änderte (vgl. Stein 1994, S. 131ff.). Seit diesem Zeitpunkt ist die Familie Borgardt formell im Besitz des Blattes. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam es aber zu einem Vorfall, der für die Entstehungsbedingungen während der Berichterstattung über Stalingrad entscheidend ist.
Um diesen Vorfall näher zu beleuchten, muss ein kurzer Blick in die Geschichte der Re-gion und insbesondere der BZ in der Weimarer Republik geworfen werden. In dieser Phase ließen sich vor allem die Kreiszeitungen in Nordostniedersachsen als bürgerlich charakterisieren. Sie konnten zwar keiner bürgerlichen Partei direkt zugeordnet werden, waren dennoch nicht wirklich überparteilich (vgl. Stein 1994, S. 75). Es ist aber festzuhalten, dass diese Region im Nordosten Niedersachsens welfisch geprägt war, was durch den vorherigen Namen der BZ ebenfalls zum Ausdruck kommt. Politisch gesehen war die Region während der Weimarer Republik eine Hochburg der „Deutsch-Hannoverschen Partei“.[30] Die BZ bezeichnete sich zu Beginn der Weimarer Republik zeitweilig selber als „deutsch-völkisch“, später als „bürgerlich“. Im Untertitel hieß die BZ ab September 1921 „Unabhängige Tageszeitung für nationale Politik“. Außerdem trat sie bei den Wahlen zum Reichspräsidenten 1925 und 1932 für Hindenburg ein (vgl. Stein 1994, S. 134).
Ab dem Jahr 1928 wurde der Raum Bremervörde zu einer Hochburg der Nationalsozialisten im damaligen Regierungsbezirk Stade und auch die BZ rückte weiter nach rechts. Stein beschreibt ihr Auftreten als stark antisozialistisch und deutschnational (vgl. Stein 1994, S. 132). Nachdem die BZ im September 1931 ihren Kreisblatt-Status verlor, favorisierte sie eine autoritäre Lösung jenseits der parlamentarischen Demokratie. Dies tat sie unter Hinweis auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Bauern (vgl. ebd.). Dabei stand sie jedoch nicht der NSDAP-Führung nahe, sondern übte „unverblümt Kritik an der Gau-NSDAP“ (Stein 1994, S. 134). Der Verleger und damalige Schriftleiter Borgardt unterstützte vielmehr den Bremervörder Arzt Dr. Günther von Heyman, der bis zum Sommer 1932 als Reichsredner für die NSDAP und Funktionär für „rassenhygienische Fragen“ umher reiste, sich dann aber mit dem Gauleiter für Osthannover, Telschow, überwarf. Heyman trat zur „Schwarzen Front“[31] Otto Strassers über, schrieb einen offenen Brief an Hitler und organisierte eine Rede Strassers in Bremervörde am 21. Oktober 1932 (vgl. ebd., S. 132). Diese erregte laut Stein „fast mehr Aufsehen als Hitlers Erscheinen eine Woche später“ (ebd.). Borgardt schuf mit der BZ eine Plattform für Heyman und hielt zu ihm. Damit hatte er allerdings die Rache des bald siegreichen Gauleiters auf sich gezogen. Dieser sorgte nach der Machtübernahme dafür, dass die BZ Konkurrenz von dem „Bremervörder Tageblatt“ bekam, einer Nebenausgabe der NS-Zeitung „Hamburger Tageblatt“. Die Gauleitung verschärfte immer weiter den Druck, bis die BZ zugunsten des NS-Blattes am 01. März 1934 eingestellt werden musste. Da das „Bremervörder Tageblatt“ wirtschaftlich erfolglos war, wurde es bereits am 28.02.1935 wieder eingestellt und es kam zu Rückgabeverhandlungen mit der Reichspressekammer und dem Verlegerverband (vgl. ebd., S. 132f. et Borgardt 1978, S.1). Die führten dazu, dass die BZ wieder erscheinen durfte. Allerdings musste Bernhard Borgardt das Verlagsrecht an seine beiden minderjährigen Söhne abtreten. Der Verlag wurde nun in Pflegschaft von dem ortsansässigen Rechtsanwalt Mahler geführt (vgl. Staatsarchiv Stade, Rep. 180 G Nr. 222).[32] Somit hatte der einstige Verleger zwar das Mitspracherecht im Verlag verloren, blieb aber zumindest im formellen Besitz des Unternehmens. Die damaligen Schriftleiter wurden nun von der Gaupropagandaleitung bestellt (vgl. Borgardt 1978, S. 1). Erst nach Kriegsende wurde der Verlag samt Zeitung wieder vollständig der Familie Borgardt zurückgegeben (ebd.).
Während der Weimarer Republik bezog die BZ den im Abschnitt über die NS-Presse bereits erwähnten Nachrichtendienst TU des deutsch-nationalen Medienmoguls Alfred Hugenberg (vgl. Stein 1994, S. 134). Nach der „Machtergreifung“ durch die Nationalsozialisten erhielt die BZ wie alle Zeitungen den DNB-Nachrichtendienst. Außerdem richtete die Gauleitung im Oktober 1937 in Lüneburg den kostenlosen, so genannten „Nationalsozialistischen Gaudienst“ (NSG) ein, womit eine genuine Berichterstattung in sämtlichen Zeitungen des Gaues sichergestellt werden sollte. Anfangs erschien der NSG dreimal wöchentlich, später täglich. Mit der Einrichtung eines Schnelldienstes des NSG seien, laut Stein, die Presseinformationen im Gau Osthannover vollends monopolisiert worden (vgl. S. 87f.). Außerdem stellt Stein fest, dass die Taktik, die bestehende bürgerliche Presse nicht durch eine nationalsozialistische zu ersetzen, sondern „dienstbar“ zu machen, wie es der Reichspressechef Dietrich betont hatte, auch vom Gauleiter Telschow in Osthannover angewandt wurde. Er habe nämlich nichts dafür getan, eine nationalsozialistische Tagespresse aufzubauen (vgl. S. 82).
Es bleibt festzuhalten, dass die BZ während der Berichterstattung über Stalingrad nur noch offiziell eine eigenständige Zeitung war. Das Verlagsrecht hatten zwar die minderjährigen Söhne des alten Verlegers Bernhard Borgardt, aber ausüben konnten sie es selber nicht. Wegen des Bezugs der nationalsozialistischen Nachrichtendienste DNB und NSG und wegen der durch die Gauleitung eingesetzten Schriftleiter kann von einer gleichgeschalteten Berichterstattung ausgegangen werden. Wie bzw. ob sich dies auf die Berichterstattung über die Schlacht von Stalingrad ausgewirkt hat, wird die folgende Analyse zeigen.
3. Methodik
Im vorigen Abschnitt wurde dargestellt, unter welchen Entstehungsbedingungen die Berichterstattung über Stalingrad in der BZ stattfand. Um nun jedoch präzisere Rückschlüsse von den Auswirkungen der Entstehungsbedingungen auf die Berichterstattung schließen zu können, musste die BZ genauer untersucht werden. Dafür wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse[33] gewählt. Im Folgenden soll zunächst die Bedeutung dieser Methode für die Erforschung von Medieninhalten wiedergegeben werden, um anschließend das konkrete Vorgehen in dieser Arbeit aufzuzeigen.
„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen [...].“ (Früh 1998, S. 25)
So definiert Werner Früh die Inhaltsanalyse in einem der beiden deutschen „Standard-Lehrbücher“[34] für diese Methode (vgl. Maurer/Reinemann 2006, S.11). Damit werden auch die drei besonderen Eigenschaften einer Inhaltsanalyse deutlich. Sie ist erstens eine empirische Methode, zweitens muss sie systematisch durchgeführt werden und drittens intersubjektiv nachprüfbar sein (vgl. Maurer/Reinemann 2006, S. 35). Mayring erweitert in seinem Lehrbuch den Kreis der Bedingungen für eine qualitative Inhaltsanalyse[35] um drei Punkte. Er stellt fest, dass eine Inhaltsanalyse „Kommunikation analysieren“ wolle, welche in irgendeiner Form bereits protokolliert vorliege. Außerdem müsse, wie Früh es schreibt, „systematisch“ vorgegangen werden, das heißt, dass es nicht zu einer freien Interpretation des Materials kommen soll. Dafür müsse wiederum „regelgeleitet“ gearbeitet werden, was bedeutet, dass gewisse Standards und Regeln eingehalten werden, um die intersubjektive Nachprüfbarkeit zu gewährleisten. Außerdem müsse sie „theoriegeleitet“ sein, was wiederum bedeutet, dass es nicht darum geht, einen Text zu referieren, sondern dass hinter der Inhaltsanalyse eine Fragestellung steht, die an die Erfahrungen anderer Forscher zu dieser Thematik anknüpft (vgl. Mayring 2008a, S. 12f.). Als letzten Punkt nennt Mayring das Hauptziel einer Inhaltsanalyse. Es ginge bei dieser Methode vor allem darum, „Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation“ zu ziehen (ebd.).
Früh unterscheidet die Art der Rückschlüsse in drei verschiedene Ansätze. So ist es möglich, einen diagnostischen, einen prognostischen oder einen formal-deskriptiven Ansatz[36] zu verfolgen. Früh charakterisiert den diagnostischen Ansatz als Herangehensweise, der „etwas über die Entstehungsbedingungen, also über die Beziehung Kommunikator – Mitteilung aussagen“ möchte (1998, S. 42). Dabei stehen die Fragen im Vordergrund, was beispielsweise der Autor des Textes mitteilen möchte, welche Wirkungen er erzielen möchte oder welche Wertvorstellungen er besitzt. Der Kommunikator muss dabei kein einzelner Autor, sondern kann auch ein Autorenteam sein. Bei dem prognostischen Ansatz wird hingegen das Hauptaugenmerk nicht auf die Entstehungsbedingungen gelegt, sondern vielmehr auf die Wirkung beim Rezipienten (vgl. ebd.). Die Möglichkeit vom untersuchten Material auf die Wirkung beim Rezipienten zu schließen, wird jedoch von Claudia Wegener in Frage gestellt. Sie meint, dass sich „die Wirkung eines medialen Stimulus“ nur schwer vorhersagen lässt, da dafür mehr Informationen über den Rezipienten, wie zu dessen kognitiver Kompetenz, aktuellen Stimmungs- und Gefühlslagen usw., vorliegen müssten (vgl. Wegener 2005, S. 205).
Nachdem bereits die Inhaltsanalyse im Allgemeinen und ihre verschiedenen Ansätze erläutert wurden, soll nun ein kurzer Blick auf die Besonderheiten einer qualitativen Inhaltsanalyse gelegt werden. Mayring beschreibt in seinem Lehrbuch den Unterschied zwischen qualitativem und quantitativem Vorgehen in verschiedenen Punkten, von denen exemplarisch die Wichtigsten aufgeführt werden sollen.[37]
Eine wichtige Unterscheidung liegt im Skalenniveau begründet. So kann bei einer rein qualitativen Analyse nur eine Nominalskala verwendet werden, wohingegen bei einer quantitativen Analyse die Möglichkeit besteht, die Daten je nach Messverfahren auf einer Ordinal-, Intervall- oder Ratio-Skala[38] abzubilden (vgl. Mayring 2008a, S. 17). Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal besteht im wissenschaftlichen Selbstverständnis quantitativer bzw. qualitativer Forschung. Hier bestehen unterschiedliche Auffassungen, was den Analysegegenstand angeht. Als ein Beispiel für das „implizite Merkmal ihres Wissenschaftsverständnisses“ (Mayring 2008a, S. 18) nennt Mayring die Einzelfallorientierung qualitativer Forschung, wohingegen die quantitative Forschung darin keine Verallgemeinerungsmöglichkeit sieht und deshalb eine repräsentative Stichprobe anstrebt, welche die Grundgesamtheit abbildet (vgl. ebd.).
Die qualitative Inhaltsanalyse will sich diese vermeintlichen Gegensätze jedoch zunutze machen und zu einem stringenten und effektiven Vorgehen führen.
„Der Grundgedanke einer qualitativen Inhaltsanalyse [Hervorhebung durch Mayring] besteht [...] darin, die Systematik [...] der Inhaltsanalyse für qualitative Analyseschritte beizubehalten, ohne vorschnelle Quantifizierungen vorzunehmen.“ (Mayring 2009, S. 469)
So beschreibt Mayring die Besonderheiten der qualitativen Inhaltsanalyse. Für ihn ist es kein Widerspruch, gleichzeitig qualitativ und quantitativ zu arbeiten. Ihm zufolge steht am Anfang eines jeden wissenschaftlichen Vorgehens – womit explizit auch quantitative Studien gemeint sind – ein qualitativer Schritt, da man erst wissen müsse, was man eigentlich untersuchen will. Anschließend müsse man es konkret benennen. Dieser Schritt entspreche somit schon dem Nominalskalenniveau, da man das Material in zwei Kategorien – wird untersucht vs. wird nicht untersucht – eingrenzt. Genau dieses Vorgehen erfolgt auch bei der Inhaltsanalyse in Form der Erstellung des Kategoriensystems (vgl. Mayring 2008a, S. 19). Zunächst muss nämlich festgelegt werden, was und wie es untersucht werden soll. Es muss passend zum Material erstellt und ausprobiert werden. Mayring beschreibt dies als den „Hauptbestandteil inhaltsanalytischer Arbeit“ und sagt, dass es "ein Vorgehen [sei], das eindeutig qualitativer Art“ sei (ebd.). Erst durch diesen Schritt könnten quantitative Methoden angewandt werden, falls sie überhaupt angewendet werden sollen.
Oft werde nicht erkannt, dass schon das Eingrenzen des Materials und die Auswahl der Kategorien ein qualitativer Schritt sei. Mayring spricht in diesem Zusammenhang von der „Krux der quantitative[n] Analyse“ (ebd.). Er führt weiter an, dass die gewonnenen quantitativen Erkenntnisse wieder zurückgeführt werden müssten auf die ursprüngliche Fragestellung. Auch der Satz des Sozialwissenschaftlers Anderson aus den 1970er Jahren zeige das qualitative Vorgehen bei quantitativer Forschung: „Zahlen sprechen niemals für sich selbst. Sie müssen immer interpretiert werden“ (zit. nach Mayring 2008a, S. 19). Mayring fasst abschließend zusammen, dass ein Forschungsprozess immer folgendermaßen ablaufe: „Von der Qualität zur Quantität und wieder zur Qualität.“ (Mayring 2008a, S. 19).
Somit ist die qualitative Inhaltsanalyse kein Gegensatz zu einer vormals quantitativen Methode, sondern vielmehr eine logische Begründung des qualitativen Vorgehens um sinnvoll zu einem Kategoriensystem zu kommen, ohne dabei die quantitative Systematik und Nachprüfbarkeit aus den Augen zu verlieren.
Die Erstellung des Kategoriensystems ist somit, neben der Festlegung auf das zu unter-suchende Ausgangsmaterial, für das Gelingen der Inhaltsanalyse von großer Bedeutung[39]. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Vorgehensweisen, die induktive und die deduktive Kategorienbildung. Die eher klassische Vorgehensweise, vor allem bei rein quantitativen Analysen, ist die deduktive. Hier werden die Kategorien durch theoretische Überlegungen definiert. Dabei spielen Voruntersuchungen, der Forschungsstand, neue Theorien etc. eine große Rolle (vgl. Mayring 2008a, S. 74).
Im Gegensatz dazu werden bei der induktiven Vorgehensweise die Ausprägungen der Kategorien „direkt aus dem Material in einem Verallgemeinerungsprozeß“ (Mayring 2008a, S. 75) gebildet. Dabei wird im Gegensatz zum deduktiven Vorgehen vorher kein umfangreiches Theorienkonzept aufgestellt, sondern in einem ersten Durcharbeiten des Materials entweder Ausprägungen in einer bestehenden Kategorie subsumiert oder eine neue Kategorie gebildet. Laut Mayring ist diese Vorgehensweise vor allem für die qualitative Inhaltsanalyse von großem Nutzen, da sie „eine[...] möglichst naturalistische[...], gegenstandsnahe[...] Abbildung des Materials ohne Verzerrung durch Vorannahmen des Forschers“ anstrebe (2008a, S. 74f.) Dies beinhalte aber nicht, dass die Analyse frei von jedem Standard sei, da das Material und das allgemeine Thema der Kategorienbildung weiterhin theoriegeleitet ausgewählt werden müsse (vgl. Mayring 2008b, S. 11f.).
In der vorliegenden Arbeit soll bekanntlich der Frage nachgegangen werden, wie über die Kämpfe in Stalingrad in der „Bremervörder Zeitung“ berichtet wurde. Dabei ist die Orientierung an anderen Forschungsarbeiten und Theorien nur sehr begrenzt möglich. Aus diesem Grund ist es äußerst sinnvoll, eine qualitative Inhaltsanalyse durchzuführen, die durch eine induktive Kategorienbildung entstanden ist. Dadurch ist es möglich, die quantitativen Methoden des Auszählens von Häufigkeiten mit der qualitativen Methodik der freieren Bestimmung der Kategorien zu verbinden. Vor allem die induktive Kategorienbildung unterstützt dieses Vorhaben, da keine weiteren Vorannahmen in die Kategorien mit einfließen, sondern sie aus dem Material heraus entstehen. Dennoch wird dabei die Fragestellung immer berücksichtigt.
Da die Inhaltsanalyse, wie bereits erwähnt, per Definition systematisch durchgeführt und intersubjektiv nachprüfbar sein muss, soll nun die Vorgehensweise in der Analyse der BZ erläutert werden. In der für diese Arbeit zugrundeliegenden Inhaltsanalyse flossen die Ausgaben der BZ vom 24. August 1942 bis zum 13. Februar 1943 ein, welche in der Universitätsbibliothek Lüneburg auf Mikrofilm vollständig erhalten sind. Der Erhebungszeitraum wurde dabei nach qualitativen Maßstäben ausgewählt. So wurde der Anfangspunkt des Erhebungszeitraums gewählt, weil der Name Stalingrad dort das erste Mal in einem Bericht auftaucht, der sich direkt auf die Kämpfe um Stalingrad bezieht und nicht nur als Orientierung für die Leser dient.[40] Der Endpunkt wurde hingegen gewählt, weil ab diesem Zeitpunkt die Berichte über die Kämpfe in Stalingrad zu ihrem Ende kommen.[41]
Insgesamt erschienen im Erhebungszeitraum 146 Ausgaben. Eine durchschnittliche Ausgabe der BZ während der Berichterstattung über Stalingrad hatte von Montag bis Freitag den Umfang von vier Seiten. Zwei Seiten enthielten dabei Artikel aus der überregionalen Berichterstattung, und zwei waren für den Lokalteil sowie für Werbeanzeigen und einen Fortsetzungsroman bestimmt. Diese Aufteilung konnte je nach aktuellem Nachrichtenstand variieren. Die Wochenendausgaben hatten hingegen einen Umfang von sieben bis acht Seiten. Der Umfang des überregionalen Teils blieb dabei gleich. Im Lokalteil wurden hingegen deutlich mehr Berichte und Reportagen sowie Geschichten aus der Region abgedruckt. Hinzu kamen zudem Fotos von den Kriegsfronten.[42] Für die Analyse waren jene Ausgaben relevant, die mindestens einmal das Wort „Stalingrad“ enthielten. Diese mussten entweder im überregionalen Teil der BZ oder im Lokalteil abgedruckt worden sein.[43]
Für die vorliegende Arbeit wurde der diagnostische Ansatz nach Früh gewählt. Wie bereits im Abschnitt über den Forschungsstand beschrieben, sind die Entstehungsbedingungen der BZ sehr charakteristisch für die Zeit des Nationalsozialismus. Da die bereits beschriebenen Restriktionen im Nationalsozialismus großen Einfluss auf die Berichterstattung hatten, lässt sich bei dieser Analyse allerdings nicht direkt auf die konkrete Sicht und Meinung der Schriftleiter in der BZ schließen. Vielmehr soll diese Inhaltsanalyse dazu dienen, die Strategie der NS-Propaganda und die Umsetzung dieser Vorgaben zu unter-suchen.
Der prognostische Ansatz soll hier nicht gänzlich ausgeklammert werden. Er spielt bei der Kategorienbildung jedoch zunächst eine untergeordnete Rolle, da er im vorliegenden Fall deutlich interpretativer wäre als der diagnostische Ansatz. Es kann nämlich nicht sauber nachgewiesen werden, aus welchen weiteren Quellen sich die Leser ihre Informationen geholt haben. Dennoch wird bei der Auswertung der Ergebnisse immer wieder die mutmaßliche Wirkung beim Leser interpretiert.
Als nächster Schritt wurde der Erhebungszeitraum rein quantitativ auf die verschiedenen Veröffentlichungsformen untersucht, wie beispielsweise Artikel, Artikelüberschrift, Foto mit Bildunterschrift (kurz: BU) zu Stalingrad. Dabei ging es noch nicht um eine induktive Kategorienbildung, sondern um eine rein quantitative Erhebung. Sobald das Wort „Stalingrad“ in einer der Formen erwähnt wurde, wurde es in der Statistik erfasst. Darüber hinaus wurden für die erfassten Artikel die Formen im Speziellen[44] systematisiert und den verschiedenen Kategorien zugeordnet. Außerdem wurden der grobe Umfang des Abschnittes über Stalingrad[45], die Länge des Artikels/des Abschnittes in Zeilen sowie die Häufigkeit der Nennung des Namens „Stalingrad“ erfasst.
Das Kategoriensystem, welches zur weiteren Untersuchung des erhobenen Materials benötigt wurde, entstand dann durch eine induktive Kategorienbildung. Zunächst wurden weitere Oberkategorien gebildet, die nun die Qualität der einzelnen Artikel abbilden sollten. Zu diesen zählten die Rolle der Soldaten als Angreifer oder Verteidiger, der Raum, in dem gekämpft wurde, die Verwendung von rhetorischen Mitteln, die Verwendung des Namens „Stalingrad“, die Nennung von Verlustzahlen, die Darstellung des Feindes, sowie der Grad der Emotionalisierung in den Artikeln.
Anschließend wurde das Material durchgearbeitet und die Kategorien spezifiziert. So wurden bspw. bei der Ausprägung der Emotionalisierung der Artikel schrittweise verschiedene Ausprägungen erkannt, zu Merkmalen einer Kategorie zusammengefasst und mit Code-Wörtern definiert.[46] Dieses Vorgehen wurde ebenfalls für die anderen Oberkategorien gewählt, sodass am Ende ein Kategoriensystem entstand, welches die gesamte Bandbreite der Artikelausprägungen erfasste. Dieses Kategoriensystem[47] wurde anschließend noch einmal detailliert auf die Artikel angewendet. So entstanden die Ergebnisse für die anschließende Auswertung.
Um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verifizieren, wurde außerdem eine Intrakoder-Reliabilitätsprüfung durchgeführt. Dafür wurden vom Hauptkodierer stichprobenartig einzelne Ausgaben ein zweites Mal ausgewertet. Anschließend wurden die Ergebnisse der Stichprobe mit denen der umfangreichen Auswertung verglichen. Die Reliabilität lag dabei bei über 94 Prozent. Eine Interkoder-Reliabilitätsprüfung wurde nicht durchgeführt, da dies für den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit zu umfangreich gewesen wäre. Zudem wird dieser Prüfung in Teilen der Forschung wenig Aussagekraft im Hinblick auf qualitative Inhaltsanalysen beigemessen, da es bei qualitativen Methoden sehr viel stärker zu unterschiedlichen Interpretationen der Kategorien kommen kann als bei quantitativen Methoden (vgl. Mayring 2008b, S. 12f.).[48]
Nach der Durchführung der Analyse wurden abschließend die Ergebnisse umfangreich im Hinblick auf die Fragestellung und die Entstehungsbedingungen interpretiert. Dabei haben sich fünf entscheidende Ergebnisse herausgebildet, welche im Folgenden ausführlich erläutert werden. Zunächst wird das wichtigste Merkmal vorgestellt, die Einteilung der Berichterstattung in Phasen. Anschließend werden, aufbauend auf den Phasen der Berichterstattung, die Modifikation des Raumes, der Wandel des Soldatenbildes und die Art und Weise der Berichterstattung wiedergegeben. Abschließend wird ein Blick auf die beson-dere Funktion der Berichterstattung gelegt.
4. Die vier Phasen der Berichterstattung
Eine der grundlegendsten Erkenntnisse dieser Inhaltsanalyse ist die Tatsache, dass die Berichterstattung über Stalingrad in der „Bremervörder Zeitung“ in vier Phasen eingeteilt werden kann. Dies lässt sich zum einen quantitativ, zum anderen qualitativ anhand von Schlüsselwörtern und besonderen Ereignissen belegen.
In den folgenden vier Abschnitten sollen die Phasen einzeln vorgestellt und erläutert werden. Außerdem werden die quantitativen Ergebnisse der Inhaltsanalyse wie die Zahl und Länge der Artikel, die Häufigkeit der Nennung des Namens „Stalingrad“ sowie die Artikelgattung dargestellt.
4.1. Phase 1
„Unterdessen geht das räumlich und menschenmäßig umfangreiche Ringen um Stalingrad unaufhörlich weiter.“ („Zwischen Kaukasus und Wolgaknie“, BZ, 88. Jg., Nr. 197)[49]
Mit diesen Worten begann die „Bremervörder Zeitung“ in der Ausgabe vom 24. August 1942 ihre Berichterstattung über die Kämpfe um Stalingrad, womit zugleich die erste Phase der Berichterstattung begann.[50] In einem Übersichtsartikel über die verschiedenen Kämpfe an der Ostfront wurde in zwei Absätzen geschildert, wie die deutschen Verbände weiter in Richtung Stalingrad vorrückten. In dieser Ausgabe stellte die Meldung noch eine Randnotiz dar, aber bereits am nächsten Tag rückte die Wolgastadt in den Mittelpunkt der Berichterstattung. Die gesamte Ausgabe wurde mit „Der Don nordwestlich Stalingrad überschritten“ (BZ, 88. Jg., Nr. 198 v. 25. August 1942) überschrieben. Diese Veröffentlichungsform stellte eine Besonderheit der BZ dar, für die es notwendig ist, sie im folgenden Absatz näher zu erläutern.
Im Gegensatz zu heutigen Lokalzeitungen war die auffälligste und größte Überschrift nicht einem Artikel zugeordnet, sondern stand für sich alleine direkt unter Zeitungstitel und Datum. Sie wirkte wie eine Schlagzeile großer Boulevard-Blätter und verwies auf einen Artikel in der Ausgabe, in dem die Thematik der Schlagzeile noch einmal aufgegriffen wurde. Im Folgenden soll für diese Form der Schlagzeile der Begriff „Ausgaben-Titel“ verwendet werden. Da dieser eine hervorgehobene Stellung in der Berichterstattung hatte, ist er für die Analyse besonders wichtig. So betitelte die Bremervörder Zeitung in der ersten Phase der Berichterstattung fast die Hälfte ihrer Ausgaben mit „Stalingrad“. Bei 18 Ausgaben bis zum 14. September widmeten sich acht Ausgaben den Kämpfen um Stalingrad. Welche dies im Einzelnen sind, soll an dieser Stelle noch nicht näher vorgestellt werden. Zunächst wird vielmehr die erste Phase weiter erläutert.
Die Aufmachung am 25. August, in der Stalingrad das erste Mal im Ausgaben-Titel erschien, wurde durch einen Artikel unterstützt, der sich ausschließlich mit internationalen Pressestimmen zur Lage Stalingrads auseinandersetzte. Überschrieben mit „Kritisches Stadium für Stalingrad“ wies er auf die Sorge im feindlichen Ausland hin, dass die deutschen Truppen Stalingrad einnehmen könnten. Dabei steht dieser Artikel sinnbildlich für die Funktion der internationalen Pressestimmen in der ersten Phase der Berichterstattung. Sie sollten die euphorische Stimmung in den von deutscher Seite verfassten Artikeln legitimieren, indem sie die Sorgen und Ängste der feindlichen Länder über einen baldigen Fall Stalingrads wiedergaben. So heißt es in dem gerade erwähnten Artikel:
„‚Die Schlacht von Stalingrad ist in ein für die Sowjets kritisches Stadium getreten. [...] Der deutsche Einbruch stellt fraglos eine ernste Bedrohung dar,‘ heißt es in einem [englischen] Bericht. [...] Selbst Moskau muß die neuen deutschen Erfolge zugeben und erklärt, es sei ‚dem Feind gelungen, einen Keil in unsere Linien zu schlagen.‘ Die Sowjets seien in erbitterte Kämpfe verwickelt.“ (BZ, 88. Jg., Nr. 198)
Hier zeigt sich, wie die internationalen Meldungen dazu genutzt wurden, den deutschen Vormarsch in ein noch besseres Licht zu rücken. Die BZ verwendete Autoritätsargumente, um die eigenen Meldungen zu untermauern. Denn wenn selbst die gegnerischen Zeitungen und Offiziellen von einem „kritische[n] Stadium für Stalingrad“ sprachen, konnten die Leser mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Berichte der Wahrheit entsprachen.
Ein weiteres wichtiges Merkmal der ersten Phase zeigt sich ebenfalls ab dieser Ausgabe, da von nun an Stalingrad regelmäßig in den Meldungen des OKW-Berichts[51] erschien. Auf der ersten Seite wurde den Kämpfen um die Wolgastadt ein längerer Absatz gewidmet, in dem gemeldet wurde, dass deutsche Truppen den Don „nordwestlich Stalingrad“ überschritten hätten und weiter Richtung Osten vorgerückt seien (vgl. „Sowjetluftwaffe verlor 157 Flugzeuge“, ebd.).
Der weitere Verlauf dieser Phase war einerseits von Erfolgsmeldungen geprägt, welche eine Einnahme von Stalingrad nur als eine Frage der Zeit wirken ließen. Andererseits wurde immer wieder die Schwere der Kämpfe betont, wie am 31. August, als von „harte[n] Kämpfe[n]“ („Stellungen im Raum Stalingrad durchstoßen“, BZ, 88. Jg., Nr. 203) die Rede war, oder am 09. September, als die „erbitterte[n] Kämpfe“ („Schwerste Panzerverluste der Sowjets“, BZ, 88. Jg., Nr. 211) geschildert wurden.[52] Grundsätzlich kann gesagt werden, dass auf der einen Seite die Euphorie, die unter anderem durch die internationalen Pressestimmen unterstützt wurde, sowie die Zurückhaltung und Betonung der Härte der Kämpfe auf der anderen Seite die unterschiedlichen Auffassungen in der NS-Führung zu dieser Zeit widerspiegeln. Der Reichspropagandaminister Josef Goebbels wünschte sich nach der Niederlage vor Moskau im Sommer 1941, bei welcher der Fall der sowjetischen Hauptstadt sehr optimistisch vorausgesagt worden war, die Propaganda im Jahr 1942 zurückhaltender. Bereits im April 1942 erklärte er in einer Ministerkonferenz: „Die Kommentare hätten die Aufgabe, mehr abzudämpfen, als aufzustacheln.“ (zit. nach Brendel 1985, S. 25) Als dann Ende August die Kämpfe um Stalingrad in den Fokus der Öffentlichkeit rückten, wies Goebbels wiederholt darauf hin, dass der Name „Stalingrad“ mit Vorsicht gebraucht werden solle, da er bei der Bevölkerung eine hohe Bedeutung hätte. Es sollten jene Erwartungen gedämpft werden, die von einem raschen Sieg bei Stalingrad ausgingen. So hieß es noch vor der ersten Erwähnung der Kämpfe um Stalingrad am 22. August 1942 in seiner Ministerkonferenz:
„Das Thema Stalingrad darf nicht angeschnitten werden. Man könne heute noch nicht voraussagen, wie lange es dauern würde, bis die Stadt in deutschen Händen ist, und es sei nicht tragbar, wenn man heute schon auf die Operationen hinweist.“ (zit. nach Boelcke 1989, S. 275)
Einen Tag später wies Goebbels darauf hin, dass der Name Stalingrad erst erwähnt werden dürfe, wenn er auch im OKW-Bericht genannt würde (vgl. ebd.). Dies war in der BZ jedoch nicht der Fall, denn hier wurde Stalingrad bekanntlich bereits am 24. August in einem Überblicksartikel über die Kämpfe an der Ostfront erwähnt. Allerdings ist davon auszugehen, dass der bereits geschilderte Artikel am 24. August von der obersten Propaganda gewollt war. Der Artikel wurde zwar nicht als offizieller OKW-Bericht veröffentlicht, ist aber vermutlich ebenfalls von der Abteilung WPr des OKW verfasst worden.
Wie hoch die Bedeutung des Namens „Stalingrad“ für die NS-Führung wirklich war, zeigt ein am 29. August 1942 erschienener langer einspaltiger Artikel, der auf Seite 1 beginnt und auf Seite 2 fortgesetzt wird. In diesem wurde Stalingrad bereits als „Schlüsselstadt“ bezeichnet und umfangreich über die strategische Bedeutung der Wolgastadt berichtet. Dort heißt es unter anderem:
„Es geht bei Stalingrad, das im Mittelpunkt dieser Kämpfe steht, tatsächlich um mehr als um eine Stadt – es geht um eine strategische und verkehrstechnische Position, die für den Fortgang des Feldzuges im Osten von ausschlaggebender Bedeutung ist. Es geht hier aber auch – wenigstens für die Bolschewisten – um ein Symbol, um Stalingrad als Sinnbild des Sowjetregimes.“ („Schlüsselstadt Stalingrad“, BZ, 88. Jg., Nr. 202)
Hier wird deutlich, dass die von Goebbels geforderte Zurückhaltung in der Presse kaum umgesetzt wurde, sondern sich eher die Meinung des Reichspressechefs Dietrich durchsetzte, der bereits im September mit dem Fall der Wolgastadt rechnete (vgl. Brendel 1985, S. 42). Der Stellenwert der Stadt wurde somit bereits zu Beginn der Kämpfe auf ein Äußerstes angehoben. Gleichzeitig wurde die Symbolkraft Stalingrads im weiteren Verlauf des Artikels ein Stück weit entkräftet: „Die Bedeutung von Stalingrad als bolschewistisches Symbol interessiert nur den Gegner“ („Schlüsselstadt Stalingrad“, BZ, 88. Jg., Nr. 202). Hier zeigt sich jedoch eine gewisse Ambivalenz. Einerseits wird von einer strategischen Schlüsselstadt gesprochen, die Geschichte der Stadt betont und die Bedeutung für Stalin sowie für die gesamte Sowjetunion herausgehoben, andererseits versucht der Artikel klarzustellen, dass es nicht darum gehe, die Stadt nur ihres Namens wegen anzugreifen, sondern allein wegen ihrer verkehrstechnischen und strategischen Bedeutung.
Bereits in der nächsten Ausgabe wurde dem Leser zum ersten Mal klar gesagt, wie dicht die deutschen Kampfverbände vor Stalingrad stehen. So heißt es in der Überschrift des OKW-Berichts: „25 Kilometer vor Stalingrad“ (BZ, 88. Jg., Nr. 203 v. 31.08.1942). Es lässt den Eindruck entstehen, dass der Vormarsch bislang sehr schnell vorangegangen war und es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis Stalingrad eingenommen werde. Dies lässt sich auch durch die Wortwahl im OKW-Bericht belegen. Dort heißt es, dass „deutsche Truppen die feindlichen Stellungen durchbrachen und [...] starke sowjetische Kräfte [zerschlugen]“ (ebd.). Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass das Stadtgebiet bombardiert und dadurch „ausgedehnte Brände“ hervorgerufen wurden (ebd.). Der Eindruck des scheinbar gelungenen Vormarsches deutscher Truppen wurde am 02. September verstärkt, als auf weitere „Bodengewinne“ hingewiesen wurde. Außerdem wurde zum ersten Mal in der Berichterstattung die Wolga erreicht, zunächst nördlich der Stadt.[53]
Ab dem 05. September betonte die BZ in ihren Berichten, dass Stalingrad von den sowjetischen Verteidigern zu einer Festung ausgebaut worden sei. So heißt es im OKW-Bericht am 05. September: „Im Festungskampffeld von Stalingrad nahmen die deutschen Angriffstruppen zahlreiche zäh verteidigte und neuzeitlich ausgebaute Kampfanlagen“ („Stadt und Hafen Tamanskaja genommen“, BZ, 88. Jg., Nr. 208). Gleichzeitig tauchte im Ausgaben-Titel das erste Mal der Begriff der „Schlacht“[54] auf. Dieser erhöhte einerseits den Stellenwert der Kämpfe, andererseits wurde dadurch auch die Schwere der Kämpfe betont.
Dieser gewisse Widerspruch der Berichterstattung zwischen Siegesgewissheit und Zurückhaltung war unter Umständen den bereits geschilderten unterschiedlichen Ansichten in der NS-Führung im Hinblick auf die Propaganda geschuldet. Denn vor allem der September war in der NS-Führung dadurch geprägt, dass einige Funktionäre, wie beispielsweise der Reichspressechef Otto Dietrich, den Fall von Stalingrad schon kurz bevorstehen sahen (vgl. Brendel 1985, S. 42), während andere, wie Propagandaminister Goebbels, die Presse weiterhin zur Zurückhaltung aufforderten. Goebbels wollte nicht riskieren, dass eine zu hohe Erwartungshaltung innerhalb der deutschen Bevölkerung entstand. Er bremste auch in der augenscheinlich offensiven und erfolgreichen Kampfphase der deutschen Truppen im ersten Drittel des Septembers die Nachrichten und Propagandabestrebungen. Der Bevölkerung sollten keine Illusionen gemacht werden, die durch einen schnellen Verlauf der Operationen entstehen könnten. Vielmehr sollten die Härte, Schwere und das gigantische Ausmaß der Kämpfe der Bevölkerung vor Augen geführt werden (vgl. Brendel 1985, S. 27).
Dies wurde mit dem gerade dargestellten Bericht über das „Festungskampffeld“ in gewisser Weise erreicht, allerdings wurden nahezu ausschließlich positive Meldungen abgedruckt. So wurde die Ausgabe vom 08. September mit „Weitere Erfolge im Festungsgebiet von Stalingrad“ betitelt (BZ, 88. Jg., Nr. 210). Außerdem widmete sich der Artikel „Zu Wasser und zu Lande“ der gegenwärtigen allgemeinen Kriegslage. Dort heißt es im Abschnitt zu den Kämpfen im Osten:
„Der Kampf an der Ostfront konzentriert sich gegenwärtig vor allem um den wichtigsten Eckpfeiler der bolschewistischen Linien, um die stark befestigte Stadt Stalingrad. Im Festungskampfgelände dieses wichtigen Platzes schreitet die deutsche Offensive trotz des härtesten Widerstandes der Sowjets ununterbrochen vorwärts.“ („Zu Wasser und zu Lande“, ebd.)
Hier ist der oben bereits beschriebene Widerspruch in einem Absatz zu erkennen. Es handelt sich zwar um ein „Festungskampfgelände“, aber selbst die schwierigsten Bedingungen könnten den deutschen Vormarsch nicht stoppen. Es ist also durchaus eine permanente Siegesgewissheit zu lesen, die scheinbar durch die Betonung der Schwierigkeiten abgemildert werden sollte, um keine allzu große Euphorie zu erzeugen, wie es Goebbels gefordert hatte.
Für die NS-Führung war es zu diesem Zeitpunkt vergleichsweise leicht, die Propaganda zu gestalten, da es noch keine militärischen Rückschläge gab, die der Bevölkerung mitgeteilt werden mussten bzw. mit denen propagandistisch umgegangen werden musste. Somit trifft zu diesem Zeitpunkt die Aussage Wettes zu, dass die Propaganda in den ersten Kriegsjahren „auf dem Rücken der Wehrmacht geritten“ sei und nur Erfolge „verkaufen“ musste (2003, S. 44).
Wenn man nun noch die quantitative Auswertung betrachtet, wird deutlich, dass sich die positive Stimmung auch in Zahlen ausdrückt. Von insgesamt 262 Artikeln im gesamten Erhebungszeitraum bis zum 13. Februar, die das Wort „Stalingrad“ enthalten, wurden in der BZ in der ersten Phase 39 veröffentlicht. Das macht zwar nur knapp 15 Prozent der Gesamtsumme aus, aber da die erste Phase auch mit Abstand die kürzeste ist, scheint der Blick auf den Ausgabendurchschnitt sinnvoll. Bei gerade einmal 18 Ausgaben, die in der ersten Phase erschienen sind, errechnet sich eine durchschnittliche Berichterstattung von 2,17 Artikeln pro Ausgabe. Die überwiegende Anzahl der Artikel waren dabei OKW-Berichte, die mit einer Anzahl von 20 über die Hälfte der gesamten Artikel in dieser Phase ausmachen.[55] Zusammen mit den acht weiteren Übersichtsartikeln, die sich mehr als nur einem Frontabschnitt widmen, machen sie mehr als 70 Prozent aller Artikel aus.[56] In beiden Artikelgattungen wird sich meist in einem oder zwei Absätzen den Kämpfen um Stalingrad gewidmet. Artikel, die sich vollständig mit den Kampfhandlungen in Stalingrad auseinandersetzen, gibt es in dieser Phase nur drei. Dies sind meist den OKW-Bericht ergänzende Meldungen, wie der bereits erwähnte Artikel über die „Schlüsselstadt Stalingrad“ (BZ, 88. Jg., Nr. 202 v. 29.08.1942) oder der Artikel mit der Überschrift „Stalingrad: 7 km tiefer Einbruch“ (ebd., Nr. 211 v. 09.09.1942). Letztgenannter wird zudem mit den Worten eingeleitet: „Zu dem schweren Ringen um die Festung Stalingrad teilt das Oberkommando der Wehrmacht ergänzend mit“ (ebd.).
Hinzu kommen fünf Artikel, die internationale (Presse-)Stimmen wiedergeben. Wie bereits erwähnt, hatten diese die Funktion, die Berichte der BZ in ihrer Wirkung zu unterstützen. Meist widmen sie sich in ihrem kompletten Umfang den Kämpfen um Stalingrad. Nur einmal ist dies nicht der Fall, da dort die allgemeine Situation des Krieges aus der Sicht des Gegners dargestellt wird (vgl. „Eingestandene Unfähigkeit“, ebd., Nr. 207).
[...]
[1] Vgl. dazu die Titel folgender Bücher: „Stalingrad – eine deutsche Legende“ (Ebert 1992), „Stalingrad. Mythos und Wirklichkeit einer Schlacht“ (Wette/Ueberschär 2003), „Die Schlacht von Stalingrad. Metamorphosen eines deutschen Mythos“ (Kumpfmüller 1995).
[2] Auf die Geschichte der „Bremervörder Zeitung“ wird noch ausführlich eingegangen.
[3] Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird auf Grund der besseren Lesbarkeit entweder die männliche Form oder der Plural verwendet.
[4] Für die Untersuchung wurde dabei die norddeutsche Ausgabe zugrunde gelegt.
[5] Dass sich die Berichterstattung in der „Bremervörder Zeitung“ im Hinblick auf die in Faulstichs Analyse festgestellten Phasen unterscheidet, wird ebenfalls Thema der Abschnitte über die Ergebnisse der durchgeführten Inhaltsanalyse sein.
[6] Dieser führte zu dieser Zeit den Untertitel „aelteste Heimatzeitung im Stadt- und Landkreis Iserlohn“. Inwieweit die „Bremervörder Zeitung“ ebenfalls eine Heimatzeitung war, wird der Abschnitt zum Forschungsstand über die „Bremervörder Zeitung“ zeigen.
[7] Es wird sich in der Analyse der „Bremervörder Zeitung“ zeigen, ob es bei diesen Zeitungen zu einer ähnlichen Berichterstattung kam oder ob es doch Unterschiede gab.
[8] Unter Presse werden in dieser Arbeit die Printmedien Zeitung und Zeitschrift verstanden. Ein Fokus wird dabei auf die Zeitung gelegt, da in der folgenden Analyse mit der „Bremervörder Zeitung“ genau dieses Medium ausgewertet wurde.
[9] Als Beispiel für die umfassende Beschäftigung mit der Presse im Nationalsozialismus seien die Aufsätze von Rudolf Stöber in Heidenreich/Neitzel „Medien im Nationalsozialismus“, von Hans-Dieter Kübler in Faulstich „Die Kultur der 30er und 40er Jahre“, sowie der Forschungsbericht von Faulstich über die Medienkultur im Nationalsozialismus in Karmasin/Faulstich „Krieg-Medien-Kultur“ genannt.
[10] Die „Reichspressekammer“ wurde zusammen mit zahlreichen anderen Kammern wie der „Reichsrundfunkkammer“ und der „Reichsschrifttumskammer“ durch das „Reichskulturkammergesetz“ vom 22. September 1933 ins Leben gerufen (vgl. Kübler 2009, S. 152). Auf die gesamten Kammern im Speziellen soll im Folgenden allerdings nicht weiter eingegangen werden, da diese zum Großteil keinen unmittelbaren Einfluss auf die untersuchte Berichterstattung hatten.
[11] Wie sich dieser Konflikt auf die Presseberichterstattung auswirkte und wer vermeintlich den größeren Einfluss auf die Berichterstattung innerhalb der deutschen Presse hatte, soll im nächsten Abschnitt über die Kriegsberichterstattung im zweiten Weltkrieg näher erläutert werden.
[12] Das „Aushängeschild“ des Eher-Verlags war unter anderem das Zentralorgan der NSDAP, der „Völkische Beobachter“.
[13] Während des Krieges mussten unter anderem die „Frankfurter Zeitung“ und die „Münchener Zeitung“ schließen. Auch hier profitierten vor allem wieder die Parteizeitungen, welche die Abonnenten der geschlossenen Zeitungen einfach übernahmen (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 54). Ob auch die „Bremervörder Zeitung“ von den Schließungsaktionen betroffen war, wird im Abschnitt 2.4 näher erläutert.
[14] Die besonderen Eigenheiten und Funktionen dieses Zeitungstyps werden im Abschnitt über die „Bremervörder Zeitung“ (Abschnitt 2.4) näher erläutert, da diese ein gutes Beispiel für eine solche Zeitung darstellt.
[15] Ob es auch im Gau Osthannover, in welchem Bremervörde lag, Kompetenzstreitigkeiten gab, ist leider nicht belegt. Die Akten im Hauptstaatsarchiv in Hannover zur Presse des Gaus sind zum großen Teil nicht mehr vorhanden.
[16] Ein Buch speziell zur NS-Pressepolitik im Zweiten Weltkrieg wurde 1991 von Doris Kohlmann-Viand unter selbigem Namen veröffentlicht.
[17] Insgesamt gab es zu Kriegsbeginn 13 „Propagandakompanien“, davon sieben beim Heer, vier bei der Luftwaffe und zwei bei der Marine. Die Anzahl wurde im Laufe des Krieges noch erhöht (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 48). Wie eine PK im Detail zusammengesetzt war, soll hier nicht näher erläutert werden, ist aber bei Kohlmann-Viand ausführlich dargestellt.
[18] Ob auch in der „Bremervörder Zeitung“ viele PK-Berichte zu finden sind, wird die Auswertung zeigen.
[19] Auf die teilweise großen Konkurrenzkämpfe zwischen den verschiedenen Ministerien, wie Wehrmacht, RMVP, und den Parteibehörden, wie dem Reichspresseamt, soll hier nur eingeschränkt eingegangen werden, da das den Umfang der Arbeit erheblich ausweiten würde und die Analyse nicht unmittelbar betrifft. Zur weiteren Vertiefung ist das bereits erwähnte Buch von Doris Kohlmann-Viand zu empfehlen, das sich dieser Thematik ausführlich widmet.
[20] Dietrich hielt sich fast immer in der Nähe des „Führers“ auf. Dieser Tatbestand sowie die Weitergabe der Anweisungen durch die RPA bzw. Gaupropagandaämter, deren Leiter der Partei meist näher standen als dem RMVP, führten zu einem stärkeren Einfluss Dietrichs (vgl. Kohlmann-Viand 1991, S. 101ff.).
[21] Zur Schlacht von Stalingrad als militärisches Ereignis gibt es bereits einige Forschungsergebnisse. Allein in der Bibliographie von Müller/Ueberschär aus dem Jahr 2000 finden sich zum militärischen Kampf um Stalingrad und im Kaukasus 1942/43 175 Titel.
[22] Der Don ist der letzte große Fluss westlich von Stalingrad. Vom großen Donbogen bis zur Wolga sind es ungefähr 70 km Luftlinie.
[23] Brendel nennt eine geplante Menge von 700 Tonnen und ein Minimum zum Überleben von 300 Tonnen. Dieses Minimum konnte aber nur an vier Tagen erfüllt bzw. überboten werden (vgl. Brendel 1985, S. 19).
[24] Dass die Ernennung Paulus’ zum Generalfeldmarschall vor allem einen propagandistischen Zweck hatte, wird die Interpretation der Analyseergebnisse zeigen.
[25] Die Zahlen variieren in den verschiedenen Quellen.
[26] Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird die „Bremervörder Zeitung“ mit BZ abgekürzt, es sei denn, der ausführliche Name steht im Vordergrund des Interesses.
[27] Hingewiesen sei hier auf zahlreiche Studien oder Monographien beispielsweise zum „Völkischen Beobachter“ und zur „Frankfurter Zeitung“.
[28] Unter einer Heimatzeitung verstand man laut dem Handbuch der Zeitungswissenschaft: „Zeitungen, die einer geschlossenen Kulturlandschaft, entweder durch geschichtliches Wachstum oder durch organische Eingliederung, eng und dauernd verbunden sind, aus dieser Landschaft die besonderen Kräfte ihrer inhaltlichen Gestaltung empfangen und sich die Deutung des Lebenssinnes ihres Gebiets innerhalb des Volksraums zur ständigen Aufgabe machen.“ (zit. nach Kohlmann-Viand 1991, S. 122).
[29] In der Stadt Bremervörde lebten zu diesem Zeitpunkt zwischen 3.500 und 4.000 Menschen. Diese Zahl erhöhte sich bis 1939 auf knapp 5.000. Im Landkreis Bremervörde lebten bei Kriegsbeginn 46.272 Menschen (vgl. Stein 1994, S. 130).
[30] 1924 scheiterte ein Volksentscheid zur Abspaltung des Landes Hannover von Preußen, im Kreis Bremervörde erhielt der Volksentscheid jedoch eine Zustimmung von über 50%. Im Landesdurchschnitt waren es nur 25,5% (vgl. Stein 1994, S. 81).
[31] Auf die politische Ausrichtung der „Schwarzen Front“ soll hier nicht weiter eingegangen werden.
[32] Im Niedersächsischen Landesarchiv – Staatsarchiv Stade befinden sich Akten zur Schließung der BZ sowie zu den Verhandlungen zur Wiederzulassung der Zeitung. Über den Rechtsanwalt liegen allerdings keine weiteren Informationen vor.
[33] Als ursprünglich rein kommunikationswissenschaftliche Methode hat die Inhaltsanalyse mittlerweile Einzug in verschiedene Disziplinen gehalten. So bedient sich nicht nur die Kommunikations- und Medienwissenschaft dieser Methodik, sondern auch die Psychologie zum Auswerten von Behandlungsgesprächen, die Bildungswissenschaft zur Verbesserung und Erforschung von Lehrsituationen, sowie die Linguistik zur Erforschung von textlichen Details (vgl. Mayring 2008b, S. 7ff).
[34] Als Autor des zweiten „Standard-Lehrbuchs“ nennen Maurer/Reinemann Klaus Merten, der im Jahr 1995 eine Einführung in die Methodik der Inhaltsanalyse veröffentlichte (vgl. 2006, S. 12). Weitere Definitionen der Inhaltsanalyse gibt es zudem von Ritsert, George, Kaplan et al., wie sie Mayring in seinem Buch über qualitative Inhaltsanalysen aufführt (vgl. 2008a, S. 11f.).
[35] Auf die Besonderheiten einer qualitativen Inhaltsanalyse wird im Folgenden eingegangen.
[36] Im Folgenden werden nur die beiden erstgenannten Ansätze näher erläutert. Auf den formal-deskriptiven Ansatz soll hier nicht weiter eingegangen werden, da er für diese Inhaltsanalyse nicht in Betracht kommt.
[37] Weitere Unterscheidungsmerkmale zwischen qualitativer und quantitativer Forschung und weitere Erläuterungen finden sich auch bei Flick et al. in ihrer Einführung zur qualitativen Forschung (vgl. Flick et al. 2009).
[38] Die Merkmale der verschiedenen Skalenniveaus sollen hier nicht näher erläutert werden. Zum Nachlesen sind Einführungstexte in die Statistik oder Sozialwissenschaften zu empfehlen.
[39] Mayring zitiert Krippendorfs Aussage über die Bedeutung der Kategorienbildung. So sei sie „ein[...] zentrale[r] Schritt der Inhaltsanalyse, ein[...] sehr penible[r] Prozeß, eine Kunst (Krippendorf 1980)“ (2008, S. 74).
[40] Beispiele für die Nennung als Orientierungspunkt sind die Ausgaben Anfang August 1942, in denen der Name Stalingrad als Bezeichnung für Bahnlinien genannt wird.
[41] Ausgenommen ist ein verspäteter Schlussartikel am 17. Februar. Da zu diesem Zeitpunkt die Berichterstattung allerdings schon zu ihrem Ende gekommen ist, fließt dieser Artikel in die Analyse nicht mit ein.
[42] Der Umfang der Weihnachtsausgabe war mit zehn Seiten deutlich größer. Sie bildet jedoch eine Ausnahme.
[43] Keine Berücksichtigung in der Analyse fanden Todesanzeigen sowie die Werbeseiten der BZ. Auf Todesanzeigen, die sich direkt auf Stalingrad beziehen, wird in der Interpretation der Ergebnisse kurz hingewiesen.
[44] Darunter sind die Artikelgattungen zu verstehen: handelt es sich beispielsweise um einen OKW-Bericht, um einen Artikel mit internationalen Pressestimmen, um einen Artikel ausschließlich über Stalingrad etc..
[45] Hierbei gab es die Ausprägungen „Ganzer Artikel“, „Absatz“, „Satz“, „Nebensatz“.
[46] Unter Code-Wörtern versteht man jene Wörter, die als „Schlüsselwörter“ für eine Kategorie gelten. So deutet bspw. „die deutschen Angreifer“ daraufhin, dass sich die deutschen Soldaten im Angriff befinden.
[47] Das verwendete Kategoriensystem befindet sich zur besseren Nachprüfbarkeit im Anhang.
[48] Aus diesem Grund schlägt Mayring vor, nach Auswertung durch den Zweitkodierer die unterschiedlichen Auffassungen abzugleichen und es nur dann als Nicht-Übereinstimmung zu werten, wenn der Zweitkodierer den Hauptkodierer von einer ungenügend ausgeprägten Kategorie überzeugen kann (vgl. Mayring 2008b, S. 13). Die Durchführung dieser Methode würde den zeitlichen Rahmen der Arbeit allerdings deutlich übersteigen.
[49] Die Artikel in der BZ lassen nur in sehr wenigen Fällen Rückschlüsse auf den Autor zu. Zudem werden keine Seitenzahlen abgedruckt. Aus diesem Grund wird in den Zitatsbelegen der Artikelname sowie die Ausgabennummer genannt. Falls ein Autor bekannt ist, wird dieser ebenfalls erwähnt, in allen anderen Fällen ist der Autor unbekannt.
[50] Wie bereits erwähnt, tauchte der Name „Stalingrad“ bereits vorher in der BZ auf, allerdings hatte er nur die Funktion eines Orientierungspunktes. Erst Ende August fiel der Name „Stalingrad“ mit Bezug auf die Kämpfe um die Stadt.
[51] Die Bedeutung und Aufmachung des OKW-Berichts wurde im Abschnitt 2.2. ausführlich dargestellt.
[52] Die weitere Verwendung von prägenden Adjektiven wird ausführlich im Abschnitt über die Art und Weise der Berichterstattung behandelt.
[53] Vgl. „Weiterer Bodengewinn vor Stalingrad – Repressalien für britische Gemeinheiten“, BZ, 88. Jg., Nr. 205.
[54] „Die Schlacht um Stalingrad geht weiter“ (BZ, 88.Jg., Nr. 208).
[55] Es ist darauf hinzuweisen, dass nicht in jeder Ausgabe ein OKW-Bericht abgedruckt wurde. So fehlt der offizielle OKW-Bericht in vier Ausgaben dieser Phase (vgl. BZ, 88. Jg., Nr. 202, Nr. 204, Nr. 207 et Nr. 212). In der Ausgabe Nr. 205 wurden hingegen zwei abgedruckt. In den weiteren Phasen wird diese Auswertung nicht weiter vorgenommen. Es bleibt aber als Besonderheit zu berücksichtigen.
[56] Zur besseren Veranschaulichung sei auf die Grafik 1 im Anhang hingewiesen.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Ludwig-Macke (Autor:in), 2003, Walderlebnispädagogik in Kindergarten und Grundschule. Konzept, Inhalte, Spielevorschläge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/277635
Kostenlos Autor werden



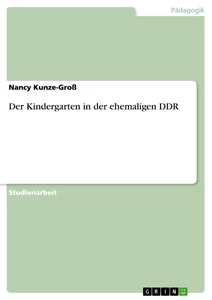
















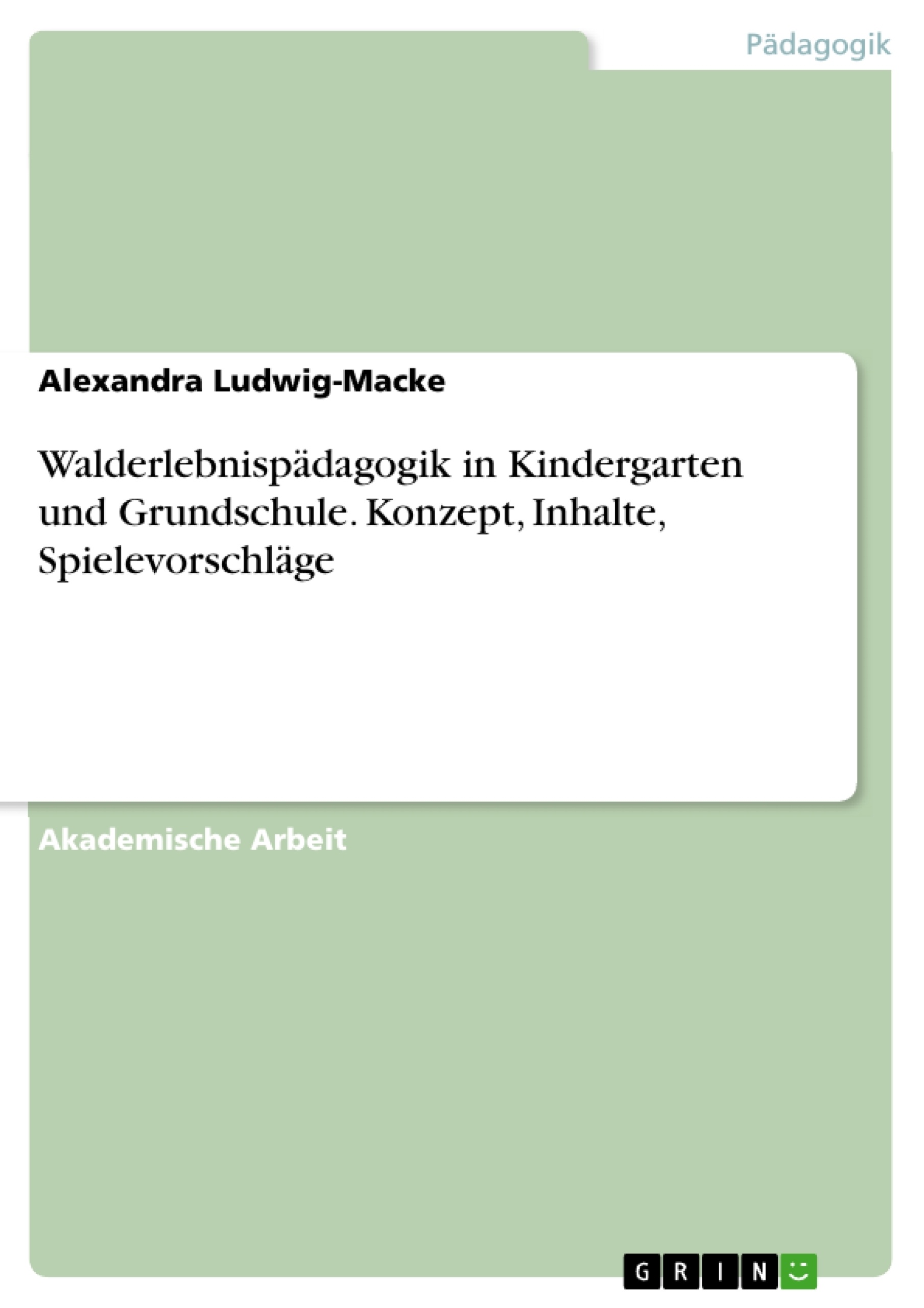

Kommentare