Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Problemstellung
2 Das Boreout-Syndrom
2.1 Begriff
2.2 Elemente
2.2.1 Unterforderung
2.2.2 Langeweile
2.2.3 Desinteresse
2.3 Entwicklung und Abgrenzung zur inneren Kündigung
2.4 Boreout-Strategien und Boreout-Paradox
2.5 Arbeitszufriedenheit und Qualitativer Lohn
2.6 Betroffene und Symptome
3 Studie
3.1 Forschungsfrage und Hypothesen
3.2 Methode
3.2.1 Beschreibung der Stichprobe
3.2.1 Datenerhebungsmethode
3.2.2 Forschungsinstrument
3.3 Ergebnisse
3.4 Diskussion der Ergebnisse
4 Schlussfolgerung, Ausblick und praktische Implikationen
Literaturverzeichnis
Anlage
Anlage 1: Fragebogen
Anlage 2: Werte Cronbachs Alpha
Anlage 3: Kodeplan
Anlage 4: Ergebnisse Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstests
Anlage 5: Gesamtergebnisse Boreout-Syndrom
Anlage 6: Testergebnisse zu Frage 2
Anlage 7: Testergebnisse zu Frage 4
Anlage 8: Testergebnisse zu Frage 6
Anlage 9: Testergebnisse zu Frage 7
Ehrenwörtliche Erklärung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Das Boreout-Syndrom.
Abbildung 2: Einfluss des Komplexitätsgrads der Tätigkeit auf die Frustration.
Abbildung 3: Grundlegender Prozess Emotionen
Abbildung 4: Zusammensetzung Boreout-Syndrom - absolute Zahlen.
Abbildung 5: Boreout-Syndrom: Häufigkeitsverteilung.
Abbildung 6: Auswertung Konstrukte.
Abbildung 7: Darstellung Frage 2.
Abbildung 8: Darstellung Frage 4.
Abbildung 9: Darstellung Frage 6.
Abbildung 10: Darstellung Frage 7.
Abbildung 11: Fragebogen.
Abbildung 12: Histogramm Stichprobe 2.
Abbildung 13: Histogramm Stichprobe 1.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Arten von Gefühlen.
Tabelle 2: Langeweile als Lernemotion.
Tabelle 3: Coping-Kategorien.
Tabelle 4: Grundgesamtheit Bürotätigkeit.
Tabelle 5: Stichprobe 1.
Tabelle 6: Anteile in Stichprobe 1.
Tabelle 7: Grundgesamtheit Gesundheits- und Krankenpfleger/innen.
Tabelle 8: Stichprobe 2.
Tabelle 9: Anteile in Stichprobe 2.
Tabelle 10: Konstrukte, Indikatoren & Fragen.
Tabelle 11: Ordinalskala.
Tabelle 12: Auswertung Konstrukte.
Tabelle 13: Annahme eines Boreout-Syndroms - Bedingungen.
Tabelle 14: Auszug Kodeplan.
Tabelle 15: Boreout Syndrom Gesamt.
Tabelle 16: Boreout-Syndrom – absolute Zahlen.
Tabelle 17: t-Test Zusatzhypothese Teil 1.
Tabelle 18: t-Test Zusatzhypothese Teil 2.
Tabelle 19: Mann-Whitney U-Test Zusatzhypothese.
Tabelle 20: : t-Test Hypothese 3 Teil 1.
Tabelle 21: t-Test Hypothese 3 Teil 2.
Tabelle 22: t-Test Hypothese 4 Teil 1.
Tabelle 23: t-Test Hypothese 4 Teil 2.
Tabelle 24: Auswertung Frage 2.
Tabelle 25: Auswertung Frage 4.
Tabelle 26: Auswertung Frage 6.
Tabelle 27: Auswertung Frage 27.
Tabelle 28: Cronbachs Alpha.
Tabelle 29: SPSS Kodeplan Variablenbeschreibung.
Tabelle 30: SPSS Kodeplan Variablenwerte.
Tabelle 32: Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest - Krankenhaus.
Tabelle 33: Gesamtergebnisse Boreout-Syndrom.
Tabelle 34: t-Test Frage 2 Büroangestellte vs. Krankenhaus.
Tabelle 35: Mann-Whitney U-Test Frage 2 Büroangestellte vs. Krankenhaus.
Tabelle 36: t-Test Frage 2 Personen bis 29 Jahre vs. Personen ab 30.
Tabelle 37: t-Test Frage 2 Azubis vs. andere Büroangestellte.
Tabelle 38: : t-Test Frage 4 Krankenhaus vs. Büroangestellte.
Tabelle 39: t-Test Frage 4 Personen bis 29 Jahre vs. Personen ab 30.
Tabelle 40: Mann-Whitney U-Test Frage 4 Personen bis 29 Jahre vs. Personen ab 30.
Tabelle 41: t-Test Frage 4 Azubis vs. andere Angestellte.
Tabelle 42: Mann-Whitney U-Test Frage 4 Azubis vs. andere Büroangestellte.
Tabelle 43: t-Test Frage 6 Büroangestellte vs. Krankenhaus.
Tabelle 44: t-Test Frage 7 Büroangestellte vs. Krankenhaus.
Abstract
Der Begriff „Boreout-Syndrom“ beschreibt eine psychische Erkrankung auf Grund von Langeweile, Unterforderung und Desinteresse am Arbeitsplatz und stellt das Gegenteil zum Burnout-Syndrom dar. In dieser Arbeit wurde neben der theoretischen Aufbereitung des Themas eine Studie zur Erforschung des Boreout-Syndroms durchgeführt. Dafür wurden 37 Büroangestellte (davon 15 Azubis) sowie 15 Krankenhausmitarbeiter mittels eines schriftlichen Fragebogens befragt. Die Ergebnisse bestätigen die Existenz des Boreout-Syndroms: bei drei der Befragten konnte bereits ein Boreout festgestellt werden, neun zeigen diesbezüglich eine starke Tendenz. Auch wurde bestätigt, dass das Phänomen in Berufen, in denen die Arbeit unmittelbar anfällt wie z.B. bei Krankenschwestern/-pflegern, nicht vorkommt. Des Weiteren wurde der Frage nachgegangen, inwieweit das Alter und der Status der Beschäftigung (Auszubildender vs. andere Angestellte) einen Einfluss auf die Anfälligkeit für das Boreout-Syndrom haben. Im ersten Fall besteht zwar ein Mittelwertunterschied, jedoch konnte keine praktische Relevanz nachgewiesen werden. Im zweiten Fall konnte kein nennenswerter Unterschied gefunden werden. Zur Überprüfung dieser Ergebnisse bedürfte es weiteren Studien mit größeren Stichproben. Zum Schluss warden einige praktische Implikationen gegeben.
The term „boreout syndrome“ describes a mental illness mainly caused by boredom, mental underload as well as indifference at the workplace demonstrating the opposite of the burnout syndrome. Next to the preparation of the topic´s theoretical foundation, a study was conducted within this paper to explore the phenomenon. Therefore, 37 office workers (including 15 apprentices) as well as 15 nurses were questioned using a written survey. The results show that the boreout syndrome is existent: three respondents are already suffering from it while nine of them tend to be affected shortly. The results also confirm that the boreout syndrome is not possible in jobs like nurse or policemen/-women, where the work comes up immediately. Furthermore, the question was considered whether age and employment status (apprentices vs. other office workers) have an influence on the vulnerability to the illness. In the first case, there is indeed a difference in the average values; however, practical relevance could not be proved. In the second case no considerable difference could be found. To review these results some more studies containing higher samples would be necessary. Eventually, some practical implications are provided.
1 Problemstellung
Wir bewegen uns in einer schnelllebigen Welt. Globalisierung, steigender Wettbewerb, eine angespannte Wirtschaftslage und nicht zuletzt die ständige Erreichbarkeit durch neue Kommunikationsmedien haben den Druck auf die Menschen unserer Zeit enorm erhöht. Firmen fordern beinahe unbegrenzte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie ständige Erreichbarkeit von ihren Mitarbeitern, die neben ihrem Beruf auch noch ihr Privatleben meistern müssen (Gaschke, 2007, 1).
Es ist somit nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl unserer Bevölkerung an psychischen Erkrankungen leidet. Dem Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK) zufolge, wurde im Jahr 2006 bei 22,1% aller versicherten Erwerbspersonen mindestens eine psychische Störung diagnostiziert. Tendenz steigend (Techniker Krankenkasse, 2008, 20).
Auch die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) (2012, 4) beschreibt einen Trend zunehmender psychischer Erkrankungen. In ihrer Studie zur Arbeitsunfähigkeit wertete sie die Angaben der großen gesetzlichen Krankenkassen - der Deutschen Angestellten Kasse (DAK), der Allgemeinen Ortskrankenkasse (OAK) sowie der Betriebskrankenkasse (Bund) (BKK) – aus und kam zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2011 12,5% aller betrieblichen Fehltage der Versicherten auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen waren. Dieser Wert hat sich seit dem Jahr 2000 nahezu verdoppelt. Im aktuellen Gesundheitsreport der DAK zeigt sich, dass psychische Erkrankungen mit mittlerweile 15% sogar den zweithäufigsten Grund für die Krankheitstage von Erwerbspersonen darstellen (DAK-Gesundheit, 2013, 6).
Ein vor allem in den Medien oft genannter Begriff im Rahmen der Diskussion um psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz ist das „Burnout“ Syndrom. Es beschreibt einen Zustand emotionaler Erschöpfung einhergehend mit einer Depersonalisation und einer verminderten persönlichen Erfüllung im Beruf. Auslöser dafür ist meist Überforderung, die Menschen an die Grenzen ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit stoßen und psychisch zusammenbrechen lässt (Maslach, 2003, 2). Allein im Jahr 2006 ließen sich 33.000 der 2,5 Millionen TK-Versicherten auf Grund von Müdigkeit, Unwohlsein und Überforderung krankschreiben (Ruhwandl, 2009, 20). Und auch die Häufigkeit des Burnout-Syndroms nimmt beständig zu. So hat sich, laut der bereits oben zitieren BPtk-Studie, die Anzahl der Krankschreibungen, die auf Burnout zurückzuführen sind, seit 2004 um 700% erhöht (Bundespsychotherapeutenkammer, 2012, 1).
Nichtsdestotrotz ist die Verbreitung des Burnout-Syndroms im Vergleich zu anderen psychischen Erkrankungen, wie Depressionen oder Angstzustände, relativ gering. So waren 2011 nur 4,5% der Fehltage auf die Diagnose „Burnout“ zurückzuführen (Bundespsychotherapeutenkammer, 2012, 3). In der aktuellen DAK Studie wird sogar explizit darauf hingewiesen, dass das Burnout-Syndrom wesentlich weniger verbreitet ist, als die Präsenz in den Medien vermuten lässt: nur 0,2% der männlichen und 0,3% der weiblichen Versicherten der DAK wurde im Jahr 2012 ein Burnout diagnostiziert (DAK-Gesundheit, 2013,51).
In dieser Fülle der psychischen Erkrankungen taucht nun seit Kurzem ein neuer, noch relativ unbekannter Begriff auf: das Boreout-Syndrom. Die Verwandtschaft des Begriffs zum oben bereits erläuterten Burnout-Syndrom ist nicht schwer zu erkennen. Tatsächlich stellt das Boreout-Syndrom das Gegenteil zum Burnout-Syndrom dar – eine psychische Erkrankung auf Grund von Unterforderung, Desinteresse und Langeweile am Arbeitsplatz (Rothlin & Werder, 2007, 13).
In der fortlaufenden Diskussion um zunehmenden Stress und Druck am Arbeitsplatz, Doppelbelastungen und Burnout, mag dieses Syndrom zunächst eher unrealistisch klingen. Und gerade das mag der Grund sein, dass es bis jetzt so wenig Aufmerksamkeit gefunden hat: in unserer Leistungsgesellschaft haben psychische Probleme auf Grund von Unterforderung und Langweile keinen Platz (Rothlin & Werder, 2007, 7). Und doch gibt es sie.
In einer Studie der Hochschule Luzern aus dem Jahr 2010 (4) bewerteten 52% der 1230 befragten Beschäftigten ihren Job als „wenig stressig“ und 14% sogar als „überhaupt nicht stressig“. Die aktuelle Untersuchung des Marktforschungsinstituts Gallup (2013a, 1) zeigt, dass 61% der Deutschen nur noch „Dienst nach Vorschrift“ machen, während 21% bereits innerlich gekündigt1 haben. Nur 15% der Mitarbeiter geben an, eine hohe emotionale Bindung an ihren Arbeitgeber zu haben und sich freiwillig für dessen Ziele einzusetzen. Eine Studie der Deutschen Universität für Weiterbildung (DUW) kommt zu ähnlich beunruhigenden Ergebnissen: 11% der deutschen Erwerbstätigen fühlen sich in ihrem Job unterfordert. Davon geben 53% an, zu wenig anspruchsvolle Aufgaben zu erhalten, 48% wünschen sich mehr Verantwortung in ihrem Beruf und 37% klagen über fehlende Abwechslung im Job (DUW-Presseservice, 2011, 3-4).
Besonders betroffen scheinen junge Arbeitnehmer zu sein. Laut einer Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) Schweiz gaben im Jahr 2010 (2) ein Drittel der befragten Schweizer zwischen 18 und 39 Jahren an unterfordert zu sein. In einer Veröffentlichung der deutschen Bundesregierung vom Februar 2011 (1) zeigt sich, dass 60% der deutschen Beschäftigten bis 29 angeben, eigentlich mehr leisten zu können, als es von ihnen in ihrem Job verlangt wird. Eine Studie der Universität Hohenheim zur Ausbildungsadäquanz2 deutscher Ausbildungs- und Hochschulabsolventen macht deutlich, dass 17,6% der deutschen Berufstätigen unterwertig beschäftigt sind. Ein Teil ihrer Qualifikationen bleibt also ungenutzt, was eine Unterforderung darstellt. Besonders häufig betrifft dies die Gruppe der 18 – 29 Jährigen (Rukwid, 2012, 30-36).
Obwohl alle diese Studien Hinweise auf die Existenz des Boreout-Syndroms liefern, gibt es noch keine Studien die sich mit der Häufigkeit des Boreout-Syndroms an sich beschäftigen. Dies wäre jedoch sehr interessant. Schätzungen zufolge beträgt allein der Schaden durch Mitarbeiter, die keine oder nur geringe emotionale Bindung an ihr Unternehmen haben 18,3 Milliarden Euro im Jahr (Gallup, 2013b, 45). Durch innere Kündigung entsteht jährlich sogar ein volkswirtschaftlicher Schaden zwischen 112 und 138 Milliarden Euro (Gallup, 2013b, 13). Der Schaden, verursacht durch das Boreout-Syndrom, liegt schätzungsweise in einem ähnlichen Bereich.
Ziel dieser Arbeit ist es deshalb einen Beitrag zur Erforschung des Boreout-Syndroms zu leisten. Mit Hilfe einer Studie in Kapitel 3 soll die Existenz bzw. Verbreitung des Syndroms erforscht werden.
Außerdem soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit Alter, Art des Berufes und Beschäftigungsstatus (Auszubildender vs. andere Angestellte) das Vorkommen des Boreout-Syndroms beeinflussen. Zur Beantwortung der Fragen wird ein schriftlicher Fragebogen erstellt, der in ein bis zwei exemplarischen Unternehmen angewendet wird.
Da es sich beim Boreout-Syndrom um ein eher heikles Thema handelt, muss bei der Erstellung des Fragebogens vor allem auch auf einen sensiblen Umgang und eine geeignete Fragestellung geachtet werden. Trotzdem könnten Probleme mit der Ehrlichkeit der Befragten auftreten, was bei der Auswertung zu beachten ist.
Nach Durchführung der Erhebung werden die Ergebnisse in Kapitel 3.3 aufbereitet, um dann in Kapitel 3.4 analysiert und unter Berücksichtigung der Forschungsfragen kritisch gewürdigt zu werden.
Um eine aussagekräftige Studie sowie eine angemessene Befragung zu gewährleisten, werden in Kapitel 2 zunächst die theoretischen Grundlagen des Boreout-Syndroms dargestellt. Dabei sollen neben einer Definition des Konstrukts und seiner Elemente aus wissenschaftlicher Sicht, vor allem Strategien, Symptome und betroffene Personengruppen näher betrachtet werden. Auf Ursachen wird nicht näher eingegangen, da dies für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht relevant erschien.
Außerdem werden am Ende der Arbeit einige Maßnahmen und praktische Implikationen gegeben, die helfen können ein Boreout-Syndrom zu verhindern.
„Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen: Entweder leistet man wirklich etwas, oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei weitem nicht so groß.“
-Danny Kaye, Amerikanischer Schauspieler-
2 Das Boreout-Syndrom
2.1 Begriff
Der Begriff „Boreout-Syndrom“ tauchte erstmals 2007 auf. In ihrem Buch „Diagnose Boreout: Warum Unterforderung im Job krank macht“ beschreiben die zwei Unternehmensberater Phillipe Rothlin und Peter Werder ein Phänomen der Arbeitswelt, das bislang noch recht wenig Aufmerksamkeit gefunden hat: psychische Probleme von Beschäftigten – nicht etwa durch Überforderung– sondern durch Unterforderung, Desinteresse und Langeweile. Sie taufen es „Boreout-Syndrom“ und lehnen sich dabei recht eng an den relativ bekannten Begriff des „Burnout-Syndroms“ an. In der Tat stellt das Boreout-Syndrom das Gegenteil zum Burnout-Syndrom dar (Rothlin & Werder, 2007, 13). Dies mag der Grund sein, warum die Autoren auch einen ähnlich aufgebauten Begriff wählten, der bereits beim Lesen eine Beziehung der beiden Phänomene vermuten lässt.
Der Begriff „Burnout“ leitet sich vom englischen Verb „to burn out3 “ – ausbrennen – ab und beschreibt somit recht gut den Kern des Problems: Betroffene sind überfordert und fühlen sich infolgedessen erschöpft oder „ausgebrannt“ (Maslach, 2003, 2).
Der Begriff „Boreout“ jedoch, deckt nur eine Facette des Syndroms ab. Die Autoren setzten ihn aus den englischen Wörtern „bore“ – Langweiler bzw. „to bore“ – sich langweilen und „out“ – außen – zusammen und konstruierten so einen neuen Begriff, der eine Art „Ausgelangweilt-Sein“ beschreibt. Wie jedoch bereits erwähnt, besteht das Boreout-Syndrom nicht nur aus dem Element „Langeweile“, sondern aus zwei weiteren, ebenso bedeuteten Teilen: der Unterforderung und dem Desinteresse (Rothlin & Werder, 2007, 13). Des Weiteren, kann nur dann von einem Boreout-Syndrom gesprochen werden, wenn alle drei Elemente gleichzeitig, über einen längeren Zeitraum und in starker Ausprägung vorkommen (Abb. 1), denn jeder hat in seinem Beruf mit Sicherheit schon einmal diese Elemente erlebt und leidet trotzdem nicht zwangsläufig am Boreout (Rothlin & Werder, 2007, 26). Zusätzlich dazu liegt ein Boreout nur dann vor, wenn die betroffene Person nichts gegen ihre missliche Lage unternimmt und die Situation so paradoxerweise selbst Aufrecht erhält (Rothlin & Werder, 2007, 10). Auf diesen Aspekt wird in Kapitel 2.4 näher eingegangen.
Neben dem Werk von Phillipe Rothlin und Peter Werder, gibt es noch kaum Fachliteratur, die sich mit dem Begriff und einer eigenständigen Definition des Boreout-Syndroms beschäftigten. Die wenigen bestehenden Werke beziehen sich stets auf die zwei Schweizer Autoren.
Abbildung 1: Das Boreout-Syndrom.
Quelle: Eigene Darstellung.
2.2 Elemente
2.2.1 Unterforderung
Das Thema „Unterforderung“ findet sich vor allem in Literatur zur Arbeits- und Organisationspsychologie sowie zur Personalwirtschaft. Bei Sichtung der Fachliteratur wurde jedoch deutlich, dass das Thema „Unterforderung“ wesentlich weniger Beachtung findet, als das der „Überforderung“. Wie im Kapitel 1 jedoch bereits deutlich wurde, ist auch die Unterforderung ein ernst zunehmendes Problem der heutigen Arbeitswelt, das sich sogar immer weiter verbreitet.
Allgemein entstehen Über- als auch Unterforderung wenn die Qualifikationen eines Mitarbeiters nicht mit den Anforderungen an dessen Arbeitsplatz übereinstimmen (Olfert, 2008, 85). Nitsch & Udris (1976, 20) definieren Unterforderung als „umweltakzentuiertes Anforderungsgefälle im Sinne eines Anforderungsdefizits“. Sie entsteht also dann, wenn die Anforderungen an den Mitarbeiter dessen Qualifikationen deutlich unterschreiten.
Insgesamt kann zwischen einer qualitativen und einer quantitativen Unterforderung unterschieden werden. Tritt eine qualitative Unterforderung auf, ist der Inhalt der Arbeit für den Arbeitnehmer zu einfach. Er bekommt zu wenig Verantwortung und könnte eigentlich mehr leisten, als von ihm verlangt wird. Bei der quantitativen Unterforderung hingegen, hat der Arbeitnehmer schlichtweg zu wenig zu tun. Dies kann zum daran liegen, dass im entsprechenden Unternehmen zu wenig Arbeit vorhanden ist oder die Arbeit ungleich auf die Arbeitskräfte verteilt ist (Rothlin & Werder, 2007, 17).
Obwohl dies zunächst befremdlich klingen mag, stellt auch die Unterforderung einen hohen Stressfaktor für die betroffenen Personen dar. Während der Begriff „Stress“ umgangssprachlich oft sehr unspezifisch für unangenehme oder belastende Situationen oder als Synonym für „Zeitdruck“ verwendet wird, finden sich in der Fachliteratur sehr unterschiedliche Definitionen (Dragano, 2007, 70). Mc Ewen (2000, 2) versteht unter Stress psychische und physische Reaktionen des Körpers auf ein Reizereignis, das vom Individuum als bedrohlich eingestuft wird. Diese Reizereignisse werden auch als „Stressoren“ bezeichnet. Es gibt eine Unmenge an Stressoren für den menschlichen Organismus, beispielsweise physische wie Lärm oder Hitze. Unter-, als auch Überforderung stellen spezifische Stressoren der Arbeitsaufgabe dar (Frey & Hoyos, 1999, 434). Die Folge sind schlechte Arbeitsergebnisse, da für produktive und effektive Arbeit ein mittleres Stressniveau nicht überschritten werden darf. Im Idealfall herrscht eine Ausgewogenheit zwischen Anspannung, Erregung und Aktivierung (Stock, 2010, 12).
Die Reaktionen des Körpers auf Stress sind vielfältig und von der individuellen Person abhängig. Chronische Symptome reichen von einer verminderten Gedächtnisleistung, Unruhe, Angst und Niedergeschlagenheit bis hin zu physischen Reaktionen wie Kopfschmerzen und erhöhtem Blutdruck (Hörmann & Weber, 2007, 52-56).
Spezifische Folgen der Unterforderung können Monotonie und psychische Sättigung sein (Hartung, 2004, 5). Bei der Monotonie setzt der menschliche Organismus seine Gesamtaktivität herab, wenn er sich über einen längeren Zeitraum zu wenig anstrengen musste. Er passt sich an die Reizarmut der Umgebung an und es kommt zu einem mehr oder weniger starken Handlungs- und Leistungsverzicht. Unter psychischer Sättigung versteht man einen erhöhten Zustand der Spannung und Frustration, der meist mit einer starken Abneigung gegen die auszuführende Tätigkeit sowie einem deutlichen Leistungsabfall einhergeht (Nitsch & Udris, 1976, 20-21).
In einer Studie zur Arbeitsauslastung von Shaw & Weekley (1985, 95) zeigt sich, dass die meisten Beschäftigten die qualitative Unterforderung als weitaus belastender empfinden, als die quantitative. Auch Hettinger & Wobbe (1993, 507-508) gehen davon aus, dass der Komplexitätsgrad der Tätigkeit einen starken Einfluss auf den Grad der Frustration hat. So ist dieser bei einer optimalen Übereinstimmung zwischen den Qualifikationen eines Mitarbeiters und den Anforderungen am Arbeitsplatz sehr gering. Tritt jedoch Überforderung (zu hoher Komplexitätsgrad der Tätigkeit) oder Unterforderung (zu niedriger Komplexitätsgrad der Tätigkeit) auf, ist die Frustration besonders hoch. Dies wird in Abbildung 2 ersichtlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Einfluss des Komplexitätsgrads der Tätigkeit auf die Frustration.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blum und Naylor (1968, 340).
Dauert dieses Ungleichgewicht über einen längeren Zeitraum an, so können ernsthafte Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und im Falle der Unterforderung eben auch ein Boreout-Syndrom die Folge sein (Hörmann & Weber, 2007, 52-56).
2.2.2 Langeweile
Rothlin & Werder (2011, 23) verstehen unter Langweile am Arbeitsplatz einen Zustand, in dem der Arbeitnehmer nicht weiß, was er arbeiten soll, weil es nichts für ihn zu tun gibt. Dies führt zu einem Gefühl der Ratlosigkeit oder Verzweiflung.
In der Wissenschaft wird das Phänomen der „Langeweile“ den Gefühlen bzw. Emotionen zugeordnet. Bei Gefühlen handelt es sich um Reaktionen auf einen Reiz (Stimulus). Diese werden von der entsprechenden Person als mehr oder minder angenehm bzw. unangenehm empfunden, treten unmittelbar auf und sind weitestgehend unabhängig (Betsch, Funke & Plessner, 2011, 124).
Es gibt zwei Arten von Gefühlen: nicht-repräsentatorische und repräsentatorische. Letztere repräsentieren Sachverhalte, die außerhalb des zentralen Nervensystems zu finden sind. Zu dieser Gruppe gehören bedürfnisbezogene Gefühle wie z.B. Hunger oder Durst sowie körperlicher Schmerz, da sie bestimmte physiologische Zustände des Körpers darstellen. Nicht-repräsentatorische Gefühle dagegen, repräsentieren keine physiologischen Sachverhalte, sondern solche, die nur innerhalb des zentralen Nervensystems lokalisiert sind. Sie werden auch als Emotionen bezeichnet (Pekrun, 1988, 100).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Arten von Gefühlen.
Quelle: Eigene Darstellung.
Für den Emotionsbegriff an sich finden sich in der Literatur sehr unterschiedliche Definitionen. Pekrun (1988, 99) hat daraus einen einheitlichen und übergreifenden Emotionsbegriff formuliert: bei einer Emotion handel es sich um ein „spezifisches ganzheitliches Erleben, das bis zu drei Komponenten umfassen kann: (a) einen für die jeweilige Emotion spezifischen, nicht-repräsentatorischen Erlebensanteil [Gefühlsanteil] (affektive Komponente); (b) für die jeweilige Emotion spezifische Kognitionen (kognitive Komponente); und (c) Wahrnehmungen physiologischer und expressiver Abläufe (körperperzeptive Komponente).“
Die drei Komponenten sollen im Folgenden nun noch etwas genauer betrachtet werden:
1.) Affektive Komponente
Sie zeigt, dass Emotionen keine reinen Gedankeninhalte sind, sondern von der jeweiligen Person tatsächlich gefühlt und erlebt werden. Die affektive Komponente ist für das Vorhandensein einer Emotion notwendig und hinreichend; die zwei folgenden Komponenten können fehlen (Götz, 2011, 187; Pekrun, 1988, 107).
2.) Kognitive Komponente
Bei „Kognitionen“ handelt es sich um mentale Repräsentationen von Sachverhalten. Diese werden intern vom zentralen Nervensystem produziert und basieren somit nicht auf sensorischen Input (Götz, 2011, 187; Pekrun, 1988, 107). Mit Emotionen gehen oft auch solche Kognitionen einher, es drängen sich dem Betroffenen also bestimmte Gedanken auf. Erlebt eine Person in einer Situation beispielsweise Stolz, so wird sie auch an zukünftige, positive Konsequenzen denken z.B. das Lob durch andere oder auch eine in Aussicht stehende finanzielle Belohnung (Götz, 2011, 21).
3.) Körperperzeptive Komponente
Diese umfasst zum einen eine physiologische Komponente, also körperliche Reaktionen, die beim Erleben von Emotionen auftreten können. Hat eine Person Angst, erhöht sich z.B. ihr Puls und die Pupillen weiten sich. Zum anderen werden der körperperzeptiven Komponente „expressive Abläufe“ zugeordnet. Dabei handelt es sich um Gesichtsausdrücke und Körperhaltungen, die bei Emotionen spontan auftreten und es dem Gegenüber so ermöglichen, eine Emotion überhaupt wahrzunehmen (Götz, 2011, 21).
Während behavioristische Ansätze davon ausgingen, dass Emotionen direkt von Situationsmerkmalen („Stimuli“) ausgelöst werden, nehmen die meisten seit der „kognitiven Wende“ vorherrschenden kognitiven Emotionstheorien an, dass Emotionen ohne vorauslaufende Kognitionen nicht zu Stande kommen4 (Pekrun, 1988, 107). So entsteht Angst nach Lazarus (1966, 44-55) erst dann, wenn eine Person kognitive Einschätzungen zur Relevanz der Gefahr sowie deren Kontrollierbarkeit vornimmt und diese als problematisch bewertet (concept of appraisal).
Menschliche Emotionen können aber neben der Interpretation gegenwärtiger Situationen auch auf Kognitionen (Gedanken) vergangener und zukünftiger Situationen beruhen (Pekrun, 1988, 109). Ein Kind, das von einem Hund gebissen wurde, wird sich bei Anblick irgendeines Hundes wieder daran erinnern (Kognition einer vergangen Situation) und mit Angst reagieren. Erfährt eine Person in einer Situation ein Erfolgserlebnis, können Gedanken an eine zukünftige Belohnung (Kognition zukünftiger Situation) z.B. zu Vorfreude führen.
Die entscheidende Funktion von Emotionen ist das Auslösen eines bestimmten Verhaltens bzw. der Impulse zu diesem Verhalten (Motivation). Aus evolutionsbiologischer Sicht kann davon ausgegangen werden, dass Emotionen das Überleben sichern sollen, da sie meist ein adaptives (anpassendes) Verhalten hervorrufen (Götz, 2011, 22; Pekrun, 1988, 130).
Der gesamte, beschriebene Prozess der Emotionsauslösung, -bestandteile und –folgen ist in Abbildung 3 nochmals zusammenfassend dargestellt. Dabei ist anzumerken, dass nach Pekrun (1988, 103) nicht nur Kognitionen sondern auch Wahrnehmungen und neurochemische Abläufe Auslöser von Emotionen sein können. Des Weiteren können Emotionen in ein komplexes Geflecht von Bedingungen und Wirkungen eingebettet sein. Alle dargestellten Elemente können also auch wechselseitige Beziehungen zueinander aufweisen, Emotionen somit z.B. auch Kognitionen auslösen (Pekrun, 188, 133). All dies soll hier jedoch nicht weiter erläutert werden und auch in der Darstellung wurde zu Gunsten der Verständlichkeit darauf verzichtet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Grundlegender Prozess Emotionen
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pekrun (1988, 133).
In unserer Sprache gibt es hunderte Wörter zur Bezeichnung von Emotionen. Den Kernbereich typischer Emotionen stellen Freude, Angst, Traurigkeit und Wut dar. Oft genannt werden auch Abneigung/Ekel, Neid, Unruhe, Sehnsucht, Scham und Zuneigung. Dennoch ist es teilweise schwer, Emotionen von Stimmungen (z.B. Nervosität) oder überdauerenden Zuständen (z.B. Schüchternheit) abzugrenzen, da alle drei Konzepte keine scharfen Grenzen aufweisen (Euler, Mandl & Otto, 2000, 33; 37).
Im schulischen und beruflichen Kontext sind vor allem die sogenannten Lern- und Leistungsemotionen von Bedeutung. Diese werden, wie der Name schon vermuten lässt, von Lern- bzw. Leistungssituationen hervorgerufen und unterscheiden sich strukturell und funktional. So treten Lernemotionen beim Erwerb von Wissen und Fertigkeiten auf, Leistungsemotionen in Prüfungssituationen, weshalb Hoffmann & Pekrun (1999, 252) sie auch als „Prüfungsemotionen“ bezeichnen (Hoffmann & Pekrun, 1999, 247; 252). Zu den am häufigsten vorkommenden Prüfungsemotionen gehören Freude, Hoffnung, Erleichterung, Ärger, Angst und Hoffnungslosigkeit, während Freude, Ärger, Angst und Langeweile zu den häufigsten Lernemotionen zählen (Hoffman & Pekrun, 1999, 253). Wie bereits an der Kategorisierung deutlich wird, sind die beiden Konstrukte nicht trennschaft voneinander abgrenzbar, da einige Emotionen wie z.B. Ärger oder Angst sowohl in Lern- als auch in Prüfungssituationen vorkommen.
Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die besonders geeignet sind um Lern- und Leistungsemotionen weiter zu ordnen:
1.) Valenz
Emotionen können subjektiv als positiv oder negativ eingestuft werden (Pekrun, 1998, 233).
2.) Objektgerichtetheit und Zeitorientierung
Emotionen sind immer auf „etwas“ ausgerichtet, egal ob das Bezugsobjekt tatsächlich vorliegt oder es sich nur um eine Kognition handelt (Eder & Rothermund, 2011, 166). Dabei gibt es aufgabenbezogenen und sozial bezogenen Emotionen. Aufgabenbezogenen Emotionen lassen sich noch nach ihrem zeitlichen Bezug in gegenwartsorientierte/tätigkeitsbezogene, vergangenheitsorientierte (retrospektive) oder zukunftsorientierte (prospektive) Emotionen unterteilen (Pekrun, 1998, 233).
3.) Aktivierung
Es gibt aktivierende Emotionen, die zum Handeln motivieren und zu physiologischer Aktivierung führen sowie desaktivierende Emotionen, die mit physiologischer Deaktivierung einhergehen und somit zum Nicht-Handeln motivieren (Lohrmann, 2011, 18; Pekrun, 1998, 234).
4.) Ausrichtung
Intrinsische Emotionen sind auf die Lernhandlung an sich gerichtet, während extrinsische Emotionen auf mit der Lernhandlung verbundene Konzepte gerichtet sind (z.B. Vorfreude auf gute Resultate) (Pekrun, 1998, 234).
Im Folgenden soll nun das Phänomen „Langweile“ anhand dieser Kriterien untersucht sowie dessen Entstehung und Folgen näher betrachtet werden.
Wie bereits angedeutet wurde, handelt es sich bei der Langweile um eine Lernemotion. Es besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass sie eine negative Valenz besitzt, wenn auch teilweise eine unterschiedlich starke Ausprägung angenommen wird. Langeweile ist immer auf eine bestimmte Situation oder Tätigkeit zurückzuführen und gehört deswegen zu den aufgabenbezogenen Emotionen. Sie ist gegenwartsorientiert, kann also weder durch Erinnerung an vergangene noch zukünftige Situationen ausgelöst werden. Außerdem ist sie den desaktivierenden und intrinsischen Emotionen zuzuordnen (Lohrmann, 2011, 16; Pekrun, 233-234). In Tabelle 2 sind die Merkmale der Langeweile nochmals zusammenfassend dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Langeweile als Lernemotion.
Quelle: Eigene Darstellung.
Charakteristisch für Langeweile ist, dass, wie der Begriff schon deutlich macht, die Zeit langsamer zu vergehen scheint, also eine „lange Weile“ andauert (Frenzel, Götz & Pekrun, 2007, 313). Besonders hervorzuheben ist auch, dass Langeweile vor allem in Situationen auftritt, die vom Individuum als unwichtig eingestuft werden. Im Gegensatz zu allen anderen Emotionen, nimmt die Intensität von Langeweile also mit zunehmender wahrgenommener Wichtigkeit ab (Götz, 2004, 141-142; Pekrun, 2006, 317-318).
Die Ursachen von Langweile werden hauptsächlich in den drei Modellen von Pekrun (2000), Hill & Perkins (1985) sowie Robinson (1975) beschrieben (Frenzel, Götz & Haag, 2006, 114). In diesem Kontext, sollen nur einige Aspekte aus dem Modell von Hill & Perkins vorgestellt werden, da sie der Auffassung von Rothlin & Werder am nächsten kommen.
Nach Hill & Perkins können monotone Situationen Ursache von Langeweile sein. Dabei sind jedoch spezifische Situationscharakteristika zu berücksichtigen: Langweile tritt nur dann auf, wenn in der monotonen Situation keinerlei andere Stimulationen vorhanden sind oder eine Zuwendung zu diesen nicht oder nur schwer möglich ist (Perkins, zit. nach Frenzel et al., 2006, 115-116). Am Arbeitsplatz ist dies besonders problematisch. Ein Arbeitnehmer, der eine monotone Arbeit verrichtet oder im schlimmsten Fall gar nichts zu tun hat, hat relativ begrenzte Möglichkeiten sich anderweitig zu beschäftigen. Der Betroffene kann weder tun was er möchte noch kann er einfach nach Hause gehen. Er beginnt sich also zu langweilen (Rothlin & Werder, 2011, 22-23). Des Weiteren kann Langweile auch durch Unterforderung ausgelöst werden (Götz, 2004, 19). Hierdurch wird ein Zusammenhang der beiden ersten Boreout-Elemente deutlich.
Die Folgen von Langweile sind vielfältig. Insgesamt ist anzumerken, dass sich Langeweile als desaktivierende, negative Emotion ungünstig auf die Lern- und Leistungsmotivation auswirkt. Sie senkt sowohl die intrinsische, als auch die extrinsische Motivaiton (Götz, 2011, 50).5 Ihr intrinsischer, negativer Charakter führt meist zu einer reduzierten Aufmerksamkeit und einer damit einhergehenden Leistungsminderung. Außerdem zeigt eine Studie von Frenzel, Götz & Pekrun (2007, 319), dass Langeweile oft zu einem geringeren Wohlbefinden der betroffenen Personen führt. Bei Langeweile, die durch Unterforderung entsteht, kommt es neben Monotonie und Eintönigkeit vor allem zu Frustration, und Lustlosigkeit (Titz, 2001, 123). In der Literatur werden auch immer wieder positive Folgen der Langweile diskutiert wie z.B. die Initiierung kreativer Prozesse. Im Schulkontext ist diese Ansicht jedoch kaum tragbar (Frenzel et al., 2007, 314; 328) und auch während der Arbeit kann dies maximal für sehr kurze Zeitspannen der Langeweile gelten.
Um der Langweile zu entkommen, wenden Personen verschiedenen Copingstrategien an, auf die jedoch erst im Kapitel 2.4 näher eingegangen wird (Lohrmann, 2011, 29).
Generell ist anzumerken, dass es zum Thema Langeweile immer noch recht wenig empirische Untersuchungen gibt. Dennoch konnte bereits in einigen Studien nachgewiesen werden, dass das Phänomen in der Schule sehr häufig auftritt (Frenzel et al., 2007, 313). Am Arbeitsplatz ist die Langeweile weitgehend unerforscht, einige der im Kapitel 1 aufgeführten Erhebungen lassen jedoch vermuten, dass die Langeweile auch dort angetroffen werden kann.
2.2.3 Desinteresse
Der Begriff „Desinteresse“ findet in der Literatur ähnlich wenig Beachtung wie der Begriff „Unterforderung“. Beim gegenteiligen Ausdruck, dem Interesse, verhält sich dies jedoch anders. Er wurde in der Literatur von namhaften Autoren wie Neuendorff, Herbart, Dewey, Kerschensteiner oder Piaget behandelt und soll daher im Folgenden kurz dargestellt werden.
Der Begriff „Interesse“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich „dazwischen sein in Raum und Zeit“, „gegenwärtig sein, beiwohnen“ bzw. „es ist von Wichtigkeit, es ist von Bedeutung, es ist daran gelegen“ (Neuendorff, 1973, 10). In der Literatur wird er sehr unterschiedlich definiert, je nachdem in welchem Kontext er Verwendung findet. Auch in der Psychologie hängt seine Bedeutung sehr stark von der „theoretischen Heimat“ des jeweiligen Autors ab (Todt, 1978, 9).
English & English (1958, 271) liefern in ihrem „Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms” erstmals eine Zusammenfassung der Bedeutungen und Elemente der verschiedenen Definitionen. Diese können jedoch nicht als gänzlich unabhängig voneinander gesehen werden.
1.) Interesse als Aufmerksamkeitseinstellung
2.) Interesse als Tendenz einem Gegenstand selektive Aufmerksamkeit zu schenken
3.) Interesse als ein Gefühl oder eine Einstellung, dass ein Objekt oder Ereignis für einen selbst bedeutsam ist
4.) Interesse als Streben danach, die Merkmale eines Objektes vollständig zu explorieren
5.) Interesse als ein Gefühl, ohne das es einer Person nicht möglich ist etwas zu lernen
6.) Interesse als ein angenehmes Gefühl, das mit Tätigkeiten einhergeht, die ungehindert ihr Ziel erreichen
7.) Interesse als Tendenz sich mit einer Tätigkeit zu beschäftigten, nur um ihrer selbst willen (intrinsische Motivation)
Zwei Hauptmerkmale werden in der Auflistung ersichtlich: Interesse scheint mit Aufmerksamkeit bzw. Aktivität verknüpft zu sein und somit eine antreibende, dynamische Kraft zu besitzen (Motivation). Außerdem richtet es sich immer auf ein Objekt und kann somit als gegenstandsbezogen angesehen werden. Insgesamt wird Interesse in den verschiedenen Definitionen entweder als (positives/angenehmes) Gefühl oder als Tendenz (Disposition) beschrieben (Prenzel, 1988, 36-37).
Zusätzlich zu den bereits genannten, finden sich in der Literatur zwei weitere Merkmalsbereiche. So ist zum einen festzuhalten, dass Interesse auch einen kognitiven Aspekt beinhaltet, da die Gegenstände, auf die sich das Interesse richtet, vom Individuum kognitiv repräsentiert werden. Setzt sich ein Individuum mit einem Gegenstand seines Interesses auseinander, wird diese Repräsentierung zunehmend ausdifferenziert. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Interesse mit Werten und Wertschätzungen einhergeht. Der Gegenstand des Interesses ist für eine Person also von Wert (Krapp, 2009, 55-56; Prenzel, 1988, 36-37).
In der pädagogischen Psychologie ist vor allem die motivationale Komponente des Interesses von Bedeutung. Sie beeinflusst das Lernen und die Lernergebnisse positiv (Krapp, 1998, 185). Im pädagogischen Kontext werden zwei Interessengebiete unterschieden: das individuelle bzw. persönliche Interesse sowie das situationale Interesse bzw. die Interessantheit.
Individuelles/persönliches Interesse
Dies ist die Vorliebe eines Individuums für ein bestimmtes Wissensgebiet. Es wird davon ausgegangen, dass persönliche Interessen langfristig bestand haben und das Lernergebnis beeinflussen. So wirkt sich ein hohes persönliches Interesse positiv auf die Motivation und das Lernergebnis aus, ein niedriges negativ. Aus handlungstheoretischer Sicht wird angenommen, dass sich dass Individuum, wenn es frei über seine Zeit verfügen kann, ohne äußere Veranlassung, häufig und freudig mit solchen Aktivitäten beschäftigt, die seinen persönlichen Interessen entsprechen.
Situationales Interesse/Interessantheit
Es gilt als erwiesen, dass sich ein Individuum, trotz fehlenden persönlichen Interesses, einem Gegenstandsbereich verstärkt zuwendet, wenn dieser interessant gemacht wird. Man spricht dann vom situationalen Interesse. In der Schule kann dies z.B. durch die Lernumgebung, den Lerngegenstand oder eine gute didaktische Aufbereitung erreicht werden. Es ist anzumerken, dass beide Konzepte Teile eines übergeordneten Interessenskonstrukts sind und sich gegenseitig beeinflussen. So kann z.B. ein hohes situationales Interesse das persönliche Interesse steigern oder ein hohes persönliches Interesse eine nicht vorhandene Interessantheit ausgleichen (Prenzel & Krapp, 1992, 12-15).
Insgesamt ist auffallend, dass der Begriff des Interesses eher positiv geprägt ist. Er geht mit angenehmen Gefühlen einher, erhöht die Aufmerksamkeit und führt zu intrinsischer Motivation. Es kann somit angenommen werden, dass „Desinteresse“, als Gegenteil zum Interesse, eher als negativ aufzufassen ist, besonders auch in Bezug auf Motivation und Leistung im Beruf.
Rothlin & Werder (2007, 20) definieren „Desinteresse“ als „Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber der Arbeit und dem Arbeitgeber.“ Sie betonen, dass der Mitarbeiter keinerlei Interesse an seiner Branche und deren Produkten zeigt. Seine Arbeit ist für ihn irrelevant und wertlos und er beschäftigt sich außerhalb seiner Arbeitszeit niemals freiwillig mit Themen, die seine Arbeit betreffen (Rothlin & Werder, 2007, 20). Es wird deutlich, dass Rothlin & Werder von einem fehlenden persönlichen Interesse ausgehen, das mit einem negativen Gefühl und einer fehlenden Motivation des Arbeitnehmers einhergeht.
Einige weiterer Aspekte, die Rothlin und Werder in ihrer Definition aufnehmen, sind die fehlende Identifikation des Mitarbeiters mit seinem Unternehmen und seiner Arbeit sowie die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal des Unternehmens und dessen Zielen (Rothlin & Werder, 2007, 20-21). Diese sind eher in das Gebiet der Personalwirtschaft bzw. Arbeits- und Organisationspsychologie einzuordnen und entsprechen weitgehend den Begriffen des Commitments und der Identifikation bzw. des Job Involvements.
Unter Commitment wird allgemein die Bindung eines Mitarbeiters an die Organisation, in der er arbeitet, bezeichnet (Blicke, Nerdinger & Scharper, 2011, 77). In einer der bekanntesten Definitionen von Mowday, Porter & Steers (1982, 27) wird die allgemeine Definition um drei Aspekte erweitert: ein Mitarbeiter mit einem hohen Commitment akzeptiert und glaubt an die Ziele und Werte seines Unternehmens. Er setzt sich für sein Unternehmen ein und möchte unbedingt Teil dessen bleiben. In der Literatur wird zusätzlich zwischen drei Arten von Commitment unterschieden, wobei die Definition von Mowday et al. am ehesten der des affektiven Commitments zuzuordnen ist (Allen & Meyer, 1997, 11; Felfe, 2008, 27-36):
1.) Kalkulatives Commitment
Ein Mitarbeiter bleit bei seinem Unternehmen, weil ihm die Kosten eines Wechsels zu hoch erscheinen. Möglicherweise sind die Chancen auf dem Arbeitsmarkt schlecht oder er würde mit Gehaltseinbußen rechnen müssen.
2.) Affektives Commitment
Liegt eine affektive Bindung vor, bleit der Mitarbeiter bei seinem Unternehmen, weil er dies wirklich möchte. Er identifiziert sich mit ihm, engagiert sich für die Arbeit und fühlt eine emotionale Verpflichtung gegenüber seinem Arbeitgeber.
3.) Normatives Commitment
Der Arbeitnehmer fühlt sich dem Unternehmen moralisch verpflichtet und eine Kündigung wird aus diesen Gründen als verwerflich angesehen.
Obwohl einige Autoren versuchen eine Trennung vorzunehmen, ist der Begriff der Identifikation weitgehend gleichzusetzten mit dem des affektiven Commitments (Ammon, 2006, 8). Ein Mitarbeiter, der eine hohe Identifikation aufweist, fühlt sich seinem Unternehmen zugehörig und setzt sich für dessen Ziele ein (Lieber, 2007, 16).
Job Involvement hingegen, beschreibt nicht die Bindung des Mitarbeiters an die größere Organisation, sondern die Bindung an seinen jeweiligen Job. Einem Mitarbeiter mit einem hohen Job Involvement liegt seine Arbeit wirklich am Herzen und sie und seine Leistung sind wichtig für sein Selbstwertgefühl (Campell et al., 2010, 63). Es ist davon auszugehen, dass Mitarbeiter, die eine hohe Bindung an ihre Arbeit haben, auch eine hohe Bindung an die übergeordnete Organisation (Commitment) besitzen (Campell, Judge & Robbins, 2010, 63; Mowday, Porter & Steers, 1978, 11).
In ihrer Definition gehen Rothlin und Werder also, neben einem fehlenden persönlichen Interesses, hauptsächlich von einem fehlenden affektiven Commitment (bzw. Identifikation) und einem Mangel an Job Involvement aus. Jedoch kann auch kalkulatives Commitment dazu beitragen, dass ein Jobwechsel trotz bevorstehenden Boreout-Syndroms nicht in Erwägung gezogen wird (Rothlin & Werder, 2007, 10).
2.3 Entwicklung und Abgrenzung zur inneren Kündigung
Insgesamt ist festzuhalten, dass es durchaus normal ist und noch lange nicht von einem Boreout-Syndrom gesprochen werden kann, wenn ein Arbeitnehmer an einem typischen Arbeitstag Momente der Unterforderung, Langweile und des Desinteresses erlebt. Tauchen diese nur kurzzeitig und in geringer Ausprägung auf, können sie sogar positive Effekte haben. So können Unterforderung und Langeweile kreative Prozesse auslösen oder für das Pflegen sozialer Kontakte im Betrieb genutzt werden. Aufkommendes Desinteresse kann einen Arbeitnehmer dazu veranlassen, sich Gedanken darüber zu machen, was ihn wirklich interessiert und ihn zum Handeln veranlassen. Dies kann ein klärendes Gespräch mit dem Arbeitgeber über neue Aufgaben oder auch einen Jobwechsel zur Folge haben (Rothlin & Werder, 2007, 26).
Treten Unterforderung, Langweile und Desinteresse jedoch verstärkt über einen längeren Zeitraum auf, so kann dies, wie in den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt, sehr negative Effekte auf die physische und psychische Verfassung des Arbeitnehmers sowie auf seine Motivation und Arbeitsleistung haben. Besonders problematisch ist auch, dass sich die drei Elemente des Boreout-Syndroms gegenseitig bedingen (Rothlin & Werder, 2007, 14). So kann aus qualitativer und quantitativer Unterforderung schnell Langweile entstehen (Ulich, 2011, 482). Ein permanent gelangweilter Mitarbeiter wird früher oder später auch das Interesse an seiner Arbeit verlieren (Rothlin & Werder, 2007, 14). Schleichend kann so ein Borout-Syndrom entstehen. Der Mitarbeiter beginnt sich unzufrieden zu fühlen, ist nicht mehr motiviert und distanziert sich auch emotional von seiner Arbeit. Er hat keine Lust mehr zu arbeiten und beginnt Strategien zu entwickeln, sich die ungeliebte Arbeit vom Hals zu halten und dennoch ausgelastet und beschäftigt zu wirken (Rothlin & Werder, 2007, 29).
Die Beschreibung des Boreout-Syndroms mag an den Begriff der „inneren Kündigung“ erinnern. Obwohl beide ähnliche Ursachen und auch Folgen haben und sich auch Verlauf und Probleme sehr ähneln, sind sie dennoch nicht identisch (Rothlin & Werder, 2009, 166-171). Bei der inneren Kündigung reagiert ein Mitarbeiter meist bewusst auf ein empfundenes Ungleichgewicht zwischen Arbeitseinsatz und Belohnung. Er reduziert die Arbeitsleistung um das Gleichgewicht wiederherzustellen und distanziert sich vom Unternehmen (Hilb, 1992, 5). Beim Boreout-Syndrom liegt die Ursache der Leistungsminderung in der dauerhaften Unterforderung, der Langeweile und dem Desinteresse und dem Versuch dies zu verheimlichen. Dennoch ist anzumerken, dass beide Konzepte durchaus Wechselwirkungen aufweisen können. So kann ein Boreout-Syndrom auf langer Sicht eine innere Kündigung zur Folge haben. Eine bestehende innere Kündigung, kann im Umkehrschluss aber auch ein Boreout-Syndrom begünstigen (Rothlin & Werder, 2009, 166-171).
2.4 Boreout-Strategien und Boreout-Paradox
Im Allgemeinen reagieren Individuen, die Stress und Belastungen ausgesetzt sind, mit sogenannten Coping- bzw. Bewältigungsstrategien. Folkman & Larzarus (1984, 141) definieren Coping als „sich kontinuierlich verändernde, kognitive und verhaltensbezogene Bemühungen einer Person, um spezifische externe und/oder interne Anforderungen, die als Ressourcen übersteigend und anstrengend bewertet werden, zu bewältigen (Übers. d. Verf.)“. Beim Coping handelt es sich also um einen Prozess der stattfindet, wenn sich die Bedingungen in der Mensch-Umwelt Beziehung verändern und diese Veränderung vom Individuum als belastend empfunden wird (Folkman & Lazarus, 1984, 142). Grundsätzlich werden zwei Arten von Coping-Strategien unterschieden (Ehlert, 2003, 116; Folkman & Lazarus, 1984m 150-153; Lohrmann, 2008, 29):
[...]
1 In dieser Arbeit soll der Begriff wie folgt verstanden werden: Bei einer inneren Kündigung gibt es im Gegensatz zur offenen Kündigung keine Auflösung des Arbeitsvertrages. Der Mitarbeiter entschließt sich jedoch, bewusst oder unbewusst, auf jegliches Engagement am Arbeitsplatz zu verzichten (Brinkmann & Stapf, 2005, 16-18; Hilb, 1992, 5).
2 Ausbildungsdäquanz meint hier den Grad der Übereinstimmung zwischen den Qualifikationen, die im Bildungssystem erworben wurden, und dem Anforderungsprofil der ausgeübten Tätigkeit am Arbeitsmarkt (Rudwik, 2012, 2).
3 Alle folgenden englischen Übersetzungen können online unter www.dict.cc nachgelesen werden.
4 Das bis dahin in der Psychologie vorherrschende Paradigma des Behaviorismus, welches menschliches Verhalten in Reiz-Reaktions-Ketten zerlegt und dabei innerpsychische Vorgänge vollkommen außer Acht lässt, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts im Rahmen der „kognitiven Wende“ vom Kognitivismus abgelöst (Göhlich, Wulf & Zirfas, 2007, 9). Es wurden nun verstärkt innerpsychische Vorgänge untersucht, wie das Bewusstsein des Menschen und damit verbundene kognitive Prozesse (z.B. Denken, Wahrnehmen und Urteilen) (Roumois, 2007, 109). Maßgeblich zu dieser Wende trugen Wissenschaftler wie Piaget, Bruner und Neisser bei (Göhlich et al., 2007, 10).
5 Intrinsische Motivation liegt vor, wenn Tätigkeiten ihrer selbst willen ausgeführt werden. Bei extrinsischer Motivation wird die Aufgabe nicht ihrer selbst willen, sondern als Mittel zum Zweck ausgeführt (Götz, 2011, 50).
- Arbeit zitieren
- Lisa Günthner (Autor:in), 2013, Das Boreout-Syndrom am Arbeitsplatz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/276502
Kostenlos Autor werden
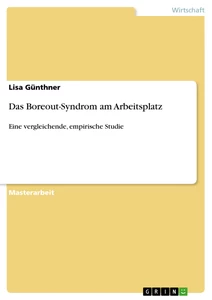



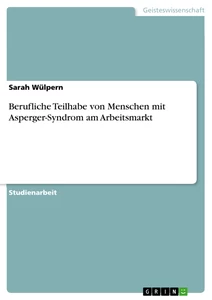
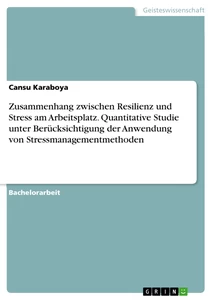
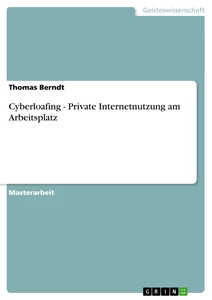













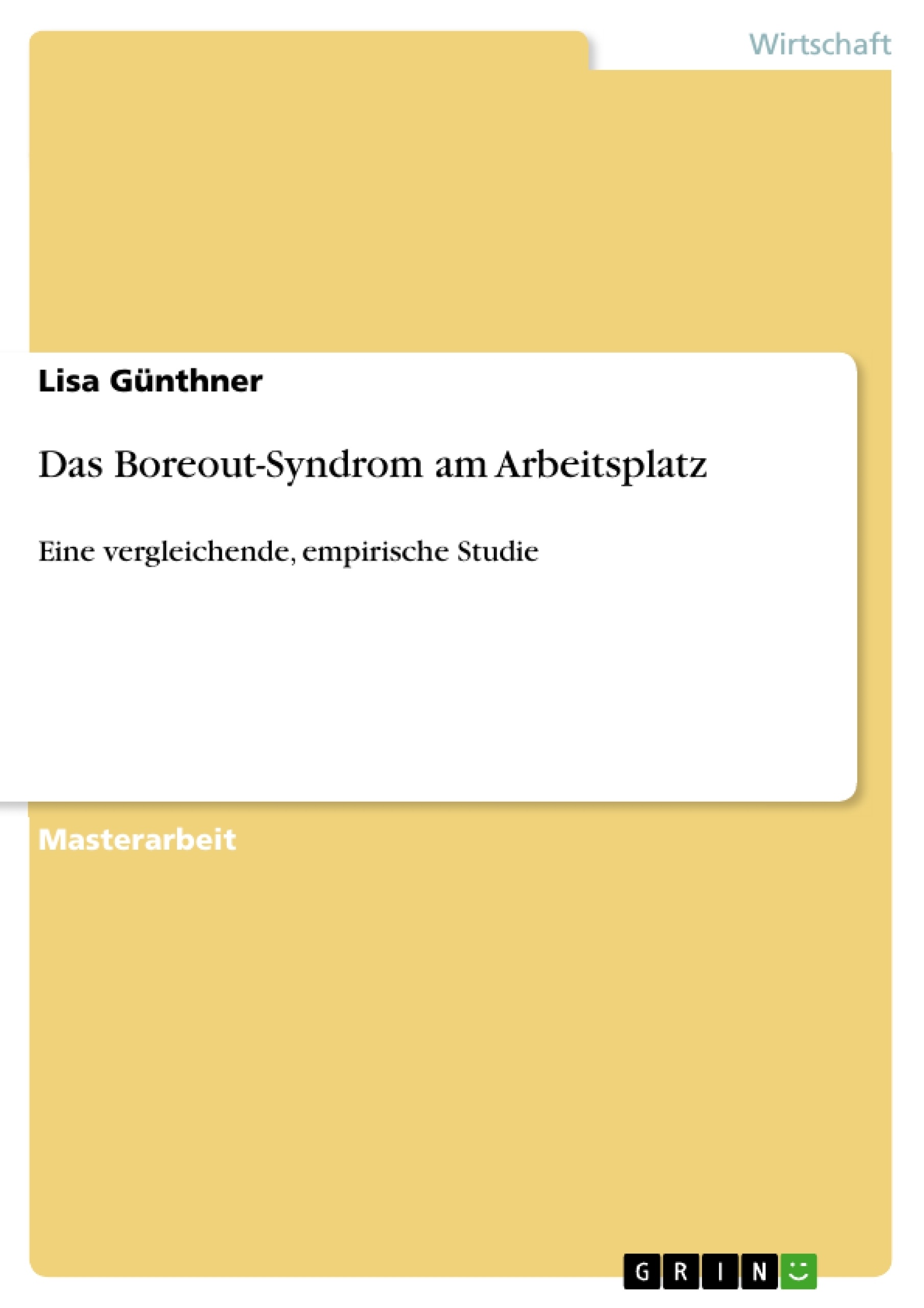

Kommentare