Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Migration in der Bundesrepublik Deutschland
1.1 Arbeitsmigration
1.2 Aussiedlung
1.3 Flucht
2. Phasen der Ausländer_innenpolitik
2.1 DieAnwerbungsphase (1955-1973)
2.2 Die Konsolidierungspolitik (1973-1979)
2.3 Die Integrationspolitik (1979-1981)
2.4 Die Wende von der Integration zur Begrenzung (1981-1990)
2.5 Die Phase der Asylpolitik (1990-1998)
2.6 „Deutschland ist ein Einwanderungsland“ (1998-2004)
2.7 Das erste Zuwanderungsgesetz (2005)
3. Ausländer_innenpädagogik
3.1 Klassische Assimilations-Konzepte
3.1.1 Der „race-relation-cycle“ von R.E.Park und E.W.Burgess
3.1.2 Das Sieben-Stufenmodell von R.Taft (1957)
3.1.3 Die Assimilationstheorie von M.Gordon (1964)
3.2 Die Assimilationstheorie nach H. Esser (1980)
3.3 Die Kritik an der Ausländer_innenpädagogik
4. Multikulturalismus 37
4.1 Formen des Multikulturalismus
4.2 Theorien des „Mainstream-Multikulturalismus“
4.2.1 Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung-Charles Taylor (1992)
4.2.2 Multikulturelle Staatsbürgerschaft-Will Kymlicka (1995)
4.2.3 Der Kulturbegriff im „Mainstream-Multikulturalismus“
4.3. Die Multikulturalismusdebatte in Deutschland
Inhaltsverzeichnis Seite
4.3.1 Die Befürworter_innen: Multikulturelle Gesellschaft als ´Chance`
4.3.2 Die Gegner_innen: Multikulturellen Gesellschaft als ´Bedrohung`
4.3.3 Die Kritiker_innen: Multikulturalismus als ´Ideologie`
5. Interkulturelle Pädagogik
5.1 Interkulturelle Pädagogik nach Wolfgang Nieke (1995)
5.1.1 Kultur und Kulturkonflikte
5.1.2 Der Kulturrelativismus und der „aufgeklärte Ethnozentrismus“
5.1.3 Der vernünftige Umgang mit Konflikten
5.1.4 Die Ziele Interkultureller Pädagogik
5.2. Die Kritik an Konzepten Interkultureller Pädagogik
5.3 Weiterführungen der Interkulturellen Pädagogik
5.3.1 Transkulturalität
5.3.2 Migrationspädagogik
Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Einleitung
Die Debatte um Migration, Integration und Bildung in Deutschland hält seit Jahrzehnten an und erlebt immer wieder Hochkonjunkturen. Auch die pädagogische Forschung und Praxis widmet sich seit vielen Jahren diesen Phänomenen. Es wäre hier aber nicht unangebracht auch von Problemen zu sprechen. Denn tatsächlich ist es so, dass der öffentliche Diskurs um Migration in den meisten Fällen mit Problembeschreibungen verbunden ist. Die öffentliche Meinung über Migrant_innen[1] in Deutschland ist negativ geprägt. Die Medien aber auch die Politik trugen wesentlich dazu bei. Der Umgang der Bundesrepublik mit ihren Migrant_innen war lange Zeit maßgeblich geprägt von dem Leitsatz: „Deutschland ist kein Einwanderungsland“. Noch heute wird von konservativen Kreisen der Gesellschaft bestritten, dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist. Wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, diese Tatsache ist noch heute für viele eine unangenehme Realität.
Auch im erziehungswissenschaftlichen Diskurs um Migration und Bildung werden Migrant_innen mit Problemen in Verbindung gebracht. Diese Wahrnehmung in Wissenschaft und Alltag gründet auf der zunehmenden kulturellen Pluralisierung der deutschen Gesellschaft, die mit der Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer_innen und dem Nachzug ihrer Familien zunehmend sichtbar wurde. Dies war und ist vor allem denjenigen ein Dorn im Auge, die Deutschland als eine kulturell homogene Nation verstehen. Die pädagogische Arbeit sah sich in Anbetracht der neuen Zielgruppe der Migrant_innen neuen Herausforderungen aber auch neuen Problemen ausgesetzt.
„Gastarbeiter_innen“ die später „Ausländer_innen“ und seit der Jahrtausendwende „Migrant_innen“ genannt wurden, trugen ihre fremde Kultur in die deutsche Gesellschaft hinein. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001, hatte man in den Migrant_innen aus der Türkei schließlich „die Muslime“ entdeckt. Ihre Kultur wirkte daraufhin nicht mehr nur fremd, sondern auch bedrohlich. Der „deutschen Kultur“ stand „der Islam“ entgegen. Zwei scheinbar unvereinbare Kulturen. Doch was sind Kulturen überhaupt? Wie findet der Kulturbegriff Verwendung? Warum entstehen Kulturkonflikte? Eine Antwort auf diese Fragen suche Ich in migrationspädagogischen Konzepten, die im Laufe der vergangen sechs Jahrzehnte als Reaktion auf die migrationsbedingte kulturelle Pluralisierung entwickelt wurden.
Mein Interesse an diesem Thema wurde durch mediale Diskurse um kulturelle Zugehörigkeit und Anerkennung sowie durch persönliche Erfahrungen mit kulturellen Zuschreibungen und vermeintlichen „Kulturkonflikten“ geweckt.
Viele wissenschaftliche Disziplinen beschäftigen sich mit Kultur, eine einheitliche Definition von Kultur gibt es nicht. Vielmehr wird der Kulturbegriff je nach Zusammenhang neu bestimmt. Kultur ist also relativ zu ihrem Bezugsrahmen. Dabei ist Kultur mehr als nur ein bestimmtes Produkt menschlicher Ausdruckskraft, wie die so genannte Hochkultur. Der Kulturbegriff wird auch verwendet für Gruppen von Menschen mit einer gemeinsamen Wertevorstellung. Und er wird angewendet auf Menschen, die ein bestimmtes Merkmal der Differenz teilen. Dieses Differenzmerkmal grenzt eine kulturelle Gruppe von anderen Kulturgruppen ab.
Der Kulturbegriff wird in den Sozial- und Kulturwissenschaften von Beginn an gebraucht und intensiv diskutiert und somit auch unterschiedlich definiert. Aus der evolutionistischen Perspektive beispielsweise, entwickelt sich Kultur als zivilisatorische Leistung linear in mehreren Stufen. Demnach gibt es entwickelte Kulturen und unterentwickelte, was unvermeidlich zu Hierarchisierungen führt. Kulturrelativistische Positionen betonen hingegen die Gleichwertigkeit der Kulturen. Diese Position hat in der klassischen Interkulturellen Pädagogik eine große Bedeutung und findet sich auch in Multikulturalismuskonzepten. Sie ist dem Vorwurf der Kulturalisierung und Ethnisierung ausgesetzt, da Kultur in vielen Zusammenhängen als „Nationalkultur“ verstanden und mit „Ethnie“ verknüpft wird.
Vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den politischen gesellschaftlichen und erziehungswissenschaftlichen Diskursen und Entwicklungen um die Themen Migration, Bildung und Kultur. Kultur als zentrale Differenzkategorie wird in den verschiedenen Ansätzen der Migrationspädagogik[2], nach ihrem jeweiligen theoretischen Kontext unterschiedlich gehandhabt und definiert.
Der erziehungswissenschaftliche Umgang mit migrationsbedingten kulturellen Differenzen soll anhand migrationspädagogischer Konzepte der „Ausländer_innenpädagogik“, des „Multikulturalismus“ und der „Interkulturellen Pädagogik“ erläutert werden.
Dazu werden die theoretischen Hintergründe der jeweiligen Konzepte vorgestellt. Angesichts der Fülle an Publikationen und Theorien und für eine bessere Übersichtlichkeit werden ausschließlich markante Diskursstränge der einzelnen Konzepte und Theorien der Ausländer_innenpädagogik in Kapitel drei, des Multikulturalismus in Kapitel vier und der Interkulturellen Pädagogik in Kapitel fünf, Berücksichtigung finden.
Einführend werde ich in Kapitel eins zunächst allgemeine Bedingungen von Migrationsprozessen darstellen und die für die Zuwanderung nach Deutschland relevanten Migrationsformen darstellen. In Kapitel zwei folgt eine Zusammenstellung der für diese Migrationsformen gewichtigen ausländer_innenpolitischen Rahmenbedingungen der Jahre 1955 bis 2005. Dabei wurden diese, aus Gründen der Übersichtlichkeit und des besseren Verständnisses, in sieben Phasen eingeteilt.
Ziel ist es die Bedeutung der Kategorie Kultur im pädagogischen Umgang mit Migrant_innen herauszuarbeiten. Dabei liegt der Fokus auf den erziehungswissenschaftlichen Theorien. Die Umsetzung in die pädagogische Praxis kann aufgrund des begrenzen Rahmens nur im geringen Umfang dargestellt werden.
1. Migration in der Bundesrepublik Deutschland
Migration als Wanderungsbewegung ist kein neues Phänomen. Schon immer wanderten Menschen aus den unterschiedlichsten Motiven heraus, über bestimmte Grenzen hinweg. Migration wird durch eine Vielzahl zusammenwirkender Faktoren demographischer, kultureller, politischer, ökonomischer und sozialer Art verursacht, welche auf der persönlich-individuellen, als auch auf der gesellschaftlich-strukturellen Ebene angesiedelt werden können (vgl. Han 2005:8). Der Begriff „Migration“ umfasst eine Vielzahl an Phänomenen, wie Formen der Zu- und Auswanderung oder die Konstruktion des „Eigenen“ und des „Fremden“ (vgl. Mecheril 2010:11). Er ist sowohl in der deutschen Alltagssprache, als auch in der Fachsprache der Sozialwissenschaften heimisch geworden. Eine einheitliche Definition gibt es aber nicht. Mit dem Phänomen der Migration setzt sich eine Vielzahl unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen auseinander, dementsprechend unterschiedlich sind die Forschungsschwerpunkte und Definitionen des Begriffs. Für die Soziologie und Pädagogik stehen in erster Linie die individuellen und gesellschaftlichen Folgen der Migration und die Bildungssituation der so genannten „zweiten und dritten Generation“, sowie Methoden der Interkulturellen Erziehung im Zentrum des Interesses (vgl. Treibel 1990:17f.).
Unter Migration kann „jede Ortsveränderung von Personen“ (Hoffmann-Nowotny 1973:107) und „ein permanenter oder semipermanenter Wechsel des Wohnsitzes“ (Heberle 1955:2, zitiert nach Treibel 1990:18) verstanden werden. Doch Migration bezieht sich nicht nur auf räumliche oder zeitliche Aspekte, sondern sie bewirkt auch bedeutende soziale Veränderungen für die wandernden Individuen, die Herkunftsgesellschaft und die Aufnahmegesellschaft der Migrant_innen (vgl. Treibel 1990:13). Geprägt durch den Kontext der „Ausländer_innenbeschäftigung“ ab den 1950er Jahren, wird der Begriff „Migration“ heute in öffentlichen Diskursen, hauptsächlich in Bezug auf ehemalige „Gastarbeiter_innen“ und deren Familien und Nachkommen verwendet. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass davon ausgegangen wurde, die angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte würden nur eine begrenzte Zeit in Deutschland verweilen und zum anderen damit, dass bis Ende der 1990er Jahre an der offiziellen Selbstdarstellung „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ festgehalten wurde. So wurde Anfang des 21. Jahrhunderts aus den ehemals „Gastarbeiter_innen“ und „Ausländer_innen“ oder „ausländische Mitbürger_innen“ genannten De-facto Einwander_innen und ihren Nachkommen, „Migrant_innen“ beziehungsweise „Personen mit Migrationshintergrund“.
Die Konsequenzen dieser Selbstdarstellung, die Unterschätzung der sozialen Folgen von Migration, sowie das Verständnis von „Nation“ und des „Deutsch-Seins“, prägen damals wie heute, das gesellschaftliche Zusammenleben, sowie den Bereich der Erziehung und Bildung (vgl. Mecheril 2010:24). Die Entstehung pädagogischer Konzepte als Reaktion auf die Anwesenheit von Migrant_innen und die Institutionalisierung der Interkulturellen Pädagogik wurden maßgeblich von Wirtschaft und Politik angetrieben und sind daher unabhängig von diesen zwei Bereichen schwer beschreibbar (vgl. Borelli 1986:2).
Die Ursachen und Motive für Migration, sowie ihre Richtung und Formen, wandeln sich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen und sind sehr vielfältig. Es wird unterschieden, ob es sich um Migration innerhalb der staatlichen Grenzen, um Binnenmigration oder um internationale Migration handelt und zwischen temporärer und dauerhafter Migration. Die Übergänge sind hierbei fließend. So war beispielsweise die Migration der ehemaligen „Gastarbeiter“ temporär gedacht, entwickelte sich aber in den meisten Fällen zu einer dauerhaften Migration, einer Einwanderung beziehungsweise Niederlassung.
In Bezug auf die theoretische Erklärung der Ursachen der Migration gibt es eine Reihe von Modellen, wie das Push-Pull-Modell (Lee 1972), welches nach Abstoßungsfaktoren (Push-Faktoren) in der Auswanderungsgesellschaft und nach Anziehungsfaktoren (Pull-Faktoren) in der Aufnahmegesellschaft sucht. Das Modell der Kettenmigration sieht das Motiv zur eigenen Migration in den persönlichen (Verwandtschafts-) Beziehungen, dem Informationsaustausch und den Unterstützungsangeboten von bereits gewanderten Migrant_innen (vgl. Han 2005:12ff.). Oft wird im Zusammenhang der Ursachen für Migration auch zwischen freiwilliger Migration und Zwangsmigration unterschieden. Diese Kategorisierung ist jedoch problematisch, da sie der Komplexität des Migrationsphänomens nicht gerecht wird und nach monokausalen Begründungen sucht.
In Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland, dem wichtigsten Ziel von Migrant_innen in Europa, kristallisieren sich vor allem drei Migrationsformen heraus: Arbeitsmigration, Aussiedlung und Flucht (vgl. Mecheril 2004:28). Im weiteren Verlauf dieser Arbeit bezieht sich Migration auf den Aspekt der Zuwanderung.
Im Folgenden sollen die für die neuere deutsche Migrationsgeschichte (nach 1950) relevanten drei Migrationsformen und Migrant_innengruppen kurz vorgestellt werden.
1.1 Arbeitsmigration
Eine Form von Migration stellt die Arbeitsmigration dar. Wie der Begriff bereits konkretisiert, handelt es sich um eine Wanderung von Menschen zum Zwecke der Arbeitsaufnahme, die von der konkreten Arbeitsmarktpolitik eines Landes und den strukturellen Bedingungen der Wirtschaft bestimmt wird. Wird der Mehrbedarf an Arbeitskräften in einer wachstumsorientierten Wirtschaft durch den heimischen Arbeitsmarkt nicht gedeckt, kann er durch die Rekrutierung von Arbeitskräften ausländischer Märkte ausgeglichen werden (vgl. Han 2005:86). Die Zuwanderung von Arbeitsmigrant_innen, ob erzwungen oder freiwillig, ist in der Deutschen Geschichte nicht neu, doch die nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzende wirtschaftliche Wachstumsphase in den westlichen Industrieländern, brachte eine neue innereuropäische Arbeitsmigration aus dem Süden in den Nordwesten mit sich. Die als vorübergehend geplante Arbeitsmigration geht oft in eine Einwanderung über, vor allem wenn die ökonomischen Ziele nicht erreicht wurden oder sich die politische und ökonomische Situation in den Herkunftsländern verschlechterte.
So blieben auch viele der so genannten „Gastarbeiter_innen“, die durch bilaterale Abkommen ab 1955 für den deutschen Arbeitsmarkt angeworben wurden. Der Begriff „Gastarbeiter_in“ ist symbolisch für das Verständnis der Aufnahmegesellschaft von den ausländischen Arbeitskräften, aber auch das der Migrant_innen selbst, die ebenso nicht geplant hatten, auf Dauer zu bleiben (vgl. Treibel 1990:85).
Mit dem, im Rahmen der Ölkrise verhängten „Anwerbestopps“ im Jahr 1973, war die Zuwanderung von ausländischen Arbeitnehmer_innen aus Nicht-EG-Staaten nur noch in geringerem Umfang und durch Ausnahmeverordnungen möglich. Viele „Gastarbeiter_innen“ beschlossen in Deutschland zu bleiben, um ihr Aufenthaltsrecht nicht zu verlieren und holten ihre Familien nach. Die „Familienzusammenführung“ ist eine Migrationsform, die stark mit der Arbeitsmigration zusammenhängt. Aufgrund der Familienzusammenführung der „Gastarbeiter_innen“, die bis Ende der 1980er andauerte, wuchs die ausländische Bevölkerung in Deutschland beträchtlich (vgl. Marburger 1991:22). Auch die Zahl der schulpflichtigen Kinder, die in den ersten Jahren der „Gastarbeiter_innen“-Migration noch sehr gering gewesen war, stieg in kurzer Zeit stark an (vgl. Auernheimer 2003:35).
Die „Anwerbestoppausnahmeverordnung“ (ASAV) von 1990 ermöglichte die Einstellung ausländischer Arbeitskräfte nach Bedarf, ohne den Anwerbestopp von 1973 aufzuheben. Durch die Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit, der Ausländerbehörden, der lokalen Arbeitsagenturen und der Visa-Vergabestellen, sowie durch zahlreiche Änderungen und Ergänzungen wurde das deutsche System der Arbeitsmigration immer komplizierter und entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem langen Katalog von Ausnahmen innerhalb einer restriktiven Migrationspolitik (vgl. OECD 2013:77).
Im Jahr 2000 wurde die „Green Card“ für ausländische Fachkräfte aus der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT-Branche), eingeführt. Auch wenn die „Green Card“-Initiative aufgrund der geringen Nachfrage scheiterte, stieß sie eine breite Debatte zur Reform der deutschen Migrationspolitik an (vgl. ebd.:71).
Erst fünf Jahre später, am 01.01.2005, trat schließlich nach langwierigen und konfliktreichen Verhandlungen, das erste Zuwanderungsgesetz der Bundesrepublik Deutschland mit dem Titel „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthaltes und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern“ in Kraft.
Dieses beinhaltet einige Fortschritte und Vereinfachungen wie die Reduzierung der Aufenthaltstitel und die gesetzliche Verankerung eines Integrationskonzeptes.
Die feingliedrige Struktur der Arbeitsmigration, die insbesondere durch die §§ 18 bis 21 des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) und die Beschäftigungsverordnung (BeschV) gesteuert wird, orientiert sich stark am Bedarf des Arbeitsmarktes.
Nicht-EU-Staatsangehörige benötigen für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel. Unter bestimmten Voraussetzungen, wie die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit (BA) oder dem Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebotes, erhalten sie ihre Arbeitserlaubnis als Nebenbestimmung ihres Aufenthaltstitels (vgl. BAMF 2011:78f.). Nach mindestens 5 Jahren Aufenthalt in einem EU-Staat, können Nicht-EU-Staatenangehörige den Rechtsstatus eines langfristig Aufenthaltsberechtigten erhalten (Daueraufenthalt-EG, §9a AufenthG).
Un- und geringqualifizierte Arbeitsmigration wird nur befristet (maximal 6 Monate) zugelassen. In der Regel handelt es sich um so genannte Saisonarbeiter_innen, beispielsweise in der Landwirtschaft oder in der Gastronomie. Ihr Daueraufenthalt ist ausgeschlossen.
Der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt ist für hochqualifizierte Arbeitsmigrant_innen aufgrund des hohen Fachkräftemangels, wesentlich einfacher. Ausländischen Absolvent_innen deutscher Hochschulen kann beispielsweise eine Niederlassungserlaubnis (unbefristeter Aufenthaltstitel) erteilt werden, wenn sie bereits einen Aufenthaltstitel besitzen oder über ein angemessenes Arbeitsplatzangebot verfügen (vgl.AufenthG, §18b Abs.1 und 2). Für hochqualifizierte ausländische Fachkräfte ist von Beginn ihres Aufenthaltes an eine Niederlassungserlaubnis vorgesehen, „wenn die Annahme gerechtfertigt ist, dass die Integration in die bundesdeutschen Lebensverhältnisse und die Sicherung des Lebensunterhalts ohne staatliche Hilfe gewährleistet sind“ (AufenthG, § 19 Abs.1).
Das zum 01.08.2012 in Kraft getretene „Gesetz zur Umsetzung der Hochqualifizierten-Richtlinie der Europäischen Union“(HQRLUmsG), wurde durch den neuen §19a, in das Aufenthaltsgesetz eingefügt. Demnach erhalten hochqualifizierte Arbeitsmigrant_innen aus Nicht-EU-Staaten, die über ein bestimmtes jährliches Mindestgehalt verfügen, die „Blaue Karte EU“ und einen befristeten Aufenthaltstitel, der bereits nach dreijähriger Beschäftigung (bei guten Sprachkenntnissen schon nach zwei Jahren), durch eine unbefristete Niederlassungserlaubnis ersetzt werden kann (vgl. BAMF 2011:81).
Auch Familienangehörigen von Inhaber_innen einer Blauen Karte EU kommt ein privilegierter Status zuteil. Sie erhalten auch ohne Nachweis über Deutschkenntnisse eine Aufenthaltserlaubnis und einen sofortigen Zugang zur Erwerbstätigkeit (vgl. ebd.).
Die restriktive Zuwanderungspolitik bezieht sich hauptsächlich auf un- oder geringqualifizierte Arbeitsmigrant_innen aus Nicht-EU-Ländern. Denn bezüglich der Zuwanderung Hochqualifizierter ist Deutschland mittlerweile eines der OECD-Länder mit den geringsten Beschränkungen. Laut OECD-Bericht „Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte: Deutschland“, der am 04.02.2013 erschienen ist, beträgt die Zahl der Arbeitsmigrant_innen in Deutschland jährlich nur 25.000 und ist vergleichsweise niedriger als in vielen anderen OECD-Ländern (vgl. OECD 2013:19).
1.2 Aussiedlung
Die größte Zuwanderungsgruppe sind die so genannten Aussiedler_innen. Sie gelten als Nachfahren ehemaliger deutscher Siedler_innen in Osteuropa, als deutsche „Volkszugehörige“. Seit 1993 spricht man von Spätaussiedler_innen. Ihre Zuwanderung beruht zum einen auf Artikel 116, Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, der besagt:
“Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist (…) wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31.Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat“ (GG Stand 2009).
Zum anderen gründet sie auf dem Paragraphen 1, Absatz 2.3 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG, 1953 verabschiedet), welcher jede(n), die/der
„(…) vor dem 1.Juli 1990 oder danach im Wege des Aufnahmevertrages vor dem 1.Januar 1993 die ehemals als unter fremder Verwaltung stehenden deutschen Ostgebiete, Danzig, Estland, Lettland, Litauen, die ehemalige Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Albanien oder China verlassen hat oder verlässt (…)“ als Aussiedler_in definiert.
Die Zuwanderung der Aussiedler_innen nach Deutschland bewegte sich in den 1950er und 1960er Jahren aufgrund der restriktiven Grenzpolitik auf einem zahlenmäßig niedrigen Niveau, stieg in den 1970er Jahren unter anderem wegen der so genannten „neuen Ostpolitik“ an und erreichte Ende der 1980er Jahre mit dem Fall des „eisernen Vorhangs“ ihren Höhepunkt (vgl.Gogolin/Krüger-Potratz 2006:65).
Im Laufe der 1990er Jahre führte eine Reihe von restriktiv wirkenden Gesetzen, wie das Aussiedleraufnahmegesetz von 1990 und das Kriegsfolgenbereinigungsgesetz von 1992 zu einem Rückgang der Zuwanderung von Aussiedler_innen. Denn seit dem musste ein förmliches Aufnahmeverfahren, sowie die Prüfung der deutschen „Volkszugehörigkeit“ und der deutschen Sprachkenntnisse (ab 1996) durchlaufen werden. Mit der Anpassung des Bundesvertriebenengesetzes, welches das einzige gesetzliche Instrument für die Aufnahme und Eingliederung der Aussiedler_innen ist, bezeichnet die Bundesregierung die gewaltsame Umsiedlung, Vertreibung, Zerstreuung und Unterdrückung Millionen Deutscher in osteuropäischen Siedlungsgebieten als Kriegsfolgen und übernimmt besondere Verantwortung (vgl. Han 2005:116).
Auch wenn die Eingliederung der (Spät-)Aussiedler_innen in die deutsche Gesellschaft durchaus mit Schwierigkeiten verbunden war und ist, kann man von einem eindeutig privilegierten Status im Vergleich zu anderen Migrantengruppen sprechen (vgl. Mecheril 2004:29). Das Bundesvertriebenengesetz sicherte den
(Spät)-Aussiedler_innen umfassende finanzielle und soziale „Eingliederungshilfen“, die es für andere Zuwanderergruppen in dieser Form nicht gab. Sie bekamen ein Jahr Sprachförderung, bezogen Rente und Arbeitslosengeld, auch ohne Beiträge gezahlt zu haben und ihnen wurden Wohnungen vermittelt. Seit 1990 allerdings haben sich diese Hilfen reduziert. Die Sprachförderung beträgt nur noch sechs Monate, anstelle des Arbeitslosengeldes gibt es ein Eingliederungsgeld und die Rentenansprüche wurden gekürzt (vgl. Münz/Seifert/Ulrich 1999:134). Der größte Vorteil gegenüber anderen Zuwander_innengruppen ist und war aber, dass die Einwanderung in ein Land erfolgte, in dem zum Teil heute noch die Vorstellung von Zugehörigkeit und Staatsangehörigkeit auf einem „völkischen“ Abstammungsrecht beruht.
(Spät-)Aussiedler_innen waren zwar auch „anders“, aber sie gehörten dazu.
Paragraph 6.1 des Bundesvertriebenengesetzes (BVFG 2012) legt fest:
„Deutscher Volkszugehöriger (…) ist, wer sich in seiner Heimat zum deutschen Volkstum bekannt hat, sofern dieses Bekenntnis durch Abstammung, Sprache, Erziehung, Kultur bestätigt wird“.
Ihre anerkannte deutsche „Volkszugehörigkeit“, begründet auf ihrer Abstammung, sicherte den (Spät-)Aussiedler_innen eine rechtliche Gleichstellung zu deutschen Staatsbürger_innen, welche die Lebensplanung in der „neuen Heimat“ maßgeblich erleichterte. In den letzten Jahren ist eine Verschiebung des Herkunftskontextes der (Spät-)Aussiedler_innen zu beobachten. Stammte der Großteil der Aussiedler_innen zuvor aus Polen und Rumänien, hat sich ihre Herkunft ab den 1990er Jahren fast ausschließlich zugunsten der ehemaligen Sowjetunion verschoben (vgl. Han 2005:115). Galten jugendliche Spätaussiedler_innen vor einigen Jahren noch als eine eher unauffällige, nahezu schon assimilierte Gruppe, zählen sie heute zunehmend zu den benachteiligten, marginalisierten und auch „auffälligen“ Jugendlichen (vgl. Dietz 2003:153). Auch die geringen Deutschkenntnisse vieler junger Spätaussiedler_innen und die steigende Kriminalitätsrate unter ihren Reihen, zeugen von ihrer prekären Situation (vgl. Mecheril 2004:31; Dietz 2003:176). Ein alarmierendes Zeichen für die zunehmende Marginalisierung und Ausgrenzung der Migrant_innengruppe der Spätaussiedler_innen in der Gesellschaft ist die trotz ihrer offiziell anerkannten deutschen „Volkszugehörigkeit“ zunehmende Verbreitung und Verwendung der pauschalen Bezeichnung „Russlandsdeutsche“ für die Gruppe der Aussiedler_innen aus Russland.
Weiterführende Literatur zur Gruppe der Aussiedler_innen in Deutschland:
Klaus J. Bade und Jochen Oltmer (Hrsg.): Aussiedler: deutsche Einwanderer aus Osteuropa; V&R unipress GmbH, Göttingen 2003
1.3 Flucht
Flucht und Vertreibung stellen die ältesten Formen der Migration dar und sind seit jeher mit der Menschheitsgeschichte verbunden. Flüchtlinge sind Menschen, die aufgrund unterschiedlich verursachter und begründeter Bedrohungen für ihre Freiheit und ihr Leben, ihren ursprünglichen Wohnsitz vorübergehend oder dauerhaft verlassen und anderswo Zuflucht suchen. (vgl. Han 2005;101). Die Begriffe Asylsuchende und Flüchtlinge werden im Alltag oft synonym verwendet. Dabei unterscheidet sie etwas Grundlegendes: Flüchtlingen wurde ihr Status bereits anerkannt, Asylsuchende oder Asylbewerber_innen, deren Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist, stehen noch einen Schritt vor dieser Bezeichnung.
Das Grundrecht auf Asyl ist seit 1949 fest im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (GG) verankert und gilt als historische Antwort der Deutschen, auf die bitteren Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus (vgl. Bade 1994:94). So heißt es in Artikel 16a Absatz 1: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“.
Auf internationaler Ebene, verpflichtet das von der UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) ausgearbeitete „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“, die so genannte Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) vom 28. Juli 1951 mit dem Zusatzprotokoll vom 31.1.1967 (zeitliche und geographische Erweiterung des Wirkungsbereichs), die Unterzeichnerstaaten zur Gewährung von Asyl und einem Mindestschutz nicht-asylberechtigter Flüchtlinge. Die Konvention regelt Bestimmungen für Flüchtlinge, bezüglich ihrer sozialen Sicherheit, Erwerbstätigkeit oder dem Zugang zu Bildung und legt auch Pflichten gegenüber dem Aufnahmeland fest. Artikel 33 Absatz 1 der GFK schreibt ein „Verbot der Ausweisung und Zurückweisung“ von Flüchtlingen in Gebiete und Länder, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht sein würde. Schlüsselelement der GFK ist jedoch die Definition des Flüchtlingsbegriffs in Artikel 1. Demnach, „findet der Ausdruck ´Flüchtling´ auf jede Person Anwendung, (2.) Die (...) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchen sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht dorthin zurückkehren will.“
In den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik suchten noch vergleichsweise wenig Ausländer_innen, mehrheitlich aus den kommunistischen Ostblockstaaten Asyl in Deutschland. Erst ab Mitte der 1970er Jahre, und vor allem in den Jahren 1984 bis 1992, kam es zu einem enormen Anstieg der Asylbewerber_innenzahlen, der 1992 mit 440.000 Asylbewerber_innen seinen Höhepunkt erreichte (vgl. Bade/Oltmer 2004:106).
Folgen der massiven Zunahme der Anträge, waren Einschränkungen des Rechts in der Asylpraxis, längere Verfahrensdauern und steigende Kosten für die Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber_innen. Aber auch erhebliche gesellschaftliche Spannungen wirkten sich negativ auf die Akzeptanz des Asylgrundrechts in der Gesellschaft aus.
Die Politisierung und Instrumentalisierung der Asyldebatte im Kampf der Parteien um Wählerstimmen und mangelnde Transparenz in der Asylpolitik schürten ab den 1980er Jahren zusätzlich wirtschaftliche und soziale Ängste in der Bevölkerung. Es fielen Floskeln und Schlagwörter wie „Eindämmung der Asylantenflut“, „Dammbruch“, „Das Boot ist voll“, „Überfremdung“ oder „Scheinasylanten“, welche von den Medien aufgegriffen und in undifferenzierter Berichterstattung verbreitet wurden (vgl. Bade, 1994:101).
Die Lage der Flüchtlinge und Asylbewerber_innen änderte sich ab den 1990er Jahren entscheidend. 1992 erfolgte durch das Gesetz zur Neuregelung des Asylverfahrens, dem „Asylverfahrensgesetz“ (AsylVfG), eine Verfahrensbeschleunigung, welche allerdings nicht ausreichte, die grundsätzlichen Probleme der Steuerung der Asylbewerber_innenzuwanderung zu lösen. Die in der Praxis bereits angewandten Restriktionen wurden mit der Grundgesetzänderung und der Neuregelung des Asylverfahrensrechts durch den so genannten „Asylkompromiss“ im Jahre 1993, auch gesetzlich verankert. Das Grundrecht auf Asyl in Artikel 16a GG wurde in den Absätzen 2 bis 5 mit Einschränkungen versehen. Seither hat in der Regel kein Anrecht auf Asyl in Deutschland, „wer aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist(…)“ (Art.16a Abs.2 GG). Weitere Einschränkungen ergeben sich aus der gesetzlichen Festlegung sicherer Herkunftsstaaten (vgl. Art.16a Abs.3 GG) und den erweiterten Möglichkeiten zur „Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen“ (vgl.Art.16a Abs.4 GG). d.h. sofortige Zurückweisung oder Abschiebung der Asylbewerber_in, ohne Prüfung der Verfolgungsgründe (vgl.bpb.de Asylrecht.). Diese Einschränkungen haben seitdem nicht nur die Asylbewerber_innenzahlen gesenkt und den „Transitverkehr“ von Asylsuchenden durch Deutschland in andere europäische Länder verstärkt, sie haben auch die Zahl der illegalen Inlandaufenthalte erhöht. Dabei beginnt die Illegalität mit dem Überschreiten der Aufenthaltsfrist, dem Nichtnachkommen der Ausreiseaufforderung nach Ablehnung des Antrags auf Asyl oder dem Abtauchen nach Abschiebungsankündigung, sowie mit der Arbeitsaufnahme ohne Arbeitserlaubnis (vgl. Bade et al. 2008:164, Bade/Oltmer 2004:113).
Nach Angaben des UNHCR waren im Jahr 1999 weltweit 22,4 Millionen Menschen auf der Flucht (vgl. UNHCR-Report 2001, zitiert nach Han 2005:102). Bis Ende 2011 stieg die Zahl auf 42,5 Millionen Menschen (vgl. UNHCR Global Trends Report 2011:2). Diese Zahlen beruhen allerdings auf dem Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) und umfassen somit nur Flüchtlinge, die sich außerhalb ihres Herkunftslandes befinden. Das bedeutet, dass Binnenflüchtlinge, die innerhalb ihres Herkunftslandes verfolgt und vertrieben werden und deren Zahl nur geschätzt werden kann, keinen Flüchtlingsstatus haben. Die GFK regelt lediglich das Recht der anerkannten Flüchtlinge, jedoch nicht das der Asylsuchenden. Sie nennt fünf Verfolgungsgründe: Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und politische Überzeugung. Es bleibt dabei den jeweiligen Aufnahmestaaten überlassen, wen sie als Flüchtling aufnehmen wollen. Die GFK kann, nicht zuletzt aufgrund ihrer einseitig formulierten Flüchtlingsdefinition, den neuen Fluchtursachen und Entwicklungen kaum Rechnung tragen, denn sie schließt Armuts- und Umweltflüchtlinge, sowie Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge aus (vgl. Han 2010:93ff.).
Die Grundlagen zur Anerkennung als Flüchtling, bilden der in der GFK definierte Flüchtlingsbegriff, sowie das Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) und das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) der Bundesrepublik Deutschland (vgl. BAMF 2010:106). Die Prüfung der Asylanträge und die Durchführung der Asylverfahren, einschließlich der Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, obliegen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Nach der Einreise ist unter Berufung auf §16a GG (siehe oben), eine Asylantragstellung möglich. Während der Durchführung des Asylverfahrens, erhält der Flüchtling nach §55 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) eine Aufenthaltsgestattung.
Das Ziel einer Asylantragstellung ist es, einen Aufenthaltstitel zu erlangen. Jedoch kommt es in nur wenigen Fällen zu einer Anerkennung des Asylantrages. Die Anerkennungsquote als asylberechtigt (nach Art.16a GG) bewegte sich im Jahr 2011, auf einem Niveau von 1,2 %. 49,7 % der Anträge wurden abgelehnt (vgl. BAMF, 2012:10). Bei Ablehnung des Asylantrages wird in den meisten Fällen eine Duldung nach § 60a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) ausgestellt. Die Duldung stellt keinen Aufenthaltstitel dar, sondern bedeutet lediglich eine ausländerbehördliche Registrierung, die eine „Vorübergehende Absetzung der Abschiebung“ aufgrund tatsächlicher, rechtlicher, humanitärer oder persönlicher Gründe mit sich bringt (vgl.§ 60a, Abs.2; §60 AufenthG; Bader/Oltmer 2004:115). Wer eine Bescheinigung über eine Duldung hat, ist nicht „illegal“, jedoch an zahlreiche Einschränkungen gebunden. So dürfen geduldete „De-facto-Flüchtlinge“, die in Deutschland die größte Flüchtlingsgruppe darstellen (vgl. Bade/Oltmer 2004:115), beispielsweise nur unter bestimmten Voraussetzungen und nach dem Ermessen der Ausländerbehörden, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe besteht für „geduldete“ Ausländer_innen nicht. Der Bedarf an Ernährung oder Kleidung wird durch Sachleistungen (Gutscheine) gedeckt. Es besteht ein Anspruch auf eingeschränkte medizinische Versorgung, wenn der Nachweis über ihre Notwendigkeit erbracht wurde. Besonders einschränkend wirkt die so genannte „Residenzpflicht“, die es „Geduldeten“ verbietet, einen bestimmten Landkreis ohne Urlaubsschein zu verlassen. Dies sind nur einige der unzähligen Einschränkungen, die nach Mecheril die „Unerwünschtheit“ Asylsuchender demonstrieren (vlg. Mecheril 2004:40).
Insbesondere für Jugendliche „Gedultete“ bedeutet die Residenzpflicht im Alltag, dass sie in ihrer Freizeitgestaltung stark beeinträchtigt sind. In einigen Bundesländern unterstehen „gedultete“ Kinder und Jugendliche nicht der Schulpflicht, sondern haben ein so genanntes Schulbesuchsrecht (bspw. Hessen), dessen Einforderung oftmals mit Hürden verbunden ist. Die Abhängigkeit des staatlichen Erziehungsauftrags vom jeweiligen Aufenthaltsstatus, kann die Reduzierung der Bildungschancen und die Behinderung der gesellschaftlichen Teilhabe junger Menschen bedeuten.
Erst mit dem 2009 in Kraft getretenen § 18a AufenthG, der „Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung“ und dem seit 2011 geltenden §25a AufenthG, der „Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden“ können „gedultete“ Ausländer_innen unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und gegebenenfalls schulpflichtig werden. Welche Voraussetzungen dies sind und wer als „gut integriert“ eingestuft wird, obliegt wieder dem Ermessen der jeweiligen Ausländerbehörde.
Wird der Asylantrag abgelehnt und auch keine Duldung aufgrund humanitärer Gründe erteilt, werden Flüchtlinge aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Kommen sie dieser Aufforderung nicht nach, halten sie sich illegal in Deutschland auf und sind vollkommen rechtlos. Die Zahl der „illegalen“ Flüchtlinge in Deutschland wird auf etwa 100 000 geschätzt (vgl. Mecheril 2010:33).
Aufgrund ihres unsicheren bzw. illegalen Rechtstatus, der allgegenwärtigen Angst vor Abschiebung, oftmals fehlender Sprachkenntnisse, möglicher traumatischer Erfahrungen während der Flucht, sowie strukturelle und gesellschaftliche Benachteiligungen und Einschränkungen, aber auch wegen der Unterbringung in Massenunterkünften, befinden sich Flüchtlinge und Asylbewerber_innen in Deutschland, oftmals in einer prekären Situation und sind psychischen Belastungen ausgesetzt. „De-facto-Flüchtlinge“ mit Duldungsstatus werden vielfach noch als „Scheinasylant_innen“, papierlose Flüchtlinge als „Illegale“ stigmatisiert (vgl. Bade 1994:136). Im Integrationsprozess von Flüchtlingen und Asylbewerber_innen, nimmt Soziale Arbeit eine zentrale Rolle ein. Durch ihre beratende, betreuende und begleitende Funktion, kann sie wesentlich zur Verbesserung der Lebenssituation der in Deutschland lebenden Flüchtlinge und Asylbewerber_innen beitragen.
Weiterführende Literatur über Soziale Arbeit mit speziellen Flüchtlingsgruppen (Bürgerkriegsflüchtlinge, traumatisierte Flüchtlinge, ungebegleitete minderjährige Flüchtlinge), bieten Fritz/Groner (Hrsg.): Wartesaal Deutschland. Ein Handbuch für die soziale Arbeit mit Flüchtlingen. Lucius&Lucius; Stuttgart, 2004.
2. Phasen der Ausländer_innenpolitik
Da die Amtssprache von Anbeginn an bis Ende der 1990er Jahre den rechtlichen Begriff „ausländische Arbeitnehmer_innen“ beziehungsweise „Ausländer_innen“ verwendete, wird die in dieser Arbeit bevorzugte Bezeichnung „Migrant_in“, in den folgenden Abschnitten zur Ausländer_innenpolitik durch „Ausländer_in“ ersetzt.
2.1 Die Anwerbungsphase (1955-1973)
Die erste Phase der Ausländer_innenpolitik, von 1955 bis 1973, ist gekennzeichnet von der Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer_innen, den so genannten „Gastarbeiter_innen“. Bereits Mitte der 1950er Jahre überstieg in den meisten europäischen Industriestaaten, im Zuge des „Wirtschaftswunders“, die Nachfrage an Arbeitskräften das Angebot innerhalb der nationalen Grenzen. Der Arbeitskräftemangel verschärfte sich durch die Verkürzung der Arbeitszeiten, den Aufbau der Bundeswehr und die insgesamt ansteigenden Ausbildungszeiten (vgl. Marburger 1991:19). Um diesem Mangel entgegenzuwirken, schloss die Bundesanstalt für Arbeit 1955, den ersten Arbeitskräfteanwerbevertrag mit Italien ab. Es folgten in den Jahren 1960 bis 1968, Abkommen mit Spanien und Griechenland, der Türkei, Portugal, Tunesien, Marokko und schließlich Jugoslawien. Das 1965 verabschiedete „Gesetz über die Einreise und Aufenthalt von Ausländern im Bundesgebiet“ , kurz Ausländergesetz (AuslG), festigte den zeitlich begrenzten (Arbeits-)Aufenthalt und wurde durch die Koppelung der Arbeitserlaubnis an einen Aufenthaltstitel, in der Praxis als Mittel der Wirtschaftspolitik eingesetzt (vgl. Langenwohl-Weyer 1979:11f.).
Für den deutschen Staat stand überwiegend die Lösung arbeitsmarktbezogener Probleme im Vordergrund. Einwanderung, oder gar Integration der ausländischen Arbeitskräfte in die deutsche Gesellschaft, war vorerst nicht vorgesehen. Der Großteil der ausländischen Arbeiternehmer_innen, beabsichtigte ohnehin nur einen temporären Aufenthalt in Deutschland. In der Hoffnung auf bessere Einkommensverhältnisse, kamen sie in der Regel ohne ihre Familien und mit dem Ziel, Geld zu sparen, um sich und ihren Familien, eine bessere Zukunft in der Heimat sichern zu können. Entsprechend sah das Ausländergesetz keine sozial- und bildungspolitischen Maßnahmen vor (vgl. Seifert 2000:102).
Die politische Idee hinter dem Verständnis von den „Gastarbeiter_innen“, war das so genannte Rotationsprinzip. Der Aufenthalt sollte befristet sein, „verbrauchte“ Arbeitskräfte sollten durch „unverbrauchte“ ausgetauscht werden (vgl. Mecheril 2010:28). In der Praxis wurde das Rotationsprinzip, welches allerdings nur von wenigen Teilen der Wirtschaft und der CDU/CSU offen vertreten wurde, aber nicht konsequent umgesetzt (vgl. Treibel 1990:42). Viele Betriebe waren mit ihren ausländischen Arbeitnehmer_innen zufrieden und scheuten neue Einlernkosten. Zudem konnten teilweise ganze Arbeitsbranchen, die für einheimische Arbeitnehmer_innen zunehmend an Attraktivität verloren hatten, auf den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte nicht mehr verzichten. Auf Seiten der „Gastarbeiter_innen“, gab es ebenso vielschichtige Gründe, den Zeitpunkt der geplanten Rückkehr zu verschieben. Erst die politische und gesellschaftliche Diskussion Anfang der 1970er Jahre, wies auf soziale Folgeprobleme der Ausländer_innenbeschäftigung hin (vgl. Bade 1994:54).
Mit dem „Anwerbestopp“ der „Gastarbeiter_innen“ vom 23.November 1973, im Kontext der so genannten Ölkrise, endeten die erste Phase der Ausländer_innenpolitik und die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer_innen aus Nicht-EG-Staaten. Ihre Zuwanderung, wurde nur noch in einem geringeren Umfang und im Rahmen weniger Ausnahmen gestattet. Ziel war es zum Einen, den weiteren Anstieg des Ausländer_innenanteils in der Bevölkerung und auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern und zum Anderen, die Motivation der „Gastarbeiter_innen“ zu erhöhen, in ihre Herkunftsländer zurück zu kehren. Die so genannte „Familienzusammenführung“ der „Gastarbeiter_innen“, der Nachzug von Ehegatt_innen und minderjährigen Kindern, die bis Ende der 1980er andauerte, ließ die Ausländer_innenbevölkerung aber langfristig, auch ohne die Zuwanderung neuer Arbeitskräfte, weiter wachsen (vgl. Bade 1994:54f.).
2.2 Die Konsolidierungspolitik (1973-1979)
Die nächste Phase der Ausländer_innenpolitik von 1973 bis 1979, stand unter der Formel „Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung“. Dies umfasste zahlreiche Begrenzungs- und Anpassungsmaßnahmen, wie die „Stichtagsregelung“ (1974), nach der Ausländer_innen, die nach dem 30.11.1974 zugewandert waren, keine Arbeitserlaubnis mehr erhielten, die Einführung der Kindergeldregelung (1975) und die „Zuzugssperre“ für Ballungsgebiete mit einem Ausländer_innenanteil von mehr als 12% (vgl. Langenwohl-Weyer et al. 1979:14f.). Diese Maßnahmen bewirkten durchaus eine Reduzierung der ausländischen Arbeitnehmer_innen, stießen aber auch eine andere, unbeabsichtigte Entwicklung an: die Niederlassung vieler ausländischen Arbeitnehmer_innen und ihrer Familien (vgl. Treibel 1990:45ff.).
Konsolidierung sollte nicht nur die Begrenzung der Zuwanderung bedeuten, sondern auch die Integration derjenigen ausländischen Mitbürger_innen, die beabsichtigten, längerfristig in Deutschland zu bleiben. Die Vorschläge der Bund-Länder-Kommission von 1976/1977, zur Fortentwicklung einer umfassenden Konzeption der Ausländer_innenbeschäftigungspolitik, schenkten erstmals auch den sozialen Ansprüchen der Ausländer_innen größere Aufmerksamkeit und sahen eine Verfestigung des aufenthaltsrechtlichen Status der in der Bundesrepublik lebenden ausländischen Arbeitnehmer_innen vor (vgl. Mehrländer 1984:91).
Hinsichtlich der Integration der ausländischen Bevölkerung, wurde dennoch zunächst wenig getan (vgl. Seifert 2000:137).
2.3 Die Integrationspolitik (1979-1981)
In den Jahren 1979 bis 1981 bildete „Integration“ das zentrale Schlagwort in politischen und wissenschaftlichen Diskussionen. Die lange Zeit vernachlässigten, sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen wurden in dieser dritten Phase der Ausländer_innenpolitik in den Vordergrund gerückt. Unter Integration bezweckte man eine erleichterte Eingliederung ausländischer Familien durch politisch-administrative Maßnahmen, meinte aber die Anpassung der Ausländer_innen an die deutsche Gesellschaft (vgl. Treibel 1990:47). Angestoßen wurde die Diskussion um die Integration, von der im September 1979 veröffentlichten Denkschrift über „Stand und Weiterentwicklung der Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien in der Bunderepublik Deutschland“.
Das so genannte „Kühn-Memorandum“, des ersten „Ausländer_innenbeauftragten“ der Bundesrepublik, Heinz Kühn, lieferte einen ersten „alarmierenden Befund“(Kühn 1979:1) zur Situation der ausländischen Bevölkerung in Deutschland. Das Kühn-Memorandum forderte eine „konsequente Integrationspolitik“ und enthielt zahlreiche Vorschläge für die Schwerpunktsetzung, wie beispielsweise die Abkehr von „undifferenzierte(n) Konzeptionen einer Integration ´auf Zeit´“, die „Anerkennung der faktischen Einwanderung (…)“ und die „erhebliche Intensivierung der integrativen Maßnahmen vor allem für die Kinder und Jugendlichen, d.h. im Bereich der Vorschule, Schule und beruflichen Bildung“(ebd.:3f.).
Einige Vorschläge des Kühn-Memorandums wurden 1980 in die Leitlinien der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Ausländer_innenpolitik aufgenommen, allerdings machten weitere Gesetzesvorlagen der 1980er Jahre deutlich, dass die Schwerpunkte der Ausländer_innenpolitik, hauptsächlich auf der Zuwanderungsbegrenzung und der Förderung der Rückkehrbereitschaft lagen (vgl. Mehrländer 1984:92).
2.4 Die Wende von der Integration zur Begrenzung (1981-1990)
Die erste „Wende in der Ausländerpolitik“, die 1981 einsetzte, prägte die vierte Phase der Ausländer_innenpolitik bis 1990. Die zum Teil widersprüchliche „Sowohl-als-auch-Politik“ (Seifert 2000:138), welche sowohl die Integration, als auch die Rückkehr der ausländischen Bevölkerung fördern sollte, blieb überwiegend erfolglos. Insbesondere nach dem Regierungswechsel 1982, war eine Abkehr von einer Integrationspolitik zu einer Begrenzungspolitik festzustellen, die K.-H. Meier-Braun als Wechsel vom „Wettlauf um Integrationskonzepte“ zum „Wettlauf um eine Begrenzungspolitik“ bezeichnete (vgl. Meier-Braun 2006:205). Im Dezember 1982 wurde eine „Kommission Ausländerpolitik“ aus Vertretern von Bund, Ländern und Gemeinden eingesetzt, die die angekündigten Zielsetzungen der Regierung unterstützten. Diese waren: Integrationsangebote für die Ausländer_innenbevölkerung zu schaffen, den Anwerbestopp von 1973 aufrechtzuerhalten, die Familienzusammenführung zu begrenzen und die Rückkehrbereitschaft der Ausländer_innen zu fördern (vgl. Bade 1994:60). Trotz der Ankündigung der CDU-FDP-Bundesregierung unter Helmut Kohl, die Ausländer_innenpolitik zu einem der Hauptschwerpunkte ihres Dringlichkeitsprogramms zu machen, folgten keine bedeutenden Gesetze oder Reformen, mit Ausnahme des „Gesetz(es) zur befristeten Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern“ von 1983. Dieses sah die Zahlung einer Rückkehrhilfe („Rückkehrprämie“) an vor allem arbeitslose Ausländer_innen aus Nicht-EG-Staaten und die sofortige Auszahlung ihrer Beiträge in die deutsche Rentenversicherung vor (vgl. Treibel 1990:48). In Anspruch genommen wurden diese, nur für sechs Monate gültigen Maßnahmen, allerdings mehrheitlich von denjenigen Ausländer_innen, die sich bereits entschlossen hatten, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren (vgl.Seifert 2000:137). Auch wenn die Rückkehrforderung, seitens der Regierung als Erfolg dargestellt wurde, handelte es sich in erster Linie um eine Sparmaßnahme für die Rentenversicherung auf Kosten der ausländischen Arbeitnehmer_innen und ist, wie viele andere Maßnahmen in der Ausländer_innenpolitk, eher als eine symbolische Maßnahme zu sehen (vgl. Meier-Braun 2006:206). Durch die 1990 erlassene „Anwerbestoppausnahmeverordnung“ (ASAV), konnten nun ausländische Arbeitskräfte, auch ohne Aufhebung des allgemeinen Anwerbestopps von 1973 angeworben werden, um den Arbeitskräftemangel in bestimmten Arbeitsbranchen zu beheben (vgl. Bade 1994:67). Die mangelnde Transparenz und Konzeptionslosigkeit in der Ausländer_innenpolitik, die anhaltende starke Zuwanderung von Flüchtlingen und Aussiedler_innen, bei weiter steigender Arbeitslosigkeit und die verstärkte öffentliche Wahrnehmung der Ausländer_innen als „Problemverursacher_innen“, sowie die wachsende „Fremdenfeindlichkeit“ im Land lösten Unbehagen, Empörung aber auch Abwehrhaltungen in der Gesellschaft aus. Die Verschränkungen der öffentlichen und politischen Diskurse über die Integration der ehemaligen „Gastarbeiter_innen“ und über die Zuwanderung von Aussiedler_innen und asylsuchenden Flüchtlingen verschärften diese Situation (vgl. Bade 1994:57).
Die langersehnte Reform des Ausländergesetzes (AusländerG) und dessen Inkrafttreten am 1. Januar 1991, stellt den Übergang der vierten zur fünften Phase der Ausländer_innenpolitik dar. Das Gesetz erleichterte zwar Einbürgerungen von Ausländer_innen, die mindestens 15 Jahre in Deutschland lebten und von Jugendlichen, die in Deutschland aufgewachsenen waren, doch die Verschärfung der Ausweisungsbefugnisse und die Erweiterung der Ermessensspielräume der Behörden bei der Verlängerung befristeter Aufenthaltserlaubnisse, steigerte die Unsicherheit der Ausländer_innen bezüglich ihres Rechtsstatus. Eine umfassende Konzeption zur Integration blieb aus, vielmehr strebte das Gesetz eher eine Assimilation der ausländischen Bevölkerung an (vgl. Bade 1994:65f.).
2.5 Die Phase der Asylpolitik (1990-1998)
In der fünften Phase der Ausländer_innenpolitik von 1990 bis 1998, stand die Asylpolitik im Vordergrund. In einer Zeit, in der die Zahl der Asylsuchenden eine neue Rekordhöhe erreichte und als mit dem Ende des Kalten Krieges Aussiedler_innen als neue Zuwanderungsgruppe hinzukamen, „gerieten die ´Gastarbeiter´ fast in Vergessenheit“ (Meier-Braun 2006:206). Die Begrenzungspolitik wurde durch eine Grundgesetzänderung des Artikels 16, durch den so genannten „Asylkompromiss“ im Jahre 1993, auch gesetzlich verankert. Das Grundrecht auf Asyl wurde mit Einschränkungen versehen, welche die „Abwehr“ von Asylanträgen und die „Abschiebung“ von asylsuchenden Menschen vereinfachten. Bezüglich der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe der ausländischen Bevölkerung gab es in dieser Phase keine Fortschritte. Zahlreiche Initiativen auf Länder- und kommunaler Ebene setzten sich in den 1990er Jahren für mehr politische Partizipationsmöglichkeiten der „ausländischen Mitbürger_innen“ ein und forderten das kommunale Wahlrecht für Ausländer_innen aus Nicht-EG-Staaten, sowie die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Diese Forderungen wurden aber nicht eingelöst. Das Staatsbürgerschaftsrecht basierte seit 1913, auf einem „völkischen“ Abstammungsprinzip, dem „Jus sanguinis“ („Recht des Blutes“), wonach die Staatsbürgerschaft von den Eltern vererbt wurde (vgl. Meier-Braun 2006:206). Annette Treibel bewertet die Ausländer_innenpolitik der 1990er Jahre als „Fortsetzung der Politik der 70er und 80er Jahre“ mit den Prinzipien „Nicht-Einwanderungsland, Inländer Primat auf dem Arbeitsmarkt, Begrenzung des Ausländerzuzugs“ (Treibel 2001:116).
Auf gesellschaftlicher Ebene ist diese Phase geprägt von Diskussionen um die multikulturelle Gesellschaft aber auch steigender „Fremdenangst“ und gewalttätigen Übergriffen auf Ausländer_innen und Asylsuchenden, die mit „der Straßenjagd auf ´Asylanten ´“ begannen und in Brandanschlägen auf Wohnhäuser türkischer Familien und Asylbewerber_innenheime gipfelten (Hoyerswerda 1991, Rostock-Lichtenhagen 1992, Mölln 1992 und Solingen 1993) (vgl. Bade 1994:67).
2.6 „Deutschland ist ein Einwanderungsland“ (1998-2004)
Der Regierungswechsel von 1998 brachte eine erneute Wende in der Ausländer_innenpolitik. In dieser sechsten Phase, die bis 2004 andauerte, wurde erstmals in der Deutschen Geschichte die Einwanderungssituation in Deutschland nicht mehr geleugnet. Die Regierungskoalition SPD/Grüne reformierte zunächst das Staatsangehörigkeitsrecht, das am 01.Januar 2000 in Kraft trat. Kern der Reform war die Einbürgerung durch das Geburtsrecht, das seit 1913 geltendes Abstammungsprinzip „Jus sanguinis“, wurde zugunsten des „Jus soli“ („Recht des Bodens, Landes“) aufgehoben. Bezüglich der hitzig diskutierten doppelten Staatsbürgerschaft, sieht die so genannte „Optionspflicht“ vor, dass Kinder ausländischer Eltern, zusätzlich zur deutschen Staatsbürgerschaft, die Staatsbürgerschaft der Eltern erhalten und sich spätestens bis zu ihrem 23. Lebensjahr für eine der Staatsangehörigkeiten entscheiden müssen (vgl.Bade/Oltmer 2004:128). Wenn sich die sogenannten „Optionskinder“ nicht entscheiden beziehungsweise nicht fristgerecht nachweisen können, dass sie ihre ausländische Staatsangehörigkeit abgelegt haben, droht ihnen der Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit. Die „Green Card“-Initiative, die hochqualifizierten ausländischen Fachkräften außerhalb der EU, den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern sollte, stieß im Jahr 2000 eine breite Debatte über die Notwendigkeit eines Zuwanderungsgesetzes an.
Die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“, nach ihrer Vorsitzenden auch „Süßmuth-Kommission“ genannt, legte am 04. Juli 2001 einen Bericht vor in dem es heißt:„Die jahrzehntelang vertretene politische und normative Festlegung ´Deutschland ist kein Einwanderungsland´ ist aus heutiger Sicht als Maxime für eine deutsche Zuwanderungs- und Integrationspolitik unhaltbar geworden“. und weiter: „Die Kommission stellt fest, dass Deutschland (…) ein Einwanderungsland geworden ist.“ (BMI 2001:12f.).
Bundesinnenminister Otto Schily legte 2001 einen Gesetzesentwurf zum Zuwanderungsgesetz vor, der zusammen mit dem Bericht der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“, einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer aktiven und planvollen Gestaltung von Migration und Integration als zentrale Aufgaben der Politik darstellen sollte.
2.7 Das erste Zuwanderungsgesetz (2005)
Die siebte Phase der Ausländer_innenpolitik begann mit dem Inkrafttreten des ersten Zuwanderungsgesetz (ZuwG) der Bundesrepublik Deutschlands am 01. Januar 2005, dem langwierige und konfliktreiche Verhandlungen in den Jahren 2001 bis 2004 vorhergegangen waren. Die Große Koalition von CDU/CSU und SPD erklärte das Thema Integration wieder zu einer Schwerpunktaufgabe. Erstmals gab es ein Gesetz, das alle Bereiche um Migration und Integration von Migrant_innen umfasste. Es enthält eine komplette Erneuerung des Ausländerrechts. Das durch Artikel 1 neu eingeführte „Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet“, das so genannte „Aufenthaltsgesetz“ (AufentG) bildet das Kernstück des neuen Zuwanderungsgesetzes.
Die bisher fünf unübersichtlichen Aufenthaltstitel wurden durch zwei, eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis und eine (unbefristete) Niederlassungserlaubnis ersetzt (vgl. Schneider 2007). Nach wie vor ist eine Aufenthaltserlaubnis an einen Zuwanderungsgrund (beispielsweise Erwerbstätigkeit oder Studium) geknüpft. Der Anwerbestopp von 1973 blieb für Nicht- und Geringqualifizierte Arbeitskräfte erhalten. Die Zuwanderung von hochqualifizierten Arbeitskräften hingegen wurde erleichtert. Mit dem Zuwanderungsgesetz wurden zudem erstmals Integrationsmaßnahmen gesetzlich verankert und Integration wird als Querschnittsaufgabe institutionalisiert.
So haben Neuzuwander_innen, aber auch bereits längere Zeit in Deutschland lebende Migrant_innen den Anspruch und zugleich die Verpflichtung, an einem Integrationskurs teilzunehmen (vgl. Han 2005:199) und das „Amt der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration“ wird an das Kanzleramt angegliedert und mit Staatsministerin Maria Böhmer besetzt.
[...]
[1] Im weiteren Verlauf dieser Arbeit verwende ich den so genannten „Gender Gap“ für eine gendergerechte Schreibweise.
[2] „Migrationspädagogik“ verwende ich als Überbegriff für pädagogische Ansätze in der Migrationsgesellschaft.
- Arbeit zitieren
- Pinar Kehribar (Autor:in), 2013, Migrationspädagogik. Von der Ausländerpädagogik zu Transkulturalität in der Erziehungswissenschaft, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272479
Kostenlos Autor werden












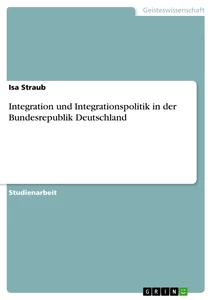







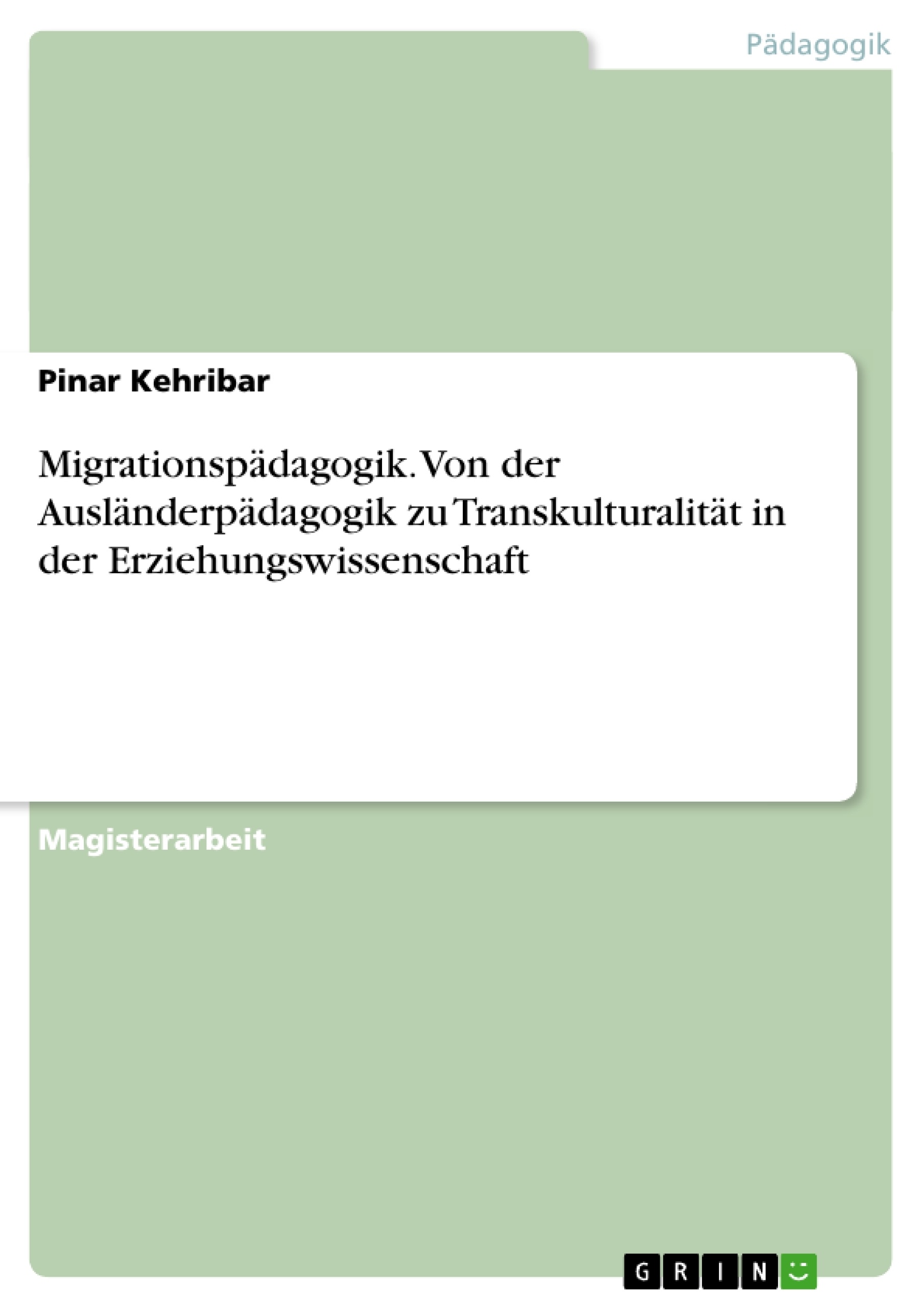

Kommentare