Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hintergründe
2.1 Was bedeutet „Geschlecht“?
2.2 Sozialhistorische Betrachtung zur Entstehung der modernen Geschlechterordnung
3. Methodische Anmerkungen
4. Mannsein, Männlichkeit und Geschlechterverhältnis in den sozialen Dimensionen der Milieu- und Generationszugehörigkeit
4.1 Männer mittleren Alters
4.1.1 Männer der leistungsorientierten Mittelschicht
4.1.2 Männer der intellektuellen Mittelschicht
4.1.3 Männer des Arbeitermilieus
4.2 Junge Männer
4.2.1 Studenten
4.2.2 Junge Facharbeiter
5. Vergleichende Auswertung: Verortung von Tradition und Modernisierung
5.1 Vergleiche bezüglich der Milieuzugehörigkeit
5.2 Vergleiche bezüglich der Generationszugehörigkeit
5.2.1 Die Bedeutung von lebensgeschichtlichen Entwicklungsphasen in der jungen Generation
5.3 Zur Modernisierung von Männlichkeit: Dauerreflexion und Pragmatismus
6. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Modernisierungstheoretischen Ansätzen zufolge findet derzeit zunehmend eine „Freisetzung aus traditionalen Frauen- und Männerrollen“ statt.[1] Nachdem männliche Herrschaft über historische lange Zeiträume uneingeschränkt gegeben war, weil sowohl Männer als auch Frauen entsprechende Denkmuster übernahmen und immerfort reproduzierten, erfolgt heutzutage seitens der Frauen nicht länger ein fragloses Einverständnis mit der gesellschaftlichen Dominanz der Männer. Die Erwerbsquote der Frauen und diverse Frauenförderpläne weisen unübersehbar darauf hin, dass sich im Geschlechterverhältnis etwas geändert hat, jedoch stellt sich die Frage, wie gravierend sich diese Veränderungen tatsächlich auswirken. Denn auch wenn sich männliche Herrschaft nicht mehr als „natürlich gegeben“ durchsetzt, befinden sich hinter den sichtbaren Umgestaltungen weiterhin verborgene Kontinuitäten. Einen Hinweis auf solche Kontinuitäten gibt z.B. die Tatsache, dass vor allem in weiblichen Biographien eine Freisetzung aus tradierten Rollenzuweisungen stattfindet. Da jedoch auch die Männer unvermeidlich mit diesen Neuerungen konfrontiert werden, wäre hier eine Art „komplementäre Reaktion“ zu erwarten, die in irgendeiner Weise auf die veränderten Vorstellungen der Frauen eingeht. Wie sich nun diese Reaktionen der Männer darstellen und wie Männer sie erleben, wird im Folgenden zu untersuchen sein.[2]
Eine weit verbreitete Annahme besagt, dass die öffentliche Diskussion über das Geschlechterverhältnis Brüche im Geschlechterrollenmodell fördert.[3] Im Vorfeld der in dieser Arbeit untersuchten Fragen darf indes bereits angenommen werden, dass von einer Generalisierung der These von der „Krise des Mannes“ abgesehen werden sollte.[4] Denn auch wenn das Geschlechterverhältnis in Bewegung geraten ist, verlieren traditionelle Männlichkeitsmuster nicht unmittelbar an Gültigkeit. Vielmehr erweisen sich etablierte kulturelle Deutungsmuster oftmals Neuerungen gegenüber als äußerst widerstandsfähig und ändern sich keinesfalls analog zu gesellschaftlichen Veränderungen, sondern bleiben im Gegenteil weiterhin wirksam.
Sozialwissenschaftliche Thesen konstatieren eine Orientierung an traditionellen Geschlechterrollenstereotypen vor allem im Arbeitermilieu. Der Mittelschicht wird hingegen ein nicht unbeträchtliches Veränderungspotential bezüglich des Geschlechterverhältnisses unterstellt. Von den Männern dort seien progressive Reaktionen auf Neuerungen zu erwarten, da es ihnen leichter fiele, sich mit veränderten Geschlechterrollen zu arrangieren und ihrerseits selbst Veränderungen zu initiieren.[5]
Dieser Behauptung soll anhand der Fragen, wie Männer den Wandel im Geschlechterverhältnis erleben, wie sie auf die Erwartungen von Frauen reagieren, ob dabei habituelle Verunsicherungen entstehen und welche Deutungsmuster in Bezug auf Männlichkeit vorherrschend sind und Anwendung finden, nachgegangen werden. In diesem Zusammenhang steht die Fragestellung nach der Bedeutung des Mannseins in besonderem Maße im Fokus, da hiervon ausgehend verschiedene für die befragten Männer relevante Dimensionen hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses entfaltet werden und daraus Rückschlüsse auf die vorliegenden Deutungsmuster von Männlichkeit gezogen werden können. Dabei wird sich zeigen, ob der Prozess der Auflösung von Geschlechterrollen wirklich insbesondere von der Mittelschicht wesentliche Unterstützung erfährt bzw. in welchem sozialen Milieu denn tatsächlich eine Modernisierung von Männlichkeit – die in einer progressiv gewandelten Praxis ihren Ausdruck findet – als Reaktion auf die „feministische Herausforderung“ zu verorten ist. Anhand der Feststellungen von traditionsverhafteten Kontinuitäten einerseits und Modernisierungstendenzen andererseits soll im Hinblick auf die zu erwartenden Entwicklungen im Geschlechterverhältnis auch eine vorsichtige Prognose für die kurz- bis mittelfristige Zukunft getroffen werden.
Diese Untersuchung geschieht mithilfe der Auswertungen von mit verschiedensten Zusammenschlüssen von Männern geführten Gruppendiskussionen, deren Auswahl und Differenzierung entlang der sozialen Dimensionen der Milieu- und Generationszugehörigkeit vorgenommen wurden. Die Gruppendiskussionen waren Bestandteil des Forschungsprojekts „Die Symbolik der Geschlechtszugehörigkeit. Kollektive Orientierungen von Männern im Wandel des Geschlechterverhältnisses“, welches vom Institut für empirische und angewandte Soziologie (EMPAS) der Universität Bremen in den Jahren von 1993 bis 1997 durchgeführt wurde.[6] Daran beteiligt waren u.a. Michael Meuser und Cornelia Behnke, auf deren Ausführungen zur besagten Studie sich die vorliegende Arbeit stützt.
Inhaltlich geht diese Arbeit wie folgt vor: Zunächst werden für ein besseres Verständnis der zu bearbeitenden Thematik Hintergründe in Bezug auf die Aspekte Geschlecht und Geschlechterordnung beleuchtet. Anschließend erfolgen kurze Anmerkungen zum in der Studie angewandten Gruppendiskussionsverfahren. Danach werden die empirisch ermittelten Ergebnisse zur Bedeutung des Mannseins und den vorliegenden Deutungsmustern von Männlichkeit sowie zum Geschlechterverhältnis gemäß der jeweiligen Milieu- und Generationszugehörigkeit der Männer geordnet dargestellt, anhand derer eine vergleichende Auswertung insbesondere hinsichtlich der Verortung von in der Tradition männlicher Hegemonie stehenden Kontinuitäten sowie von Modernisierungstendenzen vorgenommen werden soll. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein auf dem Boden der hier gewonnenen Erkenntnisse zu erschließendes Resümee.
2. Hintergründe
2.1 Was bedeutet „Geschlecht“?
„Die Aufgabe einer soziologischen Geschlechterforschung besteht nicht darin, soziale Konsequenzen angeborener Unterschiede zu erklären, sondern zu zeigen, wie der Dimorphismus als Grundlage und Rechtfertigung geschlechtsbezogener sozialer Arrangements verwendet wird, wie solche Arrangements dadurch gültig gemacht werden.“[7]
Diese Sichtweise impliziert, dass das Konzept von der anatomischen Zweigeschlechtlichkeit ein den meisten Menschen unzweifelhaftes Gedankenmuster ist, das insofern anerkannt werden muss, als Untersuchungen zur (Re-)Produktion von Geschlechterdifferenzen und –ordnungen nicht losgelöst von den vorherrschenden, allgemein in der Gesellschaft akzeptierten und praktizierten Denkweisen geschehen können. Ungeachtet dessen, inwieweit der Dimorphismus tatsächlich als „natürlicher“ und grundlegender Unterschied zwischen den Geschlechtern gegeben ist, ist in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen zu berücksichtigen, dass die Zugehörigkeit zu ausschließlich einem definierten Geschlecht für den Großteil der Menschen eine Selbstverständlichkeit darstellt.
Es muss in der soziologischen Geschlechterforschung also differenziert werden, dass es einerseits Ansätze gibt, welche die Existenz von zwei Geschlechtern voraussetzen und darauf aufbauend Untersuchungen anstellen, und dass anderseits theoretische Überlegungen unabdingbar sind, die Geschlecht als soziales Konstrukt begreifen und demzufolge die gängigen Deutungsmuster von Zweigeschlechtlichkeit – welche oftmals aus Geschlecht auch besagte „soziale Konsequenz[en] angeborener Unterschiede“ ableiten – selbst zum Gegenstand der Forschung machen.
Aktuelle theoretische Konzeptionen der Kategorie Geschlecht als soziale Konstruktion kritisieren derartige ontologische oder naturalistische Betrachtungen der Geschlechterdifferenz, bei denen Geschlechtsrollen oder –identitäten unmittelbar aus körperlichen Beschaffenheiten abgeleitet werden. Auch die Unterscheidung von körperlichem Geschlecht (sex) und sozialem Geschlecht (gender) ist in dieser Kritik eingeschlossen, denn auch der Körper selber gilt nicht nur als kulturell überformt, sondern als vollständig kulturell konstituiert.[8] Die Geschlechterordnung und –differenz sei als Resultat sozialer Prozesse insofern vom realen Vorhandensein geschlechtsdefinierender Genitalien völlig unabhängig, als dass bei der Zuschreibung von Geschlechtlichkeit in sozialen Interaktionen der Körper nicht erkundet werde, sondern die Identifikation gemäß eines gesellschaftlich vereinbarten geschlechtlichen Codes erfolge.[9] Dieser Code beinhaltet „männliche“ bzw. „weibliche“ Verhaltensweisen und symbolische Darstellungsformen, die auch als „kulturelle Genitalien“ bezeichnet werden.[10] Dem geschlechtlichen Code entsprechende Inhalte werden vom Kindesalter an erlernt und in Interaktionen zunächst mit signifikanten Anderen und später im sozialen Alltag erprobt und reproduziert.[11] Außerhalb der symbolischen Realität, aus der letztendlich die Geschlechterordnung resultiert, gibt es den konstruktivistischen Theorien zufolge keine dem menschlichen Körper innewohnende, sich selbst konstituierende Bedeutung. In diesem Zusammenhang lässt sich zu Bedenken geben, dass diese Konzeption das konkrete Erleben von Geschlechtlichkeit bzw. des geschlechtlichen Körpers als „kulturell produziertes Missverständnis“ abqualifiziert,[12] den Körper quasi „entsexualisiert“ und – wie auch Geschlecht selbst – zum reinen, nicht mehr erfahrbaren Diskursprodukt macht.
Dabei drängt sich die Frage auf, inwieweit ein „kulturell produziertes Missverständnis“ vorliegen kann, wenn sich die Entwicklung der Kategorie Geschlecht und der Geschlechterdifferenz zu dem, wie es sich heute darstellt und allgemein praktiziert wird (ob nun unbewusst oder in kritischer Reflexion, ob sie gutgeheißen wird oder nicht), als ein früher Grundstein der Kultur betrachten lässt, auf den aufbauend viele weitere kulturelle Entwicklungen erst später entstanden sind. Denn an dieser Stelle bietet es sich an – bevor im weiteren Verlauf dieser Arbeit der Dimorphismus gemäß der alltäglichen Wahrnehmung des überwiegendes Teils der Gesellschaft als gegebene Realität betrachtet wird, nach deren Ursprung nicht weiter gefragt wird – kurz auf die im Eingangszitat erwähnten „soziale[n] Konsequenz[en] angeborener Unterschiede“ zurückzukommen und zu verfolgen, wie die dichotome Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit überhaupt zustande kommen konnte.
Es ist unumstritten, dass die Geschlechterdifferenz nicht ausschließlich und immer eindeutig aus der Natur herzuleiten ist und die jeweils wahrgenommenen Unterschiede gewissen Interpretationsleistungen entsprechen, die in einem bestimmten gesellschaftlich-kulturellen Kontext stehen.[13] Der Blick auf die Kategorie Geschlecht soll also keinesfalls eine Renaturalisierung erfahren. Dennoch soll hier angemerkt werden, dass die wahrgenommene Geschlechterdifferenz und die dazugehörigen Symboliken sich nicht zufällig und losgelöst von konkreten leiblichen Erfahrungen, gewissermaßen „freischwebend“, entwickelt haben.
Aus Sicht der Sprachphilosophie und der Sprachentwicklung ist es logisch, dass gemäß der in den allermeisten Fällen optisch eindeutig unterscheidbaren Beschaffenheit insbesondere der primären Geschlechtsmerkmale eine semantische Differenzierung der Kategorie „Mensch“ in „Mann“ und „Frau“ vorgenommen wurde. Wie auch bei allen anderen voneinander verschiedenen Objekten in der Außenwelt ergab sich im Prozess der Zunahme an sprachlicher Vielfalt und gleichzeitiger Ökonomie natürlicherweise eine begriffliche Trennung, um exakt auf nur ein Objekt oder ein „Subobjekt“ einer bestimmt Kategorie referieren zu können. Diese begriffliche Zuordnung erfolgte allerdings arbiträr, das heißt, ein Wort allein sagt noch nichts über die inhaltliche Beschaffenheit des von ihm bezeichneten Objekts aus.[14] Die Unterscheidung von „Mann“ und „Frau“ ist hier lediglich nach Äußerlichkeiten getroffen worden und steht keinesfalls im Zusammenhang mit charakterlichen Zuschreibungen. Verkürzt lässt sich sagen, dass als relevant erachtete geschlechtliche Differenzen semantische Unterscheidungen provoziert und produziert haben, und nicht umgekehrt.
Ebenso verhält es sich mit geschlechtsspezifischen Symboliken, denen konkrete leibliche Erfahrungen vorausgehen. Diese entstanden meist auf dem Boden geschlechtsexklusiver Erlebnisse. In jeder Kultur findet sich in Symboliken und Mythen irgendeine Form der Darstellung der Differenzierung nach Geschlecht, wobei hauptsächlich auf die zweigeschlechtlich verlaufende Fortpflanzung verwiesen wird.[15] Dabei zeigt sich, dass Menschen über historisch lange Zeiträume hinweg geschlechtliche Vorgänge ähnlich interpretiert und daraus auch bestimmte Fähigkeiten und Prädestinierungen von Mann und Frau geschlossen haben. Jedoch trägt auch dieser Umstand nicht zur Behauptung stets eindeutiger Geschlechtskategorien oder zur Zementierung einer Geschlechterordnung bei.[16]
Es ist zwar in der Tat so, dass von sich auf rein körperliche Vorgänge beziehenden Symboliken im späteren Laufe der gesellschaftlich-kulturellen Entwicklung immer mehr auf geschlechtsspezifische Wesenszüge abstrahiert wurde, wodurch letztlich die heute bekannten Stereotype resultierten (gemeint ist hiermit insbesondere das 19. Jahrhundert, detaillierte Ausführungen finden sich in Abschnitt 2.2). Dennoch lässt sich nicht von kulturell konstituierten Körpern sprechen, vielmehr ließe sich sagen, dass viele kulturelle Entwicklungen auf dem Boden der Wahrnehmung von Zweigeschlechtlichkeit bzw. analog zu dieser entstanden sind. Und diese Wahrnehmung körperlicher Unterschiede ist weitaus älter als später daraus getroffene wesensmäßige Ableitungen und die hierarchische Bewertung dieser.
Wäre der Dimorphismus nicht als derart offensichtlich und relevant betrachtet bzw. im wahrsten Sinne des Wortes „gesehen“ worden, wären viele Begrifflichkeiten gar nicht erst entstanden, die heutzutage zur Reproduktion des vorherrschenden Geschlechterverhältnisses bedingende und selbstverständliche Entitäten darstellen. Wäre der Blick auf körperliche Unterschiede und geschlechtsspezifisches leibliches Erleben ein anderer, gleichmütigerer gewesen, hätte die gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung wohl eine andere Richtung eingeschlagen. Gleichwohl nehmen zweifelsohne auch umgekehrt kulturelle Neuerungen Einfluss auf die Sichtweise bezüglich der Geschlechtlichkeit und der Geschlechterordnung, je nachdem, wie sich Relevanzen verschieben. So wäre die kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Geschlecht, wie sie heutzutage stattfindet, vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar gewesen, und sie verändert selbstverständlich das Bewusstsein – wenn auch nicht unmittelbar die Praxis – in Bezug auf das Geschlechterverhältnis.
Es bleibt festzuhalten, dass der geschlechtliche Körper zwar sicherlich (vor allem in der Neuzeit) eine kulturelle Überformung erfährt, jedoch zugleich die materielle Basis und somit den Ursprung bildet, worauf diese Überformung erst möglich wird und er aufgrund dessen nicht ausschließlich als kulturell konstituiert gelten kann. Denn wäre Geschlecht derart abstrakt, wie die Theorien von Geschlecht als (ausschließlich) sozialer Konstruktion suggerieren, wäre es – wie oben dargelegt – gar nicht zum Entstehen z.B. bestimmter Symboliken gekommen, die im Konstruktivismus als rein willkürlich und losgelöst von „wahrer“ Körperlichkeit angesehen werden. Dabei sind die Symboliken an sich eine logische Folge der erlebten Körperlichkeit, die daraufhin vorgenommene hierarchische Bewertung zugunsten des Mannes ist indes im Grunde willkürlich und keinesfalls ersichtlich aus sich selbst hervorgehend, jedoch im Weiteren von vielen kulturellen Einflüssen gestärkt worden.
Es soll also keinesfalls gesagt werden, dass es gut und richtig ist, wie „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ derzeit wahrgenommen, kategorisiert und hierarchisiert werden. Erklärte Absicht war es hier lediglich zu zeigen, dass die Entstehung der Symboliken und wahrgenommenen Prädestinierungen sowie der semantischen Unterscheidungen in sich schlüssig und nachvollziehbar ist, in dieser Lesart einer inneren Logik folgt und Geschlecht somit grundsätzlich kein „kulturelles Missverständnis“ darstellt. Der einmal eingeschlagene Weg im Sinne eines Festhaltens an der getroffenen Differenzierung zweier Geschlechter wurde fortlaufend weiterverfolgt. Jedoch wird nicht behauptet, dass die Darstellung geschlechtsspezifischer Erfahrungen zu keiner anderen als der aktuell vorherrschenden Geschlechterhierarchie hätte führen können. Die als geschlechtsspezifisch formulierten biologischen Unterschiede, die als relevant erachtet wurden, hätten auch eine andere Interpretation und damit assoziierte Bewertung erfahren können (beispielsweise eine höhere Bewertung der Frau aufgrund ihrer Fähigkeit, „Leben zu schenken“).
Die in der Historie der Geschlechterdifferenz und –ordnung getroffenen Interpretationen von „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“ waren also weder unumgänglich und die einzig denkbaren, noch sind sie dazu determiniert, jetzt auf ewig festgelegt zu sein. Verschiedene Arten einer „kulturellen Überformung“ des Geschlechts bzw. der Geschlechtlichkeit wären möglich gewesen und sind dies auch weiterhin, und in der Reflexion ließe sich wohl jede dieser Möglichkeiten als „kulturelles Missverständnis“ interpretieren. Denn welche Art der Interpretation geschlechtsexklusiver biologischer Vorgänge könnte als „richtig“ bezeichnet werden? Es würde wohl gesagt werden, dass es schon von vorne herein „falsch“ sei, überhaupt biologische Unterschiede innerhalb der Spezies Mensch wahrzunehmen. Diese Wahrnehmung war jedoch eine „Leistung“, die der Mensch selbst erbracht hat, sie geschah nicht intentional, und dennoch wurde sie hervorgebracht, ohne Reflexion oder eine Wahl zwischen verschiedenen Interpretationsformen. Von daher hat sich ein „Verständnis“ für Geschlechtlichkeit entwickelt, dass sich zwar heutzutage aus einem bestimmten Blickwinkel als „Missverständnis“ bezeichnen lässt, aber ist es dann nicht schon die unterschiedlich angelegte Biologie der beiden „Subkategorien Mann und Frau“ in der Spezies Mensch, die mit „Missverständnis“ oder „Irrtum“ betitelt werden muss? Wieviel „(kulturelles) Missverständnis“ kann vorliegen, wenn bereits in einer Zeit vor der Entstehung der Sprache Symboliken für Geschlechtlichkeit verwendet werden und Menschen, die sich noch gar nicht als „Mann“ und „Frau“ bezeichnen können, eine „Arbeitsteilung“ gemäß den durch die Biologie gegebenen Prädisponierungen (vor allem im Sinne der Gebär- und Stillfähigkeit der Frau) vollziehen?
Natürlich sind solche Arrangements unter dem vorherrschenden kulturellen und technischen Fortschritt neu zu bewerten. Und es ist auch dieser Fortschritt, der – wenigstens theoretisch – die Möglichkeit schafft, die Geschlechterrollen zu hinterfragen und aufgrund der Technisierung der Welt und der damit verbundenen körperlichen und geistigen Multioptionalität neu zu gestalten (um ein Kind zu stillen, ist nicht mehr zwingend die Anwesenheit der Frau erforderlich etc.). Jedoch ist die Wahrnehmung von Geschlecht als biologischer Dimorphismus alleinig nicht als „kulturelles Missverständnis“ zu bezeichnen, da er zunächst völlig wertfrei keine hierarchisierenden „soziale[n] Konsequenz[en]“ mit sich brachte. Indes ist jegliche aus dem Dimorphismus abgeleitete, wie auch immer geartete Bewertung der Leistungen von Männern und Frauen sowie die daraus resultierende Hierarchisierung theoretisch variabel und von daher aus einer entsprechend kritischen Perspektive grundsätzlich immer als Missverständnis auslegbar. Der Dimorphismus hätte nicht zwingend für die Unterdrückung der Frau und die Vorstellung von männlicher Hegemonie „missbraucht“ werden müssen, oder umgekehrt: Die Unterdrückung der Frau und die Hegemonieansprüche des Mannes gehen nicht unmittelbar auf die Wahrnehmung von Zweigeschlechtlichkeit zurück und sind vom Dimorphismus keinesfalls unumgänglich „vorgegeben“ worden. Der Dimorphismus ist in diesem Sinne zwar „falsch“ ausgelegt worden, stellt aber gesondert für sich – und dementsprechend auch der geschlechtliche Körper – nach dem hier zugrundegelegten Verständnis kein „kulturelles Missverständnis“ dar. Jedoch bleibt es stets schwierig, über ein System oder Konzept zu reflektieren, in das die eigene Person selbst eingebunden ist. Und auch bei jedem Entwickeln oder Überdenken einer neuen bzw. einer bestehenden Theorie ist es unvermeidlich, dass sich wissenschaftliche Überlegungen und persönliche Überzeugung miteinander vermischen.
Außerhalb der dargelegten „Missverständnis-Diskussion“ lässt sich festhalten, dass Geschlecht sowohl als materielles Phänomen, als auch als ein symbolisches System in einem korrespondierenden gesellschaftlich-kulturellen Kontext gesehen werden kann.[17] Und auch wenn Geschlecht als (vornehmlich) soziales Konstrukt betrachtet wird, sollte die Unterscheidung von „sex“ und „gender“ nicht gänzlich getilgt werden, denn dies nimmt der Geschlechterforschung in der Soziologie (und Sozialpsychologie) doch letztendlich den Untersuchungsgegenstand: den Menschen mit einer konkreten (Selbst-)Wahrnehmung als geschlechtliches Wesen, der das Geschlechterverhältnis beeinflussen kann, von diesem selber beeinflusst wird und zu Veränderungen beitragen kann und den es deshalb in seiner Wahrnehmung ernstzunehmen gilt.
Es ist klar geworden, dass die Standpunkte, von denen aus die Kategorie Geschlecht betrachtet wird, ebenso vielfältig sind wie die daraus hervorgebrachten Deutungen. Für die nun zu beschreibende Studie und deren Auswertung ist es jedoch aus dem eben genannten Grund wichtig, eine Interpretationsweise zu wählen, die der Fragestellung (und somit auch den befragten Männern) gerecht wird.
Die Studie fragt nicht nach einer theoretisch „richtigen“ Interpretation der Kategorie Geschlecht, sondern nach Erfahrungen von Männern in ihrer Selbstwahrnehmung als geschlechtliches Wesen. Hier soll nicht auf theoretischer Ebene im Sinne des Konstruktivismus diskutiert werden, ob „Männlichkeit“ und „Weiblichkeit“, wie es dem Alltagsverständnis entspricht, überhaupt existiert. Es geht auf der anderen Seite auch nicht darum, eine einheitliche, universal gültige Männlichkeit zu behaupten, vielmehr sind „Männlichkeitstheorien“ in dieser Studie ausschließlich in Form der festzustellenden (milieu- und generationsspezifischen) Deutungsmuster von Männlichkeit relevant, die mit einer entsprechenden Ausprägung des männlichen Habitus verbunden sind und der Alltagspraxis der befragten Männer zugrunde liegen bzw. an denen zumindest eine Orientierung stattfindet.
Die Auffassung des Mann- und Frauseins als „kulturell produziertes Missverständnis“ geht indes an der erlebten Realität und somit am Selbstverständnis eines überwiegenden Teils der Gesellschaft (bzw. der Männer in der Studie) vorbei, da die meisten Menschen ihre Geschlechtsidentität nun mal als direkte Folge ihrer jeweiligen biologisch-anatomischen Merkmale begreifen und infolgedessen dem Erleben der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht eine fundamentale und in hohem Maße persönlichkeitsstiftende Wirkung zukommt.[18]
Der geschlechtliche Habitus äußert sich dabei als „naturalisierte Praxis“, da kulturelle Überformungen der eigenen Geschlechtlichkeit in den meisten Fällen eben nicht wahrgenommen oder reflektiert werden. Vielmehr bezeichnet der geschlechtliche Habitus einen Modus der Wahrnehmung und des Handelns, in dem die Geschlechtsrolle und deren Darstellung fraglos gegeben sind.[19] Der geschlechtliche Habitus ist dem Körper gewissermaßen „eingeschrieben“. Aus diesem „Zustand des unreflektierten ‚Zuhauseseins’ in der sozialen Welt“ resultiert einerseits das „doing gender“, andererseits auch eine Garantie habitueller Sicherheit,[20] die nur bei nicht intendiertem, gewohnheitsmäßigem, unhinterfragtem Handeln im Geltungsbereich des geschlechtlichen Habitus gegeben ist, bei der positiven Annahme eines geltenden Zwangs, bei einem Leben gemäß des Habitus. Der Kern des männlichen Habitus ist das Prinzip der hegemonialen Männlichkeit.[21] Das diesem Prinzip innewohnende Deutungsmuster versteht die Geschlechtscharaktere und die soziale Differenzierung nach Geschlecht als ausschließliche, direkte und natürliche Folge des Diphormismus.
Welchem Milieu und welcher Generation die Männer angehören, die ein derartiges Deutungsmuster übernehmen und wo Männer zu verorten sind, denen ihr Mannsein kein „unreflektiertes Zuhausesein“ ist und die eine fundamentale habituelle Verunsicherung erfahren, wird festgestellt werden, denn es wird im Folgenden u. a. darum gehen „zu zeigen, wie [bzw. ob] der Dimorphismus als Grundlage und Rechtfertigung geschlechtsbezogener sozialer Arrangements [noch immer] verwendet wird“, welches Verständnis die Männer von Männlichkeit haben und wie sich ihr Mannsein in der Alltagspraxis darstellt.
2.2 Sozialhistorische Betrachtung zur Entstehung der modernen Geschlechterordnung
Bevor das Geschlechterverhältnis, so wie es sich heutzutage aus männlicher Perspektive darstellt, in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt werden soll, ist es hilfreich, sozialhistorische Hintergründe zur Entstehung der modernen Geschlechterordnung aufzuzeigen.
„Diese Welt hat immer den Männern gehört“[22] – dieses Zitat von Simone de Beauvoir beinhaltet einen Aspekt, der sich seit jeher in allen geschichtlichen Epochen durch- und fortgesetzt hat: die Dominanz des Mannes über die Frau. Dabei handelt es sich nicht um die Folge eines gesonderten Ereignisses der Menschheitsgeschichte, sondern um ein über historisch lange Zeiträume hinweg zu rekonstruierendes Muster. Der Beginn der Moderne nimmt im Hinblick auf das derzeitig vorherrschende Geschlechterverhältnis einen besonderen Stellenwert ein, denn hier ergaben sich neue Qualitäten im Verhältnis zwischen den Geschlechtern, die auf bürgerlichen Deutungsmustern begründet sind und bis heute nachhaltige Wirkung zeigen.[23]
Der Wandel im Geschlechterverhältnis ging einher mit gesellschaftlichen Veränderungen im Rahmen der Industrialisierung. Die Standesgesellschaft war mehr oder minder in Auflösung begriffen. Die zuvor weitgehend autarke Großfamilie, die den familieneigenen Betrieb und privaten Lebensraum im sogenannten „ganzen Haus“ untrennbar miteinander verband, wich der „Kernfamilie“, die nur noch aus zwei Generationen bestand, nämlich den Eheleuten und den jeweiligen Kindern. Der Arbeitsplatz des Mannes war fortan nicht länger an das Haus gebunden und dies führte somit zur Aufteilung von privatem und öffentlichem Bereich. Diese ökonomischen und sozialen Veränderungen bewirkten auch Neuerungen im Geschlechterverhältnis. Denn während noch im 18. Jahrhundert Männer und Frauen weitestgehend gleichermaßen über ihre soziale Position innerhalb des „ganzen Hauses“ definiert wurden, kam es im 19. Jahrhundert im Zuge der Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit in der Industriegesellschaft zur Abgrenzung von Geschlechtscharakteren. Diese wurden aus den veränderten, scheinbar einer „natürlichen“ biologischen Determiniertheit folgenden Funktionen von Mann und Frau in der „Kernfamilie“ abgeleitet und zu gegensätzlichen „männlichen“ und „weiblichen“ Prinzipien universalisiert.[24]
Diesen Prinzipien wurden bestimmte Eigenschaften zugeordnet, die als ineinandergreifende Kontraste angesehen werden können. Aus bestimmten, jeweils als geschlechtsspezifisch betrachteten physischen und psychischen Eigenschaften wurde eine Prädestinierung des Mannes für den öffentlichen Bereich und der Frau für den häuslichen Bereich geschlossen. Als weitere, komplementär angelegte Gegensatzpaare galten z.B. Aktivität, Rationalität und Geist, die dem Mann zugeschrieben wurden bei gleichzeitiger Definition von Passivität, Emotionalität und Körper, die dem weiblichen Prinzip zugehörig seien.[25] Die sich zunehmend ausdifferenzierenden Humanwissenschaften legitimierten darüber hinaus die Zuordnung von Mann und Frau zu zwei verschiedenen Sphären als natürlich. Dabei ist selbstverständlich anzumerken, dass es sich um männliche wissenschaftliche Experten handelte, die die Idee der biologisch begründeten Geschlechtscharaktere unterstützen. Die Trennung in weibliche und männliche Prinzipien darf also gut und gerne als männliche Erfindung gelten. Dies impliziert auch, dass der weibliche Geschlechtscharakter eine Fremddefinition darstellte, was kennzeichnend für die bürgerliche Ordnung der Geschlechter war.[26]
Frauen wurde in diesem Zusammenhang eine Partizipation an der fortlaufend an Bedeutung gewinnenden Sphäre von Staat und Politik versagt. Das für die notwendige Regeneration des Mannes von der Frau zu gestaltende Familienleben wurde als Begründung für den Ausschluss aus der Öffentlichkeit herangezogen. Somit wurde die Auffassung von Mann und Frau als sich in Harmonie ergänzende Komplemente propagiert. Dabei erfuhr die Frau zum einen eine Degradierung, da ihr die Möglichkeit einer Erwerbsarbeit nachzugehen, vorenthalten wurde. Anderseits ergab sich eine Idealisierung der Frau als der „schönere“, „bessere“ Teil der Menschheit, der als edel und erhaben galt und den unentbehrlichen Kontrast zu einer immer kälter werdenden Welt verkörperte. Das Wesen der Frau wurde gewissermaßen doppelt verklärt, wobei anzumerken ist, dass eine solche Sichtweise ein bürgerliches Phänomen war.[27]
Die Kultivierung von männlichen und weiblichen Geschlechtscharakteren galt nämlich nicht gleichermaßen für alle gesellschaftlichen Gruppen des 19. Jahrhunderts, denn die Klassenzugehörigkeit war auch damals – wohl mindestens im selben Maße wie heute die Milieuzugehörigkeit – für die Ausbildung von geschlechtlichen Deutungsmustern entscheidend. Die Trennung von Haushalt und Arbeitsplatz als Basis für die Entstehung der Idee der komplementären Geschlechtscharaktere konnte im Gegensatz zum Bürgertum bei Bauern und Handwerkerfamilien nicht vollzogen werden. Aus dem Arbeitermilieu war es lediglich die Gruppe der Lohnarbeiter, deren berufliche Situation theoretisch eine Rezeption des Konzepts der geschlechtsspezifischen männlichen und weiblichen Prinzipien hätte ermöglichen können, dem entgegen stand jedoch die Erwerbstätigkeit der Frauen.[28]
Die Familien des Arbeitermilieus waren gezeichnet durch materielle Sorgen, so dass ein Beitrag der Frau zum Einkommen meist völlig unverzichtbar war. Die finanziellen Nöte verhinderten also insofern die Kultivierung weiblicher Tugenden, als dass es nicht möglich war, die Frau aus dem öffentlichen Leben fernzuhalten und ausschließlich in der häuslichen Sphäre zu beheimaten. Dass die Polarisierung der Geschlechtscharaktere einzig im neu formierten Bürgertum realisiert wurde, bedeutet indes nicht, dass sich die Beziehungen zwischen Mann und Frau im Arbeitermilieu durch Gleichberechtigung und Solidarität auszeichneten. Auch hier existierte trotz der relativen ökonomischen Unabhängigkeit der Frau ein Machtgefälle zugunsten des Mannes. Die Haushaltsführung oblag ausschließlich der Frau und die Ernährerrolle des Mannes war für diesen von besonderer Bedeutung, der durch die notwendige Beisteuerung zum Familieneinkommen seitens der Frau eine schmerzliche Schmälerung beigebracht wurde.[29]
Letztendlich muss also beim Begriff der „modernen“ Deutungsmuster des Geschlechterverhältnisses im 19. Jahrhundert relativiert werden, dass es sich dabei vor allem um bürgerliche Konzepte handelt. Die Orientierungen des Arbeitermilieus hinsichtlich dieses Zusammenhangs sind längst nicht vergleichsweise hinreichend und eindeutig dokumentiert.[30]
Die folgenden Ausführungen zum Thema des Mannseins sowie des männlichen Blicks auf das Geschlechterverhältnis und die Frau werden auch herausstellen, inwieweit heutige Deutungsmuster traditionsverhaftete Kontinuitäten im Sinne der bürgerlichen Geschlechterordnung darstellen und in welchem sozialen Standort diese insbesondere zu finden sind.
3. Methodische Anmerkungen
Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Studie sind das Ergebnis aus Diskussionen von 30 Gruppen, in denen Männer verschiedener Altersstufen und ebenso unterschiedlicher sozialer Milieus vertreten waren. Es handelt sich dabei um sogenannte natürliche Gruppen, die im realen Leben und somit unabhängig von der Erhebungssituation existieren.[31] Die Gruppen sind ausschließlich geschlechtshomogene Männergruppen, da kollektive männliche Orientierungen ermittelt werden sollen, und zwar in authentischer, unbeeinflusster Form, also ohne eine eventuelle Verzerrung, die durch die Anwesenheit von den Männern bekannten Frauen hervorgerufen werden könnte. Die Gruppenmitglieder entstammen jeweils demselben sozialen Milieu und derselben Generation und sind somit durch sozialräumliche und lebensgeschichtliche Nähe miteinander verbunden.
Bei der Auswahl der Gruppen ging es vor allem darum, Material für eine vergleichende Analyse zu erlangen, um letztendlich minimale als auch maximale Kontrastierungen vornehmen zu können. Die gewonnenen Aussagen sind zwar nicht im statistischen Sinne repräsentativ, jedoch arbeitet der Forschungsprozess durch die Bildung von Vergleichsgruppen in valider Weise Typiken heraus.[32]
Der Art, wie die Studie angelegt ist, geht die Annahme voraus, dass es qualitativ divergierende Männlichkeiten bzw. männliche Deutungsmuster gibt, die ihrerseits an unterschiedliche soziale Standorte gebunden sind und nur jeweils dort existieren (können), und deren jeweilige charakteristische Konstitution als auch deren (Darstellungs-)Praxis wiederum umgekehrt durch entsprechende soziale Strukturen bedingt bzw. hervorgerufen ist.[33] Mit anderen Worten gehen die Forschenden davon aus, „dass Männer in der Regel die Form von „Männlichkeit“ repräsentieren und praktizieren, die dem Leben in ihrem jeweiligen spezifischen sozialen Kontext angemessen ist“.[34] Demgemäß sollen verschiedene Deutungsmuster von Männlichkeit im Sinne kollektiver Orientierungen herausgearbeitet werden.
[...]
[1] Vgl. Behnke, Cornelia, Loos, Peter u. Meuser, Michael: Habitualisierte Männlichkeit. Existenzielle Hintergründe kollektiver Orientierungen von Männern. In: Biographieforschung und Kulturanalyse. Transdisziplinäre Zugänge qualitativer Forschung. Hrsg. von Ralf Bohnsack u. Winfried Marotzki. Opladen: Leske + Budrich 1998. S. 225.
[2] Vgl. Meuser, Michael: Gefährdete Sicherheiten und pragmatische Arrangements. Lebenszusammenhänge und Orientierungsmuster junger Männer. In: Die ungleiche Gleichheit. Junge Frauen und der Wandel im Geschlechterverhältnis. Hrsg. von Mechthild Oechsle und Birgit Geissler. Opladen: Leske + Budrich 1998. S. 237 u. 238.
[3] Vgl. Behnke, Cornelia: „Frauen sind wie andere Planeten.“ Das Geschlechterverhältnis aus männlicher Sicht. Frankfurt a.M., New York: Campus Verlag 1997. S. 9.
[4] Vgl. Meuser: Gefährdete Sicherheiten und pragmatische Arrangements. S. 238.
[5] Vgl. Behnke, Loos, Meuser: Habitualisierte Männlichkeit. S. 225.
[6] Vgl. Meuser: Gefährdete Sicherheiten und pragmatische Arrangements. S. 240.
[7] Meuser, Michael: Geschlecht und Männlichkeit. Soziologische Theorie und kulturelle Deutungsmuster. Opladen: Leske + Budrich 1998. S. 70.
[8] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 12.
[9] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 13.
[10] Vgl. Korte, Herrmann: Soziologie im Nebenfach. Eine Einführung. Konstanz: UVK 2001. S. 142.
[11] Vgl. Meuser: Geschlecht und Männlichkeit. S. 68.
[12] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 14.
[13] Vgl. ebd.
[14] Vgl. Linke, Angelika, Nussbaumer, Markus u. Portmann, Paul R.: Studienbuch Linguistik. 4., unveränderte Auflage. Tübingen: Niemeyer 2001. S. 33.
[15] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 16.
[16] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 16 u. 17.
[17] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 18.
[18] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten.“ S. 18.
[19] Vgl. Behnke, Loos, Meuser: Habitualisierte Männlichkeit. S. 226.
[20] Vgl. Meuser: Gefährdete Sicherheiten und pragmatische Arrangements. S. 242.
[21] Vgl. Meuser: Geschlecht und Männlichkeit. S. 118 u. 119.
[22] Simone de Beauvoir. Nach: Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 19.
[23] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 19.
[24] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 21.
[25] Vgl. Korte: Soziologie im Nebenfach. S. 136.
[26] Vgl. Behnke, Cornelia u. Meuser, Michael: Zwischen aufgeklärter Doppelmoral und partnerschaftlicher Orientierung. Frauenbilder junger Männer. In: Zeitschrift für Sexualforschung, Jg. 10, Heft 1, 1997. S. 3.
[27] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 23.
[28] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 25.
[29] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 28.
[30] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 29.
[31] Vgl. Meuser: Gefährdete Sicherheiten und pragmatische Arrangements. S. 240.
[32] Vgl. Behnke: „Frauen sind wie andere Planeten“. S. 31.
[33] Vgl. Brandes, Holger: Der männliche Habitus. Band 2: Männerforschung und Männerpolitik. Opladen: Leske + Budrich 2002. S. 116.
[34] Ebd.
- Arbeit zitieren
- Julia Haase (Autor:in), 2005, Mannsein, Männlichkeit und Geschlechterverhältnis im ausgehenden 20. Jahrhundert. Tradition oder Modernisierung?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272432
Kostenlos Autor werden








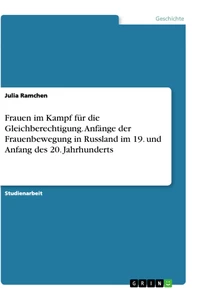













Kommentare