Leseprobe
Inhalt
Vorbemerkung
1. Theoretische Grundlagen - Gottfried W. Leibniz’ Monadologie
2. Der Begriff der Monade in der Ästhetischen Theorie Adornos
3. Kritik an Adornos Monadenkonzeption der Kunstwerke
Schlussbemerkung
Bibliographie
Vorbemerkung
Das Resultat des Prozesses sowohl wie er selbst im Stillstand ist das Kunstwerk. Es ist, was die rationalistische Metaphysik auf ihrer Höhe als Weltprinzip proklamierte, Monade: Kraftzentrum und Ding in eins. 1
Die Monade als Gedankenfigur zur näheren Bestimmung des allgemeinen Wesens der Kunstwerke ist in Theodor W. Adornos Ästhetischer Theorie durchgängig präsent. Jedoch hat die Verwendung des Monadenbegriffs, verglichen mit der bemerkenswerten Fülle an Forschungsliteratur, welche der 1970 posthum erschienenen Ästhetischen Theorie gewidmet ist, bisher nur wenig Beachtung erfahren2. Wie Birgit Recki schon 1988 feststellt, resultiert dieser Umstand nicht zuletzt aus der weitverbreiteten Annahme, es handele sich bei dem Rückgriff auf den Terminus “Monade” lediglich um „die verschrobene Neigung des Autors zu eigenwilligem Umgang mit philosophischem Bildungsgut”3. Doch bereits die Hartnäckigkeit, mit der in der Ästhetischen Theorie am Begriff der Monade festgehalten wird, deutet auf dessen systematische Relevanz für Adornos ästhetische Überlegungen hin und lässt eine eingehendere Beschäftigung mit diesem Thema lohnenswert erscheinen.
Die der vorliegenden Arbeit vorangestellte Aussage ist einer Passage der Ästhetischen Theorie entnommen, welche für Adornos Monadenkonzeption der Kunstwerke von zentraler Bedeutung ist. Sie bildet daher einen geeigneten Ausgangspunkt für die leitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit: Wie ist Adornos Deutung der Kunstwerke als Monaden genau zu verstehen und warum eignet sich gerade die ursprünglich der Metaphysik Leibniz’ entstammende Monadenkonzeption zur Charakterisierung seiner Auffassung vom Wesen der Kunstwerke? Um eine erhellende Antwort auf diese Fragen nach der Rolle des Begriffs der Monade in Adornos kunsttheoretischen Betrachtungen liefern zu können, bedarf es zunächst einer ausführlicheren Erläuterung der Grundgedanken der Leibnizschen
Monadenlehre, soweit diese in der sogenannten Monadologie enthalten sind. Dabei soll es in erster Linie darum gehen, die besonderen Eigenschaften der Monade näher zu bestimmen und so dem Monadenbegriff eine grobe Kontur zu geben, wobei die Darstellung sich vornehmlich auf diejenigen Merkmale konzentrieren wird, welche für die Ästhetische Theorie Adornos interessant sind. Die Ausführungen zur Leibnizschen Monadenkonzeption sind demnach Gegenstand des ersten Abschnitts. Auf der so gewonnenen Grundlage erfolgt im zweiten Kapitel die eigentliche Klärung der leitenden Fragestellung, d.i. die Analyse der spezifischen Anwendung des Monadenbegriffs bei Adorno und, damit eng zusammenhängend, die Bestimmung des Stellenwerts, welchen der Begriff in der Ästhetischen Theorie einnimmt. Anschließend widmet sich der dritte Abschnitt der kritischen Diskussion der Adornoschen Konzeption der Kunstwerke als Monaden. Die Ausführungen schließen mit einer kurzen Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse.
1. Theoretische Grundlagen - Gottfried W. Leibniz’Monadologie
Die 1714 erschienene Monadologie stellt das Kernstück der Metaphysik Leibniz’ dar und enthält, wie der Titel4 unschwer erahnen lässt, die zentralen Bestimmungen seines Monadenbegriffs, welche „auch im Wesentlichen für andere und spätere Monadenkonzeptionen verbindlich”5 bleiben. Ausgehend von der rationalistischen Grundannahme der Möglichkeit einer vollständigen Erklärbarkeit alles Seienden versucht Leibniz’ mit seiner Monadologie eine Antwort auf die Frage nach der Beschaffenheit der elementarsten Bausteine der Wirklichkeit zu geben. Diese, die gesamte Erscheinungswelt konstituierenden Bausteine, bezeichnet Leibniz unter Rückgriff auf den griechischen Terminus (monas) als Monaden6. Wörtlich übersetzt bedeutet nichts anderes als “die Einheit” bzw. “das Einfache“, womit bereits ein grundlegendes Charakteristikum der Leibnizschen Monaden benannt ist:
Es handelt sich um „einfache Substanz[en]; einfach heißt: ohne Teile”7. Dieser These liegt die zu Leibniz’ Lebzeiten populäre Auffassung zugrunde, wonach ein bestimmter Gegenstand nur durch Zerlegung in seine Einzel- bzw. Elementarteile und anschließende Wiederzusammensetzung dieser Teile vollständig verstanden werden kann8. Dass man so zwangsläufig auf nicht weiter zerlegbare, mithin letzte Teile stößt, ist dabei für Leibniz ebenso evident wie die Tatsache, dass Zusammengesetztes bzw. Zusammensetzungen existieren. Ihm zufolge muss es „einfache Substanzen geben, weil es Zusammengesetztes gibt; denn das Zusammengesetzte ist nichts anderes als eine Anhäufung […] von Einfachem” (MO 11).
Nun könnte man annehmen, dass es sich bei den Monaden um physische Elemente handelt und Leibniz’ Monadenkonzeption also lediglich eine Fortsetzung der von Demokrit ausgehenden Tradition des atomistischen Materialismus darstellt. Jedoch will Leibniz die Monaden keineswegs als solche materiellen Elementarteilchen verstanden wissen. Für ihn ist offensichtlich, dass „da, wo es keine Teile gibt, weder Ausdehnung noch Figur [existieren], noch die Möglichkeit einer Teilung” (MO 11) besteht. Ihre Unteilbarkeit steht demnach in direktem Widerspruch zu einer materiellen Verfasstheit der Monaden. Die Vermutung, die „wahren Atome der Natur” (MO 11), wie Leibniz die Monaden auch bezeichnet, seien rein geistige, unkörperliche Entitäten, liegt nahe9 ; wobei sich sogleich die schwierige Frage nach dem Zusammenhang zwischen solchen unausgedehnten, einfachen Elementen auf der einen und den ausgedehnten, zusammengesetzten Dingen des körperlichen Universum auf der anderen Seite aufdrängt. Leibniz’ Lösung dieses Problems besteht in der Annahme, dass es sich bei den Monaden gleichsam um „ontologische Zwitter[wesen]”10 handelt, in denen die „intelligible göttliche Realität (zu der Geist, Seele und Spontaneität gehören) und die phänomenale weltliche Wirklichkeit (zu der Körper und mechanische Kausalität gehören) vereint sind”11. Diesen Doppelcharakter versucht Leibniz begreiflich zu machen, indem er den Monaden eine punktuelle Struktur zuschreibt12. Demnach stellt eine Monade, grob zusammengefasst, die „Vereinigung des mathematischen Mittelpunktes (der Seele) mit seiner umgebenden Hülle (ihrer Erstmaterie)”13 dar. Den mathematische Punkt, das Zentrum einer jeden Monade, muss man sich dabei als den unausgedehnten Schnittpunkt unendlich vieler Linien vorstellen, welche von diesem Punkt aus „in den physischen Punkt auseinanderlaufen”14 ; wobei der physische Punkt die weiter oben erwähnte Hülle bzw. Erstmaterie bezeichnet15. So lassen sich die Monaden gleichsam als Verschmelzungen von Geist und Materie, als “metaphysische Punkte“ beschreiben, deren winkelbildendes Zentrum „trotz der mit den Winkeln gegebenen Beziehung zur materiellen Ausdehnung”16 ein Punkt ohne abstehende, d.h. räumliche Teile bleibt; weshalb es auch gerechtfertigt ist, von den Monaden als einfachen, unausgedehnten Substanzen zu sprechen17.
Geht man nun von Einfachheit und Unteilbarkeit als wesentliche Merkmale der Monade aus, ergeben sich daraus noch zwei weitere bedeutende Eigenschaften. Zum einen können Monaden Leibniz zufolge auf „natürliche Weise” (MO 11) weder entstehen noch vergehen, „da sie nicht [wie die Dinge der körperlichen Natur; Anm. des Verfassers] durch Zusammensetzungen gebildet” (MO 11) werden. Denn alles Zusammengesetzte entsteht aus Teilen oder vergeht in Teile, wohingegen die unteilbaren Monaden „nur auf einen Schlag […], das heißt […] durch Schöpfung beginnen und durch Vernichtung enden” (MO 11-13) können. Die Quelle dieses Schöpfungsaktes ist das göttliche Wesen, welches von Leibniz auch als „die ursprüngliche Einheit oder die einfache Ursubstanz” (MO 37) bezeichnet wird. In Anbetracht des Themas der vorliegenden Arbeit sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass dem Schöpfungsbegriff neben den, für Leibniz’ System wesentlichen, theologischen Implikationen ein genuin ästhetisches Moment eignet, indem er auch „auf den künstlerischen Schöpfungsakt”18 verweist. Die zweite, aus ihrer Einfachheit und Unteilbarkeit resultierende Eigenschaft der Monaden besteht darin, dass sie durch äußere Einflüsse in ihrem Inneren nicht verändert werden können. Anders als bei Zusammensetzungen, „bei denen es einen Wechsel zwischen den Teilen gibt” (MO 13), kann man in einer Monade „weder etwas umstellen noch sich eine innere Bewegung vorstellen […], die [von außen; Anm. des Verfassers] in ihr angeregt, gelenkt, vermehrt oder vermindert werden könnte” (MO 13); ein äußerlicher Eingriff liefe ihrer Bestimmung als einfache Substanz schlicht zuwider. Diese hermetische Abgeschlossenheit, welche jegliche Kommunikation der Monaden unter einander, d.h. jeden reziproken Austausch unmöglich macht, verdeutlicht Leibniz auch durch die berühmte Metapher von der “Fensterlosigkeit” der Monaden. Danach besitzen diese keine Fenster, „durch die irgendetwas ein- oder austreten könnte” (MO 13).
Wurden die Leibnizschen Monaden bis hierher als einfache, unteilbare, unvergängliche, unbeeinflussbare und fensterlose Substanzen beschrieben, so fällt auf, dass fast alle diese Bestimmungen ausgrenzender bzw. negierender Art sind, insofern sie lediglich anzeigen, welche Eigenschaften den Monaden nicht zukommen. Jedoch müssen die Monaden tatsächliche Eigenschaften bzw. Qualitäten haben, da sie „sonst […] nicht einmal Wesen” (MO 13), mithin nicht einmal etwas Seiendes wären. Auch müssen die Monaden sich in ihren Qualitäten voneinander unterscheiden. Andernfalls ließe sich die Vielfalt der wahrnehmbaren, körperlichen Welt nicht erklären, wobei Leibniz freilich voraussetzt, dass das, „was im Zusammengesetzten [d.h. der körperlichen Welt; Anm. des Verfassers] ist, nur von dem in ihm enthaltenen Einfachen herrühren kann” (MO 13). Leibniz betont im Folgenden, dass „sogar jede Monade von jeder anderen verschieden sein“ (MO 15) muss. Dabei beruft er sich auf das “Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren“, welches in letzter Konsequenz darauf hinausläuft, dass in der Natur niemals zwei vollkommen gleiche Wesen existieren19. Jede Monade stellt also ein letztendlich unverwechselbares Individuum dar.
Nachdem so zunächst die Notwendigkeit des Vorhandenseins differenzierender und individuierender Qualitäten in den Monaden aufgezeigt wurde, zieht Leibniz nun - ausgehend von der für ihn unbestreitbaren Tatsache, dass alle „Wesen und folglich auch die geschaffene[n] Monade[n] der Veränderung unterlieg[en]“ (MO 15) - das sogenannte “Kontinuitätsprinzip“ zur Beschreibung der inneren Verfasstheit der Monaden heran. Es besagt, dass „jede Bewegung, alle Veränderungen […] einen lückenlosen Zusammenhang (so ein Vorschlag, um die Bedeutung von ‘Kontinuum‘ zu erklären) bilden“20. Dies trifft Leibniz zufolge sowohl auf die äußeren Veränderungen in der Natur als auch auf die Veränderungen der inneren Zustände der Monaden zu. Da sich Veränderungen also immer schrittweise und niemals sprunghaft vollziehen, sodass stets einiges bestehen bleibt und anderes sich ändert, muss jede Monade so etwas wie eine „Vielheit in der Einheit oder im Einfachen einschließen […], obwohl es darin keine Teile gibt“ (MO 15-17). Diese zunächst paradox anmutende Bestimmung wird verständlicher, wenn man, wie weiter oben bereits geschehen, die einzelnen Monaden bzw. deren Zentren als mathematische Punkte mit prinzipiell unendlich vielen Schnittwinkeln betrachtet, wobei die unterschiedlichen Schnittwinkel jene in den Monaden enthaltene Mannigfaltigkeit darstellen. Somit lässt sich jede Monade als eine, kontinuierlicher Veränderung unterworfene, individuelle Einheit beschreiben, welche zugleich eine „Vielzahl von Affekten und Beziehungen“ (MO 17) in sich birgt. Denkt man diese Charakterisierung nun mit der oben erläuterten Kennzeichnung der Monaden als fensterlose, von außen nicht affizierbare Substanzen zusammen, so folgt daraus, dass ihre „natürlichen Veränderungen […] von einem inneren Prinzip herrühren“ (MO 15) müssen, dessen Wirken Leibniz als „Appetit“ (MO 17) bezeichnet. Diese immanente Tätigkeit besteht in dem unaufhörlichen Streben jeder einzelnen Monade, von einem inneren Zustand zum nächsten zu gelangen. Einen solchen augenblicklichen, „vorübergehende[n] Zustand, der eine Vielheit in der Einheit“ (MO 17) beinhaltet, bezeichnet Leibniz als „Perzeption“ (MO 17), was am ehesten mit dem Begriff “Vorstellung“ übersetzt werden kann21. Eine Monade ist demnach ein ihrem Wesen nach vorstellendes Geschöpf und was es vorstellt, ist nicht weniger als die gesamte Schöpfung, weshalb Leibniz die Monaden auch als „Spiegel des Universums“ (MO 41) charakterisiert. Dabei repräsentieren die Monaden die Gesamtheit der ihnen äußerlichen Welt auf indirekte Art und Weise22, entsprechend ihrem je eigenen Blickwinkel, sodass jede Monade einen „individuelle[n] Ausdruck der Welt“23 darstellt und folglich ebenso viele verschiedene Universen wie Monaden existieren, welche „dennoch nur die unterschiedlichen Perspektiven eines einzigen gemäß den verschiedenen Gesichtspunkten“ (MO 43) der einzelnen Monaden sind. Durch diesen perspektivischen Repräsentationscharakter kommt den Monaden ein wesentlich ästhetisches Moment zu, indem sie „immer auch reflektierendes Zeichen für anderes“24 sind.
Jedoch muss jede Monade nicht nur alle anderen Monaden immer schon implizit enthalten; ihre Fensterlosigkeit hat auch zur Folge, dass sie all ihre eigenen Bestimmungen von Anfang an in sich haben muss, d.h. sämtliche Zustände, die sie irgendwann, und sei es in noch so ferner Zukunft, einmal durchlaufen wird. Gleich „unkörperlichen Automaten“ (MO 19) entwickeln sich die Monaden gemäß ihrem jeweiligen individuellen Gesetz „nach Art eines analytischen Urteils“25, sodass “ent- wickeln“ hier buchstäblich als “auswickeln“ im Sinne eines allmählichen Entfaltens des immer schon in ihnen Vorhandenen verstanden werden muss. Da die Monaden also die alleinigen Ursachen ihrer Veränderungen sind, bezeichnet Leibniz sie auch als „Entelechien“ (MO 19), d.h. als autonome, selbstständige und selbstgenügsame, durch Individualität gekennzeichnete Wesenheiten, welche, lebendigen Kraftzentren gleich, die Grundlage alles Lebens bilden.
[...]
1 Adorno, Theodor Wiesengrund: Ästhetische Theorie, Frankfurt a. M. (Suhrkamp) 1973, S. 268. - Im Folgenden abgekürzt mit ÄT.
2 Ausgenommen sei hier Andreas Pradlers 2003 erschienene Monographie Das monadische Kunstwerk, welche sich diesem Gegenstand ausführlich widmet. Siehe hierzu: Pradler, Andreas: Das monadische Kunstwerk - Adornos Monadenkonzeption und ihr ideengeschichtlicher Hintergrund, Würzburg 2003.
3 Recki, Birgit: Aura und Autonomie: Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, Würzburg 1988, S. 98.
4 Den Titel Monadologie wählte Heinrich Köhler 1720 in seiner ersten deutschen Übersetzung des französischen Originaltextes Eclaircissement sur les Monades. Vgl. hierzu: Busche, Hubertus: Einführung, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 3.
5 Pradler, Andreas: Das monadische Kunstwerk - Adornos Monadenkonzeption und ihr ideengeschichtlicher Hintergrund, Würzburg 2003, S. 17.
6 In der griechischen Philosophie wurde der Begriff zur Bezeichnung alles dessen verwendet, was einfach und unteilbar ist. Auch in der griechischen Mathematik, so z.B. in den Schriften Euklids spielt der Terminus eine Rolle. Dort bezeichnet die “Monas“ das Minimum der arithmetischen Größe, wobei sie selbst nicht zu den Zahlen gehört, sondern so etwas wie deren ideale Quelle darstellt. Vgl. hierzu: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Regenbogen, Arnim und Meyer, Uwe <Hg.>, Hamburg 1998, S. 425 (Stichwort: Monade).
7 Leibniz, Gottfried Wilhelm: Monadologie, Stuttgart (RUB) 1998, S. 11. - Im Folgenden abgekürzt mit MO.
8 Diese Methode wird als resolutiv-kompositorische bezeichnet. Vgl. hierzu: Pradler, Andreas: Das monadische Kunstwerk - Adornos Monadenkonzeption und ihr ideengeschichtlicher Hintergrund, Würzburg 2003, S. 17.
9 Dies nimmt u.a. Andreas Pradler an. Vgl. hierzu: Ebd., S. 18.
10 Busche, Hubertus: Übernatürlichkeit und Fensterlosigkeit der Monaden, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 50.
11 Ebd., S. 50.
12 Die punktuelle Struktur der Monaden wird in der Monadologie in keiner Weise behandelt, ist aber, wie sich im Folgenden zeigen wird, für das Verständnis der Leibnizschen Theorie aufschlussreich.
13 Busche, Hubertus: Übernatürlichkeit und Fensterlosigkeit der Monaden, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 51.
14 Ebd., S. 51.
15 Anders als die Zweitmaterie, d.h. die ausgedehnten Körper, welche immer nur Phänomene sind, charakterisiert Leibniz die Erstmaterie als äußerst feine, flüssige Lichtmaterie; diese ist genaugenommen nicht ausgedehnt, sondern strebt lediglich nach Ausdehnung. Somit stellen die Monaden gewissermaßen Vermittler zwischen den bei Leibniz streng getrennten, keiner direkten Interaktion fähigen Bereichen der geistigen und der körperlichen Welt dar, indem die flüssige Erstmaterie der Monaden das substantielle Band zwischen Geist und Körper bildet. Und trotzdem es keine direkte, physische Beeinflussung zwischen geistiger und körperlicher Welt geben kann, herrscht dennoch eine vollkommene Übereinstimmung zwischen den beiden Bereichen, welche sich aus der von Gott eingerichteten “Prästabilierten Harmonie“ ergibt. Vgl. hierzu: Busche, Hubertus: Übernatürlichkeit und Fensterlosigkeit der Monaden, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 52.
16 Ebd., S. 52.
17 Ausführlich beschäftigt sich Hubertus Busche mit Leibniz' Theorie zum Verhältnis von materieller und geistiger Welt und der punktuellen Beschaffenheit der Monaden. Vgl. hierzu: Ebd., S. 50 ff.
18 Pradler, Andreas: Das monadische Kunstwerk - Adornos Monadenkonzeption und ihr ideengeschichtlicher Hintergrund, Würzburg 2003, S. 19.
19 Zum “Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren“ bei Leibniz siehe: Poser, Hans: Innere Prinzipien und Hierarchien der Monaden, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 83.
20 Poser, Hans: Innere Prinzipien und Hierarchien der Monaden, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 82.
21 Da Vorstellungen im Allgemeinen ein Bewusstsein voraussetzen, Leibniz jedoch nur bestimmten Monaden die Fähigkeit bewusster Perzeption zuschreibt, kann man “Perzeption“ anstatt mit “Vorstellung“ auch mit “Informationen“ übersetzen. Vgl. hierzu: Buber, Rüdiger <Hg.>: Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung, Band 5 (Rationalismus), Stuttgart 2002, S. 236.
22 Das Repräsentationsverhältnis besteht gerade nicht in einer direkten kausalen Einwirkung (welche aufgrund der Fensterlosigkeit der Monaden ausgeschlossen werden muss), sondern wird durch die von Gott eingerichtete “Prästabilierte Harmonie“ dergestalt geregelt, dass alle Monaden des Universums schon von Beginn an als Möglichkeiten aufeinander abgestimmt sind und also jede Monade implizit alle anderen enthält. Die “Prästabilierte Harmonie“ regelt also nicht nur das Verhältnis zwischen körperlicher und geistiger Welt (siehe dazu Fußnote 15), sondern auch sämtliche Beziehungen zwischen den einzelnen Monaden. Vgl. hierzu: Poser, Hans: Innere Prinzipien und Hierarchien der Monaden, in: Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie, Busche, Hubertus <Hg.>, Berlin 2009, S. 93.
23 Pradler, Andreas: Das monadische Kunstwerk, Würzburg 2003, S. 21.
24 Recki, Birgit: Aura und Autonomie: Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno, Würzburg 1988, S. 99.
25 Ebd., S. 100.
- Arbeit zitieren
- Timo Weißberg (Autor:in), 2011, Der Begriff der Monade in Th. W. Adornos Ästhetischer Theorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271019
Kostenlos Autor werden
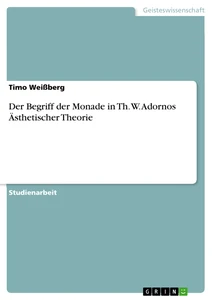
















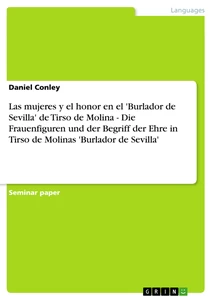


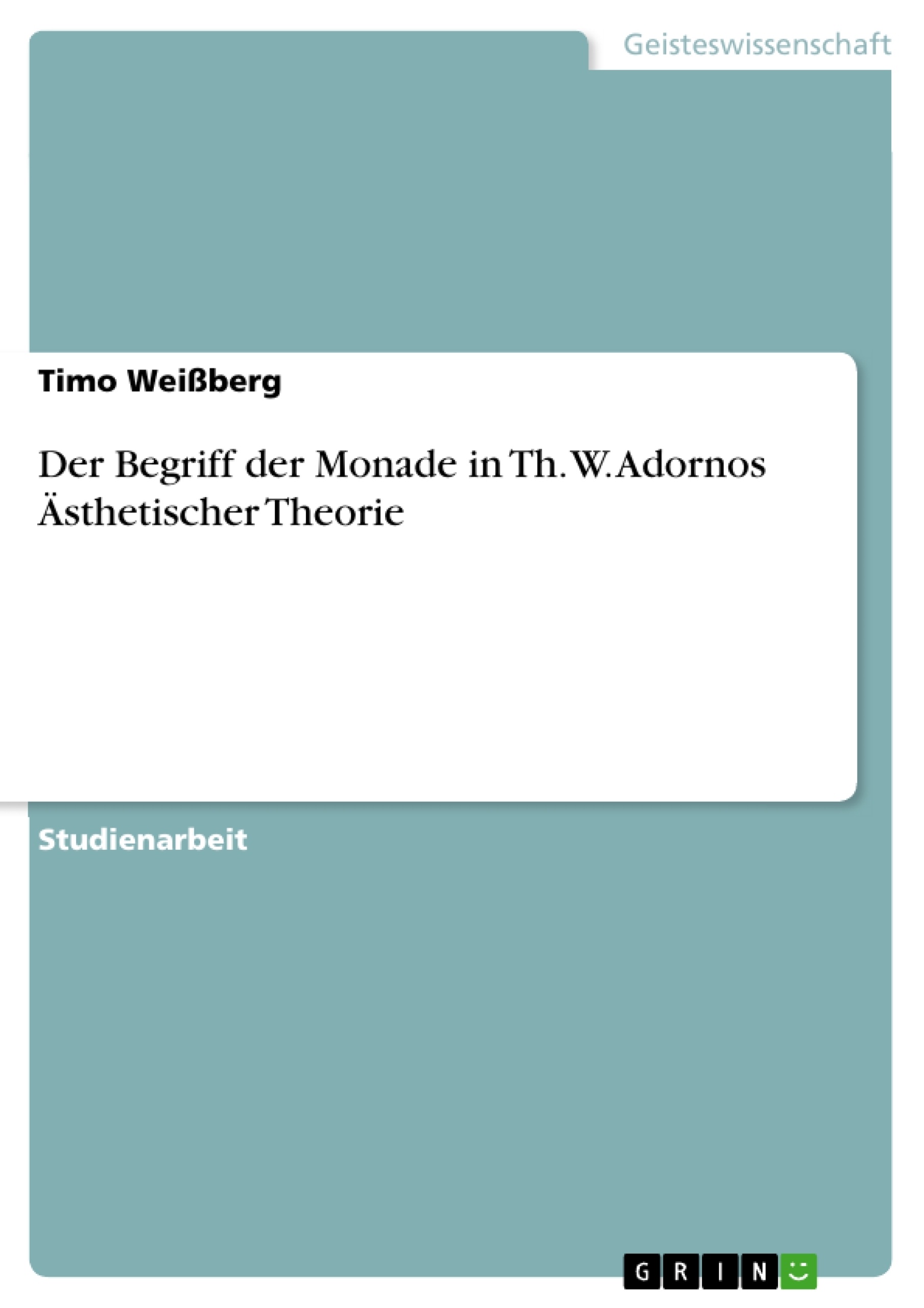

Kommentare