Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Trost
Vorwort
Zusammenfassung
Abstract
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
2. Sterbekultur in Deutschland
3. Sterben in Institutionen
4. Spezialbereich Intensivstation
4.1. Geschichtliche Entwicklung
4.2. Strukturelle Gegebenheiten
4.3. Intensivmedizinischer Behandlungsprozess
4.4. Ziele und Ergebnisse intensivmedizinischer Maßnahmen
5. Rechtliche Rahmenbedingungen
5.1. Gesetze und andere verbindliche Rechtsnormen
5.2. Rechtsprechung
5.3. Leitlinien und vorsorgliche Erklärungen
5.4. Synopse und aktuelle Entwicklungen
6. Sterbebegleitung auf Intensivstationen
6.1. Ist-Situation der Sterbebegleitung auf Intensivstationen
6.2. Bedürfnisse sterbender PatientInnen und ihrer Angehörigen
6.3. Bedürfnisse und Belastungsfaktoren begleitender Pflegekräfte
6.4. End-of-life Care Konzepte und Maßnahmen
7. Methodik
7.1. Fragestellung und Ziel der Untersuchung
7.2. Instrumente
7.3. Untersuchungsablauf
7.4. Studienpopulation
7.5. Statistische Auswertung
8. Ergebnisse
8.1. Deskriptiv
8.1.1. Stationscharakteristika
8.1.2. Soziodemografischer Hintergrund
8.1.3. Assoziationen
8.1.4. Erinnerte Situationen der Sterbebegleitung
8.1.5. Individuelle Unterstützungs- und Verarbeitungsfaktoren sowie Einstellungen
8.1.6. Wunschvorstellungen von Sterbebegleitung
8.1.7. Einschätzung des Ist-Zustandes
8.1.8. Gegenüberstellung Zufriedenheit und Unzufriedenheit mit der Sterbebegleitung
8.2. Analytisch
8.2.1. Hypothese I: Wenn Pflegkräfte genügend Zeit für die Sterbebegleitung haben, ist die Situation nicht so belastend.
8.2.2. Hypothese II: Je eindeutiger und umfangreicher die Information und Kommunikation zwischen ÄrztInnen, Pflegenden und PatientInnen und/oder deren Angehörigen ist, desto weniger belastend ist die Sterbebegleitung
8.2.3. Hypothese III: Wenn die Entscheidung über Therapie bzw. Therapieverzicht konsequent eingehalten wird und mit dem Patientenwillen übereinstimmt, ist Sterbebegleitung für die Pflegekräfte nicht so belastend
8.2.4. Hypothese IV: Wenn Pflegekräfte Ressourcen nutzen können, ist Sterbebegleitung für sie nicht so belastend
8.3. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse
9. Diskussion
10. Schlussfolgerungen und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Trost
Unsterblich duften die Linden -
was bangst Du nur?
Du wirst vergehn, und Deiner Füße Spur
wird bald kein Auge mehr im Staube finden.
Doch blau und leuchtend wird der Sommer stehn
und wird mit seinem süßen Atemwehn
gelind die arme Menschenbrust entbinden.
Wo kommst du her? Wie lang bist Du noch hier?
Was liegt an Dir?
Unsterblich duften die Linden -
Ina Seidel (1885-1974)
Vorwort
Die Idee zu dieser Studie entstand durch eigene Beobachtungen und Erfahrungen im Bereich Sterbebegleitung, die ich im Laufe meiner langjährigen pflegerischen Tätigkeit auf verschiedenen Intensivstationen gemacht habe. Der unterschiedliche Umgang mit sterbenden Schwerstkranken und ihren Angehörigen sowie die häufig erlebte Sprachlosigkeit führten zu intensiver Literaturrecherche, um mehr über diese Phänomene zu erfahren. Wegen der kaum vorhandenen deutschen Studien zu diesem Thema - im Unterschied zu vielfachen internationalen, hauptsächlich nordamerikanischen Veröffentlichungen - gedieh der Plan einer eigenen Erhebung.
Daher gilt mein Dank vor allem den Pflegekräften der Intensivstationen, die durch die Beantwortung meiner Fragen diese Studie überhaupt erst ermöglichten. Ich hoffe, dass die vorliegende Arbeit ihr geduldiges Warten auf Resultate belohnt. Auch den MitarbeiterInnen der Leitungsebenen der beiden Krankenhäuser sei für ihre starke Unterstützung gedankt.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich Prof. Dr. Petra Kolip für ihre zuverlässige Betreuung aussprechen und all denen, die den Fortgang der Arbeit durch Korrekturlesen oder auch nur durch aufmunternde Worte begleiteten.
Zusammenfassung
Sterbebegleitung auf Intensivstationen ist besonders schwierig, da hier ÄrztInnen und Pflegekräfte darauf spezialisiert sind Menschenleben zu retten und die Prognose häufig unklar ist. Deutsche Studien, die Belastung und Ressourcen von Intensivpflegekräften im Zusammenhang mit End-of-life Care (EOLC) untersuchen, sind bisher rar.
Die vorliegende Arbeit erforscht diese Beziehung und fragt nach den Wunschvorstellungen der Krankenschwestern und -pfleger bezüglich EOLC. Mit Hilfe von vier Hypothesen werden Einflüsse des Zeitbudgets der Pflegekräfte, der Information und Kommunikation zwischen allen Beteiligten, der Therapielinie und der Ressourcenmobilisierung auf die Belastung der Pflegekräfte überprüft.
Es handelt sich um eine schriftliche Befragung des Pflegepersonals (n=193) von fünf Intensivstationen zweier großer Krankenhäuser im Sommer 2001. 85 Fragebögen konnten ausgewertet werden (Rücklaufquote 44%).
Die Sterberate lag auf den internen Stationen deutlich höher als auf den chirurgischen und differierte zwischen 1,2% und 9,3%. Besonders belastend empfanden es die Befragten, wenn die Patienten sehr jung und sympathisch waren, der Tod unerwartet eintrat oder die Therapie unverständlich war. Eine schlechte Prognose wurde hingegen eher als entlastend empfunden. Der Umfang des Zeitbudgets und die Nutzung von Ressourcen beeinflussten den Belastungsgrad signifikant. Die Anwesenheit von Angehörigen sowie die Ablenkung mit angenehmen Dingen erwiesen sich hierbei als entlastend. Zwei Drittel der Befragten sahen auf ihrer Station keine optimalen Bedingungen zur Begleitung Sterbender, da geeignete Räumlichkeiten und Zeit fehlten.
Intensivpflegekräfte möchten ihren sterbenden PatientInnen und deren Angehörigen einen friedlichen und würdevollen Abschied ermöglichen. Viele Gegebenheiten im Umfeld erschweren dies. Angebote zur Unterstützung des Pflegepersonals würden gleichzeitig die EOLC-Qualität verbessern. Erste Schritte zur Entlastung könnten gezielte Fortbildungsangebote, das Einrichten eines Abschiedszimmers, ethische Fallbesprechungen gemeinsam mit ÄrztInnen sowie das Hinzuziehen von Ethik-Konsilen oder externen Hospizhelfern sein. Um dauerhaft ein mixed-management model mit einem Miteinander von Intensivmedizin, Palliative Care und Hospice Care zu implementieren, bedarf es der Akzeptanz des Todes auch auf Intensivstationen und des Umsteuerns auf der Krankenhausleitungsebene.
Abstract
Background: It is extremely difficult to provide terminal care in intensive care units since doctors and nurses specialize in saving human lives and prognoses are often ambiguous. So far, few German studies have researched the pressures on intensive care nurses, and the resources available to them, in relation to end-of-life care.
Objektive: This paper investigates both the above-mentioned relationship and the requests and needs nurses have with respect to EOLC.
Methods: This study is based on a written survey of the nursing staff (n=193) of five ICUs in two big hospitals which was carried out in the summer of 2001.
Results: 85 questionnaires were analyzed (44% response rate). The death rate was considerably higher on internal wards than on surgical wards and varied between 1.2 percent and 9.3 percent. According to the respondents, stress factors consist of young age of the patient, unexpected death, ambiguous therapy and empathy with the patient, while bad prognoses relieve the strain on the nursing staff. Both the available time budget and the specific resource utilization have a significant effect on stress levels. In this context, the presence of relatives and pleasant experiences which distract the patient are factors that relieve the stress felt by the nursing staff. Two-thirds of the respondents stated that their wards did not provide optimum conditions for supporting dying patients due to a lack of time and suitable premises.
Conclusions: Intensive care nurses would like to create conditions that allow dying patients and their relatives to take leave of each other in a peaceful and dignified manner. A range of supportive measures could relieve the nursing staff and simultaneously improve the EOLC quality. Specific training activities, the establishment of a hospice room, ethical case discussions involving the doctors and the mobilization of ethics committees or external hospice volunteers could represent initial steps towards relieving the strain felt by nurses. The implementation of a sustainable mixed-management model that integrates intensive care medicine, palliative care and hospice care requires the acceptance of death on intensive care units and a general reorientation at the hospital management level.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Sterbeorte der über 59jährigen in Rheinland-Pfalz (1995) nach Alter und Geschlecht (Ochsmann et al., 1997, S.19)
Abbildung 2: Ablauf Hirntoddiagnostik (Wissenschaftlicher Beirat der BÄK, 1998, S. A 1862)
Abbildung 3: Entscheidungsdiagramm für die Frage nach Beendigung/Nichteinleitung lebensverlängernder Maßnahmen. (Borasio, Putz & Eisenmenger, 2003, A 2063)
Abbildung 4: Palliative Care innerhalb der Erfahrung von Krankheit, Trauer und Risiko. Modifiziert nach Ferris in Truog et al., 2001, S. 2333)
Abbildung 5: Sterbefallcharakteristika der teilnehmenden Stationen
Abbildung 6: Ausrichtung der spontan geäußerten Assoziationen
Abbildung 7: meist genannte Assoziationen
Abbildung 8: Verarbeitungsarten belastender Sterbesituationen
Abbildung 9: Motive zur Arbeit auf einer Intensivstation
Abbildung 10 Häufigkeitsverteilungen der Oberkategorien für notwendige und besonders wichtige Bedingungen für optimale Sterbebegleitung
Abbildung 11: Häufigkeitsverteilungen der meist genannten Hauptkategorien für notwendige und besonders wichtige Bedingungen für optimale Sterbebegleitung
Abbildung 12: „Halten Sie auf Ihrer Station Ihre oben genannten Bedingungen für eine optimale Sterbebegleitung für erfüllt?“
Abbildung 13: Ursächliche Bereiche für die Einschätzung des Ist-Zustandes
Abbildung 14: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung bezogen auf den. Informationsfluss
Abbildung 15: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, bzgl. Therapie
Abbildung 16: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in der Situationen der Sterbebegleitung, signifikante Antworten bzgl. Sterbezeitpunkt
Abbildung 17: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, signifikante Antworten bzgl. Betreuungszeit
Abbildung 18: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, Frage: „Wie belastend war die Situation für Sie?“
Abbildung 19: Einzelzusammenhang Belastung / genügend Zeit für Sterbebegleitung
Abbildung 20: Einzelzusammenhang Belastung / Informationen /Aufklärung vom Arzt
Abbildung 21: Einzelzusammenhang Belastung / Therapieentscheidung
Abbildung 22: Einzelzusammenhang Belastung / personelle Unterstützung
Abbildung 23: Einzelzusammenhang Belastung / Unterstützung durch Supervision und Fortbildung
Abbildung 24: Einzelzusammenhang Belastung / Verarbeitungsart
Abbildung 25: Zusammenhang Belastung / Geschlecht, Arbeitsumfang
Abbildung 26: Zusammenhang Belastung / IPS-Erfahrung, Arbeitsumfang
Abbildung 27: Zusammenhang Belastung / Einfluss von privater Todeserfahrung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Sterbeorte in Rheinland-Pfalz (1995) nach Altersgruppen (Ochsmann et al., 1997, S. 15)
Tabelle 2: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, Antworten 1 bis 5 (Situation)
Tabelle 3: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, bzgl. der Frage: Was für Auswirkungen hatte das auf Ihre Pflege?
Tabelle 4: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, Gründe für das Ausmaß der Belastung, wichtigste Belastungsfaktoren.
Tabelle 5: Vergleich zufrieden vs. unzufrieden in den Situationen der Sterbebegleitung, Gründe für das Ausmaß der Belastung, Entlastungsfaktoren.
Tabelle 6: Gesamtzusammenhang Belastung / genügend Zeit für Sterbebegleitung
Tabelle 7: Gesamtzusammenhang Belastung / Unterstützung von außen
Tabelle 8: Einzelzusammenhang Belastung / Verarbeitungsart (introvertiert)
Tabelle 9: Zusammenhang Belastung / Begründung für Arbeit auf IPS
Tabelle 10: Gesamtzusammenhang Belastung innere Ressourcen
1. Einleitung
In Deutschland sterben zur Zeit pro Jahr ca. 800.000 Menschen. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird diese Zahl in Zukunft ansteigen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder, 2007). Trotz des Wunsches der meisten Menschen zu Hause zu sterben, verbringen etwa die Hälfte von ihnen ihre letzten Stunden, Tage oder Wochen in einem Krankenhaus (Ochsmann et al., 1997). Doch gerade in Krankenhäusern scheint die professionelle Betreuung Sterbender die größten Defizite aufzuweisen. Pflegekräfte fühlen sich unsicher im Umgang mit Sterbenden und deren Angehörigen und berichten über Kommunikationsprobleme (Kaluza & Töpferwein, 2005).
Intensivstationen gibt es in den meisten Krankenhäusern. Vieles unterscheidet sich hier von Normalstationen, und alles zielt darauf ab, Menschenleben zu retten. Trotzdem sind deutsche Intensivstationen für ca. 8% ihrer PatientInnen der Ort des endgültigen Abschieds vom Leben (Schuster, 1998). Auf europäischen Intensivstationen wächst die Anzahl der PatientInnen, die kaum Aussicht auf Heilung haben (Carlet et al., 2004).
Betreut werden diese Menschen von Pflegekräften, die vor allem geschult sind im Wiederbeleben, im Umgang mit Geräten und im schnellen Reagieren auf jegliche Art von Notfällen. Doch häufig wissen die Helfenden nicht, ob der/die betreffende PatientIn im Falle eines plötzlichen Herz-Kreislaufstillstandes reanimiert werden möchte (Principal Investigators, 1995, zitiert in Miller, Forbes & Boyle, 2001). Wann die Pflege eines/einer PatientIn zu einer Sterbebegleitung wird, lässt sich aufgrund unklarer Prognosen über Krankheitsverläufe in der Intensivmedizin vielfach erst im Nachhinein bestimmen (Carlet et al., 2004). Wird eine lebenserhaltende Therapie abrupt abgesetzt, kann der Tod sehr schnell eintreten. Stimmt also die Analyse des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin: "Nirgendwo ist durch die medizinischen Möglichkeiten, den Todeszeitpunkt zu manipulieren, Sterbebegleitung so schwierig wie in der Intensivmedizin." (Müller-Busch, 2001, S. 733)?
Wie sich unter diesen Rahmenbedingungen Sterbebegleitung auf Intensivstationen gestaltet und welche Wunschvorstellungen Pflegekräfte dazu äußern, ist die allgemeine Forschungsfrage dieser Arbeit. Ihr spezielles Interesse gilt dabei den Ressourcen und Belastungen von Pflegekräften. Zur genaueren Analyse werden vier Hypothesen aufgestellt, die den Einfluss von Zeitumfang, Informations- und Kommunikationsfluss, Kongruenz von Therapielinie und PatientInnenwille sowie Ressourcenmobilisierung auf die Belastung der Pflegekräfte während einer Sterbebegleitung prüfen.
Der Begriff „End-of-life Care“ (EOLC) wurde gewählt, um eine umfassende Betrachtung zu ermöglichen. Hierin enthalten ist die Vision eines Miteinanders von institutioneller intensivmedizinischer und palliativer sowie externer hospizlicher Betreuung in enger Zusammenarbeit mit PatientIn und Angehörigen. Im Vordergrund steht die Prämisse, die Würde und Selbstbestimmung der PatientInnen zu achten mit dem Ziel, die bestmögliche Lebensqualität zu gewährleisten und für die Befriedigung ihrer körperlichen, psychischen, sozialen und spirituellen Bedürfnisse zu sorgen.
Die vorliegende Magisterarbeit schildert die Ergebnisse einer im Sommer 2001 durchgeführten schriftlichen Befragung des Pflegepersonals von fünf Intensivstationen zweier großer Krankenhäuser und setzt sich umfassend mit „End-of-life Care“ auseinander.
Begonnen wird mit einem Blick auf die „Kultur des Sterbens“ (Kapitel 2). Dieser weite Blickwinkel verdeutlicht, dass der Umgang mit dem Sterben ein Produkt der Gesellschaft und der jeweiligen Zeitepoche ist. Es wird die Vermutung geäußert, dass wir uns am Beginn einer Ära der lebendigeren Sterbekultur befinden könnten (Heller, 1994).
Das 3. Kapitel thematisiert das Sterben in Institutionen. Zunächst werden statistische Daten zu Sterbeorten erläutert. Im Anschluss erfolgt eine kurze Darstellung der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, die Hospizdienste, Altenheime und Krankenhäuser zur Betreuung Sterbender aufweisen.
Kapitel 4 richtet den Focus auf die Intensivstation. Begonnen wird mit einem geschichtlichen Abriss, der zeigt, welchen rasanten Veränderungen die Intensivmedizin unterworfen ist. Zur besseren Vorstellung der besonderen Gegebenheiten auf Intensivstationen werden deren Struktur sowie der intensivmedizinische Behandlungsprozess, dessen Ziele und mögliche Ergebnisse erläutert.
Nachdem in Kapitel 4 schon angeklungen ist, dass z.B. bei Fragen des Therapieabbruchs oder der Organexplantation rechtliche Bestimmungen eine wichtige Rolle spielen, wird im Anschluss diesen Rahmenbedingungen ein ganzes Kapitel (5) gewidmet. Dies geschieht vor allem in dem Bewusstsein, dass es auf diesem Gebiet große Unsicherheiten, sowohl auf pflegerischer, als auch auf ärztlicher Seite gibt (Carlet et al., 2004). Der Stellenwert, den in dem Zusammenhang rechtliche Regelungen einnehmen, ist zu hoch, um diese in den Anhang zu verbannen. Neben wichtigen Gesetzestexten und Rechtsnormen wird hier deshalb auch auf die Rechtsprechung sowie auf Leitlinien und vorsorgliche Erklärungen eingegangen. Eine Synopse und ein Blick auf aktuelle Entwicklungen schließt diesen Teil ab.
Kapitel 6 bildet den theoretischen Kernbereich der vorliegenden Arbeit. Beginnend mit der Beschreibung der Ist-Situation der Sterbebegleitung auf Intensivstationen, folgt die Betrachtung der Bedürfnisse sterbender PatientInnen und ihrer Angehörigen. Danach stehen die Bedürfnisse und Belastungsfaktoren der begleitenden Pflegekräfte im Mittelpunkt des Interesses. Maßnahmen und Konzepte zur optimalen Versorgung Sterbender werden am Ende dieses Abschnitts vorgestellt.
In Kapitel 7 wird die Methodik dieser Untersuchung erläutert. Beschrieben werden dabei Fragestellung und Ziel, gewählte Instrumente, Untersuchungsablauf, Studienpopulation sowie die statistische Auswertung.
Kapitel 8 beinhaltet die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, die in einem deskriptiven und einem analytischen Teil getrennt dargestellt und anschließend zusammengefasst werden. Eine Gegenüberstellung dieser Ergebnisse mit denen anderer Studien erfolgt im 9. Kapitel. Die Erkenntnisse aus dem Vergleich werden diskutiert und interpretiert.
Den Abschluss bildet Kapitel 10. Hier werden die Schlussfolgerungen aus dieser Arbeit gezogen und versucht Perspektiven zur Verbesserung von „End-of-life Care“ aufzuzeigen.
2. Sterbekultur in Deutschland
Befinden wir uns zur Zeit in einer Umbruchphase der Sterbekultur in Deutschland? Neigt sich das vom französischen Historiker Philippe Ariès (1914 - 1986) beschriebene „Modell des ins Gegenteil verkehrten Todes“ seinem Ende zu? Einige Entwicklungen scheinen darauf hinzudeuten.
„Kultur“ wird im Wörterbuch der Soziologie definiert als „…die Gesamtheit der Lebensformen, Wertvorstellungen und der durch menschliche Aktivitäten geformten Lebensbedingungen einer Bevölkerung in einem historischen und regional abgrenzbaren (Zeit-)Raum… “ (Hillmann, 1994, S. 460). Von ihr leiten sich Normen, Rollen, Traditionen und Verhaltensmuster ab. Die „Sterbekultur“ beschreibt somit den Ausschnitt der Kultur, der den Rahmen für den Umgang einer Gesellschaft mit dem Thema Sterben bildet. In den USA benannte Robert Kastenbaum 1972 mit „death system“ …“Teile der Kultur, die mit Sterben, Tod und Trauern zu tun haben und mit der Art und Weise, in der wir unsere Sterblichkeit leben “ (Morgan, 2003, S. 15). Die Sterbekultur ist also ebenso wie die Kultur als Ganzes den jeweiligen historischen Strömungen unterworfen.
Der Geschichtsforscher unterschied im Laufe der Geschichte fünf Modelle, die jeweils für einen gewissen Zeitabschnitt typisch waren (Ariès, 1996):
1. der gezähmte Tod (frühe Geschichte bis ins Mittelalter)
2. der eigene Tod (etwa 12. – 15. Jahrhundert)
3. der lange und nahe Tod (etwa 16. – 18. Jahrhundert)
4. der Tod des Anderen (19. Jahrhundert)
5. der ins Gegenteil verkehrte Tod (ab dem 20. Jahrhundert)
Der Wandel lässt sich seiner Meinung nach an vier Parametern beobachten: dem Bewusstsein des Menschen von sich selbst, der Verteidigung der Gesellschaft gegen die wilde Natur, dem Glauben an ein Leben nach dem Tode und dem Glauben an die Existenz des Bösen.
Bis ins Mittelalter war der Tod etwas Vertrautes und Alltägliches, und das Sterben fand mitten in der Gemeinschaft statt. Die Sterbezeremonie, in der der Sterbende eine aktive Rolle einnahm, stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl. Da der Tod aber auch das Überleben der ganzen Sippe gefährden konnte, stellte er gleichzeitig eine Prüfung ihrer Stabilität dar und konnte zu einer Schwächung ihres Verteidigungssystems führen. Der eigentliche Tod wurde nicht als Lebensende aufgefasst, sondern zunächst nur als Eintritt in ein Übergangsreich, in dem die Verstorbenen in Ruhe auf das wirkliche Ende warteten. Obwohl der Tod etwas Vertrautes war, stellte er doch – vor allem, wenn er plötzlich kam und nicht genug Zeit bot, materielle und spirituelle Angelegenheiten zu regeln – ein Unglück dar.
Das zweite Modell unterscheidet sich vom vorherigen in den Bereichen „Bewusstsein des Menschen von sich selbst“ und „Glauben an ein Leben nach dem Tode“. Der Grund hierfür ist ein stark ausgeprägter Individualismus. Der einzelne Mensch konnte und wollte sein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Sein Körper durfte das Leben genießen oder/und Buße tun, während seine Seele nach dem Tod unsterblich wurde. Mit der Verfassung eines Testamentes bewirkte der Verstorbene einerseits ein positives Andenken an seine Person in der Welt, und andererseits meinte er so beim „Jüngsten Gericht“ seine Aussicht auf einen Platz im Himmel zu verbessern. Nach seinem Tod wurde der Leichnam umhüllt, so dass niemand mehr den Anblick eines Toten gewahr wurde. Kirchliche Zeremonien sorgten dafür, dass sich die Phase zwischen Todeszeitpunkt und Beerdigung verlängerte. Als sichtbares Zeichen seiner gewesenen Existenz verblieb nun meist ein Grabstein auf dem Friedhof oder in der Kirche (Ariès, 1996; Morgan, 2003).
Das Modell des langen und nahen Todes unterscheidet sich vor allem in der Abwehr der wilden Natur von den vorherigen Epochen. Erste Erfolge der Naturwissenschaften trugen das Ihrige dazu bei. Der Glaube an Gott (Reformation) und die Gefühle der Menschen befanden sich im Aufruhr, was sich auch in den Darstellungen des Todes abbildete. Er faszinierte und flößte gleichzeitig Angst ein, besonders die, lebendig begraben zu werden. Der Tod schien wieder wie einst unberechenbar zu sein.
Die stürmischen Entwicklungen des 19. Jahrhundert lassen sich auch an der Veränderung der Sterbekultur ablesen, die alle vier Parameter betrifft. Die aufgrund der besseren Hygienemaßnahmen und des medizinischen Fortschritts gestiegene Lebenserwartung schuf die Möglichkeit längerfristige Bindungen einzugehen und eine Privatsphäre aufzubauen. Es bildete sich die Kernfamilie. Im Modell „der Tod des anderen“ machte nicht mehr der eigene Tod Angst, sondern die Tatsache von einem geliebten Wesen Abschied nehmen zu müssen. Durch die Vorstellung die Lieben einst im Jenseits wieder zu sehen, bekam der Tod eine schöne Gestalt. Vor der Hölle fürchtete sich niemand mehr.
Für das 20. Jahrhundert trifft das Modell des ins Gegenteil verkehrten Todes zu. Es stellt eine Weiterentwicklung des Todes des Anderen dar, wenn auch die Auswirkungen teilweise ein sehr verändertes Bild erzeugen. Die in der Romantik zelebrierte letzte Kommunion mit Gott oder mit den Anderen wurde dadurch erschwert bzw. verhindert, dass dem Sterbenden zu dessen Schutz die gesundheitliche Prognose verheimlicht wurde. Gleichzeitig sorgte eine nun häufig stattfindende Einlieferung in ein Krankenhaus für eine „Beschmutzung“ und Entprivatisierung des Todes. Die Gemeinschaft trat vollkommen in den Hintergrund, die Medizin hatte die wilde Natur scheinbar im Griff und für die Organisation des kollektiven Lebens war nicht mehr die Gemeinschaft zuständig, sondern der Staat mit seinem Regelwerk. Statt traditioneller Gemeinschaft existiert nun eine Massengesellschaft, die …“von unwiderstehlichen Strömungen durchzogen [wird], die sie in einen permanenten Krisenzustand versetzen und zu sporadischen Aggressivitätsausbrüchen oder kollektiven Phobien treiben “(Ariès, 1996, S. 787). Ariès sieht dies neben der Bedeutung des Anderen als Ursache für die Negierung des Todes. Dem Sterbenden wurde nun weniger mit Mitleid gegenübergetreten als mit Scham und Ekel. Das Böse war nicht mehr von Natur her böse, es bildete sich als Folge einer Fehlleistung der Gesellschaft und konnte daher durch Überwachung und Sanktionen eliminiert werden. Die Todesangst blieb und der Tod gewann seine einst gezähmte Wildheit zurück.
Philippe Ariès verstarb 1986 und konnte somit nur die Anfänge der Hospizbewegung beobachten. Würde er in der stetigen Verbreitung des Hospizgedankens vielleicht den Beginn eines neuen Modells erkennen?
Andere Autoren (Vovelle, 1983 zitiert in Feldmann, 1997) betonen den Einfluss der demografischen Entwicklung auf den Umgang mit Sterben und Tod. Ein genauerer Blick darauf hilft uns, die bis ins Ende des letzten Jahrhunderts wachsende Ausblendung des Todes in unserer Gesellschaft besser zu verstehen. Im Mittelalter waren die Menschen den Infektionskrankheiten vollkommen hilflos ausgeliefert. So starb allein an der Pest im 14. Jahrhundert ca. ein Drittel der Bevölkerung Europas (Tuchmann, 1984 zitiert in Morgan, 2003). Einer gewissen demografischen Beruhigung im 16. Jahrhundert folgten erneute massive Einschnitte durch anhaltende Kriege und eine Rückkehr der Pest. Eine Erholungsphase im 18. Jahrhundert wurde abgelöst durch neue Seuchenausbrüche (Cholera, Typhus), die durch die Urbanisierung begünstigt wurden. Gleichzeitig wurden nun aber Mittel entwickelt und angewandt, die Krankheit und Schmerz lindern konnten. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg erheblich, was vor allem auf die Eindämmung der Säuglings- und Kindersterblichkeit zurückzuführen ist (Feldmann, 1997). Dadurch dass nun zunehmend ein höheres Alter erreicht wird, wächst die Zahl der damit assoziierten chronisch-degenerativen Erkrankungen kontinuierlich. Diese sind häufig mit einem langen Leidensweg verbunden, so dass der Tod nicht plötzlich eintritt, sondern das Sterben einen langsamen Prozess darstellt (Heller, 1994). Klaus Feldmann spricht in diesem Zusammenhang von „reduzierten Individuen“, die ihr eigenes „Hoch-Selbst“ überleben können und stellt die These auf: „Die moderne Identität wird durch ein lebenslanges psychisches und soziales (Partial)-Sterben geprägt …“ (Feldmann, 1997, S. 46).
Wie gehen wir nun Anfang des 21. Jahrhunderts mit Sterben und Tod um? Wir wissen mehr über die biologischen Vorgänge am Lebensende als alle Generationen vor uns. Forscher befragten Studenten zum Thema Tod und stellten fest, dass diese häufiger an den Tod denken, als ihre Großeltern dies taten (Lester & Becker, 1992-93 zitiert in Morgan, 2003). Wird der Tod noch – wie von Ariès beschrieben - im psychologischen Sinn verneint? Spiegelt sich in der Verneinung des Todes vielleicht überdies eine Reaktion auf zwei Weltkriege und die verheerenden Geschehnisse des Holocaust wieder, in denen der Tod vehement in den Alltag der Menschen zurückgekehrt war? Die Einen wollten sich ihrer folgenreichen Taten nicht erinnern; die Anderen mussten vergessen, um das ihnen und ihren Familien widerfahrene Leid zu überwinden, um weiterleben zu können. Die Täter und Opfer, die diese Zeit überlebt haben, sind nun größtenteils am Ende ihrer statistischen Lebenserwartung angelangt. Die jetzt lebenden Generationen sind vorwiegend nicht mehr direkt von diesen grausamen Ereignissen betroffen. Daher ist der Weg möglicherweise offen für eine untraumatische Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben.
Einen ersten großen Schritt zur Thematisierung des Sterbens machten Barney G. Glaser und Anselm L. Strauss, indem sie das Verhalten von Menschen untersuchten, die an Sterbesituationen im Krankenhaus beteiligt sind. Die Ergebnisse erschienen 1965 unter dem Titel „Awareness of Dying“ und wurden 1974 als „Interaktion mit Sterbenden“ ins Deutsche übersetzt. Eine noch größere Popularität, vor allem auch im nichtwissenschaftlichen Bereich, erlangte die in den USA vor kurzem verstorbene Schweizer Ärztin Elisabeth Kübler-Ross, die Gespräche mit Sterbenden führte und ihr daraus resultierendes Sterbephasenmodell 1969 veröffentlichte. Ihr Buch "On Death and Dying" wurde bereits 1971 ins Deutsche ("Interviews mit Sterbenden") übersetzt. Beide Bücher gelten noch heute als Grundlage der Sterbeforschung und ihre Theorien sind inzwischen von einigen Wissenschaftlern weiterentwickelt worden.
In den letzten Jahren erscheinen immer mehr Publikationen, die sich mit dem Thema Sterben und Tod auseinandersetzen. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft (Anthropologie, Ethik, Ethnologie, Geschichte, Jura, Medizin, Pflege, Psychologie, Soziologie, Thanatologie, Theologie) oder sind Erfahrungsberichte (Nahtoderlebnisse, Betreuungsschilderungen). Ebenso spiegelt sich in anderen Medien ein steigender Bedarf an Auseinandersetzung mit dieser Materie ab. In der öffentlichen Diskussion steht vor allem die Sterbehilfe in all ihren Nuancen im Vordergrund. Die Hospizbewegung als klarer Gegner einer aktiven Sterbehilfe wächst beständig und verfügt inzwischen in Deutschland über 1.103 ambulante und 158 stationäre Einrichtungen, die von 156 Palliativstationen ergänzt werden (Deutsche Hospiz Stiftung, 2008). Veränderungen sind auch im Bestattungswesen zu beobachten. Hier zeigt sich ein Trend weg vom Familiengrab hin zur anonymen Bestattung. Andreas Heller vermutet aufgrund dieser teils widersprüchlicher Realitäten, dass wir „… in den modernen, ausdifferenzierten Gesellschaften an einem Übergang von einem erstarrten Sterbekult zu einer lebendigeren Sterbekultur… “ stehen (Heller, 1994).
3. Sterben in Institutionen
Über 90% der Menschen möchten gern ihre letzten Lebenstage in ihrer eigenen Wohnung verbringen (Schmitz-Scherzer, 1997 zitiert in Deutscher Bundestag, 2002). Andererseits beanspruchen sie medizinische Hilfe, so lange dies Erfolg verspricht. Die Grenzen zwischen Erfolg und Misserfolg einer Therapie sind fließend. Die Genesungschancen bei einer schweren Erkrankung, die ein Laie kaum abschätzen kann, lassen sich sogar durch professionelle Helfer nicht mit absoluter Gewissheit prognostizieren.
Es gibt in Deutschland kaum Daten über die Orte des Sterbens, da diese nur auf den Leichenschauscheinen angegeben werden und nicht in die Sterbefallzählkartenstatistik der Statistischen Landesämter eingehen. Der Anteil der im Krankenhaus verstorbenen PatientInnen kann aus den Meldungen der Krankenhäuser errechnet werden, die Verteilung auf andere Sterbeorte (Zuhause, Altenheim, Hospiz, anderes) bleibt unbekannt. Die wenigen Untersuchungen, die es gibt, weisen darauf hin, dass in anderen Ländern Menschen häufiger in Institutionen sterben als in Deutschland (Ochsmann et al., 1997). Bis 1975 stieg der Anteil der im Krankenhaus verstorbenen in den meisten Ländern an und die Unterschiede zwischen den Ländern wurden kleiner. In der BRD kletterte die Zahl von ca. 43% 1960 auf ca. 54% 1975, während sie sich in der DDR in diesem Zeitraum konstant um ca. 41% hielt. In der Periode von 1975 bis 1990 verlangsamte sich in vielen Staaten der Anstieg bzw. wurde sogar rückläufig. So sank in der BRD der Anteil im Krankenhaus verstorbener von ca. 54% auf ca. 51%, wohingegen er in der DDR von ca. 41% auf 48% stieg (Blumenthal-Barby, 2001). Das Statistische Bundesamt gab an, dass im Jahr 1999 in der Bundesrepublik 860.000 Menschen starben, davon 52% in Krankenhäusern, 14% in Alten- und Pflegeheimen und 29% in einer Privatwohnung, wobei die letzten beiden Zahlen auf Schätzungen beruhen (Deutscher Bundestag, 2002). Eine Emnid-Umfrage im Auftrag der Deutschen Hospiz Stiftung ermittelte im Jahr 2003 einen Anteil von 2,1% der Verstorbenen, die durch Palliative Care und ca. 4,3%, die hospizlich begleitet wurden (Deutsche Hospizstiftung, 2003).
Randolph Ochsmann et al. haben 1995 in Rheinland-Pfalz Sterbedaten vom Statistischen Landesamt mit den Sterbeorten der Leichenschauscheine verknüpft und kamen so zu den für Deutschland bislang einzigen konkreten und teilweise überraschenden Ergebnissen der Sterbeortforschung (Ochsmann et al., 1997). Lediglich 44,1% der Menschen in den ausgewählten Regionen verstarben im Krankenhaus, 12,8% im Altenheim, 37,3% in der eigenen Wohnung, 2,5% in einer anderen Wohnung und 1,7% an sonstigen Orten. Keine Angaben über den Ort gab es für 1,7% der Sterbefälle.
Da der von Ochsmann et al. für 1995 ermittelte Anteil an Todesfällen in Krankenhäusern gut mit den Daten des Statistischen Landesamtes übereinstimmt (44,1% vs. 44,5%), kann die Verteilung der Sterbeorte als repräsentativ für Rheinland-Pfalz betrachtet werden. Für das gesamte Bundesgebiet errechnete das Statistische Bundesamt damals allerdings einen Anteil von 48%.
Die Altersgruppenanalyse von Ochsmann et al. zeigt, dass das Krankenhaus der Hauptsterbeort für Säuglinge (76,6%) ist. Auch für die Altersklassen von 1 bis 59, 60 bis 69 und 70 bis 79 gilt dies, allerdings bei einem relativ konstanten Anteil zwischen 50,0% und 52,9%. Die Hochbetagten hingegen verbringen ihre letzen Lebenstage eher in einer Privatwohnung als im Krankenhaus oder einer Einrichtung der Altenhilfe. Für die Über-90-jährigen tritt das Krankenhaus als Sterbeort mit einem Anteil von 25% ziemlich in den Hintergrund.
Tabelle 1: Sterbeorte in Rheinland-Pfalz (1995) nach Altersgruppen (Ochsmann et al., 1997, S. 15)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auch das Geschlecht wirkt sich auf die Lokalisation des Sterbens aus. Männer ab 60 Jahren sterben in allen Altersgruppen häufiger im Krankenhaus und in der Privatwohnung als Frauen, während letztere eher im Altenheim verscheiden als ihre Altersgenossen. Da Frauen ein niedrigeres Heiratsalter und eine höhere Lebenserwartung haben als Männer, können letztere eher damit rechnen am Lebensende zu Hause von ihren Partnerinnen versorgt zu werden.
Neben den demografischen Faktoren gibt es auch soziostrukturelle Einflüsse auf den Sterbeort. Sterben in Institutionen tritt vor allem dort gehäuft auf, wo es eine erhebliche Dichte an Krankenhausbetten gibt. Auch eine hohe Konzentration von frei praktizierenden Ärzten führt zu diesem Ergebnis. In Gebieten mit einer hohen Dichte an Sozialstationen lässt sich kein signifikanter Anstieg des Anteils der Sterbefälle in Privatwohnungen feststellen, wohingegen sich bei einem starken Angebot von Altenheimplätzen erwartungsgemäß der Anteil der dort Versterbenden erhöht. Außerdem sterben im dichter besiedelten Gebieten mehr Menschen im Altenheim als im Krankenhaus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Sterbeorte der über 59jährigen in Rheinland-Pfalz (1995) nach Alter und Geschlecht (Ochsmann et al., 1997, S.19).
Nicht zu vernachlässigen sind natürlich die politisch-rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. So konnten z.B. die Auswirkungen, die die Einführung der Pflegeversicherung mit sich brachten, bei der Untersuchung von Ochsmann et al. noch nicht berücksichtigt werden. Ebenso ist anzunehmen, dass Änderungen in der Aufteilung der Leistungsvergütung der Pflegeversicherung Effekte bei der „Wahl“ des Sterbeortes zur Folge haben.
Für die bereits von Philippe Ariès beschriebene Entprivatisierung des Sterbens führt Franco Rest weitere Gründe an. Er sieht im Trend zur Institutionalisierung des Sterbens die Auswirkung folgender Fakten: Kleinfamilie, Arbeitsteilung, Spezialisierung, Ausgliederung des Schwachen, Verdrängung des Todes, Verstädterung, Profitinteressen, Naturbeherrschung, Erlebnisarmut, Ersetzbarkeit des Menschen, technische Entwicklungen und Alterstrennung (Rest, 1998). Weingarten vertritt die These, „… daß die Verlagerung des Sterbeprozesses in die Institution Krankenhaus zu einer Anonymisierung des Erlebnisses des Todes und zu einer institutionell und damit bürokratisch geformten, technischen Lösung des Sterbeprozesses geführt hat, der unverträglich mit dem zu sein scheint, was man meint, wenn man von der Würde des menschlichen Todes spricht.“ (Weingarten, 1984, S. 352).
Der „Sterbebegleitung“ als explizite Aufgabe von Institutionen widmen sich in der Regel bisher weder Krankenhäuser noch Altenheime in geeigneter und expliziter Weise. Lediglich in Hospizdiensten (ambulant und stationär) und auf Palliativstationen ist dies selbstverständlich, um die Persönlichkeit und Identität eines Menschen in der Endphase seines Lebens aufrechtzuerhalten.
End-of-life Care [1] ist der heute häufig verwendete Überbegriff für die Bereiche des außerhalb des Gesundheitssystems entstandenen bürgerlichen Reformprojektes Hospice Care und für das professionelle Interventionsmodell Palliative Care (Ewers, 2003). Laut einer Emnid-Umfrage wissen 95% der Deutschen nicht, was Palliative Care ist und können von daher auch kein (späteres) Bedürfnis nach dieser Versorgungsform ausdrücken. Nach Informationserhalt votieren für die Bereitstellung von Palliative Care 39% grundsätzlich für jeden Sterbenden, 38% nur für Sterbende, die es explizit einfordern und 11% nur für Sterbende in bestimmten Einrichtungen (Deutsche Hospizstiftung, 2003).
Leider gibt es bisher in Deutschland keine ausreichende Versorgung (sowohl quantitativ als auch qualitativ) auf diesem Gebiet. Allerdings steigt die Anzahl der Dienste und Weiterbildungsmöglichkeiten in Palliativmedizin und Palliativpflege beständig. Die Zahl der Planbetten pro eine Million Einwohner differiert regional extrem. Sie lag vor einigen Jahren zwischen 4,0 und 23,5, im Mittel standen 12 Betten zur Verfügung (Deutscher Bundestag, 2002).
Die multiprofessionellen und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen arbeiten eng interdisziplinär zusammen, um Menschen in ihrer letzten Lebensphase vor sozialer Ausgrenzung und sozialer Entmündigung zu schützen und ihre Schmerzen zu lindern. Ihr Engagement gilt nicht, wie im Krankenhaus, dem Kampf gegen den Tod, sondern der Sicherung der Lebensqualität derjenigen Menschen, die auf ihrem letzten Weg sind und deren Angehörigen.
Im Altenheim sterben, wie bereits erläutert, vor allem hochbetagte Frauen. Nach dem Thema „Sterbebegleitung“ wird man in der Regel vergeblich in den Werbebroschüren suchen. Hier steht der Auftrag „aktivierende Pflege“ im Vordergrund (Rest, 1998). Doch die BewohnerInnen denken häufiger an ihren Tod und haben häufiger Angst vor ihm als alte Menschen, die in eigenen Wohnungen oder bei Familien leben (Myska & Parswark, 1978, zitiert in Feldmann, 1997).
Gegenüber dem Krankenhaus bietet die Institution Altenheim den Vorteil, dass meist umfangreiche bis durchgängige Besuchszeiten gelten und die Angehörigen sich so nicht erst ihr Zutrittsrecht gegen Ärzte und/oder Pflegekräfte erstreiten müssen, um in den letzten Stunden bei ihrer Mutter, Oma etc. sein zu können. Dies entlastet auch das Pflegepersonal. Um eine gewisse Kontrolle über das Sterben im Heim zu erlangen, werden von den MitarbeiterInnen diejenigen BewohnerInnen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Tod am nächsten stehen, implizit als SterbekandidatInnen identifiziert. Wenn diese BewohnerInnen dann tatsächlich schnell versterben, führt das jedoch häufig zu Scham- und Schuldgefühlen beim Pflegepersonal (Salis Gross, 2003). Trotzdem kommt es nicht selten vor, dass moribunde AltenheimbewohnerInnen doch noch mittels Notarzt, teils unter Reanimationsbedingungen, ins Krankenhaus gelangen. Dies mag in manchen Fällen ein Zeichen dafür sein, dass die Pflegekräfte mit der Verantwortung überfordert sind und zu viele Unsicherheiten herrschen. Die Bewohner selbst wissen, dass sie mit dem Einzug in ein Seniorenheim in der letzten Phase ihres Lebens angelangt sind.
Im Vergleich der Institutionen ist das Krankenhaus der Ort, wo der Tod am häufigsten vorkommt und gleichzeitig weitestgehend ausgeblendet wird . Hier „… wird Herrschaft und Kontrolle ausgeübt, indem Leben (auf Zeit) gerettet wird und der Übergang nach bestimmten Regeln stattfindet. Die Kontrolle der Sterbephase liegt primär in Händen von Professionellen (Medizinern) “ (Feldmann, 1997, S. 67). Aus dem Kampf um die Gesundheit wird so häufig ein Kampf gegen den Tod, in dem mit buchstäblicher Todesverachtung alles technisch Mögliche eingesetzt wird, um den Sieg davonzutragen (Weingarten, 1984). Die sterbende Person im Krankenhaus selbst gerät dabei teilweise aus dem Blickfeld. Ihre Rolle ist nun noch mehr von Abhängigkeit und Kontrollverlust geprägt als die einer/s nicht kritisch kranken PatientIn.
Da wundert es nicht, dass 60% der Ärzte und 73% der Pflegekräfte einer Befragung das eigene Krankenhaus für sich als Sterbeort ablehnten, weil dort die Vorraussetzungen für ein würdevolles Sterben fehlten. Die Beschäftigten fügten in dieser Beziehung dem Krankenhaus folgende Attribute zu: Zeitmangel des Personals, fehlende Privatsphäre, ungenügende Räumlichkeiten, unzureichende Qualifikation der Mitarbeiter, fehlende menschliche Zuwendung, mangelnde Schmerztherapie und zu viele lebensverlängernde Maßnahmen (Kaluza & Töpferwein, 2005)
Sterben und Sterbebegleitung in Institutionen ist also abhängig von den gegebenen organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen. Nur wenn diese Rahmenbedingungen eine im Sinne des sterbenden Menschen würdevolle Begleitung ermöglichen, wird der persönliche Einsatz der MitarbeiterInnen - und hier in erster Linie der der Pflegekräfte – zur allseitigen Zufriedenheit gelingen (Heller, 1994).
4. Spezialbereich Intensivstation
Intensivstationen bilden Sondereinheiten innerhalb von Krankenhäusern, denn sie unterscheiden sich erheblich von Normalstationen. Es sind separate Betteneinheiten, in denen personelle, apparative, materielle und medikamentöse Ressourcen vorgehalten und „… zur Überwachung, Wiederherstellung und Aufrechterhaltung gefährdeter oder gestörter Vitalfunktionen bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten …“ eingesetzt werden (Lawin, 2002a, S. 1). Um einen Einblick zu geben, vor welchem Hintergrund man sich Sterbebegleitung auf Intensivstationen vorstellen muss, wird im Folgenden kurz dargestellt, wo die Ursprünge von Intensivstationen liegen, wie ihr Aufbau ist und wie der intensivmedizinische Behandlungsprozess und seine Ziele und Ergebnisse aussehen.
4.1. Geschichtliche Entwicklung
Historisch betrachtet lassen sich zwei Strömungen der Entstehung intensivmedizinischer Spezialeinheiten erkennen. Die eine entstand aus der Sorge um das Wohlergehen von Frischoperierten und sah hier Handlungsbedarf, um deren Überlebenschancen zu verbessern. Diesen Ansatz vertrat schon sehr früh Florence Nightingale, die aufgrund ihrer Erfahrungen aus dem Krim-Krieg 1853-56 vorschlug, spezielle Räume für Operierte für die Zeit direkt im Anschluss an eine Operation zu schaffen. Doch diese Idee wurde erst viel später nach Fortschritten in der Narkosetechnik umgesetzt, die längere Operationszeiten ermöglichten. Zunächst implementierten die Chirurgen Kirschner und Sauerbruch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts Wachstationen für Frischoperierte nach großen Eingriffen an ihren Kliniken (Lawin, 2002a). Die zweite Initiative ging von Internisten aus. 1947 breitete sich eine Poliomyelitis [2] -Epidemie – aus den USA kommend – auch in Deutschland aus. Die daran erkrankten PatientInnen erleiden häufig eine Atemlähmung, die ohne Beatmung zum Tode führt. Der Hamburger Internist Aschenbrenner ließ in einer Werft die erste Eiserne Lunge Deutschlands bauen und konnte mit dieser Innovation das Leben von 59% seiner atemgelähmten PoliomyelitispatientInnen retten. Das Westend-Krankenhaus der Freien Universität Berlin errichtete 1957 nach einem Umbau ein Reanimationszentrum - die erste Intensivtherapiestation in Deutschland (Schuster, 2002). In der Folgezeit beschleunigte sich die Entwicklung in der Anästhesie und Intensivmedizin sowie in der Medizintechnik, und immer mehr Krankenhäuser richteten Intensivstationen ein. 1994 ergab eine Umfrage, dass von den damals existierenden 993 Krankenhäusern in Deutschland 915 über eine Intensivstation verfügten.
4.2. Strukturelle Gegebenheiten
Im Jahr 2000 gehörten 22516 von 559651 bereitgestellten Krankenhausbetten in Deutschland zu Einrichtungen der Intensivmedizin. Dieser Anteil von gut 4% verteilt sich zu ca. je einem Drittel auf konservative, operative und interdisziplinäre Gebiete (Statistisches Bundesamt, 2002). Das Spektrum von Intensivstationen in Deutschland ist jedoch vielfältiger, als es nach der Statistik scheinen mag. Je nach Größe, Struktur, Schwerpunkt, Philosophie und Chefarztinteressen eines Krankenhauses unterscheidet sich die Organisationsform von Intensivbetten. So reicht die Palette von kleineren Krankenhäusern mit einer interdisziplinären Intensivstation mit weniger als zehn Betten über größere Häuser mit mehreren fachspezifischen Intensivstationen zu großen Kliniken mit einem umfangreichen multidisziplinären Intensivzentrum. Neben den fachspezifischen (z.B. kardiologischen [3], pädiatrischen [4] , traumatologischen [5] ) Intensivstationen gibt es solche, die sich auf besondere Behandlungstechniken spezialisiert haben, wie z.B. Verbrennungszentren und Transplantationseinheiten. Da die fachspezifische Trennung den Versorgungsbedürfnissen einer wachsenden Zahl multimorbider Patienten eher widerspricht, kommt es häufig zu Mischformen (Steinbereithner & Bergmann, 1984).
Die heute auf Intensivstationen praktizierte Intensivmedizin bietet multiple Möglichkeiten der Intensivüberwachung, -therapie und –pflege, die am Anfang der oben beschriebenen Entwicklung unvorstellbar waren. Mit dem Monitoring können Vitalparameter wie Herzschlag, Blutdruck, Atmung, Temperatur, Hirnströme, Herzzeitvolumen gemessen und kontinuierlich überwacht werden. Herzschrittmacher und Defibrillatoren [6] ermöglichen es, eine Störung oder den Ausfall des herzeigenen Reizleitungssystems so zu regulieren, dass es bei rechtzeitiger Anwendung zu keinem Herzstillstand kommen kann. Außerdem können spezielle Medikamente zur Verhinderung eines Herz-Kreislaufversagens eingesetzt werden und solche, die einen akuten Gefäßverschluss öffnen. Die Verbesserung notfallmedizinischer Maßnahmen und intensivmedizinischer Versorgung führten z.B. dazu, dass die Herzinfarktsterblichkeit erheblich gesenkt werden konnte. Ein weiterer wichtiger Erfolg der Intensivmedizin wurde unter anderem durch die Verfeinerung der Beatmungstechnik erreicht. So ist es durch die Wahl von Beatmungsgerät und –form heute möglich, alle PatientInnen vom Frühgeborenen unter 1000 g mit Atemnotsyndrom bis zum langjährigen Raucher mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung relativ atraumatisch zu beatmen (Lawin, 1989). Alle lebenswichtigen Nährstoffe erhalten in der Regel, die nicht ess- und trinkfähigen adulten [7] und pädiatrischen IntensivpatientInnen entweder parenteral über zentralvenöse Katheter oder mittels einer Sonde in den Magen appliziert. Immer mehr Organfunktionen können bei deren krankheitsbedingtem Ausfall - meist durch den Einsatz von Medizintechnik - ersetzt werden.
Auch räumlich unterscheiden sich Intensivstationen aufgrund ihrer Aufgaben von Normalstationen. Die medizinischen Geräte benötigen Platz und Anschlüsse für Strom, Sauerstoff, Druckluft und Vakuum. Meist sind diese in Versorgungsleisten in der Wand hinter den Kopfenden der Bettplätze angebracht. Für die bettlägerigen PatientInnen sind sie und die meisten angeschlossenen Geräte so zunächst nicht sichtbar. Allerdings geben sie teilweise Geräusche in Form von unterschiedlichen Alarmen von sich. Großflächige Fenster in Wänden und Türen erlauben den Durchblick, damit das Personal PatientInnen und Geräte auch im Blick hat, wenn es sich außerhalb des Zimmers aufhält. Nicht überall lassen sich diese Fenster mit Jalousien verschließen. Für die Privatsphäre der Kranken gibt es nur wenig Raum in und auf dem Nachttisch.
Nicht nur im Interieur heben sich Intensivstationen von „Normalstationen“ ab. Die besonderen Aufgaben einer Intensivstation verlangen einen speziellen Personaleinsatz. In der Regel ist zu jeder Zeit mindestens einE Arzt/Ärztin anwesend. Da der Pflegeaufwand gegenüber Normalstationen erheblich höher liegt, arbeitet hier mehr Pflegepersonal. So ist eine Pflegekraft nur für wenige (je nach Schwere der Erkrankung, Pflegeaufwand, Besetzung: 1 – 6) PatientInnen zuständig, die sie umfassend betreut. Auch die Qualifikation der Teammitglieder ist hoch, es sind überwiegend erfahrene (Fach)ärzte und in der Intensivmedizin weitergebildete Krankenschwestern und –pfleger. Da aufgrund der Bettlägerigkeit und Transportinstabilität der PatientInnen viele diagnostische (z.B. Röntgen) und therapeutische (z.B. Dialyse) Maßnahmen auf der Intensivstation durchgeführt werden, erfolgt hier zusätzlich der kurzfristige Arbeitseinsatz von MitarbeiterInnen anderer Krankenhausbereiche. Für einen reibungslosen Ablauf ist eine gute Kommunikation und Kooperation zwischen allen Beteiligten unerlässlich. Linus Geisler, ein ehemaliger Sachverständiger der Enquête-Kommission "Ethik und Recht der modernen Medizin“ stellt fest: „Die Intensivstation ist der medizinische Bereich mit dem höchsten Bedarf an Kommunikation und zugleich der Ort, der jeder Art Kommunikation die größten Hindernisse entgegenstellt“ (Geisler, 1992).
4.3. Intensivmedizinischer Behandlungsprozess
PatientInnen werden auf Intensivstationen aufgenommen, weil sie entweder aufgrund eines akuten Ereignisses (z.B. Herzinfarkt, schwerer Unfall) oder wegen einer Exazerbation [8] einer chronischen Erkrankung (z.B. schwere Atemnot bei chronischen Lungenerkrankungen) intensivmedizinisch versorgt werden müssen (Miller, Forbes & Boyle, 2001).
Nur für diejenigen Patienten, die nach einer geplanten großen Operation (wie z.B. in der Herzchirurgie) auf einer Intensivstation aufwachen, ist die Situation, in der sie sich wiederfinden, nicht überraschend. Mit ihnen konnte vor der Operation ohne Zeitdruck detailliert gesprochen werden. Zu beachten ist dabei, dass die Erwartungen des/der PatientIn bezüglich seiner/ihrer angestrebten Lebensqualität mit der medizinischen Prognose abgeglichen wurde. Nach erfolgter Aufklärung wissen die OP-KandidatInnen, welche Apparate und Schläuche zu ihrer postoperativen Versorgung auf der Intensivstation dazugehören.
NotfallpatientInnen sind zunächst einmal konfrontiert mit einer unbekannten, technisch hochgerüsteten Umgebung mit vielen geschäftigen Menschen in meist blauer, grüner oder weißer Arbeitskleidung. Für PatientInnen bedeutet dies anfangs vor allem Sicherheit, das Gefühl „es wird etwas für mich getan“, das aber eng verbunden ist mit der Angst vorm Ausgeliefertsein (Geisler, 1992). Häufig sind sie nicht in der Lage sich zu äußern, entweder weil sie vom Notarzt intubiert [9] werden mussten oder weil sie es aufgrund von Bewusstseins- und/oder Sprachstörungen (z.B. bei Apoplex [10] ) nicht können. Auch die Auffassungsgabe dieser Personen kann gestört sein. Meist müssen aber schnell Maßnahmen ergriffen werden, um den Zustand der PatientInnen zu stabilisieren. Ein ausführliches Aufklärungsgespräch ist in einem Notfall selten möglich. Im Falle einer Bewusstlosigkeit ist der Arzt sogar gezwungen, in seiner Garantenstellung als „Geschäftsführer ohne Auftrag“ im Sinne des Patienten zu entscheiden (Lasch, 1997). Vor allem wenn er den/die PatientIn nicht kennt (was die Regel darstellt), ist diese Entscheidung sehr schwierig und in ihrer Tragweite enorm. Man stelle sich zum Beispiel einen jungen Patienten vor, der vom Notarzt mit Halbseitenlähmung und Sprachstörung eingeliefert wird, dessen Bewusstseinszustand sich rapid verschlechtert, so dass er beatmet werden muss. Das Computertomogramm des Schädels stellt einen Verschluss einer Hirnarterie dar. Es gibt die Möglichkeit diesen Embolus mittels Lyse [11] aufzulösen. Dies muss aber innerhalb der ersten Stunden passieren, sonst wirkt es nicht. Eine Garantie, dass sich dadurch der Embolus auflöst und die Symptomatik vollkommen verschwindet, gibt es jedoch nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass es zu gefährlichen Blutungen kommt. Dies ist eine Risikenabwägung, wie sie häufig in Notfallsituationen von ÄrztInnen gemacht werden muss. Das Vorhandensein einer Patientenverfügung und die Informationen von nahen Angehörigen sind in solchen Fällen hilfreich, wenn der Wille des Patienten direkt nicht zu ermitteln ist.
PatientInnen, die unter laufenden Reanimationsmaßnahmen vom Notarztteam auf eine Intensivstation gefahren werden, versterben häufig schon kurz nach dem Eintreffen. Aber auch wenn die Reanimationsmaßnahmen schließlich dazu führen, dass das Herz des/der PatientIn wieder zu schlagen beginnt, ist die Situation weiterhin höchst kritisch, denn 65% versterben innerhalb der ersten Wochen nach dem Ereignis (Schuster, 1998). Ob und inwieweit das Gehirn des/der PatientIn durch mangelnde Versorgung geschädigt worden ist, stellt sich erst Tage bis Wochen später heraus. Dies frühzeitig richtig einzuschätzen gestaltet sich schwierig, da meist nicht genau bekannt ist, wie lange ein Kreislaufstillstand bis zum Einsetzen einer suffizienten Reanimation bestanden hat. Außerdem werden diese PatientInnen in der Regel zunächst analgosediert [12], damit sie nicht durch die intensivtherapeutischen Maßnahmen gestresst werden, was eine Beurteilung des Bewusstseinszustandes erschwert.
In den ersten zwei bis drei Tagen, die einE PatientIn auf einer Intensivstation verbringt, zeichnet sich meistens ab, ob sich der Gesundheitszustand stabilisiert. Zeigen sich die Vitalparameter weiter als höchst labil, ist mit einer schnellen Besserung größtenteils nicht zu rechnen. Die maximale Therapie wird mit unsicherem Ergebnis fortgesetzt (Nelson-Marten, Braaten & English, 2001). Dies bedeutet für den/die PatientIn, dass er/sie immer abhängiger von den eingesetzten Mitteln wird, die die Funktionen der Organe mehr und mehr unterstützen oder ersetzen. So wird z.B. aufgrund von Kreislaufinstabilität die Zufuhr von Katecholaminen [13] erhöht - wegen respiratorischer [14] Probleme muss die Beatmung unter höherer Sedierung und evtl. Relaxierung [15] und evtl. Bauchlagerung des PatientIn forciert werden – weil akutes Nierenversagen eingetreten ist, sorgt die Dialyse für die Entfernung harnpflichtiger Substanzen – septische Temperaturen werden mit Medikamenten gesenkt, die starkes Schwitzen auslösen und teilweise zu Kreislaufdepressionen führen.
Zeichnet sich auch im weiteren Verlauf kein Erfolg der intensivmedizinischen Behandlung ab, werden Überlegungen zur Therapiebegrenzung laut. In Deutschland sind häufig Pflegekräfte die ersten innerhalb des Intensivteams, die solche Gedanken äußern (Lasch, 1997). Für die Ärzte hingegen ist die Weiterführung der Maximaltherapie der einfachste Weg. Eine Abkehr hiervon stellt eine Veränderung des Therapieschemas dar und muss gegenüber PatienIn, Angehörigen, KollegInnen, Vorgesetzen und ihrem eigenen Gewissen begründet werden. Manche meinen, zur Lebensverlängerung unter allen Umständen verpflichtet zu sein und fürchten rechtliche Konsequenzen. Doch dass dies nicht der Fall ist, hat auch die Bundesärztekammer in ihren überarbeiteten Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung (Bundesärztekammer, 2004) festgehalten. Das Weiterführen einer Maximaltherapie ist ebenso wie deren Abbruch eine Entscheidung, die eine Begründung und ständige Überprüfung erfordert. Therapie darf nicht Selbstzweck sein, sondern muss immer die bestmögliche Hilfe für den/die PatientIn beinhalten (Lawin, 2002b).
4.4. Ziele und Ergebnisse intensivmedizinischer Maßnahmen
Bei der Übernahme von PatientInnen in intensivmedizinische Versorgung stehen kurzfristige Ziele im Vordergrund. Es geht meistens zunächst darum, die akute Lebensgefahr zu beenden. Die Notwendigkeit, Therapieentscheidungen schnell treffen zu müssen, erschwert eine ganzheitliche und langfristige Betrachtungsweise. Dabei ist zu bedenken, dass es manchmal leichter fällt, eine Therapie nach gründlicher Abwägung nicht zu beginnen, als sie später reduzieren oder abbrechen zu müssen (Lawin, 2002b). Das ist schwierig, denn der Tod gilt auf Intensivstationen nicht als natürliches Ende eines Lebens, sondern scheint das Ergebnis falscher Therapie zu sein oder ein Versagen der Medizin darzustellen (Miller, Forbes & Boyle, 2001). Dem steht die Empfehlung von Osamu Aochi, dem Präsidenten des 5. Weltkongresses für Intensivmedizin gegenüber, als Kriterien für einen guten Ausgang einer Intensivtherapie einerseits die Rückkehr in ein Leben in Gemeinschaft und Beruf oder andererseits ein friedvolles Sterben gelten zu lassen (Lawin, 2002b).
Wichtig bei der Entscheidungsfindung ist, dass das Ergebnis Folge eines Kommunikationsprozesses zwischen allen Beteiligten (ÄrztInnen, Pflegepersonal, PatientIn / Angehörige) ist, dessen Grundlage der (mutmaßliche) Wille des/der PatientIn bildet. Dies ist nicht einfach, da die Beteiligten ganz unterschiedliche Sichtweisen des Geschehens haben – verschiedene Wirklichkeiten erleben – und ihre Eindrücke divergierend verbalisieren (Geisler, 1992). Dieses Vorgehen schließt eine plötzliche, nicht abgestimmte Änderung des Therapiefahrplanes aus.
Die Entscheidung, eine Maximaltherapie nicht fortzusetzen, sollte weiter konkretisiert werden in den Abstufungen Therapieerhalt, Therapiereduktion oder Therapieabbruch (Salomon, 2000). Diese Ausdrücke sind allerdings von der Sichtweise geprägt, dass das Therapieziel „Lebensverlängerung“ lauten muss und ein „friedvolles Sterben“ nicht als guter Ausgang einer Intensivtherapie gesehen wird. Betrachtet man aber die Erfolglosigkeit einer Maximaltherapie als Ausgangspunkt, um den Therapieschwerpunkt von Kuration [16] auf Palliation [17] zu legen, so ist klar, dass zu jeder Zeit eine Basistherapie besteht, die dafür sorgt, dass die Grundbedürfnisse befriedigt werden. Welche Maßnahmen dazugehören, wird Inhalt des übernächsten Kapitels sein.
Die Therapieziele verschieben sich langsam, wenn beatmete PatientInnen einige Tage nach erfolgter Reanimation und Absetzen von schlaffördernden und schmerzlindernden Medikamenten keinerlei Reaktionen zeigen. Bei PatientInnen, bei denen erst 11 Minuten nach einem Herzstillstand mit einer Reanimation begonnen wird, kann zwar die Herz-Kreislauf-Funktion wieder hergestellt werden, der Hirntod ist aber irreversibel (Opderbecke & Weißauer, 2002). Bei kürzeren Zeiten von Sauerstoffmangel treten Hirnschäden auf, von kleineren Gedächtnislücken bis hin zum apallischen [18] Syndrom der so genannten WachkomapatientInnen. Wie umfangreich eine Hirnschädigung ist, lässt sich genau erst durch die Beobachtung und Prüfung der Reaktionen sagen. Bildgebende Verfahren, wie z.B. die Computertomografie des Schädels können allerdings schon eher Auskunft über Ausdehnung und Lokalisierung des Schadens geben.
Nicht alle Hirnfunktionen sind messbar und so lässt sich auch ihr Ausfall nicht nachweisen (Schneider, 2001). Da es sich um beatmete PatientInnen handelt, bleibt der Untergang des Atemzentrums im Verborgenen. Der Eintritt des Hirntodes ist faktisch unbeobachtbar (Lindemann, 2001). Dieser, früher als „Coma dépassé“ bezeichnete Zustand charakterisierte bis 1968 sterbende PatientInnen, deren Koma irreversibel war. Mit dieser Diagnose sollte der Weg für einen Therapieabbruchs geebnet werden (Lieser, 1998). Diese Intention änderte sich, nachdem Christiaan Barnard 1967 in Südafrika die erste Herztransplantation am Menschen durchgeführt hatte. Nach dem damals bestehenden Herztodkonzept entsprach die Organentnahme einer Tötung des Spenders. 1968 plädierte die Ad Hoc Kommission der Harvard Medical School für die Anerkennung des irreversiblen Komas als neues Todeskriterium. Sie begründete den Vorstoß erstens mit der schweren Last, die auf betroffenen Individuen, Angehörigen und Krankenhäusern ruhe und auch auf anderen PatientintInnen, die auf eine Krankenhausaufnahme wegen der Belegung mit PatientInnen mit irreversiblem Koma warten müssten. Zudem erhoffte man sich den leichteren Zugriff auf Organe zur Transplantation (Klein, 1998). Der Vorschlag des Harvard Komitees wurde noch im selben Jahr von der deutschen Gesellschaft für Chirurgie und dem Weltärztebund in Erklärungen umgesetzt (Opderbecke & Weißauer, 2002). Der wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer beschäftigte sich seit 1978 mit dieser Thematik. Zuletzt hat er seine Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes 1998 überarbeitet. Dies wurde notwendig, nachdem 1997 im Transplantationsgesetz die Richtlinienkompetenz zur Feststellung des Todes und die Verfahrensregeln zur Feststellung des endgültigen, nicht behebbaren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms der Bundesärztekammer übertragen wurde (§ 16, Abs. 1, Nr. 1 TPG).
[...]
[1] Siehe auch Kapitel 6.4
[2] Kinderlähmung
[3] Herzerkrankungen betreffend
[4] Kinderkrankheiten betreffend
[5] Unfälle betreffend
[6] Elektrisches Gerät zur Beseitigung des Herzkammerflimmerns durch Elektroschock
[7] erwachsenen
[8] Verschlimmerung
[9] Einführung eines Schlauches in die Luftröhre zur Beatmung
[10] Schlaganfall
[11] Medikamentengruppe zur Auflösung von Blutpfropfen
[12] mit Schmerz- und Beruhigungsmitteln versorgt
[13] Herzleistungssteigernde Medikamente wie z.B. Adrenalin
[14] die Atmung betreffend
[15] Medikamentöse Maßnahme, die die Muskeln inkl. Atemmuskulatur erschlaffen lässt
[16] Heilung
[17] Linderung
[18] funktionelle Trennung von Hirnrinde und anderen Hirnzentren
- Arbeit zitieren
- Corinna Meyer-Suter (Autor:in), 2008, End-of-life Care auf Intensivstationen. Belastungen und Ressourcen von Pflegekräften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270123
Kostenlos Autor werden



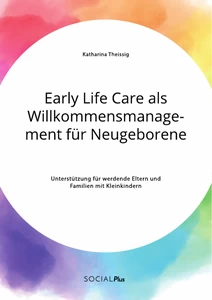












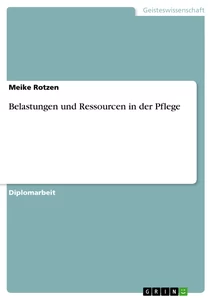



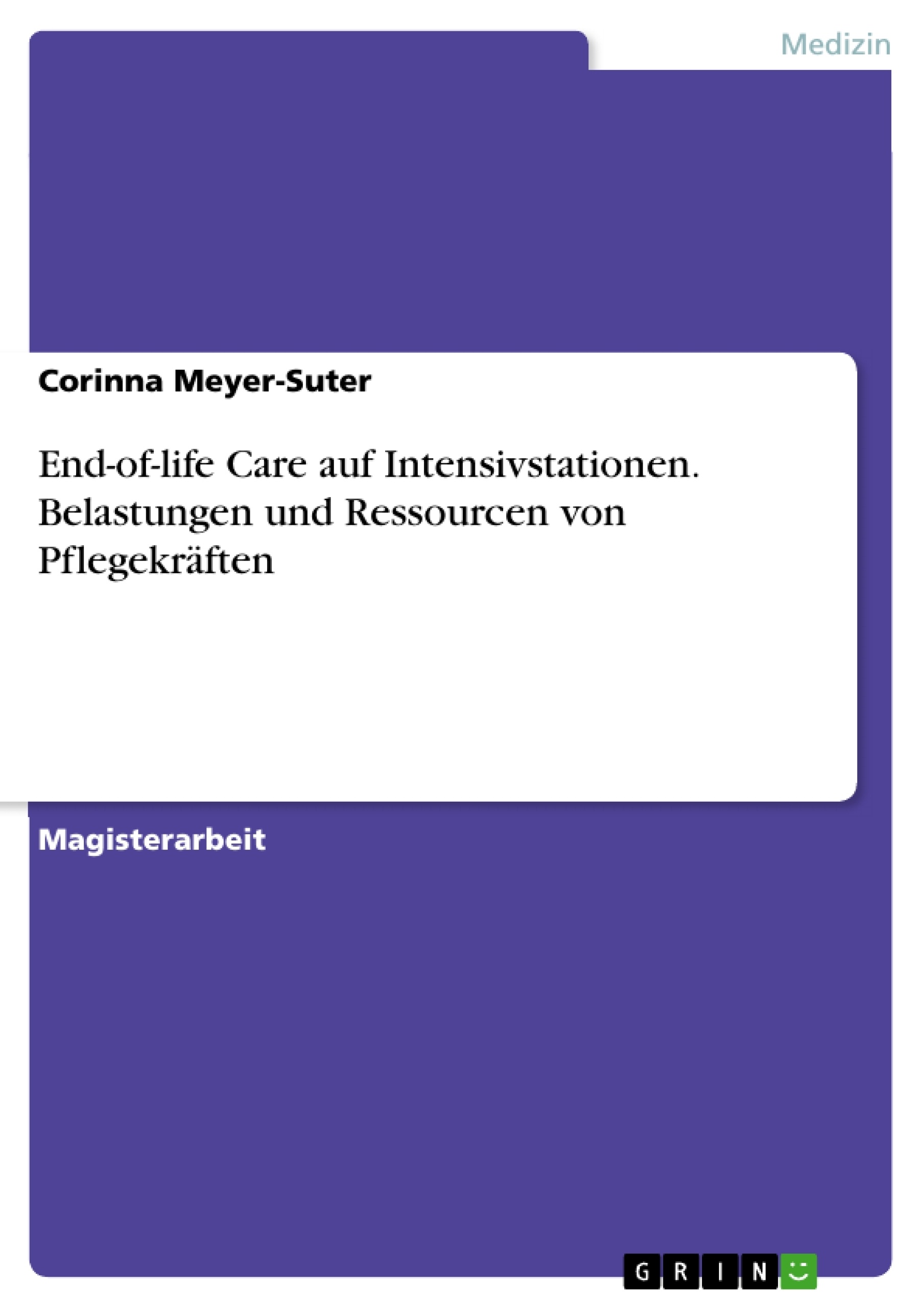

Kommentare