Excerpt
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
1.2 Einleitung
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Unternehmen in Deutschland
2.1 Kleine und Mittlere Unternehmen
2.2 Familienunternehmen
2.3 Besonderheiten von Familienunternehmen und KMU
3. Volkswirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensnachfolge nach IfM-Bonn
3.1 Klärung zentraler Begriffe
3.2 Anzahl der zur Übergabe anstehenden Unternehmen
3.3 Anzahl der von Übernahme berührten Beschäftigten
4. Formen der Unternehmensnachfolge
4.1 Die Übertragung innerhalb der Familie
4.2 Die Übertragung an Mitarbeiter (MBO)
4.3 Der Verkauf an außenstehende Existenzgründer (MBI)
5. Erfolgsfaktoren der familieninternen Nachfolge
5.1 Status quo der Erfolgsfaktorenforschung
5.2 Die Klassifizierung von Erfolgsfaktoren der Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen
5.2.1 Klassifizierung nach Le Breton-Miller
5.2.2 Klassifizierung nach De Massis, Chua und Chrisman
5.3 Einflussfaktoren der familieninternen Unternehmensnachfolge
5.3.1 Individuelle Faktoren
5.3.2 Relationale Faktoren
5.4 Zusammenfassung
6. Prozessmodelle der familieninternen Unternehmensnachfolge
6.1 Prozessmodell nach Halter
6.2 Wittener Prozessmodell der internen Unternehmensnachfolge
6.3 Zusammenfassung
7. Fazit
8. Anhang
9. Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Friedrich Wacker (Author), 2014, Prozess-und Erfolgsfaktoren Modelle der Unternehmensnachfolge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268954
Publish now - it's free
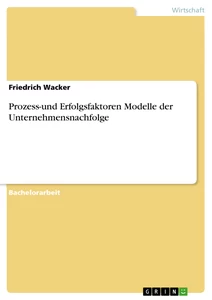
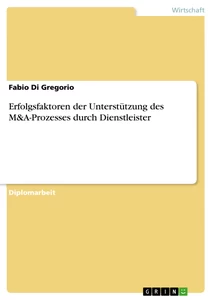
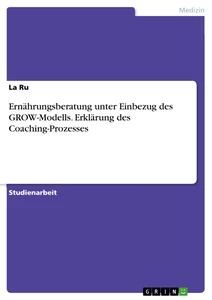

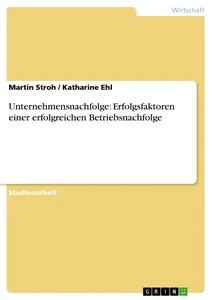
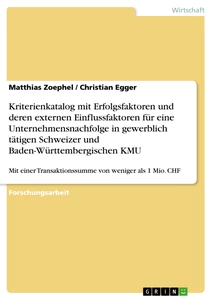
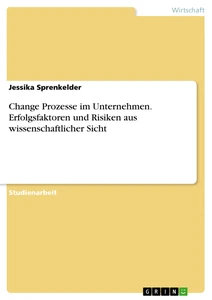
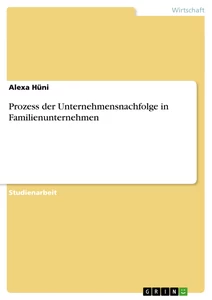


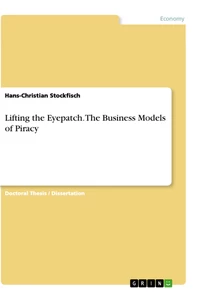
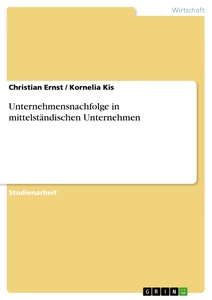

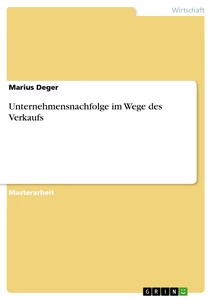
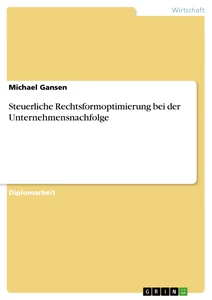

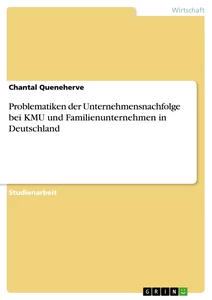
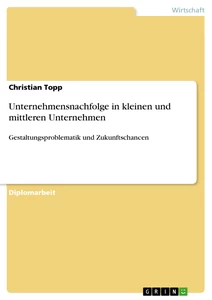

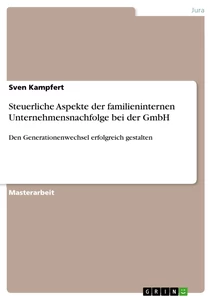
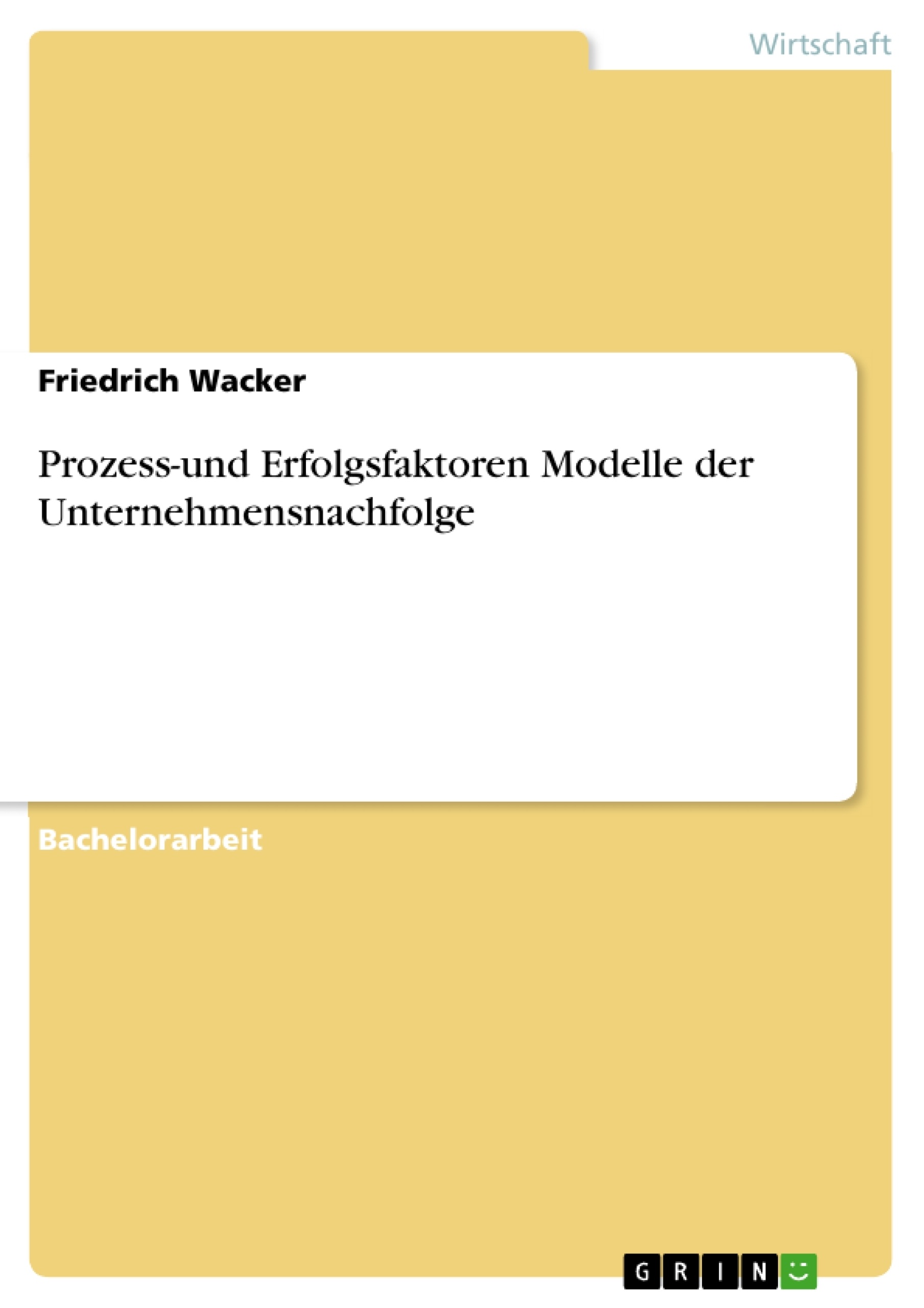

Comments