Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 MENSCHEN MIT LERNSCHWIERIGKEITEN
3 BARRIEREFREIE TEILHABE
3.1 BEGRIFFSERKLÄRUNG „TEILHABE“
3.2 BEGRIFFSDEFINITION „BARRIEREFREIHEIT“
3.3 GESETZLICHE RAHMENBEDINGUNGEN
4 LEICHTE SPRACHE
4.1 URSPRUNG UND BEGRIFFSDEFINITION
4.2 KOMMUNIKATION UND „LEICHTE SPRACHE“
4.3 VERSTÄNDLICHKEITSFORSCHUNG
4.3.1 DER EMPIRISCH-INDUKTIVE ANSATZ - HAMBURGER VERSTÄNDLICHKEITSMODELL (1974)
4.3.2 DER THEORETISCH-DEDUKTIVE ANSATZ NACH GROEBEN (1978)
4.3.3 DER LINGUISTISCHE ANSATZ NACH HERINGER (1984)
4.4 REGELKATALOGE UND PRINZIPIEN ZUR TEXTVEREINFACHUNG
4.4.1 „TIPPS UND TRICKS“ DES WÖRTERBUCHS FÜR LEICHTE SPRACHE ODER DAS KOZEPT „LEICHTE SPRACHE“ (IM ENGEREN SINN)
4.4.2 LESETEXTE FÜR JUGENDLICHE MIT SPRACHERWERBSSTÖRUNGEN NACH BRÜHLMEIER ET.AL (2009)
4.4.3 TEXTVERSTÄNDLICHKEIT UND TEXTVEREINFACHUNG IM DEUTSCHSPRACHIGEN FACHUNTERRICHT (DFU) NACH MEIRELES/BLÜHDORN 1997)
4.5 VOR- UND NACHTEILE EINER LEICHTEN SPRACHE
4.5.1 PRO LEICHTE SPRACHE
4.5.2 CONTRA LEICHTE SPRACHE
5 INTERNET FÜR ALLE?
5.1 BARRIEREFREIES INTERNET?
5.2 WEB 2.0 ODER DIE ZWEITE PHASE DER GLOBALEN VERNETZUNG
5.3 BEGRIFFSDEFINITION ONLINE-ENZYKLOPÄDIE
5.4 MENSCHEN MIT LERNSCHWIERIGKEITEN UND INTERNET
6 BISHERIGE ANGEBOTE IN LEICHTER SPRACHE
7 PLANUNG EINER ONLINE-ENZYKLOPÄDIE IN LEICHTER SPRACHE
7.1 ENTSTEHUNG UND GRUNDIDEE
7.2 WOFÜR EINE ONLINE-ENZYKLOPÄDIE IN LEICHTER SPRACHE?
7.3 ZIELGRUPPE DES PROJEKTS
7.4 AUSLEGUNG DER LEICHTEN SPRACHE
7.5 WER SCHREIBT DIE TEXTE?
7.5.1 EINBEZUG DER ZIELGRUPPE
7.6 SEITENAUFBAU
7.6.1 STARTSEITE
7.6.2 ARTIKELSEITE
7.6.2.1 Struktur des Artikels
7.6.2.2 Typographie
7.6.2.3 Bilder
7.7 HILFEMÖGLICHKEITEN
8 SCHLUSS
9 LITERATURVERZEICHNIS
10 ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1 Einleitung
Jedem Menschen wird es schon einmal im Leben so ergangen sein, dass Passagen aus Verträgen, Bedienungsanleitungen oder Gesetzestexte für sie durch eine hoch- komplizierte Schreibweise unzugänglich blieben. Menschen mit Verständnisschwie- rigkeiten, beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder Migrationshintergrund, erfahren diese Situationen nur allzu oft im Alltag. „Meist ist den AutorInnen wichtiger, dass ihre Texte juristisch oder technisch auf hohem Niveau sind - die Verständlich- keit bleibt dabei oft auf der Strecke“ (Wagner, et al., 2004 S. 207). Die uneinge- schränkte Teilhabe ist für viele Menschen hierdurch in Gefahr. Eine mögliche Lö- sung hierfür ist die von verschiedenen Verbänden, hauptsächlich durch das „Netz- werk Leichte Sprache“, geforderte leichte Sprache. War dieser Ausdruck vor einigen Jahren für einen Großteil der Menschen noch ein inhaltsleerer Begriff, so zeigt sich, dass die Initiativen der Verbände, unter anderem eine 2009 groß angelegte und von ca. 13.500 Menschen unterschriebene Petition an den Bundestag auf ein Recht für leichte Sprache (Netzwerk Leichte Sprache), langsam Früchte tragen. So gab bei- spielsweise der Bundestag am 25.10.12 eine erste Pressemitteilung in leichter Spra- che heraus (Bundestag, 2012). Ebenso sind die Wahlprogramme für die kommende Bundestagswahl im Herbst 2013 von der Mehrzahl der großen Parteien ebenfalls in einer leichten Sprache erhältlich.
Digitale Medien, vor allem das Internet, haben inzwischen nahezu alle Lebensberei- che durchdrungen. „Besonders Menschen mit Behinderungen erleichtert das Internet prinzipiell die selbstbestimmte Teilhabe am sozialen, kulturellen und beruflichen Le- ben enorm und bedeutet somit ein wesentlich erhöhtes Maß an Selbstständigkeit“ (Hojas, 2004). Es offenbart sich hier jedoch eine Ambivalenz. So ist das Internet auf der einen Seite zwar in der Lage, behinderungsbedingte Barrieren zu kompensieren, auf der anderen Seite stoßen diese Menschen im Internet, je nach Behinderung, aber immer wieder auf dieselben Barrieren (Cornelssen, 2008 S. 3). Diese Barrieren sind zum einen natürlich technisch bedingt, beispielsweise durch eine viel zu kleine, unübersichtliche Navigationsleiste. Andererseits, und damit möchte sich die vorlie- gende Arbeit schwerpunktmäßig beschäftigen, liegt die Problematik oftmals in der Sprache, die nicht nur für Menschen mit Behinderungen, eine hohe Barriere in der
digitalen Welt darstellen kann (ebd.). Bei einer Studie der „Aktion Mensch“ hat sich herausgestellt, dass Menschen mit Behinderung das Internet gar intensiver nutzen als Menschen ohne eine Behinderung (ebd.). Trotz einer Vielzahl an Barrieren, die das Internet diesen Menschen in den Weg stellt, ist daher diese Erkenntnis sehr bemerkenswert. Hier offenbart sich ein Widerspruch und gleichzeitig ein Anstoß für das in dieser Arbeit vorgestellte Projekt. Es ist offensichtlich, dass das Medium Internet, das von Menschen mit Behinderungen bereits aktiv angenommen wird, ein enormes Potential bietet, das ausgeschöpft werden sollte.
Im Rahmen eines Projekts im Laufe meines Studiums der Sonderpädagogik sollte ein Medienarrangement für Schülerinnen und Schüler der Grundschule entwickelt werden. Auf der Suche nach einer geeigneten lexikonartigen Website in kindgerech- ter Sprache wurde der Missstand diesbezüglich deutlich. Nach intensiven Recher- chen und ersten Überlegungen stieß ich auf das Konzept der leichten Sprache und stellte fest, dass es in diesem Feld noch weniger Angebote im Internet gibt. Daraus entstand die Idee, eine Online-Enzyklopädie im Stile der bekannten Plattform „Wiki- pedia“ in leicht verständlicher Sprache zu erstellen. Es ist nicht Ziel dieser Arbeit ei- nen vollständigen Projektplan für ein Online-Lexikon in leichter Sprache zu erstellen. Vielmehr geht es darum, die dahinterstehenden Grundlagen zu beleuchten und mit verschiedenen Ideen einen ersten Grundstein zu legen. So besitzt das vorgestellte Grundgerüst dieser Seite auch vielmehr einen Beispielcharakter. Um ein solches Projekt realisieren zu können wird nun also zunächst aufgrund fehlender wissen- schaftlicher Auseinandersetzung mit dem Thema einer leichten Sprache im Bezug auf Menschen mit Lernschwierigkeiten (Rüstow, 2011 S. 5f) auf bestehende Theo- rien, vor allem der psycholinguistischen Verständlichkeitsforschung zurückgegriffen und auf die Übertragung bzw. die Nutzbarkeit für das geplante Projekt überprüft.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich folgendermaßen: In einem ersten Schritt wird kurz auf den Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ (Kap. 2) eingegangen. Bar- rierefreie Teilhabe ist der Überbegriff des zweiten Kapitels. Dieses differenziert sich aus in die Definition des Teilhabebegriffs (Kap. 3.1) und einer Beschreibung des Be- griffs Barrierefreiheit (Kap. 3.2). Außerdem werden die gesetzlichen Rahmenbedin- gungen, sowohl auf EU, als auch auf nationaler Ebene vorgestellt. Im Kapitel 4 wird die leichte Sprache untersucht. Es wird zunächst der Ursprung sowie die Begriffsde- finition vorgestellt (Kap. 4.1), ehe ein Einblick in die psycholinguistische Verständ-lichkeitsforschung (Kap. 4.3) gegeben wird. Hierbei werden zwei Ansätze aus der
psychologischen und ein Ansatz aus der linguistischen Verständlichkeitsforschung beleuchtet (Kap. 4.3.1 bis Kap. 4.3.3). Diese Forschungsergebnisse dienen im An- schluss dazu, die vorgestellten „Regelkataloge“ bzw. „Prinzipien“ zur Textvereinfa- chung für verschiedene Zielgruppen, kritisch zu hinterfragen (Kap. 4.4.1 bis Kap.
4.4.3). Mit grundsätzlichen Vor- und Nachteilen einer leichten Sprache beschäftigt sich das Kapitel 4.5. Bezogen auf die digitalen Medien wird im Überkapitel „Internet für alle?“ zunächst auf den Zusammenhang zwischen Barrieren und dem Medium Internet eingegangen (Kap. 5.1). Die Vorstellung der Begriffe „web 2.0“ (Kap. 5.2) und „Online-Enzyklopädie“ (Kap. 5.3) folgt im Anschluss. Auf Grundlage der bereits genannten Studie von „Mensch zuerst“, wird dann das Nutzungsverhalten sowie spezifische Barrieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten erörtert (Kap. 5.4). Eine Bestandsanalyse von bereits vorhandenen Angeboten in leichter Sprache wird in Kapitel 6 durchgeführt. Kapitel sieben befasst sich mit dem angestrebten Projekt. Es wird zunächst die Entstehung und die grundlegende Idee (Kap. 7.1) vorgestellt, ehe im darauffolgenden Abschnitt, Gründe für die Notwendigkeit einer Online- Enzyklo- pädie in leichter Sprache erörtert werden (Kap. 7.2). In Kapitel 7.3 wird kurz die Ziel- gruppe vorgestellt. Kapitel 7.4 beschreibt die Auslegung der „leichten Sprache“ für die Plattform. Wer die Autorenschaft darstellt (Kap. 7.4), und wie auch die Zielgruppe mit einbezogen werden kann, beschreiben die nächsten Kapitel. Kapitel 7.5. und die dazugehörigen Unterkapitel beschäftigen sich mit einem prototypischen Aufbau einer solchen Plattform. Den Abschluss bildet ein Kapitel, das Hilfsmöglichkeiten für die Nutzer der Seite vorschlägt (Kap. 7.6).
2 Menschen mit Lernschwierigkeiten
Dass der Terminus „Förderschwerpunkt Lernen“ die traditionelle Lernbehindertenpä- dagogik ablösen könne, bezweifelt Heimlich (2009). Auf der Suche nach einem Be- griff, der die gegenwärtigen, aber vor allem auch die zukünftigen Aufgaben der „Lernbehindertenpädagogik“ losgelöst vom schulischen Kontext beschreibt, also bei- spielsweise inklusive der Bereiche Frühförderung und Erwachsenenbildung, erfahre der Oberbegriff der „Lernschwierigkeit“ inzwischen großen Zuspruch (Heimlich, 2009 S. 26).
Der Vorteil des Begriffs „Lernschwierigkeit“ ist nach Kretschmann (2007) die Ursa- chenneutralität. Begriffe wie „Lernbehinderung“ und „Lernschwäche“ lokalisieren be- reits das Problem und schreiben ihnen eine Ursache zu (Kretschmann, 2007 S. 5). Die Definition der „Lernschwierigkeit“ hat einen entwicklungstheoretischen Hinter- grund. Die bekannten Entwicklungstheorien (Piaget, Dewey und andere) betrachten die Entwicklung und das Lernen als Aktivitäten, die vom Individuum selbst gesteuert werden und sich als Interaktion mit dessen Umwelt zeigt. Im Hinblick darauf ist eine Lernschwierigkeit grundsätzlich nicht mehr defizitär zu sehen, da sie zum Bestandteil des Lernens selbst zählt. Lernschwierigkeiten entstehen also in allen Lernprozessen für alle Lernenden (Heimlich, 2009 S. 26f). Worin unterscheiden sich nun Menschen mit allgemeinen Lernschwierigkeiten, die bei jedem Lerner auftreten können, von gravierenden Lernschwierigkeiten? Der Schweregrad wird in Heimlichs Definition über den Förderbedarf differenziert. Die Frage ist somit, ob ein Kind, ein Jugendli- cher, ein Erwachsener seine Lernschwierigkeit selbst bewältigen kann. Ist dies nicht der Fall und wird zusätzliche sonderpädagogische Förderung nötig wird von einer gravierenden Lernschwierigkeit gesprochen. Für diese Fördermaßnahmen ist es zu- nächst unerheblich, ob die Lernschwierigkeiten vorübergehend oder dauerhaft sind, in nur einem oder mehreren Schulfächern auftritt oder ob die Ursache auf kognitive oder andere Bedingungsfaktoren zurückzuführen ist (ebd., 29f).
Behinderungen und Lernprobleme könne man gegenwärtig nicht mehr als Problem des Einzelnen betrachten. Vielmehr seien Lernschwierigkeiten Ausdruck erschwerter Lebens- und Lernsituationen, so Heimlich. Er unterscheidet zwischen vier Ebenen der Bedingungsfaktoren. Die erste Ebene ist die der unmittelbar beobachtbaren und
intersubjektiv wahrnehmbaren Lernschwierigkeiten. Hierzu zählt er, die von ihm nachfolgend als Lernschwierigkeiten im engeren Sinne bezeichneten, Rechen- und Leserechtschreibschwierigkeiten sowie Schwierigkeiten beim „Lernen des Lernens“. Die Ebene der endogenen Bedingungsfaktoren bestehend aus somatischen, sensomotorischen, kognitiven, emotionalen sowie sozialen Aspekten, bilden die zweite Ebene. Die dritte Ebene, die exogenen Bedingungsfaktoren setzen sich aus dem sozialen Umfeld, wie Familie, aber auch der Schule zusammen. Zu einer vier- ten Ebene, der Erklärungsmodelle für Lernschwierigkeiten, zählt Heimlich die erzie- hungswissenschaftlichen Erkenntnisse aus den Bereichen der Psychologie und der Soziologie. Lernschwierigkeiten können daher sowohl durch endogene, als auch exogene Bedingungsfaktoren verursacht werden (Heimlich, 2009 S. 19f).
Der Begriff „geistige Behinderung“ wird seit langem kontrovers diskutiert. Seit einiger Zeit gibt es Betroffenenbewegungen wie beispielsweise „Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V.“ von denen eine Abschaffung dieser stigmatisieren- den Begrifflichkeit eingefordert wird. „Bei den Worten ’geistig behindert’ denken viele Menschen, dass wir dumm sind und nichts lernen können. Das stimmt nicht. Wir ler- nen anders. Wir lernen manchmal langsamer oder brauchen besondere Unterstüt- zung. Deshalb wollen wir Menschen mit Lernschwierigkeiten genannt werden. Wir fordern, dass die Wörter „geistig behindert“ nicht mehr benutzt werden“ (Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V.). Durch diese Forderungen löst sich die Trennlinie zwischen Menschen mit geistiger Behinderung und Lernbehinderung auf. Dies stellt jedoch nicht unbedingt ein Problem dar, da der Begriff der Lernbehin- derung außerhalb der Bundesrepublik sowieso praktisch unbekannt ist (Theunissen, 2008 S. 130). Aus fachwissenschaftlicher Perspektive stößt diese Forderung jedoch auf vielfältige Kritik. Mithilfe der oben dargestellten Definition Heimlichs scheint es trotz allem machbar, die Gruppe der geistig Behinderten sozusagen „offiziell“ in die Masse der Menschen mit Lernschwierigkeiten einzugliedern. Noch deutlicher wird diese Möglichkeit bei der Betrachtung der Definition Zielinskis (1996), der Lern- schwierigkeiten ganz offen als „Probleme der Informationsaneignung durch ein Indi- viduum“ (Zielinski 1996, 369 zit. nach Kretschmann 2007, 4) sieht. Ob dieser Weg nun vorteilhaft ist oder nicht, sei dahingestellt.
Da für die vorliegende Arbeit der Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten aller-dings in der umfassenden Art und Weise verwendet wird, soll an dieser Stelle nicht detaillierter darauf eingegangen werden. Ist in bestimmten Textpassagen eine Spezifizierung von Nöten, wird dies angemerkt. Im Grunde befasst sich diese Arbeit auch nur schwerpunktmäßig mit dieser Gruppe. Es wird schnell deutlich, dass auch viele andere Menschen mit Verständnisschwierigkeiten wie beispielsweise Menschen mit einem Migrationshintergrund angesprochen werden.
3 Barrierefreie Teilhabe
3.1 Begriffserklärung „Teilhabe“
Der Begriff „Partizipation“ stammt von dem lateinischen Begriff „partizipare“ und be- deutet wörtlich übersetzt Teilnahme und Teilhabe (Pluto, 2007 S. 16). Auch wenn in verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten die Begriffe Partizipation und Teilhabe differenziert betrachtet werden (Partizipation insbesondere als die politische Mitbe- stimmung - die Begriffsverwendung Teilhabe hingegen häufig in den Sozialgesetz- büchern), wird sich in dieser Arbeit der Mehrzahl angeschlossen und somit beide Begriffe synonym verwendet.
Eine universell anwendbare Definition von Teilhabe scheint grundsätzlich schwierig. Dies ist zunächst dadurch begründet, dass sich der Begriff in sehr vielen Bereichen der Gesellschaft (Wirtschaft, Politik, etc.) unterschiedlich gestaltet (Winter, 2010 S. 11). Es besteht eine Vielzahl an unterschiedlichen Theorieströmen. Beck (2013) bringt außerdem an, dass „[der] Gehalt und [die] Reichweite des [Teilhabebegriffs] (ab wann spricht man von Teilhabe und ab wann von Ausgrenzung) historisch relativ und immer wieder neu zu bestimmen sei (Beck, 2013 S. 5). Grundsätzlich geht es jedoch um die drei Ebenen „Mitmachen, Mitgestalten und Mitbestimmen beim Zu- sammenleben aller Bürgerinnen und Bürger“ (Dortmunder Erklärung, 2005 S. 9). Dies sowohl auf politischer Ebene zur Sicherung der Demokratie, als auch auf ge- samtgesellschaftlicher Ebene (Pluto, 2007 S. 16).
Im Jahr 1999 verabschiedete die Weltgesundheitsorganisation (kurz: WHO) in der „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (kurz: ICF) mit dem Partizipationsmodell eine Definition auf internationaler Ebene. Diese neue Definition löst sich von den defizitorientierten Begriffen „Disability“ und „Handicap“ hin zu einer ressourcenorientierten Sichtweise mit den Begriffen „Activity“ und „Participation“ (Feuser, 2012 S. 15).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1 Das bio-psycho-soziale Modell der ICF http://www.dimdi.de/static/de/klassi/pics/diagramm-icf.png [10.07.2013]
Teilhabe bzw. Partizipation ist demnach das Einbezogensein einer Person in eine Lebenssituation bzw. in einen Lebensbereich. Eingeschränkt wird die Teilhabe durch „Probleme, die der Mensch im Hinblick auf sein Einbezogensein in die angesproche- ne Lebenssituation aus seiner subjektiven Perspektive erlebt. Die „eigentliche Be- hinderung“ ist die erschwerte Teilhabe an den Lebensbereichen (Umwelt und Ge- sellschaft) und muss daher als Ansatzpunkt für Hilfen herangezogen werden. Um die Teilhabechancen zu verbessern, müssen die „Kontextfaktoren“ (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren, die nicht Teil des Gesundheitsproblems sind), die sich förderlich oder hemmend auf die Aktivitäten und somit auch auf die Teilhabe auswir- ken können, in den Blick genommen werden (Seifert, 2008 S. 1). Dieses Modell ist seit 2001 auch im deutschen Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) verankert.
Die ICF ist ausdrücklich universal anwendbar und nicht nur auf Menschen mit Be- hinderungen zu beziehen. Die WHO bezieht den Begriff der Partizipation (bzw. Teil- habe) deshalb auf alle Lebensbereiche. Teilhabe heißt demnach Gelegenheiten für Lernen und Entwicklung zu haben (Lernen und Wissensanwendung), den Alltag selbstbestimmt gestalten zu können (Allgemeine Aufgaben und Anforderungen), mit anderen kommunizieren und in Dialog treten zu können (Kommunikation), sich in- nerhalb und außerhalb des Wohnbereichs bewegen zu können (Mobilität), bei der Selbstversorgung (Körperhygiene, Ernährung, Gesundheitssorge) aktiv einbezogen zu sein (Selbstversorgung), an haushaltsbezogenen Aufgaben/Aktivitäten beteiligt zu sein (Häusliches Leben), an zwischenmenschlichen Interaktionen teilzunehmen und soziale Beziehungen zu haben (Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen), in bedeutsamen Lebensbereichen involviert zu sein, z.B.: Bildung, Ar- beit/Beschäftigung (Bedeutende Lebensbereiche), sowie am Leben in der Gemeinde teilzunehmen (Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben) (ebd., 2). An der Definition der ICF bzw. der WHO, die Teilhabe also lediglich als „Eingebunden- heit“ oder „Einbezogensein in eine Lebenssituation“ beschreibt, stellt Beck zwar fest, dass dies den gemeinten Gehalt veranschaulicht, ihn jedoch weder theoretisch fun- diert noch hinterfragt (Beck, 2013 S. 5).
Der Grundgedanke der Weltgesundheitsorganisation wird von Bartelheimer noch sehr nützlich verfeinert in dem er ausführt:
„Teilhabe lässt sich an den Chancen oder Handlungsspielräumen mes- sen, eine individuell gewünschte und gesellschaftlich übliche Lebenswei- se zu realisieren. Gefährdet („prekär“) wird Teilhabe dann, wenn sich die äußeren wie verinnerlichten sozialen Anforderungen an die eigene Le- bensweise und die tatsächlichen Möglichkeiten zu ihrer Realisierung aus- einanderentwickeln. Diese Gefährdung schlägt in Ausgrenzung um, wenn Personen oder Gruppen dauerhaft, biographisch unumkehrbar von ge- sellschaftlich üblichen Teilhabeformen ausgeschlossen sind, die sie indi- viduell anstreben. Wie die Lebenslage, so ist die Teilhabe mehrdimensio- nal zu definieren“ (Bartelheimer, 2004 S. 53)
Es geht bei der Teilhabe um die Vergabe von Rechten und Gewährung von Leistun- gen. Die Teilnahme jedoch ist aktiv, der Teilnehmende muss teilnehmen wollen. So warnt Beck davor, Teilhabe mit Teilnahme gleichzusetzen. Denn so läuft man Ge- fahr, aus einem Teilhaberecht eine Teilnahmepflicht erwachsen zu lassen. In diesem Falle müsste das Individuum sich als teilnahmewillig und ebenso, als teilnahmefähig erweisen (Beck, 2013 S. 5).
Waldschmidt (1999) sieht in diesem Zusammenhang die Gefahr, dass „herkömmli- che Unterstützungssysteme zwar abgebaut, neue, weniger fremdbestimmende Hilfs- systeme aber gar nicht aufgebaut werden“ (Waldschmidt, 1999 S. 44). Ein klassi- sches Beispiel hierfür wäre die grundsätzliche Abschaffung der Sonderschulen, ohne eine gleichwertige Förderung in den Regelschulklassen bereitzustellen. „Vielmehr geht es darum, nach den individuellen Bedarfen und Bedürfnissen passende Unter- stützungen bereitzustellen, um so Chancengleichheit zur gesellschaftlichen Teilhabe bei Verschiedenheit der Kompetenzen und Intentionen zu ermöglichen“ (Wacker, 2005 S. 13).
Vor allem im Bezug auf Menschen mit einer Behinderung hat der Teilhabebegriff in diesen Zeiten Hochkonjunktur. Hier fehle es nach Feuser jedoch an einer begriffli- chen Klarheit. Er kritisiert gar, dass die Fragen und Probleme in der Teilhabefor- schung in Bezug auf Behinderung dieselben seien, die bereits vor vier Jahrzehnten in der Integrationsforschung diskutiert wurden. Er sieht hierin die Gefahr, dass der Teilhabebegriff eine ähnliche Trivialisierung erfährt wie der Integrations- und Inklusi- onsbegriff (Feuser, 2012 S. 15). Der Ruf nach Teilhabe von Menschen mit Behinde- rungen zeigte sich vor allem 2003, dem Europäischen Jahr der Menschen mit Be- hinderung im Dortmunder Kongress. Unter dem Motto „Wir wollen mehr als nur da- bei sein!“ diskutierten Menschen mit und ohne Behinderung über Behinderung und Gesellschaft, und im speziellen über das Teilhaberecht. „[Eine] physische Präsenz allein [garantiere noch] nicht den Respekt vor der Verschiedenheit und der Persön- lichkeit, den behinderungserfahrene Menschen benötigen, um eine eigene Rolle als Bürger(innen) der Gesellschaft zu spielen“ (Wacker, 2005 S. 14). Es geht um einen Perspektivenwechsel, weg von den „bedürftigen Sorgenkindern“ hin zu respektierten Bürgerinnen und Bürgern (ebd., 16). Der Gedanke der aktiven Mitarbeit der Men- schen mit Behinderungen wird uns beim Thema leichte Sprache wieder begegnen.
Auffällig ist, dass in der Diskussion um Teilhabe und Behinderung oft nur Menschen mit einer geistigen, einer körperlichen oder einer anderen „sichtbaren“ Behinderung angesprochen werden. Auch die Behindertenbewegungen, beispielsweise durch den angesprochenen Dortmunder Kongress, sind beinahe ausschließlich Menschen mit einer geistigen Behinderung. Es drängt sich die Vermutung nach einer fehlenden Lobby für Menschen mit einer „unsichtbaren“ Beeinträchtigung, auf. Vor allem auch im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit müssen beim Begriff Teilhabe alle Men- schen gleichwertig in den Mittelpunkt gerückt werden. Dazu zählen neben Menschen mit Behinderungen, beispielsweise auch Menschen mit Migrationshintergrund, de- nen die Teilhabe an der Gesellschaft durch die Sprache oder die fremde Kultur er- schwert wird.
3.2 Begriffsdefinition „Barrierefreiheit“
In einem Atemzug mit Teilhabe wird in der gegenwärtigen Diskussion der Begriff der Barrierefreiheit genannt. Dies vor allem seit der Nennung dieses Begriffs in dem neunten Sozialgesetzbuch sowie im Behindertengleichstellungsgesetz 2002 (Peter, 2003 S. 54). Zu einer ersten Annäherung an den Begriff wird die Definition für „Barri- ere“ aus dem Duden herangezogen. Demnach ist eine Barriere eine „Absperrung, die jemanden, etwas von etwas fernhält“ (Duden). Synonyme Begriffe für eine Barri- ere sind unter anderen „Absperrung, Barrikade, Blockierung, Hindernis oder Hürde“ (ebd.). Eine Barriere stellt sich nach dieser Definition also zunächst einmal als eine Hürde für einen Austausch zwischen Personen und/oder Dingen dar. Umgekehrt versteht man unter Barrierefreiheit somit die Abwesenheit dieser Hürden. Doch wa- rum muss überhaupt über Barrieren und deren Freiheit gesprochen und diskutiert werden? Seit der Antike wird aus der Planungsperspektive mit einem „idealisierten Muster des menschlichen Körpers“ (Jocher, et al., 2010 S. 13) gearbeitet. Verbild- licht wird dies beispielsweise durch das berühmte Proportionsschema von Leonardo da Vinci (1485/90) und anderen Werken, die jeweils als zentrales Bezugssystem dienten (Reutlinger, et al., 2011 S. 284). Diese Durchschnittswerte nehmen jedoch nicht Bezug auf Vielfalt und Verschiedenartigkeit der individuellen Körpermasse (Jocher, et al., 2010 S. 14) oder spezifischen Fähigkeiten des oder der Einzelnen (Reutlinger, et al., 2011 S. 284). Kupke stellt in ihrer Arbeit fest, dass das „Abbild eines vollkommenen, gesunden und starken Körpers [.,] auch heute noch [der] Durchschnitt unserer Gesellschaft zu sein [scheint] (Kupke, 2009 S. 40f).
Nun stellt sich die Frage, wann für einen Menschen eine Barriere auftritt. Um diese Frage zu spezifizieren wird nun zunächst die Definition der Barrierefreiheit des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) zitiert:
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn die für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ (Behindertengleichstellungsgesetz 2002, §4)
Nach dieser Definition gerät ein behinderter Mensch an eine Barriere wenn die an- gesprochenen Lebensbereiche für ihn nicht selbstständig oder nur unter Erschwernis zugänglich und nutzbar sind. Vor allem der Aspekt „ohne fremde Hilfe“, der unübersehbar auf eine größere Selbstbestimmung hinführen soll, sticht heraus.
Reutlinger und Lingg (2011) beschreiben den Vorgang wenn ein Mensch auf eine Barriere trifft sozialräumlich als „Unterbrechung eines Flusses“ (Reutlinger, et al., 2011 S. 281). Aus der Innenperspektive sei nun entscheidend, dass sich etwas (In- dividuum, Ding) auf dem Weg von A nach B befinde und durch das Hindernis dieser Weg in der vertikalen Ebene verbaut sei. Das „etwas“ erfahre einen Widerstand. Ei- ne Barriere werde jedoch nur als solche wahrgenommen, wenn sie eine Relevanz für das sich in Bewegung befindende „etwas“ habe (ebd.). Es zeigt sich hier also, dass Barrieren von jedem Menschen anders wahrgenommen werden. Sie sind „in hohem Maße subjektspezifisch“ (ebd.). Weitergedacht gibt es sogar die Möglichkeit, dass sich nach der Barriereauflösung für einen Menschen, für einen weiteren Men- schen genau dadurch eine neue Barriere eröffnet. Wird also beispielsweise für einen körperbehinderten Menschen die Bordsteinkante abgeschafft, so hat ein blinder Mensch von nun an größere Schwierigkeiten sich zu orientieren.
Barrierefreiheit assoziieren die meisten Menschen mit sichtbaren Hürden, meist für körperbehinderte Menschen, das heißt fehlende Aufzüge oder Rampen. Dies liegt vor allem daran, dass sich diese Menschen durch ihre sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten viel eher eine Lobby und Gehör verschaffen können (Kupke, 2009 S. 38). Doch steckt hinter diesem Begriff, dies wird bereits an der obigen Definition des BGG deutlich, eine Vielzahl an weiteren Schwierigkeiten für viele andere Menschen. Bei der Betrachtung aktueller Verwendungszusammenhänge des Wortes Barriere geht es nicht mehr nur um bauliche, sondern umso mehr um „unsichtbare Barrieren“ wie Kommunikations- und Verstehensbarrieren, aber auch beispielsweise um „Barri- eren im Kopf“ durch Verhaltensunsicherheit im sozial-kommunikativen Umgang zwi- schen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen (Reutlinger, et al., 2011 S. 278;280).
Deutlich wird diese Abkehr der einseitigen Sichtweise beispielsweise auch durch die 2006 durchgeführte Fachtagung „Weg mit den Hindernissen! Was heißt eigentlich Barrierefreiheit für Menschen mit geistiger Behinderung?“. Hier arbeiteten an zwei Tagen Betroffene und Fachkräfte in vier Arbeitsgruppen. Die vier Arbeitsgruppen waren „Arbeit und Wohnen“, „Reisen und Freizeit“, „Sprache und Kommunikation“, „Bauen und Verkehr“ (Niehoff, 2007). Es wurde deutlich, dass diese Menschen viel mehr Hindernisse im Leben verspüren, als die sichtbaren und oft besprochenen Hin- dernisse. Auch beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund, die der deut- schen Sprache oftmals nicht ausreichend mächtig sind, begegnen vor allem auf sprachlicher Ebene regelmäßig kaum überwindbare Hürden. Der Begriff Barrierefrei- heit ist also nicht wie vielerorts angenommen einfach ein neuartiger Modebegriff für „behindertengerecht“, sondern impliziert den Grundgedanken „Gestalten für alle“, nicht nur für behinderte Menschen. Heiden (2006) bringt an, dass Barrierefreiheit als die Basis der aus den USA stammenden „Design für alle“ Idee gesehen werden kann (in den USA: Universal Design, in Europa hauptsächlich Design for all) (Heiden, 2006 S. 205). „[Diese strebt] eine Gestaltung für alle, keine separierenden, ausgrenzenden, speziellen Lösungen für spezielle Gruppen von Behinderten (fabb 2006, zit. nach Reutlinger und Lingg 2011, 281), sondern eine breite Nutzbarkeit für Menschen mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten [an]“ (Reutlinger, et al., 2011 S. 281). 1989 wurde das „Center of Universal Design“ an der Universität in North Caro- lina gegründet an der eine offizielle Definition von „Universal Design“ entstand:
„Universal Design ist das Design von Produkten und der gestalteten Umwelt zur Nutzbarkeit für alle Menschen in höchst möglichem Umfang, ohne das Erfordernis einer Anpassung oder eines besonderen Design“ (Heiden, 2006 S. 208). „Ziel des Universal Design ist es, das Leben für alle Menschen zu erleichtern. Dies wird er- reicht, indem die Produkte, die Kommunikationsmittel und die gestaltete Umwelt besser von so vielen Menschen wie möglich genutzt werden können und das mit nur wenig oder überhaupt keinen Mehrkosten. Von Universal Design profitieren Men- schen jeden Alters und allen Fähigkeiten“ („Center für Universal Design“ 2006 zit. nach Heiden 2006, 209). Dass das „Design für alle“ durchaus seinen Nutzen hat, zeigt eine Studie des Bundeswirtschaftsministeriums: Für etwa zehn Prozent ist ein barrierefreier Zugang zur Umwelt zwingend erforderlich, für etwa 30-40 Prozent not- wendig und für 100 Prozent komfortabel (Heiden, 2006 S. 205).
Winter erläutert zum Universal Design, dass hier erkannt wird, dass die Vielfalt der Menschheit einer mannigfaltigen Gestaltung der Umwelt bedürfe und die Idee zu einer höheren Lebensqualität beitragen könne (Winter, 2010 S. 27). Sie greift in ihrer Arbeit eines der sieben Prinzipien des Universal Design auf, das Prinzip der „einfachen intuitiven Nutzung“. Dieses besagt, dass unnötige Komplexität von Sachverhalten vermieden und den Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden sollten (ebd.). Dies greift im Hinblick auf das Thema dieser Arbeit.
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Barrierefrei[heit] eine soziale Dimension [ist]. Es bedeutet gleiches Recht und gleiche Pflicht für alle Menschen. Jeder soll gleichberechtigt, selbstbestimmt, selbstständig leben können“ (Philippen 1998, o.S. zit. n. Peter 2003, 54). Dieses Verständnis veranschaulicht, dass das Ziel Barrieref- reiheit nicht durch bloße Umsetzungen von Normen erreicht werden kann. Vielmehr bedarf es eines Umdenkens, das wiederum „langen Atem“ (Peter, 2003 S. 54) erfor- dert (Winter, 2010 S. 26).
3.3 Gesetzliche Rahmenbedingungen
Teilhabe und Barrierefreiheit erhielt seit einigen Jahren Einzug in die Gesetzgebungen, sowohl auf EU- als auch auf Bundesebene. „Von der paternalistischen Fürsorge zu sozialer Teilhabe in Selbstbestimmung“ (Rohrmann, 2006 S. 175) - Selbstbestimmung und Teilhabe statt Bevormundung. Dies ist der angestrebte und zunehmend betonte Paradigmenwechsel in der Bundesrepublik (Winter, 2010 S. 19). Im Folgenden werden nun diese Gesetze aufgeführt und kurz erläutert. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf Paragraphen gelegt, die auf das Thema leichte Sprache und Information angewendet werden können.
Völkerrechtliche Ebene - Die UN-Behindertenrechtskonvention
Am 24. Februar 2009 ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland die UNBehindertenrechtskonvention (BRK). Sie verpflichtete sich hiermit, zusammen mit den anderen Vertragsstaaten, „den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern“ (BRK, Art. 1).
Dabei ist entscheidend anzumerken, dass es sich hier nicht um „leere Phrasen“ handelt, da die UN-Konvention einen „nationalen Überwachungsmechanismus“ zur Überprüfung der Umsetzung vorsieht (Schulze, 2009 S. 21).
Vor allem in Artikel 9 wird zur Zugänglichkeit festgelegt, dass Menschen mit Behinderungen eine „unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen zu ermöglichen [ist]. Außerdem verpflichten sich die Vertragsstaaten unter anderem, Menschen mit Behinderungen „den gleichberechtigten Zugang zu [..] Information und Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen [..] zu gewährleisten (BRK, Art. 9).
Bundesebene - Das Grundgesetz
Auf Bundesebene ist als höchstes Gesetz zunächst das Grundgesetz (GG) zu er- wähnen. Nach Artikel 3 des Grundgesetzes darf „niemand wegen seines Ge- schlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachtei- ligt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (GG Art.
3). Dieser Artikel zeigt dass die uneingeschränkte Teilhabe für alle Menschen ein Grundrecht der Bundesrepublik Deutschland darstellt.
Das oberste Ziel des neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX) aus dem Jahre 2001 ist es, „die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Familie, den Beruf und in das tägliche Leben zu fördern. Die Begriffe „Selbstbestimmung“ und „gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe“ werden aufgrund dessen auch durch den ganzen Gesetzestext immer wieder genannt.
Nach der Aufnahme des Benachteiligungsverbots für Behinderte 1994 in das Grund- gesetz wurde die Diskussion um ein Antidiskriminierungsgesetz für Behinderte grö- ßer (Frehe, et al., 2012 S. 85). Doch trotz allem trat das Behindertengleichstellungs- gesetz erst am 1.5.2002 in Kraft und formuliert das Ziel, „die Benachteiligung von behinderten Menschen zu beseitigen und zu verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten Menschen am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen“ (BGG, § 1). Das BGG wird vielerorts als das „Herzstück“ (Degener, et al., 2003 S. 155) des deut-schen Behindertengleichstellungsrechts bezeichnet. Da sich einige Rechtsbereiche
jedoch dem Bundesgesetz aufgrund des Föderalismus entziehen und die Vorschriften des BGG ausschließlich für Bundesbehörden oder Landesbehörden die Bundesrecht ausführen verpflichtend sind, zogen die Länder in den Jahren danach recht zügig mit Ländergleichstellungsgesetzen, die in der Regel dasselbe oder zumindest im Wesentlichen den Vorschriften des BGG folgen, nach.
Das Behindertengleichstellungsgesetz definiert Barrierefreiheit zum ersten Mal nicht nur im Hinblick auf bauliche Barrieren, sondern auch auf Systeme der Informations- verarbeitung und Kommunikationseinrichtungen (Kohte, 2004 S. 27). Wie bereits dargestellt, besagt §4 BGG unter anderem, dass „Information und Kommunikation barrierefrei sind, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind“ (§4 BGG).
Hierzu gibt es eine zusätzliche Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BITV). Darin wird festgelegt, wie Internetauftritte der Behörden sowie grafische Programmoberflächen, die öffentlich zugänglich sind, gestaltet sein müssen, um einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Punkt 3.1.3 „Ungebräuchliche Wörter“ beispielsweise besagt, dass es für ungebräuchliche Wörter Mechanismen zur Erläuterung geben soll. Im Hinblick auf Leichte Sprache formuliert die Verordnung ganz deutlich: „Für alle Inhalte ist die klarste und einfachste Sprache zu verwenden, die angemessen ist. Bei schwierigen Texten werden zusätzliche erklärende Inhalte oder grafische oder AudioPräsentationen zur Verfügung gestellt“ (31a BITV 2.0 3.1.5).
§9 BGG besagt, dass Menschen mit einer Hör- oder Sprachbehinderung ein Recht auf Gebärden oder andere geeignete Kommunikationshilfen erhalten müssen, wenn es die Durchsetzung ihres Rechts im Verwaltungsverfahren erfordert. Ähnlich legt §10 BGG fest, dass bei der Gestaltung von schriftlichen Bescheiden eine Behinde- rung zu berücksichtigen ist. Hier werden jedoch nur Blinde und Sehbehinderte expli- zit aufgeführt, die verlangen können, dass beispielsweise ein Bescheid, in einer für sie wahrnehmbaren Form und ohne zusätzliche Kosten, zugänglich gemacht wird. Das gleiche Bild zeigt sich in den Verordnungen zur „Verwendung von Gebärden- sprache und anderen Kommunikationshilfen im Verwaltungsverfahren nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)“, sowie in der „Verordnung über barrierefreie Do-kumente in der Bundesverwaltung“ und den dazugehörigen Landesverordnungen. Im Hinblick auf Leichte Sprache ist zu überlegen, ob diese nicht in diesen Paragra- phen mit aufgenommen werden sollte. Leichte Sprache kann selbstverständlich nicht mit der deutschen Gebärdensprache oder der Blindenschrift gleichgesetzt werden, da diese für sich stehende und fest definierte Kommunikationssysteme sind und eine leichte Sprache nur eine Qualität des jeweiligen Sprachsystems darstellt. Auch in der Deutschen Gebärdensprache (DGS) gibt es eine leicht verständliche Ausdruckswei- se. Doch geht es darum im Grunde auch gar nicht, da dies nur eine Einteilungsfrage ist. Leichte Sprache kann Menschen mit Lernschwierigkeiten ebenfalls, wie Gebär- den und die Blindenschrift für Nichtsprechende und Blinde Menschen, helfen, diese Informationen, die ebenfalls für die Durchsetzung ihrer Rechte notwendig sind, zu verstehen. Bisher steht, zumindest was die gesetzliche Lage angeht, ein Mensch mit Lernschwierigkeiten weitestgehend hilflos da. Auch Horst Frehe hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Er begründet das Fehlen der leichten Sprache damit, dass zu der Zeit der Gesetzesverabschiedung leichte Sprache noch nicht genügend definiert, kaum Verständnis und ein zu großer Respekt vor zu hohen Kosten vorhan- den war. Er bringt jedoch an, dass diese Argumente der Vergangenheit angehören und veröffentlicht deshalb Vorschläge, wie leichte Sprache in das BGG, das SGB I und SGB IX, das Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), das Beurkundungsgesetz so- wie in die verschiedenen Landesgleichstellungsgesetze mit einbezogen werden kann (Winter, 2010 S. 83).
Beispiel Vorschlag §11a BGG Leichte Sprache
„Menschen mit Lernschwierigkeiten haben nach Maßgabe der Rechtsver- ordnung nach Absatz 2 das Recht, mit Trägern öffentlicher Gewalt im Sinne des § 7 Abs.1 Satz 1 mündlich oder schriftlich in leichter Sprache zu kommunizieren, soweit dies zur Wahrnehmung eigener Rechte im Verwaltungsverfahren erforderlich ist. Die Träger öffentlicher Gewalt ha- ben dafür auf Wunsch der Berechtigten im notwendigen Umfang die mündliche Übertragung durch geeignete Dolmetscher in leichte Sprache oder die Übertragung von schriftlichen Dokumenten in leichte Sprache si- cherzustellen und die notwendigen Aufwendungen zu tragen“ (Frehe 2010, zit. nach Winter 2010, 84).
Um die Teilhabe über den gesetzlichen Rahmen hinaus voranzutreiben, sind unter §5 BGG sogenannte Zielvereinbarungen zwischen einem anerkannten Verband und Unternehmen oder verschiedenen Wirtschaftsbranchen möglich (§5 BGG). Diese zivilrechtlichen Verträge werden, immer mit dem Ziel der Barrierefreiheit, zum Bei- spiel auf Dienstleistungen oder ein Produkt abgeschlossen (Degener, et al., 2003 S. 157).
Für das bestehende Behindertengleichstellungsgesetz gibt es für die von den Para- graphen betroffenen Menschen die Möglichkeit, sollten sie sich in ihren Rechten die ihnen das Gesetz zugesteht, beeinträchtigt fühlen, das Verbandsklagerecht in An- spruch zu nehmen. Hier klagen Verbände (allerdings nur jene, die bereits in den Zielvereinbarungen als „anerkannter Behindertenverband“ aufgenommen wurden) stellvertretend für den beeinträchtigten Menschen gegen den Verstoß. Verbände haben außerdem die Möglichkeit, ohne eine einzelne, bereits betroffene Person bzw. ohne, dass die Verbände in ihren Rechten verletzt sind, Verstöße gegen das BGG feststellen zu lassen (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen).
Bei einer Veranstaltung anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Behinderten- gleichstellungsgesetzes mit dem Namen „In Zukunft Barrierefrei?! - 10 Jahre Behin- dertengleichstellungsgesetz (BGG)“ stellt der Vorsitzende des „Bundesverbandes Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.“ Gerwin Matysiak fest, dass das BGG den Men- schen mit Behinderungen sinnvolle Hilfsmittel an die Hand gegeben habe, um gegen Missstände vorzugehen. Da die größte Barriere für diese Menschen jedoch die Bar- riere in den Köpfen waren, sei der größte Vorteil des BGG, dass es dazu beigetra- gen habe, dass die nicht behinderte Öffentlichkeit für die Probleme der Menschen mit Behinderungen sensibilisiert wurde und wird. Kaum positive Stimmen gibt es beim Thema „Zielvereinbarungen“. Die Mehrheit der Teilnehmer ist sich einig, dass die Zielvereinbarungen gescheitert seien. Es fehle häufig an verhandlungswilligen Partnern. Verhandlungen selbst gestalteten sich oft als sehr langwierig. Darum for- dern die Teilnehmer, die Freiwilligkeit bei der Umsetzung durch mehr gesetzliche Vorschriften zu ersetzen und eine striktere Sanktionierung bei Nichteinhaltung durchzuführen (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen).
Im Bereich der barrierefreien Informationstechnik wird kritisiert, dass die Barrieref- reie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) nur für öffentlich zugängliche Seiten von Bundesbehörden gelte. Es müsse ein stärkeres Bewusstsein für barrierefreies Internet geschaffen werden und auch normale Websites, wie im Bereich des Internethandels, barrierefrei gestaltet werden (ebd.).
Grundsätzlich sollte in den Gesetzen der Behinderungsbegriff auf alle Menschen mit Beeinträchtigungen ausgeweitet werden. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben, wie oben bereits erwähnt, selten eine wirksame Stimme und somit eine fehlende Lobby. Gerade deshalb sollte sich der Gesetzgeber dessen annehmen.
Zusammenfassend kann man sagen, es existieren eine Menge Gesetze, die in der Praxis umgesetzt werden müssen. Der Grundstein, um auch Menschen mit Lern- schwierigkeiten eine gerechtfertigte Teilhabe zu ermöglichen, ist teilweise gelegt. Für die Umsetzung bedarf es jedoch Menschen, die Paragraphen mit Leben füllen, die Verantwortung übernehmen und Barrieren in den Köpfen abbauen (Schlenker- Schulte, 2004a S. 15).
4 Leichte Sprache
4.1 Ursprung und Begriffsdefinition
Jeder Mensch stand schon einmal vor dem Problem einen Text oder auch eine Rede in mündlicher Form in seiner Muttersprache ganz oder zumindest in Teilen nicht ver- standen zu haben. Eine möglichst komplizierte Ausdrucksweise ist in vielen Teilen der Gesellschaft, beispielsweise in wissenschaftlichen Arbeiten gar erwünscht. „Der Inhalt ist meist gar nicht so kompliziert. Er wird erst kompliziert gemacht - durch eine schwer verständliche Ausdrucksweise“ (Langer, et al., 2006 S. 16). „Durch die Nut- zung einer „schweren Sprache“ wird eine gesellschaftliche Ausgrenzungspolitik ge- stärkt und einer Entscheidungs- und Handlungsautonomie, nicht nur von Menschen mit Lernschwierigkeiten, entgegengewirkt“ (Rüstow, 2011 S. 71). Die Gründe für die Verwendung einer schwer verständlichen Sprache vieler Menschen sind vielfältig. Einigen ist es gar nicht bewusst, dass sie sich unverständlich ausdrücken. Andere wollen, eben genau durch diese komplizierte Sprache, Fachwissen und Fachkompe- tenz zu Tage bringen oder gar ein Nichtwissen überspielen. Ein weiterer möglicher Grund ist das Übervorteilen des Lesers bzw. Zuhörers, beispielsweise mithilfe des Kleingedruckten auf Verträgen. Außerdem wissen viele Menschen auch überhaupt nicht, wie ein leicht verständlicher Ausdruck produziert wird (Wagner, et al., 2004 S. 207).
Schwere Sprache, diesen Ausdruck verwendet vor allem die Organisation „Netzwerk Leichte Sprache“, die später vorgestellt wird, kann für viele Menschen mit Lese- und Verständnisproblemen eine Barriere darstellen. Der Personenkreis der von diesen Barrieren betroffen ist, reicht von Menschen mit Behinderungen, bis hin zu Men- schen mit Migrationshintergrund, die beispielsweise vor einem komplizierten Asylan- trag stehen. Diese Kommunikationsbarrieren können neben der geschriebenen, auch in der gesprochenen Sprache auftreten. Texte in schwerer Sprache sind jedoch sicher die größere Hürde, da hier meist nicht direkt nachgefragt werden kann, son- dern der Mensch mit dem Problem des Unverständnisses alleine gelassen wird. In etwa vergleichbar ist diese Situation damit, wenn wir auf englischsprachige Texte stoßen, unsere Englischkenntnisse dem jedoch nicht gewachsen sind. In dem Online-Wörterbuch „Wikipedia“ gibt es hierfür sogar bereits das „simple english“, bei dem
die normalen Artikel in einfaches Englisch übersetzt sind. Mit der hier besprochenen „leichten Sprache“ kann dies vor allem aufgrund der enger gefassten Zielgruppe je- doch nicht deckungsgleich gleichgesetzt werden: „Simple English Wikipedia, an ea- sy-to-read online encyclopedia for people who are learning English [..]“ (Wikipedia).
Saur (1995) mahnt, dass es sich eine demokratische Gesellschaft kaum leisten könne, bestimmten Personenkreisen Informationen aufgrund von unverständlichen Texten zu verweigern (Sauer, 1995 S. 169). Die Barriere zwischen denen der „Reichen an Information“ und denen der „Armen an Information“ stehen somit einer gleichberechtigten Gesellschaft gegenüber (Freyhoff, et al., 1998 S. 7).
Die Anfänge der „leichten Sprache“ für Menschen mit Lernschwierigkeiten (in diesem Fall hauptsächlich Menschen mit geistiger Behinderung, Anm. d. Verf.) im speziellen gehen auf das Modellprojekt „Wir vertreten uns selbst“, das vom Dezember 1997 bis November 2001 stattfand, zurück. Hier wurde von den Betroffenen selbst eine leichte Sprache eingefordert, um auch bei den Entscheidungen und Diskussionen rund um das Projekt mitreden zu können (Wessels, 2008 S. 229). Damit sich die Menschen beispielsweise bei Vorträgen bemerkbar machen konnten, um dem Redner klar zu machen, dass er schwierige Sprache verwendet hat, wurde das „StoppSchild - Halt! Leichte Sprache“ (vgl. Abbildung 2) eingesetzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2 Stoppschild "Halt! Leichte Sprache" ©Mensch zuerst http://www.people1.de/img/Halt_Leichte_Sprache_120.jpg
Kupke und Schlummer (2010) stellen fest, dass durch dieses Stoppschild ein dop- pelseitiger Lernprozess entstand, da der Zuhörer die Thematik versteht und der Redner lernt, sich einfacher auszudrücken (Kupke, et al., 2010 S. 68). 2006 entstand das „Netzwerk leichte Sprache“. Es besteht aus Mitgliedern aus Deutschland und Österreich. Verschiedene Vereine und Wohlfahrtsverbände (bspw. die Lebenshilfe oder die Caritas) und Einzelpersonen kämpfen hier für mehr leichte Sprache. Sie übersetzen in leichte Sprache, informieren darüber, bieten Schulungen an und kämpfen für die gesetzliche Festlegung des Rechts auf leichte Sprache. Hierzu gab es 2009 die bereits angesprochene Unterschriftenaktion an der sich über 13.000 Menschen beteiligten, um sich im Bundestag Gehör zu verschaffen (Netzwerk Leichte Sprache). Ebenfalls Mitglied im „Netzwerk Leichte Sprache“ ist „Mensch zu- erst - Netzwerk People First Deutschland e.V.“. Dieser Verein ist der Herausgeber des Wörterbuchs für Leichte Sprache. In dem Wörterbuch werden über 400 Begriffe in leichter Sprache erklärt. Außerdem enthält es einen Regelkatalog, der durch das „Netzwerk Leichte Sprache“ ausgearbeitet wurde. Diese Regeln, die in dieser Arbeit noch kritisch beleuchtet werden, wurden 2008 in etwas abgewandelter Form vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen für einen Leitfaden für die Erstellung von Briefen und Veröffentlichungen in leichter Sprache im Amt verwendet. So wird in der Einleitung durch das Ministerium sogar die Garantie erho- ben, „die Grundsätze der Leichten Sprache in allen seinen Briefen und Veröffentli- chungen [zu] verwirklichen“ (Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz, 2008 S. 6). Dies verdeutlicht, dass die Initiativen der Verbände durchaus Früchte tragen. Auch auf europäischer Ebene erhielt dieses Thema bereits Einzug. Im Jahr 1998 veröffentlichte die „Formely International Lea- gue of Societies for Persons with Mental Handicap“ (kurz: ILSMH) die „Europäischen Richtlinien für die Erstellung von leicht lesbaren Informationen für Menschen mit geistiger Behinderung“. Eine Gruppe von vier Experten aus vier europäischen Län- dern haben hier, vornehmlich für Menschen mit geistiger Behinderung, aber auch für andere Menschen mit Verständnisschwierigkeiten, Regeln für leichte Lesbarkeit auf- gestellt. Diese sind, da sie in jedem Zusammenhang in der EU angewendet werden können sollen, relativ neutral formuliert und sollen den Regierungen und Organisati- onen bei der Bereitstellung von leicht lesbaren Informationen Unterstützung leisten (Freyhoff, et al., 1998 S. 7).
Ein Symbol für Leichte Sprache entwickelte die gemeinnützige Organisation „Inclusion Europe“. Sie setzt sich auf europäischer Ebene für die Rechte und Belange von Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren Familien ein.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dennis Kaiser (Autor:in), 2013, Planung einer Online-Enzyklopädie in leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/268932
Kostenlos Autor werden

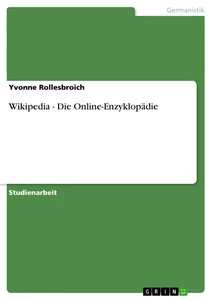



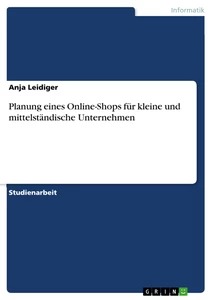










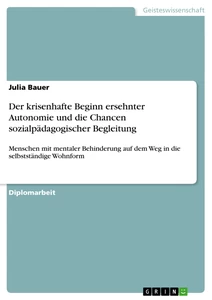





Kommentare