Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Sara Stöcklin (2005): "Zur Freiheit verurteilt" - Eine Untersuchung von Sartres Freiheitsbegriff
Einleitung
Quellen
Der Ursprung der Freiheit
Was ist Freiheit?
Zur Freiheit verurteilt?
Schluss
Bibliographie
Martin Feyen (2003): Sartre und das Nichts
Einleitung
Sartre und das Nichts
Kommentar
Schluss
Literaturverzeichnis:
Agnes Uken (2001): Die existentialistische Begründung der Freiheit in Jean-Paul Sartres Werk "Das Sein und das Nichts". Existentialismus und Freiheit
Einleitung
Formen des Seins
Sein und Handeln
Schluss
Literaturverzeichnis
Kevin Liggieri (2009): Zur Freiheit verdammt - Sartres Konzeption der Freiheit und der Vergleich zur modernen Hirnforschung
Einleitung: Ist Sartre ein toter Autor?
„Ich bin dazu verurteilt, frei zu sein.“ - Sartres Philosophie der Freiheit
Sartre und die moderne Hirnforschung: Ist Freiheit Illusion?
Ich würde nicht schreiben aus Freude am Schreiben
Literaturverzeichnis
Nina Strehle (2002): Der Blick und das Schamgefühl in Jean-Paul Sartres Werk "Das Sein und das Nichts"
Einleitung
Der Andere
Der Blick
Das Schamgefühl
Objektivierung des Andern
Literatur
Einzelpublikationen
Sara Stöcklin (2005): "Zur Freiheit verurteilt" - Eine Untersuchung von Sartres Freiheitsbegriff
Einleitung
Der Mensch ist dazu verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, und dennoch frei, weil er, einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut. (EH 155)
In diesem berühmten Zitat aus dem Essay „Der Existentialismus ist ein Humanismus“ fasst Jean-Paul Sartre den Kerngedanken seiner Philosophie zusammen: Der Mensch ist Freiheit. Ohne Halt, ohne vorgegebene Werte und ohne Entschuldigungen muss er vor sich selbst verantworten, was er ist und tut. Allen deterministischen Strömungen der Philosophie und Naturwissenschaften zum Trotz verwirft und widerlegt Sartre den Gedanken, dass der Mensch von seiner Umwelt, seiner Gesellschaft, seinem Charakter oder seinem natürlichen Wesen zu dem gemacht wird, was er ist. Die Fülle an Schriften, die er uns hinterlassen hat, ist seit ihrer Entstehung eine wahre Goldgrube für Philosophierende, die sich mit der Beschaffenheit der menschlichen Existenz auseinandersetzen.
Obwohl der Existentialismus Sartres, erstmals ausführlich dargelegt in seinem frühen philosophischen Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“, in erster Linie die Strukturen des Seins behandelt, ist der Begriff der Freiheit das tragende Element eben dieser Strukturen und schimmert bei all seinen Auseinandersetzungen durch. In der folgenden Arbeit möchte ich den Freiheitsbegriff Sartres untersuchen und kritisch beleuchten. In einem ersten Teil werde ich der Frage nachgehen, wie Sartre die Freiheit des Menschen in ihrem Ursprung begründet, und mich dabei insbesondere mit seiner Widerlegung des Determinismus beschäftigen. Daraufhin werde ich seine Definition von Freiheit unter Berücksichtigung der drei Aspekte „Wesenlosigkeit“, „Erfahrung“ und „Nichtung“ untersuchen und mich anschliessend mit der Frage auseinandersetzen, warum der Mensch gemäss Sartre zur Freiheit „verurteilt“ ist. Dabei werde ich insbesondere die Begriffe der Angst, Verlassenheit und Verantwortlichkeit beleuchten und untersuchen, welche Rolle sie in seiner Argumentation spielen.
Quellen
Als Hauptquellen für meine Untersuchung werden mir der Essay „Der Existentialismus ist ein Humanismus“ (EH) und der vierte Teil von Sartres frühem philosophischem Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“ (SN) dienen. „Der Existentialismus ist ein Humanismus“ [L’existentialisme est un humanisme] ist die leicht veränderte Fassung eines Vortrags, den Sartre 1945 hielt. Der Text erregte grosses Aufsehen und trug wesentlich zur Verbreitung seines Denkens bei. Da er die Anliegen des Existentialismus jedoch stark vereinfacht, bereute Sartre später seine Drucklegung.[1]
„Das Sein und das Nichts“ [L’être et le néant] trägt den Untertitel „Versuch einer phänomenologischen Ontologie“ und liefert eine umfassende Untersuchung von den verschiedenen Seinsstrukturen, von der Beziehung des Menschen zu anderen, aber in erster Linie zu sich selbst. Das umfangreiche Werk, erstmals 1943 erschienen, besteht aus vier Teilen, von denen sich insbesondere der Letzte mit der Freiheit des menschlichen Handelns und der menschlichen Verantwortlichkeit auseinandersetzt.
Der Ursprung der Freiheit
Warum ist der Mensch frei? Sartre führt ein „inneres“ Argument für die Freiheit ins Feld, um anschliessend äussere Argumente daraus abzuleiten. Das „innere“ Argument möchte ich die „Bedingung zur Möglichkeit“ der Freiheit nennen; es handelt sich dabei um die Nicht-Existenz Gottes. Sartre kann diese zwar nicht beweisen, setzt sie aber als Fundament und Axiom seines Freiheitsgedankens voraus. Das erste äussere, konkrete Argument kann mit Sartres eigenen Worten „Die Existenz geht der Essenz voraus“ (EH 149) betitelt werden und versucht, auf kohärente Weise die Konsequenz aus der Nicht-Existenz Gottes zu ziehen. Das zweite Argument besteht in der Widerlegung des Determinismus.
Die Nicht-Existenz Gottes
Und wenn wir von Verlassenheit sprechen […], wollen wir nur sagen, dass Gott nicht existiert und dass man daraus bis zum Ende die Konsequenzen ziehen muss. (EH 154)
Für Sartre und seine Philosophie ist die Nicht-Existenz Gottes eine absolute Notwendigkeit. Insbesondere sein Freiheitsbegriff ist darauf aufgebaut und davon abhängig, doch da die Freiheit das tragende Element seines ganzen Gedankengebäudes ist, würde dieses unter einem Gottesbeweis vollständig zusammenbrechen. So wie Kant die Existenz Gottes notwendig postuliert, muss Sartre die Nicht-Existenz Gottes notwendig postulieren. Obwohl Sartre den Begriff „Gott“ hier nicht spezifiziert, geht aus dem Zusammenhang klar hervor, dass eine Instanz ausserhalb unserer selbst gemeint ist, die uns geschaffen und ein Wesen gegeben hat, die Werte festsetzt und vor der wir uns verantworten müssen. Sartre ist sich der Konsequenzen, die eine „Abschaffung“ Gottes mit sich bringt, durchaus bewusst:
Der Existentialist denkt […]: es ist sehr unangenehm, dass Gott nicht existiert, denn mit ihm verschwindet jede Möglichkeit, Werte in einem intelligiblen Himmel zu finden; es kann kein a priori Gutes mehr geben, da es kein unendliches und vollkommenes Bewusststein gibt, es zu denken. (EH 154)
Dostojewski schrieb: „Wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt.“ Das ist der Ausgangspunkt des Existentialismus. (EH 154f)
Wenn zum andern Gott nicht existiert, haben wir keine Werte oder Anweisungen vor uns, die unser Verhalten rechtfertigen könnten […]. (EH 155)
Sartre argumentiert im Namen der „Wahrheit“. Er hält es für einfach und angenehm, an Gott zu glauben und aus diesem Glauben Werte, Richtlinien und Grenzen zu beziehen. Er hält es auch für schwierig und beängstigend[2], anstelle von Gott die Rolle des Gesetzgebers zu übernehmen und Werte zu wählen. Dennoch glaubt er schlicht und einfach, dass Gott nicht existiert, und will sein Leben folglich in Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit nach der für ihn bestehenden Wahrheit, und nicht nach einem Wunschbild, ausrichten. Auf den Vorwurf, selbstgerecht über Gut und Böse zu entscheiden, antwortet er:
Es ist mir sehr unangenehm, dass es so ist; aber da ich Gottvater beseitigt habe, braucht es ja wohl jemanden, die Werte zu erfinden. (EH 174)
Sartre möchte „den Menschen daran erinnern, dass es keinen anderen Gesetzgeber als ihn selbst gibt und dass er in der Verlassenheit über sich selbst entscheidet“ (EH176). Diese Erkenntnis, die sich durch die existentiellen Gefühle der Angst und Verzweiflung jedem Menschen aufdrängt[3], mag schmerzhaft sein, entspricht aber der Wahrheit. Sie zu verdrängen bedeutet, der menschlichen Realität auszuweichen und ein Leben in Unaufrichtigkeit zu führen.
Die Erkenntnis der Nicht-Existenz Gottes muss jedoch nicht nur Verzweiflung beinhalten. Angesichts der „Schlechtigkeit“ der Welt ist der Mensch vor eine neue Situation gestellt:
Denn in diesem Falle müsste man erfinden, verbessern, und der Mensch wäre wieder Herr seines Schicksals mit einer beängstigenden, unaufhörlichen Verantwortung. (BJ 127)
Die Bedingung zur Möglichkeit der Freiheit ist mit der Nicht-Existenz Gottes gegeben: Der Mensch ist nicht fremdbestimmt durch eine Instanz ausserhalb seiner selbst. Die wesentliche Konsequenz aus diesem Gedanken und damit weitergehende Begründung für die menschliche Freiheit zieht Sartre in der Aussage „Die Existenz geht der Essenz voraus“ (EH 149).
Die Existenz geht der Essenz voraus
Was ist darunter zu verstehen, dass die Existenz der Essenz oder dem Wesen vorausgeht? Sartre selbst bedient sich eines Beispiels, um seine Aussage zu verdeutlichen. Man stelle sich einen Handwerker vor, der einen Brieföffner herstellt. Er hat ein klares Bild vor Augen, wie dieser Brieföffner aussehen und was für einen Nutzen er haben soll. Mit dieser festen Vorstellung macht er sich an die Arbeit und bedient sich bestehender „Herstellungsverfahren“ (EH 148), um sicherzugehen, dass der Brieföffner dem von ihm vorherbestimmten Zweck dienlich sein wird. Aus diesem Beispiel geht klar ersichtlich hervor, dass bei Gegenständen dieser Art das Wesen der Existenz vorausgeht. Zuerst ist die „Idee“, d. h. die Gesamtheit aller Eigenschaften und Herstellungsverfahren, die den Begriff „Brieföffner“ definieren und als reine Vorstellung im leeren Raum steht. Dann erst greift der Handwerker zu seinem Werkzeug und bringt den Gegenstand zur Existenz. Das Wesen des Brieföffners erhält nun seinen materiellen „Körper“, seine Objekthaftigkeit.
Wenn es nun einen Schöpfer-Gott gibt, lässt sich dieser als eben so ein Handwerker denken. Er hat eine Vorstellung des Menschen, seiner Eigenschaften und Zwecke, und er kennt das Verfahren, ihn herzustellen. Das Wesen des Menschen ist schon in Gottes souveränem Plan enthalten, ehe er ihn in die Existenz ruft. Das Streben des Menschen gilt in diesem Falle der Suche nach seinem eigenen ursprünglichen Wesen, nach der Vorstellung, die Gott vor Anbeginn der Zeit von ihm hatte, und dessen Verwirklichung sein Ziel und seine Erfüllung darstellt. Auf dieses Wesen kann er sich berufen, sich daran festhalten, sich aber auch damit entschuldigen. Denn es ist ihm gegeben und war schon festgelegt, ehe er überhaupt materiell existierte.
Sartre wirft Philosophen des 18. Jahrhunderts wie Diderot und Voltaire vor, sich zwar von Gott abgewandt, die Idee von einer Wesenheit des Menschen aber dennoch nicht beseitigt zu haben. Er geht einen Schritt weiter:
Der atheistische Existentialismus, den ich vertrete, ist kohärenter. Er erklärt: wenn Gott nicht existiert, so gibt es zumindest ein Wesen, bei dem die Existenz der Essenz vorausgeht, ein Wesen, das existiert, bevor es durch irgendeinen Begriff definiert werden kann, und dieses Wesen ist der Mensch […]. (EH 149)
Was bedeutet hier, dass die Existenz der Essenz vorausgeht? Es bedeutet, dass der Mensch erst existiert, auf sich trifft, in die Welt eintritt, und sich erst dann definiert. (EH 149)
Da der Mensch nicht von einer Instanz ausserhalb seiner selbst definiert wird, muss er erst existieren, bevor er sich selbst gegenüberstehen und sein eigenes Wesen bestimmen kann. Gemäss Sartre gibt es „keine menschliche Natur, da es keinen Gott gibt, sie zu ersinnen“ (EH 149). Definiert der Mensch aber sein eigenes Wesen, so definiert er auch seinen Charakter, seinen Wert und seinen Sinn. Er erschafft sich, in dem er sich von sich selbst loslöst und sich selbst transzendent gegenübertritt – dann erst kann er den „Entwurf“ von sich selbst gestalten, den der Handwerker schon vor der Existenz seines Produktes wählt. Der Mensch ist sein eigener Gott, er ist Transzendenz (vgl. EH 175). Diese Stellung, die der Mensch sich selbst gegenüber hat, birgt eine ungeheure Verantwortung, ist aber die Grundlage der Freiheit. Der Mensch ist frei, weil die Existenz der Essenz vorausgeht, und die Existenz geht der Essenz voraus, weil es keinen Gott gibt. Dies ist der Grundgedanke von „Das Sein und das Nichts“, und im Zusammenhang mit diesem Gedanken führt Sartre die in seiner Philosophie zentralen Begriffe „Für-sich-sein“ und „An-sich-sein“ ein. Das „Für-sich-sein“ ist das transzendente, durch das Bewusstsein bestimmte Sein, das von sich selbst Abstand nimmt und sich definiert. Das „An-sich-sein“ ist das vom Bewusstsein unabhängige, objekthafte Sein der Dinge. Wenn der Mensch seine eigene Freiheit nicht anerkennen will, wenn er sich weigert, die Verantwortung für sein Sein und Handeln zu übernehmen, so reduziert er sich auf das „An-sich-sein“ und macht sich selbst zu einem blossen Objekt.[4] Diese Haltung ist jedoch nichts weiter als ein Versuch der Selbsttäuschung. In Wahrheit, so Sartre, kann der Mensch der Realität nicht ausweichen, dass er sowohl „Für-sich“ als auch „An-sich“ ist, sowohl Subjekt als auch Objekt, und somit absolut frei über sich selbst entscheiden und verfügen kann.
Was bedeutet es konkret für den Menschen, dass er kein festgesetztes Wesen hat, sondern frei über dieses entscheiden muss? In erster Linie bedeutet es, dass seine Existenz zufällig ist und keinen von Aussen konstituierten Sinn in sich trägt:
[…] das Leben hat a priori keinen Sinn. Bevor Sie leben, ist das Leben nichts, es ist an Ihnen, ihm einen Sinn zu geben, und der Wert ist nichts anderes als dieser Sinn, den Sie wählen. (EH 174)
Weiter bedeutet es, dass er auf keine schon existierenden Werte und Gesetze zurückgreifen kann, wenn er moralische Urteile fällen will:
[…] weil wir den Menschen daran erinnern, dass es keinen anderen Gesetzgeber als ihn selbst gibt und dass er in der Verlassenheit über sich selbst entscheidet. (EH 176)
Da auch kein Charakter a priori besteht, kann sich der Mensch nur über sein eigenes Handeln definieren:
[…] der Mensch ist nichts anderes als das, wozu er sich macht. (EH 150)
Wirklichkeit ist nur im Handeln […]: der Mensch ist nichts anderes als sein Entwurf, er existiert nur in dem Masse, in dem er sich verwirklicht, er ist also nichts anderes als die Gesamtheit seiner Handlungen, nichts anderes als sein Leben. (EH 161)
Der Mensch muss seinen eigenen „Entwurf“ wählen. Er ist sein eigener Handwerker, mit dem Unterschied, dass er als Objekt schon existiert und nun nur noch darüber entscheiden muss, was für einen Sinn er sich selbst verleiht. Der Sinn darf sich jedoch nicht auf etwas ausserhalb des Menschen selbst beziehen – denn mit Sartres Argumentation gibt es in diesem „Ausserhalb“ nichts, an dem sich der Mensch festhalten könnte. Tatsächlich kann nur das eigene Tun und Handeln seiner Existenz Sinn verleihen. Zum Helden wird niemand von Aussen gemacht:
Der Existentialist jedoch sagt, dass der Feigling sich zum Feigling macht, der Held sich zum Helden macht; es gibt immer eine Möglichkeit für den Feigling, nicht mehr feige zu sein, und für den Helden, aufzuhören, ein Held zu sein. (EH 164)
Der Mensch ist eben gerade deshalb frei, weil er nicht von Aussen zu dem gemacht wird, was er ist. Er muss seine Identität völlig aus sich selbst beziehen. Dabei kann er sich dieser Freiheit nicht entziehen – er kann die Verantwortung für sich selbst und sein Tun weder verweigern noch abschieben.
In der Aussage, dass der Mensch die Fähigkeit hat, von sich selbst Abstand zu nehmen und sich zu definieren, und es gleichzeitig keine äussere Instanz gibt, die ihm diese Aufgabe vor oder während seiner Existenz abnehmen könnte, liegt Sartres grundlegender Beweis für die Freiheit. Er muss jedoch noch einen Schritt weiter gehen. Denn auch wenn es keinen Gott gibt, der das Wesen des Menschen festlegt, und dieser Selbstreflexion üben kann, ist noch nicht die Freiheit im Handeln selbst bewiesen. Der Determinismus, gegen den Sartre antritt, behauptet, dass der Mensch nichts weiter als ein Glied der grossen Kette von Ursache und Wirkung ist und sein jegliches Handeln durch innere und äussere Einflüsse bestimmt wird. Der Widerlegung dieser Theorie, welche in direktem Gegensatz zu Sartres Philosophie steht, widmet dieser denn auch grosse Aufmerksamkeit und Sorgfalt.
Widerlegung des Determinismus
Die einen, die aus einem Geist der Ernsthaftigkeit heraus oder mit deterministischen Entschuldigungen ihre totale Freiheit nicht wahrhaben wollen, werde ich Feiglinge nennen […]. (EH 172)
[…] anders gesagt, es gibt keinen Determinismus […]. (EH 155)
Diesen vorwiegend polemischen Aussagen in „Der Existentialismus ist ein Humanismus“ geht eine grundlegende Untersuchung des menschlichen Handelns in „Das Sein und das Nichts“ voraus. In seiner Argumentation setzt Sartre noch vor der menschlichen Handlung selbst an; er setzt sich vorerst mit der Voraussetzung des Handelns, mit der Situation des Handelnden auseinander. Aus der phänomenologischen Beobachtung dieser Situation zieht er zwei Schlüsse:
1. kein faktischer Zustand, wie er auch sei (politische, wirtschaftliche Struktur der Gesellschaft, psychologischer „Zustand“ usw.), kann von sich aus irgendeine Handlung motivieren. (SN 757)
2. kein faktischer Zustand kann das Bewusstsein dazu bestimmen, ihn als Negativität oder Mangel zu erfassen. (SN 757)
Beide Aussagen lassen sich anhand eines Beispiels verdeutlichen. Stellen wir uns die Situation einer Analphabetin in einer entlegenen Region Indiens vor. Da sie weder lesen noch schreiben kann, ist ihr die Möglichkeit verwehrt, Händlerin zu werden. Der Handel ist in dieser Region jedoch die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen. Folglich lebt sie in absoluter Abhängigkeit von ihrer Familie, welche ihr aufgrund ihrer sozialen Stellung nicht das Recht auf eine genügende gesundheitliche Versorgung zugesteht. Gemäss Sartres erster Aussage kann diese Situation von sich aus keine Handlung seitens der Frau motivieren. Im Gegenteil: Wenn in jener Region alle Frauen Analphabetinnen sind und in völliger Abhängigkeit leben, wird ihr unter Umständen nie auch nur die Idee kommen, an ihrem Zustand etwas zu ändern. Die Motivation zur Handlung erfordert drei Schritte seitens der Frau: Sie muss erkennen, dass es eine Alternative zu ihrer jetzigen Situation gibt, sie muss sich selbst in die Zukunft entwerfen und sie muss einsehen, dass ihre jetzige Situation nicht dem Zweck dient, den sie sich mit ihrem Lebensentwurf selbst gesetzt hat. Sartres erste Aussage bezieht sich auf die Gesamtheit dieser drei Schritte, seine zweite Aussage auf den dritten Schritt.
Wie kann die Frau erkennen, dass es eine Alternative zu ihrer Situation gibt? Für Sartre ist hier die oben beschriebene Erkenntnis grundlegend, dass der Mensch von sich selbst Abstand nehmen kann. Er kann sich selbst und seine Situation „nichten“, d. h., er kann sich selbst übersteigen und aus sich selbst die Vorstellung dessen hervorbringen, das nicht ist. Er kann sich vom „Leim des Seins“[5] lösen und über den faktischen Zustand hinaus denken. Erst die Fähigkeit, zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist, zu unterscheiden, ermöglicht eine Handlung.
Die Handlung bedingt jedoch auch den zweiten Schritt. Der Mensch handelt nur im Sinne der Zwecke, die er sich selbst gesetzt hat. Diese Zwecke hat er sich gemäss seinem Lebensentwurf gesetzt. Was beinhaltet dieser Entwurf? Meistens, aber nicht notwendigerweise, enthält er die folgenden Grundelemente: „Ich will leben. Ich will nicht leiden. Ich will glücklich sein.“ Im Falle der Analphabetin erfordert die Motivation für eine Handlung allenfalls weitere Elemente: „Ich will gesund sein. Ich will unabhängig sein. Ich will meine Fähigkeiten entfalten können.“ Der Entwurf ist die „erste“, innerste Entscheidung des Menschen über sich selbst. Er entfaltet und verändert sich mit dem Bewusstseinsstrom des Menschen und ist diesem stets unterworfen. Kein Element, auch nicht der Wunsch nach Leben, ist notwendigerweise im Entwurf enthalten:
[…] denn die schlimmsten Übel oder die schlimmsten Gefahren, die meine Person zu treffen drohen, haben nur durch meinen Entwurf einen Sinn […]. Es ist also unsinnig, sich beklagen zu wollen, weil ja nichts Fremdes darüber entschieden hat, was wir fühlen, was wir leben oder was wir sind. (SN 950)
Um die Handlung im Falle der Analphabetin letztendlich hervorzurufen, bedarf es jedoch noch eines dritten Schrittes. Der dritte Schritt ist die Verknüpfung der beiden ersten Schritte. Erst wenn sie ihre gegenwärtige Situation mit ihrem eigentlichen Lebensentwurf vergleicht, wird sie feststellen, dass sie nicht glücklich ist, und ihren Zustand ändern wollen. Zusammenfassend mit Sartres Worten:
Denn hier […] muss man zugeben, dass nicht die Härte einer Situation und die von ihr auferlegten Leiden Motive dafür sind, dass man sich einen anderen Zustand der Dinge denkt, bei dem es aller Welt besser ginge; im Gegenteil, von dem Tag an, da man sich einen anderen Zustand denken kann, fällt ein neues Licht auf unsere Mühsale und Leiden und entscheiden wir, dass sie unerträglich sind. (SN 756)
Mit dieser Argumentation legt Sartre die Freiheit bereits als „grundlegende Bedingung jedes Handelns“ (SN 758) fest; denn die erste Entscheidung hat der Mensch bereits gefällt, ehe Motive und Ursachen ins Spiel gekommen sind.
Mit dieser Voraussetzung beginnt Sartre nun, den Determinismus im Bereich des konkreten Handelns zu widerlegen. Im Gegensatz zu anderen Gegnern des Determinismus bestreitet er nicht, dass es „kein Handeln ohne Motiv“ (SN 758) gibt:
Es kann nicht anders sein, da jedes Handeln intentional sein muss: es muss ja einen Zweck haben, und der Zweck bezieht sich seinerseits auf ein Motiv. (SN 758)
Der Determinist, so Sartre, macht es sich jedoch zu leicht, wenn er seine „Untersuchung auf die blosse Angabe des Motivs oder des Antriebs“ (SN 759) beschränkt. Die wesentliche Frage ist, was ein Motiv zum Motiv macht. Sartre grenzt hier den Begriff „Motiv“ klar vom Begriff „Ursache“ ab. Eine Ursache, wie wir sie in der Naturwissenschaft finden, hat notwendigerweise eine bestimmte Wirkung. Die Situation, in die der Mensch ohne sein Zutun hineingeboren wird, zum Beispiel eine ungebildete Familie in einer abgelegenen Region Indiens, ist ebenfalls eine Ursache, die sich notwendigerweise in seinem finanziellen und kulturellen Zustand auswirkt und ihm den Ausgangspunkt vorgibt, von dem aus er sein Leben gestalten muss. Was uns jedoch in unserem täglichen Leben und in unserer gegebenen Situation begegnet, nennt Sartre „Motive“. Und während der Determinist behauptet, auf ein bestimmtes Motiv folge mit derselben Sicherheit, mit der ein bestimmtes Phänomen auf eine bestimmte Ursache folge, eine bestimmte Handlung, bringt Sartre seinen Freiheitsbegriff ins Spiel. Der Mensch, als Wesen, dessen Existenz der Essenz vorausgeht, ist das einzige Geschöpf, das sich von sich selbst losreißen und sich von den Kausalreihen lösen kann[6]. Nichts zwingt ihn, auf ein Motiv eine bestimmte Handlung folgen zu lassen, denn sein Bewusstsein verleiht dem Motiv erst dessen Bedeutung[7]. „Um nämlich Motiv sein zu können, muss das Motiv als solches empfunden werden“ (SN 759). Auch wenn dieser Prozess nicht notwendigerweise auf der Ebene der Erwägung und Reflexion stattfinden muss, ist die Tatsache nicht zu umgehen, dass das „Für-sich“ das Motiv erst als Motiv oder Antrieb konstituieren muss. Wenn ich schlechte Arbeitsbedingungen hinnehme, so ist mein Motiv dafür, dass ich Angst habe, zu verhungern. Ich habe jedoch nur Angst, zu verhungern, weil ich mich dazu entschieden habe, leben zu wollen. Dass das Leben einen Wert hat, habe ich so bestimmt – genauso wie ich bestimmen könnte, dass es keinen hat. Motive und Antriebe haben nur innerhalb meines Gesamtentwurfs einen Sinn.
Äußere Motive wie Erfahrungen oder gar Wunderzeichen bilden für Sartre ebenso wenig eine Ausnahme wie gemeinhin der menschlichen Natur zugeschriebene Motive wie Charakter, Gefühle und Leidenschaft. Erfahrungen beeinflussen, aber determinieren nicht.[8] Als Mensch habe ich die Freiheit, gewisse Schlüsse aus der Vergangenheit zu ziehen – genauso kann ich jedoch beschliessen, diese Schlüsse nicht zu ziehen. In meiner besonderen Stellung in der Welt habe ich die Macht, aus der Kausalkette auszubrechen. Was „Zeichen“ anbelangt, so sind sie ebenso menschlicher Interpretation bedürftig wie jedes andere Geschehnis, das uns in die eine oder andere Richtung lenken will:
Der Existentialist meint genauso wenig, der Mensch könne Hilfe finden in einem auf Erden gegebenen Zeichen, das ihm eine Richtung weist; denn er denkt, der Mensch entziffert das Zeichen, wie es ihm gefällt. (EH 155)
Wenn ein Engel zu mir kommt, was beweist, dass es ein Engel ist? Und wenn ich Stimmen höre, was beweist, dass sie vom Himmel und nicht aus der Hölle kommen, oder aus dem Unterbewussten oder von einem pathologischen Zustand? Wer beweist, dass sie sich an mich wenden? […] Wenn eine Stimme sich an mich richtete, werde immer ich es sein, der entscheidet, diese Stimme sei die des Engels […]. (EH 152f)
Der Charakter ist nicht die Voraussetzung des Handelns, sondern das Ergebnis[9]. Ich selbst schaffe ihn als Filter, der mögliche Motive für mein Handeln bewertet und als solche konstituiert. Auch Gefühle und Leidenschaft verlieren ihre sonst so gewichtige Position bei Sartre:
Der Existentialist glaubt nicht an die Macht der Leidenschaft. Er wird nie meinen, eine schöne Leidenschaft sei eine alles mitreissende Flut, die den Menschen schicksalhaft zu bestimmten Taten zwingt und daher eine Entschuldigung ist. Er meint, der Mensch ist für seine Leidenschaft verantwortlich. (EH 155)
Die Leidenschaft ist demnach kein Trieb, dem der Mensch wehrlos gegenübersteht. Im Gegenteil, er kann dafür verantwortlich gemacht werden. Er entscheidet sich, ein leidenschaftlicher Mensch zu sein, seinen Gefühlen Gewicht zu geben und sie als Motive zuzulassen. Er benutzt sie sogar, um die Zwecke zu erreichen, die er sich in Übereinstimmung mit seinem Lebensentwurf gesetzt hat:
So ist die Freiheit, da sie mit meiner Existenz gleichzusetzen ist, Grundlage der Zwecke, die ich, sei es durch den Willen, sei es durch Leidenschaften, zu erreichen suche. (SN 770f)
Sartre fühlt sich mit dieser Argumentation dem Determinismus immer einen Schritt voraus, da er seine Grundlage angreift. Er wirft ihm vor, mit seiner Zurückweisung der Freiheit zu versuchen, den Menschen auf das „An-sich“ zu reduzieren (vgl. SN 764). Im deterministischen Weltbild ist der Mensch ein Objekt unter Objekten, nichts weiter als ein Glied der langen und verzweigten Kausalkette. Motive werden fälschlicherweise als eigenständige Dinge verstanden und die Tatsache ausgeblendet, „dass ihre Natur und ihr Gewicht in jedem Moment von dem Sinn abhängen, den ich ihnen gebe“ (SN 764).
Was ist Freiheit?
Wie soll man also eine Existenz beschreiben, die sich ständig macht und die sich weigert, in eine Definition eingeschlossen zu werden? Schon die Bezeichnung „Freiheit“ ist gefährlich, wenn dabei mitgemeint sein soll, dass das Wort auf einen Begriff verweist, wie es Wörter gewöhnlich tun. Undefinierbar und unbenennbar, wäre die Freiheit also unbeschreibbar? (SN 761)
Wer eine allgemeine Definition von Freiheit bei Sartre sucht, wird nicht fündig. Freiheit ist nicht definierbar, sondern bloß beschreibbar. In seiner Begründung dieser Aussage beleuchtet Sartre drei Aspekte: Die Wesenlosigkeit der Freiheit, die Freiheit als Erfahrung und die Freiheit als „Nichtung“. In der Wesenlosigkeit der Freiheit liegt die Begründung dafür, dass diese nicht definiert werden kann. In den Aspekten der Erfahrung und der Nichtung liegt die eigentliche Beschreibung der Freiheit. Die Beschreibung ist jedoch keine Aufzählung von Eigenschaften, sondern eher eine „Ortung“ der Freiheit im menschlichen Bewusstsein. Sartre gibt nicht primär Auskunft darüber, was Freiheit ist, sondern erklärt uns, wo sie zu finden ist.
Freiheit ist wesenlos
Die Freiheit aber hat kein Wesen. Sie ist keiner logischen Notwendigkeit unterworfen; von ihr müsste man sagen, was Heidegger vom Dasein schlechthin sagt: In ihr geht die Existenz der Essenz voraus […]. (SN 761)
Die Freiheit lässt sich weder greifen, fassen, noch definieren. Sie hat keine Substanz, keine materielle Einheit und lässt sich nicht auf einen konkreten Begriff reduzieren. Laut Sartre hat sie kein Wesen, genauso wie der Mensch kein Wesen hat. Deshalb gilt bei ihr dasselbe wie beim Menschen: Die Existenz geht der Essenz voraus. Sie ist da, präsent, unkontrolliert und unkontrollierbar. Alles, was ein Wesen hat, setzt jemanden oder etwas voraus, welcher oder welches eben dieses Wesen konstituiert hat. Die Idee des Brieföffners setzt den Handwerker voraus, sie zu denken; das Wesen des Menschen, wenn er denn eines hätte, setzte einen Gott voraus, es festzulegen. In der Handlung beispielsweise liegt ein Wesen, welches von der Freiheit konstituiert ist. Hätte die Freiheit selbst ein Wesen, müsste dieses wiederum konstituiert sein. Dies würde, blieben wir dem Glauben an die Nicht-Existenz Gottes treu, zu einem infiniten Regress führen:
Wenn wir auf die konstitutive Potenz zurückgehen wollen, müssen wir alle Hoffnung fahren lassen, für sie ein Wesen zu finden. Dieses verlangte ja eine neue konstitutive Potenz und so weiter bis ins Unendliche. (SN 761)
Um der Beschreibung von Freiheit näher zu kommen, müssen wir folglich nicht ihr Wesen, sondern die Freiheit als „das Existierende selbst in seiner Einzelnheit“ betrachten (SN 761). Hier sind wir gezwungen, uns ganz auf eine persönliche und subjektive Ebene einzulassen; denn „ich kann gewiss nicht eine Freiheit beschreiben, die dem andern und mir selbst gemeinsam ist“ (SN 761). Die Freiheit ist keine eigenständige Grösse mit selbständigen Eigenschaften und Merkmalen. Sie hat kein Wesen, sondern ist „Grundlage aller Wesenheiten“ (SN 762), allem voran Grundlage aller Handlung. Genauso wenig wie ein eigenständiges Wesen ist die Freiheit jedoch eine Wesenseigenschaft des Menschen. Mit der Aussage „Der Mensch ist Freiheit“ (EH 155) meint Sartre nicht etwa, dass die Freiheit bloss eine Eigenschaft des Menschen sei. Sie ist weit mehr als das. Mit den Worten Christa Hackeneschs:
Der Begriff der Freiheit repräsentiert keine Essenz des Menschen als eines denkenden Wesens, er steht einzig für die Wirklichkeit der Existenz des Einzelnen […]. Freiheit ist jenseits des Wesens.[10]
Die Freiheit ist mit der Existenz des Menschen gleichzusetzen. Das Sein des Menschen, das Material, aus dem es besteht, ist Freiheit:
[…] Freiheit […] ist keine hinzugefügte Qualität oder Eigenschaft meiner Natur, sie ist ganz genau der Stoff meines Seins […]. (SN 762)
Die Wesenlosigkeit der Freiheit hindert uns jedoch nicht daran, diese wahrzunehmen. Der direkteste Weg dazu ist die Erfahrung.
Freiheit als Erfahrung
Doch es handelt sich in Wirklichkeit um meine Freiheit. Ebenso übrigens konnte es sich bei meiner Beschreibung des Bewusstseins nicht um eine gewissen Individuen gemeinsame Natur handeln, sondern nur um mein einzelnes Bewusstsein, das wie meine Freiheit jenseits des Wesens ist […]. (SN 761)
Die subjektive Ebene, auf die wir uns begeben haben, kommt in Sartres Vergleich zwischen Freiheit und Bewusstsein besonders deutlich zum Ausdruck. Freiheit ist eine persönliche Erfahrung; kein Ereignis, das uns von Außen widerfährt, sondern ein tägliches, inneres Erleben. In meinem Bewusstsein erfahre ich nur mich selbst. Ich kann niemanden daran „anschließen“ und niemals in das eines anderen eindringen. Ich erkenne mich zwar selbst im anderen wieder und muss daraus schließen, dass auch er „bewusst“ ist; wird mir jedoch die Aufgabe zuteil, das Bewusstsein zu beschreiben, kann ich nur auf mein eigenes zurückgreifen. Dasselbe gilt für die Freiheit, welche meinem Bewusstsein Zugrunde liegt. Sartre greift hier auf Descartes’ „Cogito, ergo sum“[11] zurück:
An das Cogito werden auch wir uns wenden, um die Freiheit als Freiheit, die unsere ist, zu bestimmen, als blosse faktische Notwendigkeit, das heisst als ein kontingentes Existierendes, das aber zu erfahren ich nicht umhinkann. (SN 762)
„Ich denke, also bin ich“ wird bei Sartre zu der Idee „Ich denke, als bin ich frei“. Solange ich Bewusstsein von mir selbst habe, bin ich mir auch meiner Freiheit bewusst. Dieses Bewusstsein meiner eigenen Freiheit kann ich nicht umgehen. Ich erfahre meine Freiheit notwendigerweise und bin ihr bedingungslos ausgeliefert. Alle Versuche, dies zu leugnen, zeugen gemäss Sartre von Unaufrichtigkeit, Selbstbetrug oder Feigheit. Das Bewusstsein von Freiheit zu leugnen heisst, sich selbst auf ein Objekt zu reduzieren.[12] Sartres elementarer Begriff von Freiheit rechtfertigt diese klare Haltung insofern, als Freiheit wesentlich weiter gefasst wird als eine blosse menschliche Eigenschaft oder ein „Denkmodus“. Wäre Freiheit nicht mehr als das, so könnte sie vielen Menschen abgesprochen werden. Doch die Freiheit betrifft den Menschen ist seiner einzelnen Existenz[13], ihn umfassend und bedingend.
Freiheit ist jedoch nicht nur eine innere Bewusstseinserfahrung, die sich jenseits des äusserlich Erkennbaren abspielt. Sie findet sich in jeder konkreten Situation des Handelns und Entscheidens wieder. Erst durch meine Handlungen erfahre ich das volle Ausmass meiner Freiheit:
Ich bin nämlich ein Existierendes, das seine Freiheit durch seine Handlungen erfährt […]. (SN 762)
In der Handlung vollzieht und offenbart sich die Freiheit. Sie „macht sich [selbst] zu Handlung“ (SN 761), indem sie deren Motive, Antriebe und Zwecke ordnet und aus ihnen heraus eine Entscheidung fällt. Das ganze handelnde Wesen besteht somit aus Freiheit und wird von ihr konstituiert. Die Beschreibung der Freiheit ist gleichsam die Beschreibung des handelnden Menschen. Die Welt ist der Raum seiner Freiheit[14] und setzt seinen äusseren Möglichkeiten Grenzen. Sie konstituiert die „conditio“ (EH 166), die grundlegende Situation, in der sich der Mensch befindet und die ihn beschränkt. Die absolute Freiheit befähigt ihn nicht dazu, jede Handlung auszuführen. Sie befähigt ihn jedoch dazu, jede Handlung nicht auszuführen, die ihm offen steht; „Nein“ zu sagen. Sagt er zu allem „Nein“, selbst zur Erhaltung seines Lebens, so wählt er den Tod. Die Erfahrung der Freiheit führt ihn dann sogar über das Leben hinaus.
Wir erfahren die Freiheit, die unserem Handeln Zugrunde liegt, denn auch am stärksten, wenn sie uns an unsere eigenen Grenzen führt. Stehe ich am Ufer eines reissenden Flusses, so wird mir bewusst, dass nur meine eigene Freiheit, die freie Entscheidung, am Ufer stehen zu bleiben, mich daran hindert, hineinzustürzen.[15]
Freiheit als Nichtung
Um die Freiheit „in ihrem Kern zu erreichen“ (SN 763), ist ein noch tieferes Verständnis ihrer Struktur unumgänglich. Sartre versucht, uns dieses zu ermöglichen, indem er einen dritten Aspekt der Freiheit beleuchtet. Dieser widerspiegelt und vereint wesentliche Elemente seiner existentiellen Philosophie und führt uns zu den Grundgedanken seiner Freiheitstheorie.
Grundlage ist wiederum die Fähigkeit des Menschen, von sich selbst und der objekthaften Welt Abstand zu nehmen. Durch diese Distanzierung teilt sich der Mensch in das „Für-sich“ und das „An-sich“; er ist der, der Abstand nimmt und beobachtet, gleichzeitig jedoch der, von dem Abstand genommen und der beobachtet wird. In dieser Teilung entsteht ein Bruch, ein „Nichts“. Und die Möglichkeit des „Für-sich“, diesen Bruch zu vollziehen, nennt Sartre die Möglichkeit, das „An-sich“ zu „nichten“. Wenn das „Für-sich“, das bewusste „Ich“, diese Möglichkeit in Anspruch nimmt und die besagte Distanz zu sich selber herstellt, so begibt es sich in seine wahre Bestimmung. Erst dann vollzieht es den Vorgang, der es als Mensch vom Tier unterscheidet und zur „Person“ macht; erst dann ist es:
Sein ist für das Für-sich das An-sich, das es ist, nichten. (SN 763)
Die Nichtung grenzt den Menschen von sich selbst als blossem Objekt ab. Er ist nicht mehr eins mit sich selbst, er kann sich nicht mehr völlig mit der „Festigkeit des Seins“[16] identifizieren.
In dieses Bild hinein stellt Sartre nun die Freiheit. Sie bedingt und durchwirkt jeden einzelnen der beschriebenen Vorgänge. Sie ist eins mit dem Bruch zwischen „Für-sich“ und „An-sich“, ist nicht weniger als die Nichtung selbst. Der Zufälligkeit der Existenz stellt Sartre die Freiheit entgegen[17] ; das „Für-sich“ existiert als „substanzlose Freiheit“[18] und hebt sich so von der Kontingenz der Welt ab.
Freiheit lässt sich folglich als Moment beschreiben. Sie ist das Moment zwischen mir als „Für-sich“ und mir als „An-sich“. Die Nichtung, die dieses Moment hervorruft, findet sich jedoch noch an anderer Stelle: Es existiert nicht nur ein „Nichts“ zwischen dem „Für-sich“ und dem „An-sich“, sondern auch zwischen dem „Für-sich“jetzt und dem „Für-sich“, das ich in der Zukunft sein werde. Eben dieses Nichts „das zwischen das Ich, das ich jetzt bin, und das Ich, das ich sein werde, hineingeglitten ist, ist die Freiheit, mich zu entscheiden, mich zu wählen“[19]. Die absolute Freiheit ist es, die mich nicht nur von mir als „An-sich“, sondern auch von meiner Vergangenheit und meiner Zukunft trennt. Sie trennt mich von meiner Vergangenheit, indem ich jetzt entscheide, welche Motive ich als Antrieb für künftige Handlungen zählen lasse, und sie trennt mich von meiner Zukunft, weil „das, was ich bin, nicht der Grund dessen ist, was ich sein werde“ (SN 95), und „weil überhaupt kein aktuell Existierendes genau das bestimmen kann, was ich sein werde“ (SN 95f).
Für Sartre ist Freiheit die „Grundbestimmung unserer Existenz“[20], die „Definition des Menschen“ (EH 172). Ohne sie würde sich der Mensch letztendlich nicht vom Tier unterscheiden, denn er könnte nicht bewusst über sich selbst verfügen. Über sich selbst verfügen kann er nur, indem dieses Moment zwischen ihm als „Für-sich“ und ihm als „An-sich“ besteht und einen Ausweg aus der Gefangenschaft seiner eigenen Objekthaftigkeit bietet. In der sinnlosen Zufälligkeit der Welt erhält der Mensch die Möglichkeit, etwas zu schaffen, was über die Zufälligkeit hinausgeht: sich selbst. Dazu muss er sich selbst verlassen, anschauen, und dann entscheiden, wie er sich formen und gestalten möchte. Freiheit ist die „Grundlage aller Werte“ (EH 172), weil sie dem Menschen die Werkzeuge in die Hand gibt, sich selbst zu erschaffen und zu definieren. Sie ist jedoch auch Grundlage aller Werte, weil es nebst ihr keine andere Grundlage gibt, auf die der Mensch bauen könnte. Die Möglichkeit, die sie ihm gibt, ist keine Möglichkeit, die er ablehnen könnte. Er kann nicht umhin, die Fähigkeit, von sich selbst Abstand zu nehmen, auszuüben. So stellt sich denn die Frage, ob der Mensch diese grosszügige, aber unumgängliche Freiheit überhaupt wertschätzt.
Zur Freiheit verurteilt?
Ich bin verurteilt, für immer jenseits meines Wesens zu existieren, jenseits der Antriebe und Motive meiner Handlung: ich bin verurteilt, frei zu sein. (SN 764)
Sartre ist sich im Klaren darüber, dass das Bewusstsein der absoluten Freiheit weit mehr im Menschen auslöst als die Freude, aus aller Kausalität herausgelöst zu sein. In seinen Untersuchungen beschreibt und interpretiert er die existentiellen Gefühle der Angst und Verlassenheit, die Freiheit und Verantwortung bewirken. Er stellt die Angst als den Ausgangspunkt unseres Bewusstseins dar, an dem sich uns das volle Ausmass unserer Freiheit offenbart und von dem aus die Wege in zwei verschiedene Richtungen führen. Entweder wir wählen den Weg der Unaufrichtigkeit und fliehen in deterministische Entschuldigungen, oder wir wählen den Weg der Verantwortlichkeit. Einen Weg, der Freiheit und Wahl zu entfliehen, gibt es nicht.
Angst und Verlassenheit
Für Sartre ist die Angst gleichzeitig Beweis und Konsequenz der Freiheit. Beweis, weil Angst in einer determinierten Welt grundlos wäre, und Konsequenz, weil sich in ihr die Verzweiflung offenbart, auf nichts Bestehendes zurückgreifen zu können. Angst ist in ihrer Wesensstruktur Freiheitsbewusstsein[21]. Sartre verdeutlicht dies am Beispiel des Menschen, der vor einem Abgrund steht. Dieser lässt seine Augen hinunterwandern und stellt sich seinen möglichen Sturz vor. Dabei ängstigt er sich, er schaudert. Was bedeutet nun diese Angst in ihm? Gemäss Sartre fürchtet er sich nur, weil er Möglichkeiten hat[22]:
Wenn nichts mich zwingt, mein Leben zu retten, hindert mich nichts, mich in den Abgrund zu stürzen. Das entscheidende Verhalten wird aus einem Ich hervorgehen, das ich noch nicht bin. (SN 96)
Wie weiter oben ausgeführt, ist zwischen mir als „Für-sich“jetzt und meinem zukünftigen „Ich“ ein Bruch. Das Bewusstsein dieses Bruchs ist Angst, denn ich weiss nicht, was mein zukünftiges „Ich“ morgen oder in einer halben Stunde entscheiden wird. Angst ist eine Manifestation der Freiheit[23], ist die Furcht davor, dass die Freiheit ihre „nichtende Gewalt“[24] ausübt. Keine höhere Macht, keine menschliche Natur und keine Kausalkette kann mich davor schützen, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Nichts und niemand kann mir Sicherheit geben, und niemandem kann ich die Verantwortung für mein Handeln übertragen. Meiner Angst kann ich nur bedingt entfliehen. Wenn ich den Weg der Unaufrichtigkeit wähle, übertünche ich sie mit Vorstellungen, die nicht der menschlichen Realität entsprechen. Statt die Freiheit, der sie nicht ausweichen können, als „Chance“ (SN 955) zu sehen, ziehen es die Menschen tatsächlich „die meiste Zeit“ (SN 955) vor, sie zu verleugnen.
In allem Leugnen und Entfliehen entschwindet jedoch die Tatsache nicht, dass der Mensch verlassen ist. Er ist verlassen, „weil Gott nicht existiert“ (EH 154). Die Verlassenheit geht „einher mit der Angst“ (EH 159) und macht die Freiheit letztendlich zur Last, zu der wir verurteilt sind. Allein zu sein, ohne Halt, ohne Entschuldigung, ohne Grund und ohne von Aussen verliehene Daseinsberechtigung wirft den Menschen in eine Position, der er nur selten gewachsen scheint. Trotzdem bürdet ihm Sartre die volle Verantwortung dafür auf, was er ist.
Verantwortlichkeit
Die wesentliche Konsequenz unserer vorangehenden Ausführungen ist, dass der Mensch, dazu verurteilt, frei zu sein, das Gewicht der gesamten Welt auf seinen Schultern trägt: er ist für die Welt und für sich selbst als Seinsweise verantwortlich. Wir nehmen das Wort „Verantwortlichkeit“ in seinem banalen Sinn von „Bewusstsein (davon), der unbestreitbare Urheber eines Ereignisses oder eines Gegenstands zu sein“. (SN 950)
Hier kommt Sartre einmal mehr auf den Kern seiner Freiheitsphilosophie zurück: Der Mensch ist Freiheit und trägt deshalb die volle Verantwortung für sich selbst, seine Welt und sein Handeln. Diese aus der Freiheit entstehende Verantwortlichkeit ist für Sartre „drückend“ (SN 950), weil der Mensch folglich auch die schlimmste Lebenssituation in „dem stolzen Bewusstsein, ihr Urheber zu sein“ (SN 950), annehmen muss. Hier begegnen wir einem der radikalsten, teilweise beinahe grausam anmutenden Aspekte in Sartres Gedankengebäude. Er setzt uns auseinander, dass wir selbst das schrecklichste Ereignis, das uns zustösst, selbst gewählt haben:
Was mir zustösst, stösst mir durch mich zu, und ich kann weder darüber bekümmert sein noch mich dagegen auflehnen, noch mich damit abfinden. (SN 951)
Als Beispiel erwähnt Sartre grausame Kriege und Folter. Diese erscheinen uns unmenschlich, weil wir uns für ihre Unmenschlichkeit entschieden haben. Mein Leben ist meine völlig freie Selbstwahl:
[…] wenn ich in einem Krieg eingezogen werde, ist dieser Krieg mein Krieg, er ist nach meinem Bild, und ich verdiene ihn. Ich verdiene ihn […], weil ich mich ihm immer durch Selbstmord oder Fahnenflucht entziehen konnte: diese letzten Möglichkeiten müssen uns immer gegenwärtig sein, wenn es darum geht, eine Situation zu beurteilen. (SN 951)
Gewissensbisse und Bedauern sind für Sartre ebenso unangebracht wie Entschuldigungen. Etwas wählen heisst, dessen Wert zu „bejahen“ (EH 151). Der Mensch ist Gesetzgeber und Schöpfer seiner Moral. Indem er sich selbst wählt, wählt er gleichzeitig alle Menschen: denn er hat die Werte festgelegt, die er für erstrebenswert hält. Manche seiner Entscheidungen beruhen „auf Irrtum, andere auf Wahrheit“ (EH 171). Doch stets ist es seine Wahl, mit der er sich selbst definiert und in der er sich zu dem macht, was er ist.
Hier erreichen wir wieder den Ausgangspunkt: Der Mensch ist „verurteilt, frei zu sein. Verurteilt, weil er sich nicht selbst erschaffen hat, und dennoch frei, weil er, einmal in die Welt geworfen, für all das verantwortlich ist, was er tut“ (EH 155). Die immense Verantwortung seiner Existenz bedrückt den Menschen dermassen, dass er sich tatsächlich zur Freiheit „verurteilt“ fühlt. Die Freiheit ist eine Last, die er kaum zu tragen vermag. Trotzdem bezeichnet Sartre seine Theorie als „optimistisch“ (EH 163); denn in seiner Freiheit hat der Mensch unzählige Gelegenheiten und Chancen, die er nutzen kann, um sein Leben sinnvoll zu gestalten und sich selbst eine Daseinsberechtigung zu liefern.
Schluss
Sartre geht es nicht, wie vielen anderen, darum, eine Philosophie zu entwerfen, die dem Geschmack und Strom unserer Zeit entspricht. Sein Werk lebt aus der Beobachtung des Menschen in seiner zufälligen Existenz und aus der Frage, wo in dieser Zufälligkeit noch Sinn gefunden werden kann. In der gegenwärtigen Debatte um Kausalität und Determinismus, die nicht nur Natur- und Geisteswissenschaften beherrscht, sondern insbesondere auf die Jurisprudenz einwirkt, hat Sartre nicht an Aktualität verloren. Auch wenn er nicht gerne gehört wird, stellt seine Philosophie ein grosses Fragezeichen hinter die beliebte Auffassung, der Mensch sei im Grunde weder für sich selbst, noch für das, was er mit dieser Welt angerichtet hat, verantwortlich. Seine streckenweise durchaus überzeugende Argumentation sollte uns vor Augen führen, dass in unseren grundlegendsten Entscheidungen allenfalls eine Macht und Tragweite liegt, welche unserem Handeln ein bisher ungeahntes Gewicht verleihen könnte. Wo individuelle Verantwortlichkeit in einer Gesellschaft verloren geht, reichen Entschuldigungen letztendlich nicht aus, um für den Schaden aufzukommen. Deshalb haben Sartres Argumente im heutigen Diskurs nicht nur mehr Berechtigung als gegenwärtig anerkannt, sondern eine unumgängliche Notwendigkeit.
Trotzdem bieten Sartres Grundlagen grosse Angriffsflächen. Ein Postulat wie die Nicht-Existenz Gottes mag für ein geschlossenes philosophisches System notwendig sein, ist jedoch auf Dauer nicht über alle Zweifel erhaben; insbesondere wenn es ein derart tragendes Element ist. Die grössere Angriffsfläche sehe ich jedoch in seiner radikalen Auslegung der persönlichen Verantwortlichkeit für jegliche Lebenssituation. Wenn ich gefoltert werde, leide ich dann nur, weil ich in meinem Entwurf ein schmerzfreies Leben als erstrebenswert erachte? Habe ich hier wirklich eine Wahl, oder gibt es tatsächlich Grenzen meiner Freiheit, die Sartre nicht anerkennen will? Ich mag transzendent sein, doch ich bin kein Gott, und meine Freiheit wird mein Leben lang stark eingegrenzt sein. Ein Soldat, der in den Kriegsdienst gerufen wird, mag die „Freiheit“ haben, sich als Alternative erschiessen zu lassen. Ob wir hier aber von echter, absoluter Freiheit sprechen können, sei dahingestellt.
[...]
[1] Vgl. Suhr, Martin: Jean-Paul Sartre zur Einführung, Hamburg: Junius 2001, S. 61
[2] Vgl. Kapitel 5.1.
[3] Vgl. Kapitel 5.1.
[4] Vgl. Suhr, S. 122
[5] Suhr, S. 106
[6] Vgl. Suhr, S. 106
[7] Vgl. Ebd., S. 114
[8] Vgl. Suhr, S. 76
[9] Vgl. Ebd., S. 102
[10] Hackenesch, Christa: Jean-Paul Sartre, Reinbek: Rowohlt 2001, S. 35
[11] Descartes, René: Meditationes de Prima Philosophia, Stuttgart: Philipp Reclam 1986
[12] Vgl. Kapitel 3.2.
[13] Hackenesch, S. 36
[14] Ebd., S. 36
[15] Vgl. Kapitel 5.1.
[16] Hackenesch, S. 41
[17] Vgl. Ebd., S. 41
[18] Hackenesch, S. 41
[19] Suhr, S. 112
[20] Vgl. Biemel, Walter: Jean-Paul Sartre: Die Faszination der Freiheit, in: Speck, Josef (Hrsg.): Grundprobleme der grossen Philosophen, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1982, S. 87
[21] Vgl. Suhr, S. 114
[22] Vgl. Ebd., S. 109
[23] Vgl. Suhr, S. 115
[24] Ebd., S. 116
- Arbeit zitieren
- Sara Stöcklin (Autor:in)Agnes Uken (Autor:in)Kevin Liggieri (Autor:in)Nina Strehle (Autor:in)Martin Feyen (Autor:in), 2013, Jean-Paul Sartre. Philosophie des Existenzialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266216
Kostenlos Autor werden







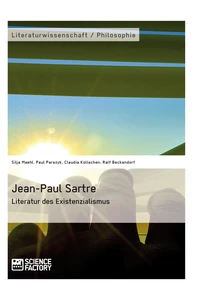






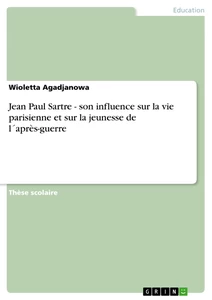

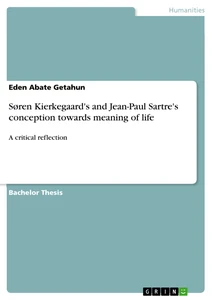

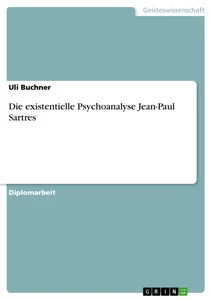



Kommentare