Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Das Konzept der deliberativen Demokratietheorie
2.1 Grundannahmen und Zielsetzung der deliberativen Demokratietheorie
2.2 Abgrenzung von Deliberation zu Abstimmungs- und Bargainingprozessen
2.3 Verschiedene Verständnisse von Deliberation
2.4 Legitimität in der Deliberativen Demokratietheorie
3. Legitimation durch Deliberation in der EU
3.1 Schaffungvontechnokratischen Aushandlungszirkeln
3.2 Verhältnis von Kommission und Ministerrat
3.3 Rolle des Parlaments
3.4 Einbezug externer Akteure durch die Kommission
4. HandlungsempfehlungenderDeliberativenDemokratietheorie
5. Zusammenfassung
Literatur
1. Einleitung
Nie gab es bisher transnationale Integrationsprozesse souveräner demokratischer Staaten mit der erreichten Intensität und Reichweite gemeinsamer und geteilter politischer Kompetenzen wie in der Europäischen Union (Huget 2007: 75). Mit entsprechend neuer Qualität und zunehmender Dringlichkeit stellt sich daher auch die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten trans- und supranationaler demokratischer Legitimation (ebd.).
In der Literatur ist die Meinungsvielfalt über die Legitimation der EU groß, doch gibt es kaum noch Stimmen, die ein Demokratiedefizit in der EU gänzlich abstreiten (Dingwerth et al. 2011: 73). Ein schwaches Parlament, eine übermächtige und nicht demokratisch gewählte Kommission, das Fehlen europaweiter Parteien und einer gemeinsamen Willensbildung - sind die oft aufgeführten Kernpunkte, des Legitimitätsdefizit in der Europäischen Union (Frisch 2007: 711). Dabei wird die These vom Legitimitätsdefizit, oft auf aus dem Nationalstaat übernommene Legitimationsmechanismen wie Parlamentarisierung, Kontrolle durch Wahlen oder eine gemeinsame Identität gestützt (ebd.).
Maßgeblich für das Ausmaß des Demokratiedefizits ist, ob die EU an bekannten nationalstaatlichen geprägten Kategorien gemessen wird, oder sie als völlig neue Form des politischen Gemeinwesens begriffen wird und daher eine Übertragung ausschließlich nationalstaatlicher Maßstäbe abgelehnt wird (Thalmaier 2005: 58f). Für eine Konzeptionalisierung von Demokratie jenseits des Nationalstaates sind nach Huget (2007: 71) aber, klassische Legitimationsmechanismen nicht anwendbar. Neben den klassischen Wegen der Legitimation wie parlamentarisch und direktdemokratisch ist deshalb zusätzlich ein dritter Weg demokratischer Legitimation europäischer Politik im Gespräch (ebd.). Dieser dritte Weg könnte die anderen ergänzen und das Demokratiedefizit lindern (ebd.). Es handelt sich um den Pfad der deliberativen Demokratie.
In dieser Arbeit werde ich daher fragen: „Wie kann die Legitimation der Europäischen Union aus Sicht der deliberativen Demokratietheorie verbessert werden?“ Dazu werde ich in Kapitel 2 klären was unter der deliberativen Demokratietheorie verstanden wird. In Kapitel 3 werde ich daran anschließend aufzeigen, an welchen Stellen in der EU bereits Ansätze für deliberative Arbeitsweisen bestehen und in Kapitel 4 Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Legitimität aus Sicht der deliberativen Demokratietheorie ableiten.
2. Das Konzept der deliberativen Demokratietheorie
Das empirische Modell der Konkurrenzdemokratie erweist sich angesichts der postnationalen Herausforderungen als 'self-defeating' (Abromeit 2002: 158). Es bleibt eng an den Staat gebunden und kann weder mit Entgrenzung, noch mit hoher Segmentierung der gesellschaftlichen Basis adäquat umgehen (ebd.). Wenn es keinen halbwegs homogenen Demos, kein funktionierendes Parteiensystem, keine identifizierbare territoriale Repräsentationsbasis gibt und wenn vor allem die Mehrheitsregel nicht anwendbar ist, dann gibt es definitionsgemäß keine Demokratie und entfällt die Möglichkeit der InputLegitimation (ebd.)
Daher ist zu fragen wie die Demokratische Kontrolle und Rückbindung von Herrschaft jenseits des etablierten Modells parlamentarischer Kontrolle erfolgen kann. Vielversprechende Antworten liefert das Konzept der deliberativen Demokratie (Kohler-Koch 2004: 223).
2.1 Grundannahmen und Zielsetzung der deliberativen Demokratietheorie
Die deliberative Demokratietheorie ist stark geprägt von von den politischphilosophischen Reflexionen der von Jürgen Habermas entwickelten Diskurstheorie, welche auf universalistische Annahmen eines Rationalisierungspotenzials sprachlicher Verständigung zurückgreift. Deliberativer Politik ist im Anschluss daran, von Jürgen Habermas als Instrument zur Erlangung „guter“ (ethischer, vernünftiger, gerechter) Entscheidungen konzipiert (Abromeit2002: 101).
Während die empirische Demokratietheorie der demokratischen Willensbildung die Funktion zuschreibt, die Ausübung politischer Macht zu legitimieren, und dem republikanischen Modell zufolge die demokratische Willensbildung das politische Gemeinwesen überhaupt erst konstituieren, gilt dem Diskursmodell die demokratische Willensbildung als eine - quasi von den Einzelakteuren - abgehobene Sphäre derVernunft (ebd.: 102).
Als Vorbild gilt hierbei die Form der Entscheidungsfindung in den Naturwissenschaften, wo es darum geht, in einem offenen wissenschaftlichen Diskurs die „Wahrheit“ herauszufinden (Göler 2006: 31f). Diese Verfahren, so die Annahme, sollten auch auf soziale Normen und kollektive Entscheidungen übertragen werden können (ebd.).
In den Überlegungen der deliberativen Demokratie kommt es daher zu einer Abwertung der gängigen „voluntaristischen Logik von Interessenverfolgung, öffentlicher Willensbildung und politischer Entscheidungsfindung“ und deren Ersetzung durch ein, diskurstheoretisches Ideal des „öffentlichen Vernunftsgebrauchs“ (Abromeit 2002: 34).
2.2 Abgrenzung von Deliberation zu Abstimmungs- und Bargainingprozessen
Die deliberative Demokratietheorie stellt daher Deliberation mit den Entscheidungsmodi „Argumentieren und Verhandeln“ als Gegenbegriff zum „Abstimmen“ ins Zentrum ihrer demokratietheoretischen Überlegungen (Martinsen 2006: 54). Weiterhin ist nach Göler (2006: 32), Deliberation vom Interaktionsmodus des Bargainings abzugrenzen. In beiden Fällen kommt man nicht über Mehrheitsentscheidungen zu einem Ergebnis, sondern es wird am Ende ein Konsens erzielt. Bei der Art und Weise wie dieser zustande kommt, unterscheiden sich beide Interaktionsformen jedoch sowohl hinsichtlich ihres konkreten Weges als auch ihrer Grundannahmen (ebd.).
Das Modell des Bargainings geht davon aus, dass die Interagierenden in den Verhandlungen darauf abzielen, ihre zuvor festgelegten Präferenzen auf der Grundlage klarer Kosten-Nutzen-Kalküle zu maximieren (ebd.). Die entscheidenden Größen für den weiteren Verhandlungsprozess sind ebendiese Präferenzen sowie die jeweilige Verhandlungsmacht der Akteure. Im Gegensatz dazu geht es den Akteuren im Modell der Deliberation nicht um die Maximierung ihrer eigenen Präferenzen, sondern um die Entwicklung eines bestmöglichen Lösungskonzepts für die zu bewältigenden Probleme (Göler 2006: 32f). Dementsprechend sollten sie in den Kommunikationsprozess weder mit fixierten Präferenzen eintreten noch externe Machtfaktoren einfließen lassen (ebd.).
Ebenso entscheidend sind aber auch die Unterschiede beim Weg der Entscheidungsfindung. Beim deliberativen Diskurs stimmen die Beteiligten dem Ergebnis letztendlich zu weil sie von ihm inhaltlich überzeugt sind (Göler 2006: 33). Hingegen kommen in Bargainingprozessen die klassischen Kompromisstechniken wie das Schnüren von Verhandlungspakten oder Zugeständnisse an anderen Stellen zum Einsatz (ebd.). Hierdurch können sich die Verhandlungspartner meist nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen bzw. das Ergebnis kommt den Präferenzen des Akteurs mit der größten Bargaining Power am nächsten. An der Problemlage gemessen bringt dieser Prozess aber nur suboptimale Ergebnisse hervor (ebd.). In deliberativen Entscheidungsverfahren sind solche Kompromissgeschäfte hingegen nicht erforderlich. Vielmehr verändern sich die Ausgangsvorstellungen der Akteure im Idealfall während des Diskurses so, dass sie am Ende miteinander in Einklang stehen und das Ergebnis schließlich von allen Beteiligten als optimal bewertet wird (ebd.).
2.3 Verschiedene Verständnisse von Deliberation
Bei der Analyse etwaiger deliberativer Entscheidungsprozesse sind, nach Göler (2007: 33), zwei Verständnisse von Deliberation voneinander abzugrenzen: „Zum einen das normative Konzept der Deliberativen Demokratie, das durch umfassende Partizipationsmöglichkeiten für alle potenzielle Handlungsbetroffenen die durch umfassende Partizipationsmöglichkeiten für alle potenziell Handlungsbetroffenen die demokratische Input-Legitimation von Entscheidungen erhöhen will, und zum anderen Deliberation verstanden als reiner Interaktionsmodus innerhalb eines Entscheidungsgremiums, der auf Grund seiner höheren Problemlösungskapazität eine höhere OutputLegitimation besitzt“ (zit. Göler2007: 33).
Kernpunkt des Konzepts der Deliberativen Demokratie, so Göler (ebd.) weiter, ist eine doppelte Öffentlichkeitsbedingung: „Die Debatten sollen öffentlich geführt werden, der Entscheidungsprozess soll allen potenziell von einer Entscheidung Betroffenen offen stehen, da nur so gewährleistet ist, dass alle relevanten Argumente in die Entscheidungsfindung einfließen“ (zit. Göler 2007: 33) .
Demgegenüber blendet Deliberation verstanden als reiner Interaktionsmodus das Problem der Beteiligungsmöglichkeiten, das im Zentrum des normativen Konzepts der deliberativen Demokratie steht, weitgehend aus. Es richtet hingegen den Fokus der Analyse darauf, ob durch deliberative Verfahren die Problemlösungskapazität eines Entscheidungsforums erhöht werden kann (ebd.: 33f).
Göler (ebd.) sagt weiter, dass sich dementsprechend auch die Begründungsmuster unterscheiden, warum man in politischen Prozessen einen deliberativen Interaktionsstil anstreben sollte. Während Deliberation verstanden als Interaktionsmodus, den Übergang zu deliberativen Verfahren mit der höheren Problemlösungskapazität rechtfertigt, befürworten Vertreter eines normativen-demokratietheoretischen Konzepts Deliberation unabhängig von dem erwarteten Output allein wegen der verbesserten partizipatorischen Grundlage. Das normative Konzept einer deliberativen Demokratie setzt immer auch einen deliberativen Interaktionsmodus voraus. Umgekehrt gilt dies aber nicht. Der Interaktionsmodus der Deliberation kann sowohl separat auftreten als auch Teil des normativen Konzepts einer deliberativen Demokratie sein (ebd. 34) .
2.4 Legitimität in der Deliberativen Demokratietheorie
Da sich das Konzept der deliberativen Demokratie weder auf majoritäre, noch auf verhandlungsgeleitete Entscheidungsverfahren stützt und stattdessen von der Konsenssuche (und -findung) zwischen den beteiligten Akteuren ausgeht, ist es für die deliberative Demokratietheorie nicht automatisch legitim was im Namen einer Mehrheit entschieden wird. Nach Habermas, muss die begründete „Vermutung der Vernünftigkeit“ hinzukommen (Abromeit 2002: 149). In der deliberativen Demokratietheorie fallen damit auch Anerkennungswürdigkeit und faktische Anerkennung auseinander. Falls keine Anerkennungswürdigkeit besteht, ist auch die faktische Anerkennung wertlos (ebd.). Die faktische Zustimmung ist im Zweifelsfall weniger bedeutsam als die Gründe, unter denen sie erfolgt. Das erlaubt eine „als-ob“- Konstruktion: Politische Entscheidungen, sofern in der Sache anerkennungswürdig, können schon dann legitim sein, wenn die Entscheidungsgründe allgemein zustimmungsfähig sind (ebd.).
Der Kommunikationsprozess soll sich an einer möglichst breiten Partizipationsmöglichkeit aller Betroffenen orientieren, wobei diese umfassende Partizipation nicht nur über die parlamentarischen Vertretungsverfahren erfolgt, sondern eine umfassende Beteiligung verschiedener Akteure der Zivilgesellschaft, die in unterschiedlichen Arenen handeln, erfordert (Göler 2007: 36).
Der Kommunikationsprozess an sich ist aber im Modell der Deliberation subjektlos (Abromeit 2002: 101). Das bedeutet das sich in einem solchen Kommunikationsprozess die Meinungs- und Willensbildung, quasi unabhängig von ihren Teilnehmern vollführt. „Ist Partizipation vieler nicht oder nur begrenzt möglich, übernehmen die Ergebnisse die Last der Legitimierung, was dann unbedenklich ist, wenn sie diskursiv zustande gekommen, so problemadäquat wie vernunftgemäß sind und so aussehen, als ob die Vielen ihnen hätten zustimmen können, wären sie gefragt worden. Fehlt es an einer Repräsentativversammlung auf oberster Ebene oder wird deren Zusammensetzung aufgrund der ungewissen Repräsentationsbasis zum Problem, können deliberative (Experten-) Gremien an deren Stelle treten, sofern sichergestellt ist, dass dort zwar nicht alle Betroffenen, wohl aber alle Sachaspekte angemessen vertreten sind“ (zit. Abromeit 2002: 159). Ein solcher rational problemlösende Arbeitsstil wird möglich, wenn die einzelnen Akteure nicht mit einem Mandat zur Durchsetzung bestimmter Interessen ihrer Wahlkreise ausgestattet sind (Tömmel 2008. 237f.). Sie können dadurch die Haltungen und Positionen der jeweils anderen reflektieren und berücksichtigen und stehen für argumentative Überzeugung offen (ebd.).
Durch diese Art von Kommunikationsprozess, aus dem „vernünftige“ Entscheidungen hervorgehen, und die Beteiligung aller von der Entscheidung Betroffener, kommt den politischen Entscheidungen erst die demokratische Legitimität zu. Wichtiger als die Partizipation aller, sind die Ergebnisse, denen auch die Betroffenen zugestimmt hätten wären sie gefragt worden (ebd.).
Zusammengefasst ist politische Herrschaft wie politische Entscheidungen dann legitim, „when the exercise of state power is supported by considerations acknowledged as reasons by the different views endorsed by reasonable citizen, who are understood as equals.“ (Guttmann/Thompson 1996: 224; zit. nach: Abromeit2002: 150).
Zwar bezieht sich das Konzept deliberativer Demokratie primär auf Entscheidungsprozesse in nationalen politischen Systemen, es erscheint aber auch auf der europäischen Ebene von Bedeutung, da dort die Bedingungen seines Funktionierens besonders ausgeprägt sind (Tömmel 2008: 237). Auch Abromeit sagt: „Sowohl die institutionelle Unter-Definiertheit von Demokratie wie die Ergebnisorientiertheit lassen das deliberative Modell als vielschichtig anwendbar erscheinen, auf unterschiedlich strukturierte Gesellschaften ebenso wie auf den postnationalen Kontext“ (zit. Abromeit 2002: 159).
3. Legitimation durch Deliberation in der EU
Die häufig aus Sicht der empirischen Demokratietheorie kritisierten Punkte in der Struktur der EU schaffen aus Sicht der Deliberativen Demokratietheorie Platz für neue Formen der Legitimation. Deliberation stellt damit eine weitere Quelle der Legitimation für die EU dar. Tömmel (2008: 239) stellt die These auf, dass es gerade die von Kritikern angeführten Defizite des EU-Systems sind, die die Grundlage und den Ausgangspunkt für die Herausbildung neuer Formen demokratischer Willensbildung bilden. „Deliberative Formen der Entscheidungsfindung lassen sich [...] für eine ganzen Reihe weiterer europäischen Entscheidungsgremien oder -arenen, seien es die offiziellen Organe der EU oder ihre mehr oder weniger institutionalisierten Substrukturen, seien es informelle Politiknetzwerke oder Arenen, konstatieren“ (zit. Tömmel: 238).
Es gibt allerdings nicht ein Modell deliberativer supranationaler Politik, vielmehr lassen sich bereichsspezifische Formen von Deliberation in mannigfachen Arenen finden (Früh 2007: 719).
3.1 Schaffung von technokratischen Aushandlungszirkeln
Als einen Anknüpfungspunkt für deliberative Verfahren benennen Joerges und Neyer die europäischen Komitologie. (Tömmel 2008: 238). In diesen Ausschüssen arbeiten spezialisierte Bürokraten und Experten. Komitologie- Ausschüsse sind vom Ministerrat eigentlich dafür gedacht als Aufsichts- und Kontrollorgane gegenüber der Kommission zu fungieren. Faktisch arbeitet die Kommission aber, in Gegensatz zu ihrer zugedachten Aufgabe, in einvernehmlicher Kooperation mit diesen (ebd.).
Die Zugangsvoraussetzung zu diesen Ausschüssen ist fachliche Zuständigkeit oder sachliche Kompetenz, um so die kooperative Beratung und Umsetzung von Politik zu ermöglichen (Kohler-Koch 2004: 224).
Joerges und Neyer sagen, dass sich in diesen Ausschüssen ein Arbeitsstil entwickelt hat, der von nationalen Interessen partiell abgelöst und problemlösungsorientiert ist (Abromeit 2002: 36). Dies gelingt den Mitgliedern, weil sie sich von ihrer Funktion als nationale Interessenvertreter abkoppeln. Die Beauftragung und Kopplung der Repräsentanten in der repräsentativen Demokratie verhindere nämlich das die Akteure problemlöseorientiert arbeiten (Kohler-Koch 2004: 224). Aus Sicht der empirischen Demokratietheorie wäre die Tätigkeit von Experten, die nicht demokratisch legitimiert und mangelnde öffentliche Transparenz an den Verfahren der Komitologie zu kritisieren. Aus dem Blickwinkel der deliberativen Demokratietheorie besteht hier aber grade eine hohe Legitimation durch deliberative Kommunikationsprozesse.
In den Experten-Diskussionen der Komitologie bilden sich Normen der supranationalen Kooperation und Problemlösung heraus. Dies belegen Joerges und Neyer mit dem Namen deliberativer Supranationalimus, den sie kennzeichnen als Kern eines Konstitutionalismus jenseits des nationalen Verfassungsstaates (Abromeit 2002: 36). Das Modell des deliberativen Supranationalismus zielt auf die Entdeckung von Verfahren, mit denen das Zustandekommen wohlerwogener Entscheidungen gesichert werden kann (Kohler-Koch 2004: 223). Dabei geht es nicht allein um die sachliche Diskussion unter Fachleuten, sondern auch um die Einbringung normativ verstandener „guter Gründe“ in die Politik, wie z.B. die Berücksichtigung nicht repräsentierter Minderheiten oder die Inklusion der Interessen von Entscheidungsbetroffenen, die keine Stimme im Entscheidungsprozess haben (Kohler-Koch 2004: 223f). Joerges und Neyer gehen davon aus, dass durch Normsetzung in den Ausschüssen die supranationale Ebene der EU weiter entwickelt wird und infolgedessen die Legitimität europäischer Entscheidungen weiter gestärkt wird (Früh 2007: 720).
Das Verfahren ist aber durchaus problembehaftet. Die Prozesse der Deliberation sind zeitaufwändig und setzen bei den Beteiligten relativ anspruchsvolle handlungsorientierungen voraus (Kohler-Koch 2004: 224). Die Zugangsbedingungen zu solchen Ausschüssen können nicht gleichberechtigt strukturiert sein, da sie sich aus der Verfügung über Expertise und aus fachlicher Zuständigkeit ergeben (ebd.). Zur ungleichen Beteiligung kommt die Gefahr der selektiven Handhabe von Zugangsmöglichkeiten, da Sachkunde keine objektivierbare Eigenschaft ist (ebd.). Auch fehle eine öffentliche Rechenschaftspflicht und die Frage, welche institutionellen Mechanismen garantieren können, dass tatsächlich verständigungsorientiert gehandelt wird, ist weitgehend ungeklärt (ebd.). Nicht zu übersehen ist vor dem Hintergrund die Gefahr, dass in den Verhandlungsprozessen Mechanismen des Gebens und Nehmens entstehen, bei denen Ergebnisse aufgrund von Machtverhältnissen und nicht wegen des besseren Arguments erzielt werden (Früh 2007: 720). Angesichts dieser Defizite besteht zumindest potenziell die Gefahr einer Entartung in eine faktisch elitäre Experten- oder Technokratenherrschaft (Kohler-Koch 2004: 224).
3.2 Verhältnis von Ministerrat und Kommission
Aus der Perspektive der empirischen Demokratietheorie wird das Verhältnis zwischen Kommission und Ministerrat kritisiert, weil es zwischen Kommission und Ministerrat keine Gewaltenteilung und keine Kontrollbeziehung zwischen den beiden Organen gibt.
Tömmel sieht aber auch hier Ansatzpunkte deliberativer Legitimation. Indem nämlich die Kommission überdas alleinige Initiativrecht und der Ministerrat über Entscheidungsmacht verfügt sind beide Institutionen sehr wohl aufeinander angewiesen (Tömmel 2008: 239f). Das Verhältnis sei von gegenseitiger Abhängigkeit geprägt. Die Kommission kann mit der von ihr ausgearbeiteten Gesetzesinitiativen die Entscheidungen weitgehend präfigurieren und somit die Entscheidungsmacht des Rats einschränken.
Der deliberative Ansatz in dieser Beziehung liegt darin das, die Machtmittel der Kommission gegenüber des Ministerrats, darin liegen das mit der Vorlage „rationaler“ und gut begründeter Vorschläge, die ihrerseits über komplexe Verfahren der Einbeziehung von Interessengruppen, Experten und Betroffenen erarbeitet wurden. Solche breit akzeptierten Kompromissvorschläge kann der Ministerrat nicht einfach ablehnen. Das Verhältnis der beiden Institutionen vermittelt zwischen den komplexen Interessenlagen im Prozess der europäischen Integration. Dabei steht die Kommission für das gemeinsame Interesse am Vorantreiben der europäischen Integration, während auf der anderen Seite der Ministerrat die Partikularinteressen der Mitgliedsstaaten repräsentiert (Tömmel: 240). Tömmel wertet die Ausbildung dieser
Dopppelspitze und deren wechselseitigen Abhängigkeit, als institutioneller Ausdruck der Berücksichtigung hochkomplexer gesellschaftlicher Interessenlagen im Prozess der europäischen Integration. Die unzureichende Gewaltenteilung bildet erst die Grundlage für die Herausbildung einer neuen institutionellen Konstruktion der geteilten Gewalt (ebd.).
3.3 Rolle des Europäischen Parlaments
Die aus der Perspektive der empirischen Demokratietheorie, kritisierte fehlende Bindung des Europäischen Parlaments an eine Regierung sorgt auch im Falle des Parlaments für neue Formen der Legitimation. Bogdanor sagt, dass die große Unabhängigkeit gegenüber anderen Organen dem Parlament die Freiheit verleiht, eigene Positionen zu entwickeln (Tömmel 2008: 241). Die relative Unabhängigkeit von nationalen Parteien und die geringe ideologische Bindungskraft der Fraktionen, so Ovey wirke in die gleiche Richtung (Tömmel 2008: 241). Dadurch wird es möglich das, dass Parlament eine gemeinsame unabhängige Position entwickelt. Ein Konsens wird auch durch die subjektive kosmopolitische Ausrichtung einzelner Parlamentarier zusätzlich erleichtert (ebd. 241 f). „Da Kommission und Ministerrat oft beide eher funktionale und sektorale, beziehungsweise bestimmte territoriale Interessen, repräsentieren und dementsprechend eher Konzepte basierend auf technischer Expertise entwickeln, tritt das Parlament diesen mit ethischen und moralischen Argumenten entgegen“ (zit. Tömmel 2008: 242). Daher bürgte sich, so Tömmel, für das Parlament die Metapher vom „Gewissen der EU“ ein.
Das Parlament erfülle somit nicht eine Repräsentativfunktion im Sinne spezifischer gesellschaftlicher Interessen, sondern eine allgemeine Kontroll- und Korrektivfunktion gegenüber den anderen Organen der EU, mit dem Ziel ordnungsgemäße und politisch korrekte Entscheidungen und Verfahrensabläufe, kurz „good governance“ abzusichern (ebd.: 244). Insgesamt ist das Parlament nicht als Repräsentant des - gebündelten und polarisierten - Willens der Völker zu werten, sondern vielmehr als Vertretung grundlegender gemeinsamer Interessen der Bürger Europas. Bei der Verfolgung solch allgemeiner Zielsetzungen stellt sich das Problem majoritärer Entscheidungen beziehungsweise das Problem nationaler Interessen kaum. Das Europäische Parlament kann diese Funktionen nur wahrnehmen weil es sich eines deliberativen Stils bedient (ebd.).
3.4 Einbezug Externer Akteure durch die Kommission
Auch der Einbezug externer Akteure in europäische Entscheidungsprozesse wird aus Sicht der empirischen Demokratietheorie häufig kritisiert. Zum Ersten weil diesbezüglich Formen der Repräsentation hochgradig asymmetrisch sind und zum Zweiten keine gleichberechtigte, offenen und transparenten Zugangsmöglichkeiten bestehen (Tömmel 2008: 246).
Hull sagt, dass die Kommission ihre Auswahl bei der Konsultation externer Akteure immer sorgfältig trifft (Tömmel 2008: 246). Allerdings achtet die Kommission dabei nicht auf eine ausgewogene politische Repräsentation, sondern orientiert sich vielmehr an der Frage, ob die Akteure über eine entsprechende technische Expertise verfügen. Solcherart technischer Expertise ist eher bei sich neu formierenden, Issue-spezifischen Gruppen beziehungsweise Vertretern schwach organisierter Interessen zu finden, als bei den klassischen, hoch aggregierten Interessenverbänden (ebd.: 246f).
Durch die Einbeziehung vieler Akteure gewinnen die Vorschläge der Kommission mehr Legitimität gegenüber dem Ministerrat. Andersen und Burns weisen darauf hin das durch eine solche Vorgehensweise zu einer grundlegenden Transformation demokratischer Interessenvertretung führt (Tömmel 2008: 248). Die demokratische Interessenvertretung findet immer weniger über große, ein breites Spektrum von Interessen bündelnde und aggregierte Verbände statt, die in zunehmenden Maße auch spezifische Interessen ausklammern und somit immer weniger in der Lage sind, sich als legitime Vertreter auszuweisen. Kleinere Gruppen Betroffener gehen dazu über, direkt und Issue-spezifisch Interessen zu artikulieren und in entsprechenden Netzwerken zu partizipieren (ebd.).
Auf Europäischer Ebene ist dieser Prozess wesentlich günstiger als auf nationaler Ebene weil die Konkurrenz traditioneller Verbände die als GateKeeper fungieren kaum gegeben ist, das unpolitische Handeln der Kommission eine solche Entwicklung fördert und der Legitimationsbedarf des Systems, der sich über die für nationale politische Systeme typischen Kanäle kaum entfalten kann so zumindest partiell gedeckt wird (Tömmel 2008: 248). .
Es sind also einmal mehr die demokratischen Defizite des EU-Systems, die Raum bieten für die Entfaltung alternativer Formen der Interessenartikulation und -repräsentation.
Auf diese Weise gelingt es eine Vielzahl von externen Akteuren in europäische Entscheidungen einzubeziehen, was die Legitimation des Systems erhöht (ebd.: 250). Den Entscheidungsprozessen mangelt es allerdings an Transparenz, was eine demokratische Kontrolle erheblich erschwert (ebd.).
4. Handlungsempfehlungen der Deliberativen Demokratietheorie
Legitimation können politische Entscheidungsprozesse, je nach Verständnis von Deliberation, zum Einen durch eine Art von Kommunikationsprozess aus dem „vernünftige“ Entscheidungen hervorgehen beziehen, und zum Anderen durch eine möglichst breite Partizipation bzw. der Einbezug aller Menschen die von der Entscheidung betroffen sind.
Die praktische Empfehlung die man aus den Überlegungen der deliberativen Demokratietheorie ziehen könnte, wäre die EU mit einer Vielzahl deliberativer Gremien zu bestücken und die schon bestehenden inklusiver und transparenter zu gestalten (Abromeit 2002: 38). Im Übrigen kann man zu dem Schluss kommen das die Union bereits auf einem guten Weg ist. Die Defizite liegen letztlich nicht im Europäischen Entscheidungssystem selbst, sondern im noch unterentwickelten „öffentlichen Forum“ (ebd.). Da dieser Prozess sich nicht wirklich von oben installieren lässt, schlussfolgert Abromeit (2002: 38), das ein zweiter Ratschlag dann wohl sein müsste abzuwarten.
Jacobsen und Vifell (2002) konnten allerdings auch zeigen das, umso politischer ein Thema ist, desto mehr verharren die Ausgangspositionen in ihrem nationalen Auftrag (Bürgin 2007: 57). An die Stelle des argumentativen Diskurses trete wieder der Modus des Verhandelns. Folglich eignen sich nur technische Probleme aber keine politischen für Deliberative Entscheidungsfindung (ebd.). Demzufolge sollten also nur solche technische Probleme durch deliberative Gremien entschieden werden.
Höreth weist kritisch darauf hin das ein mehr an Deliberation auch ein weniger Demokratie im konventionellen Sinne bedeutet (Höreth 2009: 322). Wie zuvor schon ausgeführt, ist es umso besser für die Deliberation je weniger die Akteure mit der Erwartung gewählt werden bestimmte Interessen zu vertreten. Das bedeutet letztendlich, mehr Entscheidungsfindung in Expertengremien und weniger in gewählten Repräsentativversammlungen. Da der Weg der Deliberativen Demokratie die klassischen Wege der Legitimation ergänzen soll, ist daraufzu achten das die Legitimationsbilanz positiv ist.
5. Zusammenfassung
Aufgrund der Intensität und Reichweite der transnationalen Integrationsprozesse souveräner demokratischer Staaten stellt sich die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten trans- und supranationaler demokratischer Legitimation dringlich (Huget 2007: 75).
Die deliberativen Demokratietheorie stellt eine alternative Möglichkeit dar, wie europäische Politik demokratietheoretisch erklärt und untersucht werden kann. Sie geht auf die von Jürgen Habermas entwickelten Diskurstheorie zurück und ist als ein Instrument zur Erlangung „vernünftiger“ Entscheidungen konzipiert (Abromeit 2002: 101). Dies wird durch eine spezifisch Art von Kommunikationsverfahren sichergestellt. Sie setzt aber bei den Teilnehmer dieser Kommunikationsverfahren voraus das sie die Haltungen und Positionen der jeweils anderen reflektieren und berücksichtigen und für argumentativer Überzeugung offen stehen (Tömmel 2008. 237). Durch das Diskursverfahren, aus dem „vernünftige“ Entscheidungen hervorgehen, und die Beteiligung aller von der Entscheidung Betroffener, kommt den politischen Entscheidungen demokratische Legitimität zu. Wichtiger als die Partizipation aller, sind die Ergebnisse, denen auch die Betroffenen zugestimmt hätten, wären sie gefragt worden (ebd.). Für den postnationalen Kontext erscheint die Deliberative Demokratietheorie besonders vielversprechend, da dort besonders günstige Bedingungen herrschen (ebd.).
Ansätze Deliberativer Demokratie, lassen sich in der EU in mannigfachen Arenen finden. Deliberation stellt damit eine weitere Quelle der Legitimation für die EU dar. Tömmel stellt die These auf das es gerade, die von Kritikern angeführten Defizite des EU-Systems sind, die die Grundlage und den Ausgangspunkt für die Herausbildung neuer Formen demokratischer Willensbildung bilden. Joerges und Neyer konnten z.B. nachweisen das sich in den Ausschüssen der Europäischen Komitologie ein Arbeitsstil entwickelt hat, der von nationalen Interessen partiell abgelöst und problemlösungsorientiert ist. Auch Tömmel führt anhand des „Verhältnis von Ministerrat und Kommission“, der „Rolle des Parlaments“ und dem „Einbezug Externer Akteure durch die Kommission“ aus, dass diese Punkte in der Struktur der EU, die aus Sicht klassischer Demokratietheorien kritisiert werden, neue Formen der Legitimation durch Deliberation ermöglichen.
Aus Sicht der Deliberativen Demokratietheorie wäre zu empfehlen möglichst viele deliberative Gremien einzurichten (Abromeit 2002: 38). Umso politischer ein Thema allerdings ist desto mehr tritt an die Stelle des argumentativen Diskurses wieder der Modus des Verhandelns (Bürgin 2007: 57). Offen bleibt daher ob sich nur technische Probleme aber keine politischen für Deliberative Entscheidungsfindung in der EU eignen. Aufgrund der günstigen Bedingungen für Deliberation in Expertengremien bedeutet Deliberation aber auch weniger Demokratie im konventionellen Sinne (Höreth 2009: 322). Kritiker, wie z.B. Höreth, warnen daher völlig richtig vor der Gefahr einer Technokratenherrschaft.
Literatur
Abromeit, Heidrun (2002): Wozu braucht man Demokratie? - Die postnationale Herausforderung der Demokretietheorie. Leske + Budrich: Opladen
Bürgin, Alexander (2007): Die Legitimität der EU - Normative Standards als Verhandlungsressource im Verfassungskonvent. Nomos Verlag: BadenBaden
Dingwerth, Klaus I Blauberger, Michael I Schneider, Christian (2011) Postnationale Demokratie - Eine Einführung am Beispiel von EU, WTO und UNO. Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden
Frisch, Annika (2007): Das Potenzial deliberativer Demokratietheorie für die Konzeptionalisierung von Demokratie in der Europäischen Union. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft 17, 3, 711-733
Göler, Daniel (2006): Deliberation - Ein Zukunftsmodell europäischer Entscheidungsfindung? - Analyse der Beratungen des Verfassungskonvents 2002 - 2003. Nomos Verlag: Baden-Baden
Höreth, Marcus (2007): Überangepasst und realitätsentrückt? Zur Paradoxie der Theorie der deliberativen Demokratie in der EU. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft 3 (2009), S. 307-330.
Huget, Holger (2007): Demokratisierung der EU - normative Demokrtiethorie und Governance-Praxis im europäischen Mehrebenensystem. Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden.
Kohler-Koch, Beate I Conzelmann, Thomas I Knodt, Michèle (2004): Europäische Integration - Europäisches Regieren. Verlag für Sozialwissenschaften: Wiesbaden
Martinsen, Renate (2006): Demokratie und Diskurs - Organisierte Kommunikationsprozesse in der Wissensgesellschaft. Nomos Verlagsgesellschaft. Baden-Baden
Thalmaier, Bettina (2005): Die zukünftige Gestalt der Europäischen Union - Integrationstheoretische Hintergründe und Perspektiven einer Reform. Nomos Verlagsgesellschaft: Baden-Baden
Tömmel, Ingeborg (2008): Das politische System der EU. 3. Auflage. Oldenbourg Wissenschaftsverlag: München
- Arbeit zitieren
- Marcel Kerkenbusch (Autor:in), 2012, Verbesserungsmöglichkeiten der Legitimation der Europäischen Union aus Sicht der deliberativen Demokratietheorie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265668
Kostenlos Autor werden











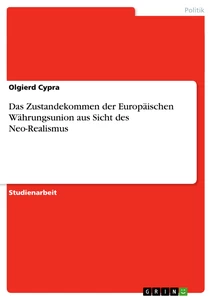








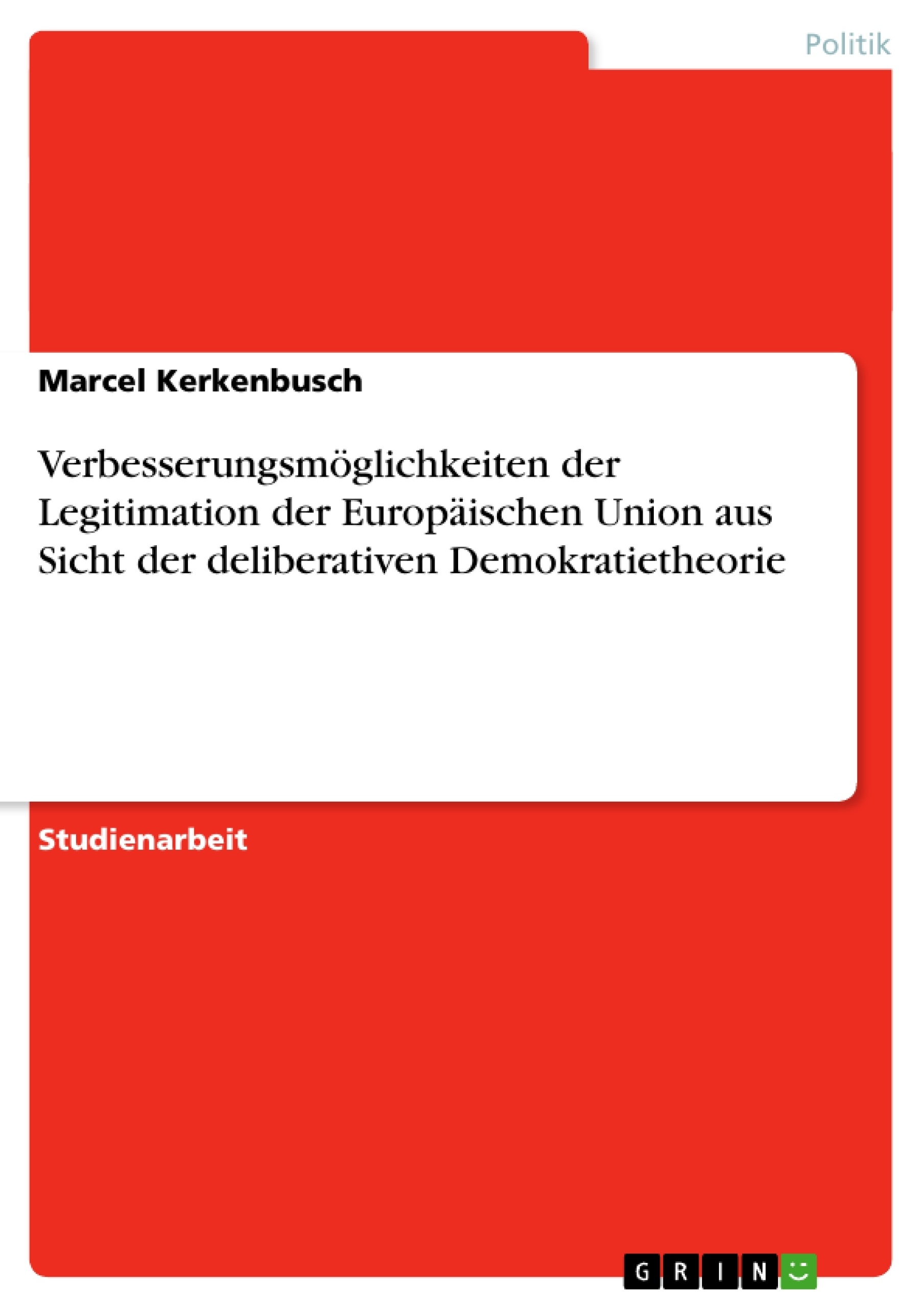

Kommentare