Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretischer Teil
2.1 Begriffsbestimmungen
2.1.1 Die Autobiographie und ihre Nachbargattungen
2.1.2 Erzählen
2.2 Funktionen, Formen und Gegenstände (modernen) autobiographischen Erzählens - grundsätzliche Überlegungen
2.2.1 Die existentielle Funktion autobiographischen Erzählens
2.2.1.1 Autobiographisches Erzählen und personale Identität
2.2.1.2 Identitätsungewißheit und existentielle Haltlosigkeit als Ausgangspunkte modernen autobiographischen Erzählens
2.2.2 Konsequenzen der modernen Identitätsproblematik für das autobiographische Erzählen
3. Drei moderne autobiographische Erzähltexte
3.1 Jean-Paul Sartre: Les Mots
3.1.1 Autobiographisches Erzählen als Instrument analytischer Erkenntnis und idealtheoretischer Selbst-Konstruktion
3.1.2 Erzählen unter der ‚Diktatur des Sinns’
3.1.2.1 Aufbau: Dialektik im Gewand einer Geschichte
3.1.2.2 Gegenstand
3.1.2.2.1 Der vermeintliche Bruch von 1916: metadiskursive Nachschöpfung des Wahnsinns in ‚Verschiebungen’ und ‚Entstellungen’
3.1.2.2.2 Klassische Elemente der Kindheitserzählung im Dienst der Dialektik
3.1.2.3 Figuren als Rollenträger
3.1.2.4 ‚Der Mann im Kind’: Perspektive und Stellung des autobiographischen Subjekts
3.1.2.5 Stil und Darstellung: Ein abtrünniger Meister der ‚belles-lettres’
3.1.3 Das Ergebnis der autobiographischen Suche: existentielle Bestimmungslosigkeit als positives Lebensaxiom
3.2 Alfred Andersch: Der Seesack. Aus einer Autobiographie
3.2.1 Autobiographisches Erzählen als Selbstversuch und Selbstsuche
3.2.2 Erzählen als Widerspiegelung eines ungewissen Such-Prozesses
3.2.2.1 Aufbau: Ein ‚ungeordnetes Buch, das kein Buch ist’
3.2.2.2 Gegenstand
3.2.2.2.1 Eine Situation existentieller Ungewißheit als Anhaltspunkt der Identitäts-Suche
3.2.2.2.2 Begebenheiten, Begegnungen, Augenblicke und ‚Fremdmaterial’ mit möglichem Erkenntnisgewinn
3.2.2.3 Stellung des autobiographischen Subjekts: Ein dominanter Sprecher
3.2.2.4 ‚Tupfen-Stil’ und ‚Flickenteppich’: Stil, Redeweisen, Redegestik
3.2.3 ‚Ergebnis’ und existentieller Stellenwert der autobiographischen Suche: ein Versuch mit geringem Erfolg?
3.3 Joan Didion: The White Album
3.3.1 Autobiographisches Erzählen als Akt elementarer existentieller Selbstbehauptung
3.3.2 Eine Erzählung (von) der Krise des Erzählens
3.3.2.1 Aufbau: „not a movie but a cutting-room experience“
3.3.2.2 Gegenstand
3.3.2.2.1 Einseitige Materialauswahl und -darstellung
Exkurs: The White Album - eine Reportage über die ‚Sixties’?
3.3.2.2.2 ,,Here are some particulars” - zum Stellenwert und zur Funktion des Konkreten und Einzelnen im White Album
3.3.2.3 Stellung des autobiographischen Subjekts: Eine unzuverlässige Erzählerin
3.3.2.4 Zeigen statt Sagen: Stil, Rhetorik und Redegestik als zentrale Bedeutungs-Träger
3.3.3 Ergebnis?
4. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1. Primärtexte
1.1 Alfred Andersch
1.2 Joan Didion
1.3 Jean-Paul Sartre
1.4 Sonstige zitierte Primärtexte
2. Sekundär- und Forschungsliteratur
2.1 Nicht einzeltext- / autorspezifische Darstellungen
2.1.1 Autobiographie / autobiographisches Erzählen
2.1.2 Erzählen
2.1.3 Identität
2.1.4 Sonstige nicht einzeltext- / autorspezifische Darstellungen (Sekundärliteratur)
2.2 Darstellungen zu den behandelten Autoren
2.2.1 Alfred Andersch
2.2.2 Joan Didion
2.2.3 Jean-Paul Sartre
Methodische Anmerkungen
zur Aufgabenstellung und -erfüllung
Ich werde die ‚Gegenstände, Formen und Funktionen’ dreier autobiographischer Texte untersuchen, wobei gleichermaßen differenziert zu klären sein wird, was, wie und warum bzw. wozu jeweils erzählt wird. Ich habe mich allerdings entschlossen, bei den Untersuchungen der Texte von der Reihenfolge der drei Aspekte im Titel abzuweichen und jeweils zuerst die Funktion und dann die formalen und inhaltlichen Aspekte zu behandeln (da die Funktion der Schlüssel zum Verständnis von Textgestalt und -inhalt ist). Die Abweichung erscheint mir legitim, da sie nur methodischer Natur ist.
zu Zitier- und Schreibweisen:
Die vollständigen Literaturangaben zu allen zitierten Texten finden sich im Literaturverzeichnis am Ende der Arbeit. In den Fußnoten werde ich mich auf folgende Angaben beschränken:
- Erstzitat: Verfassername, Erscheinungsjahr der von mir verwendeten Ausgabe (bei unselbstständigen Veröffentlichungen: Erscheinungsjahr von Sammelband / Zeitschrift), Titel.
- Alle weiteren Zitate: Verfassername, Erscheinungsjahr.
Ausnahmen bilden:
- Zitate aus Interviews: hier wird bei allen dem Erstzitat folgenden Zitaten an Stelle des Erscheinungsjahres ein Stichwort aus dem Titel des Interviews verwendet.
- die Primärtexte von Sartre, Andersch und Didion: bei Zitaten aus diesen Texten folgen die Seitenangaben mit einem Kürzel versehen direkt im laufenden Text.
- bei einigen Texten halte ich es für geboten, auch das Jahr der Erstveröffentlichung (bei Übersetzungen: Erstveröffentlichung des Originaltextes) anzugeben. Dieses findet sich beim Erstzitat und in der Literaturliste am Ende der Arbeit in [eckigen Klammern].
Sonstiges:
- ‚einfache Anführungszeichen’ werden u.a. verwendet: 1) bei freien Zitatwiedergaben (mit ‚vgl.’ + Stellenangabe in der Fußnote); 2) bei wiederholt zitierten zentralen Begriffen oder Wendungen (ohne Fußnote / Stellenangabe); 3) bei Binnenzitaten / Zitaten in Zitaten; 4) bei übersetzten Zitaten aus den Texten von Sartre und Didion (mit ‚vgl.’ + Stellenangabe des Original-Zitats); 5) bei Wörtern und Wendungen, die in besonderer (übertragener o.ä.) Bedeutung verwendet werden.
- bei Zitaten, die ich aus indirekten Quellen zitiere, wird die direkte Quelle nur in der entsprechenden Fußnote, nicht jedoch im Literaturverzeichnis angegeben.
- Bei Verweisen auf längeren Primärtext-Passagen gebe ich nur die ersten und letzen Worte der Passage an (mit ... dazwischen).
- kursive Hervorhebungen in Zitaten entsprechen dem Original. Ich verwende für Hervorhebungen die gesperrte Schreibweise oder Unterstreichungen.
- in den Kapiteln zu den Texten von Andersch und Didion werde ich der Unsitte nachgeben, Zahlen von Kapiteln und Absätzen nicht auszuschreiben, da sich beide Texte aus relativ vielen Abschnitten bzw. Kapiteln zusammensetzen.
1. Einleitung
Diese Arbeit versteht sich als textnaher Beitrag zur Frage nach dem ‚Zusammenhang von Gegenständen, Formen und Funktionen modernen autobiographischen Erzählens’.[1] Sie stellt damit eine Reaktion auf Forderungen nach einer Ausweitung erzähltheoretischer Fragestellungen dar. Ausweitung zum einen in Bezug auf den Bereich faktualen Erzählens im allgemeinen und den des autobiographischen Erzählens im besonderen. So kritisiert z.B. Gérard Genette noch Anfang der Neunziger Jahre, daß die Erzählforschung „ihre Aufmerksamkeit bisher fast ausschließlich den Verfahren und Objekten der fiktionalen Erzählung zugewandt“ hat.[2] Forschungen speziell zur Autobiographie bzw. zum autobiographischen Erzählen standen lange Zeit im Zeichen biographischen oder kulturgeschichtlichen Interesses.[3] Erst nach dem Zweiten Weltkrieg rückten gattungs- und damit z.T. auch erzähltheoretische Fragestellungen überhaupt in den Horizont der Betrachtung[4] - allerdings ist die Menge der diesbezüglich seither erschienenen theoretischen Ansätze relativ überschaubar geblieben, und unter den komplexeren, über Einzelaspekte hinausgehenden Ansätzen gibt es kaum eine Theorie, in der speziell die moderne Autobiographik unter erzähltheoretischen Fragestellungen mehr als nur am Rande berücksichtigt wird. Dies ist insofern verwunderlich, als sich die „eigentliche Autobiographie“ gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr „zur innovativen Form gewandelt“ hat.[5] Dieser Entwicklung möchte ich mit dieser Arbeit Rechnung tragen. Allerdings nicht mit einer rein ‚technischen’ Untersuchung innovativer Form- und Strukturmerkmale, denn dies entspräche einer ebenfalls zunehmend in Frage gestellten Ausrichtung der Narratologie.[6] So kritisiert Dieter Lamping die „theoretische Befangenheit“ der meisten Erzähltheorien in ihrer einseitigen Konzentration auf die formalen Aspekte des Erzählens:
„Die Erzähltheoretiker haben ihren Scharfsinn zumeist darauf verwendet, Erzähl-Techniken immer differenzierter zu beschreiben. Nur gelegentlich haben sie dabei den Zusammenhang zwischen Formen und Funktionen des Erzählens bedacht. Noch seltener war ihnen der Gegenstand des Erzählens, das Erzählte selber, Aufmerksamkeit wert - und wenn, dann zumeist bloß im Zusammenhang fiktionstheoretischer Überlegungen.“[7]
Eben dies - den Zusammenhang zwischen Erzählen, Erzähltem und der Funktion, die das Erzählen für einen Sprecher hat - möchte ich am Beispiel der Untersuchung dreier autobiographischer Texte von Jean-Paul Sartre, Alfred Andersch und Joan Didion zu erhellen versuchen. Die Arbeit ist damit erzähltheoretischen Interessen verpflichtet, sie wird sich jedoch nicht ausführlich und systematisch mit allgemeinen erzähltheoretischen Problemen, Fragen und Begriffsbildungen für den Bereich des autobiographischen Erzählens befassen. Auf eine detaillierte und kritische Auseinandersetzung mit typologischen bzw. gattungstheoretischen Entwürfen für das große Feld der Autobiographik möchte ich ebenfalls verzichten. Mir geht es um die differenzierte Auseinandersetzung mit drei konkreten Texten, wobei sich der rote Faden meiner Untersuchung nicht nach den typologischen, formalen oder inhaltlichen Merkmalen der Texte richtet (wenngleich diese natürlich eine wesentliche Rolle spielen werden), sondern nach den Funktionen, die das Erzählen über sich selbst, über das eigene Leben oder eine bestimmte Lebensphase für die drei Autoren inne hat.
Soweit zu den theoretischen Hintergründen und Grenzen meines Vorhabens. Allerdings waren es natürlich nicht allein die Entdeckung und Kombination einiger kleiner und weniger kleiner Forschungslücken, die mich zu den Schwerpunkten ‚Erzählen’, ‚Autobiographik’, ‚Moderne’ und zur Wahl der drei Texte bewogen haben. Daher nun der Überblick über die eigentlichen Vorüberlegungen und Thesen dieser Arbeit:
Warum erzählen Menschen? Der Mensch ist nicht a priori festgelegt und in seiner Wesenheit bestimmt. Seine Besonderheit besteht darin, daß er seine existentielle Situation reflektieren und transzendieren kann. Aus diesem Vermögen resultiert ein urmenschliches Bedürfnis: Die Sehnsucht nach einer Bestimmung, nach einem Sinn des Daseins, oder allgemeiner: nach Ordnungsschemata, die dem Menschen helfen, seine kontingente Existenz und die formlose und willkürliche Welt, in der er sich vorfindet, erfahrbar und verstehbar zu machen. Als ein Instrument dieser Sehnsucht hat der Mensch das Erzählen entwickelt (und es u.a. in den Dienst der großen Regulate seiner Bestimmungssehnsucht - Religion, Philosophie, Metaphysik - gestellt). Erzählen bedeutet Selektion und Anordnung von Stoffen. Damit suggeriert es immer auch eine Bedeutsamkeit und Geordnetheit dessen, wovon letztlich jede Erzählung handelt: von der Wirklichkeit und den Menschen, die sich darin bewegen. Alles Erzählen - von der Mythen- und Märchenbildung über alltägliches Erzählen bis hin zu komplexen literarischen Werken - läßt sich in dem Sinne auf das urmenschliche Bedürfnis nach Sinn und Zusammenhang und auf die Funktion der Bedeutungsproduktion zurückführen.[8] In einem ähnlich elementaren Sinn faßt Joan Didion das Erzählen von Geschichten auf, wenn sie zu Beginn ihres autobiographischen Textes The White Album feststellt:
„We tell ourselves stories in order to live. [...] We look for the sermon in the suicide, for the social or moral lesson in the murder of five. We interpret what we see, select the most workable of the multiple choices. We live entirely, especially if we are writers, by the imposition of a narrative line upon disparate images, by the ‚ideas’ with which we have learned to freeze the shifting phantasmagoria which is our actual experience“[9]
Didion formuliert in extrem zugespitzter Form die o.g. existentielle Grundfunktion des Erzählens: Erzählen versteht sie nicht in einem engen, speziell auf ihre Tätigkeit als Journalistin und Schriftstellerin bezogenen Sinn, sondern als allgemein menschliche Fähigkeit (‚we’), die dem Menschen hilft, das Chaos der alltäglichen Erfahrung zu selektieren, zu ordnen und zu ‚interpretieren’. Die Suche nach ‚Geschichten’ scheint gleichbedeutend mit der Suche nach lebensweltlichem Sinn (‚sermon’, ‚social or moral lesson’) und Zusammenhängen (‚imposition of a narrative line’) und entspringt einem Bedürfnis, das zu erfüllen für jeden Menschen lebenswichtig im eigentlichen Sinn des Wortes ist. Denn, so die implizite Konsequenz, wer die ‚Geschichten’, die ‚Predigten’ und ‚Lektionen’ in seinen alltäglichen Erfahrungen nicht mehr erkennt, wer sie nicht sich selbst oder anderen erzählen kann, läuft Gefahr, sich selbst und die Welt in der Vielfalt dieser ‚wechselnden Phantasmagorie’ zu verlieren.
Nun bringt ein derart weiter und zugleich überspitzter Begriff von Erzählen zwar dessen eigentümlichste und ursprünglichste Bedeutung auf den Punkt, doch es liegt auf der Hand, daß sich nicht jedes literarische Erzähl-Werk, jede kleine Alltagserzählung als existentielle Sinn-Suche[10] oder gar als Rettungsversuch vor dem Abgleiten ins existentielle oder psychische Abseits verstehen läßt. Wozu also dieser Ausflug in anthropologische und existentielle Weiten? Er führt zu einem wesentlichen Merkmal autobiographischen Erzählens. Denn hier haben wir es mit einem Bereich des Erzählens zu tun, in dem seine existentielle Grundfunktion wohl am konsequentesten und deutlichsten zum Tragen kommt. Wer das Unternehmen wagt, unmittelbar über sich und sein Leben zu erzählen, ist kein ‚Geschichtenerzählspieler’, der ein ‚Spiel’ mit möglichen Bedeutungen und Sinnzusammenhängen spielt[11] - der womöglich sein Inneres auf fiktionale Ebenen verlagert, auf denen er bestimmte Sinn- und Ordnungsentwürfe durch fiktive Figuren spielerisch erproben läßt. Er verzichtet auf jede Mittelbarkeit und Spielerei und verpflichtet sich statt dessen zur Wahrheit und Aufrichtigkeit. Das heißt, es ist ihm ernst mit seinem Unternehmen. Dieser Ernst geht über die bloße Verpflichtung zur Tatsachenwahrheit weit hinaus - es ist meist ein zutiefst ‚existentieller Ernst’, mit dem sich der Autobiograph an die „Verhandlung existentiell wichtiger Fragen“ wagt, „zu denen neben der Frage nach der personalen Identität des Erzählers auch die nach dem ‚Sinn’ eines Lebens gehört.“[12] Ob ein Autobiograph zum Zeitpunkt des Schreibens bereits eine Antwort auf derartige Fragen gefunden zu haben glaubt oder ob er sich im Vollzug des Erzählens noch auf der Suche befindet, ist, aus diesem Blickwinkel betrachtet, sekundär. In den meisten Fällen, so könnte man es allgemein formulieren, ist autobiographisches Erzählen existentielle Sinn-Suche. Der Satz ‚Wir erzählen uns Geschichten, um zu leben’ trifft damit in besonderem Maße auf das autobiographische Erzählen zu: Als Akt der „Selbsterkenntnis“ und „Selbstschöpfung“, als Ausdruck von oder Suche nach Identität und existentieller Sinnerkenntnis stellt es selbst einen wesentlichen Akt des Lebens dar, der zukünftige Lebensperspektiven und -strategien schaffen, verändern oder bestätigen kann.[13]
Angesichts dieser existentiellen Bedeutung des autobiographischen Erzählens wird deutlich, warum sich gerade autobiographische Texte für eine Untersuchung eignen, die die Zusammenhänge zwischen Form, Inhalt und Funktion des Erzählens zu ihrem Gegenstand machen will: Was ein Mensch aus seinem Leben erzählt und wie er es erzählt, kann überhaupt nur im Zusammenhang mit dem ‚Sinn’, den seine Lebenserzählung für ihn hat, das heißt mit der Art seiner spezifischen existentiellen Fragen und mit dem Ausgang ihrer ‚Verhandlung’ angemessen betrachtet werden. Im Gegensatz zu fiktionalen Erzähltexten, in denen die Frage nach dem ‚Warum?’ des Erzählens im konkreten Einzelfall vielleicht nur schwer oder gar nicht zu beantworten ist, wird die existentielle Funktion des Erzählens in den meisten autobiographischen Texten nicht nur elementar und ernsthaft verwirklicht, sondern ist in vielen Fällen auch weitaus greifbarer als in fiktionaler Erzählliteratur: Das ‚Warum’ und das ‚Wozu’ des Erzählens sind ja die wesentlichen Grundfragen, mit denen sich ein Autobiograph auseinanderzusetzen hat, und sie werden in dem Sinne auch von vielen Autobiographen in ihrem Werk mehr oder weniger explizit und ausführlich reflektiert.[14] Ein anderer Grund, warum sich gerade autobiographische Erzähltexte für eine umfassende Betrachtung im o.g. Sinn anbieten, hängt mit ihrer Faktualität, das heißt mit ihrem direkten Bezug auf eine wirkliche Lebensentwicklung zusammen. Insbesondere die Frage nach der Beziehung zwischen Funktion und Gegenstand des Erzählens, also danach, warum etwas und etwas anderes aus einem Leben gerade nicht erzählt wird oder warum z.B. nur ein bestimmter Lebensabschnitt erzählt wird, erhält dadurch bei autobiographischen Texten ein ganz anderes Gewicht als bei fiktionalen Texten.[15]
Hinsichtlich ihrer Funktionen und Gegenstände können autobiographische Erzählungen also ein interessantes Forschungsgebiet für erzähltheoretische Überlegungen bieten, die nicht nur ‚technischen’ Ansprüchen genügen wollen. Allerdings hat nun gerade der dritte Faktor, der in der hier angestrebten Untersuchung berücksichtigt werden soll - die Form - auf dem Gebiet des autobiographischen Erzählens lange Zeit ein Schattendasein geführt, das seine Betrachtung nur wenig aufschlußreich erscheinen läßt:
„Aufgrund ihrer chronologischen Erzählweise und der für sie konstitutiven Identität von Autor, Erzähler und Hauptfigur stellt sich die Autobiographie, zumindest im Vergleich mit fiktionalen Erzähltexten, als technisch wenig komplex, ja konventionell dar.“[16]
Dies ist - zumindest im Hinblick auf die Erzählweise - verwunderlich. Nach den obigen Ausführungen zur elementaren Funktion autobiographischen Erzählens liegt der Schluß nahe, daß nicht nur Auswahl und Darstellung, sondern vor allem die Anordnung der Erinnerungselemente in hohem Maß von der jeweiligen Funktion, die das autobiographische Erzählen für einen bestimmten Autor zu einem bestimmten Zeitpunkt seines Lebens inne hat, abhängen müßte. Phillip Lejeune formuliert diesen Zusammenhang, wenn er auf die Tatsache hinweist, „daß der allgemeinste Aufbau einer Erzählung der der Nachforschung ist und daß dieser praktisch der einzige wirklich ‚natürliche’ (das heißt mit der Situation, in der die autobiographische Erzählung entsteht, unauflöslich verbundene) ist“.[17] Das wiederum bedeutet aber, daß es so etwas wie die autobiographische Form per se gar nicht geben kann:
„Wie man erzählt, hängt immer auch davon ab, was man erzählt und wozu man erzählt.“[18]
Doch von diesem ‚fast trivialen Grundsatz’[19] scheinbar ungerührt, behandeln „[n]eun von zehn Autobiographen“ die Frage nach der Reihenfolge ihres Erzählens „so als ob sie sich gar nicht stellte“ und halten einfach mehr oder weniger streng an der kalendarischen Ordnung ihrer Lebensfakten fest.[20] Damit setzen sie dem Ausdruck einer wie auch immer gearteten Bedeutsamkeit, Sinnhaftigkeit oder „Einzigartigkeit“ ihres erzählten Lebens natürlich eine unnötige Grenze bzw. verlagern dieses Problem auf die Ebene des ‚Inhalts’ oder auf die des ‚Stils’.[21] Eine solche Verlagerung kann mehr oder weniger gelingen, doch sie ist in jedem Fall nicht konsequent im Blick auf den eigentlichen Sinn der Selbstbetrachtung:
„Denn wer zwingt sie [Simone de Beauvoir als Beispiel für Autobiographen, die sich zwar der Problematik der chronologischen Ordnung bewußt sind, aber daraus nicht die erforderlichen Konsequenzen ziehen], dem vorgefertigten Modell der linearen Erzählung zu folgen? Warum erfindet sie nicht vielmehr jene Form, die ihrer Erfahrung angemessen ist?[22]
Bezüglich der Erzählstruktur kommt also der existentiellen Funktion des autobiographischen Erzählens häufig nicht die zentrale Bedeutung zu, die ihr gebühren würde. Dem Faktum, daß es „letztlich der Sinn [ist], der bis in die chronologische Abfolge hinein die Erzählung organisiert“, wird nur in wenigen Fällen in seiner ganzen Tragweite Rechnung getragen.[23]
Damit wären wir beim letzten noch zu klärenden Begriff angelangt: Gerade in modernen autobiographischen Texten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich radikalere Verwirklichungen des o.g. Grundsatzes und damit auch eine größere formale und ästhetische Vielfalt und Komplexität erkennen, die ihre Untersuchung im Lichte der o.g. Fragestellung auch hinsichtlich der ‚Form’ lohnend erscheinen läßt. In welchem Kontext läßt sich dieser innovative Aufschwung verstehen? Erinnern wir uns an Joan Didions Aussagen zum Erzählen. Trotz der von ihr festgestellten existentiellen Notwendigkeit des Erzählens klingt im Zitat auch eine gewisse Skepsis gegenüber dieser ‚Lebensstrategie’ an: Erzählen vereinfacht die Vielfalt des Lebens, es ‚friert’ sie in einem Raster von ‚erlernten’ Sinn- und Moralvorstellungen - ‚ideas’ (vgl. die distanzierenden Anführungszeichen im Original) - ein. Und - das wäre eine Konsequenz, die sich als Frage aus dem Zitat ziehen ließe - was wäre, wenn die kollektiven oder individuellen ‚ideas’ fragwürdig würden? Wovon sollte man dann erzählen, nach welchen Prinzipien den Stoff seiner Geschichten auswählen und wie davon erzählen? Wäre in einem solchen Fall nicht alles Erzählen ein sinnloses, betrügerisches und zum Scheitern verurteiltes Unterfangen? Didions Standpunkt - das Bewußtsein von der existentiellen Bedeutung des Erzählens einerseits und die Skepsis gegenüber der ihm so eigentümlichen Sinn- und Ordnungs-Suggestion andererseits - und die sich daran anschließenden Fragen verweisen direkt auf Probleme und Krisen der modernen Erzählliteratur. Angesichts einer Welt, die immer unzusammenhängender, chaotischer, eigen- und übermächtiger erlebt wurde, dem Verlust der Vorstellung von der Autonomie des Subjekts und dem Schwinden kollektiver, allgemein verbindlicher Sinn- und Wertesysteme wurde das Erzählen in seinem traditionellen Sinne von ‚Geschichten erzählen’ im 20. Jahrhundert mehr und mehr in Frage gestellt. Die ihm eigentümliche Sinn-Suggestion erwies sich vor dem Hintergrund der krisenhaften Welt- und Identitätserfahrung (und im Zusammenhang mit Vorstellungen von einer wie auch immer gearteten überindividuellen Befragbarkeit von (Erzähl-) Literatur) als etwas Unangemessenes, Falsches oder gar Lügnerisches, als etwas, das es zu reflektieren, zu durchbrechen oder zu vermeiden galt. So kam es zu vielfältigen Erzähl-, Sprach- und Formkrisen, in denen versucht wurde, der Abwesenheit der ‚großen’ Sinn-Konzepte und endgültigen Wahrheiten durch neue Erzählweisen und -formen Rechnung zu tragen.[24] Speziell für das moderne autobiographische Erzählen lassen sich in diesem Zusammenhang folgende Tendenzen feststellen:[25]
1) Mit dem Verlust kollektiver Wahrheiten und Sinn-Systeme erhält das Subjektive und Individuelle, die Hinwendung zu ‚bloß’ individuell relevanten Sinn-Konzepten, die Suche nach den ganz persönlichen Lebens-Wahrheiten generell eine größere Notwendigkeit und Dringlichkeit als bisher. Entgegen aller Prognosen vom Tod oder der ‚Verunmöglichung’[26] der Autobiographie in der Moderne kommt das autobiographische Erzählen daher im 20. Jahrhundert keineswegs zum Erliegen - freilich zeigt es sich meist in ganz anderer Gestalt als beispielsweise die ‚großen’ bürgerlichen Autobiographien des 19. Jahrhunderts.
2) Die ‚Krisen’ des Erzählens und die damit verbundene allgemeine Sensibilisierung für Probleme des Erzählens in formaler wie epistemologischer Hinsicht zeigen sich im autobiographischen Erzählen generell in einem gestiegenen Bewußtsein der Autoren für die Möglichkeiten, aber auch Grenzen, illusorischen Suggestionen und ‚Fallen’ des (autobiographischen) Erzählens und in der konsequenten darstellerischen Umsetzung ihrer jeweiligen autobiographischen Intentionen - oft unter Rückgriff auf innovative, dem modernen fiktionalen Erzählen entlehnte Verfahren und Techniken: Der Rückgriff auf komplexe (nicht-chronologische) Ordnungsmuster, die Übernahme gattungsfremder Elemente, die „Tendenz zum bewußt Fragmentarischen“[27] und die Zunahme von Reflexionen - vor allem metanarrativer Art - all dies gehört in den Innovations-Katalog moderner Autobiographik. Die Liste ließe sich fortsetzen, doch sie ist insofern wenig aussagekräftig, als sie nur die Formen und nicht die Funktionen des Erzählens berücksichtigt.
3) Hinsichtlich der intentionalen und funktionalen Dimensionen moderner Selbstbetrachtungen läßt sich ebenfalls von einer Veränderung sprechen: Die modernen Krisen des Erzählens gingen nicht zuletzt einher mit ‚Krisen des Subjekts’ bzw. ‚Krisen des Ich’, in denen die Vorstellung vom Subjekt bzw. Ich als eine „sich seiner selbst bewußte, einheitliche und selbstmächtige Instanz“ wenn nicht verloren ging, so doch massiv in Frage gestellt wurde.[28] Im Gegensatz zu den klassischen Autobiographien dient modernes autobiographisches Erzählen daher nur mehr selten der Darstellung von gesicherter Identität und Selbsterkenntnis. Oft entspringt es krisenhaften Selbst- und Welterfahrungen und stellt eine unmittelbare Suche nach persönlicher Sinn-Orientierung und existentiellem Halt dar. Das heißt, wir haben es nicht unbedingt mit einem grundsätzlichen Wandel der Funktionen des Erzählens zu tun, sondern mit einer Verlagerung des Akzentes vom „Verfügen über sinnweltliche Deutung zum Suchen einer solchen.“[29] Eine Suche, die überdies oft partiell oder unabgeschlossen und erfolglos bleibt, weil nicht selten „der Anspruch des autobiographischen Ichs, die Wirklichkeit und die eigene Beziehung zu ihr durchschaubar vorzustellen, die eigene Geschichte als sinnvoll und zusammenhängend zu gestalten, radikal in Frage gestellt [wird].“[30]
Womit wir bei den Texten angelangt wären, um die es gehen soll: Die grundsätzliche Gemeinsamkeit von Les Mots (1964)[31] von Jean-Paul Sartre (1905-1980), Der Seesack. Aus einer Autobiographie (1977)[32] von Alfred Andersch (1914-1980) und The White Album (1979) von Joan Didion (geb. 1934) besteht darin, daß es moderne autobiographische Texte sind, deren Autoren sich - natürlich auf jeweils eigene Weise, auf ganz unterschiedlichen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln - der vielfältigen Ordnungs-, Selektions-, und Darstellungsmöglichkeiten des Erzählens bedienen und sich dabei z.T. „weit von den überkommenen Formen der Gattung [entfernen]“.[33] Der grundsätzliche Unterschied zwischen ihnen besteht in der zugrunde liegenden existentiellen Haltung und der Funktion, die das Erzählen jeweils erfüllt bzw. erfüllen soll. Dieser Unterschied gab letztlich den Ausschlag für die Wahl der Texte: Geradezu exemplarisch läßt sich diesbezüglich eine Entwicklung hin zum Suchen, Fragen und Zweifeln nachvollziehen, wie sie generell für die Entwicklung des modernen autobiographischen Erzählens charakteristisch zu sein scheint. Hilfsweise könnte man sagen: Jeder Text repräsentiert sozusagen eine bestimmte ‚Etappe’ in der zunehmenden Ausschöpfung, aber auch Infragestellung der Möglichkeiten erzählender autobiographischer Sinn-Produktion. Von Sartre über Andersch zu Didion läßt sich eine Linie ziehen, die von der erzählenden Sinn-Deutung, vom zumindest teilweisen Verfügen über eine Sinnerkenntnis, über das Fragen und Suchen nach einer solchen ins bloße Schauen und Verweigern jeder Suche führt. Diese Linie soll den übergreifenden Zusammenhang dieser Arbeit bilden, der die Untersuchungen und Analysen der einzelnen Texte miteinander verbindet.
Zum Vorgehen: Trotz der anfangs genannten Einschränkungen hinsichtlich der theoretischen Reichweite dieser Arbeit wird es nötig sein, den konkreten Textanalysen einige theoretische und allgemeine Überlegungen voranzustellen (Kap. 2): So sollen zunächst die Begriffe ‚autobiographisch’ bzw. ‚Autobiographie’ und ‚Erzählen’ im literaturwissenschaftlichen Sinn definiert werden, um den gattungstypologischen Standort der Texte zumindest grob zu bestimmen und für die folgenden Analysen das nötige begriffliche ‚Rüstzeug’ bereitzustellen (Kap. 2.1). Daran fügen sich einige Überlegungen zur existentiellen Funktion autobiographischen Erzählens im allgemeinen sowie zu den Hintergründen, Bedingungen und typologischen Merkmalen der Akzentverschiebung im modernen autobiographischen Erzählen im besonderen an, mit denen die oben aufgestellten Thesen vertieft und differenziert werden sollen (Kap. 2.2).
Der dritte Teil der Arbeit umfaßt die Analysen der Texte. Aufgrund ihrer Verschiedenheit werde ich die Texte getrennt behandeln (Kap. 3.1, 3.2, 3.3). In den einzelnen Untersuchungen fließen jeweils zwei Interessenrichtungen zusammen. Die eine richtet sich generell auf den Zusammenhang zwischen der existentiellen Funktion, die das autobiographische Erzählen jeweils für die Autoren erfüllt, und der spezifischen Selektion, Anordnung und Präsentation des Lebensstoffes. Die Gliederung meines Vorgehens in den einzelnen Text-Kapiteln wird sich nach dieser Fragestellung richten: Für jeden Text möchte ich untersuchen, welche Funktion er für seinen Autor hat (Kap. 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1), wie sich diese Funktion in den Formen und Gegenständen des Erzählens manifestiert (Kap. 3.1.2, 3.2.2, 3.3.2) und welchen Ausgang bzw. welches Ergebnis die autobiographische Suche hat (Kap. 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3). Die zweite Interessenrichtung bezieht sich auf die Modernität und Innovativität der Texte im oben erläuterten Sinne: Inwiefern heben sich die Texte von der Tradition ab und inwiefern sind sie darin miteinander vergleichbar? Diese Fragen bestimmen die Untersuchungs- und Deutungsschwerpunkte bei den Analysen der Texte, das heißt, ich werde natürlich nur diejenigen inhaltlichen und formalen Besonderheiten behandeln, die mir im Hinblick auf die Entwicklungen der modernen Autobiographik bedeutsam erscheinen. Die entsprechenden Einordnungen und Abgrenzungen werden in die Analysen einfließen und in einem abschließenden Resümee noch einmal in geraffter Form rekapituliert. Ich möchte jedoch ausdrücklich betonen, daß die Texte trotz dieser zweiten Ausrichtung an keiner Stelle nur wie Steinbrüche für moderne Darstellungstechniken ausgebeutet werden sollen. Die Texte als Ganzes zu verstehen und zu erfassen, ist mir ein ebenso wichtiges Anliegen wie die Herausstellung ihrer innovativen Merkmale und Komponenten. Diesem Anspruch werde ich vor allem in den jeweiligen Kapiteln zum Textaufbau (3.1.2.1, 3.2.2.1, 3.3.2.1) Rechnung tragen, die gewissermaßen die Herzstücke der Textanalysen bilden.[34]
2. Theoretischer Teil
2.1 Begriffsbestimmungen
Die Texte von Sartre, Andersch und Didion sind moderne Texte - das zeigt sich schon darin, daß sie z.T. nicht unbedingt dem entsprechen, was man sich gemeinhin unter einer ‚typischen’ Autobiographie und unter einer ‚typischen’ Erzählung vorstellt. Gerade deshalb ist es nötig, ein Begriffsinstrumentarium bereit zu stellen, mit dem sich der Standort der Texte in Bezug zu den verschiedenen autobiographischen Gattungen und auf dem weiten Feld der Erzählliteratur genauer bestimmen läßt. Dabei wird es notgedrungen (siehe die anfangs umrissene Forschungssituation) vor allem um formale und inhaltliche Kriterien des (autobiographischen) Erzählens gehen.[35] Da sich die Autobiographie-Forschung bisher nur wenig und vor allem nicht im Rahmen von systematischen Gattungsbestimmungen um innovative Erscheinungen moderner Autobiographik gekümmert hat, kann außerdem nicht der Anspruch erhoben werden, allen Texten, um die es hier gehen soll, jeweils ihren klar definierten Platz innerhalb einer autobiographischen Gattung ‚zuzuweisen’. Am Beispiel des Essays soll diese unbefriedigende Forschungslage kurz erläutert werden.
2.1.1 Die Autobiographie und ihre Nachbargattungen
Eine Autobiographie ist eine „[ r ] ückblickende Prosaerzählung einer tatsächlichen Person über ihre eigene Existenz, wenn sie den Nachdruck auf ihr persönliches Leben und insbesondere auf die Geschichte ihrer Persönlichkeit legt.“[36] Diese Definition von Philippe Lejeune soll im folgenden gelten, denn sie enthält die wesentlichen Formalia der Hauptgattung ‚Autobiographie’, ermöglicht sowohl Differenzierungen innerhalb des Feldes der autobiographischen Literatur als auch Abgrenzungen zu den wichtigsten benachbarten Gattungen fiktionaler und faktualer Erzählliteratur und kann damit als Folie oder Orientierungspunkt für den Begriff des ‚autobiographischen Erzählens’ dienen. Die Definition enthält „Elemente“ aus vier verschiedenen „Kategorien“:
„1) Sprachliche Form: a) Erzählung b) in Prosa
2) Behandeltes Thema: individuelles Leben, Geschichte einer Persönlichkeit.
3) Situation des Autors: Identität zwischen dem Autor (dessen Name auf eine tatsächliche Person verweist) und dem Erzähler.
4) Position des Erzählers: a) Identität zwischen dem Erzähler und der Hauptfigur b) rückblickende Erzählperspektive.“[37]
Während die Autobiographie alle genannten Bedingungen erfüllt, gelten für die Nachbargattungen jeweils nur einige der Bedingungen. Konstitutiv für die Autobiographie wie auch für alle anderen „Gattungen der intimen Literatur (Memoiren, Tagebuch, Essay)“ sind die Bedingungen 3 und 4a, das heißt die Identität zwischen Autor, Erzähler und Hauptfigur.[38] Darin besteht der wichtigste Unterschied zur Biographie (Nicht-Identität von Erzähler und Hauptfigur) und zum ‚Ich-Roman’ (Nicht-Identität von Autor und Erzähler). Letzteres, also die Identität oder Nicht-Identität von Autor und Erzähler, läßt sich bei einem Text, der alle anderen Bedingungen der Autobiographie erfüllt, allerdings nicht allein mittels textinterner Merkmale feststellen. Die Entscheidung darüber ist abhängig von der „Namensidentität“, das heißt davon, ob das Redesubjekt auf den Namen des Autors auf dem Titelblatt verweist.[39] Nur wenn ein Text diese Identität behauptet, ist er als autobiographisch anzusehen. In diesem Fall kommt es zum ‚autobiographischen Pakt’:
„Der autobiographische Pakt ist die Behauptung dieser Identität im Text, die letztlich auf den Namen des Autors auf dem Umschlag verweist.“[40]
Für die anderen Gattungen der ‚intimen Literatur’ gelten folgende Unterscheidungen: Die Memoiren erfüllen nicht die Bedingung 2, weil sie sich hauptsächlich auf die öffentliche Seite eines Lebens beziehen, das autobiographische Gedicht ist nicht in Prosa (1b), im Tagebuch besteht keine rückblickende Erzählperspektive (4b), ebensowenig im ‚Selbstportrait oder Essay’, bei denen außerdem das Kriterium ‚Erzählung’ nicht erfüllt ist (1a, 4b). Allerdings räumt Lejeune ein, daß eine Autobiographie nicht jede der innerhalb des Feldes der ‚intimen Literatur’ distinktiven Bedingungen „vollständig“ erfüllen muß.[41] So kann eine Autobiographie neben erzählender Rede natürlich auch nicht-narrative Rede (Reflexionen, Redewiedergaben etc.) enthalten, die Retrospektive kann durch die Thematisierung der Schreibgegenwart oder durch tagebuchähnliche Passagen durchbrochen werden, und in die persönliche Geschichte kann durchaus auch allgemein Sozialhistorisches oder Politisches einfließen. Eine Klassifizierung muß sich in solchen Fällen nach der ‚Proportion’ und Dominanz jeweiliger Merkmale richten; im Zweifelsfall sollte man jedoch - so klingt es in Lejeunes Hinweis auf ‚Sonderfälle’ und „Übergänge zu den anderen Gattungen der intimen Literatur“ an - lieber auf eine rigide ‚entweder-oder’ Entscheidung verzichten.[42]
Diese Relativierungen sind für meine Arbeit besonders wichtig. Wie sich zeigen wird, lassen sich allein Les Mots als Autobiographie bezeichnen, die alle von Lejeune genannten Bedingungen ‚hauptsächlich’ erfüllt. Der Seesack ist - wie der Untertitel schon andeutet - nur der Fragment gebliebene Teil einer Autobiographie und erfüllt damit die Bedingung 2 natürlich nicht ‚vollständig’. Darüber hinaus enthält der Text neben erzählenden und retrospektiven Teilen eine große Anzahl von gattungsuntypischen Elementen wie z.B. allgemein philosophische oder politische Reflexionen, Tagebuchaufzeichnungen, portraitähnliche Passagen und Deutungen eigener Werke. Dennoch verbieten es der Untertitel und seine insgesamt erzählende und retrospektive Anlage, diesen Text als Essay, Selbstportrait oder gar als Tagebuchaufzeichnung zu klassifizieren - ‚Autobiographie-Fragment’ ist und bleibt hier die wohl treffendste Bezeichnung. Am schwierigsten verhält es sich mit The White Album: Die Bedingung 2 läßt sich nur dann als erfüllt betrachten, wenn man ‚individuelles Leben’ sehr weit auslegt, denn der Text bezieht sich lediglich auf eine ganz spezielle Krisenerfahrung innerhalb einer begrenzten Lebensphase.[43] Häufig - nicht zuletzt auch aufgrund seines relativ geringen äußeren Umfangs[44] - ist daher vom White Album als einem ‚autobiographischen Essay’ die Rede. So z.B. bei Graham Good, der den Text im Rahmen seiner Untersuchung von Identity and Form in the Modern Autobiographical Essay behandelt.[45] Good bestimmt den Essay im Gegensatz zu wissenschaftlichen Abhandlungen als prinzipiell autobiographisches Unternehmen, in dem „the subjective reactions of the essayist stemming from his or her personal experiences and tastes are bound to come into play.“[46] Der autobiographische Essay unterscheidet sich von anderen Essayarten (kritischer Essay, Reise-Essay, moralischer Essay) darin, daß nicht nur seine Perspektive, sondern auch sein ‚Objekt’ „personal and private as well“ ist (wenngleich oft zusätzlich ein überindividuell relevantes Thema fokussiert wird).[47] Von der Autobiographie unterscheidet er sich im äußeren Umfang, im Gegenstand (begrenzter Zeitabschnitt, Episode) sowie in der Art und Reichweite der zugrunde liegenden Sinnproblematik einschließlich der davon bestimmten spezifischen Strukturierung und Gestaltung des ‚Stoffes’:
„the essayist does not usually draw conclusions about the significance of his or her whole life to date, in the way that most autobiographies do. There is no overarching design, only a more provisional design to cover the episode in question.”[48]
Good präzisiert damit eine der ‚Übergangs’-Unschärfen von Lejeunes Definition (Text-Umfang, Gegenstand) - allein der Begriff ‚Essay’ erscheint mir als Oberbegriff für die von ihm untersuchten Formen der Autobiographik problematisch, da er nicht nur bei Good, sondern im allgemeinen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch in relativ unpräziser Bedeutung verwendet wird und eine recht unklare, um nicht zu sagen, willkürliche Extension hat. Die intensionale Unschärfe des Begriffs gründet sich vor allem auf den bisher noch eher losen bzw. uneinheitlichen Bestimmungen der formalen und typologischen Merkmale des Essays.[49] Weitgehender Konsens herrscht lediglich in Bezug auf die Identität von Autor, Erzähler und ‚Hauptfigur’, auf die betont subjektive Perspektivierung und auf den stilistisch-sprachlichen Charakter einer verständlichen und in Prosa gehaltenen ‚Abhandlung’ (keine Erzählung). Allerdings ließe sich schon letzteres Kriterium (wie auch das von Lejeune genannte Merkmal der nicht-retrospektiven Ausrichtung des Essays) nicht ohne weiteres für den ‚autobiographischen Essay’ übernehmen: Good weist zwar auf den allgemein diskursiv-reflexiven, da auf die Untersuchung eines konkreten Problems angelegten Charakter des Essays hin, scheut sich aber gleichzeitig nicht, einen Text wie The White Album in seine Untersuchung einzubeziehen, in dem die erzählenden und berichtenden Passagen gegenüber solchen, die Reflexionen enthalten, deutlich im Übergewicht sind. Im Gegensatz zu Lejeune scheint Good die sprachliche Form überhaupt nicht als distinktives Kriterium zu berücksichtigen. In dieser terminologischen Willkür spiegelt sich die ‚verwirrende Lage’[50] auf dem Feld der Essayistik wider, angesichts derer viele Forscher die Frage nach einer engeren „(literatur-) wissenschaftlichen Definition“ mit dem allgemeinen Hinweis auf die ‚offene Form’ des Essays inzwischen beiseite geschoben oder gar für „unmöglich“ zu beantworten erklärt haben.[51] So ist aus der „Gattung, die keine werden wollte“, eine Nische für Verschiedenes geworden:[52]
„Essay, das scheint das Paßwort zu einer literarischen Haltung zu sein, in der jeder alles auf seine Weise tun kann; es bedeutet ganz einfach, sich an einem Thema zu versuchen und sich dabei zu seiner eigenen Subjektivität zu bekennen.“[53]
Angesichts dieser ex- und intensionalen Unbestimmtheiten scheint es mir ratsam, mit dem Ausdruck ‚Essay’ so vorsichtig und sparsam wie möglich umzugehen. Er soll daher im folgenden auch nicht als Gattungsbezeichnung zur Verwendung kommen, sondern lediglich als Stichwort im Zusammenhang mit der spezifischen von Good beschriebenen Entwicklungslinie in der modernen Autobiographik.[54]
Zurück zu Lejeune und Didions Text: Im Rahmen seiner Definition scheint es weder befriedigend, The White Album als ‚Autobiographie’ zu bezeichnen, noch kommt der Text einer der anderen autobiographischen Formen, die Lejeune nennt, besonders nahe. Man könnte dies zum Anlaß nehmen, die von Lejeune anhand seiner Definition vorgenommenen Differenzierungen der ‚intimen Literatur’ als zu grob und lückenhaft zu kritisieren. Andererseits ging es ihm hauptsächlich um die grundsätzliche Abgrenzung der Autobiographie zum (Ich-) Roman. Gegen seine Definition der Autobiographie und die Bestimmung ihrer wesentlichen Formalia läßt sich hingegen - einmal abgesehen von der etwas unpräzisen Festlegung ihres Gegenstandes und Umfangs - nichts einwenden. Zu bemerken ist außerdem, daß Lejeune trotz seiner differenzierten und recht ‚normativ’ wirkenden Definition für eine ‚deskriptive’ und ‚historische’ Auffassung von Gattungen plädiert.[55] In diesem Sinne sind zunehmende Abweichungen von der Gattungs-‚Norm’ (die keine präskriptive Regel sein sollte) lediglich Anzeichen für die historische Weiterentwicklung der Gattung, welche der Gattungstheoretiker durch eine deskriptive Analyse zu erfassen suchen sollte. Eben dies scheint in Zukunft für die moderne Autobiographik nötig zu sein. Wie das Beispiel Didion und der Exkurs zum Essay angedeutet haben, bedarf es einer differenzierteren Systematik und verbindlichen Terminologie, mit denen sich auch inhaltlich wie umfangmäßig begrenzte autobiographische Texte bzw. die zunehmende Vielfalt der ‚Übergänge’ und ‚Sonderfälle’ erfassen lassen. Allerdings wird dies - wenn überhaupt - wohl nur dann gelingen, wenn formale, inhaltliche und funktionale Kriterien gleichermaßen berücksichtigt werden.
Hilfsweise lassen sich die terminologischen Probleme mit dem Begriff des ‚autobiographischen Erzählens’ umgehen. Er erlaubt in Bezug auf Didions Text die Vermeidung irreführender bzw. unpräziser Termini und bildet gleichzeitig den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich alle drei Texte bringen lassen. Für diesen Minimalbegriff lassen sich die Bedingungen ‚Erzählung’ und ‚Identität von Autor, Erzähler und Hauptfigur’ aus Lejeunes Definition übernehmen (er umfaßt damit die von Lejeune genannten Gattungen Autobiographie, Tagebuch, Memoiren und autobiographisches Gedicht), während er hinsichtlich des Gegenstandes (und Umfangs), der Erzählperspektive und der sprachlichen Form flexibel bleibt. Stellt sich nun die Frage: Was genau heißt eigentlich ‚Erzählen’?
2.1.2 Erzählen
Ich werde mich im folgenden ausschließlich auf Dietrich Webers Erzähltheorie[56] beziehen und seine Definition von Erzählen kurz vorstellen. Weber orientiert sich nicht nur an den klassischen ‚Paradebeispielen’ von Erzählen, sondern versucht, der Vielfalt und Heterogenität auf dem großen Feld dessen, was tatsächlich als ‚Erzählliteratur’ angesehen wird, gerecht zu werden (seine Theorie ist damit ein Beispiel für ein ‚deskriptives’ statt ‚normatives’ Vorgehen). So liefert er eine präzise Definition des Erzählens, die jedoch z.B. auch Begriffe wie ‚schwaches Erzählen’ bzw. Erzählen ‚im weitesten Sinn’ enthält.[57] Damit bietet seine Theorie eine gute Basis für die Untersuchung von autobiographischen Texten, bei denen das Erzählen z.T. ganz offensichtlich in einer Krise steckt und sich nicht unbedingt ‚typisch’ darstellt.[58]
Erzählen hat nach Weber folgende strukturelle Merkmale:
1) Es ist „immer Darstellung einer Reihe zeitlich bestimmter Sachverhalte“, das heißt, es ist immer durch eine „Zeitpunkt-Markierung“, meistens auch durch eine „Zeitfolge-Markierung“ bestimmt.[59] Im Falle einer Zeitfolge-Markierung handelt es sich um das traditionelle Geschichtenerzählen - das „Und-dann-Erzählen“, welches „Dynamischem“ gilt und „Situationsveränderung[en]“ darstellt.[60] Hier unterscheidet Weber nochmals drei Modelle: das „Geschichtenerzählen im engsten Sinn“, bei dem die Erzählung fünf zeitlich aufeinanderfolgende Phasen durchläuft (etwa: Exposition, Komplizierung, Höhepunkt / Krise, Auflösung, Endzustand);[61] das „Geschichtenerzählen im engen Sinn“ mit drei Phasen (etwa: Exposition, Komplikation, Lösung);[62] sowie das „Geschichtenerzählen im weiteren Sinn“, welches einfach „zeitlich aufeinanderfolgende Begebenheiten“ ohne eines der o.g. typischen Verlaufsmuster darstellt.[63] Diese drei Modelle faßt Weber unter dem Begriff des ‚starken Erzählens’ zusammen.[64] Dem stellt er ein viertes Modell gegenüber - das „Erzählen im weitesten Sinn“, welches keinen ‚und-dann-... und-da- ...’-Verläufen gilt, sondern statischen „Situationen, Zuständen, Umständen“.[65] Dieses „Und-und-Erzählen“ bedarf lediglich einer ungefähren Zeitpunktmarkierung (z.B. einmal, manchmal, oft o.ä.).[66] Im Gegensatz zum ‚starken Erzählen’ ist es ‚schwaches Erzählen’:
„Starkes Erzählen ist geradlinig, zielstrebig, geschlossen. Schwaches Erzählen ist locker, mosaikhaft, offen“.[67]
2) Eine Erzählung handelt (im Gegensatz zum Drama) immer von „Nichtaktuellem“.[68] In vielen Fällen läßt sich dies noch konkretisieren: Erzählen ist meist Darstellung von Vergangenem:
„Jetzt das Erzählen, damals das Erzählte - sei das Erzählte nun lange vergangen oder gerade erst vergangen, sei es selbsterlebt oder von anderen überliefert, sei es wirklich vergangen oder der Fiktion nach vergangen.“[69]
3) „Erzähler sind Außenstehende.“[70] Dieser Grundsatz steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem vorhergehenden: Erzähler sind insofern immer Außenstehende, als sie zum Zeitpunkt ihres Erzählens nicht inmitten des Geschehens stehen, von dem sie erzählen.[71] Dieser Grundsatz bezieht sich jedoch lediglich auf die zeitliche Distanz zwischen Erzähltätigkeit und erzähltem Geschehen und darf nicht mit der z.B. für (autobiographische) ‚Ich-Erzählungen’ typischen Beteiligung eines Erzählers am erzählten Geschehen verwechselt werden.[72]
4) Aus Grundsatz 2 und 3 ergibt sich: „Erzählen hat zwei Orientierungszentren.“[73] Das eine liegt im „Ich-Hier-Jetzt-System“ des Erzählenden, das andere im „Ich-Hier-Jetzt-System“ des erzählten Geschehens bzw. der daran beteiligen Personen.[74] Am deutlichsten tritt diese doppelte Orientierung wiederum in (autobiographischen) ‚Ich-Erzählungen’ hervor, bei denen die Orientierungszentren einander meist explizit gegenübergestellt werden und sich im Verlauf der Erzählung abwechseln können. Dieser typischen Doppelpoligkeit entsprechen die Paare ‚erinnerndes vs. erinnertes Ich’ bzw. ‚erzählendes vs. erzähltes Ich’:
„Das Orientierungszentrum I bildet das sich erinnernde erzählende Ich; das Orientierungszentrum II bildet das erinnerte, seinerzeit erlebende, sozusagen erzählte Ich. Als erzählendes Ich ist es inzwischen Außenstehender in der Betrachtung von inzwischen Nichtaktuellem, als erlebendes Ich ist es ein in einem aktuellen Geschehen stehender Akteur.“[75]
5) Der fünfte Grundsatz ist eine ‚Selbstverständlichkeit’ und läßt sich auf den grundsätzlichen Handlungscharakter von Sprache zurückführen: Erzählen, ob mündlich oder schriftlich, ist prinzipiell „adressiert“, das heißt, es richtet sich immer an jemanden - sei es explizit oder implizit, an einen vorgestellten Leser / Hörer, an ein konkretes Publikum oder an die Person des Erzählenden selbst.[76]
6) Da alle der bisher genannten Grundsätze auch für das Berichten gelten und die Übergänge zwischen den beiden Redeweisen ‚fließend’ und nur ‚stilistischer’ Natur sind, schlägt Weber vor, Erzählen und Berichten nicht strikt zu trennen und lediglich zwischen „erzählend-berichtend oder berichtend-erzählend strukturierte[n] Text[en]“ zu unterscheiden.[77] So lautet der sechste Grundsatz: „Erzählen ist entfaltetes Berichten“.[78] Im engeren Sinn lassen sich Erzählen und Berichten wie folgt charakterisieren: Erzählen ist eher „sukzessiv“ und „imperfektisch“, das heißt, es stellt ‚Geschehnisse in ihrem Verlauf’ und erst noch zu ‚vollendende Tatsachen’ dar; Berichten hingegen ist eher „resultativ“ und „perfektisch“, da hier der Akzent auf Resultaten und vollendeten Tatsachen liegt.[79]
7) Insbesondere für komplexe schriftliche Erzählungen gilt außerdem: „Erzählen besteht in der Regel nicht nur aus Erzählen.“[80] Folgendes Schema faßt die verschiedenen Redeweisen zusammen, die Erzählungen „im Kern“ und „am Rand“, „konstitutiv“ oder „fakultativ“ enthalten (können):[81]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Diese sieben Grundsätze sollen für die folgenden Überlegungen als verbindliche Definition gelten. Mit ihnen wird es möglich sein, genauer zu bestimmen, mit welcher Art von Erzählen wir es in den drei Texten zu tun haben.
2.2 Funktionen, Formen und Gegenstände (modernen) autobiographischen Erzählens - grundsätzliche Überlegungen
In diesem Kapitel sollen die in der Einleitung thesenhaft formulierten Überlegungen zur existentiellen Funktion autobiographischen Erzählens sowie zu den existentiellen und epistemologischen Hintergründen des modernen autobiographischen Erzählens und den damit verbundenen typologischen Entwicklungen und Konsequenzen differenziert dargelegt werden. Den Ausgangspunkt bildet der Zusammenhang zwischen autobiographischem Erzählen und personaler Identität, mit dem sich die existentielle Funktion autobiographischen Erzählens noch genauer fassen und erklären läßt als eingangs geschehen.
2.2.1 Die existentielle Funktion autobiographischen Erzählens
2.2.1.1 Autobiographisches Erzählen und personale Identität
Ich werde im folgenden auf einige grundlegende Annahmen Erik H. Eriksons zur ‚Ich-Identität’ sowie auf einen Aufsatz von Michael von Engelhardt[82] zurückgreifen, der, ausgehend von einer Zusammenfassung der wichtigsten psychologischen und soziologischen Identitätstheorien, den allgemeinen Zusammenhang von Identität und Sprache bzw. Identität und autobiographischem Erzählen darzustellen versucht.
Erikson definiert den Begriff ‚Identität’ als „wechselseitige Beziehung, [... insofern,] als er sowohl ein dauerndes inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilhaben an gruppenspezifischen Charakterzügen umfaßt.“[83] Das heißt, Identität besteht, wenn einer Persönlichkeit kontinuierlich ein ausgewogenes und ausgeglichenes Zusammenspiel von psychischer und sozialer Entwicklung gelingt. In diesem Sinne ist Identität nichts, was zu irgendeinem Zeitpunkt der Persönlichkeitsentwicklung einfach erreicht wäre - ihre Bildung vollzieht sich vielmehr in einer „lebenslange[n] Entwicklung, die für das Individuum und seine Gesellschaft weitgehend unbewußt verläuft.“[84] Diesen Entwicklungsprozeß versucht Erikson mittels einer idealtypischen Darstellung der psychosozialen Stadien und Krisen, in denen sich die Genese der Persönlichkeit vollzieht, differenziert und systematisch darzustellen.[85] Basis seiner Erläuterungen bildet die Annahme, daß sich die Persönlichkeits-Entwicklung als epigenetischer „Vorgang zeitlich fortschreitender Differenzierung“ von biologischen, psychischen und sozialen Anlagen, Eigenschaften und Fähigkeiten vollzieht, wobei jede Differenzierung „systematisch mit allen anderen“ vorhergehenden und noch folgenden Differenzierungen „verbunden ist“.[86] Diese Differenzierungen vollziehen sich in für die verschiedenen psychosozialen Stadien der Persönlichkeitsentwicklung jeweils typischen ‚normativen’ Krisen.[87] Das Problem der Identität wird in der Adoleszenz „phasen-spezifisch“ und muß am Ende dieser Phase „seine Integration als relativ konfliktfreier psychosozialer Kompromiß finden - oder es bleibt unerledigt und konfliktbelastet.“[88] Die Möglichkeit eines ‚konfliktfreien Kompromisses’ impliziert jedoch ebenfalls nicht die endgültige ‚Erledigung’ des Problems. Für die Entwicklung der Identität sind nicht nur Verlauf und Ausgang der Adoleszenz, sondern die Bewältigung oder Nicht-Bewältigung aller noch folgenden (wie natürlich auch der ihr vorangehenden) ‚normativen Krisen’ bestimmend. In ihnen stellt sich das Problem der Identität ständig aufs Neue, aus neuen, den jeweiligen Entwicklungsstadien entsprechenden und individuell verschiedenen, da von den spezifischen sozialen Einflußfaktoren und Prägungen und vom spezifischen Verlauf vergangener Krisen abhängigen Blickwinkeln. Seelische Gesundheit bzw. eine stabile Ich-Identität ist damit, einfach gesagt, „v on der richtigen Entwicklung zur rechten Zeit abhäng[ig].“[89] Es würde zu weit führen, Eriksons differenzierte Erläuterungen zu den einzelnen Entwicklungsstadien und Krisen hier vorzustellen. Wesentlich für meine Zwecke ist an Eriksons Theorie die dynamische und genetische Bestimmung von Identität als eine auf Selbst und Welt bezogene Ausgleichs- und Anpassungsfähigkeit des Ich, die sich in einer Reihe von entwicklungstypischen Krisen bildet und darin stets aufs Neue gefordert wird. Das heißt, Identität ist etwas, das prinzipiell ‚auf dem Spiel steht’ und gefährdet ist.[90] Inwiefern gerade das Erzählen der eigenen Geschichte eine wesentliche Rolle bei der ständig vom Ich geforderten Identitätssicherung spielt, soll nun anhand von Engelhardts näherer Bestimmung der verschiedenen identitätskonstitutiven Ausgleichsleistungen des Ich erläutert werden.
Anknüpfend an Erikson versteht von Engelhardt unter dem Begriff der ‚personalen Identität’ die Fähigkeit eines Menschen, zwischen den verschiedenen psychischen, biologischen, biographischen und sozialen Einflüssen, die sein Dasein und Wesen von innen und außen prägen, zu vermitteln bzw. ein Gleichgewicht zwischen ihnen herzustellen und aufrecht zu erhalten. Dies geschieht in einem „dreifache[n] Vermittlungsprozeß“:[91]
1) „als Vermittlung zwischen der Person und ihrer sozialen Umwelt“:[92] Personale Identität kann nur zustande kommen, wenn es dem Menschen in einem ausgewogenem Maße gelingt, sowohl in Distanz zu seiner Umwelt zu treten, indem er ein „differenziertes Selbst- und Weltbild“ entwickelt, als auch sich in das konkrete soziale Umfeld bzw. in die gesellschaftliche Wirklichkeit im allgemeinen zu integrieren.[93] Zu diesem Aspekt personaler Identität gehört das von Erikson genannte ‚Teilhaben an gruppenspezifischen Charakterzügen’ - z.B. durch die Identifikation mit sozialen Rollen oder durch die Internalisierung und Erfüllung bestimmter Moral-, Sinn- und Wertvorstellungen - seien sie ideologischer, metaphysischer, religiöser oder allgemein ethisch-sittlicher Natur. Hier zeigt sich, daß Identitätsbildung immer auch wesentlich von den jeweils herrschenden gesellschaftlichen und sozialen Verhältnissen abhängig ist: Seine Gesellschaft liefert und sanktioniert in der Regel eine Reihe von ‚Identitäts-Angeboten’, die dem Menschen dabei helfen können, seinen individuellen Platz in der Welt zu finden.
2) „als Vermittlung zwischen den unterschiedlichen inneren Instanzen der Person“:[94] Mit der „Fähigkeit, sich zum Objekt seiner selbst zu machen“ ist der Mensch nicht nur in der Lage, sein Verhältnis zum ‚Außen’, sondern auch die Verhältnisse in seinem ‚Innern’ differenziert zu betrachten und zu regulieren.[95] Personale Identität besteht, wenn dem Ich ein ausgewogenes Management der verschiedenen von Es und Über-Ich (in welchem sich wiederum die soziale Seite der Identität offenbart, insofern es den Inbegriff der von Familie und Gesellschaft vermittelten und vom Ich internalisierten Wertvorstellungen und Normen darstellt) gesandten Impulse gelingt.
3) „als Vermittlung zwischen den verschiedenen historisch-biographischen Phasen im Lebenslauf des Menschen“.[96] Dieser Aspekt personaler Identität umfaßt die unter 1) und 2) genannten Aspekte und ergänzt sie um das Kriterium der Kontinuität: Da der Mensch „ein Wesen mit Zeit, ein Entwicklungswesen“ ist, erfordert personale Identität immer auch eine „Identität in der Zeit“ oder, wie es Erikson formuliert hat, ein ‚dauerndes Sich-Selbst-Gleichsein’.[97] Wiederum kommt es auf einen ausgewogenen Vermittlungsprozeß an: Personale Identität bedeutet in diesem Zusammenhang die Fähigkeit, sich einerseits von der Vergangenheit zu lösen, „um sich in eine gewandelte Gegenwart hineinfinden zu können“, die Vergangenheit aber andererseits durch ihre „deutende und bewertende Reorganisation“ in die Gegenwart zu integrieren.[98]
Die Voraussetzung dieser dreifachen Integrations- und Vermittlungsprozesse bildet die menschliche „Fähigkeit zur Selbstreflexivität“, das heißt zur Distanz gegenüber Welt und Selbst, die nur in und durch den „Dialog“ mit der sozialen Umwelt und mit sich selbst realisiert werden kann.[99] Das wesentliche Instrument zur Bildung und Sicherung personaler Identität ist damit die Sprache. Die wesentliche Form, in der dies geschieht, ist die der „Selbstaussage“, mit der ein Sprecher sich selbst Identität zuweist:
„Bei der Selbstaussage ist der Sprecher im Wechselspiel von Sprechen und Hören sowohl nach außen in die Sozialwelt als auch nach innen in die psychische Binnenwelt gerichtet. So spielt sich - freilich in unterschiedlicher Deutlichkeit - unweigerlich und gleichzeitig in jeder Selbstaussage die für die Ich-Identität konstitutive Vermittlung zwischen Personen und sozialer Umwelt und zwischen den inneren Instanzen der Person ab.“[100]
In der dialogischen Ausrichtung auf Hören und Sprechen, Innen und Außen, Ich und Welt und in der „Doppelung des Ich“, welches in der Selbstaussage immer Subjekt und Objekt zugleich ist, spiegeln sich in der Selbstaussage die für die Identität konstitutiven Voraussetzungen und Vermittlungsprozesse wider.[101] Allerdings haben nicht alle Arten der Selbstaussage für die Identitätsherstellung und -sicherung die gleiche Relevanz, und es gibt natürlich einen grundsätzlichen Unterschied zwischen einfachen Selbstbenennungen und -charakterisierungen (Name, äußere Merkmale etc.) und einer komplexen Autobiographie. Dieser besteht in der Form und im Zeitbezug: Selbstaussagen lassen sich danach unterscheiden, ob sie Identität eher ‚synchron’ in „konstative[n] Sprachhandlung[en] des Beschreibens und Typisierens“ oder eher ‚diachron’ bzw. ‚genetisch’ in der Sprachhandlung des Erzählens darstellen (in beiden Fällen können deutende, „bewertende, vorschreibende oder auch argumentative Sprachhandlungen“ hinzukommen).[102] Die synchronen Selbstaussagen, die im alltäglichen Leben eine große Rolle spielen, können sich nur auf die jeweils aktuell zu leistenden Vermittlungen zwischen Ich und Welt oder zwischen den inneren Instanzen der Person beziehen - die Herstellung von Identität als ‚Kontinuität’ kann in ihnen nicht geleistet werden. Dies gelingt nur durch Erzählen - dem „Ausdrucksmittel, mit dem alleine Zeit zur Darstellung gebracht werden kann und mit dem sich alleine Geschichte und Geschichten als konkrete Ereignis- und Erfahrungsgeschichten vergegenwärtigen lassen.“[103] In der erzählenden autobiographischen Selbstaussage wird die ‚Doppelung des Ich’ zu einer „biographisch-historischen Doppelung“, in der die Vermittlung zwischen Früher und Jetzt, vergangenem und gegenwärtigem Ich ihre adäquate Umsetzung finden kann:[104]
„Das Ich der Vergangenheit, von dem erzählt wird, und das Ich der Gegenwart, das erzählt, [...] sind durch die zwischen ihnen liegende Erfahrungs- und Entwicklungsgeschichte voneinander getrennt, was seinen Niederschlag in unterschiedlichen Lebenssituationen, [...] Sinnwelten und Identitätsformationen findet. Durch eben diese Erfahrungs- und Entwicklungsgeschichte sind sie aber auch miteinander verbunden, woraus sich die Einheit der Person in der psycho-sozialen Zeit ergibt, die um so eher einer gesonderten Absicherung über das Erzählen bedarf, wie die historisch-biographische Spannung zwischen Vergangenheit und Gegenwart anwächst.“[105]
Die erzählende Vermittlung zwischen diesen beiden Polen ist einerseits durch das vergangene Ich bestimmt, das „spontan Erinnern und Erzählen [steuert]“ oder sich „als verdrängter und vergessener Bestandteil des Gegenwarts-Ich“ der Erinnerung sperrt;[106] sie ist andererseits - und dies in weitaus höherem Maße - vom ‚Ich der Gegenwart’ bestimmt: Es liegt in der Natur des Bewußtseins, daß alles, was man sich vorstellt und ins Gedächtnis ruft, sich im Kontext der persönlichen Gegenwart darstellt und davon beeinflußt wird. Das heißt, die Erinnerung an frühere Erlebnisse und Erfahrungen kann diese nie so wiederholen, wie sie ‚wirklich’ stattgefunden haben, sondern ist stets bestimmt von Perspektiven und Standpunkten, die der gegenwärtigen Erfahrungswirklichkeit entspringen. Es gibt keine objektiv rekonstruierbare ‚Vergangenheit an sich’, sondern nur eine subjektiv zu konstruierende ‚Vergangenheit für mich’.[107] Insofern läßt sich autobiographisches Erzählen niemals als bloß „kontemplative und passive Schau“ verstehen;[108] den eigentlichen ‚Fluchtpunkt’ des Erzählens bildet vielmehr die Gegenwart des Autobiographen. Aus ihr heraus, mit allen aktuellen Lebensperspektiven und Selbst-Entwürfen im Gepäck, macht sich ein Autobiograph daran, seine Identität in der Zeit erzählend zu (er)finden, indem er versucht, in seinem Leben und seinen vergangenen Erfahrungen Zusammenhänge zu entdecken, die mit seiner gegenwärtigen inneren Verfassung und mit dem, was ihm gegenwärtig als sein ‚Ich’ erscheint, korrespondieren. In diesem Zusammenhang gehören die in autobiographischer Forschungsliteratur häufig anzutreffenden Stichworte ‚autobiographische’ bzw. ‚retrospektive Illusion’, ‚autobiographische Spiegelung’ oder ‚teleologische Tendenz’ des autobiographischen Erzählens.[109] Sie alle beziehen sich auf die Unmöglichkeit, das Vergangene mit all seinen Möglichkeiten, Implikationen und Bedeutungen, die es zum Zeitpunkt seines Erlebens für das ‚Ich der Vergangenheit’ hatte, zu vergegenwärtigen. Das sich erinnernde Ich kann nicht vermeiden, vergangene Erlebnisse und Ereignisse im Lichte der weiteren Entwicklung zu sehen, zu gewichten und zu deuten; es kann sein ‚Mehrwissen’ nicht einfach ausblenden und wird im Gegenteil bewußt oder auch unbewußt (daher die ‚Illusion’) versuchen, den Erlebnissen und Ereignissen einen Sinn zu geben, der auf seine gegenwärtige Verfassung hinausläuft (daher die ‚Teleologie’):
„Jenes Ziel, auf das hin alles gerichtet ist, bildet der Autor selbst, besser: die Vorstellung, die er von seinem Werden und seinem Ich hat.“[110]
Philippe Lejeune hat diese Eigentümlichkeit der Retrospektive und den oben geschilderten generellen Zusammenhang zwischen Autobiographie und personaler Identität in etwas anderem Kontext kurz und treffend auf den Punkt gebracht:
„Jede Autobiographie ist eine Erweiterung des Satzes: ‚Ich bin ich geworden’“[111]
Hier zeigt sich im übrigen, daß die Grenze zwischen fiktionaler und autobiographischer Literatur nicht nur in formal-typologischer Hinsicht schwer zu ziehen ist, denn auch in ihrer Grundeigentümlichkeit, „erinnernde Neuschöpfung“ zu sein, steht die Autobiographie „der echten Fiktion nicht so fern, wie es zunächst scheint.“[112]
Zusammenfassend läßt sich festhalten: Autobiographisches Erzählen ist eine besondere Form der Selbstaussage als Ausdruck personaler Identität. Im Gegensatz zu den ‚synchronen’ Identitätsdarstellungen leistet es nicht nur die identitätskonstitutiven Vermittlungen zwischen Ich und Welt und den psychischen Instanzen, sondern dient zusätzlich der übergreifenden Herstellung von personaler ‚Identität in der Zeit’: Es ermöglicht eine Vergangenheit und Gegenwart umfassende Vermittlung zwischen den gescheiterten und / oder gelungenen psychischen und / oder auf die Sozialwelt gerichteten Vermittlungsaktivitäten des Ich. Da diese Vermittlung erst im und durch Erzählen gelingen kann, ist autobiographisches Erzählen niemals nur Darstellung von Identitätsentwicklung, sondern immer auch aktuelle Identitätsbildung oder -sicherung - es stellt, wie schon gesagt wurde, selbst einen wesentlichen „Lebensakt“ dar.[113]
Nun klafft zwischen diesen generellen Bestimmungen und einer Erklärung der vielfältigen Erscheinungsformen und konkreten Entstehungsbedingungen autobiographischen Erzählens natürlich eine große Lücke. Warum sich einer tatsächlich daran macht, seine Geschichte zu erzählen, hängt individuell davon ab, in welcher Verfassung sein Ich sich befindet und wie es sich selbst und seine spezifische Umwelt erlebt (hat). Insofern lassen sich über die Funktionen autobiographischen Erzählens im Blick auf das Problem der Identität kaum Aussagen machen, die die o.g. allgemeinen Bestimmungen systematisch weiter führen würden. Autobiographisches Erzählen als ‚Herstellung oder Versicherung von personaler Identität’ kann, wie die Vielfalt und Verschiedenheit autobiographischer Erzählungen unschwer deutlich macht, tatsächlich eine ganze Menge bedeuten. Doch zumindest, und das soll nun geschehen, läßt sich mittels des Identitätsbegriffs die Akzentverschiebung im modernen autobiographischen Erzählen genauer erläutern.
2.2.1.2 Identitätsungewißheit und existentielle Haltlosigkeit als Ausgangspunkte modernen autobiographischen Erzählens
Ein wesentlicher, wenn auch nur gradueller Unterschied zwischen traditionellen und modernen Autobiographien liegt in der Art des zugrunde liegenden Identitätsbewußtseins:[114] Traditionelle Autobiographien stehen, wie Bernd Neumann in seinem Buch Identität und Rollenzwang (1970) am Beispiel der bürgerlichen Autobiographie nachgewiesen hat, oft im Zeichen einer bereits vor dem Beginn der autobiographischen Tätigkeit gewonnenen „Identitätsgewißheit“.[115] Gewißheit könnte man in diesem Zusammenhang umschreiben als das mehr oder weniger deutliche Gefühl, sich selbst und seinen Platz in der Welt gefunden zu haben. Dieses kann nur dann zustande kommen, wenn es dem Ich gelungen ist, einen relativ stabilen und ausgewogenen Kompromiß zwischen seinen individuellen Anlagen, Fähigkeiten und Bedürfnissen und den Anforderungen und Prägungen durch die Außenwelt zu schließen. Mit einer solchen Gewißheit sind der autobiographischen Versicherung der ‚Identität in der Zeit’ von vornherein ein fester Rahmen und ein Ziel gesteckt - das ‚Ergebnis’ der autobiographischen Suche steht zumindest in groben Zügen schon fest, insofern der Autor bereits über eine relativ klare Vorstellung von seinem Wesen und damit auch von seinem Werden verfügt. Der Entwicklungs-Punkt, an dem das autobiographische Ich glaubt, seine Identität gefunden zu haben - z.B. durch die Entdeckung eines bestimmten Talents, durch eine ‚Berufung’, durch eine bestimmte metaphysische Sinnerkenntnis oder durch die Identifikation mit einer bestimmten sozialen Rolle - bildet denn auch oft den Angel- und Zielpunkt der Selbstdarstellung.[116] Das Erzählen des eigenen Lebens dient dabei vor allem der Bestätigung, Absicherung oder Prüfung einer schon (vor)bewußten Einheit, Kontinuität und Sinnhaftigkeit des eigenen Werdens und wird nicht selten durch dessen überindividuelle Exemplarizität oder Besonderheit begründet.[117]
In modernen autobiographischen Texten hingegen sind solche inhaltlichen und auf einem objektiven ‚Mitteilungswert’, einer objektiven Bedeutsamkeit des eigenen Lebens insistierenden Legitimationen bzw. der damit verbundene selbstbewußte Gestus des Verkündens oder Bekennens eher selten:
„In der modernen Autobiographie ist [...] der Rückgriff auf die Subjektivität im Vergleich zu den früheren autobiographischen Darstellungen insofern radikal, als mit ihr keine sinnweltliche Überzeugung und also Identitätsbewußtsein verbunden ist. Der Autobiograph tritt nicht mehr als Verkünder oder als Bewältiger eines schweren und besonderen Lebensweges oder schließlich als der Finder einer Funktion auf, die das autobiographische Ich am Ende als Rollenträger befriedigt. Es gibt keine dogmatische oder immanent lebenspragmatische Lehre, die mit der Autobiographie geliefert werden sollte. Es gibt in modernen reflektierenden Autobiographien überhaupt keinen inhaltlich anzugebenden Bezug des autobiographischen Subjekts in einer anderen Funktion als der, autobiographisches Subjekt zu sein. Keine Rolle, die das Individuum innerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit innehaben könnte, versorgt das Subjekt mit einem Sinn seiner selbst.“[118]
In diesem Sinne stellt modernes autobiographisches Erzählen in vielen Fällen die Reaktion auf eine Verunsicherung oder Krise des autobiographischen Ich in Bezug auf den Sinn seines Daseins, seinen Platz in der Welt, den Kern seines Wesens, die Kontinuität seines Werdens, oder wie immer man die vielfältigen, mit dem Begriff der Identität verknüpften Einheits- und Sinnvorstellungen nennen möchte, dar. Der Hintergrund dieser Entwicklung wurde eingangs schon angedeutet und kann aufgrund der Vielfalt und Komplexität der für die existentielle Verunsicherung des modernen Menschen verantwortlichen Faktoren und Entwicklungen auch an dieser Stelle nur in allgemeinster Form erläutert werden. Die moderne Identitäts-Problematik gründet sich vor allem auf den sozialen Aspekt personaler Identität, also auf der wechselseitigen Abhängigkeit zwischen Selbstfindung und -definition und außersubjektiver Wirklichkeit. Das Gelingen einer ausgewogenen Vermittlung zwischen Ich und Welt setzt unter anderem voraus, daß Welt und Wirklichkeit bekannte Größen sind - etwas, in dem sich der Einzelne, sei es durch Distanz oder Bejahung, situieren und dadurch eine sichere Ausgangsbasis der individuell zu leistenden innerpsychischen und psychosozialen Vermittlungsprozesse schaffen kann. Eben diese Bedingung läßt sich für die Moderne nicht mehr ohne weiteres als erfüllt betrachten, denn dem modernen Individuum ist die „Selbstverständlichkeit der Einbettung in eine metaphysische und gesellschaftliche Sinnwelt“ abhanden gekommen.[119] Hier zeigt sich die Kehrseite des „Ausgang[s] des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“:[120] Das Kantische Ideal des freien mündigen Menschen hat sich in der Moderne zur beunruhigenden Vorstellung von dem ‚zur Freiheit verurteilten’ Menschen gewandelt, der - ob er will oder nicht - dazu verdammt ist, sich in jedem Moment seines Lebens selbst zu entwerfen.[121] Während z.B. die Identitätsbildung des ‚innen-geleiteten’ Individuums der „traditions-geleiteten“ bürgerlichen Gesellschaft noch wesentlich durch humanistische Bildungsideale sowie durch die Auseinandersetzung mit dem bürgerlichen Ethos von der „‚Berufserfüllung’ als ‚Lebenserfüllung’“ bestimmt war und mit der Internalisierung dieses von der Gesellschaft ‚sanktionierten’ und ‚kontrollierten’ Ethos und der Übernahme einer bestimmten sozialen Berufsrolle als „Charakterrolle“ ein Ausgleich zwischen innerer und gesellschaftlicher Wirklichkeit geschlossen werden konnte, findet sich das moderne Individuum in einer sich ihm versagenden Welt vor.[122] Es gibt keine ethischen und sozialen Sinn- und Ordnungssysteme mehr, die ihm dabei helfen könnten, seinen ‚Platz’ in der Welt zu finden und der Wirklichkeit von einem sicheren, klar bestimmten und umgrenzten Standpunkt aus zu begegnen bzw. einen solchen als Ziel seines Werdens oder Kern seines Wesens anzusehen. Die ‚Werte’, die ihm seine Welt vermittelt, sind nur mehr Pseudo-Werte, denn sie suggerieren (einmal abgesehen von illusorischen, da auf die Immanenz des Daseins beschränkten Glücksverheißungen) keinen existentiellen Sinn, keine wie auch immer geartete Bestimmung des Menschen mehr, die der Einzelne zum Ausgangspunkt seiner Selbstdefinition machen könnte. Alles, worauf es letztlich ankommt, sind Leistung und Rollen-Flexibilität, das heißt die Dienstbarkeit und Anpassung des Menschen an den stetigen Fortschritt und die stetige Ausdifferenzierung, von denen mehr und mehr Bereiche der Wirklichkeit erfaßt werden.[123] Das urmenschliche Bedürfnis, ein ‚differenziertes Selbst- und Weltbild’ zu entwickeln und sich selbst, seine eigentümliche Lebensbestimmung und seinen Platz in der Welt zu finden, erscheint vor diesem Hintergrund fast anachronistisch - um so mehr, als die Möglichkeit von Identität als harmonische Integration der von innen und außen wirkenden Kräfte selbst zunehmend in Frage gestellt wurde:
„Die theoretischen Überlegungen unseres Jahrhunderts in Tiefenpsychologie und Soziologie [...] haben zum Teil dazu geführt, daß die Persönlichkeit des Individuums nicht als geschlossenes Kraftzentrum des Handelns, sondern als Opfer von allgemeinen überindividuellen Kräften verstanden wird, seien diese nun psychologisch als Triebfundament oder soziologisch als Abhängigkeit von Gruppentendenzen aufgefaßt.“[124]
Es bleibt abzuwarten, inwiefern diese Entwicklungen zu einer „grundlegenden Wandlung“ der „gesamte[n] psychische[n] Struktur des Individuums“ führen werden, wie es Bernd Neumann prognostiziert.[125] Die Herausbildung des Typs des ‚außen-geleiteten’ oder ‚allozentrischen’ Menschen ohne „kontinuierliche Psychologie“, dessen innersubjektives Erleben gekennzeichnet ist von Mittelpunkt-, Standpunkt- und Grenzenlosigkeit zur Welt hin, ist sicherlich nur der Beginn dieses Wandels.[126] Fest steht, daß der in seiner Identitätsfindung und -bildung auf sich selbst zurück geworfene moderne Mensch mit ganz anderen (und größeren?) Problemen zu kämpfen hat als etwa der Mensch der bürgerlich-humanistischen Gesellschaft - er ist, wie es Sartre in etwas anderem Zusammenhang anschaulich ausgedrückt hat, der blinde Passagier ohne Fahrkarte, welche seine Lebens-Fahrt legitimiert (vgl. LM, S.65f). Fest steht aber auch, daß er sich vom Bedürfnis, sein persönliches Dasein erkunden und verstehen zu wollen, in ihm einen Sinn zu entdecken - so schwierig und aussichtslos dies auch erscheinen mag - noch lange nicht verabschiedet hat. Im Gegenteil: Mit dem Verlust bergender Sinnwelten und kollektiver Sinnvorstellungen scheint die individuelle existentielle Sinn-Suche zu einem besonders notwendigen und dringlichen Anliegen geworden zu sein. Das dokumentiert die große Zahl und Vielfalt moderner autobiographischer Erzählversuche. Es scheint, als habe das autobiographische Erzählen auch in heutiger Zeit nichts von seiner Bedeutung für die Thematisierung und Lösung existentieller Fragen eingebüßt.
Vor dem Hintergrund der existentiellen Verunsicherung und Haltlosigkeit des modernen Menschen läßt sich modernes autobiographisches Erzählen unter dem Oberbegriff des ‚identitätsungewissen’ Erzählens vom traditionellen Erzählen abgrenzen. ‚Ungewißheit’ meint in diesem Fall, daß das Erzählen nicht von der Deutungswarte eines gefestigten Ich aus geschieht, das bereits einen relativ stabilen Kompromiß zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit geschlossen hat und sich im erzählenden Rückblick ‚nur’ seiner ‚Identität in der Zeit’ versichert, indem es seine Entwicklung als Reifungs- und Bildungsprozeß dieses Kompromisses zu begreifen und darzustellen versucht. Den Ausschlag für moderne autobiographische Erzählversuche gibt häufig nicht eine bestimmte Sinn-Vorstellung und „These des Ich“, sondern das elementare Bedürfnis nach einer solchen These bzw. nach „Selbstidentifikation“ im weitesten Sinn:[127]
„Die [modernen] Autobiographien stehen nicht auf einem Feldherrenhügel des Lebens, sondern legen von dem fortwährenden geistigen Kampf Zeugnis ab, der um die Selbstdefinition geführt wird. Sie sind bis in den Augenblick des Schreibens selbst gegen die Zukunft offen.“[128]
Das heißt, modernes autobiographisches Erzählen stellt in vielen Fällen eine Suche ohne klar bestimmten Ausgangs- bzw. Zielpunkt in Form eines in sich ruhenden und erkennenden ‚Ich der Gegenwart’ dar. In Anlehnung an Lejeune könnte man sagen: Der Akzent verschiebt sich vom eher selbstbewußt-konstatierenden ‚Ich bin Ich geworden’ zum suchenden, fragenden ‚Wer bin Ich (geworden)?’, wobei neben der grundsätzlichen Frage nach dem Sinn der individuellen Existenz auch ‚Meta’-Fragen nach den Möglichkeiten und Grenzen des Bewußtseins, der Selbsterkenntnis und Selbstfindung im allgemeinen und den diesbezüglichen Möglichkeiten und Grenzen des Erzählens im besonderen an Gewicht und Bedeutung gewinnen.
Ob im Vollzug des ‚identitätsungewissen’ Erzählens eine Lösung der jeweils zugrunde liegenden existentiellen Problematik gelingt oder nicht, ob die autobiographische Suche zur Entdeckung eines existentiellen Sinns, zu einer wie auch immer gearteten Selbstidentifikation führt oder aber scheitert, zeigt sich nun vor allem im Erzählen selbst. Allerdings wäre es naiv, die Zusammenhänge zwischen den Funktionen, Formen, Gegenständen und Resultaten moderner autobiographischer Erzählungen aus einer Perspektive betrachten und beurteilen zu wollen, die sich an den typologischen und epistemologischen Eigentümlichkeiten des traditionellen ‚identitätsgewissen’ autobiographischen Erzählens orientiert: Zum einen, weil modernes autobiographisches Erzählen hinsichtlich der Entfaltung und Umsetzung der jeweils zugrunde liegenden Sinn-Intention generell konsequenter und damit auch technisch und formal-ästhetisch komplexer erscheint als das traditionelle autobiographische Erzählen. Zum anderen, weil die existentiellen Erkenntnisansprüche, die modernen autobiographischen Texten zugrunde liegen, meist ganz andere sind als die im traditionellen autobiographischen Erzählen: Für letzteres typisch ist der hohe Anspruch, das ganze Leben (oder zumindest einen wesentlichen Teil; z.B. den Prozeß der Bildung) systematisch erfassen und als kontinuierliche und ‚folgerichtige’ (da auf die Erlangung eines stabilen sinnweltlich gesicherten Identitätskonzepts zielende) Entwicklung im Zeichen eines „overall pattern of significance“ darstellen zu wollen:[129]
„Hier will der Autor sein Leben im Zusammenhang darstellen, die Entfaltung und Entwicklung seiner Persönlichkeit gestalten; die Tendenz ist auf Totalität, das heißt auf Erfassung der wesentlichen Züge gerichtet.“[130]
Natürlich kann auch das ‚identitätsungewisse’ Erzählen im Zeichen einer solchen, auf Totalität abzielenden Suche nach Einheit, Kontinuität, Lebens-Sinn im ‚großen Stil’ stehen. Es kann aber auch - und das ist angesichts der fundamentalen Verunsicherung des modernen Menschen weitaus häufiger der Fall - eine Suche nach einer „Kontinuität des Nicht-Gelingens persönlicher Geschichte“ darstellen oder auch nur noch eine auf bestimmte Lebens-Themen, -Episoden oder -Phasen beschränkte provisorische, relative oder fragmentarische Selbsterkenntnis anstreben.[131] Eine solche Selbsterkenntnis kann, wie Good am Beispiel des modernen autobiographischen Essays nachgewiesen hat, ebenfalls oft eine negative sein und vornehmlich um den ‚Verlust von Identität’ und die ‚Auflösung des Selbst’ kreisen.[132] Schließlich kann es sein, daß sämtlicher Anspruch auf Erkenntnis und Gewißheit fallengelassen wird und das Erzählen lediglich dem Ausdruck einer Befindlichkeit - z.B. der „des existentiellen Staunens und Fragens“ dient.[133] In diesem minimalsten und zugleich elementarsten Fall stellt Erzählen einen Akt des „Sagens von Leben überhaupt“, des ‚Gesehen-Werdens’ jenseits jeglichen Anspruchs auf Sinn- und Identitätsgewißheit dar:[134]
„Der Autobiograph, der sich in einer sinnweltlich nicht gefestigten Existenz vorfindet und an diesem Zustand leidet, versucht ihn dadurch erträglich zu machen, daß er sich unmittelbar in ihm stehend zeigt. [...] Er wirbt um den Leser als Auge, das ihn aus seiner Einsamkeit befreie. [...] Ist doch das Bedürfnis, gesehen zu werden, offensichtlich eine psychische Grundkonstante, die damit zusammenhängt, daß der Mensch ein soziales Wesen ist, das seinerselbst nur mittels Gegenseitigkeit gewahr wird.“[135]
Es liegt auf der Hand, daß dieser nur kleine Ausschnitt von unterschiedlichen Möglichkeiten moderner autobiographischer Intentionen ganz unterschiedliche Darstellungs- und Erzählweisen bedingen kann, die z.T. nur noch wenig mit denen des auf Totalität abzielenden traditionellen, identitätsgewissen Erzählens gemein haben.
Im Zusammenhang mit der Tendenz zu einer radikaleren Realisierung und Ausschöpfung der Möglichkeiten erzählender autobiographischer Sinn-Produktion einerseits, und der Tendenz zur Relativierung des autobiographischen Erkenntnisanspruchs andererseits, möchte ich nun einige der für das moderne autobiographische Erzählen typischen Innovationen bzw. Brüche mit den traditionellen Gattungskonventionen vorstellen. Mit Rücksicht auf die folgenden konkreten Textanalysen sollen diese Ausführungen jedoch lediglich einen groben Überblick bieten.
2.2.2 Konsequenzen der modernen Identitätsproblematik für das autobiographische Erzählen
Wenn autobiographisches Erzählen nicht mehr ‚nur’ der sichernden Einrüstung und Vergegenwärtigung einer relativ stabilen und sinnweltlich eingebetteten Identität dient, wenn die Produktion von Identitäts- und Existenzmöglichkeiten nicht mehr Sache der Welt ist, sondern ausschließlich zum Problem des Einzelnen wird, kommt auch das wesentliche Instrument zur individuellen Sinn-Produktion viel bewußter und damit tendenziell auch differenzierter und konsequenter im Blick auf die jeweils zugrunde liegende subjektive Sinnproblematik zum Einsatz als im traditionellen identitätsgewissen Erzählen. Die dem Erzählen inhärenten Möglichkeiten zur Sinn- und Ordnungsproduktion durch Auswahl, Akzentuierung, Anordnung und Deutung, die Unmöglichkeit, die ‚Vergangenheit an sich’ wiederauferstehen zu lassen und die ‚objektive’ Wahrheit eines Lebens zu finden, die teleologische Tendenz und Gegenwarts- bzw. Zukunftsbestimmtheit der Retrospektive - all diese Eigentümlichkeiten des autobiographischen Erzählens gehören gewissermaßen zum Basiswissen moderner Autobiographen und werden von ihnen nicht nur thematisiert und problematisiert, sondern auch entsprechend der individuellen Sinn-Suche aufgegriffen und ausgenutzt. Wenn Vergangenheit doch nur „eine Dimension meiner Gegenwart“ sein kann und ihre Erinnerung und Erzählung zwangsläufig bestimmten subjektiven Selektions- und Wertungskriterien unterliegen, ist dies zwar kein Freibrief für Erfindung und Lüge, doch es gibt dem Autobiographen alle Freiheit, die erzählende Rekonstruktion seiner ‚Vergangenheit für mich’ formal und inhaltlich so zu gestalten, daß ein Sinn sichtbar wird oder eine ‚Selbstidentifikation’ im weitesten Sinne gelingt.[136] Dies mag nach den Erläuterungen in den letzten Kapiteln als Selbstverständlichkeit erscheinen, doch wie eingangs erwähnt, war das autobiographische Erzählen lange Zeit in Konventionen befangen, die im Hinblick auf die Realisierung seiner existentiellen Funktion zumindest als nicht besonders logisch und konsequent anzusehen sind. So z.B. das Problem der chronologischen Ordnung. Im Hinblick auf die erläuterte Identitätsproblematik läßt sich verstehen, warum die erzählerische Orientierung an der Chronologie lange Zeit eine Art ‚ungeschriebenes’ Gattungsgesetz sein konnte und erst in jüngerer Zeit mehr und mehr zugunsten komplexerer Ordnungsmuster aufgegeben wurde:
„Es ist das chronologische Erzählen, das mit der systematischen Wiederaufnahme der Folge eigener Erfahrungen ein vorbewußtes Vertrauen in den sukzessiven Erfahrungsstrom bezeugt. Die gradlinige Chronologie ist, indem sie die gegenwärtige Erfahrung durch das individual-historisch getreue Heranholen älterer Erfahrungen bereichert und festigt, Beweis einer ungestörten Ich-Wahrnehmung und einer intakten Identität.“[137]
Mit der grundsätzlichen Infragestellung und Problematisierung der Möglichkeit einer fest umrissenen und sinnweltlich geborgenen Identität schwindet auch das nicht hinterfragte Vertrauen in den chronologischen Ablauf der Dinge. Wenn Identität im Vollzug des Erzählens erst ge- bzw. erfunden werden soll, gilt es, die Dinge nicht in der Reihenfolge darzustellen, in der sie ‚wirklich’ stattgefunden haben, sondern eine andere Ordnung zu suchen, in der sie einen Sinn ergeben könnten oder die generell der Selbsterfahrung angemessen ist. Eine ähnliche Tendenz läßt sich auch hinsichtlich der Auswahl und Deutung des Lebensstoffes erkennen. Die bis zu einem gewissen Grad gattungskonstitutive Forderung nach biographisch-historischer „Genauigkeit“ im Sinne von „nicht vergessen, nicht verzerren usw.“ wird im modernen autobiographischen Erzählen zwar nicht übergangen, doch tendenziell weitaus selbstverständlicher als im traditionellen autobiographischen Erzählen hinter die „Forderung nach Bedeutung“ zurückgestellt.[138] Es kommt nicht darauf an, alles möglichst ‚genau’ zu erzählen, wesentlich sind die Selektion, Akzentuierung und Deutung derjenigen Ereignisse, Erfahrungen und Episoden, die für die individuelle Sinn-Suche von Bedeutung sein könnten.[139] Die Konsequenzen dieser Verlagerung können sich auf den verschiedensten Ebenen eines Textes zeigen: Generell natürlich in einer dichteren thematischen Konzentration. Auf der Ebene des Inhaltes, wenn nicht mehr die ‚Geschichte einer Persönlichkeit’ im Sinne einer Lebensgesamtschau von Geburt an und soweit wie möglich erzählt wird, sondern nur bestimmte, zeitlich vielleicht weit auseinander liegende Entwicklungsphasen, -ausschnitte und Episoden fokussiert werden (womit sich natürlich auch der äußere Textumfang reduzieren kann). In den Redeweisen durch die Zunahme und Ausführlichkeit von Reflexionen und Bewertungen zum Erzählten. Mit diesem letzten Aspekt verbunden ist auch das Problem der Perspektive, die ja im autobiographischen Erzählen durch die historisch-biographische Doppelung des Ich bzw. durch die „Doppelpoligkeit von Identität und Distanz“ bestimmt ist.[140] Während in traditionellen Autobiographien dieses Problem als „eher der Rhetorik (im Sinne der mnemotechnischen Verfügbarkeit bzw. Nichtverfügbarkeit von Erinnerung) oder dem Wahrheitsprimat der Geschichtsschreibung zugehörig identifiziert“ und durch die Installation einer „Ich-Zentralgestalt“ (bzw. die darin enthaltene „verkürzende Gleichsetzung von Lebens- und Sinnzusammenhang“) umgangen wurde, gehen moderne Autobiographen nicht selten von der prinzipiellen ‚Unverfügbarkeit des Erzählobjekts’ aus und versuchen erst gar nicht, ihre rückblickenden Sinnstiftungs- oder Selbstidentifikationsversuche auf das Erleben des ‚Ich der Vergangenheit’ zu übertragen bzw. sie damit gleichzusetzen.[141] Formal kann sich dies z.B. im ständigen „Perspektivenwechsel“,[142] in einer klaren und explizierten Trennung zwischen beiden Erzählperspektiven, in der Zunahme von die Schreibgegenwart thematisierenden Kommentaren und Reflexionen oder ganz allgemein in der Dominanz der Perspektive des erinnernden / erzählenden ‚Ich der Gegenwart’ bzw. in der Präsenz eines „selbstbewußten Erzähler[s], der sich von Anfang an als das Subjekt der Erzählung setzt“, zeigen.[143]
Die Suche nach Sinn - so könnte man es nach diesem kurzen Überblick allgemein formulieren - wird im modernen autobiographischen Erzählen also mehr und mehr zum ausschließlichen und zentralen Prinzip, welches die Auswahl, Präsentation und Ordnung der Lebensfakten bestimmt. Allerdings ist dies nur eine Seite der Medaille: Auf der anderen Seite steht oft auch eine mehr oder weniger ausgeprägte Skepsis gegenüber der Möglichkeit (erzählender) Selbsterkenntnis bzw. -identifikation an sich. Die sich daraus ergebende Tendenz zu einer Relativierung des autobiographischen Erkenntnisanspruchs (bis hin zu seiner völligen Aufgabe) bildet den Ursprung weiterer typologischer Neuerungen: so etwa der verstärkte Einsatz metadiskursiver Mitteilungsformen, mit denen sich das Nicht-Erkennbare, -Erzählbare oder -Sagbare zumindest indirekt zeigen läßt - diese Tendenz wird in der Forschung häufig unter den Stichworten ‚Stilisierung’ / Stilpriorität’ beschrieben[144] (wobei Metadiskursivität per se natürlich nicht auf stilistisch-rhetorische Darstellungsmittel beschränkt ist, sondern - wie wir noch werden - durchaus auch struktureller Natur sein kann[145]), die Zu- bzw. Überhandnahme epistemologischer oder metanarrativer bzw. selbstreferentieller Reflexionen und Kommentare gegenüber dem Erzählen, Berichten und Schildern (in diesem Zusammenhang unterscheidet Picard die ‚traditionelle erzählende Autobiographie’ von der ‚modernen reflektierenden Autobiographie’[146]), das Fehlen einer wie auch immer gearteten Kohärenz und motivationalen Verknüpfung des Erzählten (‚schwaches Erzählen’) oder die Tendenz zum Fragmentarischen bzw. zur „autobiographischen Serie“, bei der „immer neue Annäherungsversuche, Korrekturen oder Konkretionen [...] die eine verbindliche Lebenserklärung [ersetzen]“.[147] Allerdings ist es nun gerade hinsichtlich dieser letztgenannten Aspekte wichtig, sie im Zusammenhang mit der Art des jeweils zugrunde liegenden Erkenntnisanspruchs zu sehen. Narrative Fragmentarizität und Inkohärenz können eine bewußt gezogene darstellerische Konsequenz auf die Einsicht in die Unmöglichkeit einer (ganzheitlichen) Selbsterkenntnis darstellen; sie können aber auch einfach auf einen Abbruch und ein Scheitern der Sinn-Suche hindeuten.
Damit möchte ich auch meine (sicher noch in vieler Hinsicht lückenhaften) theoretische Darstellung abbrechen. Erinnern wir uns an den Grundsatz: Wie und was man erzählt, hängt immer davon ab, wozu man erzählt. Eine überblicksartige Betrachtung typologischer Merkmale des modernen autobiographischen Erzählens, wie ich sie in diesem Kapitel versucht habe, mag zur ersten Orientierung genügen, doch sie wird insofern immer ‚fleischlos’ und allgemein bleiben, als sich die Formen des Erzählens letztlich nur vor dem Hintergrund seiner spezifischen Funktionen erklären lassen. Diese sind zwar im autobiographischen Erzählen fast immer existentieller Natur und stehen besonders im modernen autobiographischen Erzählen häufig im Zusammenhang mit Identitäts-Krisen, doch welche Art von Erkenntnisanspruch der Suche nach sich selbst zugrunde liegt und ob sie in diesem Sinne gelingt oder scheitert, hängt - wie auch die daraus resultierenden Formen und Gegenstände des Erzählens - allein von der individuellen Persönlichkeit des Autors ab. Das Zusammenwirken von Funktion, Gegenstand und Form läßt sich daher letztlich nur am Beispiel konkreter Texte faßbar und nachvollziehbar machen. Die autobiographischen Texte von Sartre, Andersch und Didion sind allesamt jeweils auf ihre Weise bezeichnend für die existentielle Problematik des modernen Menschen und die damit verbundenen Entwicklungen und Eigentümlichkeiten des modernen autobiographischen Erzählens. Der wesentliche Unterschied liegt jedoch in der Art, wie die drei Autobiographen mit ihrer existentiellen Verunsicherung umgehen, ob und wie sie sich ihr durch das Erzählen zu stellen versuchen und mit welchem Erfolg ihnen dies gelingt. Entsprechend präsentiert sich auch ihr Erzählen in ganz unterschiedlichen Formen.
3. Drei moderne autobiographische Erzähltexte
Wie gesagt, richtet sich die Gliederung der Kapitel zu den drei Texten nach den Fragen: Warum wird erzählt? Wie und was wird erzählt? Welches Ergebnis hat die autobiographische Suche? Die Untersuchung der Funktionen der Texte wird hauptsächlich den Charakter einer empathischen Beschreibung haben. Das heißt, ich möchte die Autoren nicht irgendwelcher unbewußten Mechanismen und Motive überführen, sondern sie selbst beim Wort nehmen. Sofern der Sinn der Selbstbetrachtung nicht unzweifelhaft und explizit aus einem Text hervorgeht, sollen zentrale Textpassagen und Aussagen der Autoren zu ihrem (autobiographischen) Erzählen vorsichtig interpretiert werden. In diesem Fall werden meine Schlüsse den Charakter von Hypothesen haben, die es durch die konkreten Textanalysen zu bestätigen gilt.
Die Untergliederung der Textanalysen folgt im wesentlichen den Untersuchungsschritten: Text-Aufbau - Gegenstand - Perspektive / Stellung des autobiographischen Subjekts im Text - Stil.[148] Innerhalb dieses groben systematischen Rahmens werde ich, insbesondere natürlich auf den weiten Feldern der ‚Gegenstände’ und des ‚Stils’, individuelle Schwerpunkte setzen, die die Texte nahelegen.
3.1 Jean-Paul Sartre: Les Mots
Eine Untersuchung der Autobiographie des Mannes, der die existentielle Bindungs- und Haltlosigkeit des Menschen zum Ausgangspunkt und Zentrum seines gesamten Denkens erhoben hat, mag nach den Ausführungen in den letzten Kapiteln besonders passend und aufschlußreich anmuten. Doch Sartre stellt sich in seiner Autobiographie nur bedingt als haltloser oder ‚identitätsungewisser’ Mensch im oben beschriebenen Sinne dar, und Les Mots sind nicht unbedingt ein Parade-Beispiel für die geschilderten Akzentverschiebungen im modernen autobiographischen Erzählen. Vielmehr scheint der Text sowohl hinsichtlich des ihm zugrunde liegenden Sinn-Problems als auch in der Art seiner erzählenden Entfaltung und angestrebten Lösung gerade an der Schwelle zwischen modernem und traditionellem autobiographischen Erzählen zu stehen. Annie Cohen-Solal hat die Eigentümlichkeit Sartres, die sein Wesen wie auch sein Vorgehen in Les Mots bestimmt, in anderem Zusammenhang treffend auf den Punkt gebracht: Sartre, so lautet ihre Aussage sinngemäß, sei zugleich ‚heftigster Widersacher’ wie ‚bestausgestatteter Erbe’ der ‚Tradition’.[149] Angesichts dieses ambivalenten Status’ eignen sich Les Mots als Ausgangspunkt meiner Untersuchungen, der auch eine Konkretisierung des bisher noch recht schlagwortartig verwendeten Begriffs der autobiographischen ‚Tradition’ ermöglicht. Allerdings soll es im folgenden nicht darum gehen, die traditionellen und modernen Elemente der Wörter[150] einfach zu ‚sammeln’ und nacheinander darzulegen - gewissermaßen nacheinander eine traditions- und eine innovationsbezogene Lesehaltung ein- bzw. Analyse vorzunehmen. Mein Vorgehen zielt darauf ab, den Text als Ganzes und im Rahmen von Sartres spezifischen Intentionen zu erfassen, und wird sich nach den o.g. Untersuchungsschritten richten. In diesem Rahmen erfolgt die ‚Auswertung’ des Textes im Hinblick auf seine Stellung zwischen Tradition und Moderne.
3.1.1 Autobiographisches Erzählen als Instrument analytischer Erkenntnis und idealtheoretischer Selbst-Konstruktion
Wie sich bereits am Titel und an den Kapitelüberschriften erahnen läßt, sind Les Mots Ausdruck von Sartres Suche nach den Ursprüngen seines Daseins als Intellektueller und Schriftsteller. Sartre schrieb seine Autobiographie mit einem klaren und auf die zentrale ‚Charakterrolle’ seines Lebens zielenden Erkenntnisanspruch:
„Ich habe Die Wörter geschrieben aus dem gleichen Grunde, aus dem ich über Genet und Flaubert geschrieben habe: Wie wird ein Mensch zu einem Schriftsteller, zu einem, der von Imaginärem sprechen will?“[151]
In Les Mots begibt sich Sartre scheinbar nur auf die Suche nach den Ursprüngen dieses spezifischen Lebensentwurfs, denn die Erzählung konzentriert sich im wesentlichen auf die ersten zwölf Lebensjahre Sartres: Wir erfahren, wie der kleine Sartre nach Notwendigkeit seiner Existenz sucht, sie schließlich im Schreiben zu finden glaubt und wie der Glaube zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr zur ‚Charakterneurose’ wird (vgl. LM, S.193). Die Tatsache, daß sich Sartre am Ende seiner Autobiographie vorwirft, noch zur Zeit der Niederschrift von La Nausée in dieser ‚Neurose’ gefangen gewesen zu sein, deutet allerdings darauf hin, daß das, was uns Les Mots als kindliche Sinn-Suche präsentieren, in Wirklichkeit ein analytisches Konstrukt ist, das heißt die Exemplifikation einer ganzen Lebenshaltung anhand der Kindheit:
„[...] das, was als die Geschichte eines Kindes präsentiert und in einer scheinbar logischen Abfolge vor uns ausgebreitet wird, [ist] in Wirklichkeit die Projektion der vom Erwachsenen später, also rückblickend, unternommenen Analyse seiner Neurose [...].“[152]
Les Mots sind also nicht einfach ‚nur’ eine Kindheitsgeschichte, sondern zugleich eine theoretische Verdichtung und analytische Aufschlüsselung eines ganzen Lebensmodells, das gewissermaßen nur am Beispiel der Kindheit betrachtet wird. Die Basis dieses Vorgehens bildet Sartres spezifische Vorstellung von Identität oder Persönlichkeit und von der diesbezüglichen Aufgabe des (Auto-) Biographen.[153] Er geht davon aus, daß der Mensch nicht einfach eine willkürliche und unzusammenhängende Ansammlung von Anlagen und Eigenschaften ist, sondern eine „Totalität“, die „nur als Ganzes begriffen werden kann.“[154] Dieser Totalität sind die Begriffe ‚Entwurf’ (‚projet’) und ‚Urwahl’ (‚choix originel’) zugeordnet:[155] Gemäß der Auffassung, daß beim Mensch die Existenz dem Wesen (‚essence’) vorausgeht, und daß sich der Mensch somit erst zu dem machen muß, was er ist, ist der ‚Entwurf’ die Art und Weise, mit der ein Mensch sich zu dem macht, was er ist. Er konstelliert sich in der ‚Urwahl’ (wobei der Begriff ‚Wahl’ nichts mit bewußtem Wollen zu tun hat) - einer ursprünglichen „freie[n] Vereinigung“ mit der Vielfalt der Welt, aus der das Individuum als personale Einheit hervorgeht.[156] Diese ‚Urwahl’ verlegt Sartre in die Kindheit, was den spezifischen Gegenstand seiner Autobiographie erklärt. Der sich in dieser Zeit ‚herauskristallisierende’ ursprüngliche ‚Entwurf’ wird „später zu einem durchgängigen und zeitunabhängigen Bestandteil der individuellen Geschichte“; er zeigt sich in der Art, wie ein Mensch mit seiner existentiellen Freiheit umgeht und drückt sich in jeder Neigung, jedem Trieb, jeder Handlung und Verhaltensweise aus.[157] Für den (Auto-) Biographen geht es nun darum, die ursprüngliche Wahl bzw. den nicht weiter reduzierbaren ‚Entwurf’ zu erkennen und seine Genese zu rekonstruieren. Dies kann nur mittels einer „zugleich induktive[n] und synthetische[n] Methode“ im Rahmen einer idealtheoretischen analytischen Konstruktion geschehen, die ihren Ausgangspunkt in einigen als wesentlich und bedeutsam erkannten bzw. erlebten Persönlichkeitsmerkmalen nimmt.[158] Anhand dieser Merkmale wird eine These über den ‚Entwurf’ gebildet. Diese These bildet den „hypothetische[n] Lektüreschlüssel [, der] auf die gesamte Geschichte des Individuums [anzuwenden ist]“ und dabei ihre logische Schlüssigkeit und Gültigkeit beweisen muß.[159] Die Forderung nach biographisch-historischer „Genauigkeit“ ist dabei zwar nicht zu vernachlässigen, die zentralen Forderungen an die Analyse lauten jedoch: „Bedeutung“, „Plausibilität“ und „Aussagekraft“.[160] Denn die Funktion des autobiographischen Erzählens besteht nicht in der Enthüllung einer objektiven Wahrheit und Erforschung der ‚Vergangenheit an sich’, sondern allein darin, „das Für-mich-Sein der Vergangenheit“ in idealtheoretischer Weise als ein kohärentes Ganzes „wiedererstehen zu lassen“.[161]
Die autobiographische Sinnfrage könnte für Sartre also gelautet haben: ‚Mit welchem ‚Entwurf’ des ‚écrivain’ habe ich mich zu mir gemacht?’[162] Die Antwort finden wir in Les Mots: Sartre analysiert die Genese der unbewußten Mechanismen, die sich in ihm im Rahmen der spezifischen ‚Situation’ seiner Freiheit,[163] das heißt unter dem Einfluß der spezifischen Rollenangebote und Wertvorstellungen seiner bürgerlich-humanistisch geprägten Familie und der kulturellen und gesellschaftlichen Situation im Frankreich des angehenden 20. Jahrhunderts herausgebildet haben, und zeigt, wie diese schließlich zu seinem spezifischen ‚Entwurf’ werden konnten. Dessen drei wesentliche qualitative Grundmerkmale seien an dieser Stelle nur kurz zusammengefaßt:
[...]
[1] Die Themenstellung und -formulierung ist ein leicht abgeändertes Zitat aus dem Aufsatz von Dieter Lamping (2000): Erzählen als Sinn-Suche. Formen und Funktionen autobiographischen Erzählens im Werk Alfred Anderschs. Vgl. ebd. S.228.
[2] Genette (1992): Fiktion und Diktion. S.65. Vgl. auch Lamping 2000, S.217f.
[3] Als Beispiel eines kultur- bzw. menschheitsgeschichtlichen Ansatzes wäre Georg Mischs (1949-1969) Geschichte der Autobiographie zu nennen - eines der wohl bekanntesten und immer noch meistzitierten Werke zur Autobiographie.
[4] Vgl. z.B. die gattungstheoretischen Ansätze von Aichinger [1970] (1998): Probleme der Autobiographie als Sprachkunstwerk. Bruss [1974] (1998): Die Autobiographie als literarischer Akt. Lehmann (1988): Bekennen, erzählen, berichten: Studien zur Theorie und Geschichte der Autobiographie. Lejeune [1975] (1994): Der autobiographische Pakt. Shumaker (1954): English Autobiography. Its Emergence, Materials, and Form. Starobinski [1970] 1998: Der Stil der Autobiographie.
[5] Holdenried (2000): Autobiographie. S.37.
[6] Zum Begriff einer ‚technischen Theorie’ (vs. dem einer ‚philosophischen Theorie’) nach August Wilhelm Schlegel (ebd. (1963): Die Kunstlehre.) vgl. Lamping 2000, S.228f.
[7] Lamping 2000, S.228f; siehe auch ebd. die Anm. 53-56 mit Beispielen zu den genannten erzähltheoretischen Interessenschwerpunkten.
[8] Siehe zu dieser ‚anthropologischen Dimension des Erzählens’ auch Vogt (1997): Grundlagen narrativer Texte. S.288f.
[9] Didion [1979] (1992): The White Album. S.11. Im folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem Kürzel TWA gekennzeichnet.
[10] Der im folgenden oft verwendete Begriff der ‚Sinn-Suche’ ist ebenfalls dem Aufsatz von Dieter Lamping 2000 entlehnt.
[11] Die Begriffe ‚Spiel’ und ‚Geschichtenerzählspieler’ für den Bereich der fiktionalen Erzählliteratur hat Dietrich Weber geprägt: Für ihn ist jeder Erzähler einer fiktionalen Geschichte ein Spieler, weil er sich durch die Wahl der Fiktion von den für autobiographisches Erzählen konstitutiven Verpflichtungen zur Wahrheit und Aufrichtigkeit entbindet - sein ‚Spiel’ ist die Erzählung. Vgl. Weber (1998): Erzählliteratur: Schriftwerk, Kunstwerk, Erzählwerk. S.85ff; sowie ebd. (1989): Der Geschichtenerzählspieler. Ein Begreifbuch von höheren und niederen Erzählsachen.
[12] Vgl. Lamping 2000, S.227 u. 228 sowie Picard, Hans Rudolf (1978): Autobiographie im zeitgenössischen Frankreich. Existentielle Reflexion und literarische Gestaltung. S.110.
[13] Aichinger 1998, S.185
[14] Was nicht heißen soll, daß es grundsätzlich müßig und sinnlos wäre, die Frage nach den Funktionen fiktionalen Erzählens zu stellen. Dieses Problem ließe sich wohl nur nicht auf dieselbe Art und Weise behandeln wie bei autobiographischen Texten. Hier läßt sich fast immer von einer ernsthaften Realisierung der existentiellen Grundfunktion des Erzählens ausgehen. Bei fiktionalen Texten kann dies der Fall sein, muß es aber nicht. Und selbst wenn das Erzählen einer fiktiven Geschichte für einen Autor womöglich eine ähnlich existentielle Funktion hat, wie sie auch das Erzählen des eigenen Lebens für ihn hätte, muß er dies noch lange nicht zu einem Thema seiner Geschichte machen. Gerade die Wahl der Fiktion ist ja (auch) eine Möglichkeit, jede unmittelbare Verbindung zwischen Leben und Werk vor dem Blick des Lesers (und vor sich selbst) zu verschleiern. Insofern ist es fragwürdig, ob sich in Bezug auf fiktionales Erzählen überhaupt mit einem so unmittelbar auf die Person des Autors bezogenen Funktionsbegriff und einer derart empathischen Methode arbeiten ließe, wie es das autobiographische Erzählen erlaubt. In Bezug auf die Vielfalt von Formen und Gattungen im Bereich des fiktionalen Erzählens wäre die (wie auch immer gestellte) Funktionsfrage außerdem wohl nur im Rahmen von begrenzten Untersuchungen zu klären, die sich auf einzelne Texte, auf Gesamtwerke einzelner Autoren oder auf eng umgrenzte Teilbereiche der fiktionalen Erzählliteratur beschränken.
[15] Zum Problem des Gegenstandes fiktionaler Erzählungen siehe Martinez / Scheffel (1999): Einführung in die Erzähltheorie. S. 20f.
[16] Lamping 2000, S.218
[17] Lejeune 1994, S.240
[18] Lamping 2000, S. 228
[19] Lamping 2000, S. 228
[20] Lejeune 1994, S.235. Dies mag daran liegen, daß die chronologische Ordnung das Fundament und Regelwerk unserer „Beziehungen zu anderen“ und zu uns selbst bildet und daher auch für das Erzählen der eigenen Geschichte als „natürlich“ empfunden wird (ebd., S.236).
[21] Vgl. Lejeune 1994, S.236
[22] Lejeune 1994, S.239
[23] Lejeune 1994, S.238
[24] Zu den Entstehungsbedingungen und exemplarischen Erscheinungsformen moderner Literatur bietet Horst Steinmetz einen anschaulichen, an der Perspektive des Lesers orientierten Überblick: Steinmetz (1997): Moderne Literatur lesen. Eine Einführung. (siehe besonders S.182-264).
[25] Hier wie auch in den folgenden Erläuterungen dient der Begriff ‚Moderne’ als Hilfs-Oberbegriff für Tendenzen, die man u.U. nochmals mittels Begriffen wie ‚klassische Moderne’, ‚Postmoderne’ o.ä. differenzieren könnte. Auf solche Unterscheidungen möchte ich jedoch verzichten, da kein Konsens über die In- und Extension solcher Begriffe besteht, und sie, je nachdem in welchem Kontext und von wem sie verwendet werden, z.T. ganz Unterschiedliches meinen und bezeichnen können.
[26] Vg. z.B. Neumann (1970): Identität und Rollenzwang. Zur Theorie der Autobiographie. S.183ff.
[27] Lehmann (1997): Art. ‚Autobiographie’. S.171.
[28] Wagner-Egelhaaf (2000): Autobiographie. S.181.
[29] Picard 1978, S.9
[30] Lehmann 1997, S.171
[31] Im folgenden werden Zitate aus diesem Text durch das Kürzel LM gekennzeichnet.
[32] Im folgenden werden Zitate aus diesem Text durch das Kürzel DS gekennzeichnet.
[33] Lamping 2000, S.219
[34] Biographische Hintergründe und Entstehungsumstände der Texte bzw. die Biographie ihrer Autoren generell werde ich nur dann berücksichtigen, wenn sie etwas zum o.g. Vorhaben beitragen. Auf eine allgemeine Vorstellung von Leben und Werk Anderschs, Sartres und Didions möchte ich verzichten. Für diesbezüglichen Informationsbedarf verweise ich auf die beiden ausführlichen Biographien zu Andersch und Sartre von Stephan Reinhardt (ebd. (1990): Alfred Andersch. Eine Biographie.) und Annie Cohen-Solal (ebd. (1988): Sartre 1905-1980. ). ‚A biographical essay’ zu Joan Didion gibt Katherine U. Henderson (ebd. (1981): Joan Didion. S.1-18.); daneben liegt von Mark Royden Winchell eine detaillierte Beschreibung von Didions Schaffen bis 1980 mit recht umfangreichen biographischen Bezügen vor (ebd. (1980): Joan Didion.).
[35] Es muß betont werden, daß es zwei Ansätze gibt - die Theorie von Jürgen Lehman (1988) und einige grundsätzliche Überlegungen von Elizabeth W. Bruss (1998) - in denen autobiographisches Erzählen auch unter funktionalen Gesichtspunkten dargestellt wird. Ich beziehe mich nicht auf diese Ansätze, weil beide von sprechakttheoretischen Grundlagen ausgehen, die ich nicht zur Grundlage meiner Arbeit machen möchte. Entsprechend der pragmatischen Ausrichtung spielt in beiden Ansätzen das Verhältnis Autor - Leser / Publikum eine zentrale Rolle - ein Schwerpunkt, den ich ebenfalls nicht übernehmen will.
[36] Lejeune 1994, S.14
[37] Lejeune 1994, S.14
[38] Lejeune 1994, S.15
[39] Lejeune 1994, S.27
[40] Lejeune 1994, S.27. Zur Herstellung der Namensidentität gibt es folgende Möglichkeiten: ‚implizit’ durch die ‚Verwendung von Titeln’ (wie beim Seesack durch den Untertitel) oder indem der Erzähler im ‚einleitenden Abschnitt des Textes’ eindeutig und für den Leser zweifelsfrei als Autor auftritt (wie im White Album); ‚offenkundig’, wenn der Erzähler innerhalb der Erzählung den Namen des Autors trägt (vgl. Lejeune 1994, S.28f). Daneben gibt es noch die Möglichkeit, daß der Leser „die Identität zwischen Autor, Erzähler und Protagonist [konstatiert], ohne daß sie feierlich verkündet worden ist“ (ebd., S.32) - z.B. durch die Erwähnung von Werken oder anderen spezifischen Merkmalen, die unzweifelhaft auf die Person des Autors verweisen (dies ist bei Les Mots der Fall). Vgl. ausführlich zum autobiographischen Pakt und anderen Paktarten: ebd., S.19-38.
[41] Lejeune 1994, S.15
[42] Vgl. Lejeune 1994, S.15
[43] Diesbezüglich ist grundsätzlich zu fragen, wie eng Lejeunes Definition des Gegenstandes der Autobiographie zu verstehen ist: ‚Geschichte einer Persönlichkeit’ klingt nach Genese und Entwicklung, nach einer Lebens-Gesamtschau, nach Totalität; die allgemeinere Wendung ‚individuelles Leben’ hingegen könnte heißen, daß die Autobiographie auch nur eine begrenzte Lebensphase zum Thema haben kann (z.B. Kriegs- oder Kindheitserlebnisse). Angesichts der Textbeispiele, auf die sich Lejeune in seinen Abhandlungen bezieht, liegt allerdings die Vermutung nahe, daß er den Gegenstand der Autobiographie hauptsächlich im Sinne der ersteren Möglichkeit versteht.
[44] In Zusammenhang mit dem Problem des Gegenstandes steht auch das Problem des äußeren Umfangs von Autobiographien. Der verbreiteten Auffassung von der Autobiographie als inhaltlich wie seitenmäßig umfangreiches ‚Werk’ trägt z.B. Jürgen Lehmann Rechnung, indem er in seiner Autobiographie-Definition die Bedingung „im Umfang eines Buches“ aufstellt (Lehmann 1997, S.169).
[45] Good (1992): Identity and Form in the Modern Autobiographical Essay. Zu The White Album siehe ebd. S.103-104.
[46] Good 1992, S.100
[47] Good 1992, S.100
[48] Good 1992, S.100
[49] Die meisten theoretischen Abhandlungen zum Essay beziehen sich vor allem auf seine Geschichte und / oder auf seine allgemein methodischen (wenig systematische, z.T. assoziative oder spontan anmutende Ausbreitung eines subjektiven Reflexionsprozesses, nur auf vorläufige oder partielle Lösungen und Resultate angelegt), epistemologischen (subjektive Sinn-Suche vor dem Hintergrund fehlender kollektiver Sinnkonzepte) oder pragmatischen (kommunikative Ausrichtung auf breite Leserschaften zwecks Anregung von Diskussionen und Denkprozessen) Eigentümlichkeiten. Vgl. dazu Schlaffer (1997): Art. ‚Essay’. S.522-524.
[50] Vgl. Schärf (1999): Geschichte des Essays: von Montaigne bis Adorno. S.7f.
[51] Schlaffer 1997, S.525
[52] Schärf 1999, S.8
[53] Schärf 1999, S.7
[54] Auch Ingrid Aichinger versucht sich an der Unterscheidung von Autobiographie und ‚kürzeren’ autobiographischen Texten: Nach inhaltlichen Kriterien grenzt sie z.B. die „Reisebeschreibung“, den „Tatenbericht“ und die „Kriegserlebnisse“ , die nur „einen Teilaspekt betonen“ bzw. einen „kurzen Abschnitt aus dem Leben eines Menschen geben“, von der Autobiographie ab (Aichinger 1998, S.176). Probleme bereitet auch ihr die Abgrenzung der Autobiographie vom „literarische[n] Selbstportrait bzw. philosophischen Reflexionen über das Ich“ (ebd., S177). Ihre diesbezügliche Unterscheidung ist, wie sie selbst eingesteht, nicht besonders ‚scharf’ (vgl. ebd.): ‚Große Autobiographien’ würden das „Ineinandergreifen von Außen- und Innenwelt“ darstellen, seien von einer alles integrierenden und sinngebenden „rückschauenden Wertung“ geprägt, und sämtliche sprachlichen und darstellerischen Mittel würden durch „Fülle und Ausdruckskraft“ direkt auf die Bedeutsamkeit des erzählten Lebens hinweisen (vgl. ebd.). Im ‚literarischen Selbstportrait bzw. philosophischen Reflexionen über das Ich’ hingegen würden diese drei Aspekte „bei zu häufiger Reflexion leicht vernachlässigt“ (vgl. ebd.). Diese Bestimmung ist in zweierlei Hinsicht unbefriedigend: Sie orientiert sich nur an den Merkmalen eines bestimmten Typus’ von Autobiographie, dessen Blütezeit überdies schon eine Weile vorbei ist - daß es auch Autobiographien gibt, in denen die drei Momente fehlen bzw. zugunsten von Reflexion ‚vernachlässigt’ werden, muß wohl, insbesondere mit Blick auf die Moderne, nicht extra erläutert werden. Außerdem läßt uns Aichinger über die Merkmale des ‚literarischen Selbstportraits’ weitgehend im Dunkeln. Zu Beginn ihrer Erläuterung spricht sie noch von ‚statischen Ich-Analysen’, vom Fehlen des ‚historischen Aspekts’ und von „primär introspektive[r] Zielsetzung“ die zum „Überwiegen der Reflexion“ und zur ‚Vernachlässigung der chronologischen Ordnung’ im Selbstportrait führen können (vgl. ebd.). Doch diese Andeutung einer funktionalen Verschiedenheit von Autobiographie und Selbstportrait (einschließlich der sich daraus möglicherweise ergebenden formalen und strukturellen Konsequenzen) wird von ihr leider nicht weiter ausgeführt.
[55] Siehe dazu das Kapitel ‚Autobiographie und Literaturgeschichte’ bei Lejeune 1994, S.379ff; zur Kritik am normativen Vorgehen von Gattungstheoretikern siehe besonders ebd. S.390ff.
[56] Weber 1998
[57] Die Seitenangaben zu den oben zitierten Begriffen folgen in der Erläuterung von Webers Definition.
[58] Die Theorie gliedert sich in zwei Teile: Im ersten Teil gibt Weber eine Definition von Erzählung bzw. Erzählen im strukturellen Sinn (Grundsätze 1-7); daran schließen sich im zweiten Teil verschiedene Überlegungen zur ‚Erzählliteratur’ an (Grundsätze 8-15). Dieser Teil - er enthält Grundsätzliches zum Verhältnis von Literatur und Erzählliteratur, zum bereits erwähnten Unterschied zwischen fiktionalem und faktualem Erzählen (Spiel vs. Ernst), zum fiktionalen Standardtyp der Erzählliteratur sowie eine Diskussion des Terminus ‚Erzähler’ - soll hier jedoch nicht interessieren.
[59] Weber 1998, S.23 und 19f
[60] Weber 1998, S.17
[61] Vgl. Weber 1998, S.12f
[62] Vgl. Weber 1998, S.13f
[63] Vgl. Weber 1998, S.15f
[64] Vgl. Weber 1998, S.20
[65] Vgl. Weber 1998, S.17
[66] Weber 1998, S.17
[67] Vgl. Weber 1998, S.20
[68] Weber 1998, S.24
[69] Weber 1998, S.25. Mit der Wahl des Begriffs ‚Nichtaktuelles’ statt ‚Vergangenes’ trägt Weber dem Typus der „fiktionalen Imaginationserzählung“ bzw. der fiktionalen „Zukunfts-Imaginationserzählung“ Rechnung - diese Differenzierung spielt für meine Zwecke jedoch keine Rolle (vgl. Weber 1998, S.28ff).
[70] Weber 1998, S.33
[71] Damit unterscheidet sich die erzählende Rede von der ‚Teichoskopie’ (vgl. Weber 1998, S.33ff) und von der dramatischen Rede (vgl. ebd., S.39ff), bei denen die Sprecher als Gegenüberstehende bzw. unmittelbar Beteiligte eines aktuellen Geschehens auftreten. Ein Grenzfall ist die sog. ‚szenische Rede’: Dabei tut ein Erzähler nur so, als ei er ein dem Geschehen unmittelbar gegenüberstehender Beobachter - er ahmt gewissermaßen den Teichoskopen nach, ohne wirklich einer zu sein; insofern handelt es sich bei der szenischen Rede um „rhetorisch verstelltes Erzählen“ (ebd., S.37f).
[72] Vgl. Weber 1998, S.39: „Sie [Erzähler in ‚Ich-Erzählungen’] sind nur als Erlebende oder Beobachtende in das erzählte Geschehen verstrickt, als Erzählende sind sie Außenstehende.“
[73] Weber 1998, S.43
[74] Weber 1998, S.43
[75] Weber 1998, S.43f; siehe auch ebd. S.44ff die Erläuterungen des 4. Grundsatzes für ‚erlebte Rede’, ‚Präsenserzählungen’ und ‚personales Erzählen’.
[76] Vgl. Weber 1998, S.49. Zum Handlungscharakter von Sprache und (Erzähl-) Texten siehe Lehmann 1988, S.13-34, der auf diesem Grundsatz der prinzipiellen Adressiertheit des Erzählens seine Theorie zur Autobiographie aufbaut. Webers weitere Differenzierungen zu diesem Grundsatz sollen hier nicht interessieren, da sie sich speziell auf fiktionales Erzählens beziehen. Ein besonders deutliches Beispiel für die Adressiertheit des Erzählens ist die autobiographische Bekenntnisliteratur, in der die Erzähler meist ein ganz bestimmtes Publikum anvisieren, das sie mit ihren Bekenntnissen zu überraschen, schockieren, belehren, bekehren o.ä. gedenken.
[77] Vgl. Weber 1998, S.59
[78] Weber 1998, S.59
[79] Vgl. Weber 1998, S.59
[80] Weber 1998, S.64
[81] Vgl. Weber 1998, S.68f
[82] von Engelhardt (1990): Zur Selbstdarstellung und Selbstsuche im autobiographischen Erzählen.
[83] Erikson (1966): Identität und Lebenszyklus. S.124.
[84] Erikson 1966, S.141
[85] siehe Erikson 1966, S.150f
[86] Erikson 1966, S.59
[87] ‚Normative Krise’ definiert Erikson im Gegensatz zu krankhaften und lähmenden Neurosen oder Psychosen als „normale Phase vermehrter Konflikte, charakterisiert einerseits durch eine scheinbare Labilität der Ichstärke, andererseits aber auch durch ein hohes Wachstumspotential. Neurotische und psychotische Krisen zeichnen sich aus durch eine gewisse Neigung zu starrer Behauptung, durch wachsende Verschwendung von Abwehrenergien und durch vertiefte psychosoziale Vereinsamung, während normative Krisen relativ überwindbar scheinen und durch einen Reichtum an freier Energie charakterisiert sind, der wohl schlafende Ängste aufweckt und neue Konflikte hervorruft, aber auch neue und erweiterte Ichfunktionen im spielerischen Ergreifen neuer Möglichkeiten unterstützt.“ (Erikson 1966, S. 144f)
[88] Erikson 1966, S.149
[89] Erikson 1966, S.59
[90] Vgl. Berger / Luckmann: Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit - Eine Theorie der Wissenssoziologie. Frankfurt/Main 1971. S.107. (hier zitiert nach Picard 1978, S.99): „Daß die Identität des Einzelnen etwas Gefährdetes ist, liegt im Wesen der Sozialisation begründet. Sie ist von der Verbindung des Individuums mit signifikanten Anderen, die kommen und gehen, abhängig.“
[91] von Engelhardt 1990, S.69
[92] von Engelhardt 1990, S.69
[93] von Engelhardt 1990, S.69
[94] von Engelhardt 1990, S.69
[95] von Engelhardt 1990, S.70
[96] von Engelhardt 1990, S.69
[97] von Engelhardt 1990, S.72
[98] von Engelhardt 1990, S.73. ‚Vergangenheit’ umfaßt dabei natürlich die in der Vergangenheit gescheiterten oder gelungenen Vermittlungsprozesse zwischen Ich und Welt und zwischen Ich, Es und Über-Ich bzw. mit Erikson gesprochen: die in der Vergangenheit bewältigten oder nicht bewältigten psychosozialen Krisen.
[99] von Engelhardt 1990, S.69
[100] von Engelhardt 1990, S.75; siehe zur ‚Fremdaussage’, mit der „ein Sprecher einer anderen Person eine Identität zu[weist]“, ebd. S.74.
[101] von Engelhardt 1990, S.77
[102] Vgl. von Engelhardt 1990, S.76
[103] von Engelhardt 1990, S.76
[104] von Engelhardt 1990, S.77
[105] von Engelhardt 1990, S.77
[106] von Engelhardt 1990, S.77
[107] Vgl. Lejeune 1994, S.283; mit den Begriffen des ,Für-mich-Sein’ (‚être- pour-moi’) und ,An-sich-Sein’ (‚être-en-soi’) bezieht sich Lejeune auf Sartre.
[108] Aichinger 1998, S.185.
[109] Vgl. z.B. Aichinger 1998, S.181-186, Picard 1978, S.78; Gusdorf [1954] (1998): Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie. S.137-141.
[110] Aichinger 1998, S.184
[111] Lejeune 1994, S.290
[112] Picard 1978, S.67; vgl. dazu auch Louis A. Renza: „In sacrificing the autobiographer’s past to a secondary role vis-à-vis his ,incomprehensible present’, any first-person-narrative-of-a-life, which necessarily is a presentification of the author’s own mental experiences at the time of writing, could be termed autobiographical and/or fictive.” (ebd. (1977): The Veto of Imagination: A Theory of Autobiography; hier zitiert nach Benesch (1994): Fictions of the Self: Geschichte, Identität und autobiographische Form. S.133. (leider fehlt bei Benesch die genaue Seitenangabe zur Stelle des Zitats im Originaltext)).
[113] Picard 1970, S.130
[114] Der nur graduelle Unterschied bedeutet natürlich, daß es ein großes Spektrum von ‚Übergangsformen’ gibt. Dieses Spektrum kann jedoch in den folgenden Erläuterungen nicht berücksichtigt werden. Das Kapitel stellt lediglich den Versuch einer möglichst grundsätzlichen Gegenüberstellung von modernen und traditionellen Autobiographien hinsichtlich ihrer existentiellen Funktion dar. Wenn also im folgenden Aussagen über das ‚moderne’ bzw. ‚traditionelle’ autobiographische Erzählen gemacht werden, handelt es sich ausnahmslos um Verallgemeinerungen!
[115] Picard, 1978, S.97 (siehe dazu auch das Kapitel „Identitätsgewißheit in der erzählenden Autobiographie ebd., S.97ff). Die Identitätsgewißheit wurde von einigen Theoretikern sogar zum konstitutiven Gattungsmerkmal erhoben. So mißt z.B. Bernd Neumann autobiographisches Erzählen generell am „eigentliche[n] Gegenstand der hochbürgerlichen Autobiographie: die festumrissene, unverwechselbare Persönlichkeit, deren Wachstum dargestellt werden soll,“ und erklärt in diesem Zusammenhang die „Verunmöglichung“ der Autobiographie für das moderne Individuum (Neumann 1970, S.183). Auch für Roy Pascal haben Autobiographien, in denen ihr Verfasser „Unsicherheit oder ein Zögern sich selbst gegenüber“ zu erkennen gibt, „die höchste Aufgabe der Autobiographie“, nämlich die umfassende Darstellung des „ganzen Menschen“ „nicht bewältigt.“ (vgl. Pascal [1960] (1965): Die Autobiographie. Gehalt und Gestalt. S.175 und 188). Der Typ der identitätsgewissen Autobiographie wird hier ‚präskriptiv’ zum Maßstab der Gattung erhoben. Das Resultat ist in beiden Fällen ein sehr enger Gattungsbegriff. Ingrid Aichinger gibt daher mit Recht zu bedenken, daß das „Wesen der Selbstdarstellung [vielleicht] weniger in einer Sinnfindung, sondern in der Suche danach [liegt]“ (Aichinger 1970, S.194).
[116] So hat Bernd Neumann für die bürgerliche Autobiographie nachgewiesen, daß sich in ihr die Selbstdarstellung meist in der Rekonstruktion des Identitäts-Bildungsprozesses bis zur Übernahme einer sozialen Berufsrolle als ‚Charakerrolle’ erschöpft: „Erinnernd wird das Heranreifen des eigenen Selbst verfolgt und vergegenwärtigt bis zu dem Punkt, an dem die Identität erreicht, die soziale Rolle übernommen, die Eingliederung in die Gesellschaft endgültig erfolgt ist. Hier bricht der Autobiograph seine Geschichte ab. Nun, da der ‚Kreiselkompaß’ installiert ist, erübrigt sich gleichsam die Fortsetzung der Lebensgeschichte. Denn nun ist unwiderruflich angelegt, was das Individuum im Verlaufe seines Lebens verwirklichen kann.“ (Neumann 1970, S.183)
[117] Zu den verschiedenen Begründungs und Legitimationsarten autobiographischer Erzählungen, die im Zeichen sinnweltlicher oder subjektiver Sinn-Überzeugungen stehen, siehe Picard 1978, S. 80-96.
[118] Picard 1978, S.107f; zum Zusammenhang zwischen Bekenntnis und Identitätsgewißheit siehe ebd., S.100f.
[119] Picard 1978, S.112
[120] Kant [1783] (1964): Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? S.53.
[121] Vgl. Sartre [1946] (2000): Der Existentialismus ist ein Humanismus. S.155.
[122] Vgl. Neumann 1970, S.182 und 183 (Zitate im Zitat von Riesmann (1958): Die einsame Masse.).
[123] Vgl. Neumann 1970, S.187: „Das ‚Gewissen wird gegenstandslos, denn an Stelle der Verantwortung des Individuums für sich und die Seinen tritt, wenn auch unter dem alten moralischen Titel, schlechtweg seine Leistung für den Apparat.’“ (Zitat im Zitat von Horkheimer / Adorno (1955): Dialektik der Aufklärung.)
[124] Picard 1978, S.98
[125] Neumann 1970, S.187
[126] Neumann 1970, S.189; vgl. ebd. S.188: „Der moderne ‚außen-geleitete’ Mensch, der mit dem Aufkommen der Massenmedien entstand, besitzt nicht mehr die festumrissene Identität des bürgerlichen Individuums. Wechselndes soziales Rollenspiel wird zum Surrogat individuellen Verhaltens. Die Berufsrolle saugt die persönliche Existenz auf. ‚In der modernen Wirklichkeit hängt die Funktion eng mit der ... Identität zusammen, weil die Frage nicht mehr darauf zielt, was einer ist, sondern was er tut.’“ (Zitate im Zitat von Riesmann (1958): Die einsame Masse.) Den Begriff des ‚allozentrischen’ (vs. dem des ‚anthropozentrischen’) Verhaltens hat meines Wissens (ich weiß es aber nicht genau) Robert Musil geprägt: „Allozentrisch heißt, überhaupt keinen Mittelpunkt mehr zu haben. Restlos an der Welt teilzunehmen und nichts für sich zurückzulegen. Im höchsten Grad, einfach aufhören zu sein. Ich könnte auch Hereinwendung der Welt und Hinauswendung des Ich sagen. Es sind die Ekstasen der Selbstsucht und der Selbstlosigkeit.“ (Musil [1930] (1978): Der Mann ohne Eigenschaften. Hier zitiert nach Hielscher: Kritik der Krise. Erzählerische Strategien der jüngsten Gegenwartsliteratur und ihre Vorläufer. S.318. (leider ohne genaue Stellenangabe zum Originalzitat)).
[127] Picard 1978, S.96
[128] Picard 1978, S.153
[129] Good 1992, S.102
[130] Aichinger 1998, S.176
[131] Holdenried 2000, S.37
[132] Vgl. Good 1992, S.102: ,,Instead of doubt giving way to certainty after conversion [wie in den traditionellen Bekenntnis-Autobiographien von Newman und Augustinus], the modern autobiographical essay often shows the reverse process, where identity is lost instead of gained. Where the traditional Bildungsroman and autobiography attempted to find the protagonist’s place in society, the modern autobiographical essay is born of the experience of displacement and the attempt to piece together some kind of coherence in a world that seems to threaten the dissolution of the self.”
[133] Picard 1978, S.165
[134] Picard 1978, S.112; siehe auch das Kapitel „Das metaphysische Bedürfnis und die anthropologische Notwendigkeit gesehen zu werden als Antriebe des modernen autobiographischen Schreibens“ (ebd. S.232ff).
[135] Picard 1978, S.232-234
[136] Vgl. Lejeune 1994, S.285
[137] Picard 1978, S.101f
[138] Lejeune (1994), S.285; siehe zur Relativität und Negativität des Genauigkeits-Begriffs ebd. Es muß betont werden, daß hier wiederum nur von Akzentverschiebungen und graduellen Unterschieden zur traditionellen Autobiographik die Rede ist. Schon Goethe hat das Primat der Bedeutung vor der Genauigkeit zur zentralen Forderung an eine Autobiographie erhoben: „Ein Faktum unseres Lebens gilt nicht, insofern es wahr ist, sondern insofern es etwas zu bedeuten hat.“ (Goethe im Gespräch mit Eckermann 1831, zitiert nach der Reclam-Ausgabe (1991): Johann Wolfgang Goethe. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit . Band 2. Kommentar, Nachwort, Register. S.13.) Allerdings - und darin spiegelt sich vielleicht eher die traditionelle Auffassung von Autobiographik wider - ist dieses Prinzip seiner Zeit bei vielen Lesern auf Unverständnis gestoßen, und nicht wenige Kritiker haben ihre Mühe darauf verwendet, die ‚Verfälschungen’ und ‚Unwahrheiten’ in Dichtung und Wahrheit z.T. tadelnd herauszustellen.
[139] Ein schönes Beispiel hierfür ist Alfred Anderschs Autobiographie Die Kirschen der Freiheit. Ein Bericht (1952). Hier bildet eine einzige kurze Lebensepisode (Anderschs Desertion aus der Wehrmacht) bzw. die damit verbundene Sinn-Erfahrung (ein existentielles Freiheitsgefühl) den thematischen Dreh- und Angelpunkt und narrativen Zielpunkt der dargestellten Lebensentwicklungen, die immerhin einen Zeitraum von 30 Jahren umfassen. Entsprechend wird nur eine relativ überschaubare Anzahl von Entwicklungen, Ereignissen, Erfahrungen und Episoden, die sich in mittel- oder unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Freiheitserlebnis bringen lassen, erzählt, während z.B. durchaus bedeutsame Lebenserfahrungen aus dem privaten Bereich (Familiengründung, Scheidung, Treffen der großen Liebe) kommentarlos ausgespart und noch nicht einmal am Rande erwähnt werden.
[140] Holdenried 2000, S.45
[141] Vgl. Holdenried 2000, S.45; ausführlich zur „erzählerischen Mittelpunktsorientierung klassischer Autobiographik” vgl. ebd.
[142] Holdenried 2000, S.45
[143] Lamping 2000, S.220
[144] Vgl. z.B. Holdenried 2000, S.48f; Picard 1978, S.20ff und 175ff.
[145] Zum Unterschied zwischen den beiden im folgenden häufig verwendeten Ausdrücke ‚metadiskursiv’ und ‚metanarrativ’: Ersterer bezeichnet alle Mitteilungsweisen, bei denen Sinn nicht (nur) diskursiv durch die Bedeutungen und Inhalte (das heißt, auf der Ebene der ‚signifiés’) der verwendeten Wörter vermittelt wird, sondern (auch) in formalen, z.B. sprachlichen, stilistischen oder strukturellen Eigentümlichkeiten (das heißt, auf der Ebene der ‚signifiants’) zum Ausdruck kommt. ‚Metanarrativ’ sind alle Äußerungen, die sich im weitesten Sinne auf die Äußerung selbst beziehen; im autobiographischen Erzählen z.B. Äußerungen, in denen die Grenzen, Schwierigkeiten, Voraussetzungen des Erzählens oder der Schreib- und Erinnerungsprozeß, in dem sich der Autor befindet, thematisiert werden.
[146] Auf dieser Unterscheidung basiert Picards gesamte Theorie; vgl. besonders Picard 1978, S.70ff; zur Selbstreferentialität siehe auch Holdenried 2000, S.47f.
[147] Holdenried 2000, S.50; vgl. dazu auch die von Aichinger prognostizierte Annäherung von Autobiographie und Tagebuch (Aichinger 1998, S.198f).
[148] Der dehnbare Begriff des ‚Stils’ steht hier als Oberbegriff für alle nicht-inhaltlichen, nicht-strukturellen und nicht-perspektivischen Eigentümlichkeiten der Darstellung. In den entsprechenden Kapiteln werden nicht nur sprachlich-rhetorische Merkmale behandelt, sondern auch generelle Merkmale bezüglich Redegestik und Redeweisen und z.T. auch Erscheinungen von Intertextualität.
[149] Vgl. Cohen-Solal 1988, S.118
[150] Zur angemessenen Übersetzung von Les Mots als Die Wörter siehe Hans Mayers Nachwort zur deutschen Übersetzung von Les Mots (2000). S.146f.
[151] Sartre [1969] (1977): Sartre über Sartre. Interview mit Perry Anderson, Ronald Frase, Quinton Hoare. S.166. Zum Gegensatz von Kunst und Leben als prinzipieller Gegensatz von Irrealität / Imaginärem und Realität bzw. Ästhetik und Ethik bei Sartre siehe Kohut (1975): Jean-Paul Sartre. S.104ff.
[152] Lejeune 1994, S.245
[153] Die oben folgenden Darlegungen zum ‚Entwurf’ und zur ‚Urwahl’ sind auf die Thematik dieser Arbeit zugeschnitten und geben in sehr vereinfachter Form nur einen winzigen Ausschnitt aus Sartres komplexer Anthropologie wieder. Einen Überblick über die wichtigsten Zusammenhänge zwischen Freiheit, Bewußtsein, ‚Für-sich’ (‚pour-soi’) und ‚An-sich’ (‚en-soi’), Entwurf, Situation gibt z.B. Seibert (1997): Existenzphilosophie. S.126-146.
[154] Kohut 1975, S.114
[155] Vgl. dazu auch Lejeune 1994, S.286ff und Kohut 1975, S.114.
[156] Vgl. Sartre [1943] (1991): Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. S.963. Vgl. auch Sartre 2000, S.150: „Der Mensch ist zunächst ein sich subjektiv erlebender Entwurf [...]; nichts existiert vor diesem Entwurf; [...] und der Mensch wird zuerst das sein, was er zu sein entworfen haben wird. Nicht, was er sein will. Denn was wir gewöhnlich unter wollen verstehen ist eine bewußte Entscheidung, die bei den meisten von uns erst später gefällt wird, von demjenigen, zu dem sie sich selbst gemacht haben.“
[157] Lejeune 1994, S.286; vgl. dazu auch Sartres Definition von ‚Person’: „Im Grund ist sie [die Person] gar nicht, oder vielmehr: sie ist in jedem Augenblick nur das seinerseits überschrittene Resultat aller zu einem Ganzen strebenden Verfahren, durch die wir ständig versuchen, das Nichtassimilierbare zuzueignen, also zunächst einmal unsere Kindheit: das bedeutet, daß [unsere Person] das abstrakte und ständig wieder retuschierte Projekt einer Personwerdung vorstellt, die einzig wirkliche - das heißt erlebte - Tätigkeit des Lebenden.“ (Sartre zitiert nach Frank (1980): Das Individuum in der Rolle des Idioten. Die hermeneutische Konzeption des ‚Flaubert’. S.100. (Stellenangabe zum Sartre-Zitat fehlt leider bei Frank)).
[158] Lejeune 1994, S.286
[159] Lejeune 1994, S.287
[160] Vgl. Lejeune 1994, S.285 u. 286
[161] Lejeune 1994, S.285
[162] Vgl. Lejeune 1994, S.290
[163] Sartre geht davon aus, daß der Mensch prinzipiell vollkommen negativ durch seine absolute Freiheit bestimmt ist. Da er aber kein Abstraktum ist, sondern innerhalb eines biologischen (Geburt und Tod) und sozialen (Familie, Mitmenschen) Kontextes existiert, ist seine Freiheit in diesem Sinne begrenzt: „es gibt Freiheit nur in Situation, und es gibt Situation nur durch die Freiheit. Die menschliche-Realität begegnet überall Widerständen und Hindernissen, die sie nicht geschaffen hat; aber diese Widerstände und Hindernisse haben Sinn nur in der freien Wahl und durch die freie Wahl, die die menschliche Realität ist.“ (Sartre 1991, S. 845f)
- Arbeit zitieren
- Julia Röhlig (Autor:in), 2003, Gegenstände, Formen und Funktionen modernen autobiographischen Erzählens: Jean-Paul Sartre, Alfred Andersch und Joan Didion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25900
Kostenlos Autor werden





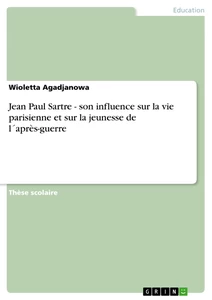

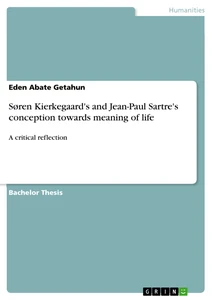


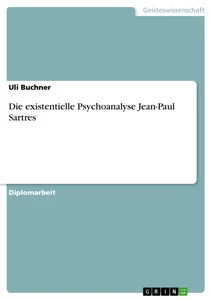





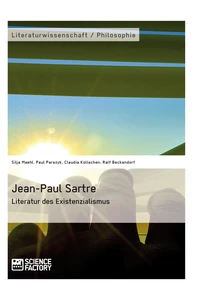



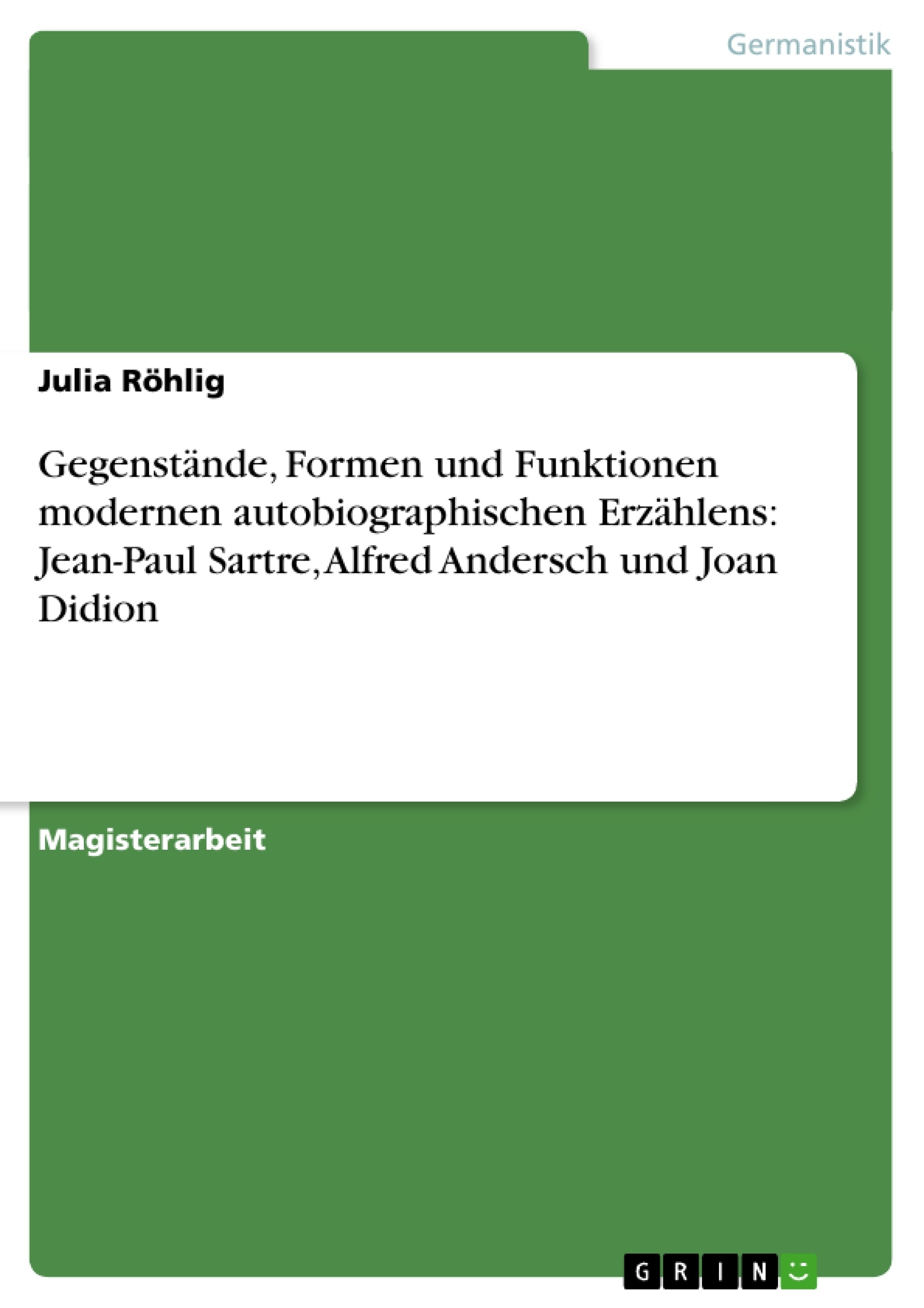

Kommentare