Leseprobe
inhalt
1 EINLEITUNG
1.1 Die Klimapolitik Hannovers - Warum dieses Thema?
1.2 Konzeptioneller Rahmen und Vorgehensweise
1.3 policy-Analyse
1.3.1 Begriff
1.3.2 Theoretisches Konzept
1.3.3 Methode
1.3.4 Typen politischen Handelns
1.3.5 Kategorien der Umweltpolicy-Analyse nach Prittwitz
1.3.6 Politisch-administratives System und Policy-Making-System
1.3.7 Policy-Zyklus
1.3.7.1 Problemdefinition
1.3.7.2 Agendagestaltung
1.3.7.3 Politikformulierung
1.3.7.4 Politikimplementation
1.3.7.5 Politiktermination
2 Zukunft der Energieversorgung - Energieversorgung der Zukunft
2.1 Zwang zum Paradigmawechsel in der Energiewirtschaft
2.1.1 Treibhauseffekt durch fossile Energieträgernutzung
2.1.2 Probleme der Atomenergienutzung
2.2 Nachhaltigkeit
2.3 Der Rio-Prozess
2.3.1 Das internationale Umweltregime der Vereinten Nationen
2.3.2 Klimarahmenkonvention
2.3.3 Das Mandat des Artikel 28 der Agenda 21
2.3.4 Internationale Kooperation auf kommunaler Ebene
2.4 Handlungsaufträge für die LHH
2.4.1 Kriterien für eine nachhaltige kommunale Klimaschutzpolitik
3 EXKURS: Rahmenbedingungen von Kommunalpolitik
3.1 Funktionen (Pflichten) der Kommune
3.2 Möglichkeiten (Rechte) der Kommunalpolitik
3.3 Kommunale Umweltschutzpolitik
3.3.1 Umweltpolitisches Handeln allgemein
3.3.2 Aspekte des übertragenen Wirkungskreises
3.3.3 Aspekte des eigenen Wirkungskreises
3.3.4 Schaffung einer eigenen Umweltbehörde
3.3.5 Zusammenfassung der Bedingungen des (umwelt-)politischen Gestaltens in der Kommune
3.4 Kommunale Klima- und Energiepolitik
4 Großstadt Hannover - Ausgangssituation
4.1 Stadtstruktur
4.2 Energieversorgung
4.3 Verkehr
4.4 Emissionen
5 Policy-Zyklus der Klimapolitik der LHH
5.1 Analyse der Akteure des politisch-administrativen Systems
5.1.1 Stadtwerke Hannover AG (SWH)
5.1.2 PreussenElektra AG
5.1.3 Parteien in Hannover
5.1.4 Verbände, Initiativen, Institute
5.1.5 Verbraucher
5.2 Analyse der Akteure des „Policy-Making“-Systems
5.2.1 Rat der LHH
5.2.2 Ratsfraktionen
5.2.3 Verwaltung der LHH
5.2.4 Verwaltungsausschuß der LHH
5.2.5 Kommunalverband Großraum Hannover
5.2.6 Zusammenfassung: Interessenkonstellation der Akteure
5.3 Die Neustrukturierung der Energieversorgung
5.3.1 Chronologische Liste der Vorgänge im Energiesektor
5.3.2 Problemdefinition
5.3.3 Agenda-Gestaltung
5.3.3.1 Bürgerantrag
5.3.4 Politikformulierung
5.3.4.1 Atomausstieg
5.3.5 Politikimplementation
5.3.5.1 Kartell-Gutachten
5.3.5.2 Energiekonzept Hannover (EKH)
5.3.5.2.1 EKH-1 - Energiepolitische Zielsetzungen
5.3.5.2.2 EKH-5 - Strombeschaffungskonzept Hannover
5.3.5.3 Konzessionsvertrag Elektrizität 1994
5.3.5.4 Institutionalisierung von Umweltschutz
5.3.5.5 Ausbau der REQ-Nutzung
5.3.5.6 Investitionsprogramm „Energetische Sanierung öffentlicher Gebäude“
5.3.5.7 Schulenergiesparen
5.3.5.8 Energiepaß
5.3.5.9 Kommunales Klimaschutzprogramm der Stadt Hannover
5.3.5.10 Klimaschutzfonds und „proKlima"
5.3.5.11 Lokale Agenda 21
5.3.5.12 LCP - Studie und ihre Umsetzung
5.3.6 Politikevalution und Terminierung
6 Auswertung der Klimapolitik der Kommune Hannover
6.1 Erkennbare Grundlinien der Policy
6.2 Restriktionen
6.3 Erfolgsbedingungen
6.4 Einfluß und Reaktion von Akteuren
6.5 Einfluß und gewicht des Konzepts Nachhaltigkeit
6.6 fazit und ausblick
7 Anhang
7.1 Verwendete Literatur und Hilfsmittel
7.2 Interviewpartner und Gesprächsdaten
Verwendete Abkürzungen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 EINLEITUNG
1.1 Die Klimapolitik Hannovers - Warum dieses Thema?
Die drohende Gefahr einer massiven Klimaveränderung ist eines der drängensten ökologischen Probleme, mit der sich die Menschheit zur Zeit konfrontiert sieht. Es handelt sich um ein tiefgreifendes, schleichendes Problem, das alle Staaten der Welt in verschiedener Hinsicht und unterschiedlichem Ausmaß gemeinsam betrifft und dem nur entsprechend in einer gemeinsamen globalen Anstrengung begegnet werden kann.
Einer der meistdiskutierten Lösungsansätze für derzeitige soziale und ökologische Probleme ist das Konzept der „Nachhaltigkeit“, wie es besonders in Folge der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro diskutiert wurde. Da in den Industrieländern weitaus gravierendere Umweltverschmutzungen und auch mehr klimaverändernde Emissionen als in den Entwicklungsländern zu verzeichnen sind (vgl. v. Weizsäcker 1997, 242) und soziale Strukturen weitgehend vorhanden und leistungsfähig sind, wird der Schwerpunkt des Handlungsbedarfs in jenen Ländern eher in ökologischen Dingen gesehen. Weizsäcker (1997, 246) weist auf die unterschiedliche Wahrnehmung der UNCED-Ergebnisse bei Industrie- und Entwicklungsländern hin, wobei jene sie als Appell zu verstärkten Bemühungen für Umweltschutz, diese sie eher als Aufforderung zur beschleunigten wirtschaftlichen Entwicklung sähen.
Die vorhandenen Lösungsvorschläge implizieren eine Anwendung auf lokaler Ebene der Staaten, also an der Stelle, an der die Ursachen von Umweltbeeinträchtigungen entstehen. Dies wird ausgedrückt in dem Motto „Global denken - Lokal handeln“. Im bundesdeutschen, lokalen Politikfeld Klimaschutz gibt es (noch) keine negativen Auswirkungen direkt vor Ort, wie etwa bei Fehlsteuerung in den Politikfeldern Verkehrs- oder Abfallpolitik. Sie spielen zunächst nur auf deutlich höheren politischen Ebenen wie der internationalen (UNO), zwischenstaatlichen (EU) Ebene und direkt als solche in anderen Weltregionen eine Rolle, z.B. in Mittelamerika, Südostasien und Hinterindien. Die dort auftretenden Beeinträchtigungen menschlichen Lebens werden politisch motiviert zu Grundlagen von lokalem Handlungsbedarf umgemünzt.
Diese Arbeit untersucht als Fallstudie den Einfluß und den Erfolg des globalen Konzepts der Nachhaltigkeit auf die lokale Klimaschutz- und Energiepolitik der Stadt Hannover innerhalb der letzten zwölf Jahre, von 1986 bis 1997[1]. Wie wurde ggf. das Motto „Global denken - Lokal handeln“ umgesetzt? Konnte durch konkrete, kleinräumige und dezentrale Politikkonzepte auf der Ebene von Kommunen, Verbrauchern und Verursachern effizienter eine sanfte Wirtschaftsweise umgesetzt werden als durch die globalen Konventionen der internationalen Gremien, die zwangsläufig eine geringere Tiefenwirkung und Tiefenschärfe haben? Aus diesen Gründen beschäftigt sich diese Untersuchung mit den Vorgängen auf kommunaler Ebene.
Um die oben gestellte Frage beantworten zu können, soll untersucht werden, ob die Policy die CO2-Bilanz der Stadt Hannover verändern und ggf. verbessern konnte, wodurch (durch welche einzelnen Maßnahmen) dies erreicht wurde, wer die Maßnahmen der Policy konzipiert, initiert und implementiert hat, inwiefern Akteure für oder gegen einzelne Maßnahmen gearbeitet haben, und welche Maßnahmen formuliert, aber nicht vollständig umgesetzt wurden. Das bedeutet, daß die Arbeit zu einem nicht geringen Teil zunächst beschreibenden Charakter hat, um dann näher in die Analyse einsteigen zu können.
Die Wahl des Untersuchungszeitraumes gründet sich auf Hannover ist eine Großstadt, Industrie- und Dienstleistungszentrum, niedersächsische Landeshauptstadt und das politische Zentrum Niedersachsens. Hannover wurde als Untersuchungsgegenstand gewählt, da der Autor hier seinen Wohnort und Lebensmittelpunkt hat und somit über gute Kenntnisse und einen leicht möglichen Zugang zu Akteuren und Informationen verfügt. Es gibt durch die politische Bedeutung der Stadt eine Vielzahl von Akteuren mit teilweise überdurchschnittlichem Engagement für nachhaltige Konzepte. So sind viele alternative und ökologische Initiativen, Verbände[2] und viele Nicht-Regierungs-Organisationen (NRO) vor Ort aktiv, die teilweise auch im Energiesektor eine wichtige Rolle spielen. Die Bürgerinitiative Umweltschutz (BIU) beispielsweise gründete 1972 in Hannover das erste Umweltschutzzentrum bundesweit.
Klimapolitik vollzieht sich hauptsächlich im Bereich der Energieversorgung. 76% der Emissionen von Treibhausgasen (THG) in Hannover werden durch die Energiebereitstellung und -nutzung (Kraftwerke, Industrie, Haushalte, Kleinverbrauch[3]) verursacht (LHH 1996/8, 11, 22). Jeder Marktteilnehmer ist in der einen oder anderen Form auf Energie angewiesen. Durch diese Einzigartigkeit und Querschnittfunktion besitzt Energie eine überragende Bedeutung für Stadtplanung, Industrie, Konsum, Verkehr, Umweltbelastung, Umweltpolitik und weitere Bereiche. Die vorliegende Arbeit wird daher den Schwerpunkt auf den Energiesektor legen[4].
Die Landeshauptstadt Hannover (LHH) hat als einzige bundesdeutsche Großstadt den Stopp des Atomstrombezugs[5] rechtskräftig zu einem festen Datum (1.1.2000) per Ratsbeschluß beschlossen und somit allein durch kommunale, politische Beschlüsse den Ausstieg aus der Atomenergie ermöglicht. Dieser Beschluß ist unter zwei Gesichtspunkten für die Untersuchung dieser Arbeit interessant. Zum einen gehen die derzeitigen bundespolitischen Überlegungen bei einem kurzfristigen Atomausstieg von hohen Entschädigungsforderungen der Kraftwerksbetreiber gegen den Staat aus. Das Beispiel Hannovers zeigte eine Alternative auf, wie diese Entschädigungsforderungen durch eine derartige Anwendung kommunaler Gestaltungsmöglichkeiten völlig hätten umgangen werden können, lange vor den Möglichkeiten, die die Liberalisierung des Strommarktes durch das neue Energiewirtschaftsgesetz einerseits bietet. Zum anderen bedeutet der Verzicht auf Atomstrombezug eine weitere Hürde beim Erreichen des CO2-Reduktionsziels. Wenn dieses Ziel durch einen weitgehenden Verzicht auf fossile Energieträger vollzogen werden soll, ergibt sich das Dilemma, daß nach herrschender Meinung nur die Atomkraft den erforderlichen Strombedarf kurzfristig bereitstellen kann. Der Rat der LHH will jedoch beide Ziele - Atomausstieg und CO2-Reduktion - gleichzeitig verwirklichen und hat entsprechende Konzepte vorgelegt. Diese doppelte Zielsetzung kann als Beleg für einen besonders hohen Anspruch an die eigene Energie- und Klimapolitik bewertet werden. Auch deswegen lohnt sich eine Untersuchung der Vorgänge in Hannover.
1.2 Konzeptioneller Rahmen und Vorgehensweise
Bei der Analyse der Energie- und Klimapolitik in Hannover orientiere ich mich am Konzept der Policy-Analyse nach Windhoff-Heritiér (Windhoff-Héritier 1987). Es wird im nächsten Abschnitt 1.3 näher beschrieben. Mit diesem theoretischen Instrumentarium soll das Machbare mit dem Erreichten verglichen werden, um den Erfolg und die Effizienz der hannoverschen Energie- und Klimaschutz-Policy in den Jahren 1986 bis 1997 einordnen zu können[6].
Als Quellen dienten verschiedene Veröffentlichungen der LHH, insbesondere Drucksachen (Drs.) von Rat und Verwaltung, Anträge der Ratsfraktionen und Veröffentlichungen weiterer Akteure wie etwa den SWH oder des Amtes für Umweltschutz.
Desweiteren wurden nicht-standardisierte Interviews mit verschiedenen Personen (als Vertreter der Akteure) geführt. Diese Gespräche dienten als Informationsquelle[7] zu den realen politischen Vorgängen und der spezifischen Interessenkonstellation, die dabei jeweils zur Verwirklichung kam. Das betraf vor allem die Motivation des eigenen politischen Handelns sowie die Einschätzung der Motivationen und Interessen anderer Akteure. Ein weiterer Aspekt war die Art der Vertretung von eigenen Interessen. Es wurde ebenfalls nach der Einschätzung des Erfolgs oder Mißerfolgs der hiesigen Politik, ihren Erfolgsbedingungen und Restriktionen gefragt.
Das Problem, das der vorliegenden Arbeit zugrunde liegt, wirkt sich nicht nur auf Hannover, sondern auf die gesamte Erde aus. Deshalb soll zunächst in Kapitel 2 ein Einblick in die Problematik des globalen Klimaschutzes gegeben werden. Hierzu wird das, was innerhalb internationaler Regime zum Thema Energieversorgung und Klimaschutz geleistet wurde, das Konzept der Nachhaltigkeit als Lösungsweg und sich daraus ergebende Handlungsperspektiven für die Landeshauptstadt Hannover dargestellt.
Es folgt in Kapitel 3 ein Exkurs zu den allgemeinen Rahmenbedingungen und Funktionsweisen von Kommunalpolitik und kommunaler Umweltpolitik sowie in Kapitel 4. die Beschreibung der Ausgangssituation in Hannover. Daraufhin soll in Kapitel 5 der Policy-Zyklus der Klimaschutz- und Energiepolitik in Hannover dargestellt und untersucht werden.
Kapitel 6 beschließt die Untersuchung mit der Gesamtbewertung der Policy und dem Fazit.
1.3 policy-Analyse
1.3.1 Begriff
Da der deutsche Begriff „Politik“ im Englischen mit den drei Worten „policy“ „polity“ und „politics“ übersetzt werden kann, die alle verschiedene Dimensionen von „Politik“ ausdrücken und bezeichnen, werden zur besseren Unterscheidung die englischen Begriffe übernommen. Dabei bezeichnet „policy“ die Dimension des gesteuerten, politischen Handelns und Planens, „polity“ die institutionellen Rahmenbedingungen wie Verfassung und Staatssystem und „politics“ bezeichnet schließlich das ungesteuerte politische Geschehen.
1.3.2 Theoretisches Konzept
Die Policy-Analyse geht von der Annahme aus, daß ein gezieltes Steuern von politischen Abläufen möglich und notwendig und politisches Handeln mehr als nur Risikomanagement ist (vgl. Prittwitz 1990; vgl. auch Windhoff-Héritier 1987, 15[8]). Während die klassische Politikwissenschaft sich mehr auf die Untersuchung von politischen Institutionen konzentrierte, bietet die Policy-Analyse verschiedene neue Kategorien, um politisches Handeln zu untersuchen und zu bewerten. Die Policy-Typen geben einen Anhaltspunkt zur Klassifizierung von politischem Handeln (Windhoff-Héritier 1987, 21), das Policy-Netz verdeutlicht die institutionalisierten Beziehungen zwischen Akteuren (ebd., 43), der Policy-Zyklus unterteilt das politische Handeln in mehrere Abschnitte mit unterschiedlichen Funktionen (s.u.).
Zum Policy-Zyklus schreibt Windhoff-Héritier:
„Ein Problem tritt als solches ins öffentliche Bewußtsein, wird aufgrund der Forderungen bestimmter Gruppen und dominanter gesellschaftlicher Wertvorstellungen als handlungsrelevantes Problem definiert und auf die politische Entscheidungsagenda gesetzt. Begleitet von politischen Auseinandersetzungen und Aushandlungsprozessen zwischen verschiedenen politischen Gruppen wird „das Problem“ in die Form einer politisch-administrativ verbindlichen Entscheidung gebracht, die dann im Durchführungsprozeß durch nachgeordnete politische und administrative Akteure, gesellschaftliche Gruppen und Organisationen sowie Einzelbürger ihre konkrete Ausgestaltung erfährt. Die daraus resultierenden konkreten Policy-Ergebnisse und -Wirkungen (die wissenschaftlich untersucht werden können: Evaluation) schließlich rufen eine politische Reaktion der Zustimmung oder Ablehnung hervor, die wiederum politisch umgesetzt wird und zur Weiterführung, Veränderung oder Beendigung der Policy führt.“ (Windhoff-Héritier 1987, 65)
„Der Blick richtet sich auf einzelne Nebenschauplätze der Politik, auf verschiedene Policy-Bereiche, wie z.B. die Krankenhausfinanzierung oder die Agrarpolitik u.a.m. Leitend ist dabei der Gedanke, daß man der Vielfalt und Komplexität politischer Prozesse nicht gerecht wird, wenn man im Sinne des traditionellen politikwissenschaftlichen Lehrbuchs nur den wichtigsten politischen Institutionen wie Regierung, Parlament, Parteien und Verbänden Aufmerksamkeit zollt, daß es in verschiedenen Politikfeldern vielmehr unterschiedliche Konflikt- und Kooperationsmuster zwischen den beteiligten Gruppen und Institutionen gibt, deren Bedeutung nur erfaßt werden kann, wenn die Kamera auf die einzelnen Policy-Schauplätze einschwenkt.“ (Windhoff-Héritier 1987, 44)
1.3.3 Methode
Die Policy-Analyse versucht, die Dynamik politischen Handelns anhand des Modells eines Policy-Zyklus mit bestimmten, definierten Abschnitten auszudrücken, nachzuzeichnen und zu untersuchen. Windhoff-Héritier nennt diese Phasen Problemdefinition, Agenda-Gestaltung, Politikformulierung, Politikimplementation und Termination. Dabei impliziert die Termination nicht nur nach dem Wortsinne die Beendigung der Policy, sondern auch die Weiterführung oder aber die teilweise oder gänzliche Neuformulierung, d.h. eine Zielkorrektur mit ein. Im Falle einer Neuformulierung verschwimmen die Grenzen zur Politikformulierung (Windhoff-Héritier 1987, 106). Die Policy-Analyse untersucht besonders in den Phasen Politikformulierung und Politikimplementation die Reaktionen von Akteuren außerhalb des inneren Entscheidungssystems auf die Wirkungen der Policy.
1.3.4 Typen politischen Handelns
In diesem Abschnitt soll dargestellt werden, welche Policy-Typen (vgl. Windhoff-Héritier 1987, 21ff.) dem handelnden politischen Subjekt (z.B. der Kommune) grundsätzlich zur Verfügung stehen. Wenn festgestellt werden kann, in welchem Maße die verschiedenen Typen angewandt wurden, lassen sich Rückschlüsse auf den Stellenwert des Issues, die Angemessenheit einer Maßnahme und ihre Erfolgsaussichten ziehen.
Die Kategorisierung erfolgt zunächst nach den vier Kriterien, die sich aus der Vielzahl von Klassifizierungen der Policy-Analyse herauskristallisiert haben und jeder Policy zugeordnet werden können: Nominalkategorie, Verteilungswirkung, Steuerungsprinzip und materielle B eschaffenheit.
- Nominalkategorie: Die Politik wird dem Fachgebiet zugeteilt (z.B. Agrarpolitik). Diese Kategorie ist besonders dazu geeignet, um institutionelle Zuständigkeiten zu verdeutlichen.
- Verteilungswirkung: Die Politik wird danach eingeordnet, ob eine materielle Umverteilung vorgenommen wird. Hierbei zählen nicht nur monetäre Effekte, sondern auch Nutzen, die sich erst zu einem späteren Zeitpunkt in materiellen Vorteil umsetzen können. Windhoff-Héritier (1987, 22) unterscheidet die Arten distributiv und redistributiv. Diese Kategorie dient dazu, erkennbar zu machen, wer zu den etwaigen Gewinnern und Verlierern einer Politik gehört oder sich als solcher sieht. Damit lassen sich Motive und politische Schwerpunktsetzung der Akteure und wahrscheinliche Reaktion der Betroffenen verdeutlichen. Verteilenden (distributiven) Maßnahmen wird wenig Mißtrauen und Protest entgegengebracht, da sich niemand als Verlierer einer Policy sieht. Entsprechend bringt umverteilende (redistributive) Policy größeren Protest derjenigen mit sich, die sich von einer Regelung benachteiligt sehen, und größere Unterstützung derjenigen, die ihrer Meinung nach profitieren werden.
- Die Unterscheidung nach Steuerungsprinzipien (Windhoff-Héritier 1987, 27ff.) beantwortet die Frage „Wie wird eingegriffen?". Wie jede staatliche Politik hat die Kommune prinzipiell verschiedene Instrumente zur politischen Steuerung zur Verfügung, die sich in der Stärke des Eingriffs unterscheiden. Es liegt im Ermessen der Kommune, wie stark die von ihr angewendete Steuerung ist. Diese verschiedenen Möglichkeiten staatlicher Gestaltungsmacht werden in fünf Arten eingeteilt: 1. Gebot/ Verbot; 2. Anreiz; 3. Angebot; 4. Überzeugung/ Aufklärung; 5. Vorbildfunktion.
Das stärkste Instrument ist das Ge- oder Verbot. Es findet praktische Anwendung in Dienstanweisungen an die Verwaltung, Bauauflagen, Bebauungsplänen, Richtlinien, Benutzungszwängen und -regeln für öffentliche Einrichtungen (Gebühren, Anschlußzwang).
Das nächste zur Verfügung stehende Instrument ist der Anreiz zu einem bestimmtem Handeln, das als der Allgemeinheit nützlich eingeschätzt wird. Dieses wird durch gezielte, einmalige Förderung begünstigt. Dieses Mittel richtet sich an alle Bürger und Betriebe, z.B. Zuschüsse im Rahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung, Gewährung von Preisnachlässen bei Grundstücksverkäufen und die Beteiligung am Sparergebnis des Schul-Energiesparens (siehe Kap. 5.3.5.6).
Das Instrument des Angebotes besteht aus einer festgelegten, dauerhaften Förderung, die unter bestimmten, zu erfüllenden Bedingungen erfolgen kann, z.B. Sozialhilfe und BAFöG-Gelder. In diese Kategorie gehört auch das Gewähren einer niedrigen Gewerbesteuer.
Bei den Instrumenten Überzeugung und Aufklärung wird der Status Quo beschrieben, ein bestimmtes Handeln daraus abgeleitet und als ethisch-moralisch hochwertig dargestellt (dies ist nicht zu verwechseln mit Öffentlichkeitsarbeit, die aber hierbei als Medium und Sprachrohr der Stadt zur Legitimation ihrer Politik eine sehr entscheidende Rolle spielt), z.B. Appelle zur Energieeinsparung im privaten Umfeld, Schul-Energiesparen
Das Instrument des Vorbildes zielt darauf ab, durch eigenes Handeln zu überzeugen, also die Norm für eine freiwillige Veränderung des Verhaltens zu setzen, indem dessen positive Wirkung erfahrbar gemacht wird - z.B. bevorzugte Einstellung von Frauen und Behinderten im öffentlichen Dienst, umweltfreundliches Beschaffungswesen, energetische Sanierung öffentlicher Gebäude etc.
- Die Unterscheidung nach Beschaffenheit (Windhoff-Héritier 1987, 35ff.) beurteilt Programme nach der Gewährung a) materieller und b) immaterieller Leistungen sowie c) verhaltensnormierende Programme ohne Leistungscharakter. Normbildende Maßnahmen haben eine weitaus geringere Reaktion zur Folge, da mit ihnen keine Sanktionen verbunden sind.
1.3.5 Kategorien der Umweltpolicy-Analyse nach Prittwitz
(Umwelt-)Policy, die immer mit einer Vielfalt von Instrumenten umgesetzt werden kann und wird, ist entsprechend von unterschiedlicher Wirkung. Prittwitz (1990, 54ff.) benutzt zur Bewertung eines Policy-Problems die Begriffe der Problemtiefe, Problemschärfe, -geschwindigkeit und -breite und fügt den Kriterien von Windhoff-Héritier analog die Kriterien von Wirkungstiefe, - schärfe, -geschwindigkeit und -breite von politischem Handeln hinzu.
1.3.6 Politisch-administratives System und Policy-Making-System
Die Policy-Analyse benutzt auch das Konzept der System-Umwelt-Theorie, nach welchem die Akteure verschiedenen Systemen zugeordnet und so voneinander abgegrenzt werden. Diese Systeme beeinflussen die politischen Entscheidungen und einander gegenseitig. Machtkonstellationen können sichtbar werden. Das politisch-administrative System beinhaltet nicht nur die offiziellen Gremien des staatlichen Entscheidungsapparates, sondern auch intermediäre Organisationen des politischen Entscheidungsprozesses wie Interessenverbände[9]. Es trägt zur Steuerung des soziokulturellen und des ökonomischen Systems bei, die beide ihrerseits die Rahmenbedingungen und Grundstrukturen des politisch-administrativen Systems stark beeinflussen. Das politisch-administrative System beinhaltet weiterhin quasi auf einer höheren Ebene das enger gefaßte „Policy-Making“-System, das die konstitutionell vorgesehenen Institutionen ausmacht, an den die Akteure des umgebenden politisch-administrativen Systems ihre Forderungen herantragen (Windhoff-Héritier 1987, 64).
Durch die Analyse der Akteure wird das Politik-Netz deutlich, innerhalb dessen die Klimapolitik entsteht, Veränderungen erfährt und umgesetzt wird. Das Verhältnis der Akteure zueinander und ihre miteinander reagierenden Interessen sind bei der Formulierung und Implementierung der Policy von großer Bedeutung.
Weitere begriffliche Werkzeuge der Policy-Analyse sind die Konzepte von Policy-Netz, mit dem der Kreis der Akteure und ihre Beziehungen untereinander beschrieben werden, und Politikarena, was auf den politischen Prozeß, das politische Handeln und Reaktionen Betroffener bezogen ist (ebd., 43ff.).
Die genaue Definition des Policy-Netzes ist „das Zusammenwirken der unterschiedlichsten exekutiven, legislativen und gesellschaftlichen Gruppen bei der Entstehung und Durchführung einer bestimmten Policy“ (ebd., 44). Von Prittwitz spricht vereinfachend von Regierung und Verwaltung als hauptsächlichen Akteuren der Umweltpolitik, zu denen weiterhin auch „gesellschaftliche Akteure außerhalb des staatlich-administrativen Komplexes (...) (Fachleute, Bürgerinitiativen, WählerInnen)“ gezählt werden könnten, so daß sich „das umweltpolitische Steuerungsmodell zu einem Modell gesamtgesellschaftlichen Handelns und Lernens“ erweitere (Prittwitz 1990, 53f).
Es gibt mehrere Anwendungsformen der Policy-Analyse: Bei der präskriptiven oder ex-ante-Analyse wird eine mögliche Policy entworfen, die ihre eigenen Folgen prognostiziert, bewertet und ggf. als Politikberatung den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellt. Der deskriptive oder ex-post-Ansatz bewertet eine Policy nach ihrer Implementation, um aus dem tatsächlichen Fall Erkenntnisse zu gewinnen. In der vorliegenden Arbeit wird der beschreibend-erklärende ex-post-Ansatz verwendet: Wer regierte (setzte seine Interessen durch) mit welcher Folge und Wirkung?
1.3.7 Policy-Zyklus
1.3.7.1 Problemdefinition
Politische Probleme sind keine objektiven Größen. Ob sie als Problem anerkannt und demzufolge auf die politische Tagesordnung gesetzt werden, hängt zum Teil von subjektiven Faktoren ab. Probleme entstehen, weil staatliches und privates Handeln bestimmte, unerwünschte Folgen nach sich zieht. „Diese Folgen aber werden durch Individuen und Gruppen unterschiedlich und selektiv perzipiert“[10]. Das bedeutet, eine Gruppierung, die ihre Interessen durch diese Folgen eingeschränkt sieht, muß sich öffentlich artikulieren und ausreichende Aufmerksamkeit auf sich bzw. das Problem lenken.
Die Motive für eine Problematisierung sind Überzeugtheit von der Existenz eines Mißstandes, die Sorge um das Allgemeinwohl oder der Wunsch, bereits getätigte Problemlösungen anderer politischer und gesellschaftlicher Systeme nachzuahmen, der Wunsch nach Profilierung einzelner Personen oder einzelne Ereignisse, die einen Meinungsumschwung veranlassen.
Die Definition eines Policy-relevanten Problems setzt voraus und bedeutet, daß dieses auch überhaupt einen Ansatz für ein Policy-Handeln bietet, daß es sich politisch-administrativ bewältigen läßt. Die Kritik an einem Problem muß Alternativen beinhalten.
Je nach Breiten- und Tiefenwirkung, die man dem Problem zuordnet, empfiehlt sich auch die Wahl einer adäquaten Policy mit entsprechender Breiten- und Tiefenwirkung. Hier findet bereits ein Vorgriff und eine gewisse Festlegung auf den Lösungsweg, die Policy-Formulierung, statt. Wenn sich Policy-Problem und Policy-Lösung nicht entsprechen, ist die Policy nicht angemessen, kann keine entsprechenden Gegenwirkungen entfalten und kann daher insgesamt nicht erfolgreich sein.
Windhoff-Héritier schreibt zur Problemdefinition, sie ließe sich keinen institutionellen Strukturen zuordnen, die für „Problemdefinition“ zuständig sind (1987, 67).
„Vielmehr beteiligen sich beliebige gesellschaftliche Gruppen, Individuen und Institutionen an diesem Prozeß, der sich auf subtile, fließende, informelle und schwer objektivierbare Weise im öffentlichen Bewußtsein vollzieht, ohne daß klar gesagt werden kann, wer daran in welcher Rolle mitwirkt.“ (ebd.)
1.3.7.2 Agendagestaltung
Nicht jedes Problem, was als solches definiert wurde, gelangt auf die politische Tagesordnung, also in eine Sphäre der Vorentscheidung, ob einem Problem politisches Handeln zukommen muß oder nicht.
„Ein gesellschaftliches Problem als Policy-Problem zu verstehen ist also gleichbedeutend mit der Aufforderung, politisch und administrativ zu handeln und Lösungsvorschläge zu entwickeln. Damit rückt das Problem in die Nähe der politischen Entscheidungsorgane, ist aber noch nicht in den engen Kreis derjenigen Probleme vorgedrungen, über die dann rechtlich verbindliche Entscheidungen gefällt werden, denn es steht noch nicht auf der politischen Tagesordnung.“ (ebd., 69).
Bei der Agenda-Gestaltung des Policy-Zyklus geht es darum, einen Prozeß einzuleiten, in dem Lösungsmöglichkeiten, Maßnahmen, Handlungen und Instrumenten für das in der ersten Phase definierte Problem gefunden und für die nächste Phase zu Wahl gestellt werden.
1.3.7.3 Politikformulierung
In der dritten Phase des Policy-Zyklus, der Politikformulierung, wird dem Policy-Problem eine Policy-Lösung, ein Programm zugeordnet. Die Programmvorschläge werden dafür nach den zur Verfügung stehenden Informationen in ihrer Effizienz abgewogen, einem politischen Entscheidungsorgan vorgelegt und nach Meinungsbildungs- und Konfliktprozessen durch eine Mehrheitsentscheidung in einen umzusetzenden Maßnahmenkatalog verwandelt. Die Policy-Analyse untersucht die Inhalte des beschlossenen Programms wie Gesetze, Vorschriften oder Verordnungen („Policy-output“), bevor auf die Implementation und ihre Ergebnisse („policy - outcomes“) und Wirkungen („policy-impacts) eingegangen wird (ebd., 19) .
In dieser Phase bestehen die größten Chancen, die Lösung eines Policy-Problems oder eine bereits geplante Policy zu verändern und zu beeinflussen. Radikale Handlungsprogramme werden abgeschwächt, um mehrheitsfähig zu werden. Es kann Einschränkungen der beabsichtigten Ergebnisse geben, Auflagen und Verbindungen (Junktim) mit anderen Politikinhalten, die nicht einmal zum selben Politikfeld gehören müssen. Wenn sich abzeichnet, daß kein Kompromiß erzielt werden kann, wird mit einem politischen Tauschhandel versucht, wenigstens andere Handlungsprogramme für eigene Positionen und Interessen auf diesem Wege durchzusetzen.
1.3.7.4 Politikimplementation
Die Implementation ist das Umsetzen oder Ausfüllen der beschlossenen Policy, des Programms, also jedweder rechtsverbindlicher Entscheidungen von politischen und administrativen Organen (Windhoff-Héritier 1987, 86). In dieser Phase des Policy-Zyklus werden die Ergebnisse („Policy-outcomes“) untersucht, beispielsweise eine Mittelallokation oder die Einstellung von Personal, und die tatsächlich sich ergebende Veränderung oder Wirkung in dem Feld, auf das die Policy zielt - hier also eine Verbesserung der Umweltqualität („Policy-impact“) (ebd., 19). Ein weiterer Punkt, der bei allen angeführten Untersuchungsbereichen zum Tragen kommt, sind beeinflussende Faktoren, wie Gegenmaßnahmen oder auch Unterstützung von Seiten der Betroffenen oder anderer Akteure („Policy-Reaktionen“) .
Die Phasen der Formulierung und der Implementation können sich dabei oft überlappen. Konflikte, die in der Formulierung nicht ausgetragen wurden, können in der Implementation wieder aufgenommen und möglicherweise zugunsten eines Akteurs verändert werden, der in der Formulierung unterlegen ist. Ebenso können umgekehrt die Akteure der Implementation bereits auf die Formulierung Einfluß nehmen, um ihre Interessen frühzeitig zur Geltung zu bringen (Windhoff-Héritier 1987, 89).
Diese Verknüpfung und Durchmischung der Phasen macht die Beantwortung der Frage schwieriger, wo die Unzulänglichkeiten eines Programmscheiterns zu verorten sind: in der Programmgestaltung oder seiner Durchführung. Je präziser ein Programm formuliert wurde, desto schwieriger ist es für die ausführenden Akteure, Änderungen in der Durchführung vorzunehmen (ebd., 90). weiterlesen!
1.3.7.5 Politiktermination
Die Politiktermination oder Programmbeendigung erfolgt aus der Veränderung der allgemeinen Existenzberechtigung des Programms: entweder das Erreichen des gesetzten Ziels, die Einsicht in das Scheitern des Programms oder seine Neuauflage in einem neuen Zyklus mit neuer Formulierung und Implementation. Eine Veränderung der Policy ist somit nicht das Ende der Policy, sondern verweist auf eine frühere Phase des Zyklus (Windhoff-Héritier 1987, 106).
Das Erreichen des gesetzten Ziels ist dabei die Ausnahme, das Scheitern oder Verändern einer Policy eher die Regel (ebd.). Das Scheitern kann in mehreren Formen geschehen, indem etwa Kritiker des Programms (z.B. Betroffene oder politische Gegner) sich durchsetzen, politische Konstellationen sich aufgrund anderer Umstände verändern und einer Maßnahme weniger Mittel und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder sich äußere Rahmenbedingungen (z.B. Konjunktur, übergeordnete Gesetzgebung, wissenschaftliche Erkenntnisse) dergestalt ändern, daß die Policy ihren Sinn verliert.
Die Beendigung kann auch durch die Formulierer selbst erfolgen, wenn in einer begleitenden oder abschließenden Evaluation festgestellt wird, daß das Ziel so nicht errreicht werden kann. Da das Problem damit noch nicht gelöst ist, muß eine neue, alternative Policy auf den Plan treten, eventuell auch mehrere, die wiederum um den Zutritt zur politischen Agenda, Legitimation und Implementation streiten. Dabei kann es sich bei einer neuen Policy auch um eine korrigierte Version des alten Programms handeln. Windhoff-Héritier (1987, 107f.) zählt mehrere Bedingungen auf, unter welchen Umständen Policies terminiert und wie und von wem Bemühungen gegen die Beendigung unternommen werden.
1.4 Thesen
Diese Arbeit kann und will die Energie- und Klimaschutzpolitik der LHH nicht bewerten. Sie geht aber von verschiedenen Annahmen aus, die im Laufe der Untersuchung belegt werden sollen.
- Eine erfolgreiche Energie- und Klimapolitik ist auf kommunaler Ebene möglich und machbar.
- Die erfolgreiche Gestaltung einer Policy kann durch die kommunale Selbstverwaltung begünstigt werden.
- Die Konzepte von Umweltschutzgruppen, Betroffenen und der GABL sind diejenigen, die einen effektiven Umwelt- und Klimaschutz am weitesten realisieren.
- Das selbstverpflichtende Bekenntnis zu einer Nachhaltigen Entwicklung bedeutet eine radikale Umstrukturierung der Versorgung und Lebensweise.
- Der Rat der LHH hat sich mit seiner langfristigen Konzeption der Energieversorgung größtenteils gegen Widerstände der Verwaltung und weiterer Akteure durchgesetzt, indem Fürsprecher mit institutionalisierten Kompetenzen ausgestattet wurden.
2 Zukunft der Energieversorgung - Energieversorgung der Zukunft
2.1 Zwang zum Paradigmawechsel in der Energiewirtschaft
Spätestens seit Anfang der 70er Jahre gibt es eine steigende Sensibilisierung für die von der Menschheit verursachte Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und den grenzüberschreitenden Charakter von Umweltbelastungen, sowohl auf Regierungsebene wie auch - vor allem in den hochentwickelten Industrienationen - auf Seiten der Bevölkerung (xxx). Als deutlicher Markstein für den Beginn dieses Paradigmenwechsels gilt das Erscheinen des Berichts an den Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“ (Meadows et al., 1972), dessen unangenehme Szenarien von zur Neige gehenden natürlichen Ressourcen von der Ölpreiskrise 1973 quasi bestätigt wurden. Seitdem wird der überdimensionale Ressourcenverbrauch und die daraus resultierende, fortschreitende Umweltzerstörung durch verbesserte Meßmethoden genauer verfolgt, in der Öffentlichkeit bewußter wahrgenommen, problematisiert und kritisiert. In der Bundesrepublik ist seit Mitte der 70er Jahre ein deutlicher Anstieg vor allem ordnungsrechtlicher und institutioneller Maßnahmen (Verschärfung von Grenzwerten, bau- und planungsrechtliche Auflagen, Einrichtung des Umweltbundesamt 1974 und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 1986 etc.) und andererseits ein erhöhtes Engagement der Bürgerinnen und Bürger in ökologischen Bewegungen zu beobachten. Die negativen Folgen des gesamtgesellschaftlichen Handelns, des Wirtschaftens und Verbrauchens, werden heute bewußter wahrgenommen und problematisiert.
2.1.1 Treibhauseffekt durch fossile Energieträgernutzung
Als eines der dringendsten globalen Umweltprobleme gilt die Gefahr eines einschneidenden Klimawandels durch die verstärkte Emission der sogenannten klimarelevanten oder Treibhausgase (THG[11]) (vgl. Heins 1997, 59). Die stärksten Emissionsquellen für diese Stoffe sind der Bereich Energieerzeugung (insbesondere durch Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdöl, Kohle, Erdgas), die industrialisierte Landwirtschaft (Viehzucht, Reisplantagen), die Produktion von aufgeschäumten Kunststoffen und das globale Verkehrsaufkommen, insbesondere Flugverkehr und motorisierter Individualverkehr (MIV). Die Vernichtung von CO2-Senken, wie die Brandrodung der tropischen Regenwälder, ist ein verstärkendes Moment.
Die emittierten THG bewirken eine Erwärmung der Erdatmosphäre, indem sie sich in ihren oberen Schichten anreichern und verhindern, daß Wärme, die als Sonnenlicht auf die Erdoberfläche trifft, wieder in den Weltraum abgestrahlt werden kann. Die Erde erwärmt sich somit immer stärker. Dieser meteorologische Effekt wurde auch in Gewächs- oder Treibhäusern beobachtet und danach benannt.
Die Folgen sind ein schleichender Temperaturanstieg - in den letzten 100 Jahren bereits um 0,7°C (Rosenkranz 1995, 109) - , verstärktes Auftreten von extremen Wetterereignissen wie Wirbelstürmen und Trockenperioden, und Veränderungen zentraler klimatologischer Konstanten wie etwa des Nordatlantikstroms oder der Verdunstungsmenge der Weltmeere[12].
Der Anteil der Industriestaaten an den Emissionen und damit am globalen Treibhauseffekt betrug bis 1988 83,7%. Kohlendioxyd ist hierbei das häufigste Treibhausgas, es ist von allen THG zu rund 50% am Treibhauseffekt beteiligt[13] und wird als Hauptursache angesehen und bekämpft. Die höchsten Pro-Kopf-Emissionen von Kohlendioxyd verursachen die USA mit 20 t/a, gefolgt von Kanada, Rußland und der Tschechischen Republik; Deutschland liegt mit 12 t/a an sechster Stelle, der Weltdurchschnitt beträgt 4,09 t/a (1990) (Rosenkranz 1995, 88), Weizsäcker (1997, 246) gibt die deutsche Pro-Kopf-Emission mit 11,5t/a an.
Seit Beginn der Industriellen Revolution um 1860 stieg die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre von 288 ppm auf 357 ppm (1994) und steigt weiter (Rosenkranz 1995, 99). Gleichzeitig sinkt die Fähigkeit der Biosphäre, die anfallenden Mengen an THG, insbesondere CO2, in ausreichendem Maße zu absorbieren: Die durch die bisherige Erwärmung abschmelzenden Polkappen geben bisher gespeichertes CO2 frei, die Ozeane können mit steigender Wassertemperatur weniger CO2 binden, und die schrumpfenden Regenwälder fallen als CO2-Senken in zunehmendem Maße aus. Es handelt sich also um einen positiven Regelkreis, der sich immer weiter verschärft (vgl. Vester 1980, 60).
Erstaunlicherweise sind die ersten Vermutungen und Warnungen (Ott 1997, 202) über die klimaverändernde Wirkung von CO2 bereits 1896 vom skandinavischen Physiker und Chemiker Svante Arrhenius (Arrhenius 1896, 237; zitiert nach: Weizsäcker 1997, 249) angestellt worden. Die menschliche Ursache des Klimawandels war jedoch bis vor kurzem innerhalb der Wissenschaft noch stark umstritten und behinderte die Diskussion und wirksame internationale Beschlüsse. Diese Anthropogenität wurde bereits 1994 von der Enquete-Kommision „Schutz der Erdatmosphäre“ des Deutschen Bundestages angeführt (Krebs/ Reiche 1998, 39) und gegen Ende 1995 wissenschaftlich bestätigt durch den zweiten Sachstandsberichts des Internationalen Ausschusses für Klimawandel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Das IPCC ist mit 2000 Fachleuten, Klimatologen und Meteorologen besetzt und verfaßt Berichte an die Klimakonferenzen der UN, so erstmals zur 2. Weltklimakonferenz 1990 in Genf. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen Klimaforscher des Hamburger Max-Planck-Instituts für Meteorologie bereits Anfang 1995 (Rosenkranz 1995, 110).
Nach Prognosen des IPCC wird die durchschnittliche weltweite Temperaturerhöhung bei einem unveränderten Emissionsverhalten der Menschheit bis Ende des 21. Jahrhunderts bis zu 3,5°C betragen (Flavin/ Dunn 1998, 145). Um diese noch auf 1,5 °C zu dämpfen, müßten die weltweiten CO2-Emissionen von derzeit 20 Mrd. t/a auf 10 Mrd. t/a im Jahr 2050 reduziert werden. Das bedeutet anteilig für die BRD eine CO2-Reduktion pro Kopf von ca. 10 t/a auf 1 t/a (Kohler 1994, 148).
Den größten Anteil an den CO2-Emissionen hat in der Bundesrepublik die Energiebereitstellung und der Energiekonsum in Haushalten, Industrie und Verkehr.
„Vielfach wird die Auffassung vertreten[14], daß das Weltklima einen zentralen Bereich darstelle, bei dessen Nichtbewältigung sich der Versuch, weitere Umweltprobleme zu lösen, erübrige. Ausgehend von dieser These wird postuliert, daß die Frage des Ressourcen- und Energieverbrauchs der Industriestaaten in ein globales Modell eingebettet werden muß, wobei ein Umsteuerungsprozeß von der Kohle- und Kernkraftenergie auf ein möglichst breit angelegtes alternatives Energiewirtschaftskonzept anzustreben sei (...).“ (Heins 1997, 59)
2.1.2 Probleme der Atomenergienutzung
Die Atomenergie galt seit der Initiative „Atoms for Peace“ des US-amerikanischen Präsidenten Dwight D. Eisenhower als sicherer Weg zu einer unendlichen, sicheren und billigen Energiequelle (Rosenkranz 1995, 21f.), so daß eine Vielzahl von Staaten in Ost und West während der 60er und 70er Jahre eigene Atomkraftwerkskapazitäten errichteten. Mit der Ölpreiskrise 1973 verstärkten sich in Deutschland diese Anstrengungen.
Seit dem Super-GAU von Tschernobyl am 26.04.1986 sind die Risiken des Betriebs von AKW jedoch deutlich geworden. Mit den Folgen dieses Unfall wird die Bevölkerung der betroffenen Regionen noch mindestens mehrere Jahrzehnte zu kämpfen haben. „Die öffentliche Meinung veränderte sich im Zusammenhang mit der Katastrophe grundlegend zu Ungunsten der Kernenergieproduktion.“ (Prittwitz 1990, 22). Weiterhin ist bis heute die Frage der sicheren Endlagerung nicht gelöst, so daß die enorme Menge von hochgiftigen und radioaktiven Materialien, die beim Betrieb jedes Atomkraftwerkes anfallen, von der Biosphäre nicht abgetrennt werden können. Ein zusätzliches Problem ergibt sich aus der Möglichkeit der militärischen Nutzung entstehender Materialien, insbesondere Plutonium, für den Bau von Atomwaffen, was ein hochbrisantes sicherheitspolitisches Problem darstellt.
In der Stromerzeugung der Bundesrepublik bestehen große Überkapazitäten. Bei einem Wegfall der Atomenergie würde der höchste jemals abgerufene Bedarf (1994) nicht unterschritten werden (Bündnis90/DIE GRÜNEN 1997b). Allerdings müßten dabei derzeit nicht genutzte Kraftwerkskapazitäten wieder in Betrieb genommen werden. Dies würde eine deutliche Erhöhung der CO2-Emissionen nach sich ziehen, da es sich meist um ältere Anlagen handelt; die teilweise mit sehr CO2-intensiven Energieträgern wie Braunkohle oder Öl befeuert werden. Zur Zeit werden diese Kraftwerke nur zur Abdeckung von Engpässen und Spitzen des Strombedarfs genutzt.
Seit Bekanntwerden der Klimaproblematik fossiler Energieträger ungefähr Mitte der 80er Jahre wird die Atomenergie von ihren Betreibern auch als klimaneutral oder zumindest klimaschonend propagiert. Nach Ansicht der Gegner wird aber auch beim Bau eines Atomkraftwerkes, seinem Betrieb, beim Abbau des Brennstoffs Uran, der Anreicherung der Brennelemente und der Endlagerung der Abfallstoffe ständig eine solche Menge CO2 emittiert, daß nicht von einer vollständig emissionsfreien oder auch nur klimaneutralen Energieproduktion gesprochen werden könne[15]. Quelle!
Aus diesen und weiteren Gründen, die allerdings politisch stark umstritten sind[16], schränkt sich die Möglichkeit der Nutzung von Atomenergie als klimaneutrale Energiequelle stark ein.
Um dem Klimawandel mit seinen verheerenden Folgen vorzubeugen und dennoch dem wachsenden Energiebedarf der Menschheit zu entsprechen, müssen also einschneidende Veränderungen in Energiebereitstellung und -verbrauch vorgenommen werden. Hier eröffnet sich als Lösungsweg die nachhaltige Entwicklung, die im folgenden beschrieben und untersucht wird.
2.2 Nachhaltigkeit
Seit Ende der 80er Jahre wird der eigentlich ökonomische Begriff „Nachhaltigkeit" auch in der weltweiten Debatte um die zukünftige Gestaltung von Umwelt- und Sozialpolitik angewandt. Er postuliert, auf wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere den Umgang mit Vermögenswerten bezogen, daß die Zugänge an Vermögensgütern den Abgängen entsprechen sollen, so daß der Vermögensstand gewahrt bleibt. Dieser Begriff wird auch seit dem 19. Jahrhundert in der Forstwirtschaft benutzt. Er besagt im dortigen Zusammenhang, daß nicht mehr Holz gefällt werden dürfe als nachwachsen kann. In der Umweltökonomie bedeutet Nachhaltigkeit die allgemeine Anwendung dieses Prinzips auf die freien Güter der Biosphäre, sowohl bei regenerierbaren wie nicht-regenerierbaren Ressourcen, um ihre Verfügbarkeit für zukünftige Generationen nicht zu gefährden (vgl. Olsson/ Piepenbrock 1996, 241: "Nachhaltigkeit").
Dieses Prinzip wird oft mit der Handlungsmaxime „Global denken - Lokal handeln“ ausgedrückt und gleichgesetzt, nicht zuletzt, um es in der Öffentlichkeit griffig darstellen und besser vermitteln zu können. So schreiben E. Jochem und Lisa Höflich-Haeberlein im Vorwort der „CO2-Minderungsstrategie Großraum Hannover“, die im Auftrag des KGH erstellt wurde:
„Der Gedanke „global denken und lokal handeln“ signalisiert letztlich jeder Gemeinde, jedem Betrieb, jedem Autofahrer und privaten Haushalt eine Verantwortung gegenüber der heutigen und insbesondere der zukünftigen Generationen. Die Auftraggeber dieser Studie greifen diese Verantwortung auf und fragen nach den geeigneten technischen sowie energie-, umwelt- und verkehrspolitischen Maßnahmen - lokal für den Großraum Hannover.“ (KGH 1992a, Vorwort)
Die Hinwendung zu Überlegungen einer nachhaltigen Wirtschaftsweise Mitte der 80er Jahre kennzeichnet den Beginn einer neuen, dritten Phase von bundesdeutscher Umweltpolitik. In einer ersten Phase (1968 - 1972) ist der Umweltschutz hierzulande als eigenes Politikfeld etabliert worden. In einer zweiten Phase (1972 - 1984) hatte sich die öffentliche Umweltpolitik hauptsächlich mit ordnungsrechtlichen Instrumenten und nachgeschalteten Reinigungskonzepten zunächst auf die Beseitigung und Reduktion von einzelnen Schadstoffen in einzelnen Umweltmedien wie zum Beispiel Luft und Wasser konzentriert. Es zeichnete sich jedoch ab, daß einige Umweltprobleme wie Flächenverbrauch, wachsende Abfallberge, Artensterben, Ozonschichtabbau nicht mit (auch national) isolierten Maßnahmen gelöst werden konnten. Diese Erkenntnis verlagerte den Schwerpunkt von Umweltpolitik von nachsorgenden, „end-of-pipe“-Lösungen auf integrierte Planung, flexible wirtschaftliche Instrumente und verstärkte internationale Zusammenarbeit (Heins 1996, 34). Die umweltpolitische Diskussion dreht sich mittlerweile um eine tiefgreifende ökologische Umstrukturierung der Wirtschaftsweise. Das bedeutet vor allem die Integration ökologischer Prinzipien (wie sie im Leitbild der Nachhaltigkeit angedeutet werden) in das alltägliche Wirtschaften und Leben.
Das Konzept Nachhaltigkeit kann als zugrunde liegendes Prinzip von vielen einzelnen Instrumenten moderner Umweltpolitik angesehen werden. Es ist keineswegs - wie etwa das Propagieren isolierter Maßnahmen und Instrumente (wie Emissionslizenzen) - als „Instrumentalismus“ anzusehen (vgl. Mez/ Weidner 1997, 17, die auf Jänickes Warnungen vor solchem Instrumentalismus hinweisen[17]), wenn sich Umweltpolitiker und -wissenschaftler in vielerlei Zusammenhängen darauf berufen. Vielmehr soll das Leitbild Nachhaltigkeit einen Maßstab und kategorischen Imperativ für die „ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft“ leisten, die ihrerseit auf diverse Instrumente zurückgreifen kann und sollte.
Bereits 1909 sprach der Chemiker und Philosoph Wilhelm Ostwald in seiner Schrift Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft von einer „dauerhaften Wirtschaft“, die „ausschließlich auf die regelmäßige Benutzung der jährlichen Sonneneinstrahlung gerichtet werden“ müsse (zit. nach: Rosenkranz 1995, 13). Im Zusammenhang mit Umweltaspekten tauchte der Begriff "Nachhaltigkeit", bzw. sein englisches Original „Sustainable Development“ erstmals in der Weltnaturschutzstrategie 1980 der International Union for the Conservation of Nature und des World Wildlife Found auf (Heins 1996, 37. Ebenso UBA 1997, 4).
1983 setzte die Vollversammlung der Vereinten Nationen (VN) die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (United Nations (oder World) Commission on Environment and Development) aus Vertretern von 13 Entwicklungsländern und 9 Industrienationen unter Vorsitz der norwegischen Vorsitzenden Gro Harlem Brundtland ein. 1987 legte diese Kommission den sogenannten Brundtland-Bericht "Our Common Future" der UNO-Vollversammlung vor, der das Prinzip der „ökologisch tragfähigen", „zukunftsfähigen" oder auch „nachhaltigen" Entwicklung folgendermaßen formulierte (Hauff 1987, 46):
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
Eine andere Definition des allgemeinen Begriffes der Nachhaltigkeit, die seine Anwendung in der politischen Steuerung erleichtern soll, ist diejenige des Sachverständigenrates der Bundesregierung für Umweltfragen (SRU), die in ihrem 1994er Bericht folgendermaßen aufgeführt wird (SRU 1994):
1. Die Verbrauchsrate regenerierbarer Ressourcen muß gleich ihrer Regenerationsrate sein,
2. Die Verbrauchsrate nicht regenerierbarer Ressourcen muß gleich der Spar- bzw. Substitutionsrate sein,
3. Der Reststoffausstoß muß gleich der Assimilationsrate [der Umweltmedien] sein,
4. Erhalt aller Umweltfunktionen,
5. Erhalt der menschlichen Gesundheit.
Es ist leicht zu erkennen, daß die Definition des SRU über diejenige der Brundtland-Kommission hinausgeht: Die Begriffe Risiko und Bedürfnis sind schwieriger einzugrenzen als die an naturwissenschaftlichen Konstanten (ökologisch, biologisch, chemisch und physikalisch) orientierten Begriffe Assimilationsrate, Substitutionsrate und Regenerationsrate.
Der Rat der Stadt Hannover definiert den Begriff Nachhaltigkeit folgendermaßen[18]:
- daß es ein gleiches Nutzungsrecht aller Menschen an den weltweit zur Verfügung stehenden Ressourcen gibt,
- daß die Nutzungsrate nicht erneuerbarer Ressourcen nicht größer sein darf als die Rate ihres Ersatzes durch erneuerbare Stoffe,
- daß die heutige Menschheit die Umweltmedien (Wasser, Boden, Luft) nicht zu Lasten künftiger Generationen belasten darf.
In einer Broschüre der hannoverschen Umweltverwaltung, Arbeitsgruppe Weltausstellung (LHH 1993/5), kommen weitere Facetten des Begriffs zum Ausdruck: Hier schreiben die Autoren, das Nachhaltigkeits-Konzept sei eingeführt worden,
„(...) um die Besorgnis über den Zustand der Erde mit kontinuierlichem Wachstum und fortschreitender menschlicher Entwicklung zu vereinbaren.“
Demzufolge wäre das Problem nicht so sehr die tatsächliche Zerstörung der Lebensgrundlagen als vielmehr eine diffuse „Besorgnis“ darüber. Hier kommt der Verdacht auf, das Nachhaltigkeits-Konzept soll zur Umetikettierung von bestehenden Policies benutzt werden, um in der Bevölkerung einen Beruhigungseffekt zu erreichen. Über eine Veränderung des derzeitigen Wirtschaftens wird nichts ausgesagt. Möglicherweise handelt es sich aber einfach um eine ungenaue Formulierung, denn im folgenden schließen sich die Autoren der Definition der Brundtland-Kommission an und erweitern die ursprünglich ausschließlich menschliche Perspektive um die Dimension einer integrierten Natur, der in ihrer ökologischen Gesamtheit die Sicherung der jeweiligen Lebensgrundlagen ermöglicht werden muß. Offenbar werden hier gängige Definitionen übernommen, aber durchaus verschieden interpretiert und benutzt[19]. Während der Rat der LHH sich größtenteils der genaueren und weitgehenderen Definition des SRU anschließt und den Aspekt der Verantwortung über den Zeithorizont der eigenen Generation hinaus ebenfalls erwähnt, übernahm die Verwaltung der LHH die diffusere Definition der Weltkommission.
Der Begriff Nachhaltigkeit hat mittlerweile in der öffentlichen Diskussion einiges an Schubkraft verloren. Zum einen tauchten bald nach der Rio-Konferenz diplomatische Schwierigkeiten auf, die den hoffnungsbeladenen Rio-Prozeß stocken und sogar zurückschreiten ließen. Auf der Rio-Folgekonferenz 1995 in Berlin konnten sich die Regierungschefs der Vertragsstaaten nicht einmal mehr auf die Bestätigung der Ergebnisse von Rio einigen. Zum anderen traten die - oben angedeuteten - Unschärfen des Begriffs immer deutlicher zutage[20], da dieser auch als Etikett für Dinge benutzt werden kann und benutzt wird, die mit dem ursprünglichen Konzept eines „sanften“, ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Wirtschaftens wenig zu tun haben. Obwohl nach Ansicht von Kritikern Quelle etwa die Nutzung der Biotechnologie - insbesondere Genveränderung - dem Nachhaltigkeits-Prinzip, die natürlichen Abläufe in der Biosphäre möglichst nicht durch menschliche Eingriffen zu stören, sondern „die Umweltfunktionen zu erhalten", wie es z.B. in der Definition des SRU[21] formuliert wird, entgegensteht, wird sie in Kapitel 16 des zentralen Dokuments der Nachhaltigkeits-Debatte - der Agenda 21 - als mögliche Option gegen die weltweiten Probleme der Ernährung erwähnt (BMUa, 129). Da der Begriff Nachhaltigkeit im allgemeinen mit „Umweltschutz“ und alternativen Konzepten gleichgesetzt wird, ist er auch als Werbeargument geeignet, ohne daß das beworbene Produkt tatsächlich den Prinzipien entsprechen muß. Man muß gucken wie der Begriff ausgefüllt wird XXX
2.3 Der Rio-Prozess
2.3.1 Das internationale Umweltregime der Vereinten Nationen
Seit den 70er Jahren wurden mehrere internationale Institutionen gegründet und im Rahmen dieser neuen politischen Handlungsräume („internationale Umweltregime“) über 100 multilaterale Abkommen zu allen möglichen Aspekten der menschlichen Umwelt geschlossen. Eine Reihe von internationalen Konferenzen begann bereits gut zwanzig Jahre vor der sogenannten Rio-Konferenz UNCED (s.u.). Auf dem ersten weltweiten Umweltgipfel von 1972 in Stockholm (der ebenfalls als UNCED bezeichnet wird) wurde von 70 Staaten das Stockholmer Aktionsprogramm für die menschliche Umwelt beschlossen und als United Nations Environment Program (UNEP) institutionalisiert. 1984 wurde der Strategiebericht zur Erhaltung der Welt (World Conservations Strategy) vorgestellt.
Der vorläufige Höhepunkt dieser Umweltdiplomatie war die Konferenz der VN für Umwelt und Entwicklung (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED) im Juni 1992 in Rio de Janeiro, auch Rio-Konferenz oder Erdgipfel genannt. Auf der Rio-Konferenz wurden u.a. die Klimarahmenkonvention und die Agenda 21 verabschiedet.
2.3.2 Klimarahmenkonvention
Das Rahmenabkommen über Klimaveränderungen (Climate Change Convention) oder Klimarahmenkonvention (KRK) vom 9. Mai 1992 wurde seit Anfang 1991 in einem zwischenstaatlichen Vermittlungsausschuß (INC = International Negotiation Council) erarbeitet, ist völkerrechtlich bindend und soll die Emission von klimawirksamen oder Treibhausgasen, deren Emission nicht im Montrealer Protokoll (der Konferenz von 1987) geregelt wird, auf einem verträglichen Niveau stabilisieren. In allen Mitgliedsstaaten sollen Maßnahmen zur Senkung der Emissionen von Treibhausgasen und zum Schutz von Treibhausgasspeichern (z.B. Wald) erarbeitet und ausgebaut werden. Zusätzlich sind die Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die mittel- und osteuropäischen Länder als größte Emittenten aufgefordert, weitere Netto-Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren - auch die Aufforstung ist somit eine mögliche Maßnahme. Die OECD-Staaten sollen den Entwicklungsländern bei der entstehenden finanziellen Belastung helfen durch Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln und Förderung des Technologietransfers. Jährliche Konferenzen sollen den Prozeß kontrollieren, konkretisieren und beschleunigen - so in Berlin 1995 und Kyoto im Dezember 1997. Die Konvention trat am 21. März 1994 in Kraft, neunzig Tage nach der fünfzigsten Ratifizierung (Fischer 1995, 184). Ihr Fortschreiten wird von der VN-Unterorganisation UNFCCC (United Nations Federation on Climate Change Convention) in Bonn überwacht.
Die Klimakonvention bildet den Kern des relativ jungen, internationalen Klimaregimes, in dessen Folge weitere Konferenzen, Verhandlungen und Normen entstanden, die hoffen lassen, daß effektive Maßnahmen gegen die anthropogene Erwärmung der Erde ergriffen werden. Allerdings ist dieses Regime noch im Anfangsstadium begriffen, so daß noch kaum greifbare Erfolge aufzuweisen sind. Die Tatsache, daß die Anthropogenität des Klimawandels erst Anfang 1995 wissenschaftlich bestätigt wurde, knapp drei Jahre nach der UNCED, hatte für die dortigen Verhandlungen zur Folge, daß zwar das Phänomen der Erwärmung anerkannt war, nicht aber die Anthropogenität. Somit war den Bremsern ein Argument zur Hand, um die Dringlichkeit massiver Reduktionen anzuzweifeln. Die Bundesregierung unter Helmut Kohl hatte sich in Rio zur freiwilligen CO2-Reduktion von 25% bis 2005 international bindend verpflichtet. Es ist diese Verpflichtung, auf das letztlich auch das CO2-Reduktionsziel der Landeshauptstadt Hannover zurückzuführen ist.
Vorgeschichte und Verhandlungsverlauf
1979 thematisierten das UNEP und die World Meteorological Organization (WMO) wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedeutung von CO2 für Temperatur und Klima der Erde auf der ersten Weltklimakonferenz in Genf. Es dauerte weitere neun Jahre, bis das Thema auf intergouvernementaler Ebene verhandelt wurde durch die Konferenz über Klimaänderungen und globale Sicherheit in Toronto 1988, die von der kanadischen Regierung organisiert wurde. Die teilnehmenden Wissenschaftler, Politiker und Vertreter unabhängiger Umwelt-NROs verabschiedeten das „Toronto-Ziel“ der Reduktion des CO2-Ausstoßes um 20% (auf der Basis 1988) bis 2005. Da dieses noch nicht völkerrechtliche Bedeutung erlangte, empfahl man zudem den Abschluß einer Klimarahmenkonvention zur Regelung von Einzelaspekten. Ebenfalls 1988 gründeten UNEP und WMO das International Panel on Climate Change (IPCC), das erstmals zur (nach Toronto) zweiten Weltklimakonferenz 1990 wissenschaftliche Berichte an eine Klimakonferenzen der UN verfaßte. Aus dieser zweiten Klimakonferenz ging eine weitere Institution hervor, der INC, der bis zur UNCED - der dritten Klimakonferenz - eine unterschriftsreife Konvention erarbeiten sollte (Gehring/ Oberthür 1997).
ÜBERSICHT DER INTERNATIONALEN KLIMAKONFERENZEN [22]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Gehring/Oberthür 1997, Rosenkranz 1995, aktuelle Tagespresse
Je nach Themengebiet versuchten verschiedene Interessengruppen wie Lobby-Organisationen der betroffenen Industriezweige, nationale Regierungen, internationale Umweltschutzverbände und andere Nicht-Regierungsorganisationen (NROs), ihre Vorstellungen in dieses Abschlußdokument der Rio-Konferenz einzubringen (Gehring/ Oberthür 1997).
Diese Einflußnahme vollzog sich bereits in den fünf Vorverhandlungsrunden des INC zur KRK. Die Verhandlungspositionen lassen sich entlang ihrer Verfechter in drei Gruppen aufteilen - Progressive, Unentschlossene und Bremser. Zu den Ersten gehörten die Länder der EG (besonders die Niederlande, Dänemark und die Bundesrepublik) und die 36 kleinen Inselstaaten, die in der AOSIS (Alliance of Small Island States) organisiert sind und über keinerlei Industrie verfügen, so z.B. die Malediven. Die Entwicklungsländer mit China (G77+1) waren nach den negativen Erfahrungen aus der internationalen Ozonregelung zwar mißtrauisch und eher ablehnend gegenüber konkreten, international verbindlichen CO2 - Reduktionszielen, können in ihrer Gesamtheit aufgrund der großen Bandbreite von Positionen aber als Unentschiedene gelten. Als Bremser galten die USA, die UdSSR und ihre Nachfolgestaaten sowie die nahöstlichen Länder der OPEC (u.a. Saudi-Arabien, Kuwait) (ebd.).
Die EU hatte sich auf Initiative von Deutschland, den Niederlanden und Dänemark bereits dazu verpflichtet, ihre CO2-Emission bis 2000 auf den Wert von 1990 zurückzufahren (Fischer 1995, 186). Die progressive Position der EG-Staaten erklärt sich durch die Tatsache, daß alle Mitgliedsländer außer Großbritannien Netto-Energieimporteure sind. Eine Rückführung des hohen Energieverbrauches, der bei einer Verpflichtung zu CO2-Reduktionen vorgenommen werden müßte, würde sich also hier positiv auf die Handelsbilanz auswirken. Hinzu kommt die hierzulande bereits vor einiger Zeit begonnene Modernisierung und Effizienzsteigerung der Energiewirtschaft. So führte z.B. Dänemark 1973 als Reaktion auf die Ölpreiskrise eine dynamische Besteuerung von Energie ein. Die Bundesrepublik ist aufgrund ihres relativ strengen Ordnungsrechtes in Bezug auf Emissionen führend in der Herstellung von nachsorgenden, sogen. „End-of-Pipe“ - Technologien quelle!. Ein Fortsetzen dieser Bemühungen wurde von den Regierungen als relativ kostengünstig eingeschätzt im Vergleich beispielsweise zur Situation in Kanada, wo noch kaum energieeffiziente Technologien genutzt und viel Geld in eine „Grundsanierung“ investiert werden müßten. Die EG-Staaten plädierten für weitgehende Prävention und dafür, die Industriestaaten auf die Stabilisierung der Emissionen ab dem Jahr 2000 auf dem Niveau von 1990 zu verpflichten. Da sich die EG-Staaten jedoch nicht einmal untereinander auf eine Harmonisierung der eigenen, nationalstaatlichen Energiebesteuerung einigen konnten, erschien ihre anspruchsvolle Position unglaubwürdig. Sie konnten die politischen Verhandlungen mit den restlichen Akteuren nicht zu weitergehenden Reduktionszielen bringen (Gehring/ Oberthür 1997).
Die Forderungen der AOSIS-Staaten waren zwar konkreter und weitgehender, hatten aber keine Aussicht auf politischen Erfolg und statt dessen eher den Charakter von moralischen Aufforderungen zur internationalen Solidarität, da die meisten Inselstaaten ohne massive Gegenmaßnahmen mit Wirbelstürmen und Flutkatastrophen zu rechnen haben, die ihre Existenz und ihr Vorhandensein bedrohen (ebd.).
Die unentschlossenen Entwicklungsländer der G77 standen dieser wie anderen anspruchsvollen Forderungen skeptisch gegenüber: Sie befürchteten, in ihrer für dringend notwendig erachteten wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung von denjenigen behindert zu werden, die sie zuvor als Kolonial- und Handelsmächte in diesen drastischen Rückstand gebracht hatten und derzeit noch die Weltmarktpreise für Rohstoffe aus Entwicklungsländern maßgeblich beeinflussen. Durch die Einbeziehung der Entwicklungsländer in die ersten Verhandlungen entstand frühzeitiger als in anderen internationalen Regimen ein starker Nord-Süd-Konflikt, in dessen Rahmen über Unterentwicklung, ihre Ursachen und die bestgeeigneten Gegenmaßnahmen diskutiert wurde. Die Entwicklungsländer forderten von den Industriestaaten, ihre historische Verantwortung wahrzunehmen für das derzeitige Klimaproblem mit verbindlichen Schritten zur CO2-Reduktion (Fischer 1995, 186) wie auch für die Unterentwicklungsproblematik der Dritten Welt durch die Förderung von Technologietransfers und eine angemessene Entwicklungshilfe[23] (ebd.).
Japan nahm eine zögerliche Haltung ein, da aufgrund der strukturellen Energieknappheit des Landes bereits viel in eine energieeffiziente Wirtschaft investiert wurde (umfangreiche Solarenergieprogramme, hoher Energiepreis[24]), weitere Maßnahmen wären besonders kostenintensiv (ebd.).
Die UdSSR, die mit schweren politischen und wirtschaftlichen Umbrüchen zu kämpfen hatte, konnte die Forderung durchsetzen, eine eigene Kategorie für Staaten im wirtschaftlichen Übergang einzuführen. Nicht nur wegen der zu erwartenden Investitionslast für Energiesparmaßnahmen zählen sie zu der Gruppe der „Bremser“, sondern auch, da sie sich von klimatischen Änderungen agrarwirtschaftliche Vorteile versprachen. Hier wird besonders deutlich, in welchem Maße sehr spezifische, nationale Interessen die Verhandlungen beeinflußten (ebd.).
Die USA als weltgrößter Produzent fossiler Primärenergie (Kohle, Öl, Erdgas) waren der Hauptgegenspieler der weitgehenden Forderungen der EG nach konkreten Reduktionszielen. Obwohl die USA bereits besonders von extremen Wetterphänomenen betroffen waren, setzten sie auf freiwillige Maßnahmen und die Kräfte des Marktes (ebd.).
In der Tat beeinflußten die energieproduzierenden Industrien bereits die Verhandlungen, indem Lobby-Organisationen wie The Climate Council und die Global Climate Coalition mit juristischer Schützenhilfe die Bemühungen der OPEC-Staaten gegen konkrete internationale Reduktionsverpflichtungen unterstützten (ebd.).
Auf der letzten Sitzung des INC, die erst im Mai 1992 stattfand, also sehr kurzfristig vor der eigentlichen Konferenz, konnten die weit divergierenden Forderungen durch einen Kompromiß rechtzeitig als ein Dokument formuliert werden, das auf der Rio-Konferenz vorgelegt und von über 150 Staaten unterzeichnet wurde (ebd.).
Die KRK ist als ausfüllungsbedürftige Rahmenkonvention konzipiert, allerdings mit einigen materiellen Regelungen. Hauptsächlich wurden Ziele und Prinzipien festgelegt: Das vordergründige, „letztendliche Ziel“ („ultimative objective“) ist es, „die Stabilisierung der THG-Konzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu erreichen, auf dem eine gefährliche menschliche Störung des Klimasystems ausgeschlossen werden kann“. Unter den fünf Prinzipien, die in Artikel 3 formuliert werden, sind die wichtigsten das Vorsorge- (Art. 3.3) und das Verursacherprinzip (Art.3.1), das die Verantwortung der Industrieländer feststellt (BMUc, 9f.).
Die Bundesregierung Kohl hatte bereits am 07.November 1990 sich das CO2-Reduktionsziel „25% auf der Basis von 1988“ als Kabinettsbeschluß zu eigen gemacht. Anläßlich der Klimakonferenz von Berlin 1995 verschärfte Bundeskanzler Helmut Kohl die einseitige Verpflichtung der Bundesrepublik, indem das Basisjahr jetzt 1990 - mit entsprechend höheren Werten - sein sollte (BMU b, Vorwort). Diese Verpflichtung wurde ebenfalls vom Kabinett verabschiedet und ist ein Maßstab auch für die kommunale Energie- und Klimapolitik.
2.3.3 Das Mandat des Artikel 28 der Agenda 21
Ein weiteres Ergebnis der Rio-Konferenz ist die Agenda 21, die aber keinen Vertragscharakter besitzt und damit nicht völkerrechtlich verbindlich ist. In diesem Dokument werden Richtlinien für die Politik der Unterzeichner in Richtung Nachhaltigkeit in sozialer, ökonomischer und ökologischer Hinsicht formuliert. In Deutschland wird der Schwerpunkt zumeist auf den Klimaschutz und Nord-Süd-Zusammenarbeit (BMU c, 58) gelegt. Art. 28 der Agenda 21 besagt, daß außerhalb der Konferenzen der VN ein vielfältiger Prozeß der politischen Gestaltung in den Kommunen und sonstigen lokalen Körperschaften der Unterzeichnerstaaten initiiert werden soll. Dies ist in vielen Städten weltweit erfolgt - so auch in Hannover mit dem Ratsbeschluß vom 08.06. 1995 (quelle drs nr). Der Begriff Rio-Prozeß bezeichnet seitdem in der öffentlichen Diskussion nicht mehr allein die Tätigkeit der VN und ihrer verschiedenen Organe, die sich mit dem Konzept der Nachhaltigkeit befassen. Er bezieht sich auch auf den dezentralisierten Diskussions- und Handlungsverlauf im lokalen Rahmen, der die nötigen Schritte zum Klimaschutz vor Ort in die Praxis umsetzen und einen unumkehrbaren Wandel und weiterführende Überlegungen nach sich ziehen soll .
Dieses Mandat transferiert einen Teil der politischen Gestaltungsmacht auf eine Ebene weit unterhalb der traditionellen staatlichen und zwischenstaatlichen Ebene. Mit der expliziten Vorgabe, die Betroffenen selbst zu Entscheidern werden zu lassen durch breit angelegte Partizipation an Entscheidungsprozessen, ist ein Prozeß der politischen Selbstorganisation in Gang gesetzt worden. Aufgabe der nationalstaatlichen Politik ist nurmehr die Moderation dieses Selbstorganisationsprozesses, also Rahmenbedingungen zum Beispiel für die Einrichtung von Agenda-Büros auf kommunaler Ebene zu schaffen.
2.3.4 Internationale Kooperation auf kommunaler Ebene
Nicht nur die KRK und die Agenda 21 haben Bedeutung für Hannover. Mehrere interlokale Gremien, die sich auf den Rio-Prozeß beziehen, beschäftigen sich mit nachhaltiger Entwicklung, Klimaschutz und Entwicklungszusammenarbeit. Hannover ist einigen dieser Gremien beigetreten, so daß hier weitere, zum Teil parallele Selbstverpflichtungen entstanden sind.
1990 gründeten Städte und Gemeinden aus aller Welt den Internationalen Rat für Kommunale Umweltinitiativen (ICLEI = International Council for Local Environmental Initiatives), ein umweltpolitisches Netzwerk von Mitgliedsstädten mit Sitz in Toronto und nationalen Büros in verschiedenen Städten, darunter Freiburg. Der ICLEI wurde vom UNCED-Sekretariat aufgefordert, einen Beitrag für die Agenda 21 zu entwerfen, in dem die Rolle von lokalen Körperschaften beschrieben werden sollte. Aus diesem Beitrag entstand der Artikel 28 der Agenda 21. Hannover kooperiert mit dem ICLEI aufgrund eines Antrages der Umweltverwaltung vom 08.04.1991. Bundesweit haben sich etwa ein Drittel der Städte und Gemeinden bereit erklärt, einen Lokale-Agenda-21-Prozeß in Gang zu setzen quelle .
Im selben Jahr entstand das „Klima-Bündnis europäischer Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder zum Erhalt der Erdatmosphäre“, das fünf Jahre später, im Jahr 1995, rund 400 europäische Städte mit der Dachorganisation der Indianervölker des Amazonasbeckens (Coordinadora de las Organizaciones de la Cuenca Amazónica - COICA) verband. Die Grundidee dieser Partnerschaft ist das gemeinsame Bemühen, den CO2-Gehalt der Atmosphäre zu verringern, jedoch ergibt sich hier eine unterschiedliche Aufgabenstellung: In Europa die Senkung der CO2-Emissionen, in Südamerika der möglichst weitgehende Schutz der Regenwälder, die als CO2-Senken ihren wichtigen Beitrag leisten. Die Europäer gehen mit diesem Bündnis die freiwillige Selbstverpflichtung ein, ihren CO2 - Ausstoß zunächst bis 2010 zu halbieren sowie auf die Verwendung von Tropenholz und FCKW zu verzichten. Der Rückgang der Emissionen soll durch sinkenden Energieverbrauch und Verringerung des motorisierten Verkehrs erreicht werden. Die Amazonier, die von den europäischen Städten unterstützt werden, bemühen sich ihrerseits um die Titulierung der indianischen Territorien, ihre nachhaltige Nutzung und Verteidigung. Als i.d.S. umweltschädlich werden außerdem die intensive Viehwirtschaft, Pestizideinsatz, überdimensionierte Wasserkraftwerke und der Abbau von Erdöl und Bodenschätzen genannt. Die Instrumente dieses Klimabündnisses sind Information, Erfahrungsaustausch und gemeinsame Projekte, beispielsweise über geeignete Energiesparmaßnahmen oder die Zusammenarbeit bei der Untersuchung, wo und wie Tropenholzverwendung vermieden werden kann. Die Prinzipien des Klimabündnisses sind diejenigen des Leitbildes der Nachhaltigkeit: Kleinräumigkeit, Dezentralität, das Handeln vor Ort und die Einbeziehung der Betroffenen (Klima-Bündnis 1998).
Im Mai 1994 tagte die „Europäische Konferenz der zukunftsbeständigen Städte und Gemeinden“ im dänischen Aalborg, die von der Stadt Aalborg und der Europäischen Kommission ausgerichtet und vom ICLEI inhaltlich ausgerichtet wurde. Hier verabschiedeten die teilnehmenden Städte und Gemeinden, Vertreter internationaler Organisationen, nationaler Regierungen und wissenschaftlicher Institute die „Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit“ (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability) oder kurz die Charta von Aalborg. Die Unterzeichner verpflichteten sich somit selbst, die Maßgaben des Artikels 28 der Agenda 21 zu erfüllen und somit die kommunale Politik nach umwelt- und sozialverträglichen Kriterien zu gestalten. So soll eine Zukunftsfähigkeit[25] oder Nachhaltigkeit erreicht werden. 1995 hatten sich insgesamt 200 Städte dieser Charta angeschlossen. Der Rat der Stadt Hannover schloß sich der Charta auf Antrag der SPD-Fraktion im November 1995 an (Drs. 1395/95).
Die Charta von Aalborg wurde formuliert vom ICLEI und dem nordrhein-westfälischen Landesministerium für Stadtentwicklung und Verkehr. Sie bezieht sich auf Grundsätze kommunalpolitischen Handelns, die zur Erreichung von Zukunftsbeständigkeit verändert werden müssen. Sie ist in drei Abschnitte unterteilt: I. eine „durch Konsens angenommene Erklärung“, II. die „Kampagne europäischer zukunftsbeständiger Städte und Gemeinden“ und III. die „kommunalen Handlungsprogramme für Zukunftsbeständigkeit“.
2.4 Handlungsaufträge für die LHH
Der Begriff Nachhaltigkeit soll, wie oben festgestellt, weltweit gelten und angewandt werden. Dafür muß seine Bedeutung für die einzelnen Ebenen des politischen Handelns definiert werden. Seine Definition muß an den spezifischen Bedingungen eines Staates oder einer Region konkretisiert werden, um ihnen gerecht zu werden (Heins 1997, 60). Daher muß zunächst festgestellt werden, welche Handlungsaufträge an die LHH sich aus der Definition von Nachhaltigkeit und den internationalen und nationalen Beschlüssen ergeben.
Aus der eigenen Definition von Nachhaltigkeit der Akteure des politisch-administrativen Systems in Hannover ergeben sich folgende Handlungsaufträge:
1. Massive Bemühungen zur Energieeinsparung
2. Reduktion der Nutzung fossiler Energieträger
3. Ausbau der Regenerativen Energiequellen (REQ)
4. Massive CO2-Reduktion
5. Ausstieg aus der Nutzung der Atomenergie
Aus den unscharf formulierten Angaben „Nutzungsrate nicht erneuerbarer Ressourcen“ u.ä. ergibt sich die Schwierigkeit, daß kein konkretes Ziel vorgegeben wird, an welchem der Erfolg der Politik gemessen werden kann. Innerhalb der internationalen Regime und Vereinbarungen wurden aber Zahlen zur CO2-Reduktion vereinbart, die als Maßstab dienen können.
Aus den aufgezählten internationalen und nationalen Beschlüssen ergeben sich für Hannover mehrere verschiedene und parallele Verpflichtungen und Vorgaben, die teilweise in Selbstverpflichtungen mündeten:
1. Der Kabinettsbeschluß der Bundesregierung vom 07. November 1990 gab das CO2-Reduktionsziel von 25% (auf der Basis von 1990) vor. Zwar liegt die völkerrechtliche Verantwortung für die Erfüllung dieses Ziels bei der Bundesregierung, sie kann es aber nur in Zusammenarbeit und durch die Aktivitäten auf regionaler und lokaler Ebene erreichen. Also kann man dieses Ziel theoretisch auch für die LHH als gültig ansehen. Der Rat hat diese Vorgabe angenommen; entsprechend ist das Reduktionsziel der LHH in den einschlägigen Ratsbeschlüssenanalog der Reduktionsziele der Bundesregierung. Diese Ratsbeschlüsse werden in weiteren Kapiteln noch eingehend behandelt werden.
2. Der Rat der Stadt Hannover schloß sich auf Antrag der SPD-Fraktion (Drs. 1393/95 vom 15.11.1995) der Charta von Aalborg an. Daraus erwächst eine (über Punkt 1 hinausgehende) Verpflichtung zur sozial- und umweltverträglichen Stadtentwicklung, Klimaschutz und Reduzierung des Energieverbrauches, Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes sowie zur Initiierung des Lokalen Agenda 21 Prozesses.
3. Mit dem Beitritt zum Klimabündnis europäischer Städte verschärft sich weiterhin die freiwillige Selbstverpflichtung der LHH dahingehend, ihren CO2 - Ausstoß nicht nur um 25% bis 2005 auf der Basis von 1990, sondern um 50% bis zum Jahr 2010 auf der Basis von 1987 zu reduzieren sowie im städtischen Beschaffungswesen auf die Verwendung von Tropenholz und FCKW zu verzichten. Als Lösungsvorschlag wurde gleich mitformuliert, daß der Rückgang der Emissionen durch sinkenden Energieverbrauch und Verringerung des motorisierten Verkehrs erreicht werden soll.
2.4.1 Kriterien für eine nachhaltige kommunale Klimaschutzpolitik
Wie muß eine kommunale Klimaschutzpolitik nun beschaffen sein, um effektiv und nachhaltig zu sein, also die oben dargestellten Ziele zu erreichen? Das Ziel ist die CO2-Reduktion um mindestens 25% in den Jahren bis 2005. In absoluten Zahlen bedeutet dies für Hannover eine Reduktion um mindestens 1,1 Mio t/a; das Kommunale Klimaschutzprogramm (KKP) der LHH (1996/8, 14ff.) gibt die vermeidbaren Mengen mit insgesamt 1,3843 Mio. t/a an, was einer CO2-Reduktion von mehr als 25% entspräche, wenn eine derzeitigen Emission von 5,3 Mio. t/a angenommen wird (ebd., 28; vgl. Kap. 4.4).
Gemäß dem Nachhaltigkeits-Prinzip, die Verbrauchsraten von Ressourcen an die Assimilationsrate der Umweltmedien anzupassen, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Menge an Schadstoffemissionen massiv zu senken. Ein radikaler Wandel in der Energieversorgung muß somit eingeleitet werden. Der Anteil an REQ müßte massiv erhöht, fossile Energieträger müßten ersetzt und Energieeinsparmaßnahmen gefördert werden. Diese Maßnahmen müßten dabei die wirtschaftliche und soziale Situation der Einwohner, Interessen der ansässigen Unternehmen und nicht zuletzt die sonstigen politischen Verpflichtungen, wirtschaftlichen Fähigkeiten und rechtlichen Spielräume der Kommune berücksichtigen.
Hier spielen Problembewältigung (Wirkungstiefe, Wirkungsgeschwindigkeit, Wirkungsbreite, Wirkungsschärfe), Umwelteffizienz (ökologische Kosten und Nutzen), ökonomische Effizienz (z.B. Kosten pro vermiedener CO2-Emission) und politisch-institutionelle Verträglichkeit (Bewahrung von demokratischen Grundsätzen, Kompatibilität mit bestehendem Recht) eine Rolle.
Der Begriff der Nachhaltigkeit impliziert weiterhin eine Verstetigung des Prozesses: Es ist mit Setzung und Erreichen eines einmaligen CO2-Reduktionsziels nicht getan, vielmehr ist angestrebt, die Lebens- und Wirtschaftsweise der Kommune dauerhaft zu verbessern. Dies beinhaltet einen dynamischen Begriff von Stadtentwicklung und die Möglichkeit von ständigen Zielkorrekturen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Beteiligung möglichst aller Akteure und Betroffenen (Industrie, Bevölkerung, Behörden) an der Programmformulierung wie auch an der Implementation. Dadurch müßte die Anwendung von starke steuernden Policy-Typen wie Gebot und Verbot - zumindest vom ideellen Politikverständnis her - eingeschränkt sein. Sie bleiben natürlich gleichwohl im Handlungsrepertoire der Kommune erhalten.
Da in Hannover gleichzeitig und zusätzlich zu den Zielen lokaler Klimaschutzpolitik der Ausstieg aus der Atomenergie geplant ist, sollte zudem eine Problemverschiebung vom Problemfeld Treibhauseffekt zum Problemfeld Risiken durch Atommüll u.a. vermieden werden.
Ich habe mich nach einigen methodischen Abwägungen dafür entschieden, die Analyse des Policy-Zyklus mit der Problemdefinition in Hannover zu beginnen, ohne das vorangegangene internationale Policy-Handeln direkt in den Zyklus einzubeziehen. In gewissem Maße wurden in Rio de Janeiro auf der oben dargestellten internationalen Ebene ebenfalls erste Phasen - Problemdefinition und Agenda-Gestaltung - eines Policy-Zyklus von Klimaschutz-Policy geleistet. Die Handlungsperspektive der Politikformulierung und -implementation, die in diesen Rahmen eröffnet wurde, bezieht sich jedoch auf die nationale und vor allem kommunale Entscheidungsebene und muß dort vorgenommen werden. Hier überschneiden sich die Zyklusbereiche von ähnlichen Policy-Zyklen, dem internationalen, nationalen und kommunalen. Die nationale Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und nationale Schaffung von juristischen Grundlagen für Lokale Agenda 21-Büros in den Unterzeichnerstaaten bedeutet für das internationale Klimaschutzregime bereits eine Implementierung ihrer Policy, die den weiteren Zyklus von Policy-Wirkungen, Policy-Reaktionen und Evaluation durchläuft.
Auf der lokalen Ebene der LHH kann jedoch wieder ein neuer, eigenständiger Zyklus mit Problemdefinition, Agenda-Gestaltung, Politikformulierung und Politikimplementation ausgemacht werden. Die Akteure wechseln, erkennen und definieren ihrerseits lokale Probleme, die sie auf die politische Tagesordnung bringen, formulieren spezifische Lösungsvorschläge, streben deren Implementation an und evaluieren die Ergebnisse der Policy. Es ist eine Besonderheit des Konzeptes von Nachhaltigkeit, daß ein einziges Leitbild mit denselben Prinzipien (Ressourcenschonung, soziale Verträglichkeit und Verantwortung für jetzige und zukünftige Generationen) für alle Staaten und Gemeinden der Erde Gültigkeit haben soll. Dazu muß die jeweilige Policy den Rahmenbedingungen vor Ort angemessen sein.
Im folgenden soll untersucht werden, welche Rahmenbedingungen der lokale hannoversche Policy-Zyklus hat, bevor in Kap. 5 die Klimaschutz-Policy der LHH untersucht werden kann.
3 EXKURS: Rahmenbedingungen von Kommunalpolitik
Der Hauptakteur des politischen Handelns, das in dieser Arbeit untersucht werden soll, ist die LHH, die durch ihre verschiedenen kommunalen Gremien und Behörden in Erscheinung tritt. Daher ist es zweckmäßig, in einem Exkurs die grundsätzlichen Rahmenbedingungen zu analysieren, die jedem kommunalpolitischen Entscheiden zugrunde liegen und es prägen, so etwa die Rechte und Pflichten einer Kommune, die Funktionen und Befugnisse der verschiedenen Gremien, den Einfluß weiterer Akteure und die Entscheidungsstrukturen.
Kommunale Klimaschutzpolitik ist ein Teil kommunalen Umwelthandelns, das seinerseits einen wichtigen Teil des allgemeinen kommunalen Handelns ausmacht. Deshalb wird ebenso auf die grundlegenden Rahmenbedingungen von Umwelt- und Klimapolitik eingegangen.
Die dargestellten Rahmenbedingungen müssen aufgrund der unterschiedlichen Landesverfassungen und darin enthaltenen Gemeindeordnungen nicht auf alle Bundesländer zutreffen. Soweit nicht mehr von einem bundesweiten „Normalfall“ gesprochen werden kann, da solche Unterschiede berücksichtigt werden müssen, beziehe ich mich hier auf Niedersachsen bzw. auf die Niedersächsische Gemiendeordnung (NGO).
3.1 Funktionen (Pflichten) der Kommune
Die Kommunen sind eine untere Ebene in der föderalistischen Struktur des Staates. Bund und Länder haben demgegenüber Staatsqualität und können damit Entscheidungen treffen, die nicht von einer höheren Ebene genehmigt werden müssen[26]. Sie verfügen über eigene Organe der Gewaltenteilung im Gegensatz zu den Gemeinden, die auch als eigene Ebene der Republik staatsrechtlich zu den Ländern gehören. Die Kommunen haben bei der Verabschiedung von Bundes- und Landesgesetzen, die für sie bindende Wirkung haben, kein Mitspracherecht (vgl. Wehling, 1994). Den Gemeinden ist jedoch das Recht zur Selbstverwaltung gegeben. GG Art. 28, 2 legt fest:
„Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Gemeindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. Die Gewährleistung der Selbstverwaltung umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Selbstverwaltung.“
Kreisfreie Städte (wie Hannover) sind zudem untere Landesbehörden. Ihre Aufsichtsbehörden sind die Landesmittelbehörden (Bezirksregierung oder Regierungspräsidium). Diese Kommunalaufsicht ist die Rechtsaufsicht über Satzungen, Haushalte, Verträge und ähnliches. Die Bezirksregierung Hannover kann also Rechtshandlungen der LHH unterbinden, wenn sie feststellt, daß diese nicht der NGO genügen.
Die Kommune ist also einerseits „rechtlich gegenüber dem Staat [eine] selbständige Ebene des Verwaltungsaufbaus“ (Schröder 1994, 28), muß jedoch Bundes- und Landesrecht vollziehen und akzeptieren, was evtl. gegen ihre eigenen Interessen als selbstverwaltete Gebietskörperschaft stehen kann[27]. Dadurch ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen Staatshoheit und kommunaler Selbstverwaltung.
Die Verwaltungstätigkeit der Gemeinde umfaßt die Selbstverwaltungsangelegenheiten (“eigener Wirkungskreis“) und die Auftragsangelegenheiten („übertragener Wirkungskreis“). Die Gemeinde hat bei der Aufgabenfindung des eigenen Wirkungskreises größtenteils freie Hand durch die Allzuständigkeit für alle Angelegenheiten, deren Regelung nicht bereits einem anderen Träger der Verwaltung gesetzlich übertragen ist.
„Zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten gehört grundsätzlich alles, was speziell und ausschließlich die örtliche Gemeinschaft und die einzelnen Gemeindemitglieder angeht, insbesondere die Versorgung der Gemeinde mit Wasser, Gas, Strom, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Gemeindeeinrichtungen, Verwaltung des Gemeindevermögens, örtliche Kultur-, Wohlfahrts- und Gesundheitspflege.“ (Schröder ebd., 29)
Die Selbstverwaltungsaufgaben unterteilen sich weiterhin in freiwillige Aufgaben, die theoretisch alles Mögliche umfassen können und sich nach Bedürfnissen und Möglichkeiten der Gemeinde richten (z.B. Bau und Unterhalt von Freizeiteinrichtungen), und pflichtige Aufgaben, die vom Gesetzgeber zur sozialstaatlichen Daseinsvorsorge und Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse auferlegt werden, bei deren Ausführung aber ein gewisser Spielraum besteht z.B. Schulbau, Bauleitplanung). Die Kommunen betreiben für die Erledigung der Daseinsvorsorge gewöhnlich eigene Versorgungsgesellschaften, die oft die Bezeichnung Stadtwerke tragen.
Die Auftragsangelegenheiten umfassen alle vom Staat den Gemeinden zur Erfüllung zugewiesenen Aufgaben, z.B. die Zahlung von Sozialhilfe oder Leistungen an Asylbewerber. Diese Erfüllung läßt die Kommune als untere Stufe der Staatsverwaltung auftreten, wobei die Zuweisung solcher Aufgaben unter Wahrung eines Kostenausgleichs und der kommunalen Organisationshoheit zu erfolgen hat. Die Landesverfassung (Niedersächsische Gemeinde-Ordnung (NGO)) konzipiert für die Aufgabenerledigung des übertragenen Wirkungskreises eine dualistische Organisation, so daß nicht die Vertretungskörperschaft (der Rat), sondern die Verwaltung zuständig ist, da es sich nicht um Entscheidungen mit Bezug auf die Gemeinde, sondern um bloße Ausführung handelt. Innerhalb der Verwaltung verteilt sich die Zuständigkeit auf die verschiedenen Fachämter und Dezernate.
Nicht zuletzt sind die Vertretungsgremien der Städte und Gemeinden demokratische Mandatsträger und Ansprechpartner der Bürger.
3.2 Möglichkeiten (Rechte) der Kommunalpolitik
Wie handelt eine Kommune, wie formuliert und implementiert sie ihre politischen Vorhaben? Welche juristischen, verwaltungstechnischen Möglichkeiten stehen ihr zur Verfügung?
Aus der Selbstverwaltungsgarantie des Art. 28,2 GG leiten sich eine Reihe von Hoheitsrechten ab, die die Gemeinde bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben innerhalb ihres Hoheitsgebietes ausüben kann. Dazu gehören a) Satzungshoheit (auch: Rechtsetzungshoheit), b) Planungshoheit, c) Finanzhoheit, d) Personalhoheit, e) Organisationshoheit und f) Steuerhoheit.
a) Die Satzungshoheit umfaßt die Befugnis zum Erlaß örtlichen Rechtes in Form von Satzungen, die in der juristischen Heirarchie unterhalb von Gesetzen und Rechtsverordnungen stehen. Satzungen sind keine juristischen Einzelfallentscheidungen, sondern verbindliche Rechtsvorschriften für das Gemeindegebiet und allgemeines Ortsrecht. Satzungen sind von der Kommunalaufsicht zu genehmigen, teilweise auch nur anzuzeigen. Die Gegenstände kommunaler Satzungen können sehr vielfältig sein, müssen aber eine Selbstverwaltungsaufgabe betreffen. Hierbei können Benutzungsregeln und -gebühren und ggf. Anschluß- und Benutzungszwänge auferlegt werden. Die wichtigsten satzungen sind die Hauptsatzung, die die Selbstorganisation der Gemeinde regelt, und die Haushaltssatzung, die die Verwendung der Gemeindemittel vorsieht. In der Haushaltssatzung, die von der Verwaltung als Haushaltsplan entworfen und vom Rat verabschiedet wird, werden die Verwaltungshaushalte der einzelnen Ämter und die Mittel für Planstellen in der Verwaltung festgelegt. Der Stellenwert oder die Priorität einer Policy läßt sich gut an den zur Verfügung stehenden bzw. zur Verfügung gestellten Mitteln erkennen. Die Satzungshoheit der LHH ist in §6 NGO festgelegt und wird vom Rat wahrgenommen.
b) Die Planungshoheit bezieht sich auf ein spezifisches Mittel der kommunalen Aufgabenerledigung im Rahmen der Stadtplanung: Den Erlaß, die Änderung und Aufhebung z.B. von Stellenplänen und Bauleitplänen, die auch als Satzung erlassen werden können. Die Bausatzung beeinflußt alle weiteren Flächennutzungs- und Baupläne. Die Planungshoheit wird von Verwaltung und Rat wahrgenommen, indem der Rat die Pläne der Verwaltung als Satzung beschließen kann.
c) Die Finanzhoheit besagt das Recht, den Haushalt in Form der Haushaltssatzung, die Festsetzung öffentlicher Aufgaben, die Errichtung oder Erweiterung von wirtschaftlichen Unternehmen, die Aufnahme von Krediten und die Übernahme von Bürgschaften festzulegen. Die Finanzhoheit besagt, daß die Gemeinde Abgaben (Gebühren, Verbrauch- und Aufwandssteuern) und Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festsetzen kann. Dieses Hoheitsrecht wird aber von der bundesdeutschen Steuerverteilung, dem Steuerrecht, und dem Gemeindehaushaltsrecht stark beschränkt.
Für die Finanzausstattung der Gemeinden sind gemäß der dualistischen föderalen Struktur der Bundesrepublik die Länder zuständig. Nach Art.106 Abs.5 GG erhalten die Gemeinden über die Länder einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer gemäß der Einkommensteuerleistung ihrer Einwohner. Ansonsten rekrutieren sich die Einnahmen der Gemeinden aus dem Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer; gemäß Art.106 GG) und den Gebühren und Beiträgen, die im Rahmen der Steuerhoheit erhoben wurden. Nach der jeweiligen Länderverfassung fließt den Gemeinden ein bestimmter Prozentsatz der Gemeinschaftssteuern zu.
Die Haushaltssituation der Kommunen hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verschärft. Die Finanzierungszuständigkeit von Aufgaben ist seit der Finanzreform von 1969 an die Verwaltungszuständigkeit gebunden. Da Bund und Länder immer mehr Aufgaben den Kommunen zugewiesen haben, müssen diese auch die Mittel zur Verfügung stellen, so beispielsweise bei der Sozialhilfe, deren Empfänger die Kassen immer stärker belasten[28]. Die Kommunen können somit nicht mehr selbständig den Umfang ihrer Aufgaben und damit auch ihrer Ausgaben bestimmen. Hier ergeben sich Probleme, da der finanzielle Spielraum für die freiwilligen Aufgaben nicht mehr von der Kommune, sondern von der Bundes- und Landesgesetzgebung abhängt. Die solchermaßen beschränkte Finanzhoheit erschwert die Selbstverwaltung der Kommune, innerhalb dieses Rahmens aber hat sie die Befugnis zur eigenverantwortlichen Einnahmen- und Ausgabenwirtschaft, d.h., sie kann eigenmächtig entscheiden, welche Aufgaben finanziert werden sollen (Larisch 1994, 83). Die Mittel, die einer Kommune zur freien Planung zur Verfügung stehen, machen ungefähr 3-5% ihres Haushaltes aus.
d) Die kommunale Personalhoheit räumt den Organen der Kommune das Recht ein, Personalbedarf zur Erledigung ihrer Aufgaben festzusetzen, eigenverantwortlich Personal einzustellen, zu befördern, zu versetzen und zu entlassen sowie das Beschäftigungsverhältnis zu bestimmen. Durch übergeordnete Normen (wie das Beamtenrecht oder Stellenobergrenzenverordnungen) sind hier allerdings enge Grenzen gesetzt. Die Funktion wird teilweise vom Rat und teilweise vom Verwaltungschef wahrgenommen.
e) Die Organisationshoheit ermöglicht es der Gemeinde, den Aufbau ihrer Verwaltung und die Organisation des Aufgabenvollzuges selbst zu bestimmen die Durchführung seiner Beschlüsse durch die einzelnen Ämter zu überwachen. Dies bezieht sich auf die Richtlinien der Verwaltungsführung, die die Gemeinde beschließen kann. Unterhalb der Ebene der Hauptverwaltungsbeamten (Dezernenten) hat die Vertretungskörperschaft aber keinen Einfluß auf die genaue Ausgestaltung, diese liegt im Ermessen des Verwaltungschefs. Diese Funktion wurde gemäß NGO bis zur Kommunalwahl 1996 vom Oberstadtdirektor und seitdem vom (sogenannten „eingleisigen“) Oberbürgermeister wahrgenommen.
Eine wichtige Möglichkeit der Kommune, im Rahmen der Organisationshoheit einem bestimmten Gegenstand (Issue) ihres politischen Handelns mehr Gewicht und Effizienz zu verleihen, ist die Institutionalisierung eines eigenständigen Dezernates, in dem die Zuständigkeiten für diesen Issue konzentriert werden. Das Berücksichtigen, Abwägen und Entscheiden an einer einzigen Stelle der Verwaltung vermeidet die Vernachlässigung gegenüber anderen Politikinhalten.
f) Die Steuerhoheit räumt den Gemeinden das Recht zur Erhebung von Steuern wie der Grundsteuer, der Gewerbesteuer (oder etwa auch einer Katzensteuer) ein (Steuerfindungsrecht), soweit dieses Recht nicht durch übergeordnete Gesetze zum Finanzausgleich wieder rückgängig gemacht wird.
Der Rat nimmt als zentrales politisches Organ die Hoheitsrechte in verschiedenen Formen wahr. Er kann Beschlußvorlagen und Anträge in Fachausschüssen beraten, Beschlüsse zu allen Angelegenheiten von Belang für die Kommune fassen, Dezernate schaffen (Planungshoheit) und Satzungen verabschieden (Satzungshoheit). Die Frage, ob es eine allein verantwortliche „Kommunalregierung“ analog zur Bundes- oder Landesregierung gäbe oder aber die Gesamtheit der Ratsmitglieder die Kommunalpolitik verantwortlich gestalten müsse, ist umstritten. In der Praxis werden die Entscheidungen von einer Ratsmehrheit getroffen, die sich je nach Zustimmung oder Ablehnung der Fraktionen individuell findet. Diese kann dauerhafte Koalition oder auch zeitweilige Abstimmungspartnerschaft zwischen mehreren Fraktionen sein[29]. Der Rat legt örtliche Steuern und Gebühren fest (Finanzhoheit, Steuerhoheit), schließt als Arbeitgeber und juristische Person Verträge mit Angestellten und Unternehmen (Personalhoheit), bestimmt den Aufbau und die Arbeitsweise der Verwaltung (Organisationshoheit).
Der Verwaltungsausschuß ist ein Organ mit eigenen Rechten gemäß der NGO. Er ist ein spezifisches Gremium der norddeutschen Ratsverfassung, dient der Entlastung des Rates und beschließt einen Großteil der Routineentscheidungen (90%[30]).
Die Verwaltung formuliert Satzungen, gibt Informationsdrucksachen zur Beratung des Rates heraus und bringt die „Verwaltungsmeinung“ in Beschlussdrucksachen in den Rat ein. Die Ämter entscheiden autonom über ihre personellen Bedürfnisse, soweit im Verwaltungshaushalt Mittel zur Verfügung stehen, sie sind hierbei auf die Entscheidung des Rates angewiesen.
Der Oberbürgermeister (kreisfreie Städte) oder Bürgermeister (Gemeinden) ist oberster höchster Repräsentant der Stadt. Er kann Sitzungen der Gremien einberufen, gehört dem Rat und dem Verwaltungsausschuß an. Seit 1996 ist er zusaätzlich Verwaltungschef (s.o.).
Der OStD oder Gemeindedirektor war (bis 1996) als Verwaltungschef für die Vorbereitung der Beschlüsse zuständig, die in den Fachverwaltungen formuliert werden, als Beschlußvorlagen in den Fachausschüssen des Rates und im Rat selber diskutiert und abgestimmt werden. Die Beschlüsse, die an die Fachämter der Verwaltung zurückgeleitet werden, werden von diesen ausgeführt, wobei die Verantwortlichkeit ebenfalls beim OStD oder Gemeindedirektor liegt, der ebenfalls die Organisationshoheit ausübt. Ebenso hat er die Personalhoheit inne.
Die LHH fungiert zusammengefaßt also als Exekutive von Bundesrecht und Landesrecht, als Landesbehörde, juristische Person (z.B. in Konzessionsverträgen und Grundstücksverträgen), Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, autonomes Selbstverwaltungsorgan mit einer Reihe von Hoheitsrechten und als demokratische Vertretung der Interessen ihrer Einwohner.
[...]
[1] 1986 war das Konzept der Nachhaltigkeit noch weitgehend unbekannt und bedeutungslos für kommunale Umwelt- und Energiepolitik. Allerdings haben bereits in diesem Jahr entscheidende Weichenstellungen stattgefunden, ohne die eine Hinwendung zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit im Energiesektor nicht möglich gewesen wäre. Vgl. Mez/ Weidner (1997, 15), die den Begriff der ökologischen Modernisierung und seine zugrundeliegenden Prinzipien als Vorläufer des sustainable development bezeichnen.
[2] Die Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Gesellschaft für Windenergie e.V. befindet sich beispielsweise in Hannover.
[3] Der sogen. Kleinverbrauch umfaßt neben den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit weniger als 20 Beschäftigten den gesamten Handel- und Dienstleistsungsbereich, das Baugewerbe sowie die öffentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen oder als Negativ-Definition: alle Verbraucherm, die nicht zur Industrie oder den privaten Haushalten gehören. GerTec/ Wuppertal 1999, 76.
[4] Weitere klimarelevante Bereiche sind Verkehr, Abfallwirtschaft sowie Landwirtschaft und Forsten; vgl. LHH 1996/8.
[5] Die wissenschaftlich-technisch korrekte Bezeichnung für diese Energieform lautet „Atomkernspaltungsenergie“. Da der Begriff „Atom“ jedoch zunehmend negativ besetzt wurde (durch die Gefahr des „Atom“krieges mit „Atom“waffen), gingen die Betreiber von Atomanlagen dazu über, von „Kernenergie“ zu sprechen. In dieser Arbeit wird weiterhin der Begriff „Atomenergie“ bzw. „Atomstrom“ verwendet.
[6] Einzelne Policies reichen in Bezug auf ihre endgültige Implementation und ihre Auswirkungen über diesen Zeitraum hinaus. In diesem Fall wird versucht, in einem Ausblick die weitere Entwicklung hinsichtlich Erfolg oder Mißerfolg der Policy abzuschätzen.
[7] Teilweise möchten die Interviewpartner aus politischen Gründen nicht genannt werden, daher wird ggf. auf eine entsprechende Quellenangabe verzichtet.
[8] „Die deutsche Policy-Forschung erwuchs in Anlehnung an die synoptische Policy-Forschung, die sich eine ausgreifende rationale Planung und politische Steuerung zum Ziel gesetzt hatte.“
[9] Mez/ Weidner (1997, 17) zählen offensichtlich „Verursacher und Umweltschützer“ nicht zum politisch-administrativen System. Ich bleibe bei der Einteilung durch Windhoff-Héritier.
[10] Windhoff-Héritier S. 67.
[11] Dazu gehören in erster Linie CO2 (Kohlendioxyd), außerdem CH4 (Methan), FCKW, FKW, NOx, N2O, CO, HC sowie Halone (Halogenkohlenwasserstoffe).
[12] vgl. http://www.PIK-Potsdam.DE/~stefan/> (= Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), vom 11.10.1999.
[13] Weitere THG haben folgende Wirkungsanteile: FCKW 17%, Methan 13%, Ozon 7%, Distickstoffoxyd 5%. LHH 1996/8, 18.
[14] Dies bezieht sich auf Aussagen von Interviewpartnern, auf jenen Heins’ Arbeit aufbaut.
[15] Diese Problematik ergibt sich auch bei konventionellen Kraftwerken, steht aber besonders in der AKW-Debatte im Mittelpunkt.
[16] Um den Rahmen nicht zu sprengen, verweise ich hier nur auf Deutsches Atomforum 1995 und 1999, Klinger 1998, Majewski 1998 für die Befürworter sowie andererseits auf Jungk 1990 und Masuch 1998.
[17] Vgl. dazu Jänicke, Martin: „Über Mittel und Ziele der Umweltpolitik. Zehn Thesen wider den ökologischen Instrumentalismus.“, in: Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung IÖW (Hrsg.): Informationsdienst IÖW/ VÖW. 10. Jg. (1995), Heft 2, Berlin, S.6-7. op. cit. Mez/ Weidner 1997.
[18] Ratsbeschluß 127/97 zitiert nach: LHH 1998/9, 98.
[19] Zu weiteren Definitionen des Begriffs vgl. Heins 1997, S.37ff.
[20] Zu einer ausführlichen, sehr radikalen und m.E. teilweise widersprüchlichen und wenig fundierten Kritik des Begriffs s. Bergstedt 1998, S. 38f. und 249ff.
[21] Bericht des SRU 1994, Kurzfassung. <http://www.umweltrat.de/gutach94.htm> vom 09.02.1999.
[22] Kunig (1997, 84) gibt eine weitere Konferenz in Genf 1996 als die 2. KRK-Konferenz an und zählt die Berliner Konferenz als die erste.
[23] Die Entwicklungshilfe (Official Development Aid - ODA) der Industrienationen soll sich nach einer Forderung der UN von 1970 auf 0,7% des Bruttosozialprodukts belaufen. Dies wird von fast keinem OECD-Staat eingehalten, Ausnahmen sind Schweden (seit 1975), Dänemark, Norwegen und die Niederlande.
[24] Weizsäcker et al. 1995, 222.
[25] Die Begriffe „Nachhaltigkeit“, „Zukunftsfähigkeit“ oder „Dauerhaftigkeit“ werden in der Diskussion synomym verwendet; in dieser Arbeit wird weiterhin der Begriff „Nachhaltigkeit“ benutzt werden.
[26] Allerdings ist hier einschränkend die Richtlinienkonformität mit Vorgaben der EU zu erwähnen.
[27] Beispielsweise wurde die von der LHH erwünschte Erhöhung der SWH-Tarife zur Finanzierung des Klimafonds (vgl. Kap. 5.3.5.10) von der zuständigen Aufsichtsbehörde des Landes so nicht genehmigt. Ebenso war dies der Fall beim Genehmigungsverfahren der Energetischen Sanierung der städtischen Liegenschaften (vgl. Kap. 5.3.5.6).
[28] Zu weiteren übertragenen Aufgaben, die den finanziellen Spielraum der Kommunen einschränken, vgl. Jürgen Schultheis: „Kommunale Selbstverwaltung in Gefahr?“, Frankfurter Rundschau vom 5. Januar 1993, zitiert nach: Bundeszentrale für politische Bildung 1994.
[29] Z.B. Haushaltspartnerschaft: Bei einer Haushaltspartnerschaft gestalten und verabschieden die Abgeordneten mehrerer Ratsfraktionen den Haushaltsplan in Absprache.
[30] Nach Auskunft des Amtes für Ratsangelegenheiten, Herr Seinige.
- Arbeit zitieren
- Michael Demus (Autor:in), 1999, Policy-Analyse am Beispiel der Klimaschutzpolitik der Landeshauptstadt Hannover, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2552
Kostenlos Autor werden












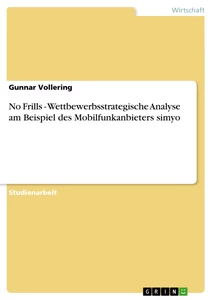







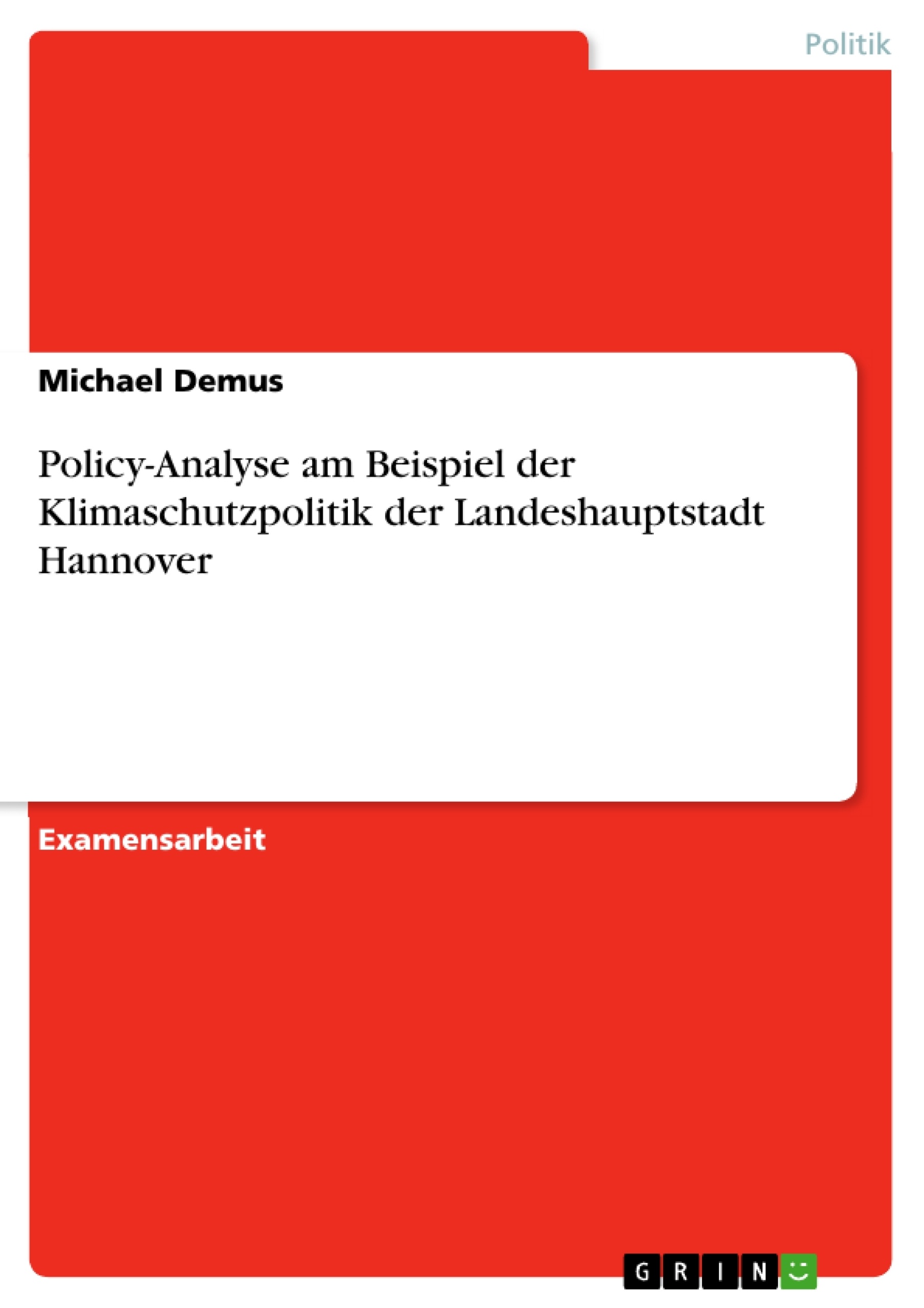

Kommentare