Leseprobe
Inhalt
Einleitung
1 Die Bedeutung von Persönlichkeit, Emotion, Wille und Motiven für die intrinsische Motivation
1.1 Kuhls funktionsanalytischer Ansatz in der Persönlichkeitspsychologie
1.1.1 Die PSI-Theorie
1.1.2 Das aus der PSI-Theorie abgeleitete STAR-Modell
1.1.3 Selbststeuerung und Volitionshemmung
1.1.4 Motive und ihre Umsetzung, Motivmessung
1.2 Intrinsisch motiviertes Verhalten
1.2.1 Intrinsische Motivation und ihre Untersuchung
1.2.2 Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
1.2.3 Selbstbestimmung und motivationale Kompetenz
1.2.4 Was untergräbt die intrinsische Motivation?
1.2.4.1 Wahrgenommene Leistungskontrolle
1.2.4.2 Persönlichkeitsdispositionen
1.2.4.3 Selbstkontrollstrategien
1.2.4.4 Diskrepanz von basalen Motiven und motivationalen Selbstbildern
1.2.4.5 Soziale Ängstlichkeit
1.2.4.6 Demotivierung durch „pädagogische Kunstfehler“ in der Lehre
2 Methoden
2.1 Fragestellungen der Arbeit
2.2 Methodische Schwierigkeiten, intrinsische Motivation im Studium zu messen
2.3 Verwendete Instrumente:
2.3.1 FSM (Fragebogen zur Studienmotivation)
2.3.2 FSS (Fragebogen zum Selbsterleben im Studium)
2.3.3 LKS (Fragebogen zur Leistungskontrolle im Studium)
2.3.4 OMT (Operanter Multi-Motiv-Test)
2.3.5 MUT-K15 (Motiv-Umsetzungs-Test Kurzversion mit 15 Skalen)
2.3.6 PSSI-K (Persönlichkeits-Stil-und-Störungs-Inventar Kurzversion)
2.3.7 SSI-K (Selbststeuerungs-Inventar Kurzversion)
2.3.8 FUA (Fragebogen Umgang mit Anderen)
2.4 Hypothesen
2.4.1 Validierung des Fragebogens zur Studienmotivation (FSM)
2.4.2 Biographische Variablen und die Motivationsform
2.4.3 Grundmotive, Motivation und Bewältigung des Studiums
2.4.3.1 Umsetzung der Grundmotive und Motivationsform
2.4.3.2 Leistungsmotiv und Selbsterleben im Studium
2.4.4 Persönlichkeitsstil und Motivationsform
2.4.5 Selbststeuerung und Motivationsform
2.4.6 Externe Leistungskontrolle im Studium und Motivationsform
2.4.7 Soziale Ängstlichkeit und Selbstbestimmung im Studium
2.4.8 Prenzels These der sechs Demotivierungsstrategien in der Lehre
2.5 Datenauswertung
2.5.1 Faktorenanalysen
2.5.2 T-Test
2.5.3 Korrelationen im Überblick
2.5.4 Mediationsanalysen im Überblick
2.5.5 Qualitative Auswertung der Verbesserungsvorschläge im FSS
2.6 Stichprobe
2.7 Untersuchung
3 Ergebnisse
3.1 Biographische Variablen und die Motivationsform
3.2 Korrelationsberechnungen
3.2.1 Prüfung der Validität des neu konstruierten FSM
3.2.1.1 Korrelationen der FSM-Skalen untereinander
3.2.1.2 Korrelationen des FSM mit studiumsrelevanten Variablen im FSS
3.2.2 Grundmotive, Studienmotivation und Selbsterleben im Studium
3.2.2.1 Korrelationen der MUT-K15- mit den FSM-Skalen
3.2.2.2 Korrelationen der OMT- mit den FSM-Skalen
3.2.2.3 Korrelationen der FSM-Skalen mit OMT-MUT-K15-Diskrepanzen
3.2.2.4 Korrelationen der MUT-K15- und der OMT-Skalen mit den FSS-Skalen
3.2.3 Persönlichkeitsstil und Motivationsform
3.2.4 Selbststeuerung und Motivationsform
3.2.5 Leistungskontrolle im Studium und die Motivationsform
3.2.6 Soziale Ängstlichkeit und Motivationsform
3.3 Mediationsanalysen zur Vorhersage der Motivationsform
3.3.1 Einfluss von Persönlichkeit über die Grundmotive und ihre Umsetzung
3.3.2 Einfluss von Persönlichkeit über Selbststeuerungsfähigkeiten und -schwächen
3.3.3 Einfluss von Basis-Motiv über Selbststeuerungsfähigkeiten und -schwächen
3.4 Mediationsanalysen zur Vorhersage des Selbsterlebens im Studium aus dem Leistungsmotiv
3.5 Mediationsanalysen zur Vorhersage des Umgangs mit Studiumsanforderungen aus der Motivationsform
3.6 Sechs Möglichkeiten, Lernende zu demotivieren
3.6.1 Strategie 1: Verhindern von Autonomie im Lernprozess
3.6.2 Strategie 2: Mangelnde Struktur / Ziel- und Bedeutungstransparenz seitens des Lehrenden
3.6.3 Strategie 3: Schlechte Anpassung der Lehre an das Niveau der Lernenden
3.6.4 Strategie 4: Fehlendes Zutrauen / mangelnde Kompetenzunterstützung
3.6.5 Strategie 5: Mangelnde soziale Einbindung
3.6.6 Strategie 6: Mangelndes Interesse der / des Lehrenden
4 Diskussion
4.1 Validierung des Fragebogens zur Studienmotivation (FSM)
4.2 Biographische Variablen und die Motivationsform
4.3 Grundmotive und die Motivationsform
4.4 Leistungsmotiv, Studienmotivation und Selbsterleben im Studium
4.5 Persönlichkeitsstile und Motivationsformen
4.6 Selbststeuerung und Motivationsformen
4.7 Externe Leistungskontrolle und Motivationsformen
4.8 Soziale Ängstlichkeit und Motivationsformen
4.9 Demotivation in der Lehre
4.10 Typen von Studierenden?
4.11 Zusammenfassende Bewertung des vorliegenden Forschungsansatzes
5 Ausblick
5.1 Offene Fragen für die Grundlagenforschung
5.2 Konsequenzen für die universitäre Lehre
Zusammenfassung
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Anhang
A Fragebögen
A.1 Fragebogen zur Studienmotivation (FSM)
A.2 Der Fragebogen zum Selbsterleben im Studium (FSS)
A.3 Original-FSS Auswertungsschlüssel
A.4 Der Fragebogen zur Leistungskontrolle im Studium (LKS)
B Faktorenanalysen
B.1 Faktorenanalyse zur Skalenkonstruktion des FSM
B.2 Faktorenanalyse zur Skalenkonstruktion des FSS
C T-Test
D Korrelationen
D.1 Korrelation von FUA und FSM
D.2 Korrelation des MUT-K15 mit dem FSS
D.3 Korrelation des OMT mit dem FSS
D.4 Korrelation von FUA und MUT-K15
D.5 Korrelation des PSSI-K mit dem MUT-K15
E Mediationen
E.1 Vorhersagen der identifizierten Regulation
E.2 Vorhersagen der externalen Regulation
F Das Anschreiben an die TeilnehmerInnen
Schlusserklärung
Einleitung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität
Theodor Mommsen
Rund ein Fünftel der Studierenden der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster leiden nach einer Studie des Hochschul-Informations-Systems (Heine, 2002) unter psychischen Problemen wie Prüfungsängsten, depressiven Verstimmungen, mangelndem Selbstwertgefühl und Arbeits- und Konzentrationsschwierigkeiten. Frauen sind mit 27 % gegenüber 18 % der Männer stärker betroffen. Dies ist eines der Ergebnisse der repräsentativen Befragung von 3743 Studierenden. Ein weiterer zentraler Befund der genannten Untersuchung liegt in der Diskrepanz zwischen der anfänglichen Studienmotivation und der Erfüllung der mit ihr verknüpften Erwartungen. Obwohl in erster Linie das Studienfach aus intrinsischen Motiven gewählt wurde, finden sich schließlich – übertragen auf die Gesamtgruppe der Befragten – nur noch 50 % von „hoch motivierten und in ihren Erwartungen bestätigten Studierenden“ (Heine, 2002, S. 10; Hervorhebung i.O.), bei deren Studienwahl das inhaltliche Interesse im Vordergrund gestanden hatte und die ihre Erwartung an interessante Studieninhalte auch erfüllt sahen. Darüber hinaus musste eine weitere Lücke festgestellt werden zwischen der für ein motivierendes und erfolgreiches Studium stark empfundenen Wichtigkeit von (individueller) Betreuung und Beratung durch die Lehrenden und der mangelnden Erfüllung dieses Bedürfnisses aus Sicht der Studierenden. Dass Studierende sich mit Schwierigkeiten in ihrer (neuen) Lebenssituation bisweilen wenig unterstützt fühlen – selbst an einem derart kleinen Fachbereich wie es der der Psychologie in Osnabrück mit rund 60 StudienanfängerInnen pro Jahr ist – zeigt die folgende, wenn auch nicht repräsentative, Aussage einer Teilnehmerin meiner Untersuchung:
„Manchmal fühle ich mich etwas alleine gelassen mit den Problemen, die im Studium auftreten können. Ich weiß nie, an wen ich mich wenden könnte. Zudem finde ich, daß der Sprung von Schule zu Uni extrem groß ist, in Bezug auf Betreuung und Beratung. Man wird weitestgehend alleine gelassen, und das ist erst mal ungewohnt.“[1]
Dass neben der sozialen Eingebundenheit, einer kompetenten Betreuung und Beratung durch die Lehrenden noch eine Reihe weiterer Faktoren von Bedeutung sein dürfte, um auf die Dauer ein befriedigendes und motivierendes Studium zu absolvieren, ist in den letzten Jahren von der Selbstbestimmungstheorie, nicht zuletzt aber auch im Zuge einer breiten Lehr-Evaluationsforschung, aufgedeckt worden (vgl. Winteler, 2000). Neben den konkreten objektiven Studienbedingungen sollten persönliche Kompetenzen in der Selbststeuerung, aber auch Fähigkeiten im Umgang mit anderen Menschen besonders hilfreich sein, das eigene Handeln als wirksam und sinnvoll und damit motivierend zu erleben. Beide – Selbststeuerungs- und Sozialkompetenzen – stellen wichtige Fähigkeiten dar, auftretende Schwierigkeiten im Studium zu bewältigen oder sich ggf. um Hilfe zu bemühen, d.h. das Leben „selbst in die Hand zu nehmen“. Wie Edward Deci und Richard Ryan bereits 1985 in ihrer Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985a; 1993) formulierten, stellt das Erleben von Selbstbestimmung des eigenen Handelns die entscheidende Quelle für eine dauerhafte positive intrinsische Motivation dar, wobei unter intrinsisch motivierten Handlungen vorläufig eben solche verstanden werden sollen, die aus Freude an der Tätigkeit selbst ausgeführt werden. Im Kontrast hierzu stehen extrinsisch motivierte Handlungen, deren motivationaler Anreiz außerhalb der Tätigkeit liegt, etwa in einer Belohnung[2]. Über diese Faktoren hinaus sollten auch die Persönlichkeitsstruktur und die Ausprägung der Grundmotive – besonders des Leistungsmotivs – Rückschlüsse auf die individuelle Motivierbarkeit im Studium zulassen.
Mittlerweile haben sich in der (pädagogischen) Psychologie sehr unterschiedliche Ansätze entwickelt, die die intrinsische Motivation – gerade auch die intrinsische Lern- und Leistungsmotivation – untersuchen. In diesem Kontext ist eine relativ neue Forschungsrichtung entstanden, die sich unter Fokussierung auf das Interessen-Konstrukt mit der auf bestimmte Gegenstände gerichteten intrinsischen Motivation, sog. „Person-Gegenstands-Bezügen“, beschäftigt (vgl. z.B. Krapp, 1992 oder Müller, 2001). In der vorliegenden Untersuchung zur intrinsischen Studienmotivation wurde jedoch der Ansatz der Selbstbestimmungstheorie deshalb zugrunde gelegt, weil er m.E. in sehr umfassender Weise motivationale Prozesse erklärt, und zwar auf der Grundlage eines Zusammenspiels von psychologischen Grundbedürfnissen, situationalen Bedingungen sowie früheren Lernerfahrungen. Gleichzeitig beschäftigt sich die Selbstbestimmungstheorie mit den Folgen intrinsischer oder extrinsischer Motivation für das Selbsterleben und die Selbst-Entwicklung, die grundlegende Faktoren für ein erfolgreiches Studium sein dürften.
Darüber hinaus bieten die umfangreichen Studien der Osnabrücker Differentiellen und Persönlichkeitspsychologie vor dem Hintergrund der noch darzustellenden Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie; zusammenfassende Darstellung bei Kuhl, 2001) einen breiten Erfahrungsschatz zum Zusammenspiel von Persönlichkeit, Selbststeuerung, Motiven, Motivation und Handlungssteuerung und können in der Untersuchung der intrinsischen Studienmotivation reiche Anregungen liefern.
Ziel dieser Diplomarbeit ist es, motivierende und demotivierende Faktoren in der Person, ihren individuellen Kompetenzen und Schwächen, aber auch der universitären Lehre aus Sicht der PSI-Theorie und der Selbstbestimmungstheorie zu untersuchen. Dabei soll die Frage im Mittelpunkt stehen, in welcher Weise die genannten internalen und externalen Bedingungen zusammenwirken und das Erleben von Selbst- oder eben Fremdbestimmung und damit – vereinfacht ausgedrückt – die intrinsische oder eben extrinsische Motivation im Studium begünstigen. Es soll ebenfalls untersucht werden, in welcher Weise die Ergebnisse der vorliegenden Studie für die Praxis nutzbar gemacht werden können. Es ist zu erwarten, dass sich Anregungen z.B. für den Bereich der Gestaltung universitärer Lehre ableiten lassen, aber auch für den Bereich der Studienberatung. Hier dürften besonders die Zusammenhänge von intrinsischer Studienmotivation und Selbststeuerungskompetenzen sowie sozialer Kompetenz von Interesse sein.
1 Die Bedeutung von Persönlichkeit, Emotion, Wille und Motiven für die intrinsische Motivation
Die Untersuchung der intrinsischen Motivation im Studium aus der Perspektive einer umfassenden Persönlichkeitstheorie beleuchtet die Interaktion von Faktoren in der Lernumwelt wie etwa der Lehr-Lernformen mit Faktoren der Persönlichkeit, der emotionalen Ansprechbarkeit, Selbststeuerungsfähigkeit und der Basismotive eines Menschen. Diese persönlichkeitspsychologischen Faktoren werden in der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (PSI-Theorie) von Kuhl (umfassende Darstellung bei Kuhl, 2001) integriert, aus der ein sehr differenziertes Modell der Handlungssteuerung abgeleitet wird. Das Zusammenspiel dieser Faktoren wird mit Hilfe von spezifischen Annahmen modelliert, wobei Persönlichkeit und Handlungssteuerung als Resultat von bestimmten Systemkonfigurationen betrachtet werden. Die PSI-Theorie bildet in dieser Diplomarbeit den einen Teil des theoretischen Hintergrunds für die Untersuchung motivationaler Prozesse im Studium. Sie soll im ersten Teil dieses Kapitels vorgestellt werden, ebenfalls die auf ihr beruhende Ableitung von Persönlichkeitsstilen und –störungen sowie ihre Erklärung von Phänomenen der Volitionshemmung. Ihre Implikationen für eine erweiterte Motivforschung werden im Anschluss dargestellt und bilden gewissermaßen die Überleitung zum zweiten Standbein dieser Arbeit. Dies ist das mittlerweile breite Wissen über motivationale Prozesse aus der Motivationsforschung, und hier speziell aus der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985a). Ein Überblick über wichtige Erkenntnisse der Forschung zur intrinsischen Motivation, insbesondere aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie, soll im zweiten Teil dieses Kapitels gegeben werden, und es soll der Versuch gemacht werden, sie in Beziehung zur PSI-Theorie zu setzen.
1.1 Kuhls funktionsanalytischer Ansatz in der Persönlichkeitspsychologie
1.1.1 Die PSI-Theorie
Grundlage der Kuhl‘schen Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen (2001) ist zum einen die von C.G. Jung (1936/1990) beschriebene kognitive Typologie. Diese zieht die individuelle Bevorzugung bestimmter kognitiver Grundfunktionen, nämlich des Denkens, der Intuition, des Fühlens oder des Empfindens, zur Beschreibung von Persönlichkeitstypen heran. Diese kognitive Typologie wird in der PSI-Theorie mit der klassischen Affekttypologie (Hippokrates, Galen) verbunden, die Persönlichkeitstypen oder Temperamente nach ihrer unterschiedlichen Empfänglichkeit für positiven und negativen Affekt differenziert. Die klassische Temperamentslehre unterscheidet Phlegmatiker, Sanguiniker, Melancholiker und Choleriker.
Die PSI-Theorie (Kuhl, 2001) postuliert ein verhaltenssteuerndes System, das durch den Antagonismus von planvollem analytischem Denken und intuitiv-spontaner Verhaltenssteuerung gekennzeichnet ist. Des Weiteren nimmt sie ein System zur Steuerung des Erlebens an, welches ebenfalls durch einen spezifischen Gegensatz charakterisiert wird, nämlich dem zwischen dem kohärenzstiftenden Fühlen und dem für widersprüchliche Eindrücke empfänglichen, konfliktsensitiven Empfinden.
Kuhl beschreibt nun in seiner PSI-Theorie die Persönlichkeit eines Menschen als das für ihn typische Muster des Zusammenspiels verschiedener psychischer Makrosysteme (Denken, Intuieren, Fühlen und Empfinden) in Abhängigkeit von der Aktivität des Belohnungs- und Bestrafungssystems bzw. der entsprechenden momentanen Stimmungslage. Diese Stimmungslage ist dabei sowohl durch momentane Eindrücke als auch durch eine grundlegende Sensitivität der Person für Belohnung bzw. Bestrafung beeinflusst.
Konkrete Annahmen der PSI-Theorie beziehen sich auf den Einfluss von positiver bzw. negativer Emotionalität auf das verhaltenssteuernde System (Denken und Intuieren) sowie auf das System zur Steuerung des Erlebens (Fühlen und Empfinden).
Folgende sog. Modulationshypothesen werden in der PSI-Theorie formuliert:
Erste Modulationshypothese (Willensbahnungs-Annahme):
Positive Emotionen dämpfen das analytische Denken und fördern die intuitive Verhaltenssteuerung (Willensbahnung).
Andersherum befördert der Wegfall positiver Stimmung, also Frustration, das analytische Denken, die Generierung von Handlungsabsichten im Intentionsgedächtnis (IG) und hemmt die Intuition (Willens- oder Ausführungshemmung).
Zweite Modulationshypothese (Selbstbahnungs-Annahme):
Der Wegfall negativer Emotionalität ermöglicht den Zugang zu den im Extensionsgedächtnis (EG) gespeicherten eigenen Selbstrepräsentationen, zu breiterem Erfahrungswissen und ermöglicht so z.B. kreative Problemlösungen (Selbstbahnung).
Umgekehrt dämpfen negative Emotionen den Einfluss des kohärenzstiftenden Fühlens auf das Erleben und fördern die konfliktsensitive Empfindungsfunktion (Selbsthemmung).
Die nachstehende Abbildung 1.1 zeigt schematisch die Wirkung von positivem und negativem Affekt auf die beiden Systeme:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1.1: Wippenmodell der Modulationsannahmen der PSI-Theorie. Abhängigkeit der Aktivierungsstärke der vier an der willentlichen Handlungssteuerung beteiligten kognitiven Makrosysteme von der Stärke positiver und negativer Affekte (A+ bzw. A-) und ihrer Herabregulierung [A(+) und A(-)] (nach Kuhl, 2000).
Positive und negative Emotionen werden also nicht als einander entgegengesetzte Pole ein und derselben Dimension aufgefasst, sondern als, wenn auch häufig negativ korrelierte, aber doch theoretisch voneinander unabhängig wirkende Dimensionen. Gestützt wird diese Trennbarkeitsannahme durch empirische Befunde zu verschiedenen Alltagsphänomenen wie beispielsweise der Alienation. Kuhl und Kazén (1994) unterscheiden im Sinne der PSI-Theorie bei diesem Phänomen der Entfremdung von eigenen Gefühlen und Präferenzen verschiedene Formen der Alienation aufgrund einer jeweils unterschiedlichen Affektlage. Sie unterscheiden
- Fälle von eingeschränkter Selbstwahrnehmung (beeinträchtigte Fühlfunktion) und
- Fälle von eingeschränkter selbstkongruenter Verhaltenssteuerung (durch eine Beeinträchtigung der Intuition bei Erhalt der Fühlfunktion).
Genau diese verschiedenen Formen der Alienation konnten bestätigt werden und die zitierte Untersuchung zeigt, dass tatsächlich der Wegfall positiver Emotionalität eine andere Auswirkung auf das Gesamtsystem hat als eine ausgeprägte negative Stimmung. Bei Personen mit niedriger Aktivierung des Belohnungssystems und somit nach der ersten Modulationshypothese angenommener geringer Verhaltensbahnung (als prospektive Lageorientierung bezeichnet) kann der Zugang zu den eigenen Wünschen, also die Fühlfunktion, weiterhin intakt sein, die Wünsche lassen sich nur nicht in die Tat umsetzen. Hier kommt es zur sog. informierten (oder manifesten) Alienation, d.h. die betreffende Person berichtet tatsächlich, dass sie sich durchaus bewusst ist, sich ihren eigentlichen Wünschen entgegengesetzt zu verhalten, sie hat aber das Gefühl, nicht anders zu können. Übertragen auf den Bereich der Studienmotivation ist der Fall denkbar, dass die betreffende Person zwar weiß, dass sie eigentlich das richtige Fach gewählt hat und weiterkommen möchte, dass sie also mit den im Selbst – dem Extensionsgedächtnis (EG) – verankerten Zielen kompatible Handlungsabsichten gefasst hat. Gleichzeitig wird aber die Umsetzung dieser Absichten aus dem Intentionsgedächtnis (IG) durch zu geringen positiven Anreiz im Studium oder zu geringe Fähigkeit, positiven Affekt selbst zu generieren (Selbstmotivierung), gehemmt. Bei starker Aktivierung des Bestrafungssystems hingegen wird nach der zweiten Modulationshypothese mit einer Beeinträchtigung der Fühlfunktion gerechnet, es kommt zur sog. fehlinformierten (oder latenten) Alienation, und die Person verwechselt leichter fremde und eigene Erwartungen, Wünsche und Ideen. Bezogen auf die Studienmotivation ist denkbar, dass die betreffende Person bereits mit ihrer Studienwahl oder ihren Schwerpunkten fremde Erwartungen zu erfüllen versucht, ohne dies bewusst zu bemerken. Dies entspräche genau dem Typ der introjizierten Regulation laut der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985a), worauf ich später im Kapitel 1.2.2 zurückkommen werde.
Voraussetzung für Selbstbestimmung ist aber der Vergleich von an die Person herangetragenen fremden Erwartungen mit den eigenen, im Extensionsgedächtnis (EG) gespeicherten Zielen und – bei Übereinstimmung mit dem Selbstsystem – die Integration solcher Introjekte in dasselbe. Wie kann man sich aber nun diese Integration und damit das Wachstum des Selbst vorstellen? Als notwendige Bedingung für die Integration neuer Ziele wird in der PSI-Theorie die Kommunikation der beiden hochinferenten Systeme – also des Intentionsgedächtnisses (IG) und des Extensionsgedächtnisses (EG) – angenommen. Selbstkongruenz, also eine Übereinstimmung der expliziten Absichten (IG) mit den impliziten Zielen (EG), hängt davon ab, wie ausbalanciert diese Kommunikation ist. Durch Hemmung des positiven Affekts (selbstgesteuertes Aushalten von Frustration) können implizite Ziele aus dem EG – vorausgesetzt der Zugang zu den im EG gespeicherten Selbstrepräsentationen ist durch herabregulierten negativen Affekt gegeben ( 1. Modulationshypothese) – in explizite Handlungsabsichten übersetzt werden (2. Modulationshypothese). Andersherum kann das Selbst die Umsetzung von fremden Erwartungen, also im IG gespeicherten expliziten Absichten bei Kompatibilität mit dem Selbstsystem durch Generierung von positivem Affekt (Selbstmotivierung) unterstützen. Diese selbstgesteuerte Aufhebung des für die Introjektion günstigen affektiven Zustands – der Hemmung des positiven Affektes – ist nötig, damit die Umsetzung von Handlungsabsichten erlebt werden kann und damit eine positive Identifikation mit ihnen unterstützt werden kann. Ein flexibler Wechsel zwischen Aktivierung und Herabregulierung von positiven und negativen Affekten ist demnach optimal für eine selbstbestimmte Zielbildung und Zielumsetzung.
1.1.2 Das aus der PSI-Theorie abgeleitete STAR-Modell
Nach der beschriebenen PSI-Theorie unterscheiden sich die Persönlichkeitsstile bzw. auch Persönlichkeitsstörungen nach ihrer jeweils unterschiedlichen Selbstaktivierung von Belohnungs- und Bestrafungsaffekten und der daraus resultierenden unterschiedlichen Bevorzugung bestimmter kognitiver Grundfunktionen. So sollte beispielsweise eine selbstunsichere Person eine geringere Sensibilität für positiven Affekt und eine stärkere für negativen Affekt haben und stärker zum kognitiven Grundtyp Denken neigen. Eine Übersicht über die zu den einzelnen Stilen bzw. Persönlichkeitsstörungen gemachten Annahmen findet sich in Tabelle 1.1.
Tabelle 1.1: Auflistung der mit dem Persönlichkeits-Stil-und-Störungs-Inventar (PSSI) erfassten Stile, der korrespondierenden Persönlichkeitsstörungen und von Hypothesen der PSI-Theorie über Belohnungs- und Bestrafungssensibilität (bzw. positive vs. negative Emotionalität), bzw. globale Verhaltensaktivierung oder sensorische Sensibilisierung ("Temperament") durch positive oder negative Erfahrungen (kursiv). Die gemäß der PSI-Theorie jeweils dominante kognitive Funktion ist in der letzten Spalte genannt (zitiert nach Kuhl & Kazén, 1997).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
*IVS = Intuitive Verhaltenssteuerung.
Im STAR-Modell werden die Persönlichkeitsstile und ihre entsprechenden Extremvarianten, die Persönlichkeitsstörungen auf die motivationalen Basisdimensionen Selbstaktivierung von Belohnungsaffekt (A+ vs. A(+), d.h. hoch vs. niedrig) und Selbstaktivierung von Bestrafungsaffekt (A- vs. A(-), d.h. hoch vs. niedrig) entsprechend ihrer jeweiligen Ausprägung projiziert (s. Abbildung 1.2). Dabei sind die Persönlichkeitsstörungen – unterschieden nach Anreiz- und Temperamentstypen – entsprechend mit „A“ und „T“ gekennzeichnet.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1.2: STAR-Modell der Persönlichkeitsstörungen (vgl. Bezeichnungen an den Stern-Spitzen), entsprechender Stile (Bezeichnungen innerhalb der Sternzacken) und kurzfristiger Systemkonfigurationen (Abkürzungen im Innenkreis). Abkürzungen: PL = Planen; EO = Erkenntnisorientierung; SN = Selbstrevision; SK = Selbstkontrolle; FA = Fantasie; SO = Selbstorganisation; KO = Kontaktorientierung; SR = Selbstregulation (nach Kuhl, 2000).
Bei den dargestellten Persönlichkeitsstilen handelt es sich um die nicht-pathologischen Entsprechungen der in den psychiatrischen Diagnosemanualen DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) und ICD-10 (World Health Organization, 1994) beschriebenen Persönlichkeitsstörungen. Zwischen Stil und Störung wird hierbei auf dem geschilderten theoretischen Hintergrund ein dimensionaler Zusammenhang postuliert.
Weitere persönlichkeitsbestimmende Aspekte, die mit dem STAR-Modell nicht dargestellt werden können, die jedoch deshalb nicht geleugnet werden, betreffen die vorherrschenden Grundmotive sowie die Selbststeuerungskompetenzen einer Person. Typische Beispiele für letztere sind Motivationskontrolle, Aufmerksamkeitskontrolle, Zielvergegenwärtigung, Planen oder Selbstdisziplin. Selbststeuerungskompetenzen können dazu beitragen, dass aus einer typischen Systemkonfiguration nicht durch affektive Fixierung eine extreme Einseitigkeit, also eine Persönlichkeitsstörung wird.
1.1.3 Selbststeuerung und Volitionshemmung
Dass Selbststeuerungskompetenzen im Hinblick auf die Überwindung von Willenshemmungen wichtig sind, klingt – so einfach formuliert – einleuchtend, zugegebenermaßen aber auch trivial. Wie wichtig sie letztlich für das Aufrechterhalten einer Studienmotivation sind, ist Thema dieser Untersuchung. Aber was ist exakt unter Selbststeuerungsmechanismen zu verstehen, und wie genau wirken sie?
Es gibt nach der PSI-Theorie verschiedene Formen sowohl der Willensbahnung, aber auch der Willenshemmung, also der eingeschränkten Selbststeuerung. Bei der Umsetzung komplexer, schwieriger Aufgaben – und im Studium hat man es mit einer ganzen Reihe von komplexen Aufgaben zu tun – muss die durch eine Belastung des Intentionsgedächtnisses bedingte Hemmung der Handlungsausführung überwunden werden. Dies geschieht nach der ersten Modulationshypothese am ehesten durch die Generierung von positivem Affekt. Wird gleichzeitig die Handlung durch die Vergegenwärtigung von Zielen oder Wünschen aus dem Extensionsgedächtnis gestützt, spricht Kuhl von Selbstregulationsstrategien. Hierzu zählen beispielsweise positive Selbstmotivierung, Herabregulierung von negativem Affekt oder die Zielvergegenwärtigung. Dagegen gibt es Strategien, die mit besonders verstärktem Druck auf schwierige, besonders auch auf unattraktive Aufgaben reagieren, sog. Selbstkontrollstrategien. Hierbei wird durch Aufrechterhalten bzw. Steigerung der negativen Emotionalität der Zugang zu evtl. störenden Wünschen oder Impulsen aus dem Extensionsgedächtnis gestört, was in bestimmten Situationen und in Ermangelung von Selbstregulationsstrategien durchaus sinnvoll sein kann. Zu den Selbstkontrollstrategien zählen negative Selbstmotivierung, Selbstbestrafung nach Misserfolg oder Impulskontrolle (vgl. u.a. Kuhl, 1996, S. 684). Entsprechend lassen sich zwei Formen von Volitionshemmung unterscheiden: Es lassen sich erstens Persönlichkeitstypen vorstellen, bei denen – nach der ersten Modulationshypothese – die Ausführung oder Umsetzung der eigenen Wünsche und Ziele durch zu geringe Belohnungssensibilität gehemmt wird und bei denen auch nicht die benötigten Selbstregulationsstrategien zur Verfügung stehen. Hier spricht Kuhl von Ausführungshemmung oder prospektiver Lageorientierung (LOP) (Kuhl, 1998a). Zweitens kann man von einer Selbsthemmung oder Lageorientierung nach Misserfolg (LOM) sprechen, wenn es aufgrund zu starker Bestrafungssensibilität nicht mehr wirklich zur Wahrnehmung der eigenen Wünsche und Ziele kommt. Folgen können Rigidität, Konformismus oder Lähmung nach Misserfolg sein.
Überstarke Volitionshemmung, d.h. Ausführungshemmung (LOP) oder Selbsthemmung (LOM) kann ein starker Indikator für psychische Erkrankungen sein, weil gerade bestimmte Selbststeuerungsfähigkeiten bei Erkrankungen wie Depression, Zwangserkrankung, Angststörungen, Alkoholismus oder Essstörungen stark beeinträchtigt sind.
Dass Selbststeuerungskompetenzen gerade auch für die zufriedenstellende Bewältigung eines Studiums von zentraler Bedeutung sind, zumal das Studiensystem im Vergleich zu Schule oder anderen Arbeitszusammenhängen ein größeres Maß an Selbstorganisation erfordert, liegt auf der Hand. Ihr Vorhandensein könnte somit ein wichtiger Prädiktor für Studienzufriedenheit und -erfolg sein.
1.1.4 Motive und ihre Umsetzung, Motivmessung
Motivation wird alltagssprachlich gerne als Triebfeder einer Handlung zur Erreichung eines Ziels oder der Beseitigung eines unangenehmen Zustands verstanden, da sie die nötige Energie und die Richtung des Verhaltens steuert. Ist sie erst genügend stark gespannt, muss es nach diesem Vergleich also zur „Entladung“ oder „Spannungsabfuhr“ kommen. In mancher Hinsicht ist dieser – sehr mechanistische – Vergleich zu einfach: Wie Murray (1938) bereits in den 30er Jahren erstmals feststellte, handelt es sich bei der Motivation einer Handlung nicht allein um die einseitige Energetisierung eines Verhaltens aus einem Mangelzustand des Organismus heraus, was eher mit dem Terminus Trieb beschrieben wird. Hingegen betonte er bereits den interaktiven Charakter der motivationalen Handlungssteuerung: Die Umwelt regt ihrerseits bestimmte Motive an, was Murray mit dem Begriff press bezeichnete. Aus dem Zusammenspiel von Bedürfnis (need) und Umweltanregung (press) entsteht ein Thema oder Motiv, das die Handlung zu einem gegebenen Zeitpunkt zu steuern vermag. Bei der Frage, welches Thema angeregt wird und wie stark diese Anregung ausfällt, spielen die durch Lernerfahrungen erworbenen Erwartungen aber ebenso eine wichtige Rolle wie eine situative Anregung, wie man sich an einem kleinen Beispiel veranschaulichen kann: Der Satz „Lass mich dir helfen!“ spricht bei einer Person das Beziehungsmotiv an, weil sie womöglich viele positive Erfahrungen mit ihren Mitmenschen oder speziell dem Sprechenden gemacht hat, bei einer anderen eher das Leistungsmotiv, besonders wenn sie den Satz aufgrund häufiger Misserfolge oder einfach ihrer Misserfolgsängstlichkeit als Hinweis auf ihre mangelnde Kompetenz ansieht, bei einer dritten wieder am ehesten das Machtmotiv, weil ihr Thema der Kampf um Autonomie ist.
Auf der skizzierten theoretischen Grundlage entwickelte Murray einen Katalog von über 20 Motiven, von denen speziell drei in der Folge immer wieder systematisch untersucht wurden: Leistung, sozialer Anschluss und Macht (vgl. Heckhausen, 1989). Mit einem projektiven Verfahren, dem Thematischen-Apperzeptions-Test (Murray, 1943), versuchte Murray, die den Handlungen einer Person zugrundeliegenden und für sie typischen Verschränkungen von Bedürfnis und Umweltanregung, mithin die immer wiederkehrenden, meist unbewussten Themen, aufzuspüren. Er verwendete also den Motivbegriff sowohl zur Erklärung situational angeregten Verhaltens, als auch zur Beschreibung zeitlich überdauernder Persönlichkeitsmerkmale im Sinne der für eine bestimmte Person typischen Art, auf bestimmte Situationen zu reagieren.
Nach dem Grundmodell der „klassischen“ Motivationspsychologie wird typischerweise zwischen dem als überdauernde Eigenschaft einer Person verstandenen Motiv und der jeweils aktuellen Motivation – die als Resultat der Wechselwirkung von Motiv und Situation angesehen wird – getrennt. Kognitive Modelle der Motivation, die auf McClelland et al. (1953) und schließlich Weiner (1972) zurückgehen – wie beispielsweise das Risikowahl-Modell von Atkinson (1957) –, sehen die Aktualisierung von Motiven vor dem Hintergrund individueller Bewertungen von Ziel-, Erfolgs- und Risikoerwartungen sowie vorhandener Bewältigungsstrategien der Person. Emotionen sehen sie lediglich in ihrer Bedeutung für eine veränderte Wahrnehmung der Anreizstruktur einer Umgebung, d.h. Motive können durch Emotionen verstärkt werden.
Die PSI-Theorie erweitert die kognitionspsychologischen Modellvorstellungen der Motivation noch um eine weitergehende affektive Komponente (s. hierzu Kuhl, 1998a). Durch eine Veränderung der affektiven Grundstimmung ändert sich nicht nur die Anreizstruktur einer gegebenen Umgebung, sie wirkt auch direkt hemmend bzw. aktivierend auf die kognitiven Makrosysteme (Denken, Intuieren, Fühlen und Empfinden), die letztlich das Verhalten in einer konkreten Situation steuern.
Damit werden nicht nur Aussagen über die Stärke eines Motivs, sondern letztlich auch über die wahrscheinliche Form der Umsetzung von Motiven bei einer Person bei gegebener affektiver Grundstimmung möglich. So kann beispielsweise das Machtmotiv bei positiver Grundstimmung mittels der Intuitionsfunktion umgesetzt werden. Der betreffenden Person fällt es leicht, auf intuitive Verhaltensprogramme zur Umsetzung von Selbstbehauptungs- oder Machtmotiv zuzugreifen, beispielsweise in einer Gruppe die Initiative zu ergreifen oder gleich eine schlagfertige Reaktion parat zu haben, wenn jemand sie bevormunden will.
Die PSI-Theorie ermöglicht somit eine differenziertere Betrachtung der motivationalen Zustände und der für eine Person typischen Motiv-Umsetzung mittels der vier kognitiven Grundfunktionen. Von den basalen Motiven zu unterscheiden ist das bewusste motivationale Selbstbild einer Person. Da die Kenntnis sowohl der basalen Motive als auch des motivationalen Selbstbildes einer Person für die Untersuchung ihrer intrinsischen Motivation von Bedeutung sein dürfte, sollen beide, also implizite und explizite Motive, sowie die für die Person typische Umsetzungsform dieser Motive in der vorliegenden Studie ebenfalls untersucht werden. Auf bestimmte Verfahren zur Messung von Motiven sowie ihrer Umsetzung, die aus der PSI-Theorie entwickelt wurden, soll im methodischen Teil dieser Arbeit genauer eingegangen werden.
1.2 Intrinsisch motiviertes Verhalten
Kaum ein Gebiet in der Psychologie ist mittlerweile so breit erforscht wie das der intrinsischen Motivation. Dies gilt für die Grundlagenforschung, aber auch gerade für die Anwendung in verschiedensten Bereichen der Pädagogischen Psychologie, der Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch z.T. der Klinischen Psychologie. Für den Zeitraum von 2000-2002 finden sich in der von der American Psychological Association herausgegebenen Datenbank PsycINFO 316 Verweise auf Studien zur intrinsischen Motivation.
Dabei handelt es sich bei der „intrinsischen Motivation“ um einen sehr schillernden Begriff, der in den verschiedenen theoretischen Konzeptionen unterschiedlich gefasst wurde und wird. Rheinberg (2002a) weist aber in Anlehnung an Schiefele (2001) sowie Schiefele und Köller (2001) darauf hin, dass sich
„in jüngster Zeit zunehmend die Tendenz durch[setzt], den Begriff intrinsische Motivation einheitlich für solche Motivationsformen anzuwenden, die allein um der Tätigkeit und nicht der Ergebnisse willen durchgeführt werden“ (Rheinberg, 2002a, S. 155).
Die Erklärung dieses Begriffs soll nun noch etwas erweitert werden: Die im vorigen Abschnitt besprochenen basalen Motive sind gleichsam der „Schlüssel“ zur intrinsischen Motivation, indem etwa ein starkes Leistungsmotiv in einer Situation, in der es um das Bewältigen einer kniffeligen Aufgabe geht, dazu führen kann, dass man alles um sich herum über diese Tätigkeit vergessen kann. Das Ausmaß der intrinsischen Motivation im Studium hängt jedoch nur zu einem gewissen Grad von den basalen Motiven oder speziell dem Leistungsmotiv und seiner Umsetzung ab, was im nachstehenden Kapitel dargestellt werden soll.
Zunächst soll im Folgenden (Kapitel 1.2.1) skizziert werden, welches die Perspektiven sind, aus denen heraus das schwer fassbare Phänomen „intrinsische Motivation“ bislang beleuchtet worden ist. Hierzu zählen das Konzept der motivationalen Orientierung nach Elliot (1997) und die Bezugsnorm-Orientierung (Heckhausen, 1974; Rheinberg, 1980; 2001) sowie die Theorie des Interesses (Krapp, 1992). Dabei stehen die Fragen im Vordergrund, was genau unter intrinsischer Motivation verstanden wird und wie sie untersucht worden ist. Einer dieser Forschungsperspektiven, derjenigen der Selbstbestimmungstheorie von Edward Deci und Richard Ryan (1985a; 1993) wird ein weiteres Kapitel (1.2.2) gewidmet, da sie neben der PSI-Theorie die Basis meiner Untersuchung ausmacht. Schließlich soll das Konzept der motivationalen Kompetenz von Rheinberg (2002b) in Abschnitt 1.2.3 vorgestellt werden, da hierin interessante Hinweise für das Verständnis des Phänomens Selbstbestimmung enthalten sind. Und danach soll in Kapitel 1.2.4 der Frage nachgegangen werden, welche Faktoren die intrinsische Motivation aus Sicht der vorgestellten und für diese Studie zentralen Theorien – der PSI-Theorie, der Selbstbestimmungstheorie und des Konzepts der motivationalen Kompetenz – unterminieren.
Vor diesem theoretischen Hintergrund werden im methodischen Teil dieser Arbeit gezielte Fragestellungen entwickelt, wie z.B. zur Beziehung von intrinsischer Motivation im Studium zu den weiteren in dieser Studie untersuchten Variablen wie Leistungskontrolle, Persönlichkeit, Basismotive, Selbststeuerungsfähigkeit, Kreativität oder sozialer Kompetenz.
1.2.1 Intrinsische Motivation und ihre Untersuchung
Zunächst soll der vielschichtige und – wie bereits angedeutet – unterschiedlich verwendete Begriff der „intrinsischen Motivation“ näher betrachtet werden. Trotz unterschiedlichster Konzeptionen in der Forschung sowie der teilweise außerordentlich festgefügten Vorstellungen über den Gegenstand sollte allerdings nicht vergessen werden, dass es sich um ein hypothetisches Konstrukt handelt.
Bisher wurde gesagt, dass unter intrinsisch motivierten Handlungen solche verstanden werden, deren Anreiz in der Tätigkeit selbst und nicht außerhalb liegt. Bei Csikszentmihalyi wird zur Charakterisierung intrinsisch motivierter Tätigkeiten die Verbindung mit einem ganz bestimmten Erleben postuliert, dem sog. Flow-Erlebnis. Es bezeichnet ein holistisches Gefühl des Verschmelzens mit der Tätigkeit und soll nach seiner Theorie als Belohnung wirken und so die Ausübung der Tätigkeit erklären (Csikszentmihalyi, 1985; s.a. Csikszentmihalyi & Schiefele, 1993).
Damit kommt Csikszentmihalyi einer bedeutend älteren Idee von White (1959) sehr nahe, die eine Wirksamkeitsmotivation postulierte. Nach White (1959) gibt es ein zentrales Wirksamkeitsbedürfnis, das viele verschiedene, triebunabhängige Verhaltensweisen motiviert. Dieses Wirksamkeitsbedürfnis wird von White als Motor der menschlichen Entwicklung angesehen, indem es die Person motiviert, immer wieder neue, herausfordernde Situationen aufzusuchen, die Voraussetzung für Weiterentwicklung. Im Unterschied zu anderen Basisbedürfnissen wie Hunger oder Durst tritt dieses Bedürfnis nicht zyklisch auf, sondern wirkt ständig – allenfalls von akuten Bedürfnissen unterbrochen – im Hintergrund. Dieses grundlegende Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit ist im Unterschied zu Trieben nicht zu befriedigen oder zu sättigen, vielmehr motiviert es die Person, sich immer wieder neue Tätigkeitsfelder zur Befriedigung zu suchen.
Den Gedanken der Selbstwirksamkeits-Motivation griffen ebenfalls Deci und Ryan in ihrer Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985a; 1993) auf. Im Unterschied zu den bisher genannten Charakterisierungen (vgl. auch Rheinberg, 2002a, S. 152ff.) betont ihre Definition explizit die Bedingung der Selbstbestimmtheit von intrinsischem Verhalten. In Anlehnung an diese Theorie werden unter intrinsisch motivierten Verhaltensweisen solche verstanden, welche ausgeführt werden, weil die Ausführung selbst ein frei gewähltes und in sich befriedigendes Ziel darstellt.
Bestimmungsmerkmale der intrinsischen Motivation sind danach also Autonomie und Befriedigung bei der Ausübung der Tätigkeit. Damit sind intrinsisch motivierte Verhaltensweisen abgegrenzt von solchen, die zwar frei gewählt, jedoch als wenig befriedigend erlebt werden oder von solchen, die zwar befriedigend, aber nicht unbedingt selbstgewählt sind. Eine solche eher externale, d.h. von außen gesteuerte, Form der Handlungsregulation könnte sich ausdrücken in Sätzen wie: „Ich will diese Aufgabe nun erledigen, sie macht mir aber keinen sonderlichen Spaß“ oder im zweiten Fall: „Die Arbeiten, die von mir in meinem Job erwartet werden, machen mir Spaß.“ In letzterem Fall würde die Selbstbestimmungstheorie streng genommen nicht von einer intrinsischen Motivation sprechen, auch wenn die betreffende Tätigkeit lustvoll erlebt wird. Sie würde von einer integrierten oder sogar identifizierten Motivation sprechen, je nachdem wie stark die von außen an die Person herangetragenen Erwartungen internalisiert und im Einklang mit den eigenen Wünschen erlebt werden. Wie man gerade an diesem Beispiel unschwer erkennen kann, macht es Sinn, intrinsisch und extrinsisch motiviertes Verhalten – je nach erlebter Wahlfreiheit – als graduelle Abstufungen auf einem Kontinuum der Selbstkompatibilität oder eben Selbstbestimmung anzusehen.
Dass eine simple Unterscheidung in intrinsisch vs. extrinsisch, wie diese lange Zeit im klassischen dichotomen Modell in der Forschung vorgenommen wurde, der Vielfalt menschlicher Verhaltensregulation nicht gerecht wird, soll im Folgenden weiter erläutert werden. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass, auch wenn die intrinsische Motivation meist leistungsthematisch untersucht wurde, sich dennoch viele der folgenden Erkenntnisse auch auf andersthematische Inhalte übertragen lassen. Der leistungsthematische Bezug der meisten Studien erklärt sich aus der Nähe zu einem der wichtigsten Anwendungsbereiche dieser Forschungstradition, der Lern- und Leistungsmotivation in der Schule.
Das klassische free-choice -Paradigma (Deci, 1972) in der experimentellen Untersuchung intrinsisch motivierten Verhaltens ging von der Annahme aus, dass sich an der Dauer des gezeigten Zielverhaltens in einer free-choice -Phase ablesen lässt, ob ein Verhalten intrinsisch oder extrinsisch motiviert ist. Dass die alleinige Betrachtung der Beschäftigungsdauer allerdings zu fatalen Fehlschlüssen führen kann, konnten Ryan, Koestner und Deci (1991) in einer Studie zur Korrumpierung der intrinsischen Motivation durch Ich-Beteiligung zeigen: Ein Verhalten wurde auch dann in der free-choice -Phase fortgesetzt, wenn es durch eine Form von Ich-Beteiligung zustande gekommen, aber nicht mit Spaß verbunden war. Solches Verhalten kann nur als internal, aber nicht als intrinsisch motiviert definiert werden. Unter Ich-Beteiligung ist der Zustand zu verstehen, in dem das Meistern einer Aufgabe zum Zweck der Selbstbestätigung oder zur Reduzierung einer Selbstwertbedrohung geschieht. (vgl. Ryan et al., 1991, S. 186). Formen der Ich-Beteiligung sind nach Greenwald (1982) die Ich-Beteiligung
- durch Bedrohung der Wertschätzung durch andere,
- durch Bedrohung der Selbstwertschätzung und
- durch persönliche Wichtigkeit der betroffenen Tätigkeit.
Persönlich wichtige Werte werden also durch die Aufgabe berührt. Ryan et al. (1991) konnten in ihrem Experiment zur Unterscheidung von intrinsisch motiviertem und internal kontrolliertem Verhalten zeigen, dass sich Ich-Beteiligung genauso auf das beobachtbare Verhalten in der free-choice -Situation auswirkt wie Fremdkontrolle. ProbandInnen der Experimentalgruppe „Ich-Beteiligung“ (mit der Instruktion, die gestellte Aufgabe sei ein „kreativer Intelligenztest“) setzten die ihnen gestellte Aufgabe „freiwillig“ fort, empfanden jedoch wesentlich weniger Interesse und Wahlfreiheit als ProbandInnen in der Experimentalgruppe „Aufgabenorientierung“ (einfache Erläuterung der Aufgabe). Entscheidend für die intrinsische Motivation ist also nicht die Dauer des gezeigten Zielverhaltens in der free-choice -Phase, sondern die dabei empfundene Wahlfreiheit, das Interesse und die Freude bei der Tätigkeit.
So trat mit der „kognitiven Wende“ in der Leistungsmotivations-Forschung schließlich auch die Frage in den Vordergrund, welche Ziele Menschen eigentlich verfolgen, wenn sie ihr Leistungsmotiv umsetzen. Es wird zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen motivationalen Orientierungen in Bezug auf das Leistungsmotiv unterschieden. Nicholls (1984; 1988) spricht von Aufgaben-Orientierung (task orientation) vs. Ich-Orientierung (ego orientation) und Elliot (1997) unterscheidet Zielorientierungen nach learning goals (Lernziel-Orientierung), auch mastery goals (Kompetenzerwerb-Orientierung) genannt, und performance goals (Performanz-Ziel-Orientierung). Während bei der Lern-Ziel- oder auch Kompetenzerwerbs-Orientierung für die Person ein Interesse am Gegenstand und ein Zuwachs von eigenem Wissen im Vordergrund steht, würde also beispielsweise unter Bedingungen der Ich-Beteiligung eine Performanz-Ziel-Orientierung dem eigenen Verhalten zugrunde gelegt. Denn bei dieser Orientierung ist es der betreffenden Person wichtig, gut oder besser als die anderen abzuschneiden, möglicherweise auch unabhängig vom persönlichen Interesse am Gegenstand. Die performance-goals -Orientierung lässt sich noch unterteilen in performance-avoidance goals (entspricht Versagensbefürchtung) und performance-approach goals (entspricht Überlegenheitswünsche). Untersuchungen zur Zielorientierung, Lernfreude und Lernleistung konnten nach Rheinberg (2002b) das in Abbildung 1.3 dargestellte Beziehungsmuster bestätigen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1.3: Auswirkungen der unterschiedlichen Zielorientierungen auf Lernfreude und Lernleistung (nach Rheinberg, 2002b, S. 188)
Während sich die motivationale Orientierung „Kompetenzerwerb“ positiv auf die Lernfreude auswirkt, steht sie allerdings nicht in einem direkten Zusammenhang zur Lernleistung. Entsprechendes gilt für die Orientierung an Überlegenheitswünschen: Sie hat positiven Einfluss auf die Lernleistung, aber keinen direkten Bezug zur Lernfreude. Das gezeigte Verhalten würde demjenigen aus dem experimentellen Setting unter Ich-Beteiligung entsprechen. Versagensbefürchtung als die zweite, „negative“ Spielart der Performanz-Orientierung, wirkt sich negativ sowohl auf Lernfreude als auch auf Lernleistung aus. Dieser verheerende Effekt von Versagensbefürchtungen lässt sich mit den Hypothesen der PSI-Theorie erklären, indem diese Zielorientierung mit starkem negativen Affekt gekoppelt sein dürfte, welcher zum einen die Lernfreude unterminiert, zum andern aber auch nach der zweiten Modulationshypothese den Zugang zu den impliziten Wissenslandschaften erschwert, welcher aber für den Lernzuwachs wichtig ist.
Ein den Zielorientierungen verwandtes Konzept ist das der Bezugsnormen (Heckhausen, 1974; Rheinberg, 1980; 2001). Es gibt sachliche, individuelle und soziale Bezugsnormen zur Beurteilung der eigenen oder fremden Leistung. Nach Rheinberg (2002b) prägen besonders elterlicher Erziehungsstil, Lehrerverhalten, aber auch generell das Bildungssystem die jeweils dominante Bezugsnorm, nach der SchülerInnen und StudentInnen bewertet werden und schließlich sich selbst bewerten.
Dickhäuser und Rheinberg (2002) nehmen an, dass je nach persönlicher Zielorientierung eine unterschiedliche, nämlich angemessene Bezugsnorm zur eigenen Leistungsbeurteilung herangezogen wird. Die verschiedenen Zielorientierungen werden indes der jeweils gesellschaftlich geltenden Bezugsnorm unterschiedlich gut gerecht. Beispielsweise ist davon auszugehen, dass eine starke Betonung der sozialen Bezugsnorm durch das Bildungssystem bei den SchülerInnen oder StudentInnen eher performance-approach goals (Überlegenheitswünsche, die auch stärker mit dem Macht- als mit dem Leistungsmotiv assoziiert sind) befördern kann. Dagegen würde eine Betonung der individuellen Bezugsnorm, die in unseren Schulen und Universitäten i.d.R. nicht gilt, den learning goals stärker Raum lassen.
Aufgrund dieser Zusammenhänge ist festzuhalten, dass die intrinsische Motivation stärker mit der Kompetenzerwerbs-Orientierung und mit einer individuellen Bezugsnorm assoziiert ist. Dies wird in Kapitel 1.2.4.1 noch einmal von Bedeutung sein, in dem es um die Frage geht, unter welchen Bedingungen sich Leistungsfeedback negativ auf die intrinsische Motivation auswirken sollte.
Andere kognitive Ansätze, die ebenfalls aufgrund ihrer Praxisnähe für den schulischen Bereich attraktiv sind, thematisieren motivationswirksame Erwartungen eines Lernenden: Im Zentrum steht wiederum das Konzept der Selbstwirksamkeit und es wird angenommen, dass sich die für eine Person typische Attribution von Erfolg und Misserfolg auf die zukünftige Erfolgserwartung und damit auf die Motivation auswirkt. Die stark anwendungsorientierte Forschung sucht nach Möglichkeiten, die zugrundeliegenden Einstellungen zu ändern und beschäftigt sich mit den typischerweise tiefergehenden Lernstrategien von Lernern, die eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben (vgl. etwa Pintrich & deGroot, 1990).
Eine weitere Forschungsperspektive ist die der sog. Münchner Interessentheorie (vgl. Krapp, 1992), welche „Interesse" als gegenstandsspezifische intrinsische Motivation versteht. Sie thematisiert die Wertschätzung bzw. Abneigung, die einem bestimmten Gegenstand entgegengebracht wird. Interesse wird im Kontext Lernmotivation angesehen „als eine auf Selbstbestimmung beruhende motivationale Komponente des intentionalen Lernens“ (Krapp, 1993, S. 202). Insofern wird bei Interessenhandlungen Selbstintentionalität erlebt, jedoch werden nicht alle Formen der Instrumentalität ausgeklammert, weil interessenbestimmtes Lernen fast immer mit Intentionen außerhalb des reinen Tätigkeitsvollzugs verbunden ist. Aufgrund der hohen Selbstbestimmtheit interessengeleiteter Handlungen haben Interessen eine große Bedeutung für das individuelle Selbstkonzept. Forschungsschwerpunkte betreffen Vorhersagen von Lernstrategien, Lerntiefe, Lernleistung aufgrund von Interesse, geschlechtsspezifische Unterschiede, aber auch die Entwicklung individueller Interessen. In einer Studie von Schiefele et al. (1995) konnte der Lernaufwand als Korrelat des Interesses die Vorhersage von Studienerfolg aufgrund des Studieninteresses erklären.[3] Hier drängt sich die Frage auf, durch welche internalen Prozesse dieser höhere Lernaufwand vermittelt wird, ob es sich also um intrinsische Motivation oder lediglich um Identifikation im Sinne der Selbstbestimmungstheorie handelt. Die Analysetiefe in diesem Ansatz ist hierdurch m.E. im Verhältnis zur Selbstbestimmungstheorie stark verringert, indem intrinsische, integrierte oder identifizierte Motivationsformen nicht differenziert werden und als „Interesse“ zusammenfassend untersucht werden.
1.2.2 Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan
Auf der Grundlage langjähriger Forschungen formulierten Deci und Ryan 1985 ihre Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985a; 1993), die nun genauer vorgestellt werden soll. Sie stellt ein umfassendes Motivationsmodell dar, das die Initiierung und Regulation menschlichen Verhaltens auf der Basis von drei psychologischen Grundbedürfnissen erklärt:
- erlebte Selbstbestimmung,
- Selbstwirksamkeit und
- soziale Eingebundenheit.
Es soll Voraussagen über verschiedene Affekte, Kognitionen und Verhaltensweisen in unterschiedlichsten Lebensbereichen ermöglichen. Dabei stellen die genannten psychologischen Grundbedürfnisse die energetische Quelle motivierten – und das heißt intrinsisch oder extrinsisch motivierten – Handelns dar. Das Konzept der Grundbedürfnisse kann erklären, warum bestimmte Handlungsziele motivierend wirken, aber auch, wie es zu einer zunehmenden Integration von Handlungszielen in das Selbstkonzept kommt, wenn nämlich gerade diese Bedürfnisse bei der Ausübung der Handlung in einem gegebenen Handlungsumfeld befriedigt werden können. Damit beschreibt die Selbstbestimmungstheorie gleichzeitig die Entwicklung des integrierten Selbst als eine fortschreitende Integration zunächst extrinsisch motivierter Prozesse über den Motor des Bestrebens nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Einbindung. Zugleich werden hiermit Bedingungen in der (Lern-)umwelt angedeutet, welche die intrinsische Motivation, bzw. die Integration extrinsischer Ziele unterstützen oder eben behindern können.
Deci und Ryan beziehen sich in der Herleitung ihrer Selbstbestimmungstheorie auf White, der bereits 1959 ein grundlegendes Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit als Motor der Selbst-Entwicklung postulierte (White, 1959), sowie auf deCharms (1968), dessen Konzept der „kausalen Autonomie“ – der Zustand, in dem man sich selbst als Ursprung des eigenen Handelns erlebt – als Schlüssel zur intrinsischen Motivation gesehen wird. Deci und Ryan (1985a) stellen somit die wahrgenommene Selbstbestimmung bei der Verursachung und Regulation des Verhaltens in den Mittelpunkt. Die in der Selbstbestimmungstheorie angenommene Tendenz des Organismus zur Selbst-Entwicklung stellt dabei eine Erweiterung des zunächst rein kognitiven, attributionstheoretischen Modells dar.
Im Selbstwirksamkeits-Bedürfnis sehen sie die energetische Quelle der intrinsischen Motivation, weil dieses Bedürfnis genau dadurch gekennzeichnet ist, dass es im Gegensatz zu den Bedürfnissen, die den verschiedenen – in der Selbstbestimmungstheorie differenzierten – Formen der extrinsischen Motivation zugrundeliegen, nicht durch die Erreichung eines Endzustandes befriedigt werden kann.
Voraussetzung allerdings für die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist die Möglichkeit und das Erleben von Selbstbestimmung. Auch wenn Interesse und Kompetenzstreben für die intrinsische Motivation eine große Rolle spielen, so ist ungeachtet dessen das bestimmende Element die wahrgenommene Autonomie bei der Ausführung der Tätigkeit, was nach Deci und Ryan auch die Freiheit von Belohnungen und irgendwelchen Kontingenzen bedeutet:
„To be truly intrinsically motivated, a person must also feel free from pressures, such as rewards or contingencies.“ (Deci & Ryan 1985a, S. 29).
Jegliche Form des Kontroll-Erlebens – dies schließt auch die Kontrolle durch innere Zwänge ein – unterminiert demnach die intrinsische Motivation. Somit stellt die wahrgenommene Selbstbestimmung bei einer Tätigkeit die entscheidende Basis für das Entstehen von intrinsischer Motivation dar.
Die Erfahrung von Autonomie und Selbstwirksamkeit ist dabei sowohl von äußeren Bedingungen als auch von persönlichen, für ein Individuum typischen Wahrnehmungsschemata in Bezug auf die Initiierung und Regulation von Verhalten, der sogenannten Kausalitätsorientierung, beeinflusst. Die Art und Weise, wie ein Mensch die Verursachung und Regulation von Verhalten sieht, seines eigenen oder desjenigen anderer Menschen – nämlich als autonom (autonomy), kontrolliert (control) oder „unpersönlich“(impersonal) – hat Einfluss auf seine Motivation. Der Begriff „impersonal“ lässt sich dabei nur unzureichend mit „unpersönlich“ oder „nicht personengebunden“ übersetzen. Menschen können mehr oder weniger stark den drei verschiedenen Tendenzen zuneigen, daher werden diese als Dimensionen und nicht als Klassifizierungen oder Typen bezeichnet. Die Kausalitätsorientierung wird dabei als eine generelle, verschiedene Lebensbereiche übergreifende Orientierung gesehen, die Vorhersagen über Affekte, Kognitionen und Verhaltensweisen in einer gegebenen Situation erlauben soll. Dabei sind die Prototypen der drei verschiedenen Orientierungen (autonom, kontrolliert und unpersönlich), auf einem Kontinuum entsprechend ihrem Grad der empfundenen Selbstbestimmung angeordnet mit dem
- größten Selbstbestimmungs-Erleben bei der Autonomieorientierung,
- geringem Selbstbestimmungs-Erleben bei der Kontrollorientierung und dem
- geringsten Erleben von Selbstbestimmung bei der Unpersönlichkeitsorientierung.
Die Selbstbestimmungstheorie differenziert nun drei Gruppen von motivationalen Prozessen, die nach der Wahrnehmung des einer Tätigkeit zugrundeliegenden Anreizes (als in der Tätigkeit selbst liegend, außerhalb der Tätigkeit oder als der Person nicht fassbar) unterschieden werden. Diese Wahrnehmung ist wiederum stark von der persönlichen Kausalitätsorientierung geprägt. Es werden unterschieden: die intrinsische Motivation, die extrinsische Motivation und die Amotivation, wobei die extrinsische Motivation noch weiter untergliedert wird. Diese Motivationsformen sind mit einem unterschiedlichen Ausmaß an erlebter Selbstbestimmung verbunden.
Nach der Theorie zählen nicht nur intrinsisch motivierte Handlungen zu den selbstbestimmten Verhaltensweisen, sondern auch solches extrinsisch motiviertes Verhalten, das, wenn auch zweckgebunden oder ursprünglich aus fremden Zielen generiert, dennoch frei gewählt und als interessant bewertet wird, das als internal reguliertes Verhalten angesehen werden kann, welches durch in das Selbst integrierte Ziele gestützt wird. Solche Verhaltensweisen werden als Manifestation der Autonomie-Orientierung angesehen. Den übrigen external regulierten und den amotivierten Verhaltensweisen fehlt dagegen das Erleben von Wahlfreiheit und Selbstkongruenz.
Es werden neben der integrierten Regulation drei weitere Formen der externalen Regulation beschrieben: Die identifizierte Regulation, die introjizierte Regulation und die externale Regulation, wobei die letztere im älteren dichotomen Modell vormals als extrinsische (im Kontrast zur intrinsischen) Motivation bezeichnet wurde. Ihnen liegt die Kontroll-Orientierung zugrunde, Selbstbestimmung wird hier höchstens in geringem Maße erlebt, eher dagegen Fremdbestimmung. Die Amotivation stellt schließlich die Regulationsform dar, der auf der Ebene der Kausalitätsorientierung die „unpersönliche“ Orientierung entspricht und die folglich mit der geringsten Erfahrung von Selbstbestimmung verbunden ist.
Tabelle 1.2 gibt einen Überblick über die wichtigsten Kennzeichen der sechs Regulationsformen nach Deci und Ryan (1985a).
Tabelle 1.2: Unterscheidungsmerkmale der sechs Motivationsformen nach der Selbstbestimmungstheorie (Deci & Ryan, 1985a).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Auf der Grundlage der Selbstbestimmungstheorie können, ausgehend von der Kausalitätsorientierung einer Person und vom angenommenen Grad der erlebten Selbstbestimmung, Vorhersagen für ihre Motivation und ihr Verhalten in speziellen Lebensbereichen überprüft werden. Deci und Ryan (1985b) berichten Zusammenhänge der Kausalitätsorientierung mit verschiedenen Verhaltens- oder Einstellungsbereichen, wie beispielsweise mit der Leistung im Studium, mit dem Bindungsmuster von Mutter und Kind (Bridges et al., 1983) oder mit dem Coping mit operativen Eingriffen bei Koronarpatienten (King, 1984). So ging beispielsweise eine starke Tendenz zur Kontroll-Orientierung – wohlgemerkt in unterschiedlichsten Lebensbereichen – einher mit schlechteren Studienleistungen. Der Subskalenwert für „Kontroll-Orientierung“ in der General Causality Orientations Scale (Deci & Ryan, 1985b) korrelierte mit der Note im Seminartest zu -.25 (p < .02). Da neben der generellen, situationsübergreifenden Kausalitätsorientierung auch weitere Faktoren für das Zustandekommen einer Zensur von Bedeutung sein dürften wie beispielsweise Interesse, Tagesform, Wichtigkeit der Note und die Fähigkeit der Person, kann diese negative Korrelation bereits als vergleichsweise stark angesehen werden. Garbarino konnte bereits 1975 in einer Untersuchung zeigen, dass sich die Einführung einer Belohnung negativ auf die Performanz bei einer Aufgabe auswirken konnte, in der ein Kind einem anderen Kind etwas beibringen sollte. Diese Ergebnisse decken sich im Übrigen mit dem Befund einer Metaanalyse von Schiefele und Schreyer (1994), wonach sich in verschiedensten Studien zur intrinsischen und extrinsischen Motivation zeigte, dass sich intrinsische Lernmotivation leistungssteigernd, dagegen extrinsische Lernmotivation eher leistungsmindernd auswirken kann.
Es ist nun zu klären, was genau unter Selbstbestimmung, der zentralen Voraussetzung für intrinsische Motivation, verstanden werden soll. Kuhl (1998a) definiert Selbstbestimmung in Anlehnung an Deci und Ryan (1991) folgendermaßen:
„Der Begriff Selbstbestimmung beschreibt die Bildung und Umsetzung von Zielen, welche weitgehend die in hochinferenten Selbstrepräsentationen integrierten Interessen und Bedürfnisse berücksichtigen“ (Kuhl 1998a, S. 65f.).
Diese Definition unterstreicht die Bedeutung der Selbstbestimmung im Prozess der Willensbahnung und -umsetzung. Darüber hinaus zeigt sie interessante Ansatzpunkte für die Untersuchung von Selbstbestimmung vor dem Hintergrund der PSI-theoretischen Annahmen, die sich ja in besonderer Weise mit dem Zugang zu den hochinferenten Selbstrepräsentationen und der Umsetzung selbstbestimmter Ziele beschäftigen. Welche Beziehung besteht beispielsweise zwischen der erlebten Selbstbestimmung und den Selbststeuerungskompetenzen, der kognitiven Grundfunktion oder dem Persönlichkeitsstil eines Menschen? Konkrete Annahmen hierüber können aus der PSI-Theorie abgeleitet werden (s. Hypothesen in Kapitel 2.4).
Deci und Ryan (1987, S.1033f.) betonen ausdrücklich, dass man vorsichtig sein sollte, intrinsische Motivation mit Selbstbestimmung gleichzusetzen und extrinsische Motivation mit Fremdbestimmung. Denn auch external reguliertes Verhalten kann selbstbestimmt sein, es unterscheidet sich definitionsgemäß von dem intrinsisch motivierten Verhalten ja zunächst einmal lediglich durch den außerhalb der Tätigkeit liegenden Anreiz. Dagegen ist intrinsisch motiviertes Verhalten durch seinen autotelischen Charakter definiert und kann deshalb nicht fremdbestimmt sein, denn der Anreiz liegt ja gerade innerhalb der Tätigkeit. Vorstellbar sind Tätigkeiten, die in erster Linie der Erreichung eines externen Ziels dienen, etwa das Durcharbeiten von komplizierten Studien und dicken Büchern, um die Selbstbestimmungstheorie besser zu verstehen und etwa Forschungsarbeiten besser beurteilen oder gar selbst durchführen zu können. Dieses Ziel wird dabei von der Person so stark geschätzt, dass die Ausübung der Tätigkeit – wenn auch extrinsisch motiviert – doch selbstbestimmt aus freiem Willen in Angriff genommen werden kann. Es macht also Sinn, selbstbestimmte Verhaltensweisen zu unterscheiden in einerseits intrinsisch motiviertes und andererseits solches extrinsisch motiviertes Verhalten, bei dem bereits die Integration der (außerhalb der Tätigkeit liegenden) Ziele und Werte ins Selbst stattgefunden hat.
Die Selbstbestimmungstheorie hat die Forschung nachhaltig beeinflusst, indem sie zunächst das dichotome Modell von extrinsischer vs. intrinsischer Motivation in mehr als zwei unterschiedliche Handlungsregulationsformen ausdifferenziert hat und zudem um die Vorstellung der Amotivation erweitert hat. Mit ihrer Annahme einer grundlegenden Selbstwirksamkeitsmotivation nach White (1959) wird der intrinsischen Motivation eine zentrale Rolle im Prozess der Integration neuer Wünsche und Ziele in das Selbst zugeschrieben.
1.2.3 Selbstbestimmung und motivationale Kompetenz
Nach obiger Definition der Selbstbestimmung ist selbige auch durch eine Passung von basalen Motiven, Zielen und Tätigkeiten charakterisiert. Indes erfordert das Erreichen eines solchen Zustandes introspektive sowie selbstregulative Fähigkeiten. Rheinberg (2002b) spricht in diesem Zusammenhang von motivationaler Kompetenz. Er definiert sie folgendermaßen:
„Motivationale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, aktuelle und künftige Situationen so mit den eigenen Tätigkeitsvorlieben in Einklang zu bringen, dass effizientes Handeln auch ohne ständige Willensanstrengung möglich wird.“ (Rheinberg, 2002b, S. 200)
Rheinberg gliedert diese Kompetenz in vier grundlegende Fähigkeiten auf, und zwar:
1. Die Kenntnis der eigenen basalen Motive
2. Die Fähigkeit, Situationen und Tätigkeiten im Vorhinein richtig auf ihren motivationalen Anreiz zu beurteilen
3. Die korrekte Einschätzung des Ausmaßes, in dem die erforderlichen Aktivitäten zu den eigenen Vorlieben passen, und schließlich
4. Die Fähigkeit, die anstehende Tätigkeit bei Bedarf auch durch motivpassende Anreizanreicherung aufzuwerten.
Gerade der letzte Punkt macht m.E. deutlich, dass es sich bei intrinsisch motivierten Handlungen doch möglicherweise um einen begrenzten Spezialfall der auf Selbstbestimmung beruhenden Verhaltensweisen handelt: Tätigkeiten, die um ihrer selbst willen ausgeführt werden und mit einem Flow-Erlebnis verbunden sind, erfordern auf höherer Ebene keinerlei Nachregulation durch zusätzliche Anreizanreicherung der anstehenden Tätigkeit. Das Selbst ist zwar beteiligt, jedoch unbewusst – das Flow-Erleben ist nach Csikszentmihalyi (1985) besonders durch Selbstvergessenheit charakterisiert –, und es werden bei Deci und Ryan nur diejenigen Ziele und Tätigkeiten als intrinsisch angenommen, deren Vollzug mit positivem Affekt verbunden ist. Der positive Affekt erklärt über die erste Modulationshypothese der PSI-Theorie die Aufrechterhaltung der Tätigkeit durch positive Selbstmotivierung, lediglich eine latente Beteiligung selbstregulatorischer Funktionen sorgt für die intuitive Verhaltenssteuerung (Kuhl, 2001, S.595).
Intrinsisch motiviertes Verhalten sollte demnach zwar präferiert werden, da es mit größerem positivem Affekt gekoppelt ist; das Ausmaß an Selbstbestimmung wird dagegen möglicherweise gerade bei der integrierten Regulationsform am deutlichsten gespürt.
Erinnern wir uns an das obige Beispiel, das den Charakter der integrierten Regulation verdeutlichen sollte, so wird ersichtlich, wie wichtig eine Aktivierung des Selbst für das Erleben von Selbstbestimmung ist. Dazu passen Befunde von Schultheiss und Brunstein (1999), die zeigen, wie bedeutsam es für das Ziel-Commitment ist, dass vor der Inangriffnahme eines Ziels der Zugang zu den impliziten Motiven geschaffen und eine Vorstellung der motivkompatiblen Anreize der kommenden Situation aktiviert wird. Dies wurde in der Experimentalbedingung durch die Vorab-Imagination der zugewiesenen Aufgabe, ein direktives Beratungsgespräch im Anschluss zu führen, erreicht. Dabei konnte aber die experimentelle Bedingung alleine ein höheres Ziel-Commitment nicht vorhersagen. Es war letztlich die Interaktion von Experimentalbedingung, starkem Machtmotiv und starkem Anschlussmotiv (gemessen mit dem TAT), die die Höhe des Commitments vorhersagte. Die Überbrückung der Lücke zwischen impliziten Motiven und expliziten Zielen wird durch die Aktivierung des Selbst erreicht und diese Verbindung ist offenbar für die Entscheidung für oder gegen das Ziel und die Entschlossenheit in Bezug auf das explizite Ziel von zentraler Bedeutung. Die PSI-Theorie geht in der Erklärung einen Schritt weiter, indem sie weitere Annahmen über die Entschlossenheit hinaus, über die positive Selbstmotivierung zum motivkongruenten Verhalten macht. Die Imagination motivkongruenter Inhalte sollte nicht nur eine Entscheidung für die Umsetzung motivkongruenter Ziele bzw. gegen die Umsetzung motivinkongruenter Ziele, erleichtern, sondern darüber hinaus auch positive Emotionen verstärken, die dann wiederum nach der ersten Modulationshypothese die Umsetzung der Ziele befördern.
Dass diese positive Motivierung über die zwischengeschaltete Imaginations-Übung (bei Motiv-Ziel-Kongruenz) funktioniert und auch tatsächlich zu einer besseren Performanz führt, konnten Schultheiss und Brunstein im zweiten Teil ihrer Untersuchung zeigen. Hierbei wurde auch klar, dass es nicht allein der Entspannungseffekt der Imaginations-Übung ist, der das Ergebnis maßgeblich beeinflusst. Eine neutrale Imaginations-Übung war nicht in der Lage, das untersuchte Machtmotiv für die nachfolgende Wettbewerbs-Aufgabe zu aktivieren. Die entscheidenden Effekte der Imagination sind offenbar, dass zum einen durch die Entspannung der Zugang zu den Selbstrepräsentationen ermöglicht wird, zum andern dass sie die impliziten, holistisch repräsentierten Motive lesbar macht, die ja gerade über verbale Instruktionen nicht angesprochen werden.
Für den Erhalt oder die Steigerung der intrinsischen Motivation ist also der Zugang zu den im Selbst repräsentierten Bedürfnissen und der Abgleich mit den expliziten Zielen wichtig. Auf diese wichtige Implikation für die mögliche Unterminierung der selbstbestimmten Regulation durch eine starke Sensibilität für negativen Affekt oder durch eine Diskrepanz von basalen Motiven und dem motivationalen Selbstbild werde ich in Kapitel 1.2.4.2 und 1.2.4.4 zurückkommen.
1.2.4 Was untergräbt die intrinsische Motivation?
Aus der Forschungstradition zum Komplex der intrinsischen Motivation der letzten 20 Jahre gibt es deutliche Hinweise darauf, welche Faktoren – besonders welche situationsbedingten Faktoren – kontrollierend wirken und die erlebte Selbstbestimmung beeinträchtigen. Hierzu werden z.B. im Bereich der Lernmotivation das Einengen von Spielräumen, das detaillierte Vorschreiben und massive Kontrollieren gezählt. Aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie zählt hierzu aber auch die extrinsische Belohnung der Tätigkeit, sofern sie als kontrollierend erlebt wird. Bekannt wurde das Phänomen der belohnungsbedingten Korrumpierung der intrinsischen Motivation durch eine Untersuchung von Lepper, Greene und Nisbett (1973), welche zeigte, dass eine zuvor freiwillig gewählte und als lustvoll erlebte Tätigkeit durch die Gabe einer Belohnung anschließend in ihrer Attraktivität abgewertet werden kann, sobald die Belohnung wegfällt. Unter dem Begriff „overjustification effect“ wurde eine kognitive attributionstheoretische Erklärung geliefert, die besagt, dass, sobald man eine plausible Erklärung für sein Verhalten gefunden hat (in diesem Fall die Belohnung) die zweite Erklärung (nämlich die Attraktivität der Handlung) ihre Ausführung nur noch „überrechtfertigt“ und ihre Bedeutung damit abnimmt. Diese Studie begründete eine ganze Forschungstradition zu unterschiedlichen, in erster Linie externen Korrumpierungsfaktoren, darunter kontrollierendes vs. Autonomie-unterstützendes Verhalten (Koestner et al., 1984; für einen Überblicksartikel s. Deci & Ryan, 1987), Beobachtung (Ryan et al., 1991), Leistungsfeedback (z.B. Ryan et al., 1991), aufgaben- vs. performanzkontingente Belohnung (Harackiewicz, 1979; McGraw, 1978), sogar das Sichtbarmachen von extrinsischen Belohnungen der Partnerschaft (Seligman et al., 1980) für die intrinsische Motivation in verschiedensten Verhaltens- und Lebensbereichen wie kreatives Malen (z.B. Lepper et al, 1973), kognitive Aufgaben (Harackiewicz, 1979), Partnerliebe (Blais et al., 1990), Wissensvermittlung (Garbarino, 1975) oder prosoziales Verhalten (Ryan & Connell, 1989).
Das Postulat, dass extrinsische Anreize die intrinsische Motivation korrumpieren können, wurde damals als Angriff auf die seinerzeit populären Token-Programme aufgefasst und wurde v.a. vonseiten einiger Behavioristen stark angezweifelt. Selbst im Jahr 2001, immerhin fast 30 Jahre nach der alles auslösenden Studie von Lepper, Greene und Nisbett (1973) wurde es noch hartnäckig diskutiert. (s. hierzu beispielsweise die Beiträge im Review of Educational Research von Cameron & Pierce, 1994; Cameron & Pierce, 1996; Kohn, 1996; Lepper et al., 1996; Ryan & Deci, 1996; Cameron, 2001; Deci, Koestner & Ryan, 2001; Deci, Ryan & Koestner, 2001). Nach dem klassischen lerntheoretischen Paradigma lässt sich Motivation als variable Anstrengungsbereitschaft je nach vorheriger Lernerfahrung und aktuellen Konsequenzen des Verhaltens untersuchen, wobei in Abgrenzung zur kognitivistischen Perspektive jedoch nur äußere, sichtbare und manipulierbare Konsequenzen (Verstärker) gemeint sind. Eine intrinsische Motivation, die ja gerade nicht von außen angestoßen werden muss, kann durch eine Beschränkung auf Reiz-Reaktions-Schemata nicht erklärt werden. Die behavioristischen KritikerInnen halten nach wie vor die Selbstbestimmung – als internales Konstrukt – für zu spekulativ und mit dem lerntheoretischen Paradigma nicht untersuchbar, wodurch es hier zu wenig Annäherung gekommen ist.
Im Zusammenhang mit der Korrumpierung intrinsischer Studienmotivation interessieren in der vorliegenden Studie in erster Linie diejenigen Faktoren, von denen auf der Basis der PSI-Theorie angenommen werden kann, dass sie stark mit den Voraussetzungen für intrinsische bzw. extrinsische Motivation, nämlich dem Erleben von Autonomie bzw. Fremdbestimmung assoziiert sind. Diese sind die wahrgenommene Leistungskontrolle im Studium, Persönlichkeitsdispositionen, die Neigung zu Selbstkontrollstrategien, die Deckungsgleichheit oder eben Diskrepanz von bewussten und nicht bewussten Motivausprägungen sowie die soziale Ängstlichkeit einer Person.
1.2.4.1 Wahrgenommene Leistungskontrolle
Leistungskontrolle im Studium bedeutet neben der geforderten Leistung (in Form einer Klausur, eines Referats o.ä.) auch ein Feedback über die eigene Leistung. Dabei ist die Art des Feedbacks bedeutsam für die Kompetenzunterstützung, aber auch das Autonomieerleben des Lernenden. Ergebnisse unterschiedlichster Studien über die Effekte von informativem vs. kontrollierendem Feedback zeigen, dass externes Leistungsfeedback nicht zwangsläufig eine externale Form der Regulation begünstigt, informatives Feedback kann sogar die intrinsische Motivation fördern, indem es das Kompetenzerleben fördert (vgl. Deci & Ryan, 1987; Rheinberg, 1980). So konnten auch Prenzel et al. (1993) in der Evaluation einer Studienreform zur chirurgischen Ausbildung pfadanalytisch bestätigen, dass informatives, kompetenzunterstützendes Feedback signifikant zum Erleben von Autonomie und Kompetenz und darüber zu einer intrinsischen Motivation im Studium beitrug.
Die unterschiedlichen Wirkungsweisen von informativem und kontrollierendem pauschalem (negativem) Feedback werden durch die Untersuchung von Trope, Hassin und Gervey (2001) erhellt. Feedback hat zum einen einen informationalen Wert, zum andern einen emotional bedeutsamen Wert. Nach Trope et al. (2001) kann es gerade bei negativem Feedback zu einem motivationalen Konflikt kommen, denn negatives Feedback enthält nicht nur eine emotionale Bewertung der eigenen Person, die eine Ich-Beteiligung provoziert, sondern auch besonders einen informativen Wert, der dem Lernenden gerade Hinweise zur Selbstverbesserung gibt und damit den selbstbestimmten Lernprozess anspornen kann, allerdings nur sofern die bewertete Fähigkeit von der Person für kontrollierbar und veränderbar gehalten wird.
Unter diesen Bedingungen erhöht sich der informative Gehalt des Feedbacks im Verhältnis zu seinem emotionalen Gehalt, der aversive emotionale Gehalt verliert an Bedeutung, und solcherart informatives Feedback wird nach Trope et al. (2001) gesucht. Der informative Gehalt des Feedbacks tritt dagegen in den Hintergrund, und der emotionale Gehalt, besonders der negative, wird verstärkt erlebt, wenn die betreffende Eigenschaft als nicht von der Person kontrollierbar angesehen wird. Entsprechendes Feedback wird tendenziell vermieden, da es unter genau diesen Umständen die intrinsische Motivation korrumpiert.
Leistungskontrolle im Studium kann also auch als positiv erlebt werden, nämlich angstreduzierend als informatives Feedback über die eigene Leistung. Darüber hinaus kann mögliches positives Feedback als Belohnung für die eigene Leistung gesehen werden, also als typische Form der extrinsischen Motivation. Des Weiteren kann erwartetes positives, aber auch negatives Feedback als willkommene Möglichkeit gesehen werden, bis zu einem bestimmten Punkt die Kontrolle über das eigene Verhalten, nämlich die Motivierung, sozusagen nach außen zu delegieren.
Zur Frage, ob auch positives Feedback die intrinsische Motivation korrumpiert, fassen Deci und Ryan (1987) die auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnisse verschiedener Untersuchungen folgendermaßen zusammen: Die intrinsische Motivation könne möglicherweise sogar gesteigert werden durch die Befriedigung des Kompetenzbedürfnisses. Offenbar werde sie aber dann korrumpiert, wenn durch das Erhalten von positivem Feedback darüber hinaus eine zwischenmenschliche Kontrolle erlebt werde.
Dieses individuell unterschiedliche Erleben der Fremdkontrolle spielt eine wichtige Rolle für die Emotionsregulation, indem etwa
- negative Gefühle wie Angst oder Unsicherheit durch externes Feedback reduziert werden können,
- durch Belohnung der eigenen Leistung positiver Affekt verstärkt wird, oder
- sogar durch Delegation der Kontrolle nach außen möglicher negativer Affekt durch die Leistungskontrolle als zusätzliche Motivationsquelle begrüßt wird.
1.2.4.2 Persönlichkeitsdispositionen
Ich-Beteiligung sowie ihr Gegenstück Aufgabenorientierung wurden in der zitierten Untersuchung von Ryan et al. (1991) als innerer Zustand betrachtet, der durch Umwelt-Hinweise ausgelöst wurde. Beide können aber auch als Persönlichkeitsvariablen gesehen werden. Ich-Beteiligte sollten besonders bei Unsicherheit über ihre eigene Kompetenz stärkere Anstrengungen zeigen, verbunden allerdings mit geringerem Interesse an der Tätigkeit. Nach der PSI-Theorie gibt es nun bestimmte Persönlichkeitsdispositionen, die stärker als andere zu einer solchen Ich-Beteiligung neigen. Diese Persönlichkeitsdispositionen sind durch eine stärkere Empfänglichkeit für negative Affekte wie mögliche Bestrafung gekennzeichnet. Diese Personen sollten nach der PSI-Theorie weniger Zugang zu eigenen Selbstrepräsentationen haben, und somit anfälliger für Selbstzweifel und Unsicherheit bzgl. ihrer eigenen Kompetenz sein und sich demnach häufiger selbst unter Druck setzen, eine bestimmte Leistung zu erbringen.
Negativer Affekt erhöht nach der PSI-Theorie die Aktivität der konfliktsensitiven Empfindungsfunktion, d.h. eigene Defizite werden noch stärker wahrgenommen, und das gezeigte Leistungsverhalten wird stärker durch den selbstgemachten Druck, das Selbstwertgefühl zu erhalten, motiviert als durch die mögliche Freude an der Tätigkeit. Diese wird, war sie auch ursprünglich noch vorhanden, nun aufgrund der geringeren Wahrnehmung eigener Wünsche und Vorlieben kaum noch erlebt. Basale Motive werden kaum noch wahrgenommen und können die Verhaltensregulation nicht mehr unterstützen (vgl. Schultheiss & Brunstein, 1999).
Auch konnte Baumann in ihrer Dissertation (1998) zeigen, dass lageorientierte Personen nach Induktion einer negativen Stimmung stärker zu Intrusionen, latenter Alienation und Fremdbestimmung neigen, und dass es durch eine Bewusstmachung des negativen Affekts gehäuft zu fehlinformierter Introjektion – der fälschlichen Selbstzuschreibung fremder Erwartungen – kam.
1.2.4.3 Selbstkontrollstrategien
Es ist anzunehmen, dass Selbstkontrollstrategien wie negative Selbstmotivierung, Rigidität oder Impulskontrolle ebenfalls die intrinsische Motivation untergraben, indem sie ja gerade den Zugang zu den angenehmen Gefühlen stören sollen (zweite Modulationshypothese). Bereits im Wort „Selbstkontrolle“ klingt an, dass es sich hier um eine internalisierte Form der Fremdkontrolle handelt, die sich wie Ich-Beteiligung negativ auf die intrinsische Motivation auswirken sollte.
1.2.4.4 Diskrepanz von basalen Motiven und motivationalen Selbstbildern
Nach Kuhl (1998a, S. 67) ist selbstbestimmtes Verhalten dadurch gekennzeichnet, dass seine Umsetzung mit den eigenen Bedürfnissen und Motiven in Einklang steht. Diskrepanzen zwischen impliziten Motiven (gemessen mit projektiven Verfahren wie dem TAT) und dem motivationalen Selbstbild (mit Hilfe von Fragebogen-Maßen ermittelt) lassen sich demnach als eine Form der Alienation ansehen, denn motivationale Introjekte sind ja gerade verbal vermittelt und im bewussten Selbstbild verankert und sollten sich damit in Motiv-Fragebögen wiederspiegeln, nicht jedoch in projektiven Verfahren zur Motiv-Messung. Bei Situationen oder Persönlichkeitsstilen mit starker negativer Emotionalität sowie bei Personen mit einer Neigung zu Lageorientierung nach Misserfolg werden solche Diskrepanzen nach der zweiten Modulationshypothese stärker vermutet. Diese Vermutung wurde auch in einer Untersuchung von Brunstein (2001) bestätigt. Lageorientierte zeigten eine geringere Übereinstimmung von basalen Motiven und der Entschlossenheit gerade in Bezug auf motivkongruente explizite Ziele als Handlungsorientierte. Das bedeutet für die Untersuchung der intrinsischen Motivation, dass bewusstseinspflichtige Motiv-Maße (Fragebögen) bei Lageorientierten, und wahrscheinlich generell bei Persönlichkeiten mit starker negativer Emotionalität, eher eine Inkongruenz zu den impliziten Motivmaßen zeigen, womit fremdbestimmtere Formen der Motivation wahrscheinlicher würden. Denn bei fremdbestimmten Regulationen wird ja von einer mangelnden Unterstützung des Handelns durch eigene Bedürfnisse ausgegangen, die introjizierte Regulation beispielsweise betont schon direkt die Existenz von Introjekten. So wäre die Konstellation denkbar, dass ein im Selbstbericht ermitteltes starkes Leistungsmotiv bei den oben benannten Persönlichkeitsstilen oder LOM durch ein zu geringes implizites Leistungsmotiv, oder die Kopplung desselben an die Funktion Empfinden, ständig untergraben wird, ohne dass dies der betreffenden Person bewusst wäre. Diese Diskrepanz würde sich möglicherweise durch Anspannung, Stress oder mangelnde Freude im Studium äußern.
1.2.4.5 Soziale Ängstlichkeit
Deci und Ryan haben sich bereits 1985 bei der Formulierung der Selbstbestimmungstheorie ebenfalls mit dem Zusammenhang von sozialer Ängstlichkeit und „impersonality orientation“ beschäftigt. Sie schreiben darüber:
“Finally, social anxiety would be expected to relate to one’s social ineffectiveness and thus, like public self-consciousness, to be related to the impersonal orientation. In fact, social anxiety and impersonality were very strongly correlated (r = .58)” (Deci & Ryan, 1985a, S. 169).
Dieser Bezug wird folgendermaßen erklärt: Die Impersonality-Orientierung geht, wie man sich vorstellen kann, mit einer mangelnden Erfahrung der Selbstwirksamkeit einher. Die Verbindung zum Konzept der erlernten Hilflosigkeit (Seligman, 1975), welche in Amotivation resultieren kann, wird von Deci und Ryan (1985a) ausdrücklich betont. Soziale Ängstlichkeit wiederum kann leicht in einen Teufelskreis der Selbstverstärkung münden, indem die Angst ständig die Erfahrung von Selbstwirksamkeit verhindert und so die Hilflosigkeit verstärkt. Bei sozialer Ängstlichkeit oder auch der ebenfalls mit erlernter Hilflosigkeit assoziierten Depression handelt es sich im Übrigen um Phänomene, die in der PSI-Theorie mit stark negativer oder mangelnder positiver Emotionalität (aufgrund starker oder chronischer Frustration) verbunden werden.
Eine zweite mögliche Erklärung für einen Zusammenhang von sozialer Ängstlichkeit und fremdbestimmter Regulationsform soll hier gegeben werden. Möglicherweise erklärt einfach die bei sozial unsicheren Menschen verstärkte Selbstbeobachtung und der damit verstärkte Druck, analog zum Effekt der Fremdbeobachtung, eine mögliche Korrumpierung der intrinsischen Motivation.
1.2.4.6 Demotivierung durch „pädagogische Kunstfehler“ in der Lehre
Unter der provokanten Überschrift „Sechs Möglichkeiten, Lernende zu demotivieren“ fasst Prenzel (1997) die „Strategien“ zusammen, mit denen Lehrende, i.d.R. selbstverständlich ungewollt, häufig eben gutmeinend, die Lernmotivation von Lernenden untergraben. Prenzel entwickelte seine Thesen vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985a, 1993). Nach Prenzel kommt es zu Demotivierung des Lernenden, wenn den Grundbedürfnissen nach Kompetenz, Selbstwirksamkeit und sozialer Eingebundenheit – also den nach der Selbstbestimmungstheorie unbedingten Kernvoraussetzungen für erlebte Selbstbestimmung – nicht Rechnung getragen wird. Zu den sechs Möglichkeiten, Lernende zu demotivieren, zählen nach Prenzel (1997):
1. das Verhindern von Autonomie im Lernprozess
2. mangelnde Struktur / Ziel- und Bedeutungstransparenz seitens des Lehrenden
3. eine schlechte Anpassung der Lehre an das Niveau der Lernenden durch Setzung „niedrigerer“ Lernziele (z.B. Faktenwissen, Grundfertigkeiten). Der Begriff „niedrig“ bezieht sich dabei nicht auf den Schwierigkeitsgrad, sondern auf die Qualität des Lernziels (im Unterschied zu „höheren“ Lernzielen wie Problemlösen und Verstehen).
4. fehlendes Zutrauen / mangelnde Kompetenzunterstützung
5. mangelnde soziale Einbindung der Lernenden sowie
6. mangelndes Interesse der / des Lehrenden selbst am Lehrinhalt.
Anhand von Fragebögen untersuchten Prenzel und Drechsel (1996) das Phänomen der Demotivierung in der kaufmännischen Erstausbildung und konnten dabei die genannten „Strategien“ beobachten.
Aus der bisherigen Forschungsliteratur gibt es viele Hinweise darauf, dass die in diesem Kapitel beschriebenen Faktoren Leistungskontrolle, Persönlichkeitsdisposition, Selbstkontrolle, motivationale Diskrepanzen, soziale Ängstlichkeit und schließlich die von Prenzel benannten Demotivierungsstrategien in der Lehre sich negativ auf das Erleben von Selbstbestimmung auswirken können. Diese Faktoren und ihre Wirkung auf die intrinsische Motivation im Studium sind Gegenstand meiner Untersuchung.
2 Methoden
2.1 Fragestellungen der Arbeit
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die intrinsische Motivation im Studium bei Grundstudiumsstudierenden der Psychologie. Viele der im theoretischen Teil der Arbeit berichteten Untersuchungen haben gemeinsam, dass sie die intrinsische Motivation – z.B. mit Hilfe des free-choice- Paradigmas – quasi in experimentellen Settings im Labor beobachteten. Auf methodische Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten, sie dagegen im Hinblick auf Alltagshandlungen wie das Bewältigen eines Studiums zu untersuchen, werde ich im folgenden methodischen Teil dieser Arbeit eingehen.
Anhand von Fragebögen sollen die Studienmotivation und verschiedene persönlichkeitspsychologische Faktoren zu einem Erhebungszeitpunkt auf ihre Zusammenhänge hin untersucht werden. Theoretischer Hintergrund ist neben der PSI-Theorie (Kuhl, 2001) die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985a), nach der es – nach dem Grad der empfundenen Selbstbestimmung – sechs unterscheidbare Formen von Regulation gibt:
1. Intrinsische Motivation
2. Integrierte Regulation
3. Identifizierte Regulation
4. Introjizierte Regulation
5. Externale Regulation
6. Amotivation
Dabei wird ein Kontinuum der erlebten Selbstbestimmung angenommen, auf dem sich die sechs Typen lokalisieren lassen: Intrinsische Motivation ist mit dem höchsten Grad an Selbstbestimmung verbunden, Amotivation mit dem geringsten. Verschiedene Studien differenzierten zwar unterschiedlich viele Formen von Motivation, konnten aber eine solche Kontinuumsstruktur bestätigen, so z.B. für den Bereich des leistungsbezogenen oder prosozialen Verhaltens von Kindern (Ryan & Connell, 1989), für die Beziehungsmotivation im Zusammenhang mit Partnerglück (Blais et al. 1990), oder eben auch für den Bereich Motivation im Studium (Vallerand et al., 1989).
Vallerand und seine KollegInnen stellten 1989 die von ihnen entwickelte Skala zur Motivation in der akademischen Ausbildung, die Échelle de motivation en éducation (EME) vor, die – wie auch die oben genannten Untersuchungen – auf der Selbstbestimmungstheorie basiert, allerdings sieben Motivationsformen erfasst (Vallerand et al., 1989). Die Skala differenziert dabei drei Formen der intrinsischen, drei der externalen Regulation und den Typ Amotivation. Die sieben Subskalen sind: 1. Amotivation („amotivation“), 2. Externale Regulation („regulation externe“), 3. Introjizierte Regulation („regulation introjectée“), 4. Identifizierte Regulation („regulation identifiée“), 5. Intrinsische Motivation der Wissenserweiterung / Lernmotivation („intrinsèque connaissance“), 6. Intrinsische Motivation der Selbstverwirklichung („intrinsèque accomplissement“), 7. Intrinsische Motivation des Erlebens / Flow („intrinsèque sensation“). Die integrierte Regulation wurde fallengelassen, da die untersuchten Studierenden nicht zwischen „identifizierter“ und „integrierter“ Regulation unterscheiden konnten. Die EME wurde vor dem Hintergrund des französisch-kanadischen Ausbildungssystems konzipiert und kann daher möglicherweise nicht ohne Einschränkung an einer deutschen Universität eingesetzt werden.
In Anlehnung an die oben genannten Studien wurde für die vorliegende Untersuchung der Fragebogen zur Studienmotivation (FSM) entwickelt, der die verschiedenen Motivationsformen im Studium erfassen soll. Beispiel-Items sind für die intrinsische Motivation „Ich studiere Psychologie,... weil ich mich gerne in psychologische Theorien hineindenke und sie weiterspinne“, für die introjizierte Regulation „...weil ich ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich das Studium abbrechen würde“ oder für die Amotivation „... weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst machen soll.“
Erstes Ziel der Diplomarbeit ist es, diesen Fragebogen zu validieren. Dazu soll zunächst überprüft werden, ob sich tatsächlich das angenommene Kontinuum auch in den Daten wiederfinden lässt. Näher beieinander liegende Motivationsformen sollten höher miteinander korrelieren als weiter entfernt liegende.
Selbstbestimmtere Formen der Motivation sollen nun mit bestimmten Variablen verbunden sein, die in ähnlichen Zusammenhängen bereits untersucht wurden und zu deren Erhebung ebenfalls ein neuer Fragebogen erstellt wurde, der Fragebogen zum Selbsterleben im Studium (FSS). Zu diesen Variablen gehören z.B. (gestiegenes) Interesse am Studium (Vallerand et al., 1989), wahrgenommene Kompetenz (Vallerand et al., 1989; Harackiewicz, 1979), Autonomieerleben (Deci & Ryan, 1987), Kreativität, kognitive Flexibilität (McGraw & McCullers, 1979). So gibt es viele Studien, die einen Zusammenhang von Kreativität und Selbstbestimmung nachweisen konnten (z.B. Sheldon, 1995; Koestner et al., 1984; Amabile, 1983; Mumford & Gustafson, 1988). Sheldons These, dass soziale und / oder intrapsychische Zwänge den Zugang zu den eigenen kreativen Ressourcen unterminieren können, wird ebenfalls von einer Osnabrücker Untersuchung zu Neurotizismus, Selbststeuerung und Kreativität gestützt (Biebrich & Kuhl, 2002). Kognitive Flexibilität kann als eine für den Lernprozess und –fortschritt wichtige Kompetenz angesehen werden, denn letztlich baut auf ihr die Fähigkeit zum Wissenstransfer auf. Stark und Mandl (2000) weisen darauf hin, dass das Transferproblem, das häufig traditionellen Instruktionsmethoden in Schule und Universität angelastet werde, nicht zuletzt stark mit Motivierungsproblemen zusammenhänge. Motivierungsprobleme könnten dabei sowohl Ursache als auch Konsequenz von Transferproblemen sein (Stark & Mandl, 2000). Winteler betont, dass eine Lernumgebung, die durch das Prinzip der Authentizität bestimmt ist und somit den Wissenstransfer erleichtern sollte, ebenfalls motivationsförderlich wirkt (Winteler, 2000). Deshalb soll in dieser Studie auch an Beispielen der Wissenstransfer als Indiz für kognitive Flexibilität erhoben werden. Weniger selbstbestimmte Motivationsformen sollen verbunden sein mit mehr Stress im Studium, Ängstlichkeit, Nihilismus, Konzentrationsschwierigkeiten, Unzufriedenheit und Gedanken, das Studium abzubrechen (Vallerand et al., 1989; Deci & Ryan, 1985a).
Diese Faktoren, die das Selbsterleben und den Umgang mit Schwierigkeiten im Studium prägen und die mit dem FSS erhoben werden sollen, sollten außer von der Motivationsform auch zu einem gewissen Grad von der Ausprägung des Leistungsmotivs und seiner bevorzugten Umsetzungsform abhängen.
Die Frage, ob Lebensphase und Geschlecht einen Einfluss auf die Motivationsform haben, soll in einem zweiten Schritt untersucht werden. Bezüglich der Lebensphase, womit gemeint ist, ob der / die Betreffende bereits vor dem Studium eine Ausbildung gemacht hat oder anderweitig erwerbstätig war im Unterschied zu Studierenden, die direkt von der Schule kommen, könnten bei letzteren eher fremdbestimmtere Formen der Motivation vermutet werden. Verschiedene Studien zeigen, dass im bundesdeutschen Schulsystem gerade die extrinsische Motivation „antrainiert“ wird, weshalb diese Motivationsform bei Schulabgängern womöglich noch verstärkt als normal empfunden wird. So beobachteten Köller et al. (1998) bei Schülern der siebten Jahrgangsstufe über die Zeitdauer eines Jahres allein eine prägnante Entwicklung weg von der Aufgabenorientierung hin zur Ichorientierung, wohingegen die entgegengesetzte Entwicklung quasi nicht vorkam. Auch Wild und Remy (2002) weisen darauf hin, dass bei Kindern bereits gegen Ende der Grundschulzeit die intrinsische Motivation zugunsten von fremdbestimmteren Motivationsformen nachlässt (vgl. auch Stark & Mandl, 2000). Diese Befunde deuten an, dass neben Faktoren im Elternhaus v.a. auch Sozialisationsbedingungen in der Schule dazu beitragen, die intrinsische Motivation nach und nach zu verdrängen. Bei vormals berufstätigen Studierenden kann dagegen vermutet werden, dass zumindest bei einem größeren Anteil von ihnen eine stärker reflektierte Entscheidung zum Verlassen der eingeschlagenen Bahn und ein Überwinden größerer Hindernisse nötig war, und dass somit die Entscheidung fürs Studium stärker aus den persönlichen Wünschen und Zielen unterstützt wird. Letztlich aber ist die Beziehung von Lebensphase und Motivationsform eine offene Frage, da hierzu noch keine Untersuchungen vorliegen.
Es soll weiterhin untersucht werden, ob es einen Zusammenhang von Geschlecht und Motivationsform gibt in der Art, dass Frauen evtl. häufiger selbstbestimmtere und Männer häufiger fremdbestimmtere Motivationsformen zeigen. Ein Befund, der in diese Richtung deutet, stammt aus der Studie zur Entwicklung der General Causality Orientations Scale (GCOS) von Deci und Ryan (1985b), in der die Kausalitätsorientierung von 234 männlichen und 278 weiblichen Studierenden untersucht wurde. Es zeigte sich, dass Frauen signifikant höhere Werte auf der Skala „Autonomie-Orientierung“ hatten und Männer signifikant höhere Werte auf der Skala „Kontroll-Orientierung“. Da diese Differenzen allerdings relativ gering ausfielen und es sich bei der GCOS um einen Fragebogen handelt, der Situationen aus sehr unterschiedlichen Lebensbereichen zur Beurteilung vorlegt, kann eine Hypothese zu Geschlechtsunterschieden in der Motivation im Studium nur sehr vage formuliert werden. Vallerand et al. (1989) fanden signifikante Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Psychologie-Erstsemestern hinsichtlich ihrer mit der EME ermittelten Motivationsformen. So zeigten Frauen höhere Werte auf den „intrinsischen“ Motivations-Skalen, aber auch auf der Skala „Introjizierte Regulation“. Männer hatten dagegen höhere Werte für „externale Regulation“ und „Amotivation“. Da allerdings diese Geschlechtsunterschiede nicht signifikant waren, ist bislang offen, ob es tatsächlich systematische Unterschiede in der genannten Form gibt.
Auf der Grundlage der Kuhl‘schen PSI-Theorie werden weiterhin persönlichkeitspsychologische „Killer“ der intrinsischen Motivation angenommen. Speziell die für eine Person typische Form der Umsetzung des Leistungsmotivs – etwa über das Empfinden – könnte interessante Aufschlüsse über Schwächen auf der motivationalen Ebene ergeben. Auf der Ebene der Persönlichkeitsstile sollten diejenigen Stile die intrinsische Motivation unterminieren, welche durch stärkere Sensibilität für negative Affekte gekennzeichnet sind. Auf der Ebene der kognitiven Grundfunktionen wird eine starke Bevorzugung der Denk- und der Empfindungsfunktion angenommen. Weiter wird angenommen, dass auf der Ebene der Selbststeuerung die mangelnde Ausprägung von Selbstregulationskompetenzen – im Kontrast zu einer Bevorzugung von Selbstkontrollstrategien – eine intrinsische Motivation blockieren kann, weil hier der Zugang zu den eigenen Interessen und Zielen erschwert ist. Zu diesen persönlichkeitspsychologischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der intrinsischen Motivation werden die folgenden von der Osnabrücker Persönlichkeitspsychologie entwickelten Verfahren zur Erfassung der Basismotive und der kognitiven Grundfunktion, des Persönlichkeitsstils und der Selbststeuerungskompetenzen verwendet: MUT-K15, OMT, PSSI-K und SSI-K.
In der Analyse soll zudem die möglicherweise destruktive Wirkung von Leistungskontrolle im Studium, speziell durch das in Osnabrück praktizierte Credit Point System (CPS) untersucht werden.[4] Da für eine Korrumpierung der intrinsischen Motivation durch externe Leistungskontrolle allerdings die individuelle Wahrnehmung und Bewertung der Kontrolle eine entscheidende Rolle spielen dürfte, wurde ein weiterer Fragebogen, der Fragebogen zur Leistungskontrolle im Studium (LKS), entwickelt, welcher die Einstellungen der Studierenden den verschiedenen Formen der universitären Leistungskontrolle gegenüber erfasst.
Schließlich ist im Zusammenhang mit der Selbstwirksamkeitserfahrung, der Grundvoraussetzung für intrinsische Motivation, die Frage der sozialen Kompetenz von Interesse. Deci und Ryan (1985) berichten von einem relativ starken Zusammenhang von sozialer Ängstlichkeit und der Impersonality-Orientierung (r = .58). Diese sich über verschiedene Lebensbereiche erstreckende Tendenz, Verhalten als in sehr geringem Maße selbst- oder auch fremdgesteuert anzusehen, kann nach der Selbstbestimmungstheorie als die Grundlage für Amotivation in einem konkreten Zusammenhang angesehen werden. Der berichtete Zusammenhang legt die Vermutung nahe, dass soziale Ängstlichkeit über die geringe Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit und eine wiederholte Frustration des Selbstwirksamkeitsbedürfnisses (White, 1959) die intrinsische Motivation einer Person unterminiert, wahrscheinlich sogar mit Amotivation einhergeht. Daher soll in dieser Arbeit die Verbindung von Motivationsform und sozialer Ängstlichkeit, gemessen mit dem Fragebogen Umgang mit Anderen (FUA) (van Dam-Baggen & Kraaimaat, 1999), untersucht werden.
Aus diesen sieben grob skizzierten Hauptfragestellungen (Validierung des FSM, biographische Variablen, Grundmotive, Persönlichkeitsstil, Selbststeuerungskompetenzen, Leistungskontrolle und soziale Ängstlichkeit) werden die weiter unten dargestellten Hypothesen abgeleitet.
2.2 Methodische Schwierigkeiten, intrinsische Motivation im Studium zu messen
Wie Ryan, Koestner und Deci (1991) zeigen konnten, ist es wichtig, bei der Operationalisierung des Konstruktes der intrinsischen Motivation die positive Korrelation von gezeigtem „freiwilligem“ Verhalten und berichteter Freude, Interesse und empfundener Wahlfreiheit als Indikator heranzuziehen. Insofern scheint die intrinsische Motivation im experimentellen Setting mit Hilfe von Verhaltensbeobachtung und anschließender Befragung der ProbandInnen relativ klar operationalisierbar und damit messbar zu sein.
Eine methodische Schwierigkeit ergibt sich aber bei der Untersuchung der intrinsischen Motivation im Studienalltag, welcher sich nicht so ohne weiteres beobachten lässt. Hier ist man als UntersucherIn in erster Linie auf Selbstbeschreibungen der ProbandInnen angewiesen. Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnte darin bestehen, weitere Variablen wie Interesse, Wahlfreiheit und Freude im Studium heranzuziehen, weil dies, wie bei Ryan et al. (1991) gesehen, entscheidend ist, um eine Motivation auch sicher als intrinsisch identifizieren zu können. Die genannten Kriterien sollen in der vorliegenden Studie in einem weiteren selbstkonstruierten Fragebogen, dem FSS, zusammen mit anderen Variablen erfragt werden, um somit dieser ersten methodischen Schwierigkeit zu begegnen.
Des Weiteren kann möglicherweise das Problem der sozialen Erwünschtheit auftreten, wobei es ProbandInnen als opportun erscheinen mag, die Motivation für das eigene Studium im Interesse zu verorten und weniger in späteren Verdienstmöglichkeiten oder dem Wunsch der Eltern, dass „doch noch etwas aus einem werden soll“. Hierzu sei allerdings auf zwei Studien hingewiesen, die den Einfluss von sozialer Erwünschtheit auf die gemachten Angaben zur Motivation bzw. zur Kausalitätsorientierung untersucht haben. In einer Studie zur Messung der Kausalitätsorientierung fanden Deci und Ryan (1985b) jedoch keine Beziehung zwischen der Tendenz zu sozialer Erwünschtheit und der jeweiligen Kausalitätsorientierung der betreffenden Person. Mit anderen Worten: Die Neigung, sozial erwünschtes Verhalten zu zeigen, hatte keinen signifikanten Einfluss auf den Grad der selbstberichteten Autonomie-Orientierung, diejenige Orientierung, die als die am meisten sozial erwünschte angesehen werden kann. Und auch in einer Studie von Sabourin und Blais (1989) (zitiert nach Blais et al., 1990) wurde kein nennenswerter Zusammenhang zwischen der Tendenz zur Selbst- oder Fremdtäuschung und der angegebenen Motivation, die eigene Paarbeziehung aufrecht zu erhalten, festgestellt. Aus diesem Grund soll in der vorliegenden Studie auf eine zusätzliche Belastung der UntersuchungsteilnehmerInnen durch weitere Fragebögen zur sozialen Erwünschtheit verzichtet werden.
Ein weiteres methodisches Problem betrifft die Bewusstseinspflichtigkeit der Informationen, die in einem Fragebogen gegeben werden: Können Menschen immer ganz klar sagen, warum sie so handeln wie sie es tun? Als nur ein Beispiel für mögliche diesbezügliche Fehlerquellen soll das Problem der fehlinformierten Introjektion fremder Ziele oder Handlungen kurz erläutert werden: Kuhl und Kazén (1994) untersuchten in einer Studie zur fehlinformierten Introjektion die Neigung, fremde Ziele und Aufträge im Nachhinein irrtümlich als selbstgewählt wahrzunehmen. Es zeigte sich, dass dieser Fehler häufiger bei Personen mit der Tendenz zu unkontrollierbarem Grübeln nach Misserfolgen oder anderen negativen Erlebnissen (Lageorientierung nach Misserfolg) auftritt. Vom Versuchsleiter in einem Rollenspiel zum Büro-Alltag zugewiesene Aufgaben wurden von bestimmten ProbandInnen im Nachhinein als selbstgewählt bezeichnet. Und zwar trat dieser Effekt zum einen bei ProbandInnen der genannten persönlichen Disposition auf, zum andern, wenn es aufgrund der experimentellen Manipulation zu einer Belastung des Absichtsgedächtnisses kam. In der PSI-Theorie (Kuhl, 2001) werden, wie bereits gesehen, bestimmte Annahmen gemacht, bei welchen Persönlichkeitsstilen und unter welchen Umweltbedingungen es verstärkt zu solch einem erschwerten Zugang zu den eigenen Selbstrepräsentationen, also zu Unsicherheit über die eigenen Wünsche und somit auch beispielsweise über die eigene Motivation im Studium kommen kann. Dies könnte also zu Verzerrungen in den bewusstseinspflichtigen Antworten im benutzten Fragebogen zur Studienmotivation (FSM) führen.
Der OMT, der als projektives Verfahren Auskunft über nicht bewusstseinspflichtige Motive, affektive Disposition und kognitiven Stil einer Person gibt, wurde u.a. deshalb in der vorliegenden Untersuchung eingesetzt, um dem letztgenannten Problem zu begegnen, indem hiermit eventuelle Diskrepanzen zwischen expliziten Zielen und wichtigen „eigentlichen“ Grundmotiven einer Person aufgedeckt werden können. So wird nach der PSI-Theorie angenommen, dass bei Persönlichkeitsstilen mit ausgeprägter negativer Emotionalität der Zugang zu den eigenen Selbstrepräsentationen erschwert ist, was die beschriebenen Ich-Trübungen wahrscheinlicher macht. Wo also starke Diskrepanzen zwischen bewussten und unbewussten Zielen – gerade im Zusammenhang mit dem Leistungsmotiv – vorliegen, könnten diese die Stärke der vorhergesagten Zusammenhänge etwa von berichteter selbstbestimmter Motivation und positiven Emotionen im Studium mindern.
2.3 Verwendete Instrumente:
2.3.1 FSM (Fragebogen zur Studienmotivation)
Der Fragebogen zur Studienmotivation (FSM) wurde für diese Studie auf der Basis der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985a) entwickelt, um die in diesem Ansatz postulierten sechs Formen von Motivation in Bezug auf das Studium zu erfassen. Anhand der aus der Theorie abgeleiteten Differenzierungsmerkmale zwischen den sechs verschiedenen Motivationsformen (s. Tabelle 1.2, S. 21, im Theorieteil dieser Arbeit) wurden zu jeder der sechs Motivations-Skalen vier Items formuliert mit Ausnahme der Skala „identifizierte Regulation“, die aus zwei Items bestand (Die Items des Fragebogens befinden sich im Anhang, Kapitel A.1, S. i). Anregungen für Itemformulierungen stammen ebenfalls aus der Échelle de motivation en éducation (EME) von Vallerand et al. (1989), der auch vier Items entnommen sind (genaue Angaben hierzu s. Anhang).
Die UntersuchungsteilnehmerInnen sollen auf einer vierstufigen Likert-Skala (von „trifft gar nicht zu“ über „trifft etwas zu“, „trifft überwiegend zu“ bis „trifft ausgesprochen zu“) angeben, inwieweit sie jedem der 22 Items in der Form von Selbstaussagen bezüglich der Motivation für ihr Psychologiestudium zustimmen können.
Zur Auswertung wird für jede Skala ein Rohwert berechnet. Dieser Skalen-Rohwert ergibt sich aus der Summe der zugehörigen Item-Werte (0 = trifft gar nicht zu; 1 = etwas; 2 = überwiegend; 3 = ausgesprochen).
Tabelle 2.3 gibt die für die vorliegende Stichprobe berechneten Cronbachs Alphas der sechs Skalen wieder:
Tabelle 2.3: Reliabilitäten der Original-FSM-Skalen (N = 50).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Da im Rahmen dieser Diplomarbeit der FSM nicht im Vorfeld erprobt und hinsichtlich seiner Gütekriterien verbessert werden konnte, war auch nicht unbedingt auf Anhieb mit zufriedenstellenden Reliabilitäten zu rechnen. Da einzelne Skalen jedoch ein Alpha z.T. weit unter .70 hatten, wurde entschieden, eine bessere Skalenlösung mittels Faktorenanalyse zu finden. Dies geschah mit dem Ziel, eine höhere Konsistenz der einzelnen Skalen zu erzielen, sofern sich solche Veränderungen in der Itemzuordnung von der Theorie her rechtfertigen ließen. Es wurde also ein kombiniertes Vorgehen aus theoretischer und empirischer Skalenkonstruktion gewählt.
Folgende Kriterien für die Skalenkonstruktion mittels Faktorenanalyse wurden formuliert:
Die mittels Faktorenanalyse ermittelte Faktorlösung sollte genügend Gesamtvarianz aufklären (mind. 65 %).
Inhaltliche Validität der Skalen sollte gewährleistet bleiben, d.h. die Anzahl der Abweichungen zwischen den theoretisch begründeten Originalskalen und den faktorenanalytisch ermittelten sollte begrenzt sein und die Abweichungen sollten begründbar und inhaltlich vertretbar sein.
Die resultierenden Skalen sollten hinreichend konsistent sein (neue Alphas: > .70).
Die Faktorenanalyse für den FSM wurde berechnet unter der Bedingung, dass die Eigenwerte größer als 1 sein sollten, und es ergaben sich nach Rotation bei einer Gesamtaufklärung der Varianz von 69% sieben Faktoren.
Die neu entstandenen sieben Skalen des FSM sehen folgendermaßen aus (s. Tabelle 2.4):
[...]
[1] Antwort der Untersuchungsteilnehmerin Ma37, 20 Jahre, 2. Semester. Gefragt war nach Verbesserungsvorschlägen: „Wie würdest Du das Studium umgestalten, damit es für Dich (noch) interessanter würde? Würdest Du es überhaupt im Wesentlichen ändern wollen?“ Während diese Studentin zu den Themen Seminare, Vorlesungen, empfohlene Literatur, technische Ausstattung des Fachbereichs / der Uni und Prüfungsordnung keinerlei Kritik hatte, fiel diese vergleichsweise längere Aussage schon ins Auge, zumal davon ausgegangen werden kann, dass in diesem Fall nicht das Problem der mangelnden Interessantheit des Studiums im Vordergrund stand.
[2] Eine differenzierte Darstellung der Konstrukte „intrinsische“ und „extrinsische“ Motivation erfolgt noch in Kapitel 1.2.
[3] Die Lernstrategie konnte diesen Zusammenhang von Interesse und Studienerfolg im Übrigen nicht erklären (Schiefele et al., 1995; vgl. auch Entwistle & Entwistle, 1991, die aufgrund von Interviews zu ähnlichen Ergebnissen kamen, dass nämlich für eine gute Zensur das Reproduzieren des in der Vorlesung gehörten ausreichte).
[4] Wie sich indes mittlerweile abzeichnet, wird dieses System, das es den Studierenden ermöglicht, bereits ab dem ersten Semester Vorzensuren für die Prüfungen zu erwerben, und das damit eben möglicherweise einen extrinsischen Anreiz darstellen könnte, von den wenigsten Studierenden überhaupt bewusst praktiziert. Wie mir von vielen der UntersuchungsteilnehmerInnen bestätigt wurde, liegt dies zum einen an der mangelnden Information über das System, zum andern daran, dass sich offenbar nur sehr wenige DozentInnen an dem System beteiligen.
- Arbeit zitieren
- Martina Karrasch (Autor:in), 2003, Selbst- und Fremdbestimmung im Studium. Eine Untersuchung zur intrinsischen Motivation und ihren persönlichkeitspsychologischen Korrelaten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25418
Kostenlos Autor werden

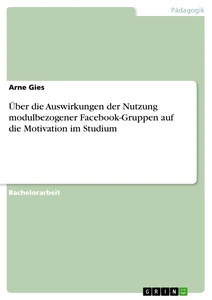
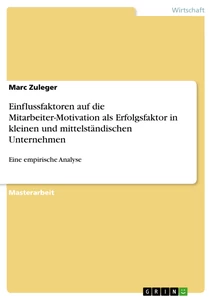


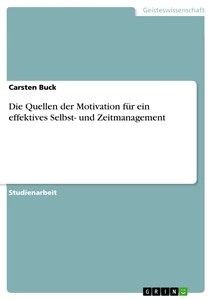



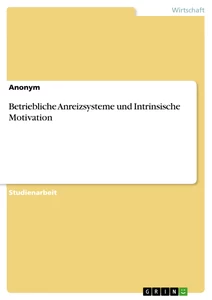




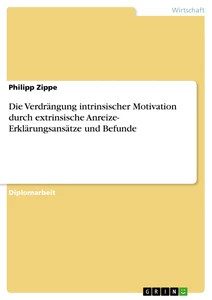


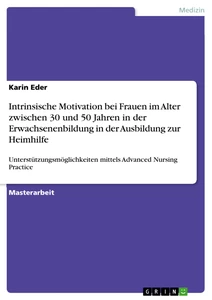


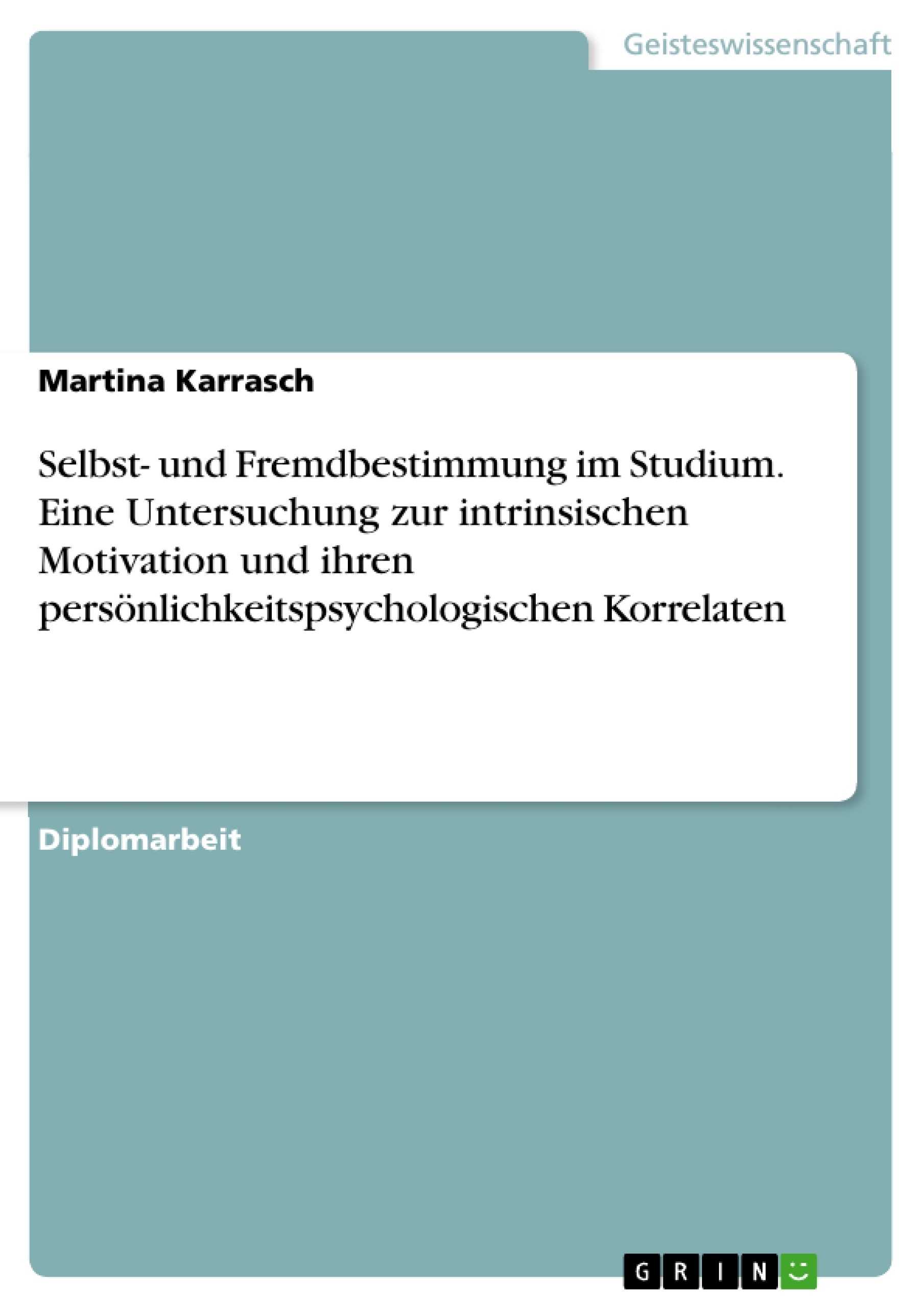

Kommentare