Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit
2.1 Kulturelle Aspekte der ‘Mündlichkeit - Schriftlichkeit’
2.1.1 Problematik der Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich geprägten Kulturen
2.1.2 Kulturelle Auswirkungen der Mündlich- bzw. Schriftlichkeit
2.2 Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Mittelalter
2.2.1 Schriftkundige im Mittelalter
2.2.2 Rolle der Schrift im Mittelalter
2.2.3 Versuch der Einordnung der mittelalterlichen Kultur als mündlich oder schriftlich geprägt
3 Schriftlichkeit und Recht im Mittelalter
3.1 Recht in der mündlichen Tradition
3.1.1 Quellenproblematik
3.1.2 Rechtsverständnis und Rechtsfindung
3.2 Verschriftlichung des Rechts
3.2.1 Unterscheidung zwischen schriftlichem und verschriftlichtem Recht
3.2.2 Gründe und Auswirkungen der Verschriftlichung alten Rechts
3.2.3 Der Sachsenspiegel: Schriftliches oder verschriftlichtes Recht
4 Schriftlichkeit und Rechtssituation in den Städten
4.1 Pragmatische Schriftlichkeit und Rechtsbedürfnisse in der mittelalterlichen Stadt
4.1.1 Gründe für die entstehende pragmatische Schriftlichkeit in der Stadt
4.1.2 Die Bedeutung der Schrift für die Befriedigung städtischer Rechtsbedürfnisse
4.2 Adaptionen und Rechtssetzungen in mittelalterlichen Stadtrechten
4.2.1 Adaption des Sachsenspiegels in den Stadtrechten
4.2.2 Adaption des gelehrten römisch-kanonischen Rechts mittels des Sachsenspiegels
4.2.3 Rechtsschöpferische Leistungen der Städte
5 Fazit
6 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Bei der Beschäftigung mit dem Thema ‘Rechtssprichwörter’, über das ich mein Referat im Rahmen des Seminars ‘Konflikt, Verbrechen und Sanktionen in der mittelalterlichen Stadt’ hielt, stieß ich durch den folgend kurz wiedergegebenen Gedankengang auf eine interessante Frage. Da Rechtssprichwörter sich als ‘Sprichwörter mit rechtlichem Inhalt’ bzw. ‘Rechtsregel mit sprichwörtlichem Charakter’ auffassen lassen, mußte eine Bestimmung, worin der ‘sprichwörtliche Charakter’ besteht, erfolgen. Als Kennzeichen eines Sprichwortes wurden herausgearbeitet, daß es sich um einen formal abgeschlossenen, kurzen, prägnanten Satz handelt, der zumeist stilistische Merkmale wie Stabreime, Endreime, Parallelismen oder Oppositionen aufweist. Diese Stilmittel tragen dazu bei, daß man das Sprichwort leichter im Gedächtnis behalten kann. Ich führte dementsprechend aus, daß Rechtssprichwörter im Mittelalter dazu dienten, daß sich die im konkreten Rechtsstreit Urteilssuchenden an die allgemeine Rechtsprinzipien enthaltenden Sprichwörter erinnern und an ihnen orientieren konnten. Abschließend mußte ich jedoch feststellen, „[...] daß die Verwendung der Rechtssprichwörter sich im Laufe des Mittelalters allmählich wandelte, sie immer seltener und nur noch als Beleg herangezogen wurden. Denn durch das Aufschreiben des Geurteilten wurde ein Rückgriff auf schon früher entschiedene Fälle möglich. Man konnte nachschauen (bzw. nachschauen lassen), zu welchem Urteil man in einem ähnlichen Rechtsstreit gekommen war. Die Einschränkung der Funktion des Rechtssprichwortes erfolgte auch im Zusammenhang mit der Anfertigung privater Aufzeichnungen der üblichen Rechtsprechung durch einzelne Rechtskundige, die zu einer Art formalem Recht wurden.“ Im Rahmen des Referates konnte ich nicht genauer auf den Funktionswandel der Rechtssprichwörter bewirkenden, umfassenderen Wandel des Rechts eingehen. Die Frage nach den Auswirkungen der Verschriftlichung des Rechts auf das allgemeine Rechtsverständnis, mußte zunächst unbeantwortet bleiben. Dennoch lag die Vermutung nahe, daß es durch eine weitere Verbreitung der Schriftlichkeit zu Veränderungen im Umgang mit dem Recht kam und daß vielleicht auf diese Weise die großen Veränderungen im städtischen Bereich erklärbar sind, wo - entgegen der sonstigen mittelalterlichen Gewohnheit - Recht rational gesetzt und bewußt gestaltet wurde, denn Städte sind die Orte, an denen die Schriftlichkeit (außerhalb des klerikalen Bereichs) am weitesten verbreitet war. Innerhalb dieser Arbeit soll nun untersucht werden, ob die sich aus den vorherigen Ausführungen ergebende ad-hoc-These, daß der Wandel im städtischen Recht durch das Aufkommen der pragmatischen Schriftlichkeit erfolgte, auch bei eingehenderer Betrachtung haltbar bleibt.
Das Thema könnte man auf verschiedenen Wegen untersuchen, in den Mittelpunkt der Betrachtung soll aber der mentalitätsgeschichtliche Aspekt gerückt werden: Weder die theoretischen Ansichten der Gelehrten noch die tatsächliche Rechtswirklichkeit sollen betrachtet werden, sondern es soll stattdessen versucht werden, die beim mittelalterlichen Menschen allgemein üblichen, idealen Vorstellungen vom Recht, seinem Geltungsgrund und seiner Bestimmung zu finden und den Wandel im Laufe des Mittelalters zu erklären. Eine zeitliche Eingrenzung (außer der Begrenzung auf das Mittelalter) kann deswegen nur schwer erfolgen, da zur dargestellten Zielsetzung eine zeitlich übergreifende Darstellung erforderlich scheint. Räumlich soll jedoch zunächst eine relativ willkürliche Beschränkung auf die größte Ausdehnung des Frankenreiches erfolgen. Später erscheint eine Konzentration auf den norddeutschen Raum sinnvoll, weil hauptsächlich in diesem Gebiet die Rezeption des Sachsenspiegels beobachtbar ist. Die ebenfalls sehr starke Übernahme des Sachsenspiegels im Raum der deutschen Osterweiterung bleibt dabei jedoch unberücksichtigt, da dieses Gebiet nicht zum alten Frankenreich gehörte. Verbleibt noch die Erklärung der Beschränkung der Arbeit auf die pragmatische Schriftlichkeit, die aus der Überlegung resultiert, daß das Rechtssetzungen rational erfolgen, also nicht im Zusammenhang mit mystischen, sakralen, sondern mit weltlichen, praktischen Vorstellungen stehen. Wenn sich also die Vermutung, daß der Schrift eine entscheidende Rolle beim Wandel des Rechts in Richtung der Rechtssetzung zukam, bestätigt, dann kann es sich dabei nur um pragmatisch verwendete Schrift gehandelt haben.
Der grundsätzliche Aufbau der Arbeit spiegelt die gewählte Vorgehensweise wider, die in einer zunehmenden Verengung des Betrachtungsgebietes besteht. So wird im ersten Teil des zweiten Kapitels zunächst allgemein auf die Frage der Auswirkungen der Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit auf eine Kultur eingegangen, bevor im zweiten Teil dieses Kapitels der Übergang zum Mittelalter erfolgt. Anschließend wird (in Kapitel 3) der Zusammenhang zwischen Schriftlichkeit, Mündlichkeit und Recht in den Mittelpunkt der Untersuchung gestellt, alle anderen kulturellen Auswirkungen bleiben ausgeblendet. Im letzten Kapitel findet eine Verengung auf den städtischen Bereich statt. Die Wahl und die Reihenfolge der zu untersuchenden Aspekte muß zum einen der grundsätzlichen Vorgehensweise entsprechen, zum anderen den darzustellenden Zusammenhängen und verwendeten Methoden gerecht werden.
So wird als Methode der Untersuchung für das 3. Kapitel der Analogieschluß gewählt, weil, wie im Kapitel 3.1.1 zum Ausdruck kommen soll, ein direkter Zugang zum ursprünglichen, mittelalterlichen Recht aus der Quellenproblematik heraus schwierig ist. Um aber unzulässige interkulturelle Vergleiche und Analogieschlüsse zu vermeiden, muß vorab eine Prüfung der Übereinstimmung der Vergleichsobjekte erfolgen. Nachdem also im Kapitel 2.1 anhand modernerer Forschungen grundsätzliche Eigenschaften mündlich geprägter, in ihrer Abweichung von schriftlich geprägten direkt (weil zeitgenössisch) zu untersuchender Kulturen herausgearbeitet sind, muß notwendigerweise erst eine Einordnung des Mittelalters in die Bereiche mündlich oder schriftlich geprägter Kulturen erfolgen (Kapitel 2.2.3), bevor die Erkenntnisse aus dem Kapitel 2.1.2 auf das Mittelalter übertragen werden können. Zur Ermöglichung dieser Einordnung dient eine ausführliche Beschäftigung mit den Fragen, wer im Mittelalter lesen und schreiben konnte (Kapitel 2.2.1) und welche Rolle der Schrift zukam (Kapitel 2.2.2)
Da sich der Sachsenspiegel, als erste Verschriftlichung des geltenden Rechts in deutscher Sprache, als möglicher Übergang vom Mündlichen zum Schriftlichen greifen läßt, soll ihm in dem Teil der Arbeit, der sich dem Zusammenhang zwischen Schriftlichkeit und Recht zuwendet, besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Dabei soll zuerst geklärt werden, ob es sich bei ihm wirklich ‘nur’ um verschriftlichtes Recht handelte und welche Beweggründe zu seiner Abfassung geführt haben könnten (Kapitel 3.2.3). Voraussetzung dafür ist eine Erklärung des grundsätzlichen Unterschiedes zwischen ‘schriftlichem’ und ‘verschriftlichtem’ Recht, die in Kapitel 3.2.1 erfolgen soll, wo auch in Abgrenzung zum heutigen Sprachgebrauch auf das mittelalterliche Verständnis von ‘geschrieben recht’ eingegangen werden soll. Weiterhin dürfen auch die in fränkischer Zeit erfolgten Niederschriften der Volksrechte nicht völlig unerwähnt bleiben, deren begrenzte Auswirkung im Kapitel 3.2.2 verständlich gemacht werden soll. Hauptthema soll jedoch - aufgrund der am Ende des Referates geäußerten Behauptung (s.o.), daß die Rechtsaufzeichnungen zu einer Art formalem Recht wurden - der Umgang der Städte mit dem Sachsenspiegel sein, weshalb das Kapitel 4.2.1 sich damit beschäftigt. In Kapitel 4.2.2 sollen dann die Folgen des Einsatzes des Sachsenspiegels in der Rechtsprechung der Städte für die Adaption des römischen kanonischen Rechts Beachtung finden.
Am Ende des Darstellungsteils (Kapitel 4.2.3) wird sich wieder vom engeren Untersuchungsgegenstand Sachsenspiegel gelöst und den rechtsschöpferischen Leistungen der Städte zugewandt. Wichtige Vorarbeit dazu leistet die Feststellung entstehender, spezieller Rechtsbedürfnisse der städtischen Bevölkerung, die im Zusammenhang mit den Fragen, weshalb es gerade in der Stadt zu einer Zunahme der Schriftlichkeit kam (Kapitel 4.1.1) und welche Möglichkeiten die Schrift zur Befriedigung der Rechtsbedürfnisse bot (Kapitel 4.1.2), behandelt werden soll.
Eine Liste der verwendeten Literatur findet sich am Ende der Arbeit. In den Fußnoten erfolgt der Nachweis stets als Kürzel aus Verfassernamen und Jahreszahl, diese sind zur schnelleren Auffindung im Literaturverszeichnis fett hervorgehoben.
Die Literatur wurde über die Fußnotenapparate der zur Erstellung des Referates herangezogenen Aufsätze und Werke, der auf diese Weise zuerst ermittelten, sowie der im Seminar verteilten Texte gesucht. Die sonst übliche Recherche mittels der IBHZ konnte unterbleiben, da schon auf die genannte Weise eine derartige Fülle an Literatur zusammen kam, daß eine weitere Suche unnötig erschien, weil ohnehin nur ein begrenzte Auswahl direkte Verwendung finden konnte. Aufgrund der Vielzahl der Texte kann an dieser Stelle nicht jedes, jeweilige Kriterium, das zur Auswahl führte, genannt und erläutert werden. Eine Begründung soll deshalb nur für die Verwendung der Texte von Fritz Kern erfolgen, da diese - 1916 bzw. 1919 verfaßt - deutlich aus dem Entstehungszeitraum der anderen Texte herausfallen. Es erscheint aber eine Kontrolle des Analogieschlusses von heutigen Kulturen auf die mittelalterliche Vorstellungswelt sinnvoll, wozu nur eine Arbeit herangezogen werden kann, die nicht von den ethnologischen Untersuchungen Jack Goodys beeinflußt sein kann. Das sicherste Auswahlkriterium, um diese Unabhängigkeit zu garantieren, ist die Wahl eines zeitlich früher entstandenen Textes.
2 Von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit
2.1 Kulturelle Aspekte der ‘Mündlichkeit - Schriftlichkeit’
2.1.1 Problematik der Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich geprägten Kulturen
Die erste Problematik bei der Unterscheidung zwischen mündlich und schriftlich geprägten Kulturen entsteht schon bei der Verwendung der Begrifflichkeiten ‘mündlich’ und ‘schriftlich’. Häufig werden diese Adjektive nur medial verstanden, d.h. ‘mündlich’ als Weitergabe von Informationen mittels des phonetischen, bzw. ‘schriftlich’ als Weitergabe mittels des graphischen Mediums. Zur Mündlichkeit gehört damit die Verknüpfung Sprechen-Hören, zur Schriftlichkeit die Verknüpfung Schreiben-Lesen, die als gleichwertige Entsprechungen aufgefaßt werden. Diese Reduzierung der Begrifflichkeiten auf einen rein medialen Unterschied reicht bei der Betrachtung von Kulturen jedoch nicht aus, es muß vielmehr auf die mit der Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit einhergehenden Unterschiede eingegangen werden.1 Dazu soll später das Kapitel 2.1.2 dienen. Um die erkannte Problematik der Reduzierung auf den rein medialen Unterschied zu vermeiden, werden in vielen Texten, die sich mit Kulturvergleichen beschäftigen, die künstlich geschaffenen deutsch-lateinischen Begriffe ‘oral’ und ‘literal’ eingeführt. Sie orientieren sich an den interdisziplinären Termini der englischsprachigen Forschung ‘orality’ und ‘litteracy’. ‘Orality’ bezieht sich dabei vorrangig auf einen Kulturzustand, ‘littaracy’ dagegen findet mehr Gebrauch im Zusammenhang mit kulturpolitschen Überlegungen.2 Die Verwendung neuer Begrifflichkeiten ist jedoch überflüssig, wenn ein Bewußtsein der Problematik und der daraus resultierenden Notwendigkeit eines Verständnisses im weiteren Sinne vorliegt. Man kann also statt dessen das Bezugsfeld der bestehenden Begriffe erweitern: Im folgenden sollen ‘Mündlichkeit’ und ‘Oralität’ als Synonyme verwendet werden und besagen, daß Denkweisen der mündlichen Tradition folgen, während ‘Schriftlichkeit’ und ‘Literalität’ auf durch die Möglichkeit zur schriftlichen Fixierung veränderte Vorstellungsräume hinweisen.
Nun ist es jedoch so, „[...], daß in einer Kultur, die ihre eigene Schrift entwickelt oder in der die Schrift als ›Import‹ erst seit relativ kurzer Zeit existiert, weite Gebiete von der Schrift bzw. der Schriftlichkeit (noch) nicht tangiert sind.“3 Jack Goody fragt deshalb, „[..] welche determinierende Kraft der Literalität beizumessen ist und welcher Grad der Fähigkeit zu lesen und zu schreiben in einer bestimmten Gesellschaft »funktional« ist.“4 Es geht darum, wie hoch der Prozentsatz der Schriftkundigen einer Kultur sein muß, die man als schriftlich geprägte Kultur betrachten kann. Die dabei vorab zu klärende Frage besteht in der genauen Abgrenzung zwischen ‘schriftkundig’ und ‘schriftunkundig’. Reicht es aus , lesen zu können, oder muß auch das Schreiben beherrscht werden, damit man als ‘schriftkundig’ anerkannt werden kann. Zumindest in einer Erhebung der United Nations zur Erfassung der Bildungsniveaus der einzelnen Länder, wurden 1995 all diejenigen, die nur lesen und nicht schreiben konnten, zu den Analphabeten gezählt.5 Das könnte damit zusammenhängen, daß die moderne Alphabetisierung zumeist im Rahmen von Entwicklungs- förderungen schon extrem schriftlich geprägter Kulturen von außen erfolgt. Es handelt sich dabei um „[...]
»kolonialisierende Importe von Schriftlichkeit« [...,] die Ausbreitung pragmatischer Schriftlichkeit, die sich aller nur erdenklichen Gebiete des kulturellen Lebens bemächtigen kann. Idealiter soll dort der Erwerb der Lese- und Schreibfähigkeit einen emanzipatorischen Effekt haben.“6 In den modernen schriftlich geprägten Kulturen „[...] lernt man stets gleichzeitig Lesen und Schreiben.“7 Um sich in einer modernen, schriftlich geprägten Kultur erfolgreich behaupten zu können, ist die Beherrschung von beidem sicherlich auch notwendig. Voreilige Analogieschlüsse auf Kulturen, in denen noch mündliche Traditionen vorherrschen und die Schriftlichkeit erst allmählich Fuß faßt, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Dort kann die Befähigung zum Lesen und Schreiben häufig sicherlich nur in ganz begrenzten Anwendungsfällen direkten Nutzen bringen, oft wird dabei auch schon die alleinige Lesebefähigung ausreichen. Im folgenden soll ‘schriftkundig’ deshalb im wörtlichen Sinne Verwendung finden, als Bezeichnung von jemandem, der Schrift kennt und zu deuten vermag. Nachdem dies geklärt ist, muß jedoch weiterhin festgestellt werden, daß die Bestimmung des Prozentsatzes der Schriftkundigen in einer Kultur wenig hilfreich ist bei der Einordnung einer Kultur als schriftlich bzw. mündlich. So führt Jack Goody aus, daß es eine wichtige Klasse von „»traditionalen« Gesellschaften [...gibt,] die nicht nur über eine Schrift, sondern über eine alphabetische Schrift [...verfügen], in der die Folgen der Literalität nur teilweise entwickelt sind und in der die mündliche Überlieferung in potentiell literalen Bereichen weiterhin eine beherrschende Rolle spielt.“8 Und Ursula Schaefer beobachtet dementsprechend, „[...] daß auch dort, wo nach der Einführung Schrift und Schriftliches benutzt werden, es einige Zeit dauert, bis Denkweisen und Denkstrukturen, Diskursformen und Diskursorganisationen, die typisch sind für die primäre Mündlichkeit, gänzlich auch im Schriftlichen selbst von solchen der Schriftlichkeit verdrängt sind.“9
Das nächste Problem beruht auf einem gängigen Vorurteil. So setzen - laut Jack Goody - Sozialwissenschaftler „[...], die in »fortgeschrittenen« Gesellschaften arbeiten, [...] das Vorhandensein von Literalität, d.h. die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, als selbstverständlich voraus [...].“10, während Sozialanthropologen der Ansicht sind, „[...] ihre Disziplin beschäftige sich mit »präliteralen«, »primitiven« oder »Stammes«-Gesellschaften, und [...] die Schrift (wo sie beherrscht wird) im allgemeinen einfach als ein »eingedrungenes« Element“11 betrachten. Es erfolgt bei dieser Klassifizierung offensichtlich eine simple Gleichsetzung der Attribute ‘lese- und schreibkundig’ mit ‘fortschrittlich’ und ‘nicht lese- und schreibkundig’ mit ‘primitiv’, die auf die Auffassung der „[...] Oralität [...] als ein Negativum, eben als Schrift losigkeit, und damit als ein Mangel, [...]“12 zurückführen läßt. So wird heute jemand, der des Lesens und Schreibens unkundig ist, als Analphabet bezeichnet, welches - wie Herbert Grundmann feststellt - „[...] eine geringschätzige-negative Bedeutung [hat,] wie etwas, was zumindest bei Kulturvölkern garnicht mehr vorkommen dürfte, eine Anomalie oder eine rückständige Erscheinung primitiver Völker und Zeiten.“13
Hierbei wird deutlich, daß bei Kulturvölkern eine allgemeine Lese- und Schreibfähigkeit erwartet wird, Kultur geradezu von Schriftlichkeit abhängig erscheint. Entgegen dieser verbreiteten Ansicht fragt Hanna Vollrath, „[...] ob nicht Mündlichkeit selbst konstitutiv für Kultur ist, nämlich für eine eigene, eben durch Oralität geprägte Kultur [...]“14. Entsprechend regt sie zu der Überlegung an, ob „[...] der Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit nicht als ein bereichernder Zuwachs an Bildungsgütern, sondern als ein Kulturbruch zu verstehen ist, der alle Lebensbereiche erfaßt.“15
2.1.2 Kulturelle Auswirkungen der Mündlich- bzw. Schriftlichkeit
Im vorherigen Kapitel wurde darauf hingewiesen, daß sich die Unterscheidung zwischen ‘mündlich’ und ‘schriftlich’ nicht nur darauf bezieht, welches Medium vorrangig zum Informationsaustausch verwendet wird, sondern daß mit dem Wechsel des Mediums eine Reihe kultureller Folgen verbunden ist.
So muß man zunächst feststellen, „[...] daß für die schriftliche Kommunikation gilt: »The meaning is in the text«, für die mündliche: »The meaning is in the context«.“16 Dadurch, daß bei einer schriftlichen Fixierung der Kontext verloren geht, ist zur Erhaltung der Verständlichkeit des Geäußerten ein anderer Umgang mit der Sprache erforderlich als im direkten, mündlichen Austausch. Zunächst einmal fehlen die Möglichkeiten der Mimik, Gestik und Betonung, dann müssen zusätzlich zeitliche und örtliche Einordnungen erfolgen und indexikalische Wörter mit eindeutigen Bezügen ausgestattet werden. Die schriftliche Form erfordert also - ganz allgemein -„[...] einen höheren Aufwand an Versprachlichung, um das Gelingen der Kommunikation zu sichern.“17 Mit der Verschriftlichung muß zudem auch eine gewisse Abstraktionsfähigkeit entwickelt werden, insofern „[...] daß die Schrift eine neue Art der Beziehung zwischen dem Wort und dem Gegenstand, auf den es sich bezieht, herstellt - eine allgemeinere und abstraktere Beziehung [...]“18, während bei mündlicher Kommunikation eine direkte Beziehung zwischen Symbol und Referent bestehen bleibt.19 Der Abstraktionsgrad ist bei Schriften, die jeweils ein Zeichen für jeweils ein Objekt verwenden, relativ gering, dafür läßt sich mittels ihrer nur relativ wenig notieren - oder es ist das Erlernen einer Flut von Einzelzeichen erforderlich. In einer Schrift, die einzelne Laute in graphischer Form festzuhalten ermöglicht, kann dagegen alles aufgeschrieben werden, denn nun „[...] kann das Sprechen selbst transkribiert werden.“20 Doch die Nutzung einer phonetischen Schrift - wie es jede (auch silben-) alphabetische ist - erfordert dafür einen sehr hohen Grad der Abstraktion. Bei Jack Goody und Ian Watt findet sich deswegen folgende Überlegung: „Die Vorstellung, einen Laut durch ein graphisches Symbol zu repräsentieren, ist ein derart erstaunlicher Sprung des menschlichen Denkens, daß das Bemerkenswerte daran nicht so sehr darin zu sehen ist, daß er erst relativ spät in der menschlichen Geschichte erfolgte, sondern vielmehr darin, daß er überhaupt erfolgte.“21
Mit der Entwicklung - oder später Einführung - eines Alphabetes wird also zum einen einer Kultur ermöglicht, nahezu alles in schriftlicher Form materiell festzuhalten, zum anderen dem Einzelindividuum beim Erlernen der einzelnen Schriftzeichen und ihrer Kombinationsmöglichkeiten eine extreme Abstraktion abverlangt. Die dem Einzelindividuum dabei einmal eröffneten Möglichkeiten der Distanzierung bleiben nicht auf der sprachlichen Ebene stehen, sondern werden auf viele andere Bereiche übertragen, die zu Innovationen im Geistesleben, durch Distanzierung und Kathegorienbildung, führen können, worauf im Rahmen dieser Arbeit (leider) nicht genauer eingegangen werden kann. Ebenso muß ein Hinweis auf die mit der Schrift entstehenden Möglichkeiten der Vereinheitlichung und des Austausches auch über größere Distanzen, der Zentralisation und neuer Formen der Verwaltung reichen.22 Es dürfte aber auch ohne genauere Analyse naheliegend erscheinen, daß mit all diesen Veränderungen eine Rationalisierung einhergeht, die das Leben in literalen Kulturen prägt. In einer schriftlich geprägten Kultur haben deshalb rational festgelegte Normen mehr Einfluß als persönliche, religiöse, traditionelle oder charismatische Bindungen, die in mündlich geprägten Kulturen entscheidend sind.
Im Rahmen dieser Arbeit müssen also viele Aspekte der durch die Einführung der Schrift hervorgerufenen Veränderungen der Denkweisen ausgeblendet bleiben. Nicht verzichtet werden soll jedoch auf die Frage nach der Auswirkung der Mündlichkeit bzw. Schriftlichkeit auf das Geschichtsverständnis, die - neben der Auswirkung auf das Recht, worauf später ausführlich eingegangen werden soll - als Grundlage für alle weiteren Überlegungen Beachtung finden muß. Einen Zugang zum Umgang mündlich geprägter Kulturen mit der Vergangenheit bieten Beobachtungen im Reich der Gonja in Nordghana. Um die Jahrhundertwende wurde ihre Geschichte der Reichsgründung erstmals von Briten aufgezeichnet, dort heißt es, daß der Gründer des Reiches Ndewura Japka sieben Söhne hatte, selbst die Gesamtherrschaft übernahm und jedem seiner Söhne nach seinem Tod einen eigenen Bezirk zuteilte. Dies paßte zu der derzeitigen Organisation des Reiches, in dem es sieben Bezirke gab, die jeweils unter der Herrschaft eines sich auf die Abstammung von Ndewura berufenden Häuptlings standen und abwechselnd den Herrscher über die gesamte Nation stellten. Im Laufe der Kolonisation durch die Briten verschwanden aber durch britische Verwaltungs- maßnahmen zwei der sieben Bezirke. Als Jack Goody 1956/57 ethnologische Feldstudien in diesem Gebiet durchführte, wurde ihm deshalb prinzipiell dieselbe Reichgründungsgeschichte erzählt wie den Forschern 60 Jahre zuvor, außer daß Ndewura Japka in der neuen Version nur fünf Söhne hatte. Die Geschichte wurde also an die gegenwärtig vorliegende, mittlerweile veränderte Situation angepaßt, ohne die Veränderung selbst zu erwähnen.23 Hanna Vollrath sieht darin eine typische Erscheinung bei oralen Gesellschaften: „[Die] politische Gegenwart wird legitimiert, d.h. als Rechtens ausgewiesen, indem gezeigt wird, daß es immer schon so war. Keine Veränderung, keine Neuerung, nur natürliche Entwicklung aus einem gegebenen Ursprung. [...] Die Vergangenheit ist also keine eigene Größe, der man sich von der Gegenwart mit der Frage zuwendet, wie es eigentlich gewesen ist, [...], sondern rückprojezierte Gegenwart.“24
Diese Angleichung der Vergangenheit an die Gegenwart ist jedoch kein absichtlicher Akt, der die Verwendung der Bezeichnung (Geschichts-)‘Fälschung’ rechtfertigen würde, es ist vielmehr ein normaler Vorgang, der mit den sozialen Funktionen des Gedächtnisses in mündlich tradierenden Gesellschaften automatisch einhergeht. Eine Generation lernt direkt von der vorhergehenden, und zwar nur, was diese für erzählenswert hält. Erzählenswert sind dabei vor allem Geschichten, die aus aktuellem Anlaß oder zur Erklärung von Gegebenem herangezogen werden können. Geschichten, die in keinem Zusammenhang zum Aktuellen mehr stehen, werden nur zufällig erzählt, deshalb fallen solche Geschichten leicht dem Vergessen anheim, „[...] denn in der reinen Mündlichkeit kann ja nur die ununterbrochen aufrechterhaltene Traditionskette dieses Vergessen verhindern, [...]“25. Die präsenten Geschichten sind also in großem Maße diejenigen, die noch eine Bedeutung für das soziale Zusammenleben aufweisen. Der Prozeß der Angleichung wird dadurch unterstützt, daß „[...] die unmittelbar gegenwärtige Erfahrung dem Erzähler dazu dient, aus Bruchstücken, die ihm von einem früheren Ereignis [oder einer gehörten Erzählung] noch in Erinnerung sind, eine konsistente Erzählung zu formen.“26
Da also in mündlich geprägten Gesellschaften „[die] Elemente des kuturellen Erbes, die ihre Bedeutung für die Gegenwart verlieren, [...] in der Regel alsbald vergessen oder verändert [werden]; und da die Individuen jeder Generation das Vokabular, die Genealogien und Mythen ihrer Gesellschaft neu erwerben, bemerken sie nicht, daß bestimmte Wörter, Eigennamen und Geschichten verschwunden sind, daß andere ihre Bedeutung verändert haben oder ersetzt worden sind.“27 Weil sie diese - allmählichen - Veränderungen nicht bemerken, erkennen sie nicht nur keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart, sondern haben überhaupt kein Gefühl „[...] für den skalar-linearen Ablauf der Zeit.“28 In mündlich tradierenden Gesellschaften ist deshalb Geschichtsforschung nicht möglich, sie verfügen über nichts, was sie mit den gegenwärtigen Zuständen vergleichen bzw. dessen Entwicklung hin zum Gegenwärtigen sie untersuchen könnten. Aufgrund des fehlenden prinzipiellen Unterschiedes zwischen Vergangenheit und Gegenwart, muß auch das Verhältnis zur Zukunft in nicht-literalen Gesellschaften anders als in literalen sein: Wenn man keine größeren Veränderungen in die eine Richtung erkennen kann, erwartet man sicherlich auch keine in die andere. Deshalb dürfte das Auftreten von Revolutionen äußerst untypisch sein, da der Schritt zum Neuentwurf gesellschaftlicher Strukturen ohne vorherige Kenntnis alternativer Gestaltungsmöglichkeiten sehr groß ist.
In den vorherigen Abschnitten wurde vor allem auf die durch das Fehlen der Schriftlichkeit ebenfalls fehlenden Möglichkeiten des Umganges mit Geschichte eingegangen, man kann dieses jedoch auch positiv betrachten und sagen, daß die Vergangenheit in oralen Kulturen „[...] nicht abgeschlossen, nicht fern, sondern sinnvoll-einheitlich und gegenwärtig ist.“29 Daraus resultiert eine Einbindung des Individuums in die Gemeinschaft, da nicht nur alles Wissen gemeinschaftlich geteiltes und allein durch die Gemeinschaft ermöglichtes Wissen ist, sondern auch nur eine gemeinsame, von allen akzeptierte Erklärung liefert.30
2.2 Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Mittelalter
2.2.1 Schriftkundige im Mittelalter
Eine genaue Bestimmung derjenigen, die im Mittelalter schriftkundig waren, ist - besonders aufgrund der zeitlichen Distanz - schwierig. Einen Zugang dürfte eine Untersuchung der Verwendung der Termini ‘litteratus’ bzw. ‘illitteratus’ durch Zeitgenossen bieten, da die von ihnen verwendeten Bedeutungen und Kontexte der Anwendung vorsichtige Rückschlüsse auf die damaligen Gegebenheiten ermöglichen. Wie man dem Aufsatz von Herbert Grundmann entnehmen kann, war die Bedeutung der Begriffe ‘litteratus’ und ‘illitteratus’ im Laufe der Geschichte mehreren Wandlungen unterworfen, die im folgenden betrachtet und interpretiert werden sollen.
So bezeichnete in der römischen Antike bis ins 1. Jahrhundert nach Christus ‘litteratus’ jemanden, der die Buchstaben kennt und gebraucht, im Gegensatz zu ‘illiteratus’, der sie nicht kennt und deshalb auch nicht gebrauchen kann. Später (ab dem 2. Jahrhundert nach Christus) läßt sich eine Begriffsaufwertung beobachten: Um als ‘litteratus’ angesehen zu werden, reicht die reine Schreib- und Lesebefähigung nicht mehr aus, man muß auch (nach den Maßstäben Ciceros: außerordentlich) belesen sein, als angemessene Übersetzung paßt nun eher ‘Gelehrter’. Seneca soll dementsprechend nicht nur Analphabeten, sondern alle, die nicht zu den sog. ‘altiores litterae’ gelangten, zu den ‘illiterati’ gezählt haben.31 Daraus kann man eventuell Rückschlüsse ziehen, die auf ein sich allgemein erhöhendes Bildungsniveau und eine größere Verbreitung der Schreibfähigkeit hindeuten, denn nur bei einer Vergrößerung des Explikationsbereichs wird eine Unterscheidung der verschiedenen Grade notwendig. Spätestens seit dem 4. Jahrhundert kommt es zu einer Verschiebung des Verwendungszusammenhanges. Da sich die Umgangssprachen der romanischen Länder regional immer mehr differenzierten (die allmähliche Sprachentwicklung durch Vermischung des ‘importierten’ Latein mit den jeweils örtlichen Sprachen zu den romanischen Sprachen), kam es zu immer extremer werdenden Abweichungen von dem in der Literatur gebräuchlichen, einheitlich bleibendem, klassischen Latein. ‘Litteratus’ war nun jemand, der das durch klassische Muster genormte Schriftlatein beherrschte, ‘illiteratus’, wer zwar prinzipiell lesen und schreiben, sich aber nicht der gehobenen ‘grammatica’ bedienen konnte.32 Noch dürfte - analog zu den vorherigen Überlegungen - die Fähigkeit, Gedanken niederzuschreiben, sich Notizen machen zu können, relativ weit verbreitet sein. Ab dem 6. Jahrhundert nach Christus jedoch kann man anscheinend nicht mehr von einer allgemein üblichen Befähigung zum Lesen und Schreiben ausgehen: Für den Bischof Caesarius von Arles ( 542) und den ostgotischen Staatsdiener und späteren Klosterbegründer Cassiodor ( ca. 580) galt nämlich schon jeder, der lesen konnte, als ‘litteratus’.33 Unter der Herrschaft „[...] germanischer, von Haus aus schriftloser Völker [...]“34 (beachte dazu Kapitel 2.2.2) ging die allgemeine Schreib- und Lesefähigkeit zurück. Sie hatten zwar Respekt vor der unentbehrlichen Schreibkunst, sahen jedoch Schreibwerk und Schulwissen nicht als Sache des Kriegers, des Adels oder des Herrschers an, sondern überließen diese den Römern und den Klerikern. Da Latein aber mittlerweile nirgends mehr Muttersprache war und man es nur noch mit dem Lesen und Schreiben erlernte, wurde der Begriff ‘litteratus’ nun gleichbedeutend mit schrift-, schreib- und lateinkundig. Da die Schule, in der man diese Fähigkeiten erwerben konnte, zumeist einem Kloster angeschlossen war, in dem Latein vermittelt werden mußte, weil es nach dem Bekenntnis der Franken zur katholisch-römischen Ausprägung des Christentums zur Kultsprache wurde, waren bald nur noch Kleriker bzw. Mönche darin bewandert.35 „ Litteras discere heißt [darum] im mittelalterlichen Sprachgebrauch fast dasselbe wie Kleriker oder Mönch werden.“36 Diese Aussage gilt vor allem für die hochmittelalterlichen Jahrhunderte, denn seit dem 10. Jahrhundert wurde es als normal angesehen, daß nur die Kleriker und Mönche über (wenigstens grundlegende) Schreib- und Lateinkenntnisse verfügten, während die Laien bis zum höchsten Adel nur ausnahmsweise lesefähig waren (und wenn dann meistens die hochadeligen Frauen), ansonsten aber einer eigenen, schriftlosen Tradition und Bildung anhingen. ‘Litteratus’ wird zu dieser Zeit fast gleichbedeutend mit Kleriker - und ‘illiteratus’ mit Laie - gebraucht.37 Doch schon bald - in der sog. ‘Renaissance des 12. Jahrhunderts’ - läßt sich in den literarisch tätigen Kreisen eine ähnliche Entwicklung wie zuvor im 2./3. Jahrhundert nach Christus beobachten. Für Johann von Salisbury gilt - unter ausdrücklicher Berufung auf Cicero und Seneca - nicht mehr jeder Lesende und Schreibende als ‘litteratus’, sondern nur noch der Kenner der antiken und christlichen Klassiker, ebenso hält es später Otto von Freising.38 Es gibt anscheinend stark unterschiedliche Bildungsniveaus innerhalb der Lesefähigen, die Gelehrteren wollen sich mittels der Begriffsverschiebung von den weniger Gelehrten abgrenzen, der Bildungsanspruch erfährt eine Steigerung. Fast zeitgleich erfolgten jedoch - in den Kreisen der neuen religiösen Gemeinschaften (vorweg der Waldenser) - die ersten schriftlichen Übersetzungen der lateinischen Bibeltexte ins Französische, wenig später auch ins Deutsche. Es entstand also eine neuartige Form der Literatur für Leser, die nicht Latein verstanden. Vor allem (rechtgläubige) Frauen folgten - ab dem 13. Jahrhundert - dem Beispiel und nutzten diese Möglichkeit, ihre Visionen, religiösen Erlebnisse und Gedanken in ihrer Muttersprache aufzuzeichnen bzw. aufzeichnen zu lassen. Das vielfältige Schrifttum der Deutschen Mystik konnte entstehen. Seitdem stimmten die alten Gleichungen nicht mehr: „[ L ] itterati und illitterati verteilen sich nicht mehr deutlich auf verschiedene Stände und auf verschiedene Sprachen, nicht mehr auf die lateinische Buchtradition lesender Kleriker und die gesprochene, gesungene Überlieferung für hörende Laien. Die Schranken zwischen beidem werden durchbrochen, die lebende Sprache wird schrift- und buchfähig [...]“.39 Zum Ende des Mittelalters verlieren deshalb die Begriffe ‘litteratus’ und ‘illitteratus’ ihre - zuvor für die jeweilige Zeit - klar zu definierenden, einheitlichen Bedeutungen, sie werden im 14./15. Jahrhundert im unterschiedlichsten Sinne verwendet.40
Eine weitere Zugangsmöglichkeit zur Klärung der Frage, wer im Mittelalter schreiben konnte, bietet die Betrachtung der sich vollziehenden Wandlungen der Buchstabenform und des Schriftbildes. Grundsätzlich läßt sich nach Ahasver von Brandt zwischen der Buch- und der Geschäftsschrift unterscheiden: „Die Buchschrift ist die ältere, weil in Kulturen mit noch geringer »Schriftlichkeit« zunächst nur wenige und nur für feierliche, kultische oder »literarische«Zwecke geschrieben wurde. Sie [...] legt keinen Wert auf schnelles, zügiges Schreiben, um so mehr Wert aber auf Schönheit, Regelmäßigkeit und Lesbarkeit. Daher wird jedem Buchstaben möglichst seine schulmäßig vorgeschriebene »kanonische« Form gegeben; er bleibt für sich stehendes Individuum, die Schrift wird mehr gezeichnet (bzw. »gemalt«) als »geschrieben«. [...] Eine Geschäftsschrift kann sich erst dann ausbilden und durchsetzen, wenn die Kultur einen gewissen Grad an allgemeiner Schriftlichkeit erreicht hat, d.h., wenn auch für Zwecke des täglichen Bedarfs, der Mitteilung, Notiz, des Geschäftslebens und der Verwaltung geschrieben wird. Hier wird kein Wert auf Regelmäßigkeit und kanonische Schönheit gelegt; das Hauptgewicht liegt auf dem Wunsch, schnell und bequem zu schreiben. Daraus ergibt sich eine vielfältige Verformung, Aufbrechung, Aufweichung und Verschleifung der Buchstaben zum Zwecke flüssigerer Federführung, allmählich sich ausgestaltend zum Schreiben in Ligatur, d.h. mit Verbindungslinien zwischen den Buchstaben namentlich eines Wortes: diese ausgebildete Form der Geschäftsschrift nennen wir Kursive.“41 So sind die schriftlichen Quellen aus der merowingischen Zeit, die noch das Ligaturenwesen der Kursivschriften zeigen, Indizien für ein weltliches Kanzleiwesen und für einen recht hohen Anteil an schreibkundigen Laien, denen das Schreiben ein tägliches, nüchternes Geschäft ist.42 Der Klerus verwendet währenddessen eine ausgesprochene Buchschrift.43 Diese im 5. Jahrhundert entstandene ‘Halbunziale’ vereinigt die Formen des unzialen, also majuskulären Schriftbildes mit den minuskulären Buchstabenelementen der Kursive und wird in den klösterlichen Schreibschulen weitergepflegt.44 Denn „[d]ie Ruhe und das Qualitätsbewußtsein der geistigen Zurückgezogenheit kam mit Buchschriften im allgemeinen aus.“45 In den ersten Urkunden der karolingischen Zeit hielt sich zunächst noch das Schriftbild der Merowingerurkunden, allerdings läßt sich schon eine allgemeine Glättung der Buchstabenformen und eine Vermeidung von starken Kürzungen feststellen.46 Im Laufe des folgenden Jahrhunderts setzt sich diese Entwicklung fort, bis in den Urkunden der sächsischen Könige und Kaiser eine reine Buchschrift mit klarem und einfachem Schriftbild Verwendung findet.47 Man kann allein daraus schon ableiten, daß die Zahl der auszustellenden Urkunden und der allgemeine Schriftverkehr deutlich abgenommen haben muß, da genügend Muße zur ordentlicheren, genaueren Ausfertigung vorhanden war. Zudem könnte die Verwendung des klaren, einfachen Schriftbildes auch auf eine Rücksichtnahme auf eine abnehmende Übung im Lesen und im Lateinischen hindeuten, da individuelle Formen der Buchstaben dem Lesenden einige Interpretationsfähigkeit abverlangt. Eine erneute Veränderung tritt ab der Mitte des 11. Jahrhunderts ein. In den Urkunden dieser Zeit „[...] hat man über das an sich klare Bild der karolingischen Minuskel ein geheimnisvolles Netz geworfen. Die Schnörkel der Oberlängen und Abkürzungszeichen [...] ziehen den Blick geradezu ab von der eigentlichen Schrift, dem Minuskelkörper zwischen der zweiten und dritten Zeile des Vierlinienschemas. Die zu einem hohen Gitter zusammengezogen Schrift derjenigen Zeilen, die traditionsgemäß verlängerte Schrift (litterae elongatae) zeigen, wirkt erst recht geheimnisvoll.“48 Fritz Rörig sieht die Schrift dieser Zeit deshalb in der Tradition der Schriftzauber, der sie zwar als Lautschrift eigentlich nicht angehören kann, durch das schmückende Beiwerk aber einen ähnlichen Eindruck zu erwecken sucht.49 „Man mochte wohl hoffen, daß die Vögte, denen gegenüber das Privileg die einzige Waffe [des Klerus bei den ewigen Streitigkeiten] war, [...], sich unter der magischen Gewalt, die aus den Pergamentblättern ausstrahlte oder ausstrahlen sollte, eher dem fügen würden, was man ihnen als königlichen Entscheid vorlas. Darüber hinaus mag der magische Charakter generell die Bedeutung gehabt haben, dem Urkundenblatt gegenüber den Laien jene Autorität zu verleihen, die ihm als eigentlich zu lesendem Rechtszeugnis bei diesen Laien notgedrungen fehlen mußte - weil sie nicht lesen konnten.“50 D.h. eine Rücksichtnahme auf nur rudimentäre Schriftkenntnisse fand nicht mehr statt, wahrscheinlich weil kaum noch jemand darüber verfügte, statt dessen wurde sich vermehrt um eine Beeindruckung des Betrachters durch die Schriftform bemüht. Fritz Rörig betrachtet in diesem Zusammenhang zusätzlich die äußere Gestaltung des Geschriebenen, um Rückschlüssse auf die damaligen Begebenheiten zu ziehen. So stellt er fest, daß vom 9. bis 12. Jahrhundert besonders viel Wert auf prächtigste und kostbarste Buchaustattungen gelegt wurde. Vor allem die Bucheinbände der Heiligen Schriften wurden auf künstlerische Weise mit viel Gold, Edel- und Halbedelsteinen geschmückt.51 Diesen Aufwand erklärt er mit der Absicht, „[...] den Laien zum mindesten einen äußeren Respekt vor jenen Büchern am Altar einzuflößen. War das doch die einzige Möglichkeit, in der diese Bücher d i r e k t auf den Laien und seine noch sehr erdgebundene Vorstellungs-welt einwirken konnten. Wie wertvoll mußte doch das sein, was diese Bücher enthielten und was der Priester aus ihnen verkündete, wenn man so viel von den höchsten Kostbarkeiten dieser Welt allein schon an ihr Äußeres verschwendete!“52 Es zeigt sich also auch bei dieser Herangehensweise, daß man in der Zeit des Hochmittelalters nicht von einer Verbreitung der Schriftlichkeit bei Laien ausgehen darf. Deshalb stammen aus dieser so gut wie urkundenlosen Zeit fast nur Königs- und Papsturkunden, die beide von Geistlichen angefertigt wurden. Für Verwaltungsaufgaben nutzten zwar Bischöfe und Klöster weiterhin die Schrift, jedoch konnten sie von Urkunden kaum Gebrauch machen, da der in Frage kommende Vertragspartner zumeist weltlich - also schriftunkundig - war und die ‘traditiones’ bevorzugte. Ab dem 12. Jahrhundert entsteht wieder ein wirkliches Urkundenwesen, dessen Entstehungsursachen Fritz Rörig nicht nennt. Er stellt nur fest, daß es wieder Beweisurkunden gab, ab dem 13. Jahrhundert sogar dispositive Urkunden, und daß die dabei verwendete Schrift eine schlichte Kursive war, da diese Urkunden ‘selbstverständlich’ gelesen werden sollten.53 Er folgert daraus: „Wieder herrscht, wie in der Spätantike, g r u n d sät z l i c h allgemeine Schriftlichkeit. Das heißt zwar nicht, daß nun jedermann lesen und schreiben konnte; das traf ja auch keineswegs auf die Spätantike zu. Aber der Zustand, daß das Schreiben und Lesen Vorrecht eines bestimmten Standes war, nämlich des Klerus, der ist allerdings vorbei. Die führenden Schichten des Laientums haben sich, auf diesem Gebiet, vom geistlichen Bildungsmonopol emanzipiert.“54
Beide Zugänge führen also zu der Beobachtung einer beständigen Abnahme der allgemeinen, pragmatischen Schriftverwendung im Verlauf des frühen Mittelalters, einer weitestgehend mündlich orientierten Laienwelt mit einer auf den Klerus begrenzten Schriftlichkeit im hohen Mittelalter und einer erneuten Verbreitung der Nutzung des schriftlichen Mediums über den klerikalen Stand hinaus im Spätmittelalter.
2.2.2 Rolle der Schrift im Mittelalter
Herbert Grundmann spricht in seinem Aufsatz von „[...] germanische[n], von Haus aus schriftlose[n] Völker[n] [...]“55. Dies ist jedoch - so allgemein - nicht richtig, denn die Germanen verfügten über Runen. Diese Runenschrift stellt eine Lautschrift dar, deren einzelnen Bestandteile (wie bei unserem Alphabet) in einer festen Reihe geordnet werden. Die Bezeichnung ‘Rune’ deutet auf eine zauberische Qualität hin, so sollen diese Zeichen der germanischen Mythologie zufolge auch nicht von einem Menschen erfunden worden sein, sondern es bedurfte göttlicher Selbstpeinigung, um zu diesem geheimen, höheren Wissen Zugang zu erlangen. Welchen hohen Stellenwert die Germanen der Schrift zusprachen, wird dadurch deutlich, daß Odin erst durch die Kenntnis der Runen zur Verkörperung der Allweisheit wird.56 Diese Koppelung der Runen an die Macht Odins erhöhte einerseits also die Wertschätzung der Schriftzeichen, andererseits schränkte dies ihre Verwendung ein: Heilige Symbole sollten nicht für profane Zwecke ‘mißbraucht’, sondern magisch genutzt werden. So findet man die ältesten Zeugnisse der Runenmagie als kurze, eingeritzte Inschriften, die magische Stärkung bewirken, Heil bringen oder Böses abwehren sollten, auf Schildbuckeln, Lanzenspitzen, Fibeln und Kämmen des 2. und 3. Jahrhunderts n.Chr. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit bot die Wahrsagung: In der einen Form des Orakels wurden mit Runen versehene Buchenstäbe ausgeworfen, um aus deren Lage die Zukunft abzulesen, dabei hatten die Zeichen bestimmten Sinngehalt. In der anderen Form wurden drei Stäbchen gezogen und die Deutung in Versform vorgenommen, wobei die Runen der drei Stäbchen den Stabreim bestimmten.57 Herbert Grundmanns Aussage hat also insofern Berechtigung als es bei den Germanen ‘nur’ mystische, aber keine pragmatische Verwendung der Schrift, demzufolge „[...] in Runenschrift [...] keine Verträge, keine Tempelinschriften, keine Briefe [...]“58 gab. Die Chance, die der Arianismus - mit seinen volkssprachlichen Gottesdiensten und der damit zusammenhängenden Entwicklung des gotischen Alphabets zur Übersetzung des Neuen Testaments - zur allgemeinen Durchsetzung der Runen bot, kann hier nicht genauer behandelt werden. Sie verging nach der Entscheidung zugunsten der römisch-katholischen Richtung ohnehin ungenutzt.59 Erwähnung finden sollte die durch den Arianismus gebotene Chance jedoch, da an diesem Beispiel die auf Schriftlichkeit beruhende Tradition des missionierenden Christentums deutlich wird.
[...]
1 Schaefer 1994, S. 359 f.
2 Schaefer 1994, S. 358
3 Schaefer 1994, S. 364
4 Goody 1968, S. 54
5 United Nations 1997, S. 91 („Ability to both read and write a simple sentence on everyday life is used as the criterion of literacy; hence semi-literates (person who can read but not write) are included with illiterates.“)
6 Schaefer 1994, S. 366. Ursula Schaefer verweist dabei eine Textstelle in ihrer Arbeit Dies.: Vokalität. Altenglische Dichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, Tübingen 1992, S. 21.
7 Schaefer 1994, S. 366
8 Goody 1968, S. 51
9 Schaefer 1994, S. 364 f.
10 Goody 1968, S. 25
11 Goody 1968, S. 25 f.
12 Vollrath 1981, S. 572
13 Grundmann 1958, S. 2
14 Vollrath 1981, S. 573
15 Vollrath 1981, S. 573
16 Schaefer 1994, S. 360. Ursula Schaefer beruft sich auf: David Olson: From Utterance to Text: the Bias of Language in Speech and Writing, in: Harvard Educational Review 47 (1977), S. 257 - 281.
17 Schaefer 1994, S. 360
18 Goody / Watt 1968, S. 88
19 Goody / Watt 1968, S. 66
20 Goody 1968, S. 28
21 Goody / Watt 1968, S. 79
22 Zur Veränderung des Denkens siehe die Beispiele aus dem antiken Griechenland bei Goody / Watt 1968, S. 86 - 88 u. 100 - 103. Zur Erweiterung der Möglichkeiten im administrativen Bereich siehe Goody 1968, S. 26.
23 Goody / Watt 1968, S. 71f. Sie beziehen sich dabei auf unveröffentlichte Feldnotizen Jack Goodys aus den Jahren 1956/57. Hanna Vollrath nennt weitere - den Beobachtungen bei den Gonja ähnelnde - ethnologischen Feldforschungsergebnisse bei den Tale (Meyer Fortes, The Signifiance of Descent in Tale Social Structure, in: Africa 14 (1934/4), S. 362 - 385), bei den Tiv (L. Bohannan: A Genealogical Charter, in: Africa 22 (1952), S. 301 - 315) und bei den Beduinen der Cyrenaika (E. Peters: The Proliferation of Segments in the Lineage of the Bedouin in Cyrenaica, in: Journal of the Roy. Anthropol. Inst. of Great Britain and Ireland 90 (1960), S. 29 - 53).
24 Vollrath 1981, S. 576
25 Schaefer 1994, S 363. Zum Thema ‘strukturelle Amnesie’ verweist Ursula Schaefer u.a. auf R. Schott: Das Geschichtsbewußtsein schriftloser Völker, in: Archiv für Begriffsgeschichte 12 (1968), S. 166 - 205.
26 Vollrath 1981, S. 576 f.
27 Goody / Watt 1968, S. 73
28 Schaefer 1994, S. 363
29 Vollrath 1981, S. 580
30 Ausführlicher dazu und zu den negativen Aspekten einer literalen Gesellschaft: Goody / Watt 1968, S. 106 - 115
31 Grundmann 1958, S. 15 - 18. Als Belege führt Herbert Grundmann Ciceros Brutus 21, 81, Pro M. Aemilo Scauro 23 und De officiis I, 37, 133 bzw. Senecas De beneficiis V, XIII, 3 an.
32 Grundmann 1958, S. 22. Herbert Grundmann verweist in diesem Zusammenhang auf den Aufsatz: Ferd. Lot: A quelle époque a-t-on cessè de parler latin? Archivum Medii Aevi 6 (1931), S. 97 - 159.
33 Grundmann 1958, S. 22 - 24. Zu Cassiodor beruft Herbert Grundmann sich auf eine Textstelle in den Institutiones divinarium litterarum c. 28 ed. R.A.B. Mynors (1937) S. 69, zu Caesarius von Arles auf dessen Predigten, MPL 39, 2325, ed. G. Morin, Corp. Christ. Ser. lat. CIII (1953).
34 Grundmann 1958, S. 22
35 Grundmann 1958, S. 22 - 38. Die von Herbert Grundmann in diesem Zusammenhang angeführten Ausnahmen am Hofe der Merowinger sollen in dieser Kurzdarstellung ausgeblendet bleiben, da die Bemühungen Chilperichs auch nach seiner eigenen Bewertung keine spürbare Wirkung zeigte; ebenso die Sonderentwicklung bei den Angelsachsen, da hier nur auf den mitteleuropäischen (soweit möglich ‘deutschen’) Raum eingegangen werden soll.
36 Grundmann 1958, S. 9
37 Grundmann 1958, S. 43 f. Herbert Grundmann führt in diesem Zusammenhang zum Beleg die Wortkombinationen ‘clerici litterati’ und ‘laici illiterati’ als seit dem 10. Jahrhundert üblich gewordene Hendiadyoins an.
38 Grundmann 1958, S. 52 - 54. Als Quellen nennt Herbert Grundmann die Seite 128 aus Johennes von Salesburies Policratius VII, 9, ed. Webb II und die Seiten 28, 37, 69 aus Otto von Freisings Gesta I.
39 Grundmann 1958, S. 59
40 Grundmann 1958, S. 61 - 65
41 Brandt 1992, S. 71 f.
42 Rörig 1952, S. 30, 32 u. 35. Fritz Rörig nennt als Beispiel ein Diplom Theuderichs III. von 688 (M. Tangl (Hg.): Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paleographie, Heft I (4. Aufl., 1904), Tafel 10).
43 Rörig 1952, S. 31
44 Brandt 1992, S. 74 f.
45 Rörig 1952, S. 31
46 Rörig 1952, S. 32. Fritz Rörig verweist zur Verdeutlichung auf die Urkunde Ludwigs des Frommen von 833 (M. Tangl (Hg.): Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paleographie, Heft III (1903), Tafel 75).
47 Rörig 1952, S. 33. Fritz Rörig nennt beispielhaft eine Urkunde Ottos II. von 973 (M. Tangl (Hg.): Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paleographie, Heft III (1903), Tafel 78).
48 Rörig 1952, S. 34 f. In diesem Zusammenhang verweist Fritz Rörig auf eine Urkunde Heinrichs III. von 1050 (M. Tangl (Hg.): Schrifttafeln zur Erlernung der lateinischen Paleographie, Heft III (1903), Tafel 83).
49 Rörig 1952, S. 34
50 Rörig 1952, S. 35
51 Rörig 1952, S. 36
52 Rörig 1952, S. 36
53 Rörig 1952, S. 36 f.
54 Rörig 1952, S. 37
55 Grundmann 1958, S. 22
56 Döbler 1992, sv. Runen
57 Döbler 1992, sv. Runen u. sv. Stabreim
58 Döbler 1992, sv. Runen, S. 236.
59 Döbler 1992, sv. Wulfila. Laut Hansferdinand Döbler fanden die gotischen Schriftzeichen immerhin über längere Zeit in Gerichtsurkunden der italienischen Ostgoten Verwendung.
- Arbeit zitieren
- Andrea Dittert (Autor:in), 1999, Der Wandel des städtischen Rechts durch das Aufkommen pragmatischer Schriftlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23330
Kostenlos Autor werden



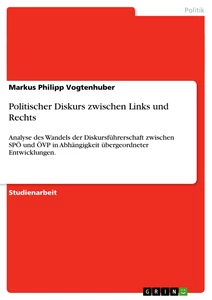
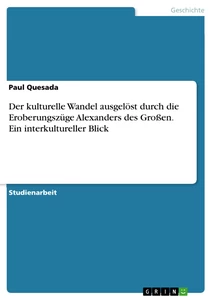












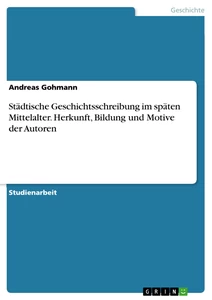


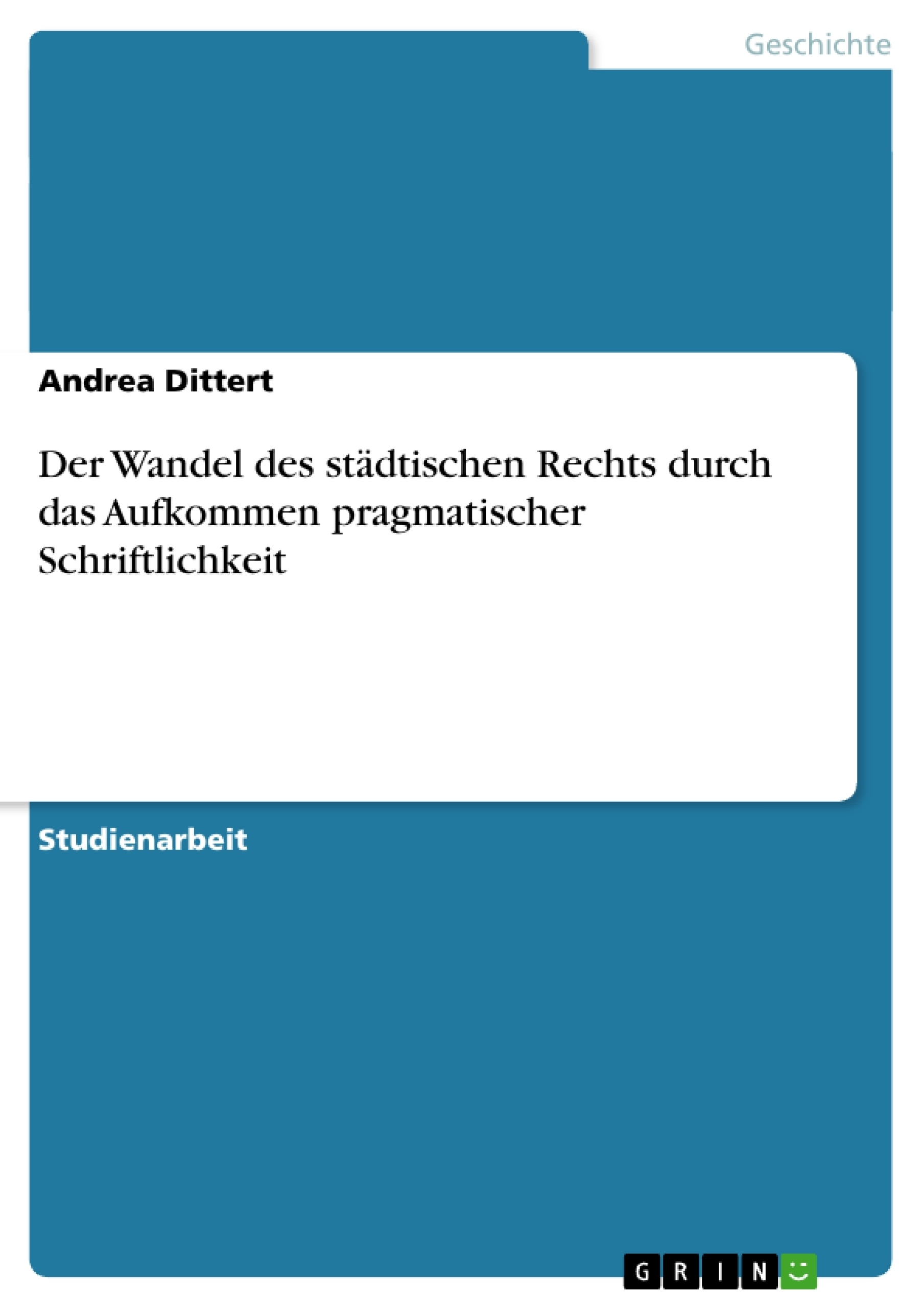

Kommentare