Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Ist dauerhaftes Wirtschaftswachstum theoretisch möglich? Von Reinhold Uhlmann
Einleitung
Erneuerbare und nicht-erneuerbare natürliche Ressourcen
Wachstumsbefürwortende Ansätze
Die Ökologische Ökonomik
Wirtschaftswachstum bei konstanter materieller Basis?
Zusammenfassung und Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Technischer Fortschritt, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung von Sebastian Sohn
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Grundlagen
Technischer Fortschritt in ausgewählten Modellen
Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und Beschäftigung
Schlusswort
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Internetquellen
Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum von Gunnar Halden
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum
Das Simulationsmodell von Julian Simon
Kritische Betrachtung
Literaturverzeichnis
Umweltverschmutzung und Wirtschaftswachstum von Christoph A. Heinrichsdorff
Einleitung
Emissionen, Immissionen und soziale Kosten
Präferenzen der Bevölkerung bezüglich Umweltverschmutzung und Wachstum
Modelle zur Bestimmung des effizienten Grades der Umweltverschmutzung
Fazit
Literaturverzeichnis
Ist dauerhaftes Wirtschaftswachstum theoretisch möglich? Von Reinhold Uhlmann
2011
Einleitung
In den letzten 200 Jahren erlebte die Menschheit ein beträchtliches Wirtschaftswachstum, welches im Vergleich zur sonstigen viel längeren Menschheitsgeschichte außergewöhnlich ist. Wirtschaftswachstum ist dabei die Zunahme des volkswirtschaftlichen Gesamteinkommens, „verstanden als die Wertsumme der volkswirtschaftlichen Produktion“ (Felderer/Homburg 2003: 38) von Gütern und Dienstleistungen (vgl. auch Mankiw 2003: 211; Luks 2001: 23). Wirtschaftswachstum hat damit sowohl eine materielle („Produktion von Gütern und Dienstleistungen“) als auch eine monetäre Seite („Wertsumme“) – ein Unterschied der für die Behandlung der hier aufgeworfenen Frage noch wichtig wird. Oft wird das volkswirtschaftliche Einkommen auch als Sozialprodukt bezeichnet, während es in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen vierfach differenziert wird, nämlich in Bruttoinlandsprodukt/-einkommen (BIP), Bruttonationalprodukt/-einkommen (BNE) sowie Nettoinlandsprodukt/-einkommen und Nettonationalprodukt/-einkommen (Felderer/Homburg 2003: 38-40). Diese Unterscheidungen[1] bleiben allerdings für das weitere Vorgehen der Arbeit unbedeutend.
Das Sozialprodukt wird oft auch als „Wohlstandsindikator“ angesehen (Felderer/Homburg 2003: 38), wobei natürlich fraglich ist, ob der Wert der produzierten Güter und Dienstleistungen mit Wohlfahrt, geschweige denn mit Lebensqualität gleichzusetzen ist, oder ob zu diesen Konzept nicht noch mehr Faktoren gehören, wie zum Beispiel Gesundheit, Umweltqualität oder niedrige Kriminalität (Jacobs 1991: 222-241; Ekins 1993: 270; Ekins/Jacobs 1994: 1; vgl. Luks 2001: 23). Trotz dessen hat das am Sozialprodukt gemessene Wirtschaftswachstum in der öffentlichen Debatte eine herausragende Bedeutung (Luks 2002: 62). Schließlich sei es „das meistakzeptierte Ziel der Welt, weil es die Aussicht auf mehr für alle mit Opfer für niemanden biete“ (Daly 1991: 8, zitiert nach Luks 2000: 44). Auch bei der Betrachtung der meisten politischen Programme erscheint Wirtschaftswachstum als eine der wichtigsten Absichten. Es wird oft argumentiert, dass es notwendig ist, um andere (wirtschaftspolitische) Ziele zu erreichen, wie z.B. die Bekämpfung von Armut oder Arbeitslosigkeit.
Ein wesentlicher Grund für das enorme Wirtschaftswachstum der letzten 200 Jahre ist die umfangreiche Nutzung nicht-erneuerbarer Rohstoffe (z.B. Georgescu-Roegen 1986a: 13; Altvater 2006: 39-43). Das Wirtschaftswachstum geht dabei bis heute mit einem steigendem Materialverbrauch und mit steigenden Emissionen einher (z.B. Jackson 2009: 71-75). Dabei gibt es die Befürchtung, „daß bei zunehmend intensiver Nutzung von Ressourcenlagern durch weiteres Wirtschaftswachstum Probleme entstehen, bzw. Grenzen erreicht werden“ (Keil 1999: 27). Dass diese Befürchtung durchaus real ist, zeigt sich dadurch, dass es bereits eine Reihe von Gewaltkonflikten um natürliche Ressourcen und den Folgen ihrer Beschränkung gibt (Bringezu/Bleischwitz 2009: 2)[2]. „Heute gilt [zudem] die Belastung der Senken (Aufnahmekapazität bspw. der Erdatmosphäre) als das entscheidende Problem für die Nicht-Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten“ (Luks 2001: 36; siehe auch Enquete-Kommission 1994: 51). Vor allem die Verbrennung fossiler Rohstoffe führt dabei zur Emissionsbelastung der Erdatmosphäre, sodass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum Klimawandel kommt, wie die Studien des IPCC zeigen. Bereits heute gibt es daher eine hohe Zahl von Klimaflüchtlingen und Opfern des Klimawandels.
Die genannten Betrachtungen führen daher zu der Fragestellung, ob weiteres Wirtschaftswachstum möglich ist, oder ob es Beschränkungen gibt, wie zum Beispiel die Endlichkeit nicht-erneuerbarer Ressourcen. Selbstverständlich hat sich die Wissenschaft, insbesondere die Wirtschaftswissenschaft, schon intensiv mit dieser Frage beschäftigt. Beispielhaft sei hier genannt, dass bereits in den 70er Jahren vor dem Hintergrund der aufgeworfenen Probleme eine Debatte um die „Grenzen des Wachstums“ entstand, die vor allem durch die gleichnamige Studie von Meadows et al. (1972) befeuert wurde (Luks 2001: 31). Neoklassische Ökonomen wie zum Beispiel Solow (1974a) hielten dem aber entgegen, dass aufgrund von Substitution zwischen Ressourcen und physischen Kapital und aufgrund von technischem Fortschritt die begrenzten Ressourcen kein Wachstumshindernis darstellen. Die Ökologische Ökonomik kritisiert allerdings diese Sichtweise, unter anderem aufgrund der Gesetze der Thermodynamik, die auch für den Wirtschaftsprozess relevant seien (z.B. Söllner 1997). Einen Konsens um die Wachstumsfrage gibt es dabei in der Wirtschaftswissenschaft noch nicht (z.B. Ockwell 2008).
Aufgrund dieser Tatsache und aufgrund der Aktualität, der genannten, mit dem Wirtschaftswachstum einhergehenden Probleme, soll in dieser Arbeit der Forschungsfrage nachgegangen werden: „Ist dauerhaftes Wirtschaftswachstum theoretisch möglich?“. Die Arbeit soll somit einen Beitrag zur laufenden Debatte leisten, die nicht nur in der Wissenschaft geführt wird sondern nach den 70ern auch wieder zunehmend in der Zivilgesellschaft[3].
Der Arbeit liegt auch eine ethische Dimension zu Grunde, nämlich die, dass die Lebenschancen zukünftiger Generationen nicht beschränkt werden sollen. Für derartige Fragen der intergenerativen Gerechtigkeit wird zumeist die „Theory of Justice“ von John Rawls (1971) herangezogen (Luks 2000: 16). Ausgangspunkt für Rawls’ Gedankenexperiment, bei dem vernünftige Gerechtigkeitsprinzipien entstehen sollen (Rawls 1971: 12), ist „die hypothetische Situation des ‚Urzustands‘ (‚original position‘), der durch einen ‚Schleier der Unwissenheit‘ (‚veil of ignorance‘) gekennzeichnet ist“ (Luks 2000: 16). In dieser Situation sollen die nach Eigeninteresse handelnden Entscheidenden, die kein Wissen über ihre zukünftige Position haben, über die Gerechtigkeitsgrundsätze der Gesellschaft entscheiden (Luks 2000: 16). Nach Rawls geht es dabei nicht nur um Gerechtigkeit innerhalb einer Generation sondern auch um Gerechtigkeit zwischen Generationen. Rawls (1971: 293) sagt dazu: „The present generation [...] is bound by the principles that would be chosen in the original position to define justice between persons at different moments of time.“ Obwohl Rawls die natürliche Umwelt nicht explizit anspricht, ergibt sich laut Luks (2000: 17) hieraus die Verpflichtung, keine Handlungen zu tätigen, „die die Lebenschancen zukünftiger Generationen beschränken oder gar zerstören“, also die Verpflichtung zu nachhaltiger Entwicklung. Damit ergibt sich für die vorliegende Arbeit die Prämisse, dass weiteres Wirtschaftswachstum nur dann gut geheißen werden kann, wenn es eben nicht „die Lebenschancen zukünftiger Generationen beschränkt oder gar zerstört“. Allerdings liegt diese Prämisse implizit auch in der Fragestellung selbst. Wenn weiteres Wirtschaftswachstum die Lebenschancen zukünftiger Generationen untergraben würde, dann wäre es äußerst wahrscheinlich, dass das Sozialprodukt ab einem gewissen Punkt sinkt oder zumindest nicht weiter steigt. In diesem Fall könnte Wirtschaftswachstum also nicht dauerhaft sein.
Da Wirtschaftswachstum ein ökonomisches Konzept ist und sich die wirtschaftswissenschaftliche Literatur umfangreich mit den Grenzen des Wirtschaftswachstums beschäftigt, soll an die Frage ökonomisch herangegangen werden. Zunächst soll dabei auf den fundamentalen Unterschied zwischen erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Ressourcen eingegangen werden, der für die Fragestellung eine große Bedeutung hat. Anhand der wesentlichen Argumentationen, die in den Wirtschaftswissenschaften hervorgebracht wurden, versucht die Arbeit dann eine Antwort auf die Wachstumsfrage zu finden. Dabei können die meisten Argumentationen in zwei Lager eingeordnet werden, in die Neoklassik auf der einen und in die Ökologische Ökonomik auf der anderen Seite (Illge/Schwarze 2005: 295). Im Folgenden soll daher der wirtschaftswissenschaftliche Mainstream (insbesondere die Neoklassik), dargestellt werden, der dauerhaftes Wachstum prinzipiell für möglich hält. An dieser Stelle soll auch kurz auf zwei Ansätze eingegangen werden, die zwar nicht explizit neoklassisch daherkommen, allerdings im Prinzip ebenfalls am Wirtschaftswachstum festhalten und auf Effizienzverbesserungen setzen. Im Anschluss folgt die Darstellung wachstumskritischer Positionen, die sich insbesondere im Paradigma der Ökologischen Ökonomik finden. Am Ende dieses Abschnitts wird außerdem ein Ansatz vorgestellt, der zwar Wachstum für möglich hält, allerdings wesentliche Prinzipien der Ökologischen Ökonomik befolgt. Auch wenn man heute weiß, dass die zunehmende Senkenbelastung eher ein Engpassfaktor ist als begrenzte Ressourcen (Luks 2001: 33), soll auf dieses Problem nur am Rande eingegangen werden. Schließlich kann dies, zumindest theoretisch, durch den Einsatz erneuerbarer Ressourcen weitgehend beseitigt werden. Wohl aber wird auf die Rolle von natürlichen Ressourcen insgesamt für den Wirtschaftsprozess eingegangen. Da sich Wirtschaftswachstum allerdings nicht nur am Einsatz von Ressourcen bemisst, sondern vor allem auch an der monetären Bewertung von Produkten und Dienstleistungen, wird im Folgenden diskutiert, ob trotz beschränkter materieller Basis immer größere monetäre Werte geschaffen werden können. Am Ende folgt die Darstellung der Ergebnisse der Arbeit.
An dieser Stelle sei auf Beschränkungen der Arbeit hingewiesen: Es geht nicht darum, inwiefern eine Gesellschaft ohne Wirtschaftswachstum denkbar ist. Diese Frage steht erst zur Debatte, wenn erwiesen ist, dass eine Wachstumsgesellschaft weiterhin nicht möglich oder nicht wünschenswert ist. Auch kann nicht geklärt werden, wie lange die Wirtschaft noch auf die derzeitige Weise weiterwachsen kann und welcher Faktor dieses Wachstum, falls es denn Grenzen hat, zuerst beschränken wird. Eine derartige Analyse würde den Umfang der vorliegenden Arbeit sprengen.
Eine weitere Anmerkung zur vorliegenden Arbeit ist folgende: Wenn von ‚kurzfristig‘ gesprochen wird, so sind Zeiträume von 50 oder 70 Jahre gemeint, als ‚langfristig‘ werden Zeitraum erachtet, die als ökonomisch schon fast nicht mehr relevant angesehen werden, ‚mittelfristig‘ sind Zeiträume, die irgendwo dazwischen liegen, also Zeiträume, die, in Jahren gesehen, eher im dreistelligen Bereich liegen.
Erneuerbare und nicht-erneuerbare natürliche Ressourcen
„During the past two hundred years, at least, mankind has enjoyed a fantastic mineral bonanza which has been the great source of an equally fantastic economic growth“ (Georgescu-Roegen 1986a: 13). Das enorme Wirtschaftswachstum der letzten 200 Jahre beruht also vor allem auf mineralischen und fossilen, sprich nicht-erneuerbaren Ressourcen (siehe auch Altvater 2006: 39-43). Laut Luks (2001: 82) kann dies als eine „Abkopplung von den ‚organischen‘ Bedingungen des Wirtschaftens“ gesehen werden. Mit dem Übergang zur fossil-mineralischen Wirtschaft kam es darüber hinaus zum Problem der übermäßigen Senkenbelastung durch Kohlendioxid und andere Abfallstoffe (Norgaard 1994: 44).
Daly (1996: 185) stellt dabei eine ‚kritische Asymmetrie‘ zwischen der Nutzung erneuerbarer und nicht-erneuerbarer Ressourcen fest. Letztere können nicht nachhaltig genutzt werden, da die Bestände zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgebraucht sind, während dies bei den Erneuerbaren möglich ist, sofern die Ernterate nicht über der Regenerationsrate liegt[4] (Wrigley 1988: 114). Hinzu kommt allerdings, dass bei der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Ressourcen räumliche Grenzen auftreten können (Luks 2000: 39, Keil 1999: 151). Laut Luks (2001: 83) ergibt sich daraus eine Wachstumsgrenze, allerdings kein „historische[r] Horizont der Endlichkeit“ (Sieferle 1997: 147) wie bei der Nutzung fossiler und mineralischer Bestände. Aufgrund der Endlichkeit nicht-erneuerbarer Ressourcen müsste bei strenger Betrachtung auf diese für eine dauerhafte Entwicklung völlig verzichtet werden (Pearce 1987: 13f.; Schröder 1995: 163). Allerdings wird dies als „wenig sinnvoll und kaum möglich“ angesehen (Luks 2000: 38). Die Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen wird daher als „Übergangslösung“ (Harborth 1991: 96) betrachtet. Allein schon die Möglichkeit, die Sonnenenergie für den Menschen als Primärenergie besser nutzbar zu machen, spricht dafür, natürliche Ressourcen für die Herstellung dafür notwendiger Solartechnologie, Windkraftanlagen etc. zu nutzen. Allerdings wird auch dieses System aufgrund von Abnutzung und nicht 100%ig möglichem Recycling irgendwann zu seinem Ende kommen (Kerschner 2010a: 547), sodass auf Dauer nur eine rein auf erneuerbaren Ressourcen basierende Wirtschaft möglich sein wird. Ob es trotzdem möglich ist, die derzeitige Wirtschaftsweise, die auf der Nutzung nicht-erneuerbarer Ressourcen beruht, weiter voranzutreiben, soll im Folgenden geklärt werden.
Wachstumsbefürwortende Ansätze
In diesem Teil der Arbeit sollen die Ansätze vorgestellt werden, die weiteres Wirtschaftswachstum grundsätzlich für möglich halten. Sie setzen dabei vor allem auf technischen Fortschritt, Substitution zwischen Naturkapital und physischem Kapital und Effizienzverbesserungen. Zunächst wird auf die neoklassische Sicht eingegangen, die in den Wirtschaftswissenschaften die größte Bedeutung hat und damit als Mainstream angesehen werden kann. Außerdem werden die Formel „Faktor Fünf“ von Ernst Ulrich von Weizsäcker et al. (2010) und der Wuppertaler Ansatz kurz dargestellt.
Der wirtschaftswissenschaftliche Mainstream: Die Neoklassik
Die Wachstumsdebatte der 1970er, die vor allem aufgrund der Ölpreiskrisen und des Berichts an den Club of Rome zu den Grenzen des Wachstums (Meadows et al. 1972) entfacht wurde (Luks 2001: 31), führte auch zu einer zunehmenden Anzahl an Publikationen von Mainstream-Ökonomen (z.B. Solow 1974a) bezüglich der Frage ob die natürliche Umwelt dem Wirtschaftswachstum Grenzen setzt (Luks 2001: 35-36, Keil 1999: 35). Laut Kerschner (2010a: 544) wird die neoklassische Sicht, dass dauerhaftes Wachstum möglich sei sehr gut zum Beispiel durch Barnett und Morse (1963) sowie Solow (1974a, 1988) repräsentiert, wobei dieses Leitbild auch heute noch im ökonomischen Mainstream vorherrsche (z.B. World Bank 2008, insb. S. ix-xii).
Illge und Schwarze (2005: 314) kommen allerdings aufgrund einer Umfrage unter Forschenden aus Deutschland zu dem Ergebnis, dass die neoklassische Umwelt- und Ressourcenökonomik „aufgeklärt“ ist und die unkritische Wachstumsantwort aus den 1970ern ablehnt. Allerdings bleiben „[g]rundlegende Veränderungen unseres Wirtschaftssystems, materielle Verbrauchsbeschränkungen und eine fundamentale Abkehr von der internationalen Arbeitsteilung […] für die neoklassische Ökonomik nicht hinnehmbar“ (Illge/Schwarze 2005: 315). Trotz dessen die Neoklassik also aufgeklärter wird (siehe auch Bartmann 2001: 53) ist zu bemerken, dass sich dies in wirtschaftswissenschaftlichen Lehrbüchern und Vorlesungen eher selten zeigt (Common 1997: 277-278). Zudem hält Solow, einer der führenden Vertreter der Neoklassik, auch 1997 noch im Wesentlichen an seinen vor über 20 Jahren aufgestellten Postulaten fest (Solow 1997), während jedoch Stiglitz (1997: 269), ein anderer bedeutender Vertreter dieses Paradigmas, die Gültigkeit der neoklassischen Modelle aus den 1970ern für 50 bis 60 Jahre begrenzt. Mehr zur zeitlichen Gültigkeit der neoklassischen Ansätze findet sich auch in dieser Arbeit. Trotz dieser Einschränkung soll im Folgenden die neoklassische Sicht auf die Frage ausführlich gezeigt werden, da sie nach wie vor als herrschende Lehre in der Wirtschaftswissenschaft angesehen werden kann (Kerschner 2010b: 33) und am weitesten verbreitet ist (Keil 1999: 33).
Neben den bereits genannten sind nach Kaivo-oja et al. (2001: 10) und Keil (1999: 35) die wichtigsten Beiträge die Folgenden: Hicks (1946), Nordhaus (1973, 1974), Solow (1974a, 1974b), Dasgupta/Heal (1974), Stiglitz, (1974a, 1974b), Hartwick (1977), Page (1977), Review of Economic Studies (41, Symposium, Mai 1974), Smith (1979, Überblick über die folgende Entwicklung der neoklassischen Ressourcenökonomik).
Die folgende Darstellung beruht zunächst vor allem auf Keil (1999: 33-67), der sich wiederum hauptsächlich auf die Veröffentlichungen aus den 1970er Jahren bezieht[5], da sich seit dem „[a]n der grundsätzlichen Vorgehensweise“ kaum etwas geändert habe (Keil 1999: 36). Da zum Beispiel Nordhaus und Tobin (1972) die Bedingungen für unbegrenztes Wachstum erfüllt sahen, war die Frage später kaum noch ein Thema und eine geeignete Produktionsfunktion wurde zum Großteil kommentarlos unterstellt (Keil 1999: 35-36).
Fundament für neoklassische ressourcenökonomische Betrachtungen, die sich vor allem auf Optimalitätsbedingungen konzentrieren, ist der Ansatz von Hotelling (1931), „der das Optimalverhalten eines ressourcenabbauenden Unternehmens bzw. den sozial optimalen Abbau- und Preispfad einer nicht-erneuerbaren Ressource zum Gegenstand hat“ (Keil 1999: 35). Solows (1974a) Artikel „The Economics of Resources or the Resources of Economics“ kann dabei als ein Schlüsseltext der neoklassischen Ressourcenökonomik gesehen werden (Luks 2000: 25). Demzufolge hängt die Frage, ob die begrenzten natürlichen Ressourcen den Produktionsprozess einschränken, vom technischen Fortschritt und von der Substituierbarkeit zwischen natürlichen Ressourcen und anderen Produktionsfaktoren ab (Solow 1974a: 10). Keil (1999: 36) bemerkt, dass dies immer noch die entscheidenden Fragen sind. Solow (1974a: 11) stellt dazu fest: „If it is very easy to substitute other factors for natural resources, then there is in principle no ‘problem’. The world can, in effect, get along without natural resources, so exhaustion is just an event, not a catastrophe“. Genauer gesagt ist im neoklassischen Modell unbegrenztes Wachstum dann möglich, wenn die Substitutionselastizität σ zwischen Kapital und Ressourcen größer als Eins ist (siehe Solow 1974a: 11, ausführlicher Keil 1999: 39). Wenn die Substitutionselastizität genau Eins ist, ist eine zusätzliche Bedingung für unbegrenztes Wachstum nötig: „Die partielle Produktionselastizität des Kapitals muß die der Ressource überwiegen; nur dann kann der verminderte Ressourceneinsatz durch Kapitalakkumulation kompensiert werden“ (Keil 1999: 40, siehe auch Dasgupta/Heal 1979: 201-205). Darüber hinaus dürfen in diesem Fall Kapital-Abschreibungen nicht mit konstanter Rate vorgenommen werden, während eine konstante lineare Abschreibung möglich ist (Keil 1999: 41-42, Dasgupta/Heal 1979: 226). Wenn die Substitutionselastizität kleiner als Eins ist, sind keine dauerhaften Steigerungen der Produktion möglich, „da für die Produktion immer eine Mindestmenge der Ressourcen notwendig ist“ (Keil 1999: 39)[6]. Wird ressourcenvermehrender technischer Fortschritt (mit einer konstanten Rate λ) in das Modell eingeführt, so gilt: „constant positive consumption is feasible, and this even so if substitution possibilities are nil“ (Dasgupta/Heal 1979: 207, siehe auch Keil 1999: 41). Steigende Skalenerträge bei der Kapitalakkumulation, sprich eine steigende Produktivität, haben dieselbe Wirkung (Keil 1999: 42)
Um auf den optimalen Wachstumspfad zu kommen, wird von den Vertretern der Neoklassik in der Regel das utilitaristische Optimum verwendet, das heißt der Gegenwartswert aller zukünftigen Konsumniveaus wird maximiert (Keil 1999: 50-51). Die sich daraus gewöhnlich ergebende neoklassische Nutzenfunktion beziehungsweise soziale Wohlfahrtsfunktion, die eine soziale Diskontrate enthält und Produktionsmöglichkeiten und Ressourcenbeschränkungen als Nebenbedingungen aufweist, findet sich zum Beispiel bei Keil (1999: 51). Für die Maximierung des Gegenwartswerts einer nicht-erneuerbaren Ressource ist die Hotelling-Regel (Hotelling 1931) Ausgangspunkt der neoklassischen Ressourcenökonomik (Keil 1999: 53). Die Regel besagt, dass für anhaltend positiven Konsum das Grenzprodukts des Kapitals der Preissteigerungsrate der Ressource entsprechen soll, die im langfristigen Gleichgewicht wiederum genauso groß ist, wie der soziale Diskontsatz beziehungsweise der Marktzinssatz (Keil 1999: 53). „Wenn tatsächlich Optimalität erreicht werden soll, so muß der Bestand an nicht-erneuerbaren Ressource genau zum Ende des Planungshorizontes aufgebraucht sein“, wobei auch die Wahl des richtigen Anfangspreises wichtig ist (Keil 1999: 54). Das Modell wurde inzwischen um verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel veränderliche Abbaukosten oder Neuentdeckungen erweitert (siehe Siebert 1982: 469), wobei sich die grundlegende Vorgehensweise allerdings nicht ändert (Keil 1999: 54).
Insgesamt hat die Neoklassik „optimistische Annahmen im Hinblick auf Substitutionsmöglichkeiten und technischen Fortschritt“ (Luks 2000: 24). In Verbindung mit den eben dargestellten Bedingungen ergibt sich somit die Sicht, dass dauerhaftes Wachstum möglich ist. Laut Luks (2001: 84) zeigt sich die Annahme weitgehender Substitutionsmöglichkeiten zum Beispiel sehr gut in der vielzitierten 1974er Symposium-Ausgabe der „Review of Economic Studies“ (z.B. Dasgupta/Heal 1974; Solow 1974b, Stiglitz 1974a, 1974b). Stiglitz (1979: 64) sagt zum Beispiel „natural resources are basically no different from other factors of production. There are presently extensive possibilities of substitution between resources and other factors (capital) and, with further research, there are likely to be further ways of substituting other factors for natural resources and making what resources we use go further“. Luks (2000: 24) sieht diese Aussage von Stiglitz als repräsentativ für den Mainstream. Eine Begründung für die optimistischen Annahmen zu Substitution und technischem Fortschritt liefert zum Beispiel De Gregori (1987; siehe auch Kaivo-oja et al. 2001: 6): „Wird eine Ressource knapp, so steigt ihr Preis und induziert damit technischen Fortschritt, der zur Substitution dieser Ressource durch eine andere führt, die zur Genüge vorhanden ist.“ (Keil 1999: 26). De Gregori vertritt aufgrund dessen die Ansicht, dass es Ressourcenbegrenzungen gar nicht geben könne (Keil 1999: 26).
Das „Subsitutionsparadigma“ der Neoklassik (Hampicke 1992a: 134) ist dabei Grundlage für das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit, welches „lediglich die Konstanz des Gesamtbestandes von menschgemachtem und natürlichen Kapital“ erfordert (Luks 2001: 20). Das heißt, ein Sinken des Naturkapitalbestandes kann zum Beispiel durch eine Erhöhung des Sachkapitalbestandes ausgeglichen werden. Beim Konzept der starken Nachhaltigkeit ist solch ein Ausgleich nicht möglich, denn dieses verlangt, dass der Bestand des Naturkapitals konstant bleibt, egal wie sich die anderen Kapitalbestände entwickeln (z.B. Hampicke 2001: 114). Laut Luks (2000: 35) wird die Verwendung des Konzepts der schwachen Nachhaltigkeit in der Neoklassik folgendermaßen begründet: „The current generation pays the compensation via improved technology and increased capital investment designed to offset the impacts of depletion“ (Pearce/Turner 1990: 238). Hartwick demonstrierte dabei, dass der Kapitalstock und damit ein nicht-abnehmender Konsum aufrecht erhalten werden können, wenn die Gewinne aus der Ressourcen-Extraktion (nach Hotelling-Regel) in physisches Kapital investiert werden (Kasanen 1982, vgl. Kaivo-oja et al. 2001: 10). Dieses auch als „Hartwick-Regel“ bekannte Postulat (Kaivo-oja et al. 2001: 10) beschreibt Hartwick (1977: 972) folgendermaßen wörtlich: „Invest all profits or rents from exhaustible resources in reproducible capital such as machines. This injunction seems to solve the ethical problem of the current generation shortchanging future generations by ‘overconsuming’ the current product, partly ascribable to current use of exhaustible resources.“
Neben dem bisher Aufgeführten wird außerdem die Internalisierung externer Effekte (Heal 2007: 23) als wichtig angesehen, ein Hauptanliegen der Neoklassik (Luks 2000: 24), sowie ein funktionierendes Preissystem (Kaivo-oja et al. 2001: 6), denn laut vieler neo-klassischer Ökonomen würde „ein funktionierender Preismechanismus letztlich jede feste Beziehung zwischen wirtschaftlichen Aktivitäten und Umweltverbrauch zerstöre[n]“ (Luks 2001: 24). Darüber hinaus wird argumentiert, dass Wirtschaftswachstum auch notwendig sei, um Umweltschutz zu finanzieren (Kaivo-oja et al. 2001: 6).
An dem dargestellten Ansatz gibt es viel Kritik, unter anderem bezüglich der optimistischen Substitutionsannahmen zwischen nicht-erneuerbaren Ressourcen und physischen Kapital. Ausführlich wird diese Kritik in einem späteren Abschnitt der Arbeit dargestellt. Als Solow von den Kritikern direkt herausgefordert wurde[7], bemerkte er, dass es vor allem auch auf die Substitution mit erneuerbaren Ressourcen ankomme (Solow 1997: 267). Daher soll im Folgenden auch die neoklassische Sicht auf erneuerbare Ressourcen dargestellt werden. Dabei werde ich mich vor allem auf die Beiträge von Smulders (1995, 2000) beziehen, die gewisse theoretische Weiterentwicklungen enthalten. Im Gegensatz zu den vorherig genannten Beiträgen basieren die Artikel von Smulders nicht auf der ‚alten‘ neoklassischen Wachstumstheorie, die technischen Fortschritt exogen sieht, sondern auf der in den 1980er Jahren entwickelten neuen endogenen Wachstumstheorie (z.B. Barro/Sala-i-Martin 1995), in der technischer Fortschritt endogen erklärt werden soll und die dabei Humankapital, Forschung und Entwicklung und learning-by-doing betont (Luks 2001: 179-180). Der Unterschied bei den erneuerbaren Ressourcen ist, dass sie einen konstanten Ressourcenstrom zur Verfügung stellen, also im Gegensatz zu den nicht-erneuerbaren bei kontinuierlichem Verbrauch unter bestimmten Bedingungen nicht aufgezehrt werden. Die methodische Herangehensweise und die Ergebnisse bleiben dabei im Prinzip dieselben. So kommt Smulders (2000: 658) zu dem Ergebnis, dass dauerhaftes Wachstum durch die Akkumulation von „physical, human, organizational and institutional capital“, durch technischen Fortschritt und durch ausreichende Substitutionsmöglichkeiten zwischen Ressourcen und den anderen genannten Kapitalarten möglich wird. Smulders (1995: 193-194) ist dabei optimistisch, dass es durch die Akkumulation von Wissen, durch „social interaction, communication, and inspiration“ möglich ist, auch aus einem konstanten Ressourcenstrom immer höheren Nutzen zu ziehen, außer wenn die Kosten der Wissensakkumulation zu hoch sind. Auf das Thema, inwiefern aus einer konstanten materiellen Basis immer mehr Nutzen gewonnen werden kann, wird in einem späteren Abschnitt ausführlicher eingegangen. Smulders zeigt sich dabei um einiges „aufgeklärter“ als zum Beispiel Solow (1997: 268), der die thermodynamischen Restriktionen für nicht relevant hält, während Smulders (2000: 607-612) sie berücksichtigt[8]. Trotz dessen bleibt festzuhalten, dass Smulders mit den üblichen neoklassischen Antworten – Substitution und technischer Fortschritt – dauerhaftes Wachstum im Prinzip für möglich hält.
„Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum“
Ein recht neuer Beitrag ist das Buch „Faktor Fünf. Die Formel für nachhaltiges Wachstum“ von Ernst Ulrich von Weizsäcker et al. (2010). Laut von Weizsäcker et al. (2010: 7) kann es im Prinzip als eine Aktualisierung von Faktor Vier (von Weizsäcker et al. 1996) gesehen werden. „‚Faktor Fünf‘ soll grob gesagt, dem Norden ermöglichen, den hohen Wohlstand zu halten […] und zugleich den Naturverbrauch um den Faktor 5 zu verringern. Und die ärmeren Entwicklungsländer sollen ein fünffaches Wohlstandswachstum erreichen, ohne den Naturverbrauch zu vermehren. Die Schwellenländer würden irgendwo dazwischen liegen“ (von Weizsäcker 2010: 48). Der Anspruch von Faktor Fünf ist dabei die globalen Energieprobleme bis 2050 zu lösen (von Weizsäcker 2010: 48-49). Von Weizsäcker (2010: 50) sieht Faktor Fünf zwar als Bundesgenossin der Degrowth-Bewegung, die nur ein Schrumpfen der Wirtschaft für möglich hält und die er zur Kritik am Wachstumswahn auffordert. Trotz dessen fällt der Ansatz in die Kategorie der wachstumsbefürwortenden Ansätze. Zum einen wollen von Weizsäcker et al. (2010: 13) das Wirtschaftswachstum nicht brandmarken und zum anderen führt laut von Weizsäcker (2010: 48) Faktor 5 zu einer Verdreifachung des heutigen Weltbruttosozialprodukts, allerdings würde es auch gleichzeitig zu einer dramatischen Entlastung von Umwelt und Klima kommen. Die Environmental-Kuznets-Curve[9] soll also durchtunnelt werden, das heißt bei konstanter Umweltbelastung soll ein steigendes Sozialprodukt erzielt werden (von Weizsäcker et al. 2010: 17-18). Kernelement des Konzepts sind Innovationen und „technologische Systemveränderungen“, um in einzelnen Bereichen wie Energie, Verkehr und Bau die Effizienz um das Fünffache zu steigern, langfristig um das Zehn- oder Zwanzigfache (von Weizsäcker 2010: 48-49). So sollen zum Beispiel die bis 2050 notwendigen CO2-Minderungen zu einem Drittel mit dem vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien und zu zwei Dritteln durch erhöhte Effizienz erreicht werden (von Weizsäcker 2010: 49). Allerdings solle auch Suffizienz eine Rolle spielen (von Weizsäcker et al. 2010: 335-379). Als Hauptgrund für die bis dato entstandenen Umweltprobleme wird zu günstige Energie angesehen, weshalb „die Energiepreise sehr sanft, dafür aber sehr langfristig“ angehoben werden sollen (von Weizsäcker 2010: 49). Von Weizsäcker (2010: 50) sieht dabei die Energiepreiserhöhungen auch als Maßnahme gegen den Rebound-Effekt, der bereits 1865 von Jevons (1965: 8, 140; vgl. Luks 2001: 148)[10] erkannt wurde. Demnach führen Effizienzverbesserungen nicht zu einem geringeren Energieverbrauch, sondern machen ihn günstiger und führen somit zu einem höheren Verbrauch.
Wuppertaler Ansatz
Dem Wuppertaler Ansatz[11] zufolge soll der materielle Input global um die Hälfte und in den Industriestaaten um 90%, also um den Faktor 10 sinken (z.B. Schmidt-Bleek 1994: 161ff.; Bringezu 1996: 200; Factor 10 Club 1995, 1996, 1997; Hinterberger et al. 1996: 84ff.; vgl. Luks 2000: 75). Die Reduktion um den Faktor 10 bezieht sich dabei auf den willkürlich gewählten Zeitraum von 50 Jahren (Schmidt-Bleek 1994: 169), während unter Annahme der Verdopplung der Bevölkerungszahl im Globalen Süden sogar ein Faktor 16 notwendig wäre (Schmidt-Bleek 1994: 26). Zudem ist festzuhalten, dass der Faktor 10 nicht streng naturwissenschaftlich hergeleitet wurde, sondern eher auf Plausibilitätsargumenten beruht und eine normative Forderung darstellt (Luks 2000: 75, 77). Zu dieser normativen Forderung gehört die Annahme, dass wir uns „der ökonomischen Entwicklung der überwiegenden Mehrheit der Menschen nicht in den Weg stellen“ (Schmidt-Bleek 1994: 168). Denn Individuen oder Regierungen würden einen nicht-wachsenden materiellen Wohlstand nicht akzeptieren, weshalb Einkommen und Umweltverbrauch entkoppelt werden sollen (Kaivo-oja et al. 2001: 16). Um die geforderte Dematerialisierung zu erreichen, wird gefordert, dass der Wohlstand zukünftig eher auf Wissen anstatt auf Land, Energie und Materialien beruhen soll (Schmidt-Bleek 2000: 1), was Parallelen zu den Arbeiten von Smulders (1995, 2000) zeigt. Es müsse darüber hinaus kulturelle (z.B. bei Konsummustern), strukturelle und technologische Veränderungen geben und der Nutzen von Produkten solle zum Beispiel durch eine größere Langlebigkeit erhöht werden (Schmidt-Bleek 2000: 4-6). Um die Erhöhung der Ressourceneffizienz zu erreichen, seien außerdem verlässliche Indikatoren notwendig (Schmidt-Bleek 1999), wie zum Beispiel MIPS (Material Intensity Per unit Service) (Schmidt-Bleek 2000: 8).
Zwischenfazit
Die Darstellung hat gezeigt, dass die Neoklassik für die Fragestellung der Arbeit durchaus relevant ist, da sie sich grundsätzliche Gedanken über die Möglichkeiten von dauerhaftem Wirtschaftswachstum macht und dabei meist den Anspruch hat über die nächsten 50 bis 60 Jahre hinauszugehen. Die Ansätze Faktor Fünf und Faktor 10 erscheinen dagegen weniger geeignet, der Fragestellung nachzugehen. Wirtschaftswachstum wird hier kaum hinterfragt, sondern eher als gegeben hingenommen. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, wie das Wirtschaften in den nächsten 40 bis 50 Jahren nachhaltiger gestaltet werden kann.
Im Folgenden soll hinterfragt werden inwiefern die Antworten der Neoklassik nützlich sind, um die aufgeworfene Fragestellung zu beantworten. Zu diesem Zweck werden der Neoklassik die entscheidenden Kritikpunkte aus der Debatte, vor allem seitens der Ökologischen Ökonomik, gegenübergestellt.
Die Ökologische Ökonomik
Einordnung und Entstehung der Ökologischen Ökonomik
In den 1960er Jahren bildete sich eine wachstumskritische Gegenbewegung zum neoklassischen Dogma, die seither immer mehr an Bedeutung gewann (Kerschner 2010b: 33). In der Wirtschaftswissenschaft ist die Ökologische Ökonomik sicherlich als Kern dieser Gegenbewegung anzusehen. Man kann dabei davon ausgehen, dass die Kritik am wirtschaftswissenschaftlichen Mainstream in gewisser Weise zum Selbstverständnis der Ökologischen Ökonomik dazu gehört, bezeichnet Söllner (1997: 195) sie doch als wichtigste Alternative zur Neoklassik. Die Kritik an dieser wird im Folgenden noch gezeigt werden. Luks (2000: 23-24) sieht das Jahr 1966 als Entstehungsjahr der Ökologischen Ökonomik (engl. Ecological Economics), da in diesem Jahr Georgescu-Roegens[12] (1966) „Analytical Economics“ und Bouldings (1966) „The Economics of the Coming Spaceship Earth“ erschienen.
Boulding (1973: 127) hebt dabei hervor, dass es einen Übergang von der durch territorialer Expansion geprägten Cowboy-Economy zur Spaceship-Economy[13] gab, „in which the earth has become a single spaceship, without unlimited reservoirs of anything, either for extraction or for pollution, and in which, therefore, man must find his place in a cyclical ecological system which is capable of continuous reproduction of material form even though it cannot escape having inputs of energy“. Auch Vertreter der Neoklassik, wie Nordhaus (1974) nehmen diesen Übergang zum Teil wahr, allerdings ergeben sich dadurch im Prinzip kein anderes Vorgehen und keine anderen Ergebnisse als bei den anderen neoklassischen Studien. Außer Georgescu-Roegen und Boulding war auch Herman Daly für die Entstehung der Ökologischen Ökonomik von großer Bedeutung. Neben seiner Wachstumskritik ist er vor allem für sein Konzept einer stationären Wirtschaft bekannt. Laut Luks (2000: 47) hat Daly eine ähnliche Sichtweise wie Boulding, die er als Übergang von der leeren zur vollen Welt bezeichnet (Daly 1992a: 192; 1992b; 1996: 7f., 109; Daly/Cobb 1994: 237, 247), wobei er einen „fundamentale[n] Wandel in den Knappheitsstrukturen“ sieht (Daly 1992b: 29). Aus der eben kurz angerissenen Analyse der Ökologischen Ökonomik ergibt sich deren zentrale Forderung „daß Grenzen aufgerichtet werden, innerhalb derer sich alles Wirtschaften nur abspielen darf. Diese Grenzen müssen die ökologische Substanz der Erde schützen“ (Hampicke 1992a: 307).
Nach dieser kurzen Einordnung sollen die Sichtweisen der Ökologischen Ökonomik nun ausführlicher dargestellt werden. Zunächst soll auf einige allgemeine und spezielle Kritikpunkte an der neoklassischen Sicht auf die Frage dauerhaften Wirtschaftswachstums eingegangen werden. Die Aspekte Substitution von Naturkapital und technischer Fortschritt werden allerdings weiter unten in eigenen Unterabschnitten behandelt, da sie die Hauptargumente der Neoklassik bilden und die Kritik der Ökologischen Ökonomik besser zu verstehen ist, wenn zuerst auf die Bedeutung thermodynamischer Restriktionen eingegangen wird. Im Unterabschnitt zu diesem letztgenannten Thema soll auch ein Beitrag zur Klärung des für die Fragestellung relevanten Aspekts geleistet werden, ob vollständiges Recycling möglich ist. Wenn dies nämlich der Fall wäre, würden die begrenzten nicht-erneuerbaren Ressourcen ein weitaus weniger bedeutendes Wachstumshindernis darstellen, da sie immer wieder verwendet werden könnten und das eventuell auch in immer kürzeren Zyklen. Ein weiterer Unterabschnitt ist Herman Daly gewidmet, zum einen um einige weitere, für die Debatte wichtige Aspekte anzusprechen, zum anderen aufgrund seiner großen Bedeutung für die aufgeworfene Frage. Wie bereits angedeutet folgt dann die Darstellung des Ansatzes von Keil (1999), der wesentliche Kritikpunkte der Ökologischen Ökonomik berücksichtigt, allerdings Wirtschaftswachstum trotz dessen grundsätzlich für möglich hält.
Kritik an der Neoklassik
Einer der Hauptunterschiede zwischen Neoklassik und Ökologischer Ökonomik ist, dass in der Neoklassik „Auswirkungen ökonomischer Aktivität auf die natürliche Umwelt […] nur in dem Maße berücksichtigt [werden], in dem sie externe Effekte auf andere ökonomische Aktivitäten hervorbringen“, während die Ökologische Ökonomik die Wirtschaft als in die natürliche Umwelt eingebettet ansieht (Keil 1999: 69, siehe dort auch die Grafiken auf S. 70). In der neoklassischen Umweltökonomik werden externe Effekte dabei als „ein eher ungewöhnliches Phänomen wirtschaftlichen Handelns“ gesehen (Luks 2000: 29). Laut Ayres/Kneese (1969: 282) sind diese aber ein „normal, indeed, inevitable part of these processes [Konsum und Produktion]“. Daher müsse aus ökologisch-ökonomischer Sicht über die neoklassische Betrachtung von Externalitäten hinausgegangen werden (Luks 2000: 29). Die Ökologische Ökonomik kritisiert die Neoklassik zudem insbesondere hinsichtlich ihrer Methodologie (Hampicke 1995: 139). So werden von der Neoklassik zum Beispiel natürliche Ressourcen mit Kapital gleichgesetzt (Hampicke 1992a: 132). Vatn und Bromley (1994: 137) bemerken dazu: „[T]he commoditization of environmental goods can be looked upon as a product of the felt need to value them. It is not immediately obvious to many – other than economists – that environmental goods and services are ‘commodities’. Nor is it apparent to non-economists why it is necessary to characterize environmental attributes in this way.“ Laut Luks (2000: 84) hat diese disziplinäre Notwendigkeit dazu geführt, dass Umweltfragen mit nicht adäquaten Methoden angegangen werden, schließlich seien Umweltbelange nie Ausgangspunkt für die Neoklassik gewesen; dabei wird versucht, die Fragen so anzugehen, dass sie zu den vorhandenen Instrumenten passen. Jacobs (1994: 69) bringt dies folgendermaßen auf den Punkt: „At heart, the neoclassical approach to environmental economics has one aim: to turn the environment into a commodity which can be analysed just like other commodities“. Reuter (2000: 195) kritisiert zudem, dass „die Frage nach den sich im Entwicklungsprozess verändernden soziologischen, institutionellen, ökologischen oder bedürfnistheoretischen Grundlagen wirtschaftlichen Handelns kein Gegenstand wachstumstheoretischer Forschung ist“ und sieht darin den Grund, warum mögliche Wachstumsgrenzen nicht in den Blick geraten.
Weiterhin wird das Effizienzstreben der Neoklassik für Nachhaltigkeitsüberlegungen als ungeeignet betrachtet (Söllner 1997: 194) und es wird kritisiert, dass der Markt allein nicht zu Nachhaltigkeit führen könne, da Nachhaltigkeit kein Gut sei (Söllner 1997: 195). Luks (2000: 86-87) sieht zum Beispiel die Beobachtung von Barnett und Morse (1963)[14], dass die Preise diverser Ressourcen im Zeitverlauf gefallen sind, nicht als Zeichen verminderter Knappheit, sondern eher als ein Versagen des Marktes, bestimmte Knappheiten anzuzeigen.
Außerdem wird angeführt, dass in den Modellen des Mainstreams Fortschritt in der Regel durch den nicht abnehmenden Konsum von Gütern definiert wird (Kaivo-oja et al. 2001: 10), womit allerdings das Konzept der nachhaltigen Entwicklung verengt würde (Cassier 1946, 1985) und eher intergenerationelle Effizienz statt gleiche Möglichkeiten betont werden (Kaivo-oja et al. 2001: 10). Die Ökologische Ökonomik beruht dagegen auf der Wertentscheidung für intergenerative Gerechtigkeit (Söllner 1997: 195) und kritisiert dementsprechend die in neoklassischen Modellen übliche Diskontierung (siehe Keil 1999: 61-65). Diese soll die „Zeitpräferenz der Individuen oder der Gesellschaft, sowie die Opportunitätskosten der Kapitalverwendung berücksichtigen“ und ohne sie würden die (neoklassischen) Optimierungsmodelle nicht funktionieren (Keil 1999: 61). Solow (1974a: 10) kommt dabei zu dem Ergebnis, „it is possible that the optimal path with a positive discount rate should lead to consumption per head going asymptotically to zero“. Costanza und Daly (1992: 42) sehen bei dieser Methode eine Wertentscheidung: „Discounting is simply a numerical way to operationalize the value judgement that (1) the near future is worth more than the distant future to the present generations of humans, and (2) beyond some point the worth of the future to the present generation of humans is negligible.“ Beltratti, Chichilnisky und Heal (1995) sprechen aufgrund der geringeren Gewichtung zukünftiger Nutzen von einer „Diktatur der Gegenwart über die Zukunft“ und Weikard (1996) sieht in der Maximierung der Gesamtwohlfahrt über den Gegenwartswert, die zu den angesprochenen großen Ungleichheiten zwischen den Generationen führt, die Unparteilichkeit utilitaristischer Ethik. Endres und Querner (1993: 28) betonen zudem, dass es möglich ist, dass heutige Generationen aus egoistischen Erwägungen eine zu hohe Diskontrate wählen. Beckermann (1994) begründet die Diskontierung zwar ausführlich, Endres und Querner (1993: 28) halten das mathematische Argument (Lösbarkeit des Optimierungsproblems) allerdings für moralisch nicht vertretbar. Hampicke (1992b: 134) sagt dazu: „Man stelle sich spätere Generationen in Not vor, denen wir eine zerstörte Erde hinterlassen haben, wie sie beim Stöbern in alten wissenschaftlichen Fachzeitschriften von der Unvermeidlichkeit ihrer Not belehrt werden, da ihre Vorfahren sich durch die Divergenz von Integralen gezwungen sahen, mehr zu konsumieren als mit der Integrität des Planeten vereinbar gewesen wäre.“ Hampicke (1991, 1992; vgl. Keil 1999: 65) hält dabei die Diskontierung, die positive Zeitpräferenz und Myopie unterstellt, sowohl für Individuen als auch für die Gesellschaft für irrational.
Weiterhin ist die Kritik zu nennen, die sich gegen die neoklassische Wachstumstheorie insgesamt richtet. Keil (1999: 42) nennt dabei in Anlehnung an Harcourt (1969) folgende Stichpunkte:
- Konzept der aggregierten Produktionsfunktion ist problematisch.
- Eine Ein-Gut-Ökonomie ist unrealistisch.
- Die (implizite) Annahme vollkommener Märkte ist unrealistisch.
- Anpassungsvorgänge benötigen Zeit.“
Darüber hinaus wird stark angezweifelt, ob dieselbe Produktionsfunktion angesichts des technischen Fortschritts für immer beibehalten werden kann (Keil 1999: 43). Denn es seien „weder die Nutzenfunktion noch die Produktionsmöglichkeiten – im Sinne von technischen Möglichkeiten zur Ausschöpfung vorhandener Potentiale – folgender Generationen bekannt“ (Keil 1999: 76). Kritik an der sozialen Nutzenfunktion gibt es auch hinsichtlich der Übertragbarkeit individueller Nutzenfunktionen auf die Gesellschaft und hinsichtlich der erforderlichen kardinalen Nutzenmessung, die im Gegensatz zur ordinalen weitaus problematischer ist (Keil 1999: 59-60).
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Individuen durchaus auch direkten Nutzen aus der Natur ziehen und sie nicht nur als Produktionsfaktor sehen, und dass daher ein nicht-abnehmender Konsum nicht mit nicht-abnehmender Wohlfahrt einhergehen muss (Kaivo-oja et al. 2001: 10). Endres und Querner (1993: 27) kritisieren zudem, dass ein möglicher Eigenwert der Natur nicht berücksichtigt wird. Allerdings kann auch eine nutzenstiftende Umwelt in neoklassische Modelle integriert werden, wie Krautkraemer (1985) zeigt. Dabei bleibt es allerdings beim neoklassischen Optimalitätsdenken, sodass es von bestimmten Bedingungen abhängt, ob und wie schnell Naturkapital verzehrt wird (Krautkrämer 1985: 165). Auch an den grundsätzlichen Ergebnissen ändert sich im Gegensatz zu anderen neoklassischen Modellen kaum etwas, denn „(t)echnological progress and capital-resource substitution provide two means by which continuous growth in consumption can be maintained“ (Krautkrämer 1985: 165).
Ein anderer Aspekt vieler neoklassischer Texte ist das Argument, dass Wachstum die finanziellen Mittel für adäquaten Umweltschutz bereitstelle. Allerdings könnten die „ökologischen Folgewirkungen des Wachstums [...] dieses Argument in sein Gegenteil verkehren“ (Luks 2001: 206). So steigen laut Binswanger (1991: 107) die „Anforderungen an den Umweltschutz [...] bei wirtschaftlichen Wachstum stärker als die Mittel, die sich aus dem Wachstum ergeben.“
Wenn man über die neoklassischen Modelle zum Thema unbegrenztes Wachstum diskutiert, ist auch der zeitliche Rahmen zu beachten, für den diese Modelle vorgesehen sind. Stiglitz (1997: 269) bemerkt dazu, dass die neoklassischen Modelle eigentlich nur für die nächsten 50 bis 60 Jahre gedacht waren. Bereits 1979 schrieb er „it is obvious that continued exponential growth is impossible […] I am not concerned here with such very long-run problems […] I am concerned here with the more immediate future.“ (Stiglitz 1979: 37). Allerdings sei „[d]iese Beschränkung […] im Laufe der Zeit und bei von anderen entwickelten Modellen in Vergessenheit geraten“ (Keil 1999: 48). Zudem hat zum Beispiel Solow hinsichtlich der zeitlichen Gültigkeit einen anderen Anspruch: „when I say ‘forever’ in this connection, I mean ‘for a very long time’ […] life in this solar system will only last for a finite time, though a very long finite time“ (Solow 1974a: 48). Dasgupta und Heal (1974: 26) beziehen sich ebenfalls auf einen sehr langen Zeitraum, wenn sie sagen „one has to be particularly conscious about the properties of production functions at the ‘corners’ […] The point of concern, of course, is the behaviour for large values of capital-resource ratio, given that large values cannot be avoided in the long run“. Diese Tatsache, dass einige neoklassische Vertreter einen sehr langfristigen Geltungsanspruch haben, allerdings ein anderer bedeutender, nämlich Stiglitz, die Gültigkeit dieser Modelle auf die Kurzfristigkeit herabstuft, lässt aus meiner Sicht Zweifel über die Eignung dieser Modelle für die hier aufgeworfene Fragestellung aufkommen.
Thermodynamik und vollständiges Recycling
Ein wichtiger Bestandteil der Ökologischen Ökonomik ist die Betonung der Relevanz thermodynamischer Restriktionen für den Wirtschaftsprozess (z.B. Söllner 1997). Luks (2000: 30) sieht dabei die Thermodynamik für die Ökologische Ökonomik als den wichtigsten Theorieimport aus der Physik an. Allerdings gibt es auch innerhalb dieser Richtung der Ökonomik sehr unterschiedliche Meinungen über die Einbeziehung thermodynamischer Konzepte (Söllner 1997: 176).
Für die Debatte wichtig sind der erste und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik[15]. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz) kann Energie nicht geschaffen oder vernichtet werden, sondern lediglich umgewandelt; da Energie und Materie in einander umgewandelt werden können, muss deren Summe konstant bleiben (Keil 1999: 71). Allerdings ist diese Umwandlung unter irdischen Umständen vernachlässigbar, sodass sich die Erhaltung von Energie und die Erhaltung von Materie (Massenerhaltungssatz) in isolierten Systemen ergibt (van den Bergh 1996: 16). Aus dem ersten Hauptsatz hat sich der „Materials Balance Approach“ (Ayres/Kneese 1969; Kneese et al. 1972; vgl. Luks 2000: 29) entwickelt. Demzufolge entspricht die Masse des Inputs an natürlichen Ressourcen der Summe aus Abfall und Akkumulation (Konsumgüter und Kapital); wenn es Recycling gibt, so ist die Änderung der Masse des recycleten Materials zu berücksichtigen (Söllner 1997: 184). Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass Güter nur mittels Materialverbrauch hergestellt werden können (Immler 1994; Diefenbacher 1994; vgl. Keil 1999: 43 Fußnote, 72). Daly (1997b: 264-265) kritisiert aufgrund dessen die neoklassische Produktionsfunktion mit ihrer Substituierbarkeit zwischen Ressourcen und Kapital. Solow (1997: 268) hält dem entgegen, dass der Massenerhaltungssatz für den Wirtschaftsprozess nicht relevant sei. Mir erscheint es allerdings aufgrund dieses Gesetzes zweifelhaft, dass immer mehr Güter mit einer gegebenen Ressourcenbasis hergestellt werden können, gerade in langfristiger Sicht, die Solow ja beansprucht. Das Thema wird allerdings im Folgenden, vor allem im Unterabschnitt zur Substitution weiter behandelt. Eine weitere Folge des Massenerhaltungssatzes ist, „daß alle Materie, die das ökonomische Subsystem aus seinem übergeordneten ökologischen System entnimmt, schließlich wieder dorthin zurückkehren muss“ (Keil 1999: 72). Söllner (1997: 184) kommt so zu einem weiteren Kritikpunkt an der neoklassischen Umweltökonomik, denn der Fakt, dass Schadstoffe nicht gänzlich beseitigt werden können, zeige die Komplexität des Externalitätsproblems und dass Ansätze, die sich nur auf einen Schadstoff konzentrieren, unzureichend sind. Darüber hinaus schätzt Luks (2000: 29) aufgrund dessen das Potenzial technischer Lösungen kritisch ein, denn „technological means for processing or purifying one or another type of residuals do not destroy the residuals but only alter their form“ (Kneese et al. 1972: 6). Söllner (1997: 184) hält den Material-Balance-Approach zwar für um einiges besser geeignet als die neoklassischen Modelle, allerdings werde der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, auch Entropiegesetz genannt, vernachlässigt, weshalb unbegrenztes Recycling im Prinzip möglich wird und Wachstumsgrenzen daher obsolet werden.
Dem zweiten Hauptsatz zu Folge tendiert Entropie, welche das Maß der keine Arbeit verrichtenden, also nicht nutzbaren Energie darstellt, im Universum zu einem Maximum (Keil 1999: 71; Georgescu-Roegen 1987). „In der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur wird das Entropiekonzept [allerdings] in einem weiteren Sinne gebraucht als in der Physik“ (Luks 2000: 30). So sei der Wirtschaftsprozess „letztlich nichts anderes als eine Umwandlung von wertvollen natürlichen Ressourcen (niedrige Entropie) in wertlosen Abfall und Abwärme (hohe Entropie)“ (Binswanger 1992: 21). Entropie wird dabei als Maß der Unordnung beziehungsweise Entwertung angesehen (Binswanger 1992: 21), was aber laut Luks (2000: 30) unter anderem aufgrund der Übertragung des Entropiekonzepts aus der Physik in die Ökonomik nicht unproblematisch ist. So gelten die thermodynamischen Gesetze nicht für materielle Prozesse, was aber Georgescu-Roegen (1977b) nicht störte, sie darauf zu beziehen und den vierten Hauptsatz der Thermodynamik zu postulieren (Luks 2000: 31). Dieser besagt „(I)n actuality no reversal of material entropy can be complete“ (Georgescu-Roegen 1977b: 303), auch materielle Prozesse sind also irreversibel (Luks 2000: 31). Dies impliziert, dass vollständiges Recycling nicht möglich ist (Georgescu-Roegen 1971: 60). Georgescu-Roegen (1981: 60) sagt zum Beispiel, „material objects wear out in such a way that small particles (molecules) originally belonging to these objects are gradually dissipated beyond the possibility of being reassembled“. Georgescu-Roegen[16] hält somit aufgrund der Gesetze der Wärmelehre[17] auf Dauer nur eine schrumpfende Wirtschaft für möglich und erstrebenswert (Kerschner 2010b: 33). Laut Kerschner (2010a: 547) könne in diesem Sinne nur die ‚Beerenpflücker-Ökonomie‘ von Georgescu-Roegen (1976: 23) als diejenige angesehen werden, die bis zum Ende der Existenz der Sonne aufrechterhalten werden könne.
Für seine thermodynamischen Interpretationen wurde Georgescu-Roegen allerdings vor allem von Robert Ayres (z.B. 1994, 1997, 1998a, 1999) kritisiert (Kerschner 2010a: 547). Zum einen verstoße der vierte Hauptsatz gegen das Gesetz von der Erhaltung der Massen (Lavoisier 1790, vgl. Kerschner 2010a: 547). Demnach dürfte zum Beispiel verbrannte Kohle nicht ‚verloren‘ sein, da sie durch den Verbrennungsvorgang lediglich in andere Stoffe umgewandelt wurde und es mit genügend Energie möglich wäre, die entstandenen Partikel wieder in Kohle zu verwandeln (Kerschner 2009: 128). Jacobs (1991: 113) betont dabei, dass beim Recycling auch die Energie für das Einsammeln, das Trennen und den Transport zu berücksichtigen ist und dass der Energiebedarf enorm steigen wird, umso mehr recycelt werden soll, da es zur Zeit nur dort stattfindet, wo es mit wenig Aufwand verbunden ist.
Zum anderen nimmt Entropie nur in isolierten Systemen und bei der Betrachtung der Gesamtheit mehrerer Systeme zu, während sie allerdings in einem System durch die Interaktion mit anderen Systemen abnehmen kann (Luks 2000: 31). Die Erde ist dabei kein isoliertes sondern lediglich ein geschlossenes System, da sie Energie von der Sonne erhält, die der Entropie auf der Erde entgegenwirken kann (Ayres 1998a, 1999; vgl. Kerschner 2010a: 547). Laut Ayres können deshalb durch Verbesserungen in der Solartechnologie so große Energiemengen genutzt werden, dass ein 100%iges Recycling möglich wird, wobei er teilweise unendliches Wirtschaftswachstum für möglich hält (Kerschner 2010a: 547). Die begrenzte Erdoberfläche ist dabei für Ayres (z.B. 2007) kein Problem, da er die Möglichkeit sieht, Energie von Sonnenkollektoren im Weltall per Mikrowellen auf die Erde zu übertragen (vgl. Kerschner 2010a: 547 Fußnote 18). Laut Kerschner (2010a: 547) sind die Überlegungen von Ayres, auch „energetisches Dogma“ genannt (Mayumi 2001), theoretisch gesehen durchaus richtig, dessen sich auch Gourgescu-Roegen (z.B. 1977a) und Daly (1981) bewusst sind; allerdings gibt es praktische Probleme, die Ayres (2006, 2007) jüngst auch selbst erkannt hat. Darüber hinaus erscheint es sozial und ökologisch bedenkenswert die Lithosphäre in eine „Mine“ zu verwandeln, um alle Abfälle und Nebenprodukte (z.B. CO2, Nitrate, Schwermetalle) wieder zu verwenden (Kerschner 2010a: 547). Ayres (1998a) gibt dabei selbst zu, dass der Kollaps der Umweltdienstleistungen (z.B. Absorption von Abfällen und Nebenprodukten) eher der für die Wirtschaft limitierende Faktor ist als die Knappheit natürlicher Ressourcen (Kerschner 2010a: 547). Außerdem ist es laut Kerschner (2010a: 547; 2009: 129) fraglich, ob das System zur Nutzung der Solarenergie mit der selbst ‚erzeugten‘ Energie gewartet und reproduziert werden kann (Georgescu-Roegen 1993), zum anderen werden Stoffe wie Indium, die für Solarzellen benötigt werden, zunehmend knapp (Andersson/Rade 2002)[18]. Kerschner (2010a: 547-548) sieht darüber hinaus die Gefahr, dass bei Vorhandensein einer günstigen und nahezu unerschöpflichen Energiequelle Bevölkerungszahl, Konsum und ökologische Auswirkungen zu stark ansteigen.
Ein anderer Aspekt ist folgender: Wenn der Primärenergieverbrauch auf der Erde wie in den letzten Jahrzehnten weiterhin mit durchschnittlich 2% pro Jahr ansteigen würde, so würde er in circa 360 Jahren so groß sein, wie die Energie, die die Erde von der Sonne erhält, wobei es absurd erscheint, dass die gesamte Sonneneinstrahlung genutzt werden kann (Glucina/Mayumi 2010: 18). Auch Söllner (1997: 188) bemerkt praktische Schwierigkeiten hinsichtlich des vollständigen Recyclings, behauptet aber, dass Georgescu-Roegen (z.B. 1981: 60) nicht die theoretische Unmöglichkeit dessen beweisen könne und nennt die bereits angesprochene Verletzung des Massenerhaltungssatzes durch den Vierten Hauptsatz[19]. Es zeigt sich also, dass der vierte Hauptsatz kein Naturgesetz ist (siehe auch Pastowski 1994; Young 1991: 169 f., vgl. Luks 2000: 31-32). Allerdings hat die Diskussion belegt, dass der vierte Hauptsatz durchaus praktische Relevanz hat[20].
Substitution
Die Substitution ist von Naturkapital mit anderen Kapitalarten, insbesondere physischem Kapital, ein entscheidender Aspekt für neoklassische Modelle hinsichtlich der Frage, ob dauerhaftes Wachstum möglich ist. So hängt laut Luks (2000: 36) die Angemessenheit des Kriteriums der schwachen Nachhaltigkeit, welches ja vom Mainstream zumeist vertreten wird, davon ab, inwiefern sich Naturkapital und physisches Kapital substituieren lassen. Die Ökologische Ökonomik teilt allerdings den ‚Substitutionsoptimismus‘ der Neoklassik nicht. Sie sieht natürliches und physisches Kapital als komplementär[21] an und nicht als Substitute (Berkes/Folke 1992: 1; Daly 1994: 25f., 1995b: 51; Folke et al. 1994: 6; vgl. Luks 2000: 37). So kritisiert zum Beispiel Hampicke (1992a: 134): „Die Begriffe der Komplementarität, der systemaren Zusammengehörigkeit, der Unentbehrlichkeit haben in der neoklassischen Routine keinen Platz. Sie spielen nicht einmal am Rande eine Rolle, geschweige denn im Zentrum, wo sie stehen müßten. Überall dort, wo die neoklassische Theorie begründeterweise der Verharmlosung ökologischer Zukunftsgefahren geziehen werden kann, zeigt ein näheres Hinsehen, daß dies auf ‚substitution worship‘ zurückzuführen ist.“
Trotz der hier aufgezeigten Kontroverse sieht der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU 1994: Rdnr. 128) einen Konsens darin, „daß eine Substitution zwischen natürlichem Kapital und Sachkapital nur begrenzt möglich ist“. Empirisch erscheint das Bild allerdings differenzierter beziehungsweise unklarer. So verweist Turner (1997: 300) zum einen auf Studien, die hinsichtlich Stahl, Kupfer und Aluminium eine Substitutionselastizität größer als eins zeigen (Brown/Field 1979), während andere hinsichtlich kritischer Metalle wie Beryllium, Titanium oder Germanium wesentlich schlechtere Substitutionselastizitäten ermittelt haben (Deadman/Turner 1988). Randall (2009: 98) stellt sogar fest, dass über Substitutionselastizitäten und ihre Veränderungen im Laufe der Zeit empirisch nur sehr wenig bekannt sei.
Laut Cleveland und Ruth (1997: 207) müssen bei der Diskussion um Substitutionsmöglichkeiten auch die Arten der Substitution beachtet werden, so gebe es zum Beispiel Substitution auf Mikro- und Makroebene beziehungsweise auf lokaler oder globaler Ebene sowie kurzfristige und langfristige Substitutionen. Stiglitz (1997: 269) verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Substitution zwischen natürlichen Ressourcen und physischen Kapital zumindest mittelfristig möglich sei. Cleveland (1987: 68) stellt fest, dass neoklassische Modelle hinsichtlich der Substitutionsmöglichkeiten auf Mikroebene durchaus richtig liegen, allerdings nicht auf Makroebene, da die physischen Beziehungen zwischen den Produktionsfaktoren nicht beachtet würden. Hier zeigt sich, dass Vertreter der Ökologischen Ökonomik vor allem theoretisch argumentieren, um zu zeigen, dass Substitutionsmöglichkeiten begrenzt sind. So erklärt Luks (2001: 240), dass es hinsichtlich der natürlichen Senken keine realistischen Substitutionsmöglichkeiten gäbe, denn „[d]ie Funktion der Erdatmosphäre, die Wirkung der Ozonschicht und die Bedeutung der Artenvielfalt lassen sich nicht durch Technik ‚ersetzen‘“.
Ein anderer Aspekt zur Substitution ist, dass die meisten Personen eine Komplementarität bei ökonomischen und ökologischen Nutzen sehen (Spash/Hanley 1995), sie messen also dem Naturkapital einen unersetzlichen Wert zu. Allerdings ignoriert auch der ökonomische Mainstream die Notwendigkeit bestimmter Naturkapitalbestände nicht, wie Hampicke (2001: 114) unter Verweis auf die Studien von Krautkraemer (1985) und Heal (1998) bemerkt.
Vertreter der Ökologischen Ökonomik weisen aber zudem daraufhin, dass in Sachkapital immer auch Naturkapital enthalten sei (Luks 2000: 37) und dass Kapital nicht den Stoff produzieren könne, aus dem es selbst besteht (Daly 1997b: 262). So sieht Keil (1999: 46) es als einen Kritikpunkt, dass „(d)ie Neoklassik unterstellt, daß unter Einsatz minimaler Mengen von Ressourcen bei genügend großem Kapitalstock eine beliebig hohe Produktion erzielbar ist“. Solow (1997: 267) versucht dabei später klarzustellen, dass es auf die Substituierbarkeit von nicht-erneuerbaren Ressourcen mit erneuerbaren und nicht auf die Substitution mit Kapital ankomme. Bei ersterer gilt die weitgehende Substituierbarkeit dabei als allgemein unumstritten (Keil 1999: 46). Ob die Produktion dabei wachsen kann oder konstant bleiben muss, hängt bei neoklassischer Betrachtung wiederum von der Substitutionselastizität ab (Keil 1999: 47). Laut Keil (1999: 47) wird aber von strengen Nachhaltigkeitsvertretern eingewandt, dass wenn erneuerbare Ressourcen einen konstanten Strom an Ressourcen liefern, auch der Output aufgrund des Massenerhaltungssatzes konstant bleiben muss und nicht steigen kann.
Ein weiteres Argument gegen das „Substitutionsparadigma“ ist, dass sich das physische Kapital über die Zeit abnutzt und Anstrengungen zu seiner Aufrechterhaltung notwendig sind, die wiederum Ressourcen benötigen. Victor (1991: 208, siehe auch Tisdell 1997: 290) formuliert dies folgendermaßen: „In the context of sustainable development, where a time horizon of 100 years or more is not out of place, it becomes true that virtually all of the manufactured capital stock of an economy must be replaced. The demands placed on the natural capital stock by such an endeavour are not trivial.“
Technischer Fortschritt und Unsicherheit
Ähnlich wie beim Aspekt der Substitution ist auch beim Thema technischer Fortschritt die Neoklassik optimistisch und die Ökologische Ökonomik skeptisch. Der Mainstream nimmt seinen Optimismus dabei meist aus den Erfolgen, die bisher durch Innovationen erreicht werden konnten. Dies sei allerdings „[a]ngesichts der Breite und Komplexität aktueller Umweltprobleme“ keine „Basis für nachhaltigkeitspolitische Entscheidungen“ (Luks 2005: 53), so die Kritik daran. Zudem wird die vollkommene Voraussicht der Neoklassik über zukünftige Zustände kritisiert (Keil 1999: 57), da technischer Fortschritt oftmals mit einer konstanten Rate in die Modelle eingebaut wird und das, obwohl es kaum Wissen über die Technik gibt, die die Modelle erfordern (Kaivo-oja et al. 2001: 6). Die Ökologische Ökonomik bestreitet dabei das problemlösende Potenzial von Innovationen nicht (Luks 2005: 53) und laut Luks (2001: 206) „spricht in der Tat nichts dafür, daß der technische Fortschritt plötzlich ‚aufhören‘ könnte“. Jedoch weist die Ökologische Ökonomik auf mögliche Grenzen von technischem Fortschritt und Innovationen zur Lösung von Umweltproblemen hin (Luks 2005: 52-53; 2001: 206), da die „Innovationsfähigkeit [des Kapitalismus] und ihr Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung über schätzt werden“ könnte (Luks 2005: 54).
Hauptgrund für diese Skepsis ist die Unsicherheit zukünftiger Ereignisse, denn „[e]ine halbwegs realistische Einschätzung ökologischer Innovationen ist erst dann möglich, wenn sie bereits stattgefunden haben“ (Luks 2005: 52). Somit sei es „absurd zu glauben, etwas über technologische Entwicklungen der nächsten 50, 100 oder gar 300 Jahre wissen zu können, von noch längeren Zeiträumen ganz zu schweigen“ (Luks 2001: 241). Auch Barro (1987: 291), ein Vertreter der neoklassischen endogenen Wachstumstheorie sagt: „We should […] consider the eventual limitations on new ideas – that is, the likelihood that technology cannot advance forever“.
Daly hat aufgrund der zu großen Unsicherheiten einen ‚vernünftigen technologischen Skeptizismus‘ entwickelt (Costanza et al. 1991: 7). Die meisten ökologischen Ökonomen haben so, mit Georgescu-Roegen 1986a: 14) gesprochen, die Sicht, dass „any rational program we may offer today must be based only on our present knowledge, not on some wishful futuristic exercise“. Denn „[w]enn sich diese Strategie [technologischer Pessimismus] als falsch – zu ‚pessimistisch‘ – erweisen sollte, ist möglicherweise Ineffizienz die Folge, nicht aber Un-Nachhaltigkeit mit entsprechenden katastrophalen Folgen für Mensch und Natur“ (Luks 2001: 242)[22].
Ein weiterer entscheidender Aspekt, der von Vertretern der Ökologischen Ökonomik vorgebracht wird, ist, dass sich auch technischer Fortschritt nur im Rahmen physischer Gesetze abspielen kann (Daly 1997b: 264). So sagen Glucina und Mayumi (2010: 17) „[i]improving the technology […] can only ever get closer to the thermodynamic maximum, it can never surpass it“.
Weitere Argumente, die die Ergebnisse technologischen Fortschritts eher kritisch sehen, beziehen sich auf den Rebound-Effekt. So stellt zum Beispiel Lecomber (1975: 43) fest, dass technische Fortschritte in der Ausbeutung natürlicher Ressourcen die Produktpreise sinken lassen und damit einem schnelleren Abbau Vorschub leisten. Zum Beispiel auf diesem Wege könnten Innovationen zu einem höheren Umweltverbrauch führen (Nill 2004: 7f.) und zu Wachstumsprozessen, die die ökologischen Vorteile zu nichte machen (Luks 2005: 56). Außerdem wird betont, dass die Anstrengungen, die für technologischen Fortschritt betrieben werden, selbst wiederum Ressourcen benötigen (Tisdell 1997: 291). In diesem Sinne argumentiert auch Paech (2010: 7): Innovationen würden zur „Aufblähung der materiellen Infrastruktur“, zu zusätzlichem Flächenverbrauch und zu umweltschädlichem Output führen, wenn die Innovationen nicht mit einem Rückbau bisheriger Kapazitäten einhergehen würden. Paech (2006: 31) fordert daher, dass zu Innovationen auch Exnovationen gehören. Ein weiterer Aspekt, der genannt wird, ist, dass gesellschaftliche Leitbilder für die Wirksamkeit ökologischer Innovationen wichtiger seien als technische Prozesse (Hinterberger et al. 1996: 247ff.), hier wird also auf Suffizienzstrategien angespielt.
[...]
[1] Siehe dazu zum Beispiel Felderer und Homburg (2003: 39-40).
[2] Aktuelle Studien zu Rohstoffkonflikten finden sich auch unter http://www.adelphi.de/de/publikationen/dok/43463.php
[3] So gab es zum Beispiel im Mai diesen Jahres in Berlin einen großen Kongress zum Thema „Jenseits des Wachstums“.
[4] Eine kurze Diskussion zu dem Thema wie und in welchem Ausmaß erneuerbare Ressourcen genutzt werden können, findet sich zum Beispiel bei Keil (1999: 136-143).
[5] Vor allem bezieht sich Keil auf Dasgupta/Heal (1979), da dieses Lehrbuch als „Standardreferenz zur neoklassischen Ressourcenökonomie“ gesehen werden kann (Keil 1999: 36).
[6] Für eine graphische Darstellung der Isoquanten in den unterschiedlichen Fällen siehe zum Beispiel Keil (1999: 39) oder die dort unter Fußnote 25 genannten Beiträge.
[7] Bevor Solow und Stiglitz 1997 in der Ecological Economics 22 (3) von Daly direkt herausgefordert wurden, gab es im Prinzip keine neoklassischen Reaktionen auf die Kritik der Ökologischen Ökonomik (Kerschner 2010a: 546, Fußnote 12).
[8] Auf die Relevanz der Thermodynamik für den ökonomischen Prozess wird ausführlich in einem anderen Abschnitt eingegangen.
[9] Die Environmental-Kuznets-Curve (EKC) beschreibt einen Zusammenhang, demzufolge mit steigendem Sozialprodukt die Umweltbelastung zunächst steigt, allerdings ab einem bestimmten Punkt wieder abnimmt, da großer Wohlstand bessere Umweltschutzmöglichkeiten schaffe. Für eine graphische Verdeutlichung siehe zum Beispiel von Weizsäcker et al. (2010: 17). Der Zusammenhang gilt allerdings als umstritten. Für eine kurze Einführung zur EKC siehe zum Beispiel Van Alstine/Neumayer (2008).
[10] Luks (2001: 146) sieht das Buch „The Coal Question“ von Jevons (1965) übrigens „als eines der ersten über die ‚Grenzen des Wachstums‘“, da es sich nicht nur mit dem Rebound-Effekt, sondern auch mit der Endlichkeit nicht-erneuerbarer Ressourcen beschäftigt.
[11] Der Ansatz wird so genannt, da er aus dem Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie heraus entstanden ist.
[12] Georgescu-Roegen lebte von 1906 bis 1994 (Daly 1997a: 173). Weitere Informationen über das Leben von Georgescu-Roegen finden sich bei Martinez-Alier (1997).
[13] Laut Söllner (1997: 179) ist das „Spaceship Earth“ ein „rather trivial concept“.
[14] Laut Luks (2000: 86) sei diese Studie im Übrigen „nach wie vor steter Referenzpunkt neoklassischer Beiträge zum Thema“.
[15] Es gibt darüber hinaus den nullten und den dritten Hauptsatz (siehe z.B. Nickel 2010: 27-28), die allerdings in der wirtschaftswissenschaftlichen Debatte keine Bedeutung haben.
[16] Georgescu-Roegen hat auch eine eigene Produktionstheorie entwickelt. Mehr dazu findet sich beim Ansatz von Keil.
[17] Bereits in den 1920ern behauptete Frederick Soddy, dass die Wirtschaft aufgrund des Entropiegesetzes nicht exponentiell wachsen könne und dass die Substitution zwischen Kapital und Ressourcen begrenzt sei; Georgescu-Roegen erwähnte ihn allerdings nicht (Martinez-Alier 1997: 234-235).
[18] Für jüngere Studien zu Konflikten um Rohstoffe, die auch für die Solarindustrie nötig sind, siehe http://www.adelphi.de/de/service/dok/43519.php (vgl. Henkel 2011).
[19] Söllner (1997: 188) beruft sich dabei auf: Ayres/Kneese (1990: 103ff.), Binswanger (1992: 114f., 1993: 214), Hall et al. (1986: 144f.).
[20] Dies stellt im Übrigen auch Luks (2000: 32) fest.
[21] Keil (1999: 96) weist daraufhin, dass hier eigentlich der Begriff ‚limitational‘ verwendet werden müsste, da der Begriff ‚komplementar‘ nur in der Haushaltstheorie üblich ist, nicht aber in der Produktionstheorie.
[22] Eine ähnliche Formulierung findet sich bei Costanza et al. 1991: 7): „Given our high level of uncertainty about this issue, it is irrational to bank on technology’s ability to remove resource constraints. If we guess wrong then the result is disastrous – irreversible destruction of our resource base and civilization itself. We should, at least for the time being, assume that technology will not be able to remove resource constraints. If it does, we can be pleasantly surprised. If it does not, we are still left with a sustainable system“
- Arbeit zitieren
- Reinhold Uhlmann (Autor:in)Christoph Alexander Heinrichsdorff (Autor:in)Gunnar Halde (Autor:in)Sebastian Sohn (Autor:in), 2013, Schneller, höher, weiter? Die Grenzen des Wirtschaftswachstums, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232754
Kostenlos Autor werden



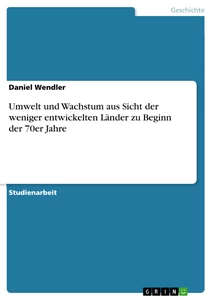


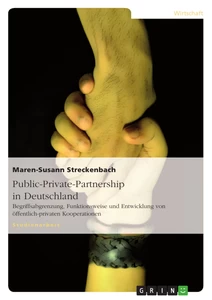







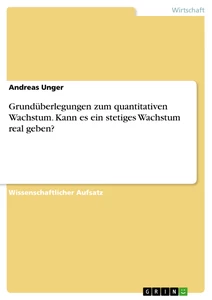







Kommentare