Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Zusammenfassung
1. Einleitung
2. Identitätskonzepte im Schlaglicht des gesellschaftlichen Wandels
2.1 Identitätskonstruktionen- Versuch einer Einordnung und Begriffsbestimmung
2.2 G. H. Mead und Identität als Spiegel sozialer Prozesse
2.3 E. H. Erikson und das Entwicklungsmodell der acht Phasen des Menschen
2.4 Mead und Erikson in der Gegenüberstellung
2.5 Identität in der Postmoderne
3. Weibliche Identität und Postmoderne
3.1 Frauen als Protagonistinnen des gesellschaftlichen Wandels
3.2 Weibliche Lebensentwürfe zwischen Tradition und (Post-)Moderne
3.3 Weibliche Identität im Kontext postmoderner Körperbilder
4. Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
Urheberrechtliche Erklärung
Erklärung zur Veröffentlichung von Abschlussarbeiten
Zusammenfassung
Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht die Frage, wie Frauen in postmodernen Gesellschaften Identität herstellen, angesichts eines gesellschaftlichen Wandlungsprozesses, der mit einer Auflösung traditioneller Leitbilder und einer enormen Pluralität und Vielfalt optionaler Lebensmodelle einhergeht. Der Wandel von Rollen und der Positionierung von Frauen im gesellschaftlichen Kontext spiegelt sich auch im Wandel des Verständnisses von Identität. Dabei bilden die theoretischen Konzeptionen nach George H. Mead und Erik H. Erikson mit ihren unterschiedlichen Grundlagen zur Erklärung des Herstellungsprozesses von Identität den Ausgangspunkt der vorliegenden Analyse. Postmoderne Perspektiven zeichnen im Kontrast ein brüchiges, fragmentiertes Bild von Identität, als ein Spiegelbild gesellschaftlicher Prozesse des Auseinanderbrechens ursprünglich festgelegter Strukturen.
In diesem Kontext zeigen sich besondere und widersprüchliche Anforderungen, denen Frauen gegenüberstehen. In einem Spannungsfeld zwischen traditionellen Leitbildern und postmodernen Paradigmen von Freiheit und Unabhängigkeit müssen Frauen Identität aushandeln, wobei sie gleichzeitig aus traditionellen Rollenvorstellungen freigesetzt und in anderer Weise wiederum an diese gebunden werden. Diese Widersprüchlichkeit wird insbesondere im sich wandelnden Stellenwert von Erwerbsarbeit und Familie deutlich, aber auch in Bezug auf den Körper, dessen identitätsstiftende Bedeutung in postmodernen Kulturen enorm an Bedeutung gewonnen hat. Während einerseits die Grenzen in vielfältiger Weise verschwimmen und Geschlechtszugehörigkeiten ihrer Definitionsgrundlage entzogen werden, so stehen diesen Auflösungstendenzen mächtige mediale Leitbilder von stereotyper Weiblichkeit gegenüber.
Auf Grundlage des Wandels von Identität im theoretischen Diskurs lässt sich eine Brücke schlagen zu den sich verändernden gesellschaftlichen Bezugssystemen, innerhalb derer Frauen sich verorten und Identität im sozialen Kontext aushandeln. Es lässt sich aufzeigen, wie komplex und diffizil sich Identitätskonstruktionen in der Postmoderne gestalten. Frauen bewegen sich in einem Bezugsrahmen voller Widersprüche, zwischen Fragmenten vielfältiger optionaler Identitäten, zwischen neuen Anforderungen und Chancen, zwischen traditionellen Zuweisungen und Neubewertungen traditioneller Leitbilder.
1. Einleitung
Die gesellschaftlichen Bedingungen für weibliche Lebenszusammenhänge haben sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gewandelt. Frauen haben heute ein hohes Maß an individueller Freiheit erlangt, den Zugang zu Bildung, Selbstbestimmung und die Möglichkeit einer autonomen Lebensführung. Und doch, so besagt eine Studie der Universität Pennsylvania, sind Frauen in industrialisierten Ländern über die Jahrzehnte zunehmend unglücklicher geworden: „Women`s relative subjective well-being has fallen over a period in which most objective measures point to robust improvements in their opportunities“ (Stevenson und Wolfers, 2009, S. 194)[1]. Obgleich sich die Lebensbedingungen für Frauen enorm verbessert haben und dies auch entsprechend erlebt wird, scheint die durchschnittliche Lebenszufriedenheit von Frauen insgesamt abgenommen zu haben (ebd., S.221). Die Autoren (ebd., S.222) diskutieren als Begründung für die sinkende Zufriedenheit verschiedene Aspekte, wie etwa einen nachlassenden sozialen Zusammenhalt oder die Tatsache, dass Frauen ihre Zufriedenheit nicht mehr ausschließlich am häuslichen Glück messen, sondern eine Brücke schlagen müssen zwischen der Zufriedenheit am Arbeitsplatz und dem Glück im Privaten. Als weiterer Grund wird angeführt, dass Frauen heute eine breitere Referenzgruppe zum Vergleich heranziehen und sich in der Gegenüberstellung als weniger glücklich einschätzen (ebd., S.223 ff.). Und doch lassen sich keine eindeutigen oder gar eindimensionalen Erklärungen für dieses Paradox finden (ebd., S.222).
Mein Interesse an der Frage, wie Frauen in postmodernen Gesellschaften Identität herstellen, angesichts einer sich im Rahmen von Individualisierung und Pluralisierung verändernden Welt, wurde durch diese Publikation angestoßen. Ich möchte in der vorliegenden Arbeit ergründen, wie Frauen angesichts des drastischen gesellschaftlichen Wandels Identität aushandeln und inwiefern klassische Identitätstheorien eine Antwort auf diese Fragen liefern können. Dabei interessiert mich besonders, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen Frauen der Aufgabe begegnen, Identität herzustellen und zu bewahren. Traditionelle Muster, Idealbilder und bestimmte Schablonen von Weiblichkeit scheinen bis heute erhalten, ungeachtet der enormen gesellschaftlichen Veränderungen. Diesen Eindruck hinterlässt zumindest die Durchsicht populärwissenschaftlicher Lektüre, in der der Leser mit einer Flut an Kontroversen zur Gleichstellung von Frauen und deren Arbeitsbedingungen, Diskussionen zu stereotypisierten medialen Leitbildern und Themen zum beruflichen Erfolg und Mutterschaft konfrontiert wird. So äußert die Finanzvorsteherin des sozialen Netzwerkes Facebook[2] beispielsweise in einem Interview: „Frauen müssen eine Wahl treffen: Sie können entweder gute Mütter oder respektierte Expertinnen sein, aber niemals beides“ (Stein 2013).
Gleichzeitig wird vom sogenannten „Hochstapler- Syndrom“ (Pezzei 2010) gesprochen, wobei insbesondere Frauen ihre eigene Leistung für nicht gut genug halten. Dies läge an den “nach wie vor gesellschaftlich verankerten Rollenzuschreibungen: Das in den 50er Jahren geprägte Ideal vom Heimchen am Herd steht Karriere, Macht und Erfolg im Wege“ (ebd.). Gerade diese Aspekte stehen den zu Beginn dieser Arbeit erwähnten Freiheiten weiblicher Lebensführung diametral entgegen, so dass anzunehmen ist, dass weibliche Identitäten sich in einem Spannungsfeld zwischen traditionellen Vorstellungen und der Freisetzung aus diesen Bindungen befinden.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werde ich daher ein besonderes Augenmerk auf die mit gesellschaftlichen Veränderungen postmoderner Kulturen verzahnte Verschiebung traditioneller Konstanten legen, die von einer Auflösung von Leitbildern und weiblichen Normalbiographien begleitet ist. Meine Analyse wird sich dabei auf die Dimensionen der Erwerbsarbeit und Familie konzentrieren und auf den Aspekt des Körpers als ‚Präsentationsplattform‘ von Identität und Medium der Verortung im sozialen Kontext. Obgleich weibliche Identitäten und Lebensbezüge im Kern immer individuell, diversifiziert und differenziert gedacht werden müssen, so bedingen doch gesellschaftliche Prozesse und Dynamiken den Rahmen, in dem sich Frauen bewegen und Identität herstellen. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen spiegeln sich dabei auch in den jeweiligen Identitätskonzepten, so dass Identität nicht aus ihrem historischen Kontext herausgelöst betrachtet werden kann. Identitätsfragen sind eng mit sozialen und kulturellen Aspekten verbunden und können als Begleiterscheinungen gesellschaftlicher Umbruchsituationen verstanden werden, durch die die Postmoderne gekennzeichnet ist.
Die Analyse weiblicher Identität vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Wandels bezieht sich aber immer auch auf das Verhältnis der Geschlechter, das sich im Hinblick auf die erheblichen Veränderungen sozialer und kultureller Strukturen gleichsam in einem Prozess des Umbruchs befindet. Weibliche Identität gestaltet sich dabei als ein fortwährender Aushandlungsprozess zwischen Selbst- und Fremdbildern, zwischen Geschlechternormen, Leitbildern und mit Weiblichkeit konnotierten kulturellen Vorstellungen. Im Hinblick auf die Fragestellungen dieser Arbeit sollen dabei neben Konzepten von Identität im Kontext gesellschaftlicher Veränderungsprozesse auch strukturelle Zusammenhänge des Geschlechterverhältnisses beleuchtet werden. Identität ist in postmodernen Gesellschaften von Widersprüchen, Fragmentierung und Pluralität gekennzeichnet, wobei besonders diese Aspekte auf Grundlage der vorliegenden Arbeit herausgestellt und sichtbar gemacht werden sollen.
2. Identitätskonzepte im Schlaglicht des gesellschaftlichen Wandels
Im Folgenden werde ich zwei Konzeptionen vorstellen, die sich mit dem Prozess des Herstellens von Identität beschäftigen und die das Verständnis von Identität maßgeblich beeinflussten. Die Frage der Identität, die heute beantwortet wird mit der Annahme, dass Identität ein offener, nie abgeschlossener Konstruktionsprozess ist, der im Austausch mit der sozialen Umgebung stattfindet, lässt sich in beiden Konzeptionen bereits erkennen.
Während die Konzeption G. H. Meads in einer langen Tradition steht, die bis heute an Aktualität nicht verloren hat, ist das Identitätskonzept nach E. H. Erikson einerseits wegweisend für ein Verständnis von Identität als krisenhafter, lebenslanger Prozess, aber es ist auch unmittelbar mit dem gesellschaftlichen Kontext verwoben, in dem Erikson es entwarf.
Im Folgenden werde ich zunächst die Idee der Konstruierbarkeit von Identität skizzieren und diesen Gedanken in den historischen Zusammenhang einordnen. Im Anschluss werden die Identitätskonzeptionen nach Mead und Erikson mit ihren jeweils unterschiedlichen Ausgangspunkten und Perspektiven auf die Entwicklung von Identität vorgestellt. Daran anknüpfend soll Identität unter den Bedingungen der Postmoderne diskutiert werden und ich werde eine Verbindung zu der Herstellung weiblicher Identität in diesem Bezugsrahmen erarbeiten.
2.1 Identitätskonstruktionen- Versuch einer Einordnung und Begriffsbestimmung
Die Vorstellung der Konstruierbarkeit der eigenen Identität ist relativ neu, wobei sie nach Kraus (1999, S.1) als Grundgedanke der gesellschaftlichen Moderne[3] betrachtet werden kann. Der Kerngedanke liegt dem Soziologen Wagner (2002, S.307) zufolge besonders in der Betonung der Autonomie des Individuums in Bezug auf die individuellen Lebensorientierungen und die Ablehnung einer vordefinierten Identität. Der Philosoph Kellner (1992, S.141) verweist vor diesem Hintergrund auf den historischen Wandlungsprozess, in dem sich Identität für die Individuen erst zur Aufgabe entwickelt hat. Kellner (ebd.) charakterisiert Identität in vormodernen Gesellschaften als „fixed, solid, and stable. Identity was a function of predefined social roles and a traditional system of myths which provided orientation […] [furthermore] identity was unproblematical and not subject to reflection or discussion” (ebd.). Der Begriff der Identität und die Idee ihrer Konstruierbarkeit verbreiteten sich dabei in dem Maße, in dem das Herstellen von Identität zunehmend zum Problem wurde (Keupp et al. 1999, S.26). Als Erikson 1946 den Identitätsbegriff im Rahmen seiner Konzeption einführte, war dieser Begriff bereits krisenhaft angelegt, Identität hatte „von Anfang an mit Krisenerfahrungen, Heimat- und Ortlosigkeit des Subjektes in der Moderne zu tun“ (ebd.).
Insofern hatte Identität von Beginn an Arbeitscharakter, wobei das Individuum sich nach Keupp et al. (ebd., S.27) aktiv um sein Verhältnis zur Welt und zu sich selbst zu kümmern hatte, es entwarf sich und seine Selbstverortung und war dabei auf wechselseitige soziale Anerkennung angewiesen. Dabei ist zu beachten, dass der Gedanke der Konstruierbarkeit einer eigenen Identität nicht für alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen galt, sondern nach Kraus (1999, S.2) bis weit in das 20. Jahrhundert hinein „Teil eines bürgerlich- elitären Diskurses“ (ebd.) war, der stark durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, den Zugang zu Bildung und auch durch den Geltungsbereich traditioneller Geschlechterrollen determiniert wurde. Wagner (1995, S.232) verweist dabei auf die Tatsache, dass die Vorstellung der Konstruierbarkeit von Identität großen Teilen der Bevölkerung nicht zugänglich war, wie etwa Angehörigen der Arbeiterschicht oder auch Frauen.
In der organisierten Moderne mit ihrer Klassenkultur und sozialen Ordnung war für die Individuen nach Wagner (ebd., S. 233 ff.) ein sicherer Platz innerhalb dieser Struktur vorgesehen, die weitgehend durch Gehorsam und Konformität der Individuen geprägt war. Individuen hatten sich, indem sie Teil der Gesellschaft wurden, in ihrem vorgegebenen, modernen „Gehäuse“ (Weber 1920, S.188) einzurichten, wobei die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unter denen Identität hergestellt wurde als berechenbar und von Kontinuität geprägt angesehen werden können. In diesem gesellschaftlichen Kontext entwickelte Erikson seine Identitätskonzeption, die, wie sich im Verlauf der vorliegenden Arbeit zeigen wird, eng mit dem soziokulturellen Kontext der Moderne verwoben ist. Die Gestaltbarkeit der eigenen Identität im Rahmen des vorgegebenen sozialen Bezugsrahmens der Moderne kann mit Keupp et al. (1999, S.55) als eine ‚Kür‘ betrachtet werden, die in postmodernen Gesellschaften zunehmend zur ‚Pflicht‘ wird.
Mitte der siebziger Jahre wurden die Individualisierungsprozesse durch das Aufbrechen der organisierten Moderne vorangetrieben. Identität wurde dabei zum Knotenpunkt einer aktiven Konstruktion des eigenen Lebensentwurfes, einer Selbstverortung und Positionierung in einer sich ständig verändernden Umwelt mit einer Vielzahl möglicher Lebensentwürfe, Chancen und Risiken. Das „unternehmerische Selbst“ (Wagner 1995, S.243) betrat die gesellschaftliche Bühne, das sich zunehmend selbstverantwortlich für die Gestaltung seines Lebens und seine soziale Positionierung einsetzen musste. Die Konstruktion einer eigenen, individuellen Identität im gesellschaftlichen Kontext ist heute zum Bezugspunkt für einen individuellen Lebensentwurf geworden. Identität wird in der Postmoderne zu einem „freely chosen game, a theatrical presentation of the self, in which one is able to present oneself in a variety of roles, images, and activities” (Kellner 1992, S.158).
Der Soziologe Stuart Hall (1994) charakterisiert die Folgen der gesellschaftlichen Umbrüche für die Individuen folgendermaßen:
„Das Subjekt, das vorher so erfahren wurde, als ob es eine einheitliche und
stabile Identität hätte, ist nun im Begriff, fragmentiert zu werden. Es ist nicht
aus einer einzigen, sondern aus mehreren, sich manchmal widersprechenden
oder ungelösten Identitäten zusammengesetzt [….] Der Prozess der Identi-
fikation selbst, in dem wir uns in unseren kulturellen Identitäten entwerfen,
ist offener, variabler und problematischer geworden“. (S.182)
In postmodernen Gesellschaften koexistieren Tradition und (Post-)Moderne, stehen sich Prozesse des Aufbrechens tradierter Strukturen und rückwärtsgerichtete Gegentendenzen ebenso gegenüber, wie sich Individuen aus überkommenen Strukturen ablösen und in neu entstehende Gefüge einbinden. Der Psychologe Kraus (1999, S.3) merkt dabei an, dass alte Formen der Subjektkonstruktion in der Postmoderne nach wie vor verfügbar bleiben und sich als definitionsmächtig für Facetten der Identität erweisen können, abhängig von sozialen Kontexten und Lebenswelten der Individuen. Das Leben in postmodernen Gesellschaften ist gekennzeichnet durch Kontingenz, dabei stehen dem Entwurf des modernen Menschen als Einheit postmoderne Biografien gegenüber, die gekennzeichnet sind durch Flexibilität, Brüche und Unsicherheiten (Behrens 2004, S. 83). Die Frage der Konstruktion von Identität in postmodernen Gesellschaften erscheint vor diesem Hintergrund ebenso hinfällig wie zentral.
2.2 G. H. Mead und Identität als Spiegel sozialer Prozesse
Meads[4] Konzeption von Identität steht in der Tradition des philosophischen Pragmatismus[5] und verweist auf den gesellschaftlichen Kontext als bedeutsamen Aspekt von Identität, wobei er Kommunikation als zentrales Element gesellschaftlicher Prozesse und damit auch der Identität betrachtet (Mead 1968., S. 299). Zentral ist dabei eine Vorstellung von Identität, die sich nur in Wechselwirkung mit den Identitäten der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe konstituiert, der Erfahrung einer eigenen Identität im Spiegel des Anderen, durch die sich der Einzelne seiner Identität bewusst wird. Vermittelndes Element ist Mead (ebd., S.113) zufolge die menschliche Fähigkeit zur Rollenübernahme, die es den Individuen ermöglicht, sich in ein Gegenüber hineinzuversetzen, die eigene Person und ihr Handeln vom Standpunkt des Anderen zu denken. Wechselseitige Rollenübernahme und eine Verschränkung der Perspektiven werden somit zum Ausgangspunkt kommunikativer Verständigung über Perspektiven und Rollen (Abels 2010, S.263). Ermöglicht wird diese über das Element der Gesten oder der Sprache als sogenannte signifikante Symbole, als „Symbolisierung von Erfahrung“ (ebd., S.261). Zeichen, Gesten und Sprache bewegen sich dabei in einem bestimmten Bedeutungskontext, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Beteiligten ähnlichen gesellschaftlichen Sozialisationseinflüssen unterlagen. Vor diesem Hintergrund werden sie zu sogenannten signifikanten Symbolen, wenn sie in einem bestimmten sozialen Bezugsrahmen dieselben typischen Reaktionen auslösen (ebd.). Im Prozess der Verständigung, der Übernahme der Position des Anderen und durch Reflektion der Bedeutung einer vorliegenden Situation, geben die Individuen dieser einen „ideellen Rahmen“ (Mead 1968, S.224). Die wechselseitige Verständigung konstituiert sich aber nicht nur in Bezug auf die Position des Anderen, sondern auch im Hinblick auf die eigene Person: „Sagt eine Person etwas, so sagt sie zu sich selbst, was sie zu den anderen sagt; andernfalls wüsste sie nicht, worüber sie spricht“ (ebd., S.189).
Im Rahmen des kommunikativen Prozesses bezieht sich die mitteilende Person nicht nur auf ihr Gegenüber, sondern sie nimmt Mead zufolge „die Haltung des anderen Individuums genauso ein […], wie sie sie beim anderen hervorruft. Sie befindet sich selbst in der Rolle der anderen Person, die sie auf diese Weise anregt und beeinflusst“ (ebd., S.300). Indem das Individuum die Rolle des Anderen übernimmt, ist es in der Lage, den eigenen Kommunikationsprozess zu lenken und kann sich auf sich selbst besinnen (ebd.). Kommunikation und wechselseitige Rollenübernahme begründen dabei das „Identitätsbewusstsein“ (ebd., S.180), indem der Einzelne im Rahmen dieses Prozesses selbst zum Objekt wird (ebd.). Ein Bewusstsein um die eigene Identität erfährt der Einzelne also nur im Spiegel des Anderen, indem er dessen Haltung übernimmt und auf das reagiert, was an das Gegenüber gerichtet ist, „und wo diese Reaktion Teil des eigenen Verhaltens wird, wo man nicht nur sich selbst hört, sondern sich selbst antwortet“ (ebd., S.181). Indem das Individuum zugleich subjektiv Handelnder und Objekt ist, indem es sich selbst mit den Augen anderer sieht, sich selbst mit diesem vergleicht, Auslöser eigenen Handelns erkennt und reflektiert, sich der Ähnlichkeit und Unterschiede zu seinem Gegenüber bewusst wird, erhält es ein Bewusstsein für die eigene Identität.
Die Entstehung von Identität im ‚play‘ und ‚game‘ nach Mead[6]
Mead unterscheidet zwei Phasen, die für die Identitätsentwicklung bedeutend sind und die in enger Wechselwirkung mit der sozialen Umwelt des Individuums stehen. Kinder entwickeln im Rahmen dieser Phasen ein Bewusstsein für eine eigene Identität, indem sie sich zunächst im nachahmenden Spiel (‚play‘), und später im organisierten Spiel (‚game‘) an zunehmend größeren sozialen Bezugssystemen orientieren.
Im ‚play‘ übernimmt das Kind die Rollen sogenannter signifikanter Anderer, also von Personen, die für das Kind eine zentrale Bedeutung haben, wie etwa die Rolle der Mutter, des Vaters oder auch die des Lehrers oder eines Polizisten (Abels 2010, S.265; Mead 1968, S.192). Das Kind kann sich im ‚play‘ mit seiner Phantasie ganz auf die Rolle des einen signifikanten Anderen in der unmittelbaren Situation beziehen und es kann nach Belieben seine Rolle wechseln oder das Spiel beenden. Im Laufe seiner Entwicklung begegnet das Kind immer größeren symbolischen Bezugssystemen und lernt, deren Regeln zu erfassen, Rollen zu organisieren und es erfährt spezifische Normen und Erwartungen, die in den Rollen organisiert sind. Mead (1968, S.194) betrachtet die „organisierte Rolle“ (ebd.) als entscheidend für das Identitätsbewusstsein.
Im ‚game‘, muss das Kind die Rolle vieler Anderer übernehmen. Mead (ebd., S.193 ff.) illustriert dies am Beispiel eines Baseballspieles, in dem Kinder die Perspektiven und möglichen Handlunger aller Mitspieler berücksichtigen müssen. Dabei liegt der zentrale Unterschied zwischen ‚play‘ und ‚game‘ darin, „dass in letzterem das Kind die Haltung aller Beteiligten in sich haben muss. Die vom Teilnehmer angenommenen Haltungen der Mitspieler organisieren sich zu einer gewissen Einheit, und diese Organisation kontrolliert wieder die Reaktion des Einzelnen“ (ebd., S.196). Die Gesamtheit aller Haltungen und Handlungszusammenhänge einer organisierten Gemeinschaft oder gesellschaftlichen Gruppe nennt Mead (ebd.) das sogenannte verallgemeinerte oder generalisierte Andere. Damit verweist der Aspekt des generalisierten Anderen auf die Gesamtheit gesellschaftlicher Werte und Normen, die in einer bestimmten Situation relevant sind (ebd., S.197 ff.). Nach Mead (ebd.) ist das „Hereinholen der weitgespannten Tätigkeit des jeweiligen gesellschaftlichen Ganzen oder der organisierten Gesellschaft in den Erfahrungsbereich eines jeden in dieses Ganze eingeschalteten oder eingeschlossenen Individuums […] die entscheidende […] Voraussetzung für die volle Entwicklung der Identität“ (ebd.). Identität stellt für Mead (ebd., S.216) ein im Kern „kognitives Phänomen“ (ebd.) dar, dessen Basis der gesellschaftliche Bezugsrahmen ist.
‚I‘ und ‚me‘ als Dimensionen des ‚Self‘[7]
Mead unterscheidet zwei Dimensionen, aus denen sich das ‚Self‘ entwickelt. Dabei bezeichnet ‚Self‘ die Identität in Bezug auf eine „eigene spezifische Individualität“ (ebd., S.245), die sich durch die individuelle Position im gesellschaftlichen Prozess ergibt, indem jede einzelne Identität einen ganz eigenen Aspekt von ihrem einzigartigen Standort innerhalb dieses Prozesses spiegelt (ebd., S.245 ff.). Dem Soziologen Abels (2010, S.273) zufolge kann das ‚Self‘ auch mit ‚Ich- Identität‘ übersetzt werden in Bezug auf die Reflexivität des ‚Self‘, wobei die Ich- Identität im Rahmen einer Reflexion der Erwartungen der Anderen und der Vorwegnahme ihrer Reaktion in der Interaktion immer neu entworfen wird.
Mead (1968, S.239) konstatiert, dass die Erfahrung von Identität ausschließlich aus sich selbst heraus nicht möglich ist, sondern dass sie sich im Kontrast zum Anderen entwickeln muss. Für die Konstitution des ‚Self‘ ist das ‚me‘ die selbstreflexive Dimension, die es dem Individuum ermöglicht, sich selbst vom Standpunkt der Anderen zu betrachten, während das ‚I‘ Träger der individuellen Reaktionen ist (ebd., S.218 ff.). Die Dimension des ‚me‘ repräsentiert die Summe der organisierten Haltungen der Anderen (ebd., S.218).
Abels (2010, S.270) spricht dabei von der sozialen Dimension von Identität, die sich in der Reflexion und Wahrnehmung der eigenen Person im Spiegel der Anderen im Prozess der Sozialisation ergibt. Im ‚me‘ erfährt sich das Individuum als Objekt. Es wird sich seiner Identität bewusst durch die Fähigkeit, die organisierten Haltungen zu übernehmen. Das ‚me‘ ist nach Mead (1968, S.240) Repräsentant der sozialen Bilder der Anderen, die sich das Individuum im Rahmen der Sozialisation selbst zuschreibt, sowie Vermittler der Anpassung an die organisierte Welt und Kontrollorgan für eigene Handlungen. Mead (ebd., S.241) charakterisiert das ‚me‘ als „ein von Konventionen und Gewohnheiten gelenktes Wesen. Es ist immer vorhanden. Es muss jene Gewohnheiten, jene Reaktionen in sich haben, über die auch alle anderen verfügen; der Einzelne könnte sonst nicht Mitglied einer Gesellschaft sein“ (ebd.).
Damit wird das ‚me‘ zur Grundlage für “den Eintritt in die Erfahrung der anderen“ (ebd., S.243) und zum Ausgangspunkt für das Individuum, Mitglied der Gesellschaft zu werden. Dabei bezieht sich Mead (ebd., S.254) auch auf Sigmund Freud (vgl. Freud 1930, 1933) und beschreibt das ‚me‘ als einen „Zensor“ (Mead 1968, S.254) im Sinne des Über- Ichs, das Repräsentant der gesellschaftlichen Kontrolle ist. Das ‚me‘ gibt nach Mead (ebd., S.253 ff.) dem ‚I‘ seine Form, es bestimmt die Struktur des ‚I‘, während das ‚I‘ den unbewussten Teil der Identität repräsentiert. Das ‚I‘ reagiert auf die Identität, die sich durch die Übernahme der Haltungen Anderer entwickelt, wobei sich im Rahmen der Übernahme das ‚me‘ konstituiert und das Individuum darauf als ein ‚I‘ reagiert (ebd., S.217).
Im ‚I‘ kommen Phantasie und spontane Reaktion zum Ausdruck, es kann sich gegen starre Konventionen einer Gemeinschaft wenden und sich in Abweichung zum ‚me‘ ausdrücken (ebd., S.243). Der Soziologe Abels (2010, S.269) merkt an, dass das ‚I‘ vor diesem Hintergrund nicht vollständig sozialisierbar ist. Die Reaktionen des ‚I‘ auf die Haltungen der Anderen können dabei immer nur rekursiv erfasst werden, das heißt, die Erfahrung des ‚I‘ kann erst dann erfolgen, wenn seine Reaktion bereits stattgefunden hat. Hier wird auch der schöpferische und spontane Kern des „I“ deutlich. Im Zusammenspiel von ‚I‘ und ‚me‘ bestimmt das ‚me‘ die Grenzen und liefert die Motivation, die es dem ‚I‘ ermöglicht, das ‚me‘ für sich einzusetzen (Mead 1968, S.254 ff). Dabei sind nach Mead beide Dimensionen, das ‚I‘ und das ‚me‘, für die Identität notwendig. Das Individuum muss die Haltungen der Anderen einnehmen, um Teil der Gemeinschaft zu werden und durch die Reaktionen und Handlungen des Individuums wirkt es wiederum auf seine Umgebung ein und verändert diese.
Nach Mead (ebd., S.246) führt „jede Anpassung […] zu irgendeiner Veränderung innerhalb der Gemeinschaft, an die sich der Einzelne anpasst“ (ebd.). Identität erhält das Individuum demnach nicht durch eine bestimmte festgelegte Ordnung, sondern indem es sich als Teil sozialer Prozesse gestaltet und verändert.
2.3 E. H. Erikson und das Entwicklungsmodell der acht Phasen des Menschen
In der Tradition der Psychoanalyse entwickelte Erikson[8] ein Modell der Identitätsentwicklung, das einerseits Bezug nimmt auf Sigmund Freuds Theorie der psychosexuellen Entwicklung (vgl. Freud 1930, 1933) und andererseits das Blickfeld erweitert bezüglich der gesellschaftlichen Bedingungen, die mit Identität in Wechselwirkung stehen.
Darüber hinaus versteht Erikson Identitätsentwicklung als einen sich über die gesamte Lebensspanne hinweg vollziehenden Prozess, wobei er von der Vorstellung einer „gesunden Persönlichkeit“[9] (Erikson 1970, S.92) ausgeht. Identität wird allerdings nicht als ein festgelegtes, unveränderbares Konstrukt betrachtet, sondern als ein Prozess, der sich zwischen Individuum und dessen kulturellem Bezugsrahmen vollzieht (ebd., S.18). Erikson (ebd., S.92) spricht dabei von einem „epigenetischen Prinzip“ (ebd.), einem Grundplan, und „dass die Teile aus diesem Grundplan heraus erwachsen, wobei jeder Teil seinen Zeitpunkt der speziellen Aszendenz besitzt, bis alle Teile entstanden sind, um ein funktionierendes Ganzes zu bilden“ (ebd.). Nach Erikson konstituiert sich Identität also nicht allein aus dem Individuum heraus, sondern ist auch maßgeblich durch soziale und kulturelle Elemente bestimmt, wobei die Identitätsentwicklung selbst einer stufenförmigen Abfolge unterliegt.
Im Rahmen der entwicklungsspezifischen Stufen steht das Individuum bestimmten definierten Krisen oder Konflikten gegenüber, die nach Abels (2010, S.277) als Ergebnis der Erfahrung einer Differenz zwischen innerer Entwicklung und der jeweiligen Anforderungen der sozialen Umwelt definiert werden können. In jeder Stufe der Entwicklung kommt es zu einem Konflikt der „Haltung eines Individuums sich selbst und der Welt gegenüber“ (Erikson 1970, S.97).
Die spezifischen Konflikte jeder Entwicklungsstufe markieren sich jeweils gegenüberstehende Pole, welche die zu leistende Entwicklungsaufgabe für das Individuum kennzeichnen.
Eine erfolgreiche Bearbeitung und Bewältigung dieser stellt dabei eine Voraussetzung für den Eintritt in darauf folgende Phasen und die Lösung der damit einhergehenden Krisen dar. Die gesunde Persönlichkeit geht nach Erikson „aus jeder Krise mit einem erhöhten Gefühl der inneren Einheit hervor“ (ebd., S.91), wobei spezifische Grundhaltungen entwickelt werden, die als „ein Gefühl von“ (ebd., S.97) beschrieben werden. Die Grundhaltungen bauen vor dem Hintergrund der entwicklungsspezifischen Stufen aufeinander auf, wobei das „subjektive Gefühl einer bekräftigenden Gleichheit und Kontinuität“ (ebd., S.15) als zentrales „Identitätsgefühl“ (ebd.) beschrieben wird. Nach Erikson ist Identität also gekennzeichnet durch einen lebenslangen Prozess aus festgelegten aufeinanderfolgenden Phasen und Krisen mit dem Ziel eines neuen Gleichgewichtes, auf das wiederum neue Krisen und Entwicklungsaufgaben folgen, die die wachsende Persönlichkeit auszeichnen. Nach Abels (2010, S.290) besteht Identität in Eriksons Konzeption „in der kritischen Vergewisserung der eigenen Biographie und ihrer weisen Annahme. Nach der Seite der kontinuierlichen Vorbereitung der eigenen Zukunft heißt Identität, sich selbst seine Meisterung zuzutrauen“ (ebd.).
Im Folgenden sollen die acht entwicklungsspezifischen Stufen und die damit verbundenen Krisen nach Erikson skizziert werden.
Erste Stufe: Vertrauen gegen Ur- Misstrauen
Im Zentrum dieser Stufe, die während der ersten Lebensjahre durchlaufen wird, steht die Entwicklung von Urvertrauen. Erikson (1970, S.97) beschreibt Urvertrauen als „eine alles durchdringende Haltung sich selbst und der Welt gegenüber“ (ebd.) und die Entwicklung des Urvertrauens als „grundlegende Voraussetzung der geistigen Vitalität“ (ebd.). Urvertrauen entsteht dabei durch die Fürsorge der Mutter, die das Kind ernährt, beschützt und sich ihm liebevoll zuwendet. Entscheidend ist die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung, die, auf Verlässlichkeit begründet, zur „Grundlage des Identitätsgefühls“ (Erikson 1971, S.243) führt. Die Entwicklung von Vertrauen mündet schließlich auch in eine vorwiegend optimistische Grundhaltung anderen Menschen gegenüber und ein grundlegendes Vertrauen in die Umwelt. Kann kein Urvertrauen aufgebaut werden oder wird es beschädigt, so entsteht ein fundamentales Misstrauen der Welt und auch sich selbst gegenüber und es können sich psychische Störungen. Entscheidend ist, dass vertrauensvolle, positive Erfahrungen mit der Umwelt überwiegen und nicht das völlige Ausbleiben von Frustrationen.
Erikson setzt die erste Stufe in Beziehung zu Glaube und Religion (ebd., S.245).
[...]
[1] Im Rahmen der Studie von Stevenson und Wolfers (2009) wurde die Zufriedenheit von Männern und Frauen über einen Zeitraum von 34 Jahren hinweg erhoben, begonnen 1972 bis 2006. Dabei wurden Daten aus den USA ebenso einbezogen wie auch Daten des Eurobarometer, die sich auf Länder der EU beziehen. Deutlich wird dabei, dass die Zufriedenheit von Frauen im Verlauf gesunken ist, sei es absolut als auch im Vergleich zu Männern. Da ich diese Studie lediglich zu deskriptiven Zwecken anführe, verzichte ich auf eine ausführliche Erläuterung.
[2] Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin von Facebook, wird im Frühjahr 2013 in verschiedenen Medien zitiert, in denen sie ihr Buch „Lean In: Women, Work and the Will to Lead“ (2013) bewirbt. Darin äußert sie sich unter anderem kritisch zum Bild arbeitender Frauen in den Medien, dem Verhältnis von Frauen zum beruflichen Leben insgesamt und in Bezug auf das Spannungsfeld zwischen Mutterschaft und Karriere.
[3] Die „Moderne“ im gesellschaftlichen Kontext konkret zu bestimmen erweist sich bei genauerer Analyse als ebenso schwierig, wie der Postmoderne eine zeitliche Bestimmung zu geben, die sich in ihren Diskursen auf die Paradigmen der Moderne bezieht. Als Ausgangspunkt für die Moderne kann nach Wagner (1995, S.26) das Zeitalter der Aufklärung betrachtet werden, da sich die Moderne insbesondere auf die Idee von Freiheit und Autonomie stützt und die beginnende Industrialisierung als Motor des modernen Projektes betrachtet werden kann.
[4] Der Sozialpsychologe und Philosoph Mead lebte von 1863 bis 1931. Sein als zentral betrachtetes Werk „Geist, Identität und Gesellschaft“ von 1934 stellt eine Zusammenschrift aus Vorlesungsaufzeichnungen und Manuskripten Meads dar. Mead gilt als bedeutender Vertreter des Symbolischen Interaktionismus , wobei Meads Schüler Herbert Blumer als Begründer dieser interaktionistischen Handlungstheorie gilt und sich dabei auf Überlegungen Meads beruft (vgl. Blumer 1969). Mit dem symbolischen Interaktionismus befindet sich Mead in einer langen Tradition, in der soziale Interaktion im Zentrum des Identitätsprozesses steht.
[5] Der Pragmatismus, eine Richtung der amerikanischen Philosophie, die ihren Höhepunkt zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte, geht mit den prominentesten Vertretern W.James und J.Dewey von der Handlung als zentrales Element des menschlichen Wesens aus (Abels 2010, S.260). Der Pragmatismus mit seiner Vielfalt an Positionen kann im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter differenziert und diskutiert werden.
[6] Obgleich ich mich im Rahmen der Ausführungen zu Mead auf die deutsche Ausgabe „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1968) beziehe, verwende ich im Folgenden die englischen Begriffe der Originalausgabe (vgl. Mead 1934). Wird in der deutschen Übersetzungsausgabe von ‚nachahmendem Spiel‘ und ‚organisiertem Spiel‘ bzw. ‚Wettkampf‘ gesprochen, werde ich die Begriffe ‚play‘ und ‚game‘ verwenden, da diese mir eingängiger erscheinen und im Rahmen einer Vielzahl an Bezügen zu Mead üblicherweise verwendet werden.
[7] Auch in diesem Zusammenhang verwende ich im Folgenden die englischen Begriffe der Originalausgabe (vgl. Mead 1934). Die Bezeichnungen ‚I‘ und ‚me‘ erscheinen mir übersichtlicher als die deutsche Übersetzung in der mir vorliegenden Ausgabe in ‚Ich‘ und ‚ICH‘. Zusätzlich ist anzumerken, dass der Begriff ‚Identität‘ im englischsprachigen Original nicht auftritt und dass die Gleichsetzung des ‚Self‘ mit ‚Identität‘ auch kritisch und differenziert betrachtet wird (vgl. Krappmann 1969, S.59).
[8] Erikson lebte von 1902 bis 1994 und war ein Schüler Anna Freuds, wobei er 1959 ein umfassendes Stufenmodell der Entwicklung vorstellte, das im Rahmen der ersten vier Phasen an Sigmund Freuds Phasentheorie der psychosexuellen Entwicklung angelehnt ist, jedoch in vielen Aspekten über diese hinaus geht.
[9] Erikson bezieht sich hier auf die Sozialpsychologin Marie Jahoda und definiert mit ihr die gesunde Persönlichkeit als eine, die „ihre Umgebung aktiv beherrscht, eine gewisse Einheit der Persönlichkeit zeigt und fähig ist, die Welt und sich selbst richtig wahrzunehmen“ (Jahoda 1950, zitiert nach Erikson 1970, S.92).
- Arbeit zitieren
- Raffaela Gentili (Autor:in), 2013, Konstruktionen weiblicher Identität in der Postmoderne, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232539
Kostenlos Autor werden









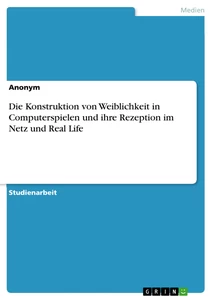











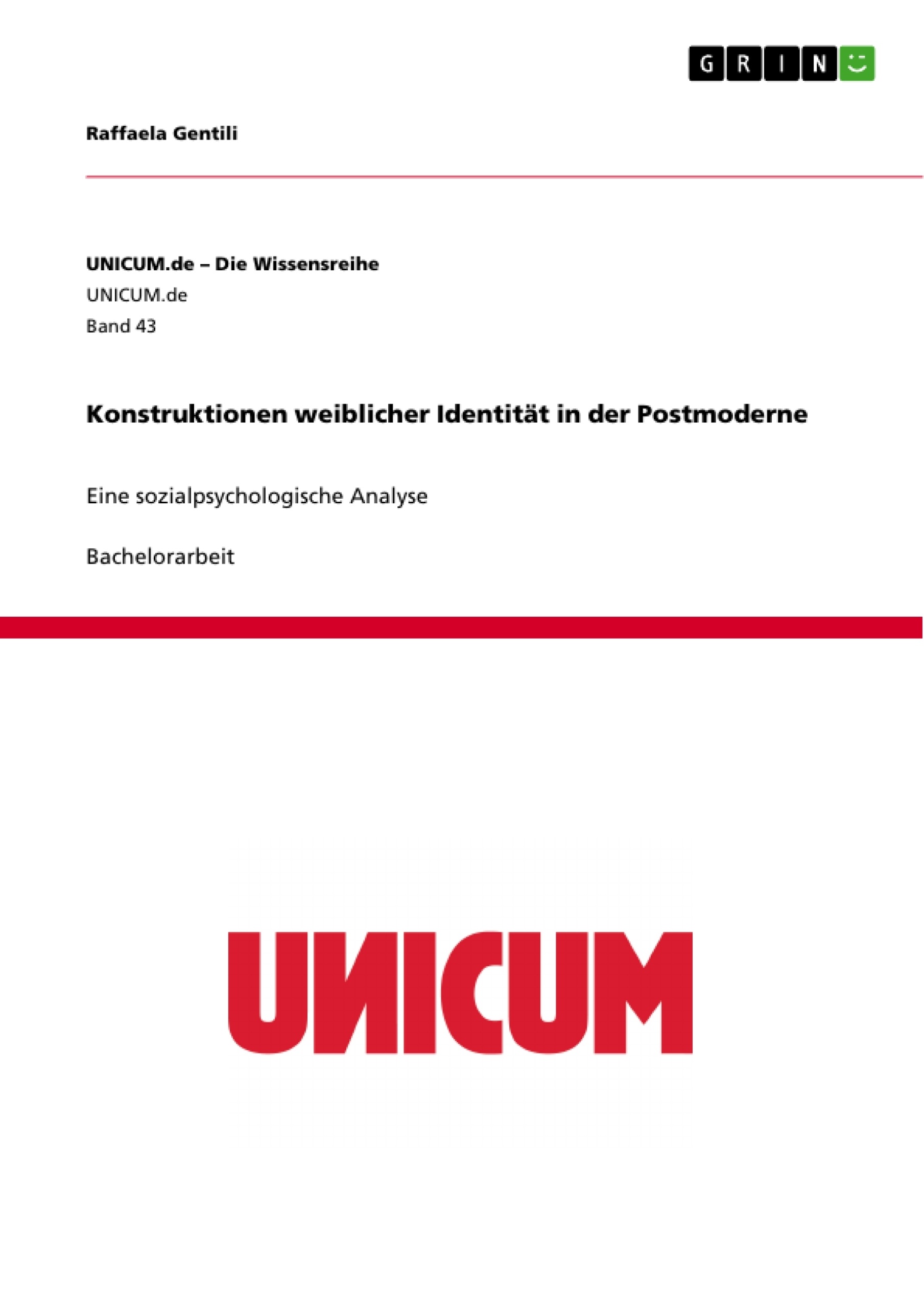

Kommentare