Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung
2. Indikatoren der Volksparteienerosion
2.1 Die Erosion des Wählerfundaments der Volksparteien
2.2 Die Erosion des Mitgliederfundaments der Volksparteien
3. Volksparteienerosion aus makrosoziologischer Erklärungsperspektive
3.1 Theoretische Grundlagen der cleavage und Milieu Theorie
3.2 Sozialstrukturelle Entwicklung in der BRD
3.2.1 Beruf und Wirtschaftssektoren
3.2.2 Konfession und Religion
3.3 Die Entwicklung der Parteipräferenzen in den verschiedenen Gruppen
3.3.1 Die Entwicklung der Parteipräferenz in Abhängigkeit von Stellung im Beruf und Gewerkschaftsmitgliedschaft
3.3.2 Die Entwicklung der Parteipräferenz in Abhängigkeit von Konfession und Religiosität
3.4 Der Erklärungsansatz in der Diskussion
4. Volksparteienerosion aus der Wertewandel Erklärungsperspektive
4.1 Theoretische Grundlagen der Wertewandeltheorie
4.2 Auswirkungen und Verlauf des Wertewandels in der BRD
4.3 Der Erklärungsansatz in der Diskussion
5. Volksparteienerosion aus sozialpsychologischer Erklärungsperspektive
5.1 Theoretische Grundlagen der Determinante der Parteiidentifikation
5.2 Dealignment als Abschwächung von Parteiidentifikation
5.3 Prüfung der Dealignment These
5.3.1 Entwicklung der Parteiidentifikation in der BRD
5.3.2 Kritische Auseinandersetzung mit den Erklärungsansätzen des Dealignments
5.4 Der Erklärungsansatz in der Diskussion
6. Abschließende Betrachtung und Ausblick
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Ergebnis der 17. Bundestagswahl vom 27. September 2009 bestätigte eine Entwicklung, welche nun schon seit Jahrzehnten zu beobachten und deren Ende nicht in Sicht ist. Es hält uns den scheinbar unaufhaltsamen Niedergang der beiden deutschen Volksparteien CDU und SPD vor Augen. Die Volksparteien stecken in einer tiefen Krise, womöglich in der tiefsten Krise Zeit ihres Bestehens. Hierbei handelt es sich keineswegs um eine an Übertreibung grenzende Aussage oder Meinungsmache, sondern um eine in der wissenschaftlichen Literatur, in den Medien und in der öffentlichen Meinung weit verbreitete Ansicht, welche nicht neu ist. Nie stand es schlechter um die beiden Volksparteien. Die CDU/CSU1 erreichte bei den Bundestagswahlen 2009 lediglich 33,8 Prozent aller abgegebenen Stimmen, die SPD gar nur 23 Prozent. Damit fuhr die CDU/CSU ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis nach 1949, die SPD gar das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit ein.
Die Ergebnisse der erst kürzlich durchgeführten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen vom 9. Mai 2010 lassen für die beiden Volksparteien keine Umkehr dieses Negativtrends erkennen. Die CDU fuhr ihr schlechtestes NRW-Ergebnis der Geschichte, die SPD das magerste NRW-Ergebnis seit 1954 ein. Diese Resultate können für die beiden großen Volksparteien weder als unvorhersehbare Wahlschlappen noch als Wahlphänomene der Jahre 2009 und 2010 verbucht werden. Vielmehr ist darin die Fortsetzung eines auf Bundesebene nun schon seit mehr als drei Jahrzehnten anhaltenden und bis jetzt nicht aufzuhaltenden Trends, welcher den Niedergang der beiden Volksparteien für die Zeit nach 1976 aufzeigt, zu erkennen. Im Jahre 1976 vereinten beide Volksparteien gemeinsam noch 91,2 Prozent aller Wählerstimmen auf sich. Mit Hinblick auf die 56,8 Prozent, welche die beiden Volksparteien bei der Bundestagswahl 2009 gemeinsam auf sich vereinigen konnten, entspricht dies einem Stimmenverlust von 34,4 Prozent innerhalb der letzten 33 Jahre. Dies wiederum entspricht einem jährlichen Stimmenverlust von gut einem Prozentpunkt und kann bei anhaltender Tendenz auf Dauer zum Verlust des Volksparteienstatus auf beiden Seiten führen. Fraglich ist dabei, inwieweit man angesichts der historisch schlechten Ergebnisse die Parteien CDU und SPD überhaupt noch als Volksparteien bezeichnen kann. Um in den Worten von Parteienforscher Karl-Rudolf Korte zu sprechen: „Bei den so genannten Volksparteien CDU und SPD handelt es sich nur noch um Volkspartei-Ruinen“ (Interview in ZDF heute, 09.05.2010). Diesen Erosionsprozess der beiden Volksparteien auf eine allgemeine Politikverdrossenheit zurückzuführen wäre schlichtweg ungenügend. Auch wenn die Wahlbeteiligung auf Bundes- und Landesebene seit Mitte der siebziger Jahre stetig sinkt und bei der Bundestagswahl 2009 mit 70,8 Prozent einen historischen Tiefstand in der Geschichte der Bundesrepublik erreichte, kann dies nicht als plausible Erklärung für die Krise der Volksparteien gelten. Dagegen spricht auch die Tatsache, dass die kleinen etablierten Parteien FDP, Bündnis 90/Die Grünen sowie die LINKE ihren gemeinsamen Stimmenanteil zwischen 1990 und 2009 von 18,4 Prozent auf 37,2 Prozent anheben und somit mehr als verdoppeln konnten. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Erstarken der etablierten kleinen Parteien wäre ebenfalls sehr interessant. In dieser Arbeit steht jedoch der Niedergang der beiden Volksparteien CDU und SPD im Mittelpunkt der Betrachtung.
Dieser Niedergang wird üblicherweise nicht nur anhand der Stimmenkonzentration, sondern auch anhand eines zweiten Indikators verdeutlicht (vgl. Wiesendahl 1998: 18; Arnim 2009: 190). Die Entwicklung der Parteimitgliederbestände bietet den beiden Volksparteien ebenfalls großen Anlass zur Sorge. Die Zahl der Parteimitglieder nimmt Jahr um Jahr ab. Die SPD zählte 1976 noch 1.022.191 Mitglieder. Die Zahl der Organisierten halbierte sich bis heute beinahe und betrug im Jahr 2009 nur etwas mehr als eine halbe Million (vgl. Abbildung 2). Nicht ganz so drastisch, aber ebenfalls gravierend, verlief der Mitgliederschwund bei der CDU. Diese zählte 1983 noch 734.555 Mitglieder. Bis 2009 sank die Zahl der Parteianhänger auf 521.149 (vgl. Ebd.). Diese Entwicklung ist für die Volksparteien besonders dramatisch, da nach wie vor davon ausgegangen wird, dass die Parteimitglieder zahlreiche wichtige Funktionen für die Parteien erfüllen. Schon Mintzel, der als ein profunder Kenner der Volksparteienforschung gilt, zeigte die besondere Bedeutung der Parteimitglieder für die Volksparteien auf (vgl. Mintzel 1996: 111-113).
Ein Interview des Parlamentarismusforschers Heinrich Oberreuter (2009a) zur Thematik der viel diskutierten Volksparteienkrise gab vor etwas mehr als einem Jahr den Anstoß zu dieser Arbeit. Sowohl aus Gründen der gegebenen Aktualität der Problematik als auch dem eigenen persönlichen Interesse beschäftigte mich dieses Thema seither immer wieder. Dabei stellte sich mir vorrangig die Frage, ob und, wenn ja, wie die Krise der Volksparteien wissenschaftlich erklärt werden kann. Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll daher auch eine kritische Auseinandersetzung mit den in der Wissenschaft gegebenen Erklärungsansätzen stehen.
Die Ursachen, die in der Literatur für den erwähnten Erosionsprozess der beiden Volksparteien angeführt werden, sind vielfältiger Natur und nicht unumstritten. Ziel dieser Arbeit ist es daher, die unterschiedlichen wissenschaftlichen Standpunkte zum oft dargestellten Niedergang der beiden Volksparteien in der BRD aufzuzeigen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten und sich kritisch mit den unterschiedlichen Standpunkten auseinanderzusetzen. Auf Grundlage bisher vorgelegter Studien zur Krisendiskussion um die Volksparteien soll sich dem Thema somit kritisch angenähert werden. Damit ergibt sich für diese Arbeit die folgende Frage: Wie kann auf Basis der maßgeblichen Literatur zur Niedergangsdebatte der beiden Volksparteien der Erosionsprozess bzw. die Krise von CDU und SPD in der Bundesrepublik Deutschland erklärt werden? Worin werden demnach die Ursachen für die Krise der Volksparteien gesehen?
Bevor dieser Frage ausführlich nachgegangen wird, soll in Kapitel 2 dieser Arbeit zunächst noch einmal näher auf die beiden Indikatoren, welche in der Regel für die Volksparteienkrise angeführt werden, eingegangen werden. Hierbei wird eine präzise Darstellung der Erosion des Wähler- und Mitgliederfundaments der Volksparteien im Fokus stehen. In Kapitel drei, vier und fünf folgt dann die umfangreiche und kritische Analyse von drei sehr populären wissenschaftlichen Erklärungsansätzen. Begibt man sich auf die Suche nach Erklärungsansätzen für die Volksparteienkrise, so kommt man nicht umhin diese aus soziologischer Perspektive, der Perspektive der Wertewandeltheorie sowie der sozialpsychologischen Perspektive zu betrachten. Da es sich bei diesen Erklärungsansätzen um sehr zentrale Ansätze handelt, und um diese ein breiter wissenschaftlicher Diskurs existiert, sollen sie auch im Mittelpunkt der Arbeit stehen und in Kapitel drei, vier und fünf diskutiert werden. Diese drei Kapitel ähneln sich dabei in ihrem Aufbau. So erfolgt in zunächst eine Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen, bevor dann diskutiert wird, inwiefern die theoretischen Erklärungen in der BRD auch in der Praxis ihre Auswirkung gefunden haben. Daran schließt sich für jedes der drei genannten Kapitel eine abschließende Diskussion an, welche bestenfalls klärt, inwieweit die gegebenen Erklärungsansätze tatsächlich zur Erklärung der Erosion der Volksparteien beitragen können.
Kapitel 3 setzt sich im Rahmen dieser Arbeit kritisch mit der soziologischen Erklärungsperspektive und dem Schwinden traditioneller Milieus und Cleavages auseinander. Kapitel 4 stellt die Wertewandeltheorie von Ronald Inglehart als Erklärungsversuch in den Mittelpunkt der Betrachtung. Kapitel 5 beleuchtet die sozialpsychologische Erklärungsperspektive kritisch. Dabei wird die Determinante der Parteiidentifikation und die theoretische Annahme einesDealignment-Prozesses, als die Abschwächung solcher Parteiidentifikation, als möglicher Erklärungsansatz für die Erosion der Volksparteien analysiert. Dass es unter den Erklärungsansätzen zu Überschneidungen kommen wird, ist abzusehen, da in gewisser Hinsicht auch ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Erklärungen zu erwarten ist. Dass bei der Betrachtung der drei genannten zentralen Erklärungsansätze stets Begleiterscheinungen auftauchen können, die auch für die Frage der Arbeit von Interesse sein könnten, ist ebenfalls zu erwarten. Insofern diese Begleiterscheinungen bzw. Nebenansätze einen kritischen Beitrag im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Leitfrage leisten können, wird an gegebenen Stellen selbstverständlich auch näher auf diese eingegangen. Die Arbeit schließt mit einer kritischen Betrachtung in Form eines Fazits sowie einem Ausblick.
2. Indikatoren der Volksparteienkrise
2.1 Die Erosion des Wählerfundaments der Volksparteien
Im folgenden Teilabschnitt soll - anhand von Wahlergebnissen vergangener Bundes- und Landtagswahlen - aufgezeigt werden, inwieweit sich das Wählerverhalten der deutschen Bundesbürger in den letzten sechs Jahrzehnten gegenüber den beiden Volksparteien entwickelt hat.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Entwicklung der Gesamtwahlbeteiligung sowie des gemeinsamen Stimmenanteils von CDU/CSU und SPD bei Bundes- und Landtagswahlen 1949-2009 (Angaben in Prozent) 2
Quelle: Amtliche Wahlstatistiken des Bundeswahlleiters, Statistisches Bundesamt (1949-2009) sowie eigene Berechnungen auf Grundlage dieser Daten.3
Betrachtet man die Entwicklung der Stimmenkonzentration auf CDU/CSU und SPD seit Gründung der Bundesrepublik, so fällt auf, dass diese von unterschiedlichen Phasen geprägt ist. Elmar Wiesendahl unterteilt die Entwicklung der Stimmenanteile der Volksparteien in drei Phasen: die „Aufschwungsphase“, die „Hochphase“ und die „Abschwungphase“ (Wiesendahl 1998: 16f.). Die von 1949 bis 1961 zu erkennende Aufschwungphase ist gekennzeichnet durch eine zunehmende Stimmenkonzentration auf Seiten der Volksparteien. Bei der Bundestagswahl von 1949 konnten sie zusammen 60,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen erreichen. Bis zur Bundestagswahl von 1961 stieg der gemeinsame Stimmenanteil von CDU/CSU und SPD um mehr als zwanzig Prozentpunkte auf 81,5 Prozent an. Eine ähnliche Tendenz zeigen die Ergebnisse der Landtagswahlen. Auch hier konnten die beiden Volksparteien im genannten Zeitraum einen stetigen Stimmenzuwachs verzeichnen, sodass deren gemeinsamer Stimmenanteil bei den Landtagswahlen im Wahlzyklus 1957 bis 1961 ebenfalls an die 80-Prozentmarke heranreichte.
Die Hochphase beschränkt sich auf den Zeitraum von 1961 bis 1983 und kann, wie es Wiesendahl sehr treffend beschreibt, als die „unangefochtene Hochzeit oder auch als goldenes Zeitalter etablierter Großparteienherrschaft der alten Bundesrepublik“ (Wiesendahl 1998: 17) gesehen werden. CDU/CSU und SPD genossen bei den Wählern während dieser Zeit einen bis heute nie wieder erreichten exorbitant hohen Zuspruch. Bei den Bundestagswahlen von 1976 entschieden sich ganze 91,2 Prozent aller Wähler an den Wahlurnen für die CDU/CSU oder die SPD. Eine solch hohe Stimmenkonzentration auf die beiden Volksparteien erscheint aus heutiger Sicht beinahe unwirklich. Jedoch war eine Stimmenkonzentration von 85 bis 91 Prozent auf die beiden Volksparteien während dieser Hochphase die Regel und verdeutlicht daher auch sehr gut die unangefochtene Hegemonialstellung der beiden Volksparteien während dieser Zeit. Dies spiegelt sich darüber hinaus in den Ergebnissen der Landtagswahlen wider, bei denen beide Parteien während der Hochphase zusammen Werte erzielten, die nahe an die 90-Prozentmarke heranreichten.
Ein weiteres, nicht zu verachtendes Indiz für die Bindekraft, die während dieser Zeit von den beiden Volksparteien ausging, kann durchaus in der sehr hohen Wahlbeteiligung gesehen werden. So konnte bei der Bundestagswahl von 1972 mit 91,1 Prozent abgegebener Stimmen unter allen Wahlberechtigten die höchste Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen in der Geschichte der Bundesrepublik erreicht werden. Auch hier lassen sich Parallelen auf Länderebene erkennen. Bei den Landtagswahlen, bei denen die Wahlbeteiligung für gewöhnlich geringer als bei Bundestagswahlen ist, konnte in den Wahlzyklen zwischen 1972 und 1983 eine bis heute nicht wieder erreichte Wahlbeteiligung von über 80 Prozent erreicht werden.
Die Phase, die danach einsetzte und bis heute anhält, ist die Phase, welche mit Hinblick auf das Thema der Arbeit im Mittelpunkt der Betrachtung steht und im Grunde auch den Anlass zu dieser wissenschaftlichen Analyse bot. Hierbei handelt es sich um die bereits erwähnte Abschwungphase, deren Beginn Wiesendahl in das Jahr 1982/83 verortet. Anhand von Tabelle 1 wird deutlich, dass die Stimmenkonzentration von CDU/CSU und SPD von diesem Zeitpunkt an kontinuierlich abnimmt. Bei den Bundestagswahlen von 1983 erreichten CDU/CSU und SPD gemeinsam noch 87 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Bei der darauf folgenden Bundestagswahl von 1987 erreichten sie gemeinsam nur noch 81,3 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Die erste gesamtdeutsche Wahl nach der Wiedervereinigung bot den beiden Volksparteien hinsichtlich der Entwicklung der Stimmenkonzentration erneut wenig Anlass zur Freude. Gemeinsam kamen sie bei der Bundestagswahl von 1990 nur noch auf 77,3 Prozent aller abgegebenen Stimmen, was gleichbedeutend mit einem durchschnittlichen jährlichen Stimmenverlust von 1,4 Prozentpunkten seit 1983 war. Eine vergleichbare Entwicklung zeichnete sich während dieser Zeit auch auf Landesebene ab. Der Wahlzyklus zwischen 1981 und 1983 stand mit einer durchschnittlichen Stimmenkonzentration von 88,5 Prozentpunkten dem Wahlzyklus von 1988-1990 und einer durchschnittlichen Stimmenkonzentration von 78,3 Prozentpunkten gegenüber. Dies entsprach wie auf Bundesebene im selben Zeitraum ebenfalls einem gemeinsamen Stimmenverlust der beiden Volksparteien von ca. 10 Prozent. Mit Blick auf die Tabelle 1 fällt allerdings auch auf, dass nach 1990 so etwas wie eine Phase kurzfristiger Stabilität eintrat. Gemeinsam mussten die beiden Volksparteien bei den drei Bundestagswahlen nach 1990 so gut wie keine Stimmenverluste hinnehmen. Zwischen 1990 und 2002 bewegte sich deren gemeinsamer Stimmenanteil auf Bundesebene stets um die 77-Prozentmarke. Auch auf Länderebene pegelte sich der gemeinsame durchschnittliche Stimmenanteil der beiden Volksparteien in den Wahlzyklen zwischen 1994 und 2005 auf einem Stimmniveau von 72 Prozent ein. Diese Ergebnisse gaben nach den immensen Stimmenverlusten zwischen 1983 und 1990 durchaus Anlass zum Optimismus. Es schien, als sei der Abwärtstrend gestoppt und eine neue Phase der Beständigkeit eingeleitet. Wer allerdings tatsächlich glaubte, der Erosionsprozess sei gestoppt und eine Phase langfristiger Stabilität sei eingeleitet, der irrte. Spätestens die Bundestagswahl 2005 holte die beiden Volksparteien wieder auf den Boden der Realität zurück. Zusammen erhielten sie 69,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen, was wiederum einem Stimmenverlust von ganzen 7,4 Prozentpunkten im Vergleich zur Bundestagswahl von 2002 gleichkam. Das bedeutete, verglichen mit der jeweils direkt vorangegangenen Bundestagswahl, den bis dahin größten gemeinsamen Stimmenverlust von CDU/CSU und SPD und war gleichbedeutend mit einem durchschnittlichen Jahresverlust von etwa 2,5 Prozentpunkten seit 2002. Trotz der gewaltigen Stimmenverluste war der Tiefpunkt noch nicht erreicht. Den vorerst negativen Höhepunkt dieser Entwicklung stellte die Bundestagswahl 2009 dar. CDU/CSU und SPD kamen zusammen auf 56,8 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Dieses Ergebnis ist in seiner Dramatik aus Sicht der Volksparteien kaum noch zu übertreffen und zeigt zudem sehr deutlich, dass die Volksparteien weiter unaufhaltsam das Vertrauen der Wähler verspielen und im Zuge dessen auch die Wähler selbst verlieren. Das Resultat der Bundestagswahl 2009 entspricht einem gemeinsamen Stimmenverlust von 12,6 Prozentpunkten seit der Bundestagswahl von 2005, was wiederum einem jährlichen Verlust von durchschnittlich 3,15 Prozent bedeutet. Es stellt zugleich den geringsten gemeinsamen Stimmenanteil von CDU/CSU und SPD seit Bestehen der Bundesrepublik dar. Die Ergebnisse auf Länderebene sprechen eine ähnliche Sprache. Im Wahlzyklus 2006 bis 2009 erreichten CDU/CSU und SPD bei den Landtagswahlen zusammen durchschnittlich 62,1 Prozent aller abgegebenen Stimmen, was einem Verlust von 9,6 Prozentpunkten gegenüber dem Wahlzyklus von 2003 bis 2005 gleichkommt. Auch auf Länderebene stellt dies einen Negativrekord dar. In keinem Wahlzyklus der Nachkriegszeit erreichten die beiden Volksparteien gemeinsam weniger Stimmen bei Landtagswahlen als im Zyklus 2006 bis 2009. Auch wenn diese extrem niedrige Stimmenkonzentration der beiden Volksparteien zurzeit überwiegend auf die Schwäche der SPD, die aktuell die wohl schwerste Krise der Nachkriegszeit durchlebt, zurückzuführen ist, bleibt festzuhalten, dass es um die beiden Volksparteien hinsichtlich des Wählerzuspruchs schlechter als jemals zuvor bestellt ist. Zusammen haben sie auf Bundesebene seit der ersten gesamtdeutschen Wahl von 1990 in weniger als zwanzig Jahren gut zwanzig Prozent an Stimmen verloren. Stimmenverluste auf Seiten der Volksparteien waren und sind in der Geschichte der Bundesrepublik seit 1976 keine Besonderheit. Auffällig ist hierbei nur, dass diesen Verlusten auf Seiten der Volksparteien in der Zeit nach der Bundestagswahl von 2002 keinerlei Stimmengewinne mehr folgten. Weder für die Union noch für die SPD. Bei der Bundestagswahl von 2002 erreichten Union und SPD jeweils noch 38,5 Prozent der Wählerstimmen. Bis zur Wahl 2005 sank der Anteil der Union auf 35,2 Prozent und der der SPD auf 34,2 Prozent ab. Bei der Bundestagswahl 2009 erreichten Union und SPD dann nur noch 33,8 bzw. 23 Prozent.
Zwischen 1976 und 2002 war zwar ebenfalls ein kontinuierlicher Stimmenverlust hinsichtlich der gemeinsamen Stimmenanteile der Volksparteien zu verzeichnen. Allerdings war dies nicht immer gleichbedeutend mit einem Stimmenverlust beider Volksparteien. Beispielsweise war es zum Teil so, dass eine der beiden Volksparteien die Schwächen der anderen Volksparteien für sich nutzte und ihr Ergebnis im Vergleich zur vorangegangen Bundestagswahl aufbessern konnte. Dieser kontinuierliche Verlust auf Seiten beider Volksparteien muss zwei mögliche Schlussfolgerungen zulassen dürfen. Ein Teil der ehemaligen Wähler von CDU/CSU und SPD wendet sich entweder verstärkt anderen Parteien zu und geben ihre Stimme auch am Wahltag diesen Parteien oder aber sie wenden sich von den beiden Volksparteien ab, indem sie auf ihre politische Teilhabe verzichten und am Wahltag nicht wählen gehen.
Was die Wahlbeteiligung betrifft, so genügt ein Blick auf die Tabelle 1 um festzustellen, dass diese auf Bundes- wie auf Länderebene nach dem Wahljahr 1998 stetig abgenommen hat. Wählten auf Bundesebene 1998 noch 82,2 Prozent aller Wahlberechtigten, so taten dies bei der letzten Bundestagswahl 2009 nur noch 70,8 Prozent aller Wahlberechtigten. Mit Hinblick auf die höchste Wahlbeteiligung in der Geschichte der BRD aus dem Jahr 1972 bedeutet dies eine um 20,4 Prozent gesunkene Wahlbeteiligung innerhalb der letzten 37 Jahre. Eine zunehmende Tendenz zur Stimmenverweigerung am Wahltag ist demnach nicht zu übersehen. Und trotzdem gibt es in Zeiten dieser zunehmenden Verweigerung gegenüber der politischen Teilhabe durch die Wahl auch Gewinner. Die kleinen, im Bundestag vertretenen etablierten Parteien FDP, Bündnis 90/Die Grünen4 und die LINKE5, profitieren von der Krise der beiden Volksparteien und befinden sich erheblich im Aufwind. Dies wird anhand der in der Tabelle 2 dargestellten Entwicklung der Stimmenkonzentration der etablierten kleinen Parteien sehr deutlich. Der Betrachtungszeitraum beschränkt sich auf den Zeitraum von 1990 bis 2009, da 1990 erstmals alle drei Parteien gemeinsam auf Bundesebene zur Wahl antraten und eine Betrachtung der gemeinsamen Stimmenentwicklung vor 1990 daher nicht möglich ist. Die Werte in Tabelle 2 machen zunächst sichtbar, dass die gemeinsame Stimmenkonzentration von FDP, Grünen und der LINKEN von 1990 bis in das Jahr 2002 auf Bundes- wie auf Länderebene nur minimal anstieg und daher als beinahe unverändert betrachtet werden kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten6
Tabelle 2: Entwicklung der Gesamtwahlbeteiligung sowie des gemeinsamen Stimmenanteils der
etablierten kleinen Parteien (FDP, Bündnis 90/Die Grünen und der LINKEN) bei Bundes- und Landtagswahlen 1990-2009 (Angaben in Prozent)
Quelle: Amtliche Wahlstatistiken des Bundeswahlleiters, Statistisches Bundesamt (1949-2009) sowie eigene Berechnungen auf Grundlage dieser Daten.
Spätestens mit der Bundestagswahl von 2005 änderte sich dies jedoch. Gemeinsam erreichten die drei etablierten kleinen Parteien bei dieser Wahl mit 26,6 Prozent aller Stimmen 6,6 Prozent mehr als gegenüber der Bundestagswahl von 2002. Den bisherigen Höhepunkt dieser Aufschwungbewegung der etablierten kleinen Parteien stellte die Bundestagswahl 2009 dar. Mit einer gemeinsamen Stimmenkonzentration von 37,2 Prozent erreichten sie bei dieser Wahl ihren bis heute größten Wählerzuspruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Dabei realisierten mit FDP (14,6%), Grüne (10,7%) und LINKE (11,9%) auch erstmals alle drei Parteien gemeinsam einen Stimmenanteil jenseits der 10-Prozentmarke. Auch auf Länderebene sind solche Ergebnisse längst keine Seltenheit mehr. Im Wahlzyklus zwischen 2006 und 2009 erreichten die drei kleinen Parteien gemeinsam durchschnittlich 30,1 Prozent der Stimmen. Selbst wenn die Ergebnisse von FDP, Grünen und der LINKEN auf Länderebene von Bundesland zu Bundesland starken regionalen Schwankungen unterliegen, so sind die jüngsten Zahlen durchaus bemerkenswert. So erreichte die FDP bei den vergangenen Landtagswahlen 2009 in Hessen 16,9 Prozent; in Schleswig-Holstein 14,9 Prozent und in Sachsen 10 Prozent. Die Grünen gewannen 2009 in Hessen 13,7 Prozent; in Schleswig-Holstein 12,4 Prozent und bei der jüngsten Landtagswahl im Jahr 2010 in Nordrhein-Westfalen 12,1 Prozent. Die LINKEN erreichten ihre besten Landtagswahlergebnisse 2009 in Thüringen mit 27,4 Prozent; in Brandenburg mit 27,2 Prozent; im Saarland mit 21,3 Prozent und in Sachsen mit 20,6 Prozent. Wie bereits erwähnt, unterliegen diese Ergebnisse bei Landtagswahlen, insbesondere die der LINKEN, starken regionalen Einschränkungen mit Stärken und Schwächen der Parteien in den verschiedenen Bundesländern. Aufgezeigt werden sollte hierbei lediglich, dass mit Blick auf die jüngsten Ergebnisse auf Länderebene sowie auf die noch viel aussagekräftigeren Ergebnisse auf Bundesebene ein starker Aufwärtstrend der etablierten kleinen Parteien nicht von der Hand zu weisen ist.
Wie oben bereits vermutet, findet sich ein Stimmenverlust der Volksparteien in Form von Stimmenzuwächsen sowohl auf Seiten der anderen Parteien als auch auf Seiten der Nichtwähler wieder. Im Folgenden soll dieser Zusammenhang kurz anhand der Entwicklung der prozentualen Anteile der Volksparteien, der etablierten kleinen Parteien, sonstiger Parteien sowie der Nichtwähler unter Berücksichtigung aller Wahlberechtigten verdeutlicht werden.
Tabelle 3: Entwicklung der Stimmenkonzentration unter Berücksichtigung aller Wahlberechtigten bei den Bundestagswahlen 1990-2009 (Angaben in Prozent)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Amtliche Wahlstatistiken des Bundeswahlleiters, Statistisches Bundesamt (1949-2009) sowie eigene Berechnungen auf Grundlage dieser Daten.
Unter Einbeziehung aller Wahlberechtigten zeigt sicht in Tabelle 3, dass die beiden Volksparteien CDU/CSU und SPD seit der Bundestagswahl von 2002 stetig an Wählern verloren, während die etablierten kleinen Parteien seit 1994 stetig an Wählern gewonnen und die Zahl der Nichtwähler seit der Bundestagswahl 2002 bis heute stetig an Stärke zugenommen hat. Bis 2002 bewegten sich die Veränderungen bzw. Schwankungen allerdings in einem nicht außerordentlich großen Rahmen. Ab der Bundestagswahl 2005 wird der rasante elektorale Verfall der Volksparteien sowie die Zunahme von Wählern der etablierten kleinen Parteien und der Nichtwähler jedoch sehr deutlich. Es wird offensichtlich, dass ein klarer Zusammenhang zwischen dem Wählerschwund der Volksparteien und dem unverkennbaren Erstarken der kleinen etablierten Parteien sowie der „Partei der Nichtwähler“ besteht. Während sich gegenüber der Bundestagswahl von 2002 bei der Bundestagswahl von 2005 weitere 7,1 Prozent von den Volksparteien abwendeten, gewannen die etablierten kleinen Parteien 4,8 Prozent, die „Partei der Nichtwähler“ 1,6 Prozent und die sonstigen Parteien 0,7 Prozent. Im Jahr 2009 entschieden sich gegenüber 2005 unter allen Wahlberechtigten noch einmal ganze 13,4 Prozent weniger für eine der beiden Volksparteien. Diese Verluste der Volksparteien lassen sich in Form von Gewinnen bei den kleinen etablierten Parteien (+ 5,5 %), der „Partei der Nichtwähler“ (+ 6,7 %) und den sonstigen Parteien (+ 1,2 %) wiederfinden. Seit 2005 bedeutet dies also einen stetigen prozentualen Zuwachs auf Seiten der etablierten kleinen Parteien, der sonstigen Parteien sowie auf Seiten der Nichtwähler. Demgegenüber steht ein stetiger Verlust seitens der beiden Volksparteien. Die Wähler wandern regelrecht von den Volksparteien ab. Zum einen laufen sie zu den kleinen etablierten Parteien über. Dies wird daran deutlich, dass diese trotz der immer kleiner werdenden Zahl an Wählern real immer mehr Wähler für sich gewinnen können.
Zum anderen begeben sich immer mehr Wahlberechtigte von den Volksparteien in die politische Bedeutungslosigkeit, indem sie nicht wählen gehen.
Mit Bezug auf die oben getroffenen Schlussfolgerungen lässt sich somit Folgendes festhalten: Die ehemaligen Wähler der beiden Volksparteien wenden sich zunehmend von diesen ab und finden sich in einer Mischung aus Nichtwählern und Wählern anderer Parteien wieder. Abbildung 1 verdeutlicht und untermauert diese These noch einmal sehr anschaulich und zeigt, dass sich der Wert der Zustimmung gegenüber den beiden Volksparteien und den etablierten kleinen Parteien seit der Bundestagswahl 2002 immer weiter annähert. Eine weitere sehr bedenkliche und zugleich, aus demokratischer Sicht, sehr gefährliche Annäherung wird hierbei ebenfalls deutlich. Mit nun rund 30 Prozent Nichtwählern entspricht der Anteil der Wahlverweigerer beinahe schon dem Anteil an Menschen, welche sich 2009 noch für eine Wahl für eine der beiden Volksparteien entschieden haben. Dies waren unter Berücksichtigung aller Wahlberechtigten 39,7 Prozent, wobei sich davon 23,6 Prozent für die CDU/CSU und 16,1 Prozent für die SPD entschieden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Entwicklung der Stimmenkonzentrationen unter Berücksichtigung aller Wahl-
Quelle: Amtliche Wahlstatistiken des Bundeswahlleiters, Statistisches Bundesamt (1949-2009) sowie eigene Berechnungen auf Grundlage dieser Daten .
Streng genommen ist die „Partei der Nichtwähler“ mit nunmehr 30 Prozent über die Zeit zur stärksten Kraft in der Bundesrepublik geworden. Ein alarmierendes Signal, welches von den Parteien, allen voran den Volksparteien, dringlich auch als solches wahrgenommen werden sollte.
2.2 Die Erosion des Mitgliederfundaments der Volksparteien
Die Mitgliederentwicklung bietet den beiden Volksparteien seit langer Zeit ebenfalls wenig Anlass zur Freude und gilt neben der oben aufgezeigten Stimmenentwicklung von CDU/CSU und SPD als der wesentliche Indikator für die Krise beider Parteien. Seit Jahren ist ein deutlicher Mitgliederschwund auf Seiten beider Volksparteien festzustellen. Dass dieses Problem nicht nur eine für deutsche Volksparteien gültige Erscheinung darstellt, belegt eine empirische Untersuchung zu Parteimitgliedschaften europäischer Demokratien von Mair und van Biezen (2001). Daraus geht unter anderem sogar hervor, dass die Geschwindigkeit des Parteimitgliederschwunds in der BRD verglichen mit anderen europäischen Staaten noch recht human verläuft (Ebd.: 12). Bei Ausrichtung des Blickpunktes auf die Erosion der Mitgliederbasis der beiden deutschen Volksparteien lassen sich ansatzweise temporäre Parallelen zur Entwicklung der Stimmenanteile von CDU/CSU und SPD erkennen. Denn die Hochzeiten hinsichtlich der Parteimitglieder- zahlen liegen, ähnlich wie die Hochzeiten der Stimmenkonzentration auf die beiden Volksparteien, in den siebziger (SPD) bzw. achtziger (CDU) Jahren. Abbildung 2 zeigt während dieser Zeit einen stetigen Mitgliederzuwachs, deren Höhepunkt für die SPD 1976 mit einer Mitgliederzahl von mehr als einer Million erreicht worden war.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Mitgliederentwicklung von CDU und SPD 1968 - 20097
Quelle: Auskunft der Parteigeschäftsstellen, zitiert in: Wiesendahl 1997: 352, für die Jahre 1968-1989; Niedermayer 2010: 425, für die Jahre 1990-2009.
Die Aufschwungphase der CDU hielt einige Jahre länger an und fand ihren vorläufigen Höhepunkt im Jahr 1983, in einer Zahl von rund 735.000 Parteianhängern. Die CDU konnte diesen Mitgliederhöchststand von 1983 erneut übertreffen, als sie im Jahr 1990 rund 790.000 Mitglieder zählte. Dieser Mitgliederhöchststand aus dem Jahr 1990 ist allerdings wenig aussagekräftig und kann nicht im Sinne einer positiven Wende in der Mitgliederentwicklung betrachtet werden. Diesem Wert kann von daher nur wenig Bedeutung beigemessen werden, da es sich bei dem oben aufgezeigten Mitgliederanstieg, welcher in abgeschwächter Form auch bei der SPD zu erkennen war, nicht um einen Mitgliederboom wie in den siebziger bzw. achtziger Jahren handelte, sondern um hinzugekommene Mitgliederbestände aus der Ost-CDU bzw. Ost-SPD. Auf diese Weise konnte sich die CDU 1990 rund 130.000 „neue“ Mitglieder aus der Ost-CDU und die SPD noch vor der Wiedervereinigung im Jahre 1989 gut 25.000 Mitglieder aus der Ost-SPD einverleiben. Sieht man von dieser kurzfristigen Korrektur nach oben, bedingt durch die hinzugekommenen Parteianhänger aus der DDR ab, so kann man sagen, dass sowohl die SPD seit 1977 als auch die CDU seit 1984 stetig an Mitgliedern eingebüßt hat.
Dieser Abschwungphase war eine regelrechte „Mitgliederschwemme“ (Wiesendahl 2005a: 24) vorausgegangen, die Ende der sechziger Jahre ihren Anfang nahm und Mitte der siebziger Jahre für die SPD und Anfang der achtziger Jahre für die CDU ihr Ende fand. Wiesendahl führt diesen Mitgliederboom zum einen auf bewusst gesteuerte Rekrutierungsmaßnahmen der beiden Volksparteien sowie auf die stark ausgeprägte Kontrahentensituation zwischen dem sozialliberalen Lager und dem Unionslager während dieser Zeit zurück (Wiesendahl 2006a: 32 f.). Der Mitgliederbestand der SPD vergrößerte sich zwischen 1968 und 1976 von rund 730.000 Mitgliedern auf mehr als eine Million Mitglieder, was einem prozentualen Substanzgewinn von ca. 41 Prozent in nur acht Jahren entspricht. Die CDU zählte 1968 rund 290.000 Mitglieder und wuchs bis zum Jahr 1983 auf eine Mitgliederstärke von rund 735.000 Parteimitgliedern an. Mit diesem exorbitant hohen Mitgliederzuwachs, der einem prozentualen Substanzgewinn von 156 Prozent in 15 Jahren entsprach, trat die CDU mit der SPD, welche bis dahin den Status der Mitgliederpartei traditionell für sich allein beanspruchen konnte, auf eine Stufe. Was auf die Zeit der „Mitgliederschwemme“ folgte, war eine Abschwungphase, welche mit Ausnahme der Jahre 1989/1990 bis heute anhält und die beiden Volksparteien Jahr um Jahr an Mitgliedern schrumpfen lässt. Parallelen lassen sich auch hier zu der Entwicklung der Stimmenkonzentration auf die Volksparteien ziehen. Ihre Stimmenanteile haben sich, wie bereits aufgezeigt, nach der Hochzeit in den siebziger Jahren bis heute stetig verringert. Es fällt auf, dass der Mitgliederschwund der beiden Volksparteien bis zur Wiedervereinigung zwar stetig, jedoch recht langsam verlief. So verlor die SPD seit ihrem Mitgliederhöchststand aus dem Jahr 1976 bis zum Jahr 1989 rund 100.000 Mitglieder, was einem prozentualen Substanzverlust von knapp zehn Prozent in 13 Jahren entspricht. Die CDU verlor seit ihrem Mitgliederhöchststand in dem Jahr 1983 bis in das Jahr 1989 ca. 72.000 Mitglieder, was einem prozentualen Substanzverlust von ebenfalls fast zehn Prozent in 6 Jahren gleichkommt. So gesehen setzte der Abwärtstrend der CDU zwar später, aber auch drastischer ein. Richtig rasant an Fahrt nahm der Prozess der Parteimitgliederrückgänge auf beiden Seiten allerdings erst nach der Wiedervereinigung auf. Nachdem die Parteien ihre Mitgliedszahlen im Zuge der Wiedervereinigung noch einmal aufbessern konnten, befinden sie sich seither im freien Fall. Dies wird bei einem Blick auf die in Tabelle 4 dargebotenen Daten besonders deutlich.
Tabelle 4: Entwicklung der Parteimitgliedschaften von CDU und SPD mit Veränderung zum Vorjahr 1990-2009
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Auskunft der Parteigeschäftsstellen, zitiert in: Niedermayer, Oskar (2010): 425.
Die SPD verlor seit der Wiedervereinigung bis in das Jahr 2008 rund 420.000 ihrer Mitglieder, was in etwa einem prozentualen Substanzverlust von 55 Prozent in nur 18 Jahren entspricht. Durchschnittlich verringerte sich der Anteil der SPD-Mitglieder somit seit 1990 um jährlich etwas mehr als drei Prozent. Die Schwächephase vor der Wiedervereinigung, welche für die SPD nach 1976 eingesetzt hatte, zeigt hingegen nur einen durchschnittlichen jährlichen Verlust von 0,77 Prozent der Mitglieder auf. Eine ähnliche, wenn auch etwas abgeschwächte Tendenz ist bei der CDU zu erkennen. Sie verlor zwischen 1990 und 2008 rund 260.000 ihrer Mitglieder, was einem prozentualen Substanzverlust von ca. 33 Prozent in 18 Jahren gleichkommt. Dies wiederum bedeutet einen durchschnittlichen jährlichen Mitgliederverlust von ca. 1,8 Prozent seit der Wiedervereinigung. Demgegenüber steht ein durchschnittlicher Jahresverlust von ca. 1,65 Prozent zwischen 1983 und 1989.
Es wird deutlich, dass die beiden Volksparteien unterschiedlich stark vom dargestellten Mitgliederniedergang betroffen sind. Die SPD ist von diesem Problem signifikant stärker berührt als die CDU. Dabei schlägt der Umstand, dass der Mitgliederschwund der SPD schon 1977 und somit acht Jahre vor dem der CDU einsetzte, kaum zu Buche. Auch die Tatsache, dass die SPD im Zuge der Wiedervereinigung weitaus weniger neue Mitglieder hinzugewann als die CDU, spielt mit Hinblick auf den stark ausgeprägten Mitgliederschwund keine übergeordnete Rolle. Was hingegen merkbar auffällt, ist die Geschwindigkeit, mit welcher die SPD gegenüber der CDU in der Nachwendezeit an Mitgliedern verliert. Seit der Nachwendezeit hat die SPD gut 162.000 Mitglieder mehr verloren als die CDU. Das bedeutet nicht, dass die CDU vom Mitgliederschwund verschont worden ist. Auch sie ist von diesem Schicksal betroffen und hat bis jetzt ebenso wenig ein geeignetes Mittel finden können, um den Mitgliederrückgang zu stoppen oder aber gar in eine Mitgliedersteigerung umwandeln zu können. Jedoch muss man festhalten, dass der Mitgliederrückgang bei der CDU wesentlich moderater abläuft als bei der SPD. Dies führt sogar soweit, dass die CDU zum Ende des Jahres 2008 erstmals in der bundesdeutschen Geschichte mehr Parteimitglieder zählte als die SPD. Ein Ergebnis, welches sich aufgrund der unterschiedlich stark voranschreitenden Mitgliederrückgänge der beiden Parteien sowie der damit verbundenen Annäherung der Parteimitgliederzahlen schon länger abzeichnete und die CDU - mit einem Überschuss von rund 8000 Mitgliedern - erstmals zur mitgliederstärksten Partei Deutschlands machte.
Doch wodurch kommt es zu diesem weiterhin stetig voranschreitenden Mitgliederrückgang der beiden Volksparteien? Der Grund dafür ist zunächst einmal in dem unausgewogenen Verhältnis zwischen Parteiaustritten und Parteieintritten zu sehen. Vergleicht man die Mitgliederentwicklung während der „Mitgliederschwemme“ mit der Mitgliederentwicklung seit der Wiedervereinigung, so kann man durchaus davon ausgehen, dass die beiden Volksparteien von heute, im Gegensatz zur SPD und CDU aus den siebziger und achtziger Jahren, eine akute und zugleich für die Parteien sehr bedrohliche Rekrutierungsschwäche auszeichnet. Diese Annahme bestätigt Wiesendahl in gewisser Weise, indem er konstatiert, dass die Mitgliederverluste in erster Linie auf die ausbleibenden Neueintritte zurückzuführen sind (Wiesendahl 1997: 354-356). Die ausbleibenden Neueintritte wiederum führen dazu, dass die Parteiabgänge, welche bei den beiden Volksparteien im Schnitt etwa jährlich 5 Prozent ausmachen (Ebd.), nicht mehr kompensiert werden können. Als Ergebnis bleiben Jahr für Jahr schrumpfende Parteimitgliederzahlen zurück. Kurzum bedeutet dies, dass die anhaltende Mitgliedererosion nicht direkt auf eine zunehmende Zahl von Parteiaustritten zurück- zuführen ist, sondern vielmehr auf die immer kleiner werdende Zahl von Neueintritten in die Partei (vgl. Wiesendahl 2006a: 46-49).
Geht man wie Wiesendahl von der Annahme aus, dass der Entschluss zu einem Parteieintritt vorwiegend im jüngeren Alter gefällt wird (vgl. Wiesendahl 2006a: 49), so ergibt sich für die Parteien daraus ein erhebliches Problem. Denn bleibt der Nachwuchs in den Parteien aus, so drohen massive Alterungseffekte, welche die Parteien im Extremfall in ihrer Existenz bedrohen können. Konkret würde dies bedeuten, dass die Parteimitglieder immer älter werden und die Parteien im schlimmsten Fall so den Kontakt zu den jüngeren Generationen verlieren. Auf diese Weise würden die beiden deutschen Volksparteien auf Dauer das Wesen von Rentner-Parteien annehmen.
Auf dem SPD-Parteitag in Münster 1988 heißt es in der Beschlussfassung folgendermaßen: „Eine Partei ohne Jugend ist eine Partei ohne Zukunft“ (Beschluss des SPD Parteivorstandes vom 22. Mai 2000, zitiert in Machnig / Bartels 2001: 45). Eine Aussage, die vermuten lässt, dass man sich innerhalb der SPD und mit Sicherheit auch innerhalb der CDU der Bedeutung des eigenen Parteinachwuchses bewusst ist. Inwieweit sich Anspruch und Wirklichkeit hier jedoch gleichen, soll im Folgenden mit einem Blick auf die Alterszusammensetzung der Parteimitgliedschaften der beiden Volksparteien ermittelt werden. Die Ansicht der Abbildungen 3 und 4 verrät, wie dramatisch die Mitgliedschaften von der CDU seit ihrem Mitgliederhöchststand in den achtziger Jahren und die der SPD seit ihrem Mitgliederhöchstsand in den siebziger Jahren in den letzten Jahrzehnten gealtert sind. Zur Problematik des Alterungsprozesses der Mitgliedschaften der Volksparteien bieten D´Antonio und Munimus (2009) ebenfalls einen guten Überblick (D´Antonio / Munimus 2009: 237-259).
Betrachtet man die Entwicklung der Alterstruktur der CDU Mitglieder in Abbildung 3, so
stellt man fest, dass der Alterungsprozess seit 1984 in vollem Gange ist. Der Anteil der über 60-jährigen Parteimitglieder hat sich zwischen 1984 und 2007 mehr als verdoppelt. Der Anteil der ehemals stärksten Gruppierung, der 30- bis 59-jährigen, ist im selben Zeitraum um 21,8 Prozent gesunken. Die jüngste Gruppierung der bis 29-jährigen Partei- mitglieder schrumpfte zwischen 1984 und 2007 von 8,4 Prozent auf 5,1 Prozent. Der Mitgliederschwund in dieser jüngsten Altersklasse hält sich mit 3,3 Verlustprozenten dabei noch im Rahmen. Es zeigt aber auch deutlich, dass es der CDU über all die Jahre nur sehr bedingt gelang, Mitglieder der jungen Generation für sich zu gewinnen.
Abbildung 3: Altersstruktur der Parteimitglieder der CDU 1984-2007 (Angaben in Prozent)8
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen: Eigenen Darstellung anhand der Daten von Wiesendahl 2003: 30-32; Wiesendahl 2006: 49-61 (für das Jahr 1984) sowie Niedermayer 2010: 431 (für die Jahre 1994-2007).
Ein wenig anders sieht es hierbei bei der SPD aus (vgl. Abbildung 4). Der Anteil der bis 29-jährigen SPD-Mitglieder betrug im Jahr 1974 ganze 19,9 Prozent und machte somit knapp ein Fünftel der SPD-Gesamtmitgliedschaft aus. Zurückzuführen ist dieser hohe Wert auf die starke Anziehungskraft der SPD in den siebziger Jahren, von welcher sich im Gegensatz zu der Mitgliederzulaufphase bei der CDU auch zahlreich junge Mitglieder anstecken ließen und in die Partei eintraten. Doch halten konnte auch die SDP den Anspruch einer ausgewogenen Mitgliederpartei mit jungen und alten Mitgliedern nicht. Der einstmals so große Anteil der bis 29-jährigen Mitglieder sank aufgrund fehlender Neueintritte in dieser Altersklasse bis in das Jahr 2007 auf 5,8 Prozent, was im Grunde einer Anpassung mit dem Wert der CDU in dieser Altersklasse gleichkommt. Die SPD konnte lange Zeit von dem Jungmitgliederstrom der siebziger Jahre zehren. Dies führte dazu, dass sie gegenüber der CDU hinsichtlich ihrer Mitgliederzusammensetzung lange Zeit als die jüngere Partei galt. Dies zeigte sich nicht nur in dem größeren Anteil der bis 29-jährigen, sondern auch in dem geringeren Anteil der über 60-jährigen.
Abbildung 4: Altersstruktur der Parteimitglieder der SPD 1974-2007 (Angaben in Prozent)9
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quellen: Eigenen Darstellung anhand der Daten von Wiesendahl 2003: 30-32; Wiesendahl 2006: 49-61 (für das Jahr 1984) sowie Niedermayer 2010: 431 (für die Jahre 1994-2007).
Der Anteil der über 60-jährigen SPD-Mitglieder war gegenüber dem der CDU 1994 um 6,7; 2004 um 3,7 und 2007 um 1,5 Prozent geringer. Die Tatsache, dass sich allerdings auch diese Werte mit den Jahren angleichen, könnte ein Indiz dafür sein, dass die SPD die Altersstatistik ihrer Mitglieder nur mithilfe der zahlreichen Jungmitglieder aus den siebziger Jahren aufbessern konnte. Dass auch diese junge SPD-Generation aus den siebziger Jahren altert, zeigt das markant ausgeprägte Übergewicht der 30- bis 59-jährigen SPD-Mitglieder in den achtziger und neunziger Jahren, welches sich bei weiter ausbleibenden Neueintritten jüngerer Generationen bald zugunsten der über 60-jährigen Parteimitglieder verschoben haben wird. Diese Tendenz ist deutlich zu erkennen und zeigt sich in einem nahezu angeglichenem Wert von 47,5 Prozent bei den 30- bis 59-jährigen SPD-Mitgliedern und 46,7 Prozent bei den über 60-jährigen im Jahr 2007.
Bei der CDU ist die Verschiebung zur anteilsmäßig stärksten Gruppierung der über 60- järigen bereits Realität. Im Jahr 2007 machten die über 60-jährigen mit 48,2 Prozent den größten Anteil der CDU-Mitgliedschaft aus.
Das Durchschnittsalter der Parteimitglieder von CDU und SPD verdeutlicht die Dramatik abermals. Zum Jahr 2009 wiesen die Mitgliedschaften von CDU und SPD ein Durchschnittsalter von 58 Jahren auf und stellten damit, abgesehen von der Partei der LINKEN, die älteste Parteimitgliederschaft unter den etablierten Parteien (Niedermayer 2010: 433). Ein Durchschnittsalter nahe der Sechzig stellt beiden Volksparteien in Sachen Nachwuchsarbeit ein Armutszeugnis aus. Angesichts der Zahlen ist bei weiterem Ausbleiben von Neueintritten, insbesondere Jungmitgliedereintritten, damit zu rechnen, dass die Mitgliederzahlen weiter schrumpfen, da die Parteimitglieder in der Folge immer älter und vermehrt versterben werden. Doch warum gelingt es den Parteien nicht, den aus Selbsterhaltungsgründen so wichtigen Nachwuchs für sich zu gewinnen und zu rekrutieren? Vergleicht man die heutigen Zeiten mit den Zeiten der „Mitgliede- rschwemme“ in den siebziger und achtziger Jahren, so muss man feststellen, dass sich die Parteien und die jüngeren Generationen über die Zeit stetig voneinander entfernt haben, was sich erkennbar an der sinkenden Wahlbeteiligung Jugendlicher (vgl. Wiesendahl 2001: 10f.) in einer Beziehungsstörung zwischen ihnen und den Parteien bemerkbar macht. Die Parteien haben stark an ihrer Glaubwürdigkeit eingebüßt und das Vertrauen der Jugendlichen mit der Zeit verspielt (vgl. Wiesendahl 2001: 12-19). Von den Parteien gehen zudem kaum Anreize für eine freiwillige Mitgliedschaft aus. Starke formuliert hierzu trefflich: „Wenn eine Partei es nicht schafft, insbesondere jüngere Menschen auch organisatorisch an sich zu binden, stellt sie sich damit auch programmatisch kein gutes Zeugnis aus“ (Starke1993: 50f.). Es ist davon auszugehen, dass ein junger Mensch seine Freizeit freiwillig nur dann in den Dienst einer Partei stellt, wenn er sich mit den Zielen der Partei identifizieren kann und das Gefühl bekommt dahingehend etwas bewirken bzw. einen Nutzen ziehen zu können. „Mit anderen Worten bekommt eine Mitgliederpartei ein Motivations- und Loyalitätsproblem, wenn sie mit ihren Wahlzielen und Politik- vorstellungen nicht im Einklang mit den Motiven und Gesinnungen steht, die Mitglieder zur Mitarbeit antreiben“ (Wiesendahl 2006a: 24). Diese Anreizschwäche der Parteien, welche bereits Kirchheimer vorhersagte (vgl. Kirchheimer 1965: 41) sowie die stark überalterte Mitgliederschar der Parteien lassen einen Parteieintritt für Jugendliche sehr unattraktiv erscheinen, was für die Parteien das Ausbleiben von Jungmitgliedernachwuchs und zugleich eine stetig alternde Parteimitgliedschaft zur Folge hat. Die Parteien befinden sich sozusagen in einem Teufelskreis, aus dem sie nur schwerlich wieder herauskommen können. Die Abbildung 5 zeigt die Probleme, die mit der Mitgliederkrise zusammenhängen und macht zugleich deutlich, dass sich diese wechselseitig bedingen.
Abbildung 5: Der Teufelskreis des Parteimitgliederschwunds10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Volksparteien, die in ihrem Inneren schon heute von der 60Plus-Generation dominiert werden, verlieren ohne die dringend benötigten Impulse durch den ausbleibenden jungen Nachwuchs auf Dauer den Anschluss an die Gesellschaft.
Dabei muss es doch, wie Hofmann (2004: 118) schon richtig bemerkte, im Interesse bzw. noch vielmehr der Anspruch einer Volkspartei sein, in der Zusammensetzung der Parteimitglieder ein Spiegelbild der Gesellschaft zu erkennen. Jedoch verflüchtigt sich die Vielfältigkeit in der Zusammensetzung der Parteimitgliedschaften der Volksparteien immer mehr. Wiesendahl spricht dahingehend von einem sich entwickelnden Beziehungs- problem zwischen Parteien und Gesellschaft, welches sich früher oder später in einer sinkenden Meinungskongruenz bzw. -korrespondenz zwischen beiden manifestieren wird (Wiesendahl 2003: 36).
Wenn man in den Parteimitgliederzahlen einen Gradmesser für das Maß an Repräsentanz und Verankerung einer Partei in breiten Teilen der Gesellschaft erkennen kann (vgl. Poguntke 2000: 219), so ist unter Berücksichtigung der oben dargestellten Parteimitgliederentwicklung zusammenfassend zu konstatieren, dass sich zwischen der Gesellschaft und den beiden Volksparteien ein immer breiter werdender Graben auftut. Wollen die Volksparteien den Kontakt zur Gesellschaft nicht noch weiter abreißen lassen, müssen hier in absehbarer Zukunft Brücken geschlagen werden, die in erster Linie dem Nachwuchs neue Anreize zur Mitarbeit in den Parteien bieten müssen.
Einige der Erklärungen des Mitgliederschwunds der Volksparteien wurden hier bereits kurz angerissen, um die Brisanz sowie das Ausmaß der Mitgliederkrise zu verdeutlichen. Im Folgenden wird auf weitere Ansätze, welche in der Wissenschaft vielfach sowohl zur Erklärung der Mitgliederkrise als auch der Krise der Volksparteien auf elektoraler Ebene zu Rate gezogen werden, eingegangen. Dabei werden sie einer kritischen Betrachtung, insbesondere hinsichtlich ihrer Gültigkeit, Stand halten müssen.
3. Die Erosion der Volksparteien aus soziologischer Perspektive
3.1 Theoretische Grundlagen derCleavage- und Milieu-Theorie
Ein in der wissenschaftlichen Literatur sehr oft verwendeter Erklärungsversuch für den fortlaufenden Erosionsprozesses der Volksparteien bezieht sich auf den makro- soziologischen Ansatz derCleavage-Theorie nach Seymour Martin Lipset und Stein Rokkan (1967) und die Frage nach der Gültigkeit der traditionellenCleavagesnach weit reichenden sozialstrukturellen Veränderungen und Säkularisierungsprozessen in der Bundesrepublik Deutschland.
Inwieweit hierin tatsächlich eine Erklärung gesehen werden kann, soll nachfolgend näher beleuchtet werden. Dafür ist zunächst eine Auseinandersetzung mit den Annahmen der Cleavage-Theorie von Relevanz. Mit ihrem Aufsatz „Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments” schickten sich Lipset und Rokkan im Jahre 1967 an, die Entstehung westeuropäischer Parteisysteme zu erklären. Die daraus hervorgegangene Cleavage-Theorie stellte einen Meilenstein dar und ist bis heute wichtiger und fester Bestandteil der Wahlforschung geblieben. Lipset und Rokkan verstehen unter einem Cleavageeinen durch Interessengegensätze entstanden politischen Konflikt innerhalb der Gesellschaft. Pappi merkt an, dass ein solcher Konflikt seinen Ursprung in der Sozialstruktur hat und sich in der Folge im Parteiensystem in Form von Parteigründungen niederschlägt (Pappi 1977: 195). Damit beruft er sich im Grunde auf die Aussagen von Lipset und Rokkan, die davon ausgingen, dass die Interessengegensätze dazu geführt haben, dass sich die vom Konflikt betroffenen Bevölkerungsgruppen organisierten und zur Durchsetzung ihrer Interessen ein Bündnis mit einer Partei eingingen. Die betroffenen Konfliktgruppen erhoffen sich der Theorie zufolge dadurch eine Vertretung ihrer Interessen durch die Partei auf höchster politischer Ebene und schenken dieser im Gegenzug Wählerstimmen (Lipset/Rokkan 1967: 5f.). Die sich dabei herausgebildeten Beziehungen zwischen Parteien und Wählern in den verschiedenen Ländern Westeuropas waren lange Zeit sehr stabil und erlaubten in Ansätzen auch verlässliche Aussagen über das Wahlverhalten bestimmter Bevölkerungsgruppen zu treffen. Inwieweit sie dies auch noch heute tun, wird im späteren Verlauf der Arbeit untersucht.
Für Lipset und Rokkan kristallisierten sich mit Hinblick auf die Entstehung westeuropäischer Parteisysteme vier zentrale Konfliktlinien heraus (Lipset/Rokkan 1967: 47). Der „Zentrum-Peripherie-Konflikt“ zwischen Eliten und Minderheiten; der Konflikt zwischen „Staat und Kirche“, beruhend auf den Machtansprüchen beider; der „Stadt- Land-Konflikt“ mit den unterschiedlichen Interessen von Stadt- bzw. Landbevölkerung und der „Kapital-Arbeit-Konflikt“ zwischen Kapitalgesellschaft und Arbeitergesellschaft. Für das bundesdeutsche Parteiensystem waren bzw. sind zwei dieserCleavagesbesonders prägend. Dabei handelt es sich um den sozioökonomischen Konflikt und den konfessionell-religiösen Konflikt. Im Zeitalter der Industrialisierung sah die stetig zunehmende Zahl der Industriearbeiter in den Sozialdemokraten die beste Vertretung ihrer Interessen auf politischer Ebene, was zu einem Bündnis zwischen Arbeitern und SPD führte. „Das sozioökonomische Cleavage resultierte aus dem Konflikt zwischen Arbeit und Kapital und führte dazu, dass Arbeiter bevorzugt die SPD oder linke Abspaltungen von ihr wählten, während sich Kapitaleigner eher ökonomisch konservativen Parteien zuwandten“ (Arzheimer/Schoen 2007: 90). Der Ursprung des konfessionell-religiösen Konflikts dagegen geht weit zurück bis in die Zeit der Reformation (vgl. Mielke 1991: 140) und spitzte sich bis in die Kaiserzeit zum so genannten „Kulturkampf“, also dem Konflikt zwischen der katholischen Kirche und dem preußisch-protestantischen Staat, zu. Die Katholiken sahen ihre Interessenvertretung während dieser Zeit sowie in der Zeit der Weimarer Republik in der Zentrumspartei und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Partei der CDU/CSU. Im Gegensatz zur katholischen Zentrumspartei betrachtete sich die CDU/CSU als „interkonfessionelle Sammlungspartei“ (Gabriel/Brettschneider 1994: 14), welche sich an katholische und protestantische Christen richten sollte. Pappi (1985: 269) sowie Falter und Schoen (1999: 457) schlussfolgern in diesem Zusammenhang, dass sich aus dem einstmals konfessionell geprägten Cleavage zwischen Katholiken und Protestanten im Laufe der Zeit ein religiöserCleavagezwischen religiösen und säkularen bzw. kirchlich gebundenen und der Kirche fernen Bevölkerungsgruppen entwickelt hat. Wessels umschreibt das konfessionell-religiöseCleavagerecht treffend, indem er sagt: „In der konfessionell-religiösen Konfliktlinie repräsentiert die CDU die Katholiken bzw. die religiös Gebundenen und steht der SPD und FDP als den säkularisierten Parteien gegenüber“ (Wessels 1997: 207). In der Wissenschaft herrscht ein reger Diskus darüber, inwieweit es sich nun um einen religiösen oder konfessionellenCleavagehandelt. Elff und Roßteutscher (2009: 314) widersprechen der These eines Wandels vom konfessionellen Cleavagehin zum religiösenCleavageund stützen sich dabei auf die Annahme, dass Katholiken weiterhin in weitaus größerem Maße als Protestanten zur Wahl von CDU/CSU tendieren. Ob es sich hierbei nun um ein konfessionelles, religiöses oder konfessionell- religiösesCleavagehandelt und inwieweit dies für den beschriebenen Erosionsprozess der Volksparteien überhaupt von Relevanz ist, wird sich im weiteren Verlauf der Arbeit zeigen.
Mit Hinblick auf die Erklärungsversuche zum vielfach diskutierten Niedergang der Volksparteien stellt sich hierbei nun zweifelsohne die Frage, welchen Beitrag die Cleavage-Theorie hinsichtlich der Ursachenergründung der Volksparteienkrise liefern kann. DieCleavage-Theorie an sich kann dies selbstverständlich nicht. Sie ist, wie bereits oben beschrieben, eine Theorie, welche die Entwicklung westeuropäischer Parteisysteme beschreibt und für die Bundesrepublik Deutschland in der Vergangenheit erklären konnte, weshalb die Arbeiter in der Regel an die Partei der SPD gebunden waren und die konfessionell-religiösen Bevölkerungsgruppen vorwiegend zur CDU/CSU tendierten. Daher könnten aber zum Beispiel Auflösungserscheinungen solcherCleavagesdie Krise der Volksparteien erklären.
Auch die Sozialmilieu-Theorie nach Mario Rainer Lepsius (1966) geht für Deutschland von einem Bündnis zwischen bestimmten Bevölkerungsgruppen und Parteien aus. Diese Bevölkerungsgruppen richten sich in der Regel an einer bzw. mehreren sozialen oder politischen Grundorientierungen aus. Dies beschreibt er als Sozialmilieu. Ein Sozialmilieu ist nach Lepsius eine „Bezeichnung für soziale Einheiten, die durch die Koinzidenz mehrerer Strukturdimensionen, wie Religion, regionale Tradition, wirtschaftliche Lage, kulturelle Orientierung, schichtspezifische Zusammensetzungen der intermediären Gruppen, gebildet werden“ (Lepsius 1966: 383). Die jeweilige Partei agiert laut Lepsius auf politischer Ebene im Sinne des jeweiligen Sozialmilieus bzw. im Sinne der sozialen Einheit als „politischer Aktionsausschuss“ (Lepsius 1966: 382) und erhält im Gegenzug die Stimme der im jeweiligen Sozialmilieu verankerten Personen.
...
1 Die CSU wird, insofern es aus Darstellungsgründen erforderlich ist, rechnerisch zur CDU dazugerechnet.
2 Daten beziehen sich bis einschließlich 1989 auf die alten Bundesländer und ab 1990, die neuen Bundesländer mit eingeschlossen, auf die gesamte BRD.
3 Mittelwert aus der Summe aller Landtagswahlen zwischen zwei Bundestagswahlen bis einschließlich September 2009. Im Folgenden Wahlzyklus genannt.
4 Bis April 1993: Die Grünen und Bündnis 90; danach Fusion beider zur Partei Bündnis 90/Die Grünen.
5 Von 1990-2005 als PDS; ab 2005 unter dem Namen Die Linke.PDS; ab 2007 nach Fusion mit WASG als Partei Die LINKE.
6 Mittelwert aus der Summe aller Landtagswahlen zwischen zwei Bundestagswahlen bis einschließlich September 2009. Im Folgenden Wahlzyklus genannt.
7 Daten beziehen sich bis einschließlich 1989 auf die alten Bundesländer und ab 1990, die neuen Bundesländer mit eingeschlossen, auf die gesamte BRD.
8 Daten beziehen sich bis einschließlich 1990 auf die alten Bundesländer und ab 1991, die neuen Bundesländer mit eingeschlossen, auf die gesamte BRD.
9 Daten beziehen sich bis einschließlich 1990 auf die alten Bundesländer und ab 1991, die neuen Bundesländer mit eingeschlossen, auf die gesamte BRD.
10 Wiesendahl (2003): 33.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Richter (Autor:in), 2010, Volksparteien in der Krise? - Eine kritische Betrachtung der Niedergangsdebatte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232264
Kostenlos Autor werden














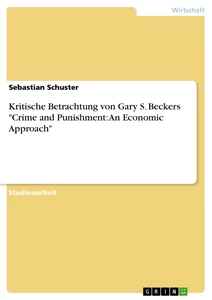








Kommentare