Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
1.1 Zur Toposforschung
1.2 Rousseau und der Entfremdungsdiskurs im 18. Jhd
1.3 Rousseau und die Unsichtbare Loge.
2. Narrative Spiegelungen: Jean Paul und „Jean Paul“
3. Tugend und Ökonomie
3.1 Geldwirtschaft: Kommerzien-Agent von Röper
3.2 Verstand -Wirtschaft: Professor Hoppedizel
3.3 Ego -Wirtschaft: Der geheime Legationsrat Oefel
4. Vernunft und Gefühl
4.1 Der hohe Mensch
4.2 Nihilismus: Ottomar
5. Leib und Seele
5.1 Jean Pauls Ganzheitstraum: Das familiäre Diner
5.2 Leib und Seele im aristokratischen Souper
5.3 Leidenschaft und Ohnmacht: Beata, Residentin, Ministerin
6. Entfremdung und Pädagogik
6.1 Schönheit und Moral: Die Erziehungs-Maximen
6.2 Topik der Vollkommenheit: Genius
7. Schluss
8. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Angesichts einer kaum noch zu überblickenden Forschungslage scheint sich am Vorabend des 250. Dichter-Geburtstages eine Frage immer mehr in den Vordergrund zu drängen: Gibt es überhaupt noch Zugänge zum Werk, mit denen sich neues Erkenntnis-Terrain erschließen lässt?
Der Verfasser möchte das im Bezug auf Jean Pauls Erstlings-Werk Die unsichtbare Loge bejahen. Denn zum gegenwärtigen Zeitpunkt stellt sich bei genauerem Hinsehen heraus, dass die textimmanente Forschung bislang bei weitem den Tiefgang vermissen lässt, der zur Erhellung der literarischen Qualität dieses Romans notwendig wäre. Dabei haben sich die meisten Beiträge auf das sogenannte "unterirdische Pädagogium" spezialisiert, jedoch ohne dass es bislang zu einer plausiblen Darstellung der Zusammenhänge von Erziehung und Charaktertopik gekommen wäre.
Gerade was die einzelnen Romanfiguren betrifft, wurden einige kompositorische Aspekte, figur-anthropologische und sozial-topographische Anordnungen, in der mir zugänglichen Literatur nicht ausreichend expliziert.[1] So stellt Gerd Ueding in seiner Darstellung zum unterirdischen Pädagogium fest:
„Überhaupt entfaltet sich die Geschichte Gustavs, nachdem er Auenthal, das Paradies seiner Kindheit, verlassen hat und in die Residenz Scheerau gekommen ist, zunehmend als die Geschichte einer Entfremdung […]. Ihren Höhepunkt können wir leicht ausmachen, nämlich die Verführung Gustavs durch die Regentin Bouse […]“.[2]
Der Bedeutungsumfang des Entfremdungsbegriffs bleibt hier ebenso unaufgedeckt liegen wie die Tatsache, dass dieser bei weitem nicht nur auf Gustav einzuengen wäre. Der Ansatz, die „Geschichte Gustavs“ sei ein Beispiel für eine „Geschichte der Entfremdung“, will auch in der Folge keine rechte Kontur annehmen. Dass die Regentin eine Verführerin ist, scheint auch nur eine flüchtige Bemerkung zu sein, die sich am Text m. A. n. ohnehin nicht belegen lässt. Zugegeben: Jean Pauls teils verworrene Romanfabeln so umfassend im Kopf zu behalten, dass sie zu jedem Zeitpunkt des Schreibens auch im Detail verfügbar sind, wäre eine herkulische Leistung und ich möchte zugeben, dass dies so gut wie unmöglich erscheint. Da es sich aber lohnt, Uedings Ansatz zu komplementieren, kann es im Folgenden durch die Reduktion des Lektüreumfangs auf die Loge selbst gelingen, auf solche Bedeutsamkeiten mit der notwendigen Sorgfalt einzugehen.
Da es aber bei Jean Paul in vielerlei Hinsicht sicher zu Überinterpretationen kommen würde, wenn man die zahlreichen intertextuellen Bezüge ignorierte, habe ich für die vorliegende Darstellung einen anthropologischen Zugang gewählt, bei dem ich insbesondere auf die bislang so gut wie gar nicht berücksichtigen Diskurse Rousseaus zurückgreifen möchte, um sie in einen topischen Kontext zur Loge zu stellen.
Um der möglichen Amphibolie des Terms „anthropologische Topik“ vorzubeugen, folgt jeweils ein Kapitel zum nicht unproblematischen Topos-Begriff und eines zum anthropologischen Entfremdungs-Diskurs mit Bezug auf Rousseau.
Im Vordergrund des vorliegenden Versuchs einer Charakter-Topik sollen die einzelnen Figuren stehen, die Jean Paul in seiner Loge nach anthropologischen Gesichtspunkten arrangiert. Diese reichen vom Konzept der „schönen Seele“ über „mehrkräftige“ und „einkräftige“ Charaktere bis hin zur völlig depravierten Satirefigur. Um die bislang fehlende Verbindung von Charaktertopik und Erziehungsdiskurs herzustellen, stellt sich am Ende die Frage nach der Rolle der Erziehung angesichts der mannigfaltigen Entfremdungserscheinungen, die dem Leser in der Loge präsentiert werden.
1.1 Zur Toposforschung
In der Forschung hat man die Unzulänglichkeiten, die mit Curtius’ Toposbegriff einhergehen, früh erkannt.[3] Dennoch konnte man nach der Veröffentlichung von Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter (1948) einen Trend bemerken, bei dem man versuchte, literarisch-topische Traditionen aufzuspüren:
„Was der Toposforschung so viel Faszinationskraft verschaffte, das war gewiß nicht irgendein Bezug zur alten rhetorischen Tradition, sondern dieses: man glaubte, hier eine neue »Methode« zur Aufarbeitung der Tradition gefunden zu haben; man sah sich befreit von der elenden Weise, Literaturgeschichte vorwiegend mit Dichterbiographien, Werkmonographien und Chronologien bestreiten zu müssen. […]“[4]
Man feierte also etwas Methodisches, das zur „Aufarbeitung der Tradition“ beitrug. Wie genau diese Methode jedoch aussehen sollte, blieb zunächst unklar. Pöggeler spricht davon, die Frühgeschichte der Toposforschung referierend, dass man sich glücklich schätzte, eine „elastische Formel“ gefunden zu haben, mit der „kristallierte Tradition erfasst werden [sollte].“[5]
Indem man sich also von der „elenden Weise“ („Dichterbiographien“ etc.) zu verabschieden glaubte, versprach die Toposforschung die Erschließung größerer Wissenshorizonte. Das hat in der Folge zu prinzipiellen Kontroversen geführt, sodass dieser theoretische Ansatz bis heute unsicher zwischen der „Skylla eines historisch-philologischen Positivismus und der Chyrabdis einer idealistischen Kunstmetaphysik“[6] oszilliert.
Jehn und Baeumer haben zu Beginn der 1970er-Jahre in ihren Sammelbänden die wichtigsten Beiträge der frühen und mittleren Toposforschung zusammengetragen. Während die ersten Beiträge der 30er- bis 50er-Jahre sich lobend oder tadelnd mit Curtius’ Konzept einer „historischen Topik“ beschäftigten, erschienen erst in den 60er Jahren diejenigen Beiträge, die sich vorwärtsgerichtet um einen literaturwissenschaftlichen Toposbegriff und dessen Handhabung bemühten.
Walter Veit war einer der ersten, der in aller Deutlichkeit nicht nur auf die Unschärfe von Curtius’ Topos hingewiesen, sondern auch eine formale sowie funktionale Neuvermessung des Begriffs vorgenommen hatte: „Wie vorteilhaft auch immer die fließenden Übergange sein mögen, so wird damit doch die Gefahr des Ungedankens erkauft: ohne eine einwandfreie Festlegung der Kategorien des Denkens ist ein Erkennen und Verstehen des Objektes nicht möglich.“[7] Veits Auffassung geht zurück auf das Toposkonzepts seiner Dissertation Geschichte des Topos der Goldenen Zeit.[8] In einer etwas später verfassten Abhandlung versucht Veit den literarischen Topos als „Denkform“ auszuweisen.[9] In Anlehnung an Käte Hamburger geht es ihm dabei um „die Wesensbestimmung der Dichtung als eines Sagens von Sein, als dargestellte Wirklichkeit.“[10] Gemeint ist, dass Poesie aus sich selbst heraus danach strebt, Wirklichkeit abzubilden. Deshalb macht Veit sich für einen mimetischen Literaturbegriff stark.[11] Die Betonung liegt jedoch nicht auf einer rein figürlichen oder phänomenologischen Abbildung, sondern auf den historischen Schemata der Welteinteilung und -deutung, den alten und neuen Ideologien. Diese gedachten Wirklichkeitsstrukturen werden dann als kompositorische Maximen in der Dichtung sichtbar. Ein Topos ist danach ein historisch manifestes Denkmodell, das die Wirklichkeit ordnet und ein zumindest hypothetisches Erklärungspotenzial besitzt.
Ähnlich wie Veit verortet Otto Pöggeler den literarischen Topos im Formelhaften, Sich-Vorstellenden. Sein Aufsatz Dichtungstheorie und Toposforschung von 1960 stellt die m. E. bis heute wichtigste Abhandlung zu Theorie und Methode des literarischen Toposbegriffs dar. Dem Anspruch der Toposforschung, eine erlernbare Methode zu sein, steht Pöggeler jedoch kritisch gegenüber. Die Nähe zu Curtius ist hier stets sichtbar. Dass Pöggeler versucht, sein Erbe weiter zu tragen, äußert sich vor allem im Hochhalten der Fahne, auf die er sich rückbeziehend auf Erich Auerbach traditionelle philologische Kompetenzen wie „Grammatik, Lexikographie, Quellenbenutzung und Textkritik“[12] geschrieben hat. Dennoch würden diese Fähigkeiten alleine nicht genügen. Er folgt dabei weiterhin Auerbach, der für die Beschäftigung mit Literatur noch weitere Voraussetzungen sah:
„Alles übrige ist nicht Methode; denn es ist nicht lehrbar: zunächst die Weite des Bildungshorizontes, die auf der leidenschaftlichen Neigung beruht, sich alles anzueignen, was für die verfolgte Erfahrung, zu deren Erwerb das Schicksal mitwirken muß; sie nährt die nachlebende Einbildungskraft, ohne die man Menschen und menschliche Werke nicht verstehen kann; und schließlich den Blick für das, was Bergson (und ihm folgend E. R. Curtius) faits significatifs, bedeutsame Tatsachen genannt hat.“[13]
Auch wenn hier der Wind eines rezeptiven Geniekults weht, ist eine über das gewöhnliche Maß hinausgehende „Neigung“ und „Einbildungskraft“ als Bedingung für ein solches Verständnis von Toposforschung kaum zu leugnen. Das liegt natürlich am Volumen der Textmenge und den philologischen Fähigkeiten, die sicherlich nicht an einem Tag zu erlernen sind und vor allem an der Begabung, auf „bedeutsame Tatsachen“ anzusprechen. Aus methodischer Sicht ist das interessant, denn Pöggeler, der hier wiederum Auerbach folgt, warnt seinen Leser vor der Unart vorbestimmter Texterschließung.
Pöggeler wendet sich gegen ein methodisches Sezieren von Poesie. „Vielen Philologen […] fällt etwas Bedeutsames auf; aber sie verstellen es sich, indem sie verfestigten Kategorien verfallen.“[14] Dies führe nämlich zu „Scheinproblemen“, die nur mit neuen „Methodenhypostasen“ zu lösen seien.[15] Anstatt sich also mit irgendwelchen aus der Fremde herbeigeholten Begriffen zu bewaffnen schlägt Pöggeler vor, im Text selbst nach charakteristischen Merkmalen zu suchen. Und eben das könne man nicht lernen, weil man dazu ein Gespür fürs Bedeutsame benötige für das allenfalls ein reichhaltiger Lektürefundus als Korrektiv dienen kann. Lektüre und Gespür bilden also eine sich gegenseitig bedingende Zirkelbewegung, in die man methodisch nicht einsteigen kann. Diesem antisystematischen Modell entspricht auch Pöggelers Vorliebe fürs topische Denken selbst:
„Das topische Denken verschmäht es nicht, sich seine Gesichtspunkte historisch zu suchen. Es fügt sich ausdrücklich in das geschichtlich geführte Gespräch über ein Problem ein. Die Autoritäten gelten etwas in diesem Gespräch. Deshalb ist die Topik und ihr mehrdeutiges Ungefähr dem «strengen» kritischen Geist, der auf reine Formen und Sachverhalte hin denkt, ein grobes Ärgernis.“[16]
Pöggeler sieht den literarischen Topos als Anwendungsfall der Dichtungstheorie. Ähnlich wie Veit geht es auch Pöggeler um eine Seins-Struktur, die ihren Ursprung im philosophischen Denken hat. Bei Pöggeler ist diese Seins-Struktur jedoch enger umrissen: Sie zielt auf das Wesen von Dichtung. Ein Topos ist kein technisches Hilfsmittel zur Produktion eines einzelnen Textes (téchne im poetologischen Sinne), sondern ein modellhaftes Vorstellungsprinzip, das als Antwort auf die Frage nach dem Wesen der Poesie entworfen ist (also „dichtungstheoretisch“).[17] Schon bei Curtius und anderen findet man eine ganze Reihe solcher Topoi: Dichtung als eine andere Form der Theologie,[18] Dichtung als altera natura oder altera philosophia.[19] Pöggeler weist immer wieder darauf hin, dass ein solcher dichtungstheoretischer Topos keine exakt umrissene Identität haben kann. Die verschiedenen dichtungstheoretischen Topoi seien häufig miteinander verflochten, so sei z. B. der Topos vom göttlichen Wahnsinn eng mit dem der altera theologia verwandt.[20]
August Obermayer übernimmt den von Pöggeler und Veit entwickelten Toposbegriff, indem er ihn als „Vorstellungsmodell“ definiert. Damit will er „eine deutliche Unterscheidung zum Klischee, dem ja der Aussagecharakter fehlt“ und auch die „zu enge Bindung ans Gedanklich-Philosophische“ vermeiden.[21] Bei Obermayer findet man zum ersten Mal das Prädikat „modern“ im Zusammenhang mit Toposforschung. Er konstatiert in aller Deutlichkeit, dass die Suche nach einem literarischen Toposbegriff nicht zurück in die Antike führen kann sowie dieser auch nicht in irgendwelchen Nachbardisziplinen zu finden wäre. Es sei für den modernen Toposbegriff eine „Konfusion“ zu beklagen, die jedoch keineswegs in der Sache selbst begründet sei, sondern auf die nachlässige Handhabung literaturwissenschaftlicher Terminologie.[22] Also auch bei Obermayer wird auf die Pflicht zur philologischen „Begriffssauberkeit“ hingewiesen, sie sei sogar allgemein „Vorraussetzung für jede Wissenschaft“.[23]
Wie seine Vorgänger sieht er den literarischen Topos nicht auf einer Stufe mit stilistischen Phänomenen wie Motiv, Metapher oder Symbol. In diesen Ausdrucksformen sieht er vielmehr die Verwirklichung eines Topos im Sinne eines Vorstellungsmodells von Sein. Diese Formen seien Beleg dafür, dass ein Topos tatsächlich wirksam ist und in seiner Wirksamkeit ein mächtiger Bestandteil der Vorstellungswelt einer Kultur.
Ein Topos kann sich in ein Motiv, ein Symbol oder in eine Allegorie verwandeln bzw. er wird dadurch erst greifbar. Hier liegt nun auch der eigentliche Verdienst Obermayers: Er hat auf vier Manifestationsvarianten literarischer Topoi hingewiesen:[24] 1. Inhalt wie sprachliche Formel eines Vorstellungsmodells (=Topos) bleiben über lange Zeit stabil. 2. Die Bedeutung des Inhalts dieser sprachlichen Manifestation eines Topos variiert unter dem Einfluss verschiedener geistiger Strömungen. 3. Es gibt Denkinhalte, die keine sprachliche Manifestation haben, jedoch als feste Topoi greifbar sind. 4. Die Kombination aus 2. und 3.: Ein dem Epochenwandel unterworfenes Denkmodell, dass keine feste sprachliche Manifestation hat.
Überraschend wirkt die Rehabilitierung des Topos als Klischee bei Beaumer. In seinem Aufsatz Dialektik und zeitgeschichtliche Funktion des literarischen Topos von 1971 weist er darauf hin, dass literarische Topoi (durchaus im Sinne von Curtius) sowohl als positive „Denk- und Ausdrucksschemata“ als auch im negativen als „feste Clichés“ auftreten können.[25] Baeumer erklärt dabei Hegels Dialektik als die für die Beschäftigung mit den literarischen Topoi ausschlaggebende Methode, da Topoi „immer in einem dialektischen Gegensatz zu ihrer vorher ausgedrückten Funktion stehen“[26]. Sie sind auf Grund ihrer Geschichtlichkeit einem stetigen Funktionswandel unterworfen und der Toposforscher stößt hier auf die immer selben dialektischen Muster von Entwurf und Gegenentwurf, von bewusster positiver und negativer Funktionalisierung. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass solche Topoi als ästhetisch wirksame Sedimente der Geistesgeschichte zu begreifen sind. Topoi werden aus Sicht des Textproduzenten „entstellt“ und wieder „neu-hergestellt“. Daraus lässt sich dann die „gesellschaftsgeschichtliche Wirklichkeit […] ablesen“.[27] Baeumer wendet sich damit gegen die (seiner Meinung nach) vage Vorstellung Veits, Topoi seien „Neuschöpfung[en] aus dem Zeitgeist“ heraus.[28] Vielmehr würden sie sich aus dem „dialektischen Prozeß der gesellschaftsgeschichtlichen Wirklichkeit“[29] ergeben.
Einen entscheidenden Beitrag hin zur Interdisziplinierung des Problems hat Lothar Bornscheuer mit seiner Monographie Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft geleistet. Bornscheuer bemüht sich um einen soziologischen Toposbegriff, betrachtet das Grundphänomen jedoch „meta-“, ja sogar „vor-wissenschaftlich“.[30] „Vorwissenschaftlich“ bedeutet letztlich Rückbezug auf die aristotelischen endoxa, den (vor-)herrschenden Meinungen, die er als natürlichen, nicht wissenschaftlich vorgeprägten Ausdruck topischer Denkweise begreift. Dieser sensus communis schließt sowohl dialektische (auf „Sprachlogik“ beruhende) wie rhetorische („psychologisch“-agitative) Argumentation mit ein und bildet einen ursprünglichen Schatz inventorischer Topoi.[31] Aus der Rückbindung der Topik an die „Alltagspraxis“ der Problemlösung entspringt der Gedanke, dass in einer nicht szientistisch geprägten Gesellschaft noch die „Einheit von Denken und Sprechen“ möglich wäre.[32] Aus diesem Postulat heraus stellt Bornscheuer dann die Frage nach den Merkmalen einer solchen ursprünglichen Inventionskunst, die notwendigerweise stark in der sozialen Umgebung des einzelnen Menschen, der seine Argumente zu einer Sache vorbringt, verwurzelt sein muss. Bornscheuers Untersuchung ergab vier Strukturmerkmale mit denen sich das Wesen einer vorwissenschaftlichen Topik charakterisieren lässt: 1. Ein Topos ist geprägt durch „Habitualität“. Das bedeutet, dass ein Topos durch soziale Konventionalisierung von Sprache, Recht oder Bildung seine Prägung bekommt. Ein Topos ist ein „Standart“, eine „Determinante“ des in einer Gesellschaft „herrschenden Selbstverständnisses“.[33] Der Gebrauch von Topoi entspricht also sozialem Verhalten. 2. Ein weiteres bestimmendes Strukturmoment ist das der „Potenzialität“. Ein Topos ist ein für die Argumentation bestimmter Gesichtspunkt, der oftmals der Interpretation bedarf, aber auch Denken überhaupt erst in Gang setzt.[34] Derselbe Topos kann ein Für oder Wider sein, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man ihn betrachtet. Hinsichtlich seines Ortes innerhalb der Rede ist er also, was seine Leistung bzw. Wirkung betrifft, „potenziell“ nicht determinierbar. 3. „Intentionalität“: Ein Topos dient nicht nur dialektisch-argumentativen oder rhetorisch-amplifikatorischen Zwecken, sondern dient innerhalb der gesellschaftlichen Kommunikation der Einbringung „weiterführende[r] Verständnishorizonte“[35]. Topoi werden im Augenblick ihres Gebrauchs bestätigt, abgelehnt, aktualisiert oder modifiziert. Sie führen die Diskussionsteilnehmer im Ringen um allgemeine Zustimmung zu grundlegenderen Fragen, auf eine „höhere, sinnvolle Bewusstseinsebene“, die oftmals mit der Verwendung bestimmter Topoi intendiert ist.[36] Selbiges gilt für die immer wieder neu zu verhandelnde Positionierung eines Topos innerhalb einer entsprechenden Topik. 4. Das vierte Merkmal eines Topos ist seine „Symbolizität“. Damit beschreibt Bornscheuer die Form eines Topos unter Berücksichtigung der Tatsache, dass unterschiedliche gesellschaftliche Schichten oder Gruppen jeweils spezifische „Sondertopiken“ entwickeln.[37] Mit Symbolizität ist dann der Wiedererkennungswert eines Topos gemeint: seine sprachliche, mimetische oder regelhafte Fixierung durch die er einprägsam wird und damit traditional wirksam.
In den 80er- und 90er-Jahren flachte die Welle literarisch-methodischer Toposforschung etwas ab, jedoch ohne dass es zu einem Konsens über die beste Verwendung des Begriffs kam. Im Jahr 2000 erschien noch einmal ein umfangreicher Sammelband, hervorgegangen aus einem Symposium zum Thema Topik und Rhetorik, der sich ausführlich noch einmal um eine Beschreibung des historischen Toposbegriffs bemühte, wobei man jedoch augenscheinlich keine terminologischen Probleme lösen, sondern allenfalls noch weiter ausdifferenzieren wollte.[38] 2007 machen Frank, Kocher und Tarnow sich für topisches Denken als heuristisch-literaturwissenschaftliche Methode noch einmal stark, indem sie darin ein „wesentliches Muster zur Generierung neuen Wissens“ erkennen wollen.[39]
In der vorliegenden Arbeit geht es mir nicht um eine weitere Schärfung des literarischen Toposbegriffs. Ich möchte lediglich darauf hinweisen, dass ich mit dem Wort „Topik“ an die Tradition, darunter eine philosophische Formation von einzelnen Gesichtspunkten zu verstehen, zwar anknüpfe, von methodischen Implikationen, die sich daraus ergeben würden aber ganz absehe. Um zu zeigen, dass die Unsichtbare Loge von anthropologischen Topoi mitgeneriert wird, bedarf es m. E. keines weiteren methodisch-theoretischen Überbaus. Wir können ohnehin nur von der Tatsache ausgehen, dass sich die einzelnen Elemente dieser Topik – sowie die Elemente des literarischen Textes eben auch – wenn überhaupt, so doch nur auf eine lockere und wenn man so will „unsystematische“ Art und Weise überführen lassen. Wir wollen also nicht dort Systeme errichten, wo sie das Wesen der Poesie von sich abstößt.
1.2 Rousseau und der Entfremdungsdiskurs im 18. Jhd.
Die von Jean Paul literarisch umgesetzte Idee, einen Jungen unterirdisch großziehen zu wollen, führt uns zu dem insbesondere im 18. Jahrhundert geführten Diskurs um die wahre menschliche Natur.[40] Das aufkommende Interesse am Menschen eines ursprünglichen bzw. natürlichen Zustands mag im allmählichen Gewahrwerden einer industriellen Revolution, der damit verbundenen Spezialisierung des Menschen oder in der immer deutlicher werdenden Kluft zwischen zivilisierter Welt und verklärter Naturvolk-Phantasie begründet sein.[41]
Bezeichnend für diese Zeit ist u. a. das enorme Interesse am Phänomen des „Wolfskindes“, welches offenbar zwischen ernsthafter Anthropologie und „Faszination durch das Monströse“ „changierte“.[42] Dieser etwas uneinheitlich gebrauchte Begriff umfasst verschiedene Fälle von Kindern, die die ersten Jahre ihres Lebens ohne menschlichen Kontakt verbracht haben. Sie haben oft gemeinsam, dass sie keine Sprache beherrschen, sich animalisch fortbewegen und diverse Anzeichen emotionaler Rohheit aufweisen wie etwa Peter von Hameln, den man 1724 als 13-jährigen, sich von Vögeln und rohem Gemüse ernährend, auf einer Wiese fand.[43] 1799 begann der Taubstummen-Arzt Jean Itard, der sich eines ähnlich verwilderten Findlings annahm (Victor oder der Wilde von Aveyron), eine Trennung von dem Vorzunehmen, was das Wesen wilder Völker kennzeichne und das von Wolfskindern. Wilde Völker seien nach Itard gerade keine Menschen im rohen Zustand, da sie über eine soziale Prägung verfügen.[44]
Die Debatte um das Wesen des Menschen im ursprünglich, nicht-entfremdeten Zustand erhitzte sich zusätzlich aufgrund theoretischer Schriften, die bis heute das humane Selbstverständnis auf einen harten Prüfstein stellen. Ich möchte hier zum einen die 10. Auflage von Linnés Systema Naturae (1758) nennen, in der zum ersten Mal der homo ferus auftaucht und die beiden Abhandlungen Rousseaus: Den Diskurs Ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sitten beygetragen hat? (1750) und den Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen (1755).[45]
Rousseaus vernichtende Kulturkritik im 1. Diskurs geht auf seine im 2. Diskurs expliziter ausgearbeitete Theorie des Wilden Mannes (l’homme sauvage) zurück. Zwar widmet sich Rousseau in diesen Abhandlungen keinen pädagogischen Fragen, dies geschieht erst 1762 auf literarische Weise im Émile, doch im 2. Diskurs werden die anthropologischen Grundlagen gelegt, mit denen sich seine Epoche auch aus Sicht der Erziehung auseinanderzusetzen hatte.[46]
Jedes Konzept der Erziehung fordert im selben Moment ein äquivalentes vom Menschen, welches das erstere transzendiert. Dieses Menschenbild, so muss man aus der Ideengeschichte zur Anthropologie wohl schließen, fluktuiert ebenso unscharf wie der menschliche Verstand, mit dessen Hilfe wir uns über uns selbst Gedanken machen. Der Mensch könne immer nur mühsam und wenn überhaupt, nur übergangsweise vom Tier abgegrenzt werden.[47] Weiter wird bezweifelt, ob der Mensch sich überhaupt als homogenes Prinzip deuten lasse bzw. ob er überhaupt eine spezifische Natur besitzt.[48]
Rousseau, der im 2. Diskurs eigentlich der Frage nachgeht, worin der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen besteht, zu deren Beantwortung jedoch zuerst grundlegende Misslehren über die Natur des Menschen aus dem Weg geräumt werden müssen, versucht sich dem Wesen des Menschen auf hypothetischem Wege zu nähern, indem er einen l’homme sauvage postuliert.
Was folgt ist zunächst eine beschleunigte Geschichte des Menschen: vom rohen, solitären Waldmenschen zur hoch entwickelten aber sich selbst entfremdeten Sozialmaschine. Der empirischen Anthropologie seiner Zeit traut Rousseau hinsichtlich des Menschen nicht, da diese seiner Meinung nach noch zu sehr in den Kinderschuhen stecke.[49]
In seiner Abhandlung durchschreitet er drei Stufen der menschlichen Entwicklung: Erstens den geschlossenen Naturzustand, zweitens den familiären Naturzustand und drittens den gesellschaftlichen Zustand, in welchem erst die Rahmenbedingung für ungerechte Machtverteilung zu finden sei und in dem etwa Handlungen beginnen moralisch zu werden.[50]
Im Bezug auf Jean Pauls Unsichtbare Loge interessiert uns vor allem Rousseaus Konzept vom Menschen im Naturzustand, da von hier aus der Entfremdungsprozess seinen hypothetischen Ausgang nimmt.[51] Wir wollen also versuchen, die Beschaffenheit dieses Zustandes zu rekonstruieren, um so zu Rousseaus Theorie eines ursprünglichen Menschen zu gelangen.
Es gibt im Wesentlichen zwei Zustände, die sich dichotomisch gegenüberstehen: der Naturzustand und der gesellschaftliche Zustand. Im Naturzustand lebt der Mensch solitär und in vollkommener Übereinstimmung mit sich selbst, während die allmähliche Bildung von menschlichen Zusammenschlüssen den Entfremdungsprozess einleitet. Doch bevor wir erklären, warum das so ist, müssen wir das Konzept vom Wilden Menschen noch besser verstehen.
Von Anfang an assoziiert Rousseau mit den Eigenschaften eines l’homme sauvage nur Positives: Er greift dabei den Topos körperlicher Abhärtung durch das Leben in der Wildnis auf. Leid aufgrund physischer Schwäche sei daher ein typisches Problem der Zivilisation. Der Mensch zeige zwar durch seine natürliche Konstitution gegenüber anderen Tieren Defizite in Punkto Muskelkraft auf, gleiche das aber durch diverse andere Vorzüge aus: z. B. dadurch, dass er nicht nur auf eine einzige Art von Nahrung angewiesen ist oder dass Menschenmütter im Gegensatz zu Tiermüttern ihr Junges bei Bedarf davontragen können oder dass die Aktivität des menschlichen Geschlechtstriebs nicht nur auf eine bestimmte Jahreszeit beschränkt ist.[52]
Der wilde Mensch sei autonomer, da er an die Widrigkeiten der Wildnis angepasst ist und sich ohne technische Hilfsmittel zurechtfindet. Wenn er im Naturzustand, um z. B. an eine Frucht zu kommen, ein Werkzeug benötigte, dann benötigte er in Wahrheit nicht diese bestimmte Frucht, denn was der Mensch braucht, das gewährt im die Natur, ohne dass sie ihm die größten Hindernisse in den Weg stellte.[53]
Das entscheidende Merkmal des Wilden Menschen sei aber seine schlichte emotionale Struktur, die mit den simplen Mechanismen der äußeren Welt korrespondiere. Da der Wilde Mensch über keinerlei Vorstellungskraft verfügt, lebt er immer im Hier und Jetzt. Kategorien wie Vergangenheit oder Zukunft kennt er nicht. In diesem Zustand ist er geistig gesund, weil er seine Leidenschaften nicht durch künstliche Bedürfnisse und Sehnsüchte reizen kann oder sein geringes Reflexionsvermögen ihn davor schützt, dass seine Seele durch Kümmernisse zermürbt wird. Seine Leidenschaften entstehen nur durch den „Antrieb der Natur“ und nicht etwa durch Ideale der Aufklärung: „Seine Begehren gehen nicht über seine physischen Bedürfnisse hinaus. Die einzigen Güter, die er in der Welt kennt, sind Nahrung, ein Weibchen und Ruhe; die einzigen Übel, die er fürchtet, sind Schmerz und Hunger.“[54]
Bei allen bereits vorgetragenen Gedanken wird eines deutlich. Rousseau geht es um den Menschen an sich und um die Frage seiner wahren Natur. Freilich ist seine zweite Abhandlung (wie auch die erste) im Rahmen eines Preiswettbewerbs der Akademie von Dijon entstanden, deshalb musste sein erklärtes Ziel auch sein herauszufinden, warum es in den Gesellschaften so ungerecht zugeht. Was aber hinter allen Bemühungen steht ist die weit grundlegendere Frage, wie es dem Menschen gelingen kann ein Leben zu führen, das seiner Natur entspricht.[55] Diese Frage beantwortet Rousseau jedoch nicht direkt, eben so wenig wie er sie explizit stellt. Er gibt auch keine positiven Ratschläge zur Lebensführung, sondern geht hauptsächlich von den in seiner Zeit vorherrschenden Zuständen aus, subtrahiert davon alles Zivilisatorische, kommt auf diesem Wege zu seinem wilden Menschen und zieht von diesem theoretisch bereinigten Grund aus den Schluss, dass die aktuelle Kultur dem Menschen nicht positiv entspricht.
Die Ganzheit des Menschen betreffend ergeben sich dann zwei hauptsächliche Entfremdungsformen: zum einen innere Separation, d. h. der Mensch degeneriert durch bestimmte Kulturphänomene zum Fragment, zum anderen die unnatürliche soziale Vervielfältigung des „Ichs“. Beides schadet dem Menschen und führt zu einem Leben, das seinem Wesen nicht mehr entsprechen kann.
Im Naturzustand, in dem alles gleichförmig verläuft, ist der Mensch weder ein Fragment noch vervielfacht. Wie er jemals den Naturzustand verlassen konnte ist für Rousseau im Übrigen ein Rätsel, da nichts und niemand aus seiner determinierten Rolle herausfallen kann (selbiges gilt für die Frage, wie der Mensch Sprache entwickeln konnte).[56] Da der l’homme sauvage ein solitäres Dasein führt und nur ab und zu sich zur Fortpflanzung mit einem „Weibchen“ verbindet, was aber ohne soziale Folgen bleibt und auf der anderen Seite auch nicht befürchten muss, dass er von einem stärkeren Wilden versklavt wird, kann er gar nicht anders, als in jenem Zustand zu verharren, in dem seine individuell-gefühlsmäßige Ganzheit dauerhaft erhalten bleibt (ja, er kann nicht einmal wissen, dass es eine Störung dieses Zustands geben kann).
Der wilde Mann ist, das geht aus dem Gesagten hervor, keineswegs ein emotionsloses Wesen. Er hat ein natürliches Interesse an seiner Selbsterhaltung sowie ein Bedürfnis nach Ruhe und Nahrung und trachtet niemals danach, anderen Geschöpfen aus blinder Aggression heraus zu schaden. Rousseau fasst diese Eigenschaften unter dem Begriff der „Selbstliebe“ (l’amour de soi-même) zusammen.[57] Diese ist die einzige Form der Liebe, die er kennt – die rein auf sich selbst bezogene.
Mit der Annahme, dass sich im Laufe der Zeit die äußeren Umstände geändert bzw. der bloße Zufall für eine Neuerung sorgte, sodass es dem solitären Menschen von Nutzen erschien, Verbindungen einzugehen, begann der Mensch nach und nach seine Lebensweise zu ändern. Die Folge war, dass man feste Bündnisse schloss, die zunächst familiärer Natur waren und später dann zu Volksgemeinschaften expandierten. Sich an soziale Strukturen gewöhnend begann der Mensch sich mit anderen zu Vergleichen und nach Anerkennung zu streben. Damit veränderte sich auch gleichzeitig seine Bedürfnisstruktur: Zur Selbstliebe gesellte sich eine zweite, bereits entfremdete Form der Liebe: die Eigenliebe (l’amour-propre oder l’amour comparatif).[58] Er fand fortan, dass er ein Recht auf Ansehen besäße und deutete den Verstoß dagegen als Beleidigung.[59] Da jetzt sein Wohlbefinden vom sozialen Ansehen abhing fing er an, den anderen gefallen zu wollen. Damit begann er für sich selbst und im gleichen Maße für die anderen zu existieren und somit verlor er die Sicherheit, immer nur bei sich selbst bleiben zu können.
Durch die Vernunft erwacht also der Mensch aus seinem tierischen Schlummer. Sie bewirkt den Übergang vom physischem Determinismus zum freien Willen – die Fähigkeit des Menschen, sich selbst zu vervollkommnen (perfectibilité) ist jedoch gleichzeitig der Ursprung seiner Entfremdung.[60] Rationale Gründe können diesen Willen nun bestimmen, was beim wilden Menschen nicht der Fall ist, da er, wie uns Rousseau lehrt, nur seine natürlichen Antriebe kennt. Mit der Ratio beginnt der Mensch sein Verhalten zu reflektieren. Dadurch kommt er zur Moral, indem er seine Handlungen ethisch und juridisch limitiert, um seine individuelle Freiheit zu schützen. Dadurch, dass der Mensch aber trotz seiner geistigen Kräfte ein organisches Wesen bleibt, ist er jeden Tag aufs Neue dem Antagonismus von Moralität und Affektion ausgesetzt.
1.3 Rousseau und die Unsichtbare Loge
Wer sich gegenwärtig auf die Suche nach den anthropologischen Spuren Rousseaus im Werk Jean Pauls begibt, wird alsbald feststellen müssen, dass man damit so gut wie unerschlossenes Neuland betritt. Ich beziehe mich dabei vor allem auf die geistige Grundhaltung Rousseaus, die sich ja insbesondere aus der Frage ergibt: Was ist der Mensch?
Für Rousseau und Jean Paul als Pädagogen trifft dies freilich weniger zu, da die Forschung hier die Ähnlichkeiten hinreichend bemerkt und gegenübergestellt hat.[61] Es ist aber doch auffällig, dass dabei anthropologische Aspekte zumeist ausgeblendet werden. So bleibt die Darstellung der Erziehung im Sinne beider Autoren ohne das entsprechende Menschenbild oftmals ein Torso.
Rousseau hat die Frage nach dem Wesen des Menschen in seinen Diskursen wohl kaum hinreichend beantwortet. Rousseau wurde im Grunde ohne ein stabiles anthropologisches Fundament zu einem der wichtigsten Denker der pragmatischen Philosophie. In diesem Fall scheint Nietzsches Gedanke zuzutreffen, wonach der Wunsch nach monistischen Erklärungsmodellen oder Begriffen eher ein Zeichen der Schwäche ist, während das Ertragen-Können von nicht monistischen Systemen – ich würde diese im Kontext der vorliegenden Arbeit gerne mit dem Begriff „Topiken“ übersetzen – ein Zeichen aufrichtiger Stärke.[62]
Die im Grunde einzige Vorarbeit auf die wir im Zusammenhang des Verhältnisses von Rousseau und Jean Paul speziell in der Unsichtbaren Loge zurückgreifen können ist Max Kommerells weitestgehend vergessene Dissertation Jean Pauls Verhältnis zu Rousseau aus dem Jahre 1925. Kommerell setzt hier nur Rousseaus Erziehungsroman Émile in Zusammenhang zur Loge. Auch für seine ganze Untersuchung spielen Rousseaus anthropologische Überlegungen wenn überhaupt nur eine periphere Rolle (explizit nennt er gar kein Beispiel), obwohl er am Ende als Fazit konstatieren muss, dass Jean Pauls Verbindungen zu Rousseau in den Romanen eher „das ganze Empfinden und Denken über den Menschen angingen“ als „vernunftgemäßere einzelne Regeln“ der Pädagogik.[63]
Auch wenn Kommerells Darstellung ein vielleicht zu negatives Bild von Rousseau vermittelt, während Jean Paul durchgängig als leuchtend-kraftvolle Ikone glorifiziert wird, so stimmt der Verfasser doch mit einigen Tendenzen überein. Denn die Annahme, dass Rousseau ein Mensch war, der sich als solcher „nie in Einklang bringen konnte“ und deswegen sein Heil in einer „tierischen Dumpfheit“ – bzw. der Kindheit – suchte,[64] muss wohl gültig sein, soweit er m. W. auch im Alter nichts von seinen rohen Naturmensch-Vorstellungen, wie sie in den Diskursen aber auch im Émile widerklingen, revidiert hat. Was aber allein die Loge betrifft, so mag ich bezweifeln, dass Jean Paul nur eine „einfachere, dichterische, volkshaftere“ Liebe zur Kindheit beweist und deshalb ein „Zurücksinken“ zu ihr „nie nötig“ gehabt hätte.[65]
Natürlich unterscheiden sich die pädagogischen Entwürfe dahingehend, und da ist Kommerell zuzustimmen, dass Gustav zu einem geistig-beseelten Hochmenschen herangezogen werden soll, während Émils Erziehung eher auf das Animalische, das Körperliche, das von jeglichen Kulturzwängen Befreite abzielt. Treffend fasst Kommerell die Gemeinsamkeiten der Erziehungsmodelle beider Romane zusammen:[66] Übereinstimmend sei der Gedanke der Isolation, wobei er jedoch auf die bereits genannten Unterschiede in der Intention hinweist, sowie der Umstand, dass beide Protagonisten von vollkommenen Mentoren ausgebildet werden. Auch dass das Zeichnen dem Musizieren vorgezogen wird, gilt für beide Texte, wobei es bei Rousseau eher um eine trockene „Schulung des bloßen Wirklichkeitssinns“ gehe, während Jean Paul das Malen als „fromme Übung“ eines sinnlichen Zueigenmachens inszeniere. Die Bemerkung, dass die Erzieherischen Vorlegblätter mit dem Inhalt des Émile korrespondieren, erscheint ebenso plausibel wie die Tatsache, dass beide Autoren in einer religiösen Erziehung die Einengung des Geistes befürchten.
Da Kommerell v. a. den pädagogischen Topoi nachspürt und die anthropologischen dabei vernachlässigt, ist es auch kaum verwunderlich, dass er klare Anspielungen, etwa auf den l’homme sauvage, nicht anführt. Ich denke u. a. an folgende Stelle im Zusammenhang des Unterirdischen Pädagogiums:
„Und so floß beiden [= Gustav u. Genius] ihr Leben sanft in die Katakombe wie eine Quelle davon. Der Kleine war glücklich; denn seine Wünsche langten nicht über seine Kenntnisse hinaus. Und weder Zank noch Furcht rissen seine stille Seele auseinander.“ (S. 56)[67]
Steht die vorliegende Formulierung nicht in augenscheinlicher Nähe zu Rousseau, mit der er seinen l’homme sauvage beschreibt?
„Die Leidenschaften ihrerseits beziehen ihren Ursprung aus unseren Bedürfnissen und ihren Fortschritt aus unseren Kenntnissen; denn man kann die Dinge nur vermittels der Vorstellungen begehren oder fürchten, die man von ihnen haben kann, oder aufgrund des einfachen Antriebs der Natur; und der wilde Mensch, der jeglicher Art von Einsicht und Aufgeklärtheit entbehrt, empfindet nur die Leidenschaften dieser letzteren Art. Seine Begehren gehen nicht über seine physischen Bedürfnisse hinaus [hervorg. DV].“[68]
M. W. blieben direkte intertextuelle Bezüge dieser Art bislang unbemerkt. Auch wenn hier eine kleine inhaltliche Verschiebung zu bemerken ist, so ist doch der Grundgedanke gemeinsam, dass in beiden Fällen der natürliche Mensch auf Grund seiner schlichten geistigen Konstitution nichts wünschen oder begehren kann was nur der Verstand hervorruft. Eben genau darin besteht ja Gustavs Glück.
Natürlich ist es aber, so sieht es auch Kommerell, ein lockeres und vor allem doch emanzipiertes Verhältnis, das Jean Paul zu Rousseau pflegt. Die Levana sei sogar in vielerlei Hinsicht ein weiterführender, gerechterer Entwurf zu Rousseaus Erziehlehre.[69] Auch wenn Jean Paul Zeit seines Lebens glühender Rousseau-Verehrer blieb, so zeigen schon die direkten Bezüge der Loge (die Kommerell übrigens nicht anführt), dass von Anhänglichkeit keine Rede sein kann. Diese erscheinen in satirischem Kontext ebenso wie in einem verehrenden. In ersterem Sinne muss man z. B. den eher weniger schmeichelhaften Vergleich zum Prahlhans Oefel verstehen, denn „Jean Paul“ behauptet dort eine charakterliche Ähnlichkeit zu Rousseau:
„Vielleicht fand auch Gustav in seinen Jahren des Geschmacks, wo den Jüngling die poetischen kleinern Schönheiten und Fehler entzücken, zuweilen die Oefelschen gut. Wie nun schon Rousseau sagt, er könne nur den zum Freund erwählen, dem seine Heloise gefalle: so können Belletristen nur solchen Leuten ihr Herz verschenken, die mit ihnen Ähnlichkeit des Herzens, Geistes und folglich des Geschmacks haben und die mithin die Schönheiten ihrer Dichtungen so lebhaft empfinden als sie selber.“ (S. 208)
„Jean Paul“ sagt hier ja eigentlich etwas Negatives über Rousseau aus, nämlich eine gewisse philosophische bzw. ästhetische Eitelkeit oder die Unfähigkeit, sich auf einen fremden „Geschmack“ einzulassen.
Ein anderes Mal stellt Jean Paul den Bezug zur Heloise im Kontext einer Adelskritik her. So legt er dem Adel die Kollektiv-Meinung in den Mund, „die Julie des Jean Jaques […] ist wie tausend Julien oder wie Jean Jaques selber: sie beginnt mit Schwärmen, endigt mit Beten – aber das Fallen ist zwischen beiden.“ (S. 273). So äußert sich der Adel über die Liebe, was bedeutet, dass er ihr eine niedrige Form, das heißt eine körperliche, fest zuschreibt. Warum Jean Paul Rousseau als einen „Gefallenen“ sieht, darüber kann man an dieser Stelle nur spekulieren. Ob Jean Paul auf Rousseaus erotische Abenteuer der Jugendzeit anspielt?[70]
Dass aber, jedenfalls für die Loge gesprochen, die verehrende Wärme für Rousseau obsiegt, zeigt die Stelle im idyllischen Lilienbad, wo „Jean Paul“ sich ehrfürchtig vor dem Genie Rousseau verneigt:
„Der große Weltgeist konnte nicht die ganze spröde Chaos-Masse zu Blumen für uns umgestalten; aber unserem Geist gab er die Macht, aus dem zweiten, aber biegsamen Chaos, aus der Gehirn-Kugel, nichts als Rosen-Gefilde und Sonnen-Gestalen zu machen. Glücklicherer Rousseau, als du selber wußtest! Dein jetziger erkämpfter Himmel wird sich von dem, den du hier in deiner Phantasie anlegtest, in nichts als darin unterscheiden, daß du ihn nicht allein bewohnest…“ (S. 379 f.)
Als die Unsichtbare Loge 1793 erschien, war Rousseau schon seit 15 Jahre gestorben, deshalb spricht „Jean Paul“ wohl vom „jetzigen [hervorgeh. DV] erkämpften Himmel“. Dass Rousseau kein glücklicher Mensch gewesen sein muss, bestimmt hier auch Jean Pauls Rousseau-Bild, weshalb diese Stelle auch einen elegischen Pathos hat. Jean Paul lobt also die gestaltende Kraft Rousseaus, der sich mit feurigem Eifer der „spröden Chaos-Masse“ widersetzt und mit der Macht seiner Vorstellungskraft einen eigenen Himmel, ein künstliches „Rosen-Gefilde“ erschuf, das aber zu Lebzeiten kein anderer bewohnen konnte als Rousseau selbst. Sicher greift Jean Paul hier das Klischee auf, dass Rousseau ein einsamer Mann war.[71] Dementsprechend wirkt es geradezu selbstverständlich, dass Rousseau im Extrablatt von hohen Menschen explizit erwähnt wird:
„Könnte man die Gräber eines Pythagoras (dieser schönsten Seele unter den Alten) – Platos – Sokrates’ – Antonins […] – Shakespeares (wenn sein Leben wie sein Schreiben war) – J.J. Rousseaus und ähnlicher in einem Gottesacker zusammenrücken: so hätte man die wahre Fürstenbank des hohen Adels der Menschheit […]“ (S. 222)
Abgesehen von den Direktbezügen geht es mir in der folgenden Darstellung um die allgemeinen anthropologischen Topoi, die Jean Paul für seine Charaktere kompositorisch zugrunde legt. Dies lässt sich de facto und am einfachsten von einer simplen Leitfrage aus bewerkstelligen: Wie steht der Mensch zu seinem Verstand? Ich behaupte, dass Jean Paul in der Unsichtbaren Loge mit jedem einzelnen seiner Charaktere eine eigene, abgeschlossene Antwort auf diese Frage gibt. Dass hier und da der Hinweis auf das Rousseau’sche Modell des Naturmenschen bzw. auf die damit zusammenhängende Kulturkritik etwas Erhellendes haben mag, dürfte mit Blick auf eine Entfremdungstopik einleuchten. Denn auch wenn Rousseau m. W. nirgendwo das Wort „Entfremdung“ erwähnt, so gilt er doch zweifelsfrei und zu Recht als einer der ersten und wichtigsten Entfremdungstheoretiker.[72] Aber dennoch möchte ich einen zu starken Fokus auf das Diskursive vermeiden, um die ohne Zweifel völlig eigenständige Charaktertopik, die Jean Paul virtuos in seinem Romanerstling entfaltet, besser zum Vorschein kommen zu lassen.
[...]
[1] Lediglich Sprengel verfolgte bisher einen ähnlichen Ansatz, jedoch ohne eine entsprechende Tiefe insbesondere für die Loge zu erreichen. S. Sprengel, Peter: Innerlichkeit. Jean Paul oder Das Leiden an der Gesellschaft. München: 1977, S. 14 ff.
[2] Ueding, Gert: Jean Paul. München: 1993, S. 54.
[3] Vgl. dazu die grundlegende Arbeit von Mertner, Edgar: Topos und Commonplace. In: Toposforschung. Eine Dokumentation. Hrsg. von Peter Jehn. Frankfurt a. M.: 1972 (= Respublica Literaria. Bd. 10), S. 22 ff.
[4] Pöggeler, Otto: Toposforschung und aktualisierte Topik. In: Toposforschung. Eine Dokumentation. Hrsg. von Peter Jehn. Frankfurt a. M.: 1972 (= Respublica Literaria. Bd. 10), S. 160. Vgl. auch Wiedemann, Conrad: Topik als Vorschule der Interpretation. Überlegungen zur Funktion von Toposkatalogen. In: Topik. Beiträge zur interdisziplinären Diskussion. Hrsg. von Dieter Breuer und Helmut Schanze. München: 1981, S. 236: „[…] die Frage nach den Ursachen seiner wissenschaftlichen Anziehungskraft [erscheint eher interessant] als die nach der Einheit [der Erscheinungen unter dem Oberbegriff ,Topik’].“
[5] Pöggeler, Toposforschung, S. 160.
[6] Bornscheur, Lothar: Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft. Frankfurt a. M.: 1976, S. 92.
[7] Veit, Walter: Toposforschung. In: Toposforschung. Hrsg. von Max Baeumer. Darmstadt: 1973 (= Wege der Forschung, Bd. 395), S. 148.
[8] Veit, Walter: Studien zur Geschichte des Topos der Goldenen Zeit. Von der Antike bis zum 18. Jahrhundert. Köln: 1961, S. 1 ff.
[9] Veit, Zur Toposforschung, S. 82.
[10] Ebd., S. 83.
[11] Ebd., S. 84
[12] Pöggeler, Otto: Dichtungstheorie und Toposforschung. In: Toposforschung. Hrsg. von Max Baeumer. Darmstadt: 1973 (= Wege der Forschung, Bd. 395), S. 80. Er folgt hier in der Darstellung Auerbach, Erich: Vier Untersuchungen zur Geschichte der französischen Bildung. Bern: 1951, S. 8f.
[13] Auerbach, Vier Untersuchungen, S. 9.
[14] Pöggeler, Dichtungstheorie, S. 80.
[15] Auerbach, Vier Untersuchungen, S. 10.
[16] Pöggeler, Dichtungstheorie, S. 86.
[17] Ebd., S. 22.
[18] Vgl. dazu insbesondere die Arbeit von Bachem, Rudolf: Dichtung als verborgene Theologie. Ein dichtungstheoretischer Topos vom Barock bis zur Goethezeit und seine Vorbilder. Bonn: 1956, S. 15. Bachem definiert allgemein solche Topoi als „Stelle (in einem Buch) oder rhetorischer Gemeinplatz“, sagt jedoch über dichtungstheoretische Topoi: „[Sie] bedeuten uns mehr als bloße Redensarten, sie sind jeweils Ausdruck der Kunstauffassung von einem bestimmten Ort des Geistes her“.
[19] Curtius, Robert Ernst: Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter. 11. Aufl. Tübingen: 1993. Vgl. S. 116 ff. und S. 214. Zu Curtius’ Toposbegriff vgl. vor allem Curtius, Robert Ernst: Zur Literarästhetik des Mittelalters II. In: Zeitschrift für Romanische Philologie 58 (1938), S.139.
[20] Pöggeler, Dichtungstheorie, S. 30 f.
[21] Obermayer, August: Zum Toposbegriff der modernen Literaturwissenschaft. In: Toposforschung. Hrsg. von Max Baeumer. Darmstadt: 1973 (= Wege der Forschung, Bd. 395) S. 263.
[22] Ebd., S. 252.
[23] Ebd.
[24] Ebd., S. 264 f.
[25] Beaumer, Max: Dialektik und zeitgeschichtliche Funktion des literarischen Topos. In: Toposforschung. Hrsg. von Max Baeumer. Darmstadt: 1973 (= Wege der Forschung, Bd. 395), S. 348.
[26] Ebd., S. 346.
[27] Ebd., S. 347.
[28] Ebd.
[29] Ebd.
[30] Bornscheuer, Topik, S. 93.
[31] Ebd.
[32] Ebd., S. 94.
[33] Ebd.
[34] Ebd., S. 98f.
[35] Ebd.
[36] Ebd.
[37] Ebd. S. 103.
[38] Schirren, Thomas/ Ueding, Gert: Topik und Rhetorik. Ein interdisziplinäres Symposium. Tübingen 2000 (= Rhetorik-Forschungen, Bd. 13).
[39] Frank, Thomas/ Kocher, Ursula/ Tarnow, Ulrike: Einleitung der Herausgeber. In: Topik und Tradition. Prozesse der Neuordnung von Wissensüberlieferungen des 13. bis 17. Jahrhunderts. Göttingen: 2007 (= Berliner Mittelalter- und Frühneuzeitforschung, Bd. 1), S. 16.
[40] Das ist sicher auch im Zusammenhang der zunächst juridisch geführten Naturrechtssdebatte zu sehen, dessen früheste Teilnehmer u. a. Thomas Hobbes mit seinem Leviathan (1651) und Samual von Pufendorf mit De iure et gentium libri octo (1672) waren.
[41] Zur Maschinisierung des Menschen vgl. Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen. Friedrich Schiller. Werke und Briefe in zwölf Bänden. Hrsg. von Otto Dann, Axel Gellhaus, Klaus Harro Hilzinger u. a. Bd. 8. Theoretische Schriften. Frankfurt a. M.: 1992, S. 576. Zur Entdeckung und Idealisierung der Südsee-Insulaner trug u. a. Louis Antoine de Bougainville mit seiner Description d’un voyage autour du monde von 1771 bei.
[42] Schmitz-Emans, Monika: Die Erfindung des Menschen auf dem Papier. Jean Pauls Unsichtbare Loge, der Fall Kaspar Hauser und Jacob Wassermanns Caspar Hauser-Roman. In: Jahrbuch der Jean-Paul-Gesellschaft, 40 (2005), S. 155.
[43] Ebd.
[44] Ebd., S. 156.
[45] Die Textgrundlagen zur vorliegenden Arbeit sind: Rousseau, Jean-Jacques: Ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sitten beygetragen hat? In der ersten deutschen Übersetzung von Johann Daniel Tietz. Hrsg. von Ralf Konersmann und Gesine Märtens. St. Ingbert: 1997. Rousseau, J.-J.: Diskurs über die Ungleichheit. Kritische Ausgabe des integralen Textes. Französisch-deutsch. 6. Aufl. Hrsg. von Heinrich Meier. Paderborn: 2008.
[46] Schmitz-Emans, Die Erfindung des Menschen, S. 157.
[47] Ebd., S. 150.
[48] Anthropologie. In: Philosophie-Lexikon. Personen und Begriffe der abendländischen Philosophie von der Antike bis zur Gegenwart. Hrsg. von Anton Hügli und Poul Lübcke. 5. Aufl. Hamburg: 2003, S. 45.
[49] Rousseau, Über die Ungleichheit, S. 77.
[50] Ebd. S. 177.
[51] Zum Begriff der Entfremdung sowie seiner neueren Verwendung vgl. Mikyung Kim: Entfremdung als Problematik in den autobiographischen Prosawerken bei Marie Luise Kaschnitz. Frankfurt a. M.: 2003 (= Europäische Hochschulschriften, Bd. 1871), S. 37 ff. In dieser Arbeit greife ich auf die allgemeine Definition zurück, die Mikyung vorschlägt: „Das Phänomen ,Entfremdung’ ergibt sich in der fremdartig (unbekannt, ungewohnt, unvertraut) gewordenen Beziehung zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen und der Umwelt und auch in der Erfahrung des eigenen ,Ichs’. Die Entfremdung steht in der Tat auch für Erfahrung von Trennung, Entfernung, Verschwinden oder Entgegensetzung zu heimischer Umwelt, Eigentum, Gemeinschaft, Religion oder eigenem Selbst.“ Zum Begriff selbst und seinen zahlreichen historischen Varianten vgl. Alt, Ernst: Zum Entfremdungsbegriff: Der theoretische Ansatz bei Rousseau. Frankfurt a. M./ Bern: 1982 (= Europäische Hochschulschriften, Bd. 68), S. 11 ff.
[52] Rousseau, Über die Ungleichheit, S. 93 f.
[53] Vgl. dazu ebd., S. 83.
[54] Ebd., S. 107.
[55] Ich verzichte an dieser Stelle bewusst auf die Formulierung „wie er glücklich wird“. Meines Wissens taucht das Wort „Glück“ auch bei Rousseau nur sehr selten auf. Das Glück, als das im aristotelischen Sinne oberste Gut, das allen anderen Zwecken übergeordnet ist als „Endzweck“, den jeder Mensch durch sein Handeln unablässig erstrebt, kann auch nur dadurch erreicht werden, dass der Mensch ein ihm „gemäßes“ Leben führt. Jedoch unterscheiden sich die Konzepte dadurch, dass unterschiedliche Vorstellungen davon herrschen, was der Mensch seinem Wesen nach ist. Aristoteles preist die Philosophie als die dem Menschen angemessendste Tätigkeit, die zudem mit dem Vorzug versehen ist, dass sie mit dem Ideal eines autark lebenden Menschen zusammen bestehen kann. Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik. Übersetzt von Franz Dirlmeier. Stuttgart: 2006, S. 11 ff. Rousseau freilich steht der rein philosophischen Tätigkeit sehr misstrauisch, ja bisweilen sogar mit Verachtung gegenüber, da sie im Grunde nur durch das Laster begründet sei. Vgl. Rousseau, Ob die Wiederherstellung der Wissenschaften und Künste etwas zur Läuterung der Sitten beygetragen hat, S. 24 f.
[56] In seinem 1762 verfassten Du Contract Social; Ou Principes Du Droit Politique (dt. Gesellschaftsvertrag) unterstellt er jedoch im 6. Kapitel, „daß die Menschen jenen Punkt erreicht haben, an dem die Hindernisse, die ihrem Fortbestehen im Naturzustand schaden, in ihrem Widerstand den Sieg davontragen über die Kräfte, die jedes Individuum einsetzen kann, um sich in diesem Zustand zu halten. Dann kann dieser ursprüngliche Zustand nicht weiter bestehen, und das Menschengeschlecht würde zugrunde gehen, wenn es die Art seines Daseins nicht änderte.“ Rousseau, Jean-Jacques: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts. Übersetzt und hrsg. von Hans Brockard. Stuttgart: 2006, S. 16.
[57] Vgl. dazu auch die Darstellung von Berief, Renate: Selbstentfremdung als Problem bei Rousseau und Schiller. Idstein: 1991 (= Beiträge zur Philosophie, Bd. 102), S. 241.
[58] Ebd., S. 103 ff.
[59] Rousseau, Über die Ungleichheit, S. 189 f.
[60] Berief, Selbstentfremdung, S. 94; Rousseau, Über die Ungleichheit, S. 103 f.
[61] Eine Gegenüberstellung von Rousseau und Jean Paul hinsichtlich ihrer Pädagogik findet man z. B. bei Münch, Wilhelm: Jean Paul. Der Verfasser der Levana. Berlin: 1907 (= Die Grossen Erzieher. Ihre Persönlichkeit und ihre Systeme, Bd. 1), S. 143 ff.; Heinritz, „Kindheitshöhle“, S. 158 f.
[62] Nietzsche, Friedrich: Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte. Hrsg. von Peter Gast. Stuttgart: 1964, S. 69.
[63] Kommerell, Max: Jean Pauls Verhältnis zu Rousseau. Nach den Hauptromanen dargestellt. Marburg a. L.: 1925, S. 164.
[64] Ebd., S. 122.
[65] Ebd., S. 122 f.
[66] Ebd., S. 117 ff.
[67] Zitate aus der Loge werden im Folgenden als Seitenangabe in Klammern belegt. Textgrundlage ist die 2. Auflage der Hanser Gesamtausgabe: Jean Paul: Die unsichtbare Loge. Sämtliche Werke. Abt. 1, Bd. 1. Hrsg. von Norbert Miller. 2. Aufl. München: 1996.
[68] Rousseau, Über die Ungleichheit, S. 107.
[69] Kommerell, Verhältnis zu Rousseau, S. 178 f.
[70] Rousseau verliebte sich in seiner Jugendzeit in eine Madame de Warens, die ihn zum Katholizismus bekehrte. Vgl. Soëtard, Michel: Jean-Jacques Rousseau. Leben und Werk. München: 2012, S. 19 ff.
[71] Was jedoch nur für die Zeit der Zurückgezogenheit in der Eremitage zutrifft. In dieser Zeit appellierte sein Freund Diderot an sein „Herz“, das ihm bei genauerem Hinhören eingebe, „dass der gute Mensch in Gesellschaft […] und dass nur der Böse allein lebt“. Ebd. S. 59.
[72] Berief, Selbstentfremdung, S. 18.
- Arbeit zitieren
- Daniel Vesel (Autor:in), 2012, Zur anthropologischen Topik in Jean Pauls "Unsichtbarer Loge", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231477
Kostenlos Autor werden









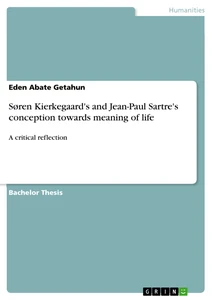
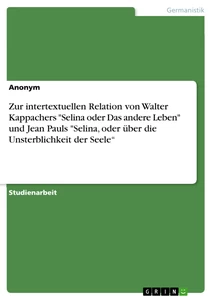











Kommentare