Leseprobe
Inhalt
Einleitung
I. Poesie
Novalis: [Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren]
Die heilende Kraft des geheimen Wortes
II. Mensch und Gott
Andreas Gryphius: Tränen des Vaterlandes, anno 1636
Entindividualisierte Hoffnungslosigkeit
Johann Wolfgang von Goethe: Prometheus
Glühende Rebellion des schöpferischen Ichs
Johann Wolfgang von Goethe: Grenzen der Menschheit
In Form gestaltete Demut
Joseph von Eichendorff: Die zwei Gesellen
Aporien im Angesicht Gottes
Eduard Mörike: Gebet
Die fromme Demut des bescheidenen Mittelwegs
Rainer Maria Rilke: Herbsttag
Zwischen Gebet und Warnung – Zerrissenheit als Krisensymptom
Jakob van Hoddis: Weltende
Rächende Raserei der gottlosen Natur
III. Mensch und Natur
Johann Hölty: Die Mainacht 54 Larmoyante Abschottung des einsamen Subjekts
Friedrich Gottlieb Klopstock: Die Sommernacht
Elegische Naturbetrachtung
Johann Wolfgang von Goethe: [Ich saug’ an meiner Nabelschnur]
Euphorische Lebensfahrt durch Mutter Natur zur Selbsterkenntnis
Friedrich Hölderlin: [Ringsum ruhet die Stadt]
Die kompensatorische „Fremdlingin unter den Menschen“
Joseph von Eichendorff: Frische Fahrt
Das romantische Subjekt im Fluss des Lebens
Joseph von Eichendorff: Zwielicht
Die Angst vor der verborgenen Seite des menschlichen Individuums
Joseph von Eichendorff: Mondnacht
Die Heimreise des Ichs durch die Natur
Eduard Mörike: Septembermorgen
Vom Glück der harmonischen Schönheit der Natur
Eduard Mörike: Er ist’s
Freudige Begrüßung eines alten Freundes
Heinrich Heine: [Ich weiß nicht, was soll es bedeuten]
Auf den Flügeln der Eule der Minerva
Heinrich Heine: [Das Fräulein stand am Meere]
Ironisierende Parodie als Zeichen innerer Zerrissenheit des modernen Individuums
Theodor Storm: Hinter den Tannen
Elegische Erinnerungen an die Natur als Ort idyllischen Glücks
Stefan George: Komm in den totgesagten park
Rehabilitation des Kunstschönen in der Natur
Georg Trakl: Verfall
Das Ende der Romantik im Angesicht des Untergangs
Gottfried Benn: Kleine Aster
Die Bestattung einer Aster in Zeiten „transzendentaler Obdachlosigkeit“
Hermann Hesse: Im Nebel
Von der Projektion der sich selbst hervorbringenden Einsamkeit
Ingeborg Bachmann: Toter Hafen
Die Entzauberung der Welt – das Ende der (Schöpfungs-)Geschichte?
Peter Rühmkorf: Himmel abgespeckt
Der Abgesang auf den Glauben an die Transzendenz als elliptische Parodie
Rolf Dieter Brinkmann: Gedicht
Das wandernde Ich auf seinem Weg aus dem Dschungel der Zivilisation
Molla Demirel: Mit dem Morgenwind
Die Wiedergeburt der Romantik aus dem Geist der interkulturellen Migration
IV. Liebe und Sehnsucht
Christian Hofmann von Hofmannswaldau: Vergänglichkeit der Schönheit
Ein Gedicht der Polaritäten – das schöne Mädchen und der Sensenmann
Johann Wolfgang von Goethe: [Es schlug mein Herz. Geschwind, zu Pferde!]
Zeitlos gültige Hommage an die Liebe
Clemens Brentano: [Zu Bacharach am Rheine]
Liebe und Sexualität als Verhängnis
Clemens Brentano: Der Spinnerin Nachtlied
Liebe, Religion und Kunst zwischen Glauben und Zweifeln: Poesie als Autopoiesis
Joseph von Eichendorff: Das zerbrochene Ringlein
Passive Todessehnsucht eines isolierten „Ichs“
Joseph von Eichendorff: Sehnsucht
Romantische Elegie der potenzierten Sehnsucht
Joseph von Eichendorff: Waldgespräch
Die Nachtseite der männlichen Vernunft
Hugo von Hofmannsthal: Frage
Monologisches Fragen – oder: Selbstbespiegelung im Auge des Anderen
Hugo von Hofmannsthal: Die Beiden
Hohe Minne in Zeiten der Selbstentfremdung des Menschen
Erich Kästner: Sachliche Romanze
Die Elegie der Sprachlosigkeit hinter sachlicher Fassade
Ingeborg Bachmann: Schatten Rosen Schatten
Selbstbehauptung in der Fremde durch die Liebe?
Peter Rühmkorf: Auf eine Weise des Joseph Freiherrn von Eichendorff
Die Parodie des Romantischen als (Selbst-)Kritik an der modernen Gesellschaft
Sarah Kirsch: Die Luft riecht schon nach Schnee
Die flüsternde Amsel – neuromantische Schwester der singenden Nachtigall?
Ulla Hahn: Mit Haut und Haar
Das Ich zwischen narzisstischer Klage und emanzipiertem Handeln
Ulla Hahn: Anständiges Sonett
Ekstatisches Loblied auf die Grenzen überschreitende Liebe
Ulla Hahn: Bildlich gesprochen
Die Unmöglichkeit der Liebe zwischen Hingabe und Besitzanspruch
V. Individuum und Gesellschaft
Gottfried August Bürger: Der Bauer
Die Geburt der radikalen Revolte aus dem Geist des selbstbewussten Zorns
Gotthold Ephraim Lessing: Der Tanzbär
Innere Freiheit als Voraussetzung der Revolte
Friedrich Hölderlin: Hälfte des Lebens
Krisenerfahrung des selbst-bewussten Ichs
Theodor Storm: Die Stadt
Die Heimat-Stadt als Fels in der Brandung des Lebens
Hugo von Hofmannsthal: Manche freilich…
Wider die Polaritäten: Vom inneren Zusammenhang aller Wesen
Rainer Maria Rilke: Der Panther
Personifizierte Isolation und metaphorische Selbstentfremdung
Georg Heym: Die Stadt 284 Poetische Ankündigung der Apokalypse
Alfred Wolfenstein: Städter
Über die Einsamkeit der Städter in unseren Tagen
Oskar Loerke: Blauer Abend in Berlin
Der Mensch als wehmütiges Objekt des abendlichen Spiels in der Großstadt
Alfred Lichtenstein: Die Dämmerung
Von der sinnlosen Hässlichkeit der Welt
Bertolt Brecht: Gedanken über die Dauer des Exils
Schreiben als Arbeit „an der Befreiung“ – der Schriftsteller im Exil
Hermann Hesse: Stufen
Übereinstimmung von Wort und Sinn – Lebenshilfe qua Literatur?
Günter Eich: Inventur
Schriftliche Selbstvergewisserung als radikaler Neubeginn?
Ingeborg Bachmann: Böhmen liegt am Meer
Chiffrierte Entgrenzungsversuche und Selbstbewahrung in der Fremde
Rolf Dieter Brinkmann: Selbstbildnis im Supermarkt
Radikale Vereinzelung des Individuums in der Welt des Massenkonsums
Franco Biondi: Die Anfänge
Identitätsbildung als sprachliches Spiel mit interkultureller Differenz
Literaturverzeichnis
Einleitung
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.[1]
Dieses nur vier Verse umfassende Gedicht ist vielleicht eines der bekanntesten in deutscher Sprache überhaupt. Es trägt den Titel „Wünschelrute“ und stammt von Joseph von Eichendorff, der das Gedicht wohl 1835 verfasst hat. Die Poesie selbst wird hier zum Thema gemacht; der Dichter befindet sich auf der Suche nach jenem „Zauberwort“, das „die Welt“ revolutioniert, indem es das „Lied“, das noch in den ebenfalls träumenden „Dingen“ schläft, zu neuem Leben erweckt. Hier wird also nichts Geringeres betont, als die gesellschaftsverändernde Kraft der Dichtkunst mittels der Phantasie. Allerdings muss das entscheidende Wort erst einmal gefunden werden, und es fragt sich, was wir uns unter der „Wünschelrute“ vorstellen können. Trotz der direkten Wendung an den Leser durch das Personalpronomen „du“, die suggeriert, es könne jeder dieses Wort „treffen“, ist es offenbar so, dass nur ein kleiner Kreis von Menschen in der Lage ist, die magische Wünschelrute so zu verwenden, dass die Suche letztlich von Erfolg gekrönt ist. Es sind die Poeten, die dies können. Kurz gesagt: Ein wahrer Poet vermag die Welt zum Singen zu bringen, und dieser Zustand ist erstrebenswert aus Sicht des Gedichts. Der Gesang, selbst eine Form der Kunst, wird geradezu religiös aufgeladen; Kunst und Religion gehen hier also eine enge Verbindung miteinander ein, deren Ergebnis ist, dass die Träume ausgelebt werden und nicht reine Utopie bleiben. Oder – wie Walter Benjamin es viele Jahrzehnte später sagen wird –: „Die Kunst ist der Statthalter der Utopie.“
Was an dieser Sichtweise von heute aus betrachtet auffällt, ist die erhebliche gesellschaftliche Bedeutung, die der Dichtkunst zugesprochen wird. Sie fristet kein Schattendasein in einer eigenen, abgeschotteten Welt, sondern ihr wird zugetraut, die Welt zu erlösen. Die Romantik war neben anderem eine europaweite künstlerische Reaktion auf eine gesellschaftliche, politische und philosophische Krisenerfahrung. Sie umfasst, bezogen auf die deutschsprachige Literatur, etwa die Zeit zwischen 1795 und 1830; das eingangs zitierte Gedicht Eichendorffs gehört in der Tat zu den letzten genuin romantischen Texten deutscher Sprache. Die Zeit um 1800 ist gerade in den angesprochenen Bereichen Literatur, Philosophie und Politik fraglos eine für die europäische Geschichte Weichen stellende Phase und der unsrigen insofern ähnlich, als auch wir das Gefühl haben, in der Epoche eines mehrschichtigen Wandels zu leben. Heute jedoch scheint sich weithin das Gefühl verbreitet zu haben, es könne sich bei dem „Zauberwort“ nur um einen Begriff aus der Finanzpolitik handeln, einigen klugen Köpfen könnte spontan das Wort „Bankenrettung“ in den Sinn kommen oder „Eurorettung“. Doch das Lied, das die Welt singt, wenn diese Wörter getroffen werden, ist – zumindest europaweit – eher eine Elegie, ein Klagelied, als eine „Ode an die Freude“ Schillerscher Prägung.
Vielleicht wäre es für die Gesellschaften nicht abträglich, es würden sich mehr Menschen mit den künstlerischen Meisterleistungen der (jüngeren) europäischen Kulturgeschichte auseinandersetzen. Der vorliegende Band möchte nichts Geringeres, als anzuregen zu einer Beschäftigung mit einer schmalen Rubrik dieses vielgestaltigen kulturellen Schatzes, nämlich der neuzeitlichen deutschsprachigen Lyrik. Diese hat in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als die Kunstrichtung des Barock in Ländern wie Spanien, England, Frankreich, Italien und eben auch Deutschland prägend war, ihre ersten prominenten Zeugnisse hervorgebracht, also zu einem Zeitpunkt, als die erst seit kurzem vereinheitlichte deutsche Schriftsprache gerade das Lateinische zu verdrängen begonnen hatte.
Seitdem sind zahllose Gedichte verfasst worden, die die Zeit bis heute überdauert haben – und zwar in erster Linie durch sprachliche Brillanz, kunstvolle formale Gestaltung und zeitlos gültige Inhalte. Die bereits erwähnte Epoche der Romantik ist sicherlich eine der zentralen für die Geschichte der deutschsprachigen Lyrik, gerade weil der Poesie damals die bereits skizzierte Bedeutung beigemessen worden ist, aber bei weitem nicht die einzige, in der es zu wahren Meisterleistungen gekommen ist.
Die vorliegende Textauswahl ist in erster Linie motiviert durch die Wertschätzung der Dichtkunst, also subjektiv geprägt und ohne Anspruch auf kanonische Gültigkeit. Die Gedichte sind angeordnet in fünf thematischen Bereichen, nämlich „Poesie“, „Mensch und Gott“, „Mensch und Natur“, „Liebe und Sehnsucht“ sowie „Individuum und Gesellschaft“, die wiederum in sich einer chronologischen Ordnung folgen. Einleitend soll zunächst anhand eines einzigen Gedichts exemplarisch gezeigt werden, welche Wertschätzung die Poesie einst genossen hat und in welch anspruchsvoller Art und Weise dies in der Lyrik selbst zum Ausdruck gekommen ist. Die Sicht des Menschen auf Gott als höhere Ordnungsinstanz wandelte sich in den letzten 350 Jahren gewaltig, dies sollen die ausgewählten Gedichte und deren jeweilige Analyse zeigen und erläutern. Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur nimmt in sehr vielen Gedichten eine zentrale Rolle ein, ebenso wie das Themenfeld „Liebe und Sehnsucht“. Welche Entwicklungen sich hier abzeichnen, sollen die beiden entsprechenden Kapitel vorführen. Ab 1800 wird verstärkt die Situation des Einzelnen in der Gesellschaft künstlerisch und philosophisch behandelt. Auch in diesem Bereich haben sich interessante Entwicklungen ergeben, deren Analyse lohnend ist für den interessierten Leser.
Auf diese Weise soll ein Panorama der deutschsprachigen Lyrik erstellt werden, das diese auf den Grundpfeilern der europäischen Kulturgeschichte zeigt, also auf Antike, Christentum und Aufklärung. Die Gedichte werden jeweils textimmanent gedeutet, unter Verknüpfung formaler, sprachlicher und inhaltlicher Fragestellungen. Aufgrund einer genauen Lektüre der Texte sollen Fragen aufgeworfen und möglichst auch schlüssig beantwortet werden, darüber hinaus besteht ein wichtiges Ziel jedoch darin, den Leser zum Weiterdenken und vielleicht auch zum Widerspruch anzuregen. Die meisten der ausgewählten Gedichte sind mehrfach von zum Teil renommierten Literaturwissenschaft-lern interpretiert worden, doch die vorliegenden Deutungen beziehen sich bewusst nicht auf deren Ansätze, sondern basieren auf dem Textverstehen des Verfassers dieses Buchs, der seinerseits den Anspruch erhebt, eine textnahe, möglichst gut begründete und insofern auch angemessene und diskussionswürdige Deutungsmöglichkeit vorzuführen. Mögliche Ausgangspunkte können dabei Assoziationen oder Reflexionen zum jeweiligen Titel des Gedichts sein, aber auch thematische Bezugnahmen, die einen weiteren philosophischen oder literaturgeschichtlichen, im weitesten Sinne geistesgeschichtlichen Horizont in den Blick nehmen. Um es deutlich hervorzuheben: Es ist nicht beabsichtigt, möglichst viele literaturwissenschaftliche Methoden zur Anwendung zu bringen, sondern es werden beispielsweise diskursgeschichtliche Aspekte oder Fragen der Gender-Forschung immer dem hermeneutischen Interesse am konkreten Text, der jeweils werkimmanent interpretiert wird, untergeordnet. Jede Einzeldeutung ist also eine analytische Reaktion auf das zuvor abgedruckte Gedicht, die dem Leser den Zugang zu diesem Werk erleichtern soll. Dabei geht es nicht um einen positivistischen Verstehensansatz, sondern es soll von Fall zu Fall gerade das Potenzial des Unbewussten ausgelotet werden; keine der Analysen geht davon aus, dass der Autor seinem Gedicht „den Sinn“, den der Rezipient zu entschlüsseln hätte, verbindlich mit auf den Weg gegeben hat, sondern jeder Text wird verstanden im Kontext einer bestimmten gesellschafts-, philosophie-, literaturhistorischen oder literarästhetischen Gemengelage, die auf den Autor einen Einfluss ausgeübt hat, der diesem selbst nicht unbedingt bewusst gewesen sein muss.
Insofern ist das eingangs zitierte Gedicht Eichendorffs programmatisch für das vorliegende Buch, denn dessen Verfasser geht davon aus, dass die Dichter jeweils mit der „Wünschelrute“ ein „Zauberwort“ getroffen haben – sonst wären die Gedichte nicht in die Sammlung aufgenommen worden –, jedoch ohne von vorneherein oder auch erst hinterher genau zu wissen, welchen Schatz sie eigentlich beim Dichten gehoben haben. Die Freude am Lesen und Interpretieren lyrischer Texte soll kombiniert werden mit dem Versuch, den Lesern diese Freude zu übermitteln und ihnen gleichzeitig einen schmalen Ausschnitt der europäischen Kulturgeschichte vorzustellen.
I. Poesie
Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben und die Gesellschaft poetisch machen […]. Die romantische Dichtart ist noch im Werden; ja das ist ihr eigentliches Wesen, daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann. […] Sie allein ist unendlich, wie sie allein frei ist, und das als ihr erstes Gesetz anerkennt, daß die Willkür des Dichters kein Gesetz über sich leide. Die romantische Dichtkunst ist die einzige, die mehr als Art, und gleichsam die Dichtkunst selbst ist: denn in einem gewissen Sinn ist oder soll alle Poesie romantisch sein.[2]
Mit diesen Worten charakterisiert Friedrich Schlegel in seinem 116. Athenäumsfragment das Wesen romantischer Dichtkunst. Diese kunsttheoretischen Äußerungen eines der wichtigsten Vertreter der Frühromantik verdeutlichen vor allem zwei zentrale Wesensmerk-male moderner Dichtkunst: erstens ihre Selbstreflexivität. Die romantische Poesie ist sich ihrer Modernität bewusst – in Abgrenzung von der Kunst der klassischen Antike, die nicht mehr als gesetzgebendes Vorbild angesehen wird. Diese Feststellung ist für die moderne europäische Dichtkunst unhintergehbar. Hinzu kommt – zweitens – die Autonomie der Kunst, die sich aus der proklamierten Freiheit des Dichters ergibt, der sich keinerlei außerliterarischen Gesetzen mehr unterwirft. Daraus leitet Schlegel die Forderung ab, dass alle Poesie romantisch sein solle, da wahre Poesie auf dieser Autonomie basiere.
Aus ästhetischer Sicht ist sicherlich festzuhalten, dass der Beginn der Romantik gleichzeitig den Beginn der Moderne bedeutet. Wenn der vorliegende Band dazu einladen will, deutschsprachige Gedichte der letzten 350 Jahre zu lesen, sie in ihrer sprachlichen Schönheit zu erfassen und über sie nachzudenken, so ist es durchaus naheliegend, mit einem Gedicht zu beginnen, das die Bedeutung der Poesie selbst behandelt. Dazu bietet sich die Epoche der Romantik aus den bereits genannten Gründen an.
Doch der Auszug aus dem berühmt gewordenen Fragment Friedrich Schlegels macht auch deutlich, wie die Romantiker das Wesen der romantischen Poesie im Speziellen sahen: Zunächst einmal ist wichtig festzuhalten, dass es um Progressivität geht, dass also die romantische Kunst ihrem Wesen nach nie vollendet sein kann. Dies ist schon deshalb einleuchtend, weil sie den universalen Anspruch verfolgt, die schärfsten Gegensätze miteinander zu verbinden. Beispielsweise sollen Kunst und Leben eins werden, sollen Wunderbares und Alltagswelt miteinander verschmelzen. Universalität – das bedeutet aber auch, dass es die uns heute geläufige Aufteilung der Literatur in diverse Gattungen dem Wesen der Poesie nach eigentlich gar nicht gibt, bzw. dass diese Trennung aufgehoben werden soll. So ist es kein Zufall, dass das ausgewählte Gedicht einem Romanfragment entstammt, nämlich dem zweiten Teil des „Heinrich von Ofterdingen“ von Novalis.
Novalis (1772-1801)
Wenn nicht[3] mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen
Wenn die so singen, oder küssen,
Mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freye Leben
Und in die < freye > Welt wird zurück begeben,
Wenn dann sich wieder Licht und Schatten
Zu ächter Klarheit wieder gatten,
Und man in Mährchen und Gedichten
Erkennt die < alten > wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor Einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.
Die heilende Kraft des geheimen Wortes
Novalis hat seinen Roman „Heinrich von Ofterdingen“ als eine „Apotheose der Poësie“ in zwei Teilen angelegt. Der Titelheld, ein junger Mann, soll zunächst zum Dichter reifen und dann als Dichter verklärt werden. Somit handelt es sich auf den ersten Blick durchaus um einen Entwicklungsroman Goethescher Prägung, allerdings hat Novalis ihn bewusst gegen Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ verfasst, da es ihm eben nicht darum geht, einen abgeschlossenen Entwicklungsprozess literarisch darzustellen, sondern eine unendliche Annäherung an das angestrebte Ideal. Dabei spielt die Poesie die zentrale Rolle; sie soll eins werden mit „dem Leben“ und gleichzeitig diesen Prozess in Gang setzen und halten. Dies ist auch der philosophische Grund dafür, dass die Titelfigur ein (werdender) Künstler ist. An vielen Stellen des Romans werden das Wesen und die Rolle der Kunst reflektiert.
Im zweiten Teil, der Fragment geblieben und 1802, also nach Novalis’ Tod, von Ludwig veröffentlicht und kommentiert worden ist, findet sich das vorliegende Gedicht „Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren“, das viele Bezüge zur Romanhandlung des ersten Teils ausweist, durchaus aber auch für sich genommen gelesen werden kann.
Das Gedicht besteht aus zwölf Versen, die paarweise gereimt sind. Das Metrum ist nicht einheitlich; Novalis hat sich des Knittelverses bedient. Die gedankliche Struktur ist ebenso klar wie die syntaktische: Das gesamte Gedicht bildet eine Hypotaxe, die aus fünf aneinander gereihten, jeweils zwei Verse umfassenden Nebensätzen besteht und dem abschließenden Hauptsatz, der ebenfalls ein Distichon bildet. Es werden Bedingungen aufgezählt, die erfüllt sein müssen, damit die Welt von ihrem „verkehrte[n] Wesen“ (Vers 12) befreit wird. Akzentuiert man stärker die Tatsache, dass der erhoffte Zustand noch nicht eingetreten ist, so wird man die Nebensätze eher konditional auffassen, ist man sich sicher, dass das Ersehnte einst eintreten wird, ist ein temporales Verständnis näher liegend. Beides ist auf Basis des Textes sicherlich zu rechtfertigen.
Welche Voraussetzungen müssen nun aber erfüllt sein, damit die Utopie Wirklichkeit wird, und wie ist dieser anzustrebende Zustand zu charakterisieren?
Zunächst einmal dürfen „Zahlen und Figuren“ (Vers 1) nicht mehr die „Schlüssel aller Kreaturen“ (Vers 2) sein. Dies bedeutet, dass eine einseitig rational argumentierende Vernunft abzulehnen ist; der Schlüssel zum Verständnis der Welt liegt nicht in formalisierendem Denken. Zahlen und Figuren haben miteinander gemeinsam, dass sie etwas klar zu definieren versuchen – sei es mathematisch oder dadurch, dass beispielsweise einer abstrakten Idee feste Umrisse verliehen werden sollen. Die Negation „nicht mehr“ (Vers 1) sagt aus, dass für die Allgemeinheit genau diese Denkweise jedoch zutrifft. Erst wenn sich dies geändert haben wird, wird sich die Situation zum Besseren hin verändern. Geistesgeschichtlich wendet sich Novalis also gegen die Aufklärung, zumindest jedenfalls gegen die vorkritische, auf die Macht der Ratio vertrauende Aufklärung.
In die gleiche Richtung weist auch das nächste Distichon. Der Teilsatz beginnt anaphorisch zum ersten, nämlich ebenfalls mit der Konjunktion „Wenn“. Hier wird die Bedeutung der Kunst – speziell des Gesangs – thematisiert sowie die Erfahrung körperlicher Liebe. Singende und küssende Menschen sollen einst mehr als wissenschaftlich arbeitende Menschen wissen; Kunst und Liebe sind also Wege, sich die Welt anzueignen, sie in ihrem Wesen zu erkennen. Das Nomen „Tiefgelehrten“ (Vers 4) ist ein Neologismus und ironisiert sicherlich das gängige Adjektiv „hochgelehrt“, das die Überlegenheit der „Gelehrten“ vor den „Unwissenden“ suggeriert. Hier wird also zum einen problematisiert, dass unser wissenschaftliches Erkenntnisvermögen begrenzt und fragwürdig ist, und zum anderen wird dem gegenüber gestellt, dass es sehr wohl möglich sein kann, die Welt singend und liebend zu „verstehen“. Die Kritik an der Wissenschaftsgläubigkeit, wie sie in der Aufklärung verbreitet war, wird also fortgesetzt und dahingehend zugespitzt, dass eine Alternative aufgezeigt wird. Kunst und Liebe sollen an die Stelle der Wissenschaft treten bzw. diese ergänzen. Vor allem werden jene Wissenschaftler der Lächerlichkeit preisgegeben, die sich der körperlichen Liebeserfahrung entziehen und sich die Welt rein kognitiv anzueignen versuchen. Offenbar ist Novalis der Auffassung, dass dieser Zustand gegenwärtig besteht, jedoch in einem zukünftigen, positiveren Zeitalter beendet sein wird.
Daran anknüpfend, wird in den nächsten beiden Versen die Offenheit des Individuums, also dessen Fähigkeit, Grenzen zu überwinden und sich selbst zu überschreiten, als nächste Voraussetzung angeführt. „Die Welt“ (Vers 5) solle sich „ins freye Leben / […] begeben“ (Vers 5f.), was bedeutet, dass dadurch, dass jeder Einzelne neue Wege beschreitet und den Weg in die Freiheit sucht, die Welt als solche geprägt und verändert wird. Diese Veränderung wird in Vers 6 deutlich, wenn die Welt nunmehr ihrerseits als „<freye> Welt“ bezeichnet wird. Novalis hat das Adjektiv in diesem Vers zwar eigenhändig gestrichen – möglicherweise aufgrund der rhythmischen Einheitlichkeit, denn somit lägen in jedem Vers vier Hebungen vor –, doch es verdeutlicht die wechselseitige Beeinflussung von Welt und Leben, von Gesellschaft und Individuum. Derzeit, so Novalis, ist die Welt noch nicht befreit von Grenzen, die jedem einzelnen gegeben sind. Dazu jedoch bedarf es der Kunst und der Liebe, des Singens und Küssens.
Die nächste Stufe der in steigernder Form dargestellten Voraussetzungen für eine bessere Zukunft ist erreicht, wenn „Licht und Schatten“ (Vers 7) miteinander vereinigt werden, wenn also Gegensätze in Einklang gebracht werden können. Dabei stehen auch diese beiden Nomen metaphorisch für die Polarität von Vernunft und Gefühl. Erst wenn beide Seiten „sich […] gatten“ (Vers 7f.), wird wahrhaftige „Klarheit“ (Vers 8) geschaffen; erst auf diese Weise kämen wir zu wirklicher Erkenntnis. Damit wird zugleich die häufig in der Aufklärung, aber auch zu anderen Zeiten immer wieder vorgenommene Bewertung des Lichts und der Dunkelheit konterkariert. Die Gegenüberstellung „Licht = hell = positiv“ versus „Schatten = dunkel = negativ“ wird aufgehoben. Novalis hat dieses Motiv auch in seinen berühmten „Hymnen an die Nacht“ aufgegriffen. Interessant ist, dass Friedrich Hölderlin in seiner Elegie „Brod und Wein“ fast zeitgleich eine ähnliche Metaphorik verwendet, um geschichtsphilosophisch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Welt zu deuten, doch während bei ihm letztlich die „Utopie“ im ewigen Wechsel von Tag und Nacht besteht, da der Mensch beides brauche und weder ohne den Tag noch ohne die Nacht leben könne, so scheint Novalis’ Utopie auf eine Vermählung der Tageszeiten hinauszulaufen, um den Titel eines weiteren Gedichts aus dem zweiten Teil des „Heinrich von Ofterdingen“, nämlich „Die Vermählung der Jahreszeiten“, abzuwandeln. Jedenfalls wird auch im vierten Distichon das gegenwärtige Wissen, das rational argumentierender Wissenschaft entstammt, als falsch, unecht jener „ächte[n] Klarheit“ gegenübergestellt, die für die Menschen noch eine Aufgabe ist.
Die fünfte und letzte Voraussetzung wird nun nicht mit der unterordnenden Konjunktion „wenn“ eingeleitet, sondern mit der nebenordnenden Konjunktion „und“. Damit wird schon sprachlich klar, dass die Aufzählung sich dem Ende zuneigt. Der Endpunkt des Steigerungsprozesses ist erreicht, wenn „in Mährchen und Gedichten“ (Vers 9) „die <alten> wahren Weltgeschichten“ (Vers 10) erkannt werden, wenn also die Menschen der Phantasie und der Poesie Glauben schenken. Dies würde nämlich bedeuten, dass sie ihre Rationalität durch die Einbildungskraft ergänzten und somit in die Lage gerieten, die Wahrheit über die Welt zu erkennen. Novalis wendet sich hier auch insofern gegen den Geist der Aufklärung, als er deren Fortschrittsgläubigkeit unterläuft: Offensichtlich liegt für ihn die Wahrheit in der Vergangenheit, bzw. waren die Menschen früher näher an der Wahrheit als sie es in der Gegenwart sind. Die „<alten> […] Weltgeschichten“ muss man kennen, um die Wahrheit zu er kennen. Dies bedeutet zugleich, dass man zur Erkenntnis also nicht gelangt, wenn man sie mit Hilfe des Verstandes sucht, sondern die Wahrheit liegt verborgen in den poetischen Texten, die ja selbst von Menschen verfasst sind: Die Wahrheit befindet sich im Inneren der Menschen, und es sind die Künstler, die sie mit ihren Texten zu Tage befördern. Tieck hat das Adjektiv „alt“ durch „ewig“ ersetzt, was einerseits ebenso die Zeitstufe der Gegenwart überschreitet, andererseits den anti-aufklärerischen Impuls wohl etwas abschwächt hin zu einer eher theologischen Betrachtungsweise.
Wenn also der Rationalismus abgelöst worden ist durch die Macht der Liebe, der Phantasie und der Kunst, dann tritt – dies ist die letzte Stufe der dargestellten Progression – der angestrebte utopische Endzustand ein, „fliegt […] das ganze verkehrte Wesen fort“ (Vers 11f.). Offensichtlich ist die Gegenwart also wesenhaft in einem schlechten, buchstäblich falschen Zustand. Verkehrt nämlich insofern, als der Mensch sich durch seine Rationalität von sich selbst entfremdet und somit von der Erkenntnis der Wahrheit entfernt hat. Dieser Zustand ist jedoch änderbar, und er wird dann verändert werden, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Erneut wird der Kunst, bzw. zunächst einmal der Sprache, die entscheidende Rolle zugewiesen, denn wenn Liebe, Kunst und Phantasie die Macht übernommen haben, dann genügt ein einziges Wort, um die verkehrte Welt schlagartig von ihrem Leid zu erlösen. Dabei handelt es sich um ein einziges, geheimes Wort (vgl. Vers 11). Dies bedeutet zum einen, dass von einem ganz bestimmten Wort die Rede ist; die Sprache wird hier geradezu mythisiert und in den Stand einer Gottheit versetzt. Zum anderen verweist das geheimnisvolle Wesen dieses Wortes darauf, dass es nur jemandem zukommt, dieses Wort zu sprechen, der dazu berufen ist, jemandem, der in das Rätsel der Welt eingeweiht ist und der des Rätsels Lösung zu erkennen vermag. Dies kann in der Logik des Gedichts und der frühromantischen Philosophie einzig und allein der Künstler sein, der buchstäblich als singender Prophet die Wahrheit kennt und verkündet. Durch ihn kann das Unendliche mit dem Endlichen, das Transzendente mit dem Immanenten vermittelt werden.
Man könnte vielleicht sagen: Wenn die Menschen bereit sind, die Worte des Dichters zu vernehmen, ihnen Glauben zu schenken und die richtige Bedeutung beizumessen, wenn nämlich Liebe und Kunst den Vorrang vor der einseitigen Rationalität haben, jeder einzelne ein freies Leben führt und die Gegensätze von Licht und Schatten vereint sind, dann ist die Welt von ihrem verkehrten Wesen befreit.
Dieser Zustand jedoch ist in diesem Gedicht – und in der außerliterarischen Wirklichkeit ohnehin – eine Utopie, die angestrebt werden muss in einem unendlichen Prozess der Annäherung. Dazu soll die Poesie den entscheidenden Beitrag liefern, und es ist der Künstler, der als einziger diesen Zustand herbeiführen kann. Auch so ist es zu verstehen, dass Novalis in einem seiner Fragmente formuliert hat: „Der Poët ist also der transscendentale Arzt.“[4] Denn die „Poësie heilt die Wunden, die der Verstand schlägt.“[5]
II. Mensch und Gott
Die europäische Kultur der Moderne basiert auf drei Säulen (der griechisch-römischen Antike, dem Christentum und der Aufklärung), die allesamt die Frage nach Gott bzw. nach dem Verhältnis zwischen Mensch und Gott gestellt und jeweils sehr unterschiedlich beantwortet haben. In der Antike wurden den Göttern gleichsam menschliche Eigenschaften zugewiesen; sie unterschieden sich von den Menschen nur durch ihre Unsterblichkeit. Wollte jedoch ein Mensch sich dazu aufschwingen, sich wie ein Gott zu gebärden, so galt dies als Hybris und wurde von den Göttern bestraft. Im Christentum wurde aus dem Polytheismus ein Monotheismus – es gibt nur noch einen Gott, der durch seinen Sohn selbst auf die Erde gekommen und Fleisch geworden ist. Der christliche Glaube folgt dem Theismus, also der Vorstellung, Gott habe die Welt erschaffen und greife selbst aktiv in den Verlauf der irdischen Entwicklungen ein. Im 18. Jahrhundert begann die Säkularisierung. Die Menschen nahmen für sich mehr und mehr in Anspruch, eigenständig denken und handeln zu können – ja zu müssen. Der rückhaltlose Glaube an Gott wurde nicht zuletzt durch schwere Naturkatastrophen (beispielsweise das Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755) nachhaltig erschüttert; die Theodizee-Frage („Wie kann man angesichts des irdischen Leids nur glauben, es gebe einen Gott?“) wurde aufgeworfen und bis heute nicht mit universaler Gültigkeit beantwortet.
Diese Entwicklung spiegelt sich in der deutschsprachigen Literaturgeschichte seit dem Barock wider. Unzählige lyrische Texte sind entstanden, die das Verhältnis zwischen Mensch und Gott auf je unterschiedliche Weise thematisieren. Die barocken Gedichte sind geprägt von einer strikten Grenzziehung zwischen Diesseits und Jenseits, Mensch und Gott, irdischem Leid und himmlischer Erlösung. Dabei spielen Katastrophen wie der Dreißigjährige Krieg oder die Pest eine zentrale Rolle. Doch noch im 17. Jahrhundert gewann – unter starkem Einfluss aus England und Frankreich – auch in Deutschland der Rationalismus an Bedeutung. Er differenzierte sich europaweit immer weiter aus, bis er mit dem Ausbruch der Französischen Revolution seine politisch-gesellschaftliche Umsetzung erfuhr. In der Literatur ab etwa 1770 spiegelt sich dies wider; das Verhältnis zwischen Mensch und Gott wurde nun viel stärker vom mündigen Individuum aus gedacht und reicht von der Rebellion gegen die Obrigkeit bis zur demütigen, frommen Unterwerfung. Charakteristisch ist hier die Reflexion des christlichen Glaubens unter Rückgriff auf die Religiosität der Antike. Einen weiteren innovativen Impuls verlieh dieser Thematik die fortschreitende Technisierung um 1900. In literarischen Werken dieser Zeit wurde, nicht zuletzt unter dem Einfluss Friedrich Nietzsches, Gottes Existenz heftig in Frage gestellt, ja Gott wird in einigen avantgardistischen Gedichten quasi zur Leerstelle degradiert.
Andreas Gryphius (1616-1664)
Tränen des Vaterlandes, anno 1636[6]
Wir sind doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret!
Der frechen Völker Schar, die rasende Posaun,
Das vom Blut fette Schwert, die donnernde Kartaun
Hat aller Schweiß und Fleiß und Vorrat aufgezehret.
Die Türme stehn in Glut, die Kirch ist umgekehret,
Das Rathaus liegt im Graus, die Starken sind zerhaun,
Die Jungfraun sind geschänd’t, und wo wir hin nur schaun,
Ist Feuer, Pest und Tod, der Herz und Geist durchfähret.
Hier durch die Schanz und Stadt rinnt allzeit frisches Blut.
Dreimal sind schon sechs Jahr, als unser Ströme Flut,
Von Leichen fast verstopft, sich langsam fort gedrungen.
Doch schweig ich noch von dem, was ärger als der Tod,
Was grimmer denn die Pest und Glut und Hungersnot,
Daß auch der Seelenschatz so vielen abgezwungen.
Entindividualisierte Hoffnungslosigkeit
Die literarische Gattung der „Kriegslyrik“ ist geprägt von der Darstellung des Grauens schlechthin: Ein lyrisches Ich beklagt Tod und Zerstörung der Umwelt und seiner Liebsten. Dabei schwingt – mal explizit, mal eher auf subtile Weise – die Frage mit, wie Gott dies alles zulassen kann bzw. wo Gott eigentlich ist. Gerade in der Epoche des Barock, die ein Zeitalter der strikten Grenzziehungen und Polaritäten ist, wird dabei eine klare Gegenüberstellung von irdischem Leben, also der Vergänglichkeit, und ewigem Leben im Jenseits vorgenommen. Auf den Schultern des Renaissance-Humanismus stehend, wird im 17. Jahrhundert der Mensch in den Blick genommen, und zwar sowohl in seiner Sonderstellung unter den irdischen Geschöpfen als auch in seiner Fragilität als Teil der Natur. Die Bezeichnung des Menschen als „denkendes Schilfrohr“ (Blaise Pascal) mag Zeugnis ablegen von dieser Sichtweise: Der Mensch denkt, setzt also seinen Verstand ein, doch er ist vergänglich und den Stürmen der Natur hilflos ausgeliefert. Die Einsicht in die Vergänglichkeit des Menschen wird also verbunden mit dessen Fähigkeit zur Selbstreflexion: Er ist in der Lage, seine eigene Situation sprachlich zu schildern und gleichzeitig über diese Situation nachzudenken.
Ein Beispiel dafür bildet das Gedicht „Tränen des Vaterslandes anno 1636“ von Andreas Gryphius. Schon der Titel zeigt, dass dieses Werk im historischen Kontext betrachtet werden muss, weil es in eben diesem ganz bewusst verortet wird. Das lyrische Ich sieht sich als Teil eines Kollektivs an, das leidet, und zwar am Elend des Dreißigjährigen Krieges. Es ist bezeichnend – und passt zu den Eingangsbemerkungen –, dass schon im Titel der einzelne Mensch keine Rolle spielt. Gleichwohl geht es um die Darstellung des Gefühls der Trauer. Das „Vaterland“ wird personifiziert, und man kann dieses Gedicht vielleicht als eines der ersten auffassen, in denen so etwas wie ein deutsches Nationalitätsbewusstsein mitschwingt. Immerhin hat sich der Dreißigjährige Krieg ja in erster Linie auf jenem Gebiet zugetragen, das wir heute als „Deutschland“ bezeichnen. In jedem Fall ist offensichtlich, dass die Heimat und deren Zerstörung in diesem Klagelied besungen werden.
Es handelt sich bei diesem Gedicht um ein Sonett. In der ersten Strophe wird deutlich zum Ausdruck gebracht, dass brutale Gewalt für umfassende Zerstörung gesorgt hat. Dies wird in der zweiten Strophe etwas konkretisiert. Gebäude liegen in Schutt und Asche, den Menschen wurde Leid angetan, die Kirche bietet keinen Schutz mehr, die Pest kommt hinzu – kurz: Die Vernichtung betrifft alle Lebensbereiche; es herrscht allein der Tod.
In der dritten Strophe wird die Katastrophe endgültig im Hier und Jetzt des lyrischen Ichs verortet, denn es spricht von der eigenen Stadt, die von Blut getränkt ist, und von der Gegenwart: Seit mittlerweile 18 Jahren wütet der Krieg, ein Ende ist nicht in Sicht. Die vierte Strophe transzendiert quasi das Grauen, denn offensichtlich gibt es etwas noch Schlimmeres als den auf Erden sichtbaren Tod, allgemeiner gefasst die Qualen, die sich auf die Sphäre der Immanenz beziehen, und das ist der Verlust der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und der Erinnerung an die Verstorbenen. Die Gegenwart ist furchtbar, und es gibt keinen Trost, da Vergangenheit und Zukunft auch gedanklich nicht zu fassen sind.
Schon der erste Vers des Gedichts bringt die Gesamtaussage auf den Punkt: Jene Gruppe, der sich das lyrische Ich zugehörig fühlt („Wir“), ist „ganz, ja mehr denn ganz verheeret“. Die hier verwendete correctio, die gleichzeitig als Hyperbel zu bezeichnen ist, macht deutlich, dass es sich um eine alles umfassende Zerstörung handelt, ausgedrückt in einem einfachen Hauptsatz. Das Füllwort „doch“ hebt den klagenden Charakter des Verses zusätzlich hervor; das Adverb „nunmehr“ rückt das Geschehen in die absolute Gegenwart des sprechenden Ichs. Nur die Tatsache, dass ein Mitglied dieser „Wir“-Gruppe noch in der Lage ist, das Elend zu artikulieren, lässt es als verfehlt erscheinen, von einer radikalen Auslöschung zu sprechen.
Es bleibt nicht lange offen, wer für die Zerstörung gesorgt hat: Verantwortlich sind die gegnerischen Kriegsmächte, die als Kollektiv behandelt werden („Der frechen Völker Schar“, Vers 2) und mit „Posaun“ (Vers 2), „Schwert“ (Vers 3) und „Kartaun“ (Vers 3) den Tod bringen. Die Attribute „rasende“ (Vers 2), „vom Blut fette“ (Vers 3) und „donnernde“ (Vers 3), die jeweils den genannten Nomen zugewiesen werden, verstärken den Eindruck der zerstörerischen Dynamik (oder dynamischen Zerstörung) des Krieges. Wie umfassend die Wirkung ist, zeigt Vers 4. Die Bewohner des Vaterlandes haben sich vergeblich ihrem Schicksal widersetzt; „Schweiß und Fleiß“ waren umsonst, ja mehr noch – sie sind „aufgezehret“: Erschöpfung und Resignation machen sich breit, zumal auch die Vorräte aufgebraucht sind. Das Vaterland ist sowohl geistig als auch materiell am Ende.
Nicht genug mit dieser globalen Darstellung – es folgt die Konkretisierung des Elends. Die „Türme“ (Vers 5), möglicherweise die repräsentativen Wahrzeichen der Heimat, sind zerstört, dasselbe gilt für das Rathaus, das gleichzeitig die politische Führung beherbergen müsste. Die Bevölkerung ist führungslos als soziale Gemeinschaft. Die starken, widerstandsfähigen Menschen (gemeint sind wohl vor allem Männer) sind „zerhaun“ (Vers 6); das Verb kann hier als verdinglichend bezeichnet werden, was unterstreicht, dass das Vaterland ohne willensstarke Individuen fortbestehen muss. Nicht genug damit, dass diese erschlagen (also durch körperliche Gewalt getötet) worden sind, sondern sie sind zerschlagen worden, was wohl auch eine Wiederauferstehung des Volkswillens ausschließen oder zumindest erschweren wird. Es geht also um mehr als um physische Zerstörung. Dies wird im folgenden Vers bestätigt, denn die „Jungfraun“ (Vers 7) sind „geschänd’t“ (Vers 7), also ihrer Ehre beraubt worden, was auch aus christlicher Sicht ein weiteres Element der Demütigung darstellt. Zudem wird die Totalität der Zerstörung stärker betont: Diese umfasst Männer und Frauen sowie Körper und Geist – kurz: alles und jeden. Es bedürfte der die Strophe abschließenden Hypotaxe nicht zwingend, um es explizit zu sagen: Ringsherum („wo wir hin nur schaun“, Vers 7) herrschen „Feuer, Pest und Tod“ (Vers 8), wobei letzterer „Herz und Geist durchfähret“ (Vers 8). Die drei zerstörerischen Elemente werden in Form einer Klimax angeordnet, wobei sie sich genau genommen nicht auf einer Ebene befinden, denn das Feuer (hier als Symbol der Zerstörung) und die Pest (als pars pro toto für sich ausbreitende Krankheiten) bewirken den Tod.
Der sprachliche Aufbau der Strophe – diese besteht aus fünf aneinander gereihten, parallel zueinander konstruierten Hauptsätzen sowie einem Satzgefüge aus Lokalsatz und Hauptsatz – bringt die Monotonie des Grauens und die Ausweglosigkeit der Lage besonders pointiert zum Ausdruck. Dabei geht fast unter, worum es in der kriegerischen Auseinandersetzung eigentlich geht, nämlich um einen Glaubenskrieg. Die Formulierung „die Kirch ist umgekehret“ (Vers 5) kann bei oberflächlicher Betrachtung als weiteres Beispiel für die äußere Zerstörung, die der Krieg mit sich bringt, angesehen werden, jedoch auch als metaphorisch dargestelltes beklagenswertes Ergebnis der Reformation und insofern möglicherweise sogar als Identitätsverlust der im Mittelalter noch einheitlichen europäischen Christenheit. Allerdings ist zu konstatieren, dass dieser Aspekt hier eher am Rande behandelt wird; im Vordergrund steht der Jammer über Tod und Zerstörung. Insofern bildet dieses Gedicht ein Beispiel für die Bedeutungslosigkeit der Ursachen der Trümmer angesichts deren Anblicks.
Der Eindruck, dass die Glaubensfragen, also letztlich die Transzendenz, eine eher untergeordnete Rolle spielen, wird in der dritten Strophe bestätigt. Wie bereits gesagt, findet hier eine Betrachtung des Hier und Jetzt statt. Die Monotonie des Grauens wird dabei unterstrichen, indem das Morden als langjähriger Prozess dargestellt wird, der sich in Form eines Stromes aus Blut äußert. Die Formulierung „allzeit frisches Blut“ (Vers 9) drückt es besonders drastisch aus: Die Opfer sind unzählbar und ihrer Individualität beraubt. Die Flussmetaphorik wird auch in etwas konkreterer Form verwendet, wenn beschrieben wird, dass die Flüsse beim Ausbruch des Krieges vor dreimal sechs Jahren (vgl. Vers 10) „Von Leichen fast verstopft“ (Vers 11) waren. Der Krieg hat somit direkte Auswirkungen auf die Natur des Vaterlandes. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Krieg den Fortgang des Lebens stark beeinträchtigt hat, denn die Ströme haben sich seitdem nur noch „langsam fort gedrungen“ (Vers 11).
Nach dieser im Hinblick auf die Konkretheit des Grauens sich steigernden Darstellung folgt der Höhepunkt des Gedichts, der allerdings darin besteht, dass konzediert wird, dass das Schlimmste sprachlich nicht darstellbar ist und sich der irdischen Immanenz entzieht. Schwerer nämlich als Tod, Krankheit und Hungersnot, also die äußerlich sichtbare Zerstörung, ist das Unsagbare, die Trauer über den vielen unwiederbringlich abgezwungenen „Seelenschatz“ (Vers 14). Dieser ist in seiner metaphorischen Beschreibung nicht genau zu identifizieren, doch es ist absehbar, was gemeint sein könnte. Es ist der Verlust der Erinnerung an die glücklichere Vergangenheit und das Fehlen einer Hoffnung, die sich auf die Zukunft, auf eine Erlösung durch den Tod vom irdischen Elend richten könnte. Ob beide Elemente gemeint sind oder nur eines von beiden, muss offen bleiben. Entscheidend ist jedoch, dass nicht nur die Körper, sondern auch die Seelen der Betroffenen Schaden genommen haben, was das Elend nur noch weiter vergrößert und verschlimmert. Wo keine Hoffnung auf ein Jenseits mehr ist, ist auch Gott in weite Ferne gerückt. Bezogen auf das vorliegende Gedicht, müsste man wohl sagen: Er ist so weit entfernt, dass er für die Menschen nicht mehr erfahrbar ist. Oder – noch radikaler formuliert: Es gibt keinen Gott, der den Menschen Hoffnung oder Trost spenden könnte. Gerade in seinem Namen sind Tod und Zerstörung ja über die Menschen gekommen. Der historische Kontext des Gedichts, also der Dreißigjährige Krieg, scheint hier zu bewirken, dass zwischen den Menschen und Gott eine so tief gehende Kluft besteht, dass letzterer, wenn er überhaupt existiert, keine Hilfe mehr ist. Wie die Grausamkeit des seelischen Schadens entzieht sich auch Gott selbst der verbalen Darstellbarkeit – nicht einmal durch ein Gebet scheint er noch erreichbar zu sein. Dieses Sonett klagt ohne Hoffnung auf Besserung und ohne Rückbezug auf eine schönere Vergangenheit; die Menschen des Vaterlandes sind ins Hier und Jetzt geworfen und der Gegenwart hilflos ausgeliefert.
Diese inhaltliche Klarheit und Absolutheit findet in der sehr strengen Form des Sonetts ihre Entsprechung. Der Alexandriner liegt in Reinform vor, jeder einzelne Vers enthält eine Zäsur nach dem dritten Versfuß, also jeweils exakt in der Mitte. Auch das Reimschema (zweimal umarmender Reim, dann strophenübergreifende Kombination aus Paarreim und umarmendem Reim) zeigt keine Abweichung von Opitzens Regelpoetik. Damit trägt auch aus formaler Sicht dieses Sonett das Gepräge einer bestimmten Epoche und lässt jegliche Individualität dahinter zurücktreten. Dies mag – jedenfalls aus heutiger Sicht – die Trostlosigkeit des Dargestellten noch weiter hervorheben; das kaum zu erkennende, sich einer „Wir“-Gruppe unterwerfende lyrische Ich tritt in seiner Individualität zurück hinter das Elend jener Zeit.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Prometheus[7]
Bedecke deinen Himmel, Zeus, Wer half mir wider
Mit Wolkendunst! Der Titanen Übermut?
Und übe, Knaben gleich, Wer rettete vom Tode mich,
Der Diesteln köpft, Von Sklaverei?
An Eichen dich und Bergeshöhn! Hast du’s nicht alles selbst vollendet,
Mußt mir meine Erde Heilig glühend Herz?
Doch lassen stehn, Und glühtest, jung und gut,
Und meine Hütte, Betrogen, Rettungsdank
Die du nicht gebaut, Dem Schlafenden dadroben?
Und meinen Herd,
Um dessen Glut Ich dich ehren? Wofür?
Du mich beneidest. Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Ich kenne nichts Ärmer’s Hast du die Tränen gestillet
Unter der Sonn’ als euch Götter. Je des Geängsteten?
Ihr nähret kümmerlich Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Von Opfersteuern Die allmächtige Zeit
Und Gebetshauch Und das ewige Schicksal,
Eure Majestät Meine Herrn und deine?
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler Wähntest du etwa,
Hoffnungsvolle Toren. Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehn,
Da ich ein Kind war, Weil nicht alle Knabenmorgen-
Nicht wußt’, wo aus, wo ein, Blütenträume reiften?
Kehrte mein verirrtes Aug’
Zur Sonne, als wenn drüber wär’ Hier sitz’ ich, forme Menschen
Ein Ohr, zu hören meine Klage, Nach meinem Bilde,
Ein Herz wie meins, Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Sich des Bedrängten zu erbarmen. Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.
Glühende Rebellion des schöpferischen Ichs
Prometheus („der Vorausdenkende“) ist jener Gott der Antike, der es wagte, gegen den Göttervater Zeus zu rebellieren und sich für die Menschen einzusetzen. Er schuf sie nach seinem Bilde, was zu einem Streit mit Zeus führte. Zur Strafe wurde er – so beispielsweise dargestellt in Aischylos’ Tragödie „Der gefesselte Prometheus“ – an den Kaukasus geschmiedet, wo ihm ein Adler die immer wieder nachwachsende Leber abfraß. Herakles befreite ihn schließlich, indem er den Adler tötete. In Attika wurde Prometheus als Gott des Handwerks und Erfinder aller Künste verehrt, die den Menschen das Leben erleichtern und angenehmer machen. Prometheus – ein kreativer Gott also, der zugleich gegen die bestehende göttliche Seinsordnung protestiert.
Wenn nun Goethe seine Hymne mit dem Namen „Prometheus“ betitelt, bezieht er sich auf diesen antiken Stoff. Zugleich spitzt er ihn zu und fügt ihn somit in die Reihe jener dichterischen Kunstwerke ein, die den Sturm und Drang bis heute aktuell gehalten haben.
Das Gedicht ist in einem stark anklagenden Ton in Ich-Form verfasst. Das lyrische Ich ist Prometheus, der sich direkt an Zeus wendet. Die sieben Strophen sind von unterschiedlicher Länge, die Anzahl der Verse schwankt zwischen zwölf und fünf. Es gibt kein einheitliches Metrum, vielmehr bestimmen freie Rhythmen den Ton dieser Hymne. Schon durch diese äußere Form ist der Unterschied zu Gedichten des Barock nicht zu übersehen. Der Dichter macht Gebrauch von seiner gestalterischen Freiheit und lässt sich nicht durch eine Regelpoetik wie die von Opitz in seinem kreativen Schaffen beeinflussen. Dies deutet bereits auf einen zentralen Aspekt des Gedichts hin: Der Dichter als schöpferisches Genie steht in enger Beziehung zu Prometheus, dem schöpferischen, rebellischen Gott.
Schon die erste Strophe beginnt mit einer direkten Anrede an Zeus. Er wird in die Defensive gedrängt, während Prometheus einen klaren Besitzanspruch auf die Erde anmeldet. In der zweiten Strophe findet eine Ausweitung statt; die Götter werden in toto als arm und kümmerlich bezeichnet sowie als abhängig von den Gebeten der Gläubigen. Die dritte und vierte Strophe stellen einen Rückblick dar auf Prometheus’ eigenes Leben. In der Kindheit habe er sich noch selbst an die Götter gewandt, wenn er in Not gewesen sei, doch er hält fest, dass nicht diese ihm geholfen haben, sondern dass vielmehr er selbst sich gerettet habe. Die fünfte Strophe greift den direkten Ton der Anklage, die sich an Zeus richtet, wieder auf. Zeit und Schicksal seien mächtigere Instanzen als der Gott des Olymp. Die in der sechsten Strophe gestellte Frage zielt darauf ab, dass Prometheus bei allem Leid, das ihm widerfahren ist, nicht resigniert und weiterhin gerne lebt. Folgerichtig beschreibt er in der siebten und letzten Strophe seine gegenwärtige Tätigkeit: Menschen nach seinem Bilde zu schaffen, die demnach ebenfalls Zeus missachten.
Ein wahrhaft rebellisches Gedicht, das, so sehr es sich gegen den Göttervater richtet, gleichwohl zutiefst religiös ist. Doch scheint die Religiosität nicht im Glauben an einen guten, gerechten Gott zu wurzeln, der die Welt erschaffen hat und nun dafür sorgt, dass sie nach Maßgabe der Gerechtigkeit in Ordnung gehalten wird, wie es nach theistischer Vorstellung der Fall ist. Sie entsteht eher geradezu aus sich selbst heraus, aus dem schöpferischen Geist des lyrischen Ichs. Dies hat sie mit dem Text selbst gemeinsam; literarische Fiktion, Kunst, und Religiosität vermischen sich also, sie werden quasi im gleichen kreativen Prozess hervorgebracht. Wie kann es sein, dass sich jemand dies anmaßen kann? Innerhalb der Logik des Gedichts lässt sich eine Antwort finden.
Schon die direkte Anrede in den beiden ersten Versen hat es in sich. Das Gedicht beginnt mit einem Imperativ („Bedecke“, Vers 1), der den angesprochenen Zeus in die Defensive zwingt. Er soll „seinen Himmel“ (vgl. Vers 1) „Mit Wolkendunst“ (Vers 2) bedecken, sich also in ihn zurückziehen und zugleich eine Grenze zum irdischen Leben ziehen, die dieses aus seinem Einflussbereich entzieht. Zeus solle sich, einem „Knaben gleich“ (Vers 3), an der Pflanzenwelt und den „Bergeshöhn“ (Vers 5) betätigen, die Menschen jedoch solle er unangetastet lassen, wie aus dem in den folgenden Versen dargestellten Besitzanspruch Prometheus’ hervorgeht: Es handle sich um seine Erde, um seine Hütte und um seinen Herd (vgl. Verse 6, 8, 10). Insbesondere am Beispiel der Hütte wird erkennbar, woher sich der Besitzanspruch des Rebellen herleitet: Nicht Zeus habe sie gebaut (vgl. Vers 9), sondern, wie man hinzufügen darf, er selbst. Ja, die Schmähung geht noch einen Schritt weiter: Zeus beneide Prometheus sogar um die Glut seines Herdes (vgl. Verse 10-12), jenes Herdes, mit dem Prometheus – den Menschen gleich – sein Leben bestreitet. Die „Glut“ steht dabei sowohl für den inneren Seelenzustand Prometheus’ als auch für die schöpferische Kraft, die das Leben spendende und das Überleben sichernde Wärme. Es ist also die Aktivität, die Fähigkeit, das Leben in die eigene Hand zu nehmen und es eigenständig zu gestalten, um die er sich beneidet fühlt.
Dieser Gedanke wird in der zweiten Strophe weitergeführt. Es geht nicht mehr nur um Zeus, sondern um alle Götter. Diese ernähren sich nämlich gerade nicht durch eigene Arbeit bzw. – um den Aspekt der Kreativität angemessen wiederzugeben – durch eigene Schaffenskraft, sondern dadurch, dass sie von der Torheit (vgl. Vers 21) der „Kinder und Bettler“(Vers 20) profitieren. Das Adjektiv „kümmerlich“ bringt die Sichtweise Prometheus’ auf den Punkt; er hat geradezu Mitleid mit der schöpferischen Armut der Götter. Gleichzeitig steckt dahinter aber auch eine deutliche Kritik am Pietismus („Opfersteuern“, Vers 16, „Gebetshauch“, Vers 17) und an der mangelnden geistigen Selbstständigkeit vieler Menschen.
Diese Kritik allerdings wird in der dritten Strophe insofern relativiert, als das lyrische Ich bekennt, dass es in der eigenen Kindheit selbst dieses Verhalten an den Tag gelegt habe. Dieser Zustand gehört jedoch – wie schon der Tempuswechsel vom Präsens ins Präteritum zeigt – der Vergangenheit an und wird als Verirrung kenntlich gemacht („mein verirrtes Aug’, Vers 24): Es gibt keine transzendente Instanz, die sich des Leides der Betenden, Hoffenden annehmen würde. Gerade durch den pars pro toto („Ein Ohr, zu hören meine Klage“, Vers 26) wird unterstrichen, was den Göttern fehlt: Empathievermögen und Barmherzigkeit (vgl. Vers 28). Davon jedoch grenzt sich Prometheus ab (vgl. Vers 27). Die Verwendung des Konjunktivs („als wenn drüber wär’“, Vers 25) bringt die ganze Bitterkeit dieser Erfahrung besonders deutlich zum Ausdruck, weil die Möglichkeit, dass es anders sein könnte, auf diese Weise sehr apodiktisch ausgeschlossen wird. Dieses lyrische Ich zweifelt die Existenz einer barmherzigen, helfenden Gottheit nicht nur an, sondern es verneint sie radikal.
Die vierte Strophe dient in erster Linie dazu, diese Einstellung am eigenen Leben zu begründen. Vier rhetorische Fragen, von denen die beiden ersten anaphorisch mit dem Fragewort „Wer“ beginnen (Verse 29 und 31) und parallel konstruiert sind, sollen deutlich machen, dass dem lyrischen Ich in Momenten der Not und Bedrängnis nicht die Götter im Allgemeinen und schon gar nicht Zeus im Speziellen beigestanden haben. An dieser Stelle fällt auf, dass das mit „Du“ angesprochene Subjekt hier unvermittelt ausgetauscht wird: An Zeus’ Stelle tritt das eigene „Heilig glühende Herz“ (Vers 34) des Prometheus. Zeus wird in seiner Rolle als Göttervater regelrecht ausgelöscht, zumindest wird ihm seine Macht abgesprochen. Gerade die damit thematisierte dritte der vier rhetorischen Fragen könnte als gedanklicher Dreh- und Angelpunkt des Gedichts verstanden werden. Es wird nämlich zum einen die Eigenständigkeit des Individuums betont („selbst“, Vers 33) und zum anderen dessen Schöpferkraft („vollendet“, ebd.). Dabei wird dem Herzen eben jener Zustand zugewiesen, der von jenem Herd ausgeht, von dem bereits in der ersten Strophe die Rede gewesen ist: Das Herz glüht, ist also voll des Lebens und des Aufbegehrens; beides kann hier wohl als dasselbe angesehen werden. Leben bedeutet rebellieren. Dieser Zustand wird mit dem als Adverb aufzufassenden „Heilig“ (Vers 34) näher charakterisiert. Der Prozess des Schaffens ist heilig, ist gleichzeitig Ursprung und Ausdruck so verstandener, wahrer Religiosität. Der Göttervater Zeus hingegen schläft „dadroben“ (Vers 37), also im Himmel, der, wie man vielleicht hinzufügen könnte, von der Erde weiter entfernt ist denn je. Der Irrtum des jungen, glühenden Subjekts wird in seiner ganzen Tragweite hervorgehoben, wenn mit der vierten der rhetorischen Fragen ausgesagt wird, dass es noch im Glühen dem Schlafenden für die Rettung gedankt habe (vgl. Vers 36). Dabei wird dieser Irrtum aber nicht selbstkritisch als Naivität bezeichnet, sondern als Ergebnis eines Betrugs (vgl. ebd.).
Das Folgende ist die Konsequenz des soeben Ausgeführten. Das lyrische Ich wendet sich nun wieder direkt an Zeus und richtet an diesen fünf weitere rhetorische Fragen, von denen die erste und die letzte besonders ins Auge fallen. Die erste („Ich dich ehren?“, Vers 38), weil sie schon in ihrer sprachlichen Form jeden Respekt vermissen lässt; der Angesprochene ist es noch nicht einmal wert, mit einem kompletten Satz bedacht zu werden. Die letzte dieser Fragen bringt indirekt zum Ausdruck, dass es für das lyrische Ich denn doch zwei Instanzen gibt, die über der eigenen Existenz stehen, nämlich „Die allmächtige Zeit / Und das ewige Schicksal“ (Vers 44f.).
Diese Einsicht ist es wohl auch, die bewirkt, dass Prometheus Rückschläge verkraftet und nicht resigniert, wenn auch „nicht alle Knabenmorgen- / Blütenträume reiften“ (Vers 51). Hier wird deutlich, dass der Rebell sich als jemanden darstellt, der über Durchhaltevermögen und Standhaftigkeit verfügt. Die erlebten Enttäuschungen haben eben nicht dazu geführt, dass er das Leben hasst oder vor ihm flieht (vgl. Vers 48f.). Es handelt sich bei diesem Rebellen also auch nicht um einen Jugendlichen, der einen momentanen Rausch verspürt, dessen Glut also schnell verraucht, sondern es handelt sich tatsächlich um einen Menschen, der „zum Manne geschmiedet“ (Vers 43) worden ist und der gelernt hat, mit Enttäuschungen umzugehen und ggf. infantile Vorstellungen aufzugeben.
Das Resultat dieser Entwicklung wird in der siebten Strophe geschildert: Das lyrische Ich setzt seine schöpferische Gestaltungskraft ein, und zwar zielgerichtet und Form gebend. Schon der einfache Hauptsatz „Hier sitz’ ich“ (Vers 52) bringt das Selbstbewusstsein zum Ausdruck. Dieses Selbstbewusstsein basiert auf eigener Lebenserfahrung, eigenständigem Denken und Handeln. Hierin liegt denn auch wohl die innere Rechtfertigung des Anspruchs, sich auf Augenhöhe mit Gott zu bewegen. Die Gestaltungskraft folgt dabei einem klaren Ziel („forme Menschen / Nach meinem Bilde“, Vers 52f.) und setzt das Bewusstsein der eigenen Vorbildhaftigkeit um („Ein Geschlecht, das mir gleich sei“, Vers 54). Dabei spielt die Emotionalität die zentrale Rolle; die geschaffenen Menschen sollen „leiden, weinen, / Genießen und [sich] freuen“ (Vers 55f.), also ein authentisches Leben führen, und dabei Zeus „nicht […] achten“ (Vers 57), ihr Leben also nicht im Hinblick auf eine höhere Instanz führen, die es nicht gibt bzw. die ohnehin nicht eingreift, sondern schläft. Der letzte Vers bringt dann das ganze Selbstbewusstsein des sprechenden, dichtenden, schaffenden Subjekts nochmals auf den Punkt; nicht zufällig endet die Hymne mit dem Personalpronomen „ich“ (Vers 58).
Der wahre Gott, so legt dieses Gedicht nahe, ist ein Künstler, dessen Religiosität der eigenen glühenden Schaffenskraft entwächst, die wiederum selbst Ausdruck eines Selbst-Bewusstseins ist, die ohne eine höhere, eingreifende göttliche Instanz auskommt und nur der Gesetzmäßigkeit von Zeit und ewigem Schicksal unterworfen ist. Man könnte ebenso gut sagen: Der wahre Künstler wirkt wie ein schöpfender Gott, weil er in der Lage ist, mittels seiner Schaffenskraft das überzeitlich Bestand Habende hervorzubringen. Kraft seines Genies steht der Künstler mit Gott auf einer Stufe.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Grenzen der Menschheit[8]
Wenn der uralte Was unterscheidet
Heilige Vater Götter von Menschen?
Mit gelassener Hand Daß viele Wellen
Aus rollenden Wolken Vor jenen wandeln,
Segnende Blitze Ein ewiger Strom:
Über die Erde sät, Uns hebt die Welle,
Küss’ ich den letzten Verschlingt die Welle,
Saum seines Kleides, Und wir versinken.
Kindliche Schauer
Treu in der Brust. Ein kleiner Ring
Begrenzt unser Leben,
Denn mit Göttern Und viele Geschlechter
Soll sich nicht messen Reihen sich dauernd
Irgend ein Mensch. An ihres Daseins
Hebt er sich aufwärts Unendliche Kette.
Und berührt
Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.
Steht er mit festen,
Markigen Knochen
Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde,
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Rebe
Sich zu vergleichen.
In Form gestaltete Demut
Der Titel der Hymne „Grenzen der Menschheit“ ist für Ohren des beginnenden 21. Jahrhunderts von geradezu beklemmender Aktualität. Aktuell deshalb, weil sich im öffentlichen Bewusstsein seit Jahrzehnten die Vorstellung verbreitet hat, dass der Mensch seiner Umwelt mit Demut begegnen sollte – bei allen Chancen, die sich ihm durch die Errungenschaften der Technik und den zivilisatorischen Fortschritt bieten. Beklemmend deshalb, weil immer wieder deutlich wird, dass es uns nicht gelingt, diese Einsicht im Leben umzusetzen – sei es im privaten oder im öffentlichen Lebensraum. Denn die Menschen machen sich die „Erde untertan“, nehmen sie hemmungslos aus und vergessen dabei, dass die Ressourcen begrenzt sind und dass sich die Natur notfalls wieder nimmt, was ihr fehlt.
Es hat durchaus etwas Tröstliches, dass bereits Goethe vor über 230 Jahren die „Grenzen der Menschheit“, also auch die Grenzen des Menschseins, thematisiert hat, mitunter vielleicht sogar gegen eigene Ansichten, die er als Jugendlicher und sehr junger Mann vertreten haben mag. Eine Frage, die man an die vorliegende Hymne stellen könnte, lautet: Wo verlaufen die „Grenzen der Menschheit“? Es schließt sich daran an die Frage: Wogegen muss die Menschheit abgegrenzt werden bzw. wogegen ist sie abgegrenzt? Und letztlich lohnt es sich weiter zu forschen: Wie geht Goethe mit der Erkenntnis der eigenen Begrenztheit in diesem Gedicht um?
Die Hymne besteht aus fünf Strophen unterschiedlicher Länge. Es fällt auf, dass sie tendenziell immer kürzer werden, denn sie bestehen aus zweimal zehn, zweimal acht und schließlich sechs Versen. Ein durchgehendes Metrum liegt dem Gedicht nicht zugrunde, wie beispielsweise in der Hymne „Prometheus“ verwendet Goethe zahlreiche freie Rhythmen. Dennoch ist die Form wesentlich regelmäßiger als in den Hymnen der Sturm und Drang-Zeit; Daktylen und Trochäen prägen den Tonfall.
Gleich zu Beginn des Gedichts wird Bezug auf Gottes Allgewalt genommen. Ihm gegenüber fühlt sich das lyrische Ich geradezu wie ein Kind, das sich ihm zu unterwerfen hat. Die Begründung folgt auf dem Fuße in der zweiten und dritten Strophe: Der Mensch solle sich nicht mit den Göttern messen, da er schon physisch nicht dazu in der Lage sei. Selbst Eiche und Rebe seien mächtiger. Die vierte Strophe widmet sich dem wesenhaften Unterschied zwischen Göttern und Menschen. Dabei wird metaphorisch ausgedrückt, dass der Mensch – im Gegensatz zu den Göttern – vergänglich und der Natur nicht gewachsen ist. Die äußere Begrenztheit menschlichen Lebens wird in der fünften und letzten Strophe thematisiert.
Schon die erste Strophe gibt die leitende Grundstruktur der Hymne vor: Götter und Menschen werden einander polar gegenüber gestellt. Mit dem uralten heiligen Vater (vgl. Vers 1f.) ist nicht der christliche Gott gemeint, sondern die „Segnende[n] Blitze“ (Vers 5) lassen eher an den griechischen Göttervater Zeus denken. Dieser ist äußerst mächtig, was ihm eine gewisse Gelassenheit verleiht (vgl. Vers 3), er greift aktiv in den Weltenlauf ein („Hand“, Vers 3), wobei er zugleich als schöpfender Gott („sät“, Vers 6) anzusehen ist. Er missbraucht seine Macht nicht („segnende Blitze“, Vers 5), aber vor allem: Sein Handeln überdauert die Zeiten, er ist uralt (vgl. Vers 1). Kurzum – er ist der „Heilige Vater“ (Vers 2) der irdischen Geschöpfe; er hat alles geschaffen und sorgt kraftvoll dafür, dass weiterhin alles wächst und gedeiht. Dies alles wird in einen einzigen Temporalsatz gepackt, der den Hauptsatz, dessen Subjekt das lyrische Ich ist, fast zu erdrücken scheint. Das „Ich“ unterwirft sich dem schöpfenden Vatergott bedingungslos; der Kuss (vgl. Vers 7) ist weniger Ausdruck der Liebe als vielmehr der Ehrerbietung. Die Eigenmächtigkeit dieses Individuums ist auf ein Minimum begrenzt; es fühlt „Kindliche Schauer“ (Vers 9), was die Abhängigkeit von diesem Gott untermauert. Das Adjektiv „Treu“ (Vers 10) bezieht sich auf die kindlichen Schauer, die also das lyrische Ich auch im Erwachsenenalter nicht verlassen. Es gibt sich somit buchstäblich als lebenslanges Kind Gottes zu erkennen. Die sprachliche Distanz zu Gott – dieser wird nicht direkt angesprochen, wie beispielsweise in der Hymne „Prometheus“, sondern es wird in der dritten Person von ihm gesprochen – entspricht der gedanklichen und physischen; das lyrische Ich küsst lediglich „den letzten / Saum seines Kleides“ (Vers 7f.), kommt also nicht direkt mit ihm in Berührung und hält wohl noch nicht einmal Blickkontakt. Diese zehn Verse zeigen also in vollendeter Form – der Symbolik der Zahl 10 entsprechend – die Unterwerfung eines lyrischen Ichs unter die Macht des Schöpfergottes.
Damit könnte die Hymne bereits zu Ende sein, denn es ist bereits das Wesentliche gesagt. Doch es findet in der Folge eine gedankliche Ausweitung statt, eine Generalisierung. Das Ich versteht sich hier nicht in erster Linie als denkendes, mündiges Individuum, sondern eher als Teil der Gattung Mensch. Dieser jedoch kommt dieselbe Demut zu wie dem einzelnen. Ja, so die gedanklich-logische Struktur des Gedichts, die Demut des Individuums ergibt sich gerade aus der Feststellung, dass sich „mit Göttern“ kein einziger Mensch messen solle (vgl. Vers 11-13). Dieser Hauptsatz, der kausal mit der ersten Strophe verknüpft ist, wird nun weiter begründet, indem die physische Begrenztheit der Gattung „Mensch“ dem Leser plastisch vor Augen geführt wird. Wieder findet sich ein Satzgefüge aus Temporalsatz und Hauptsatz. Der Mensch soll sich nicht über das ihm zukommende Maß erheben, weil er sonst buchstäblich den Boden unter den Füßen verliert, sodass er zum Spielball der Naturgewalten wird. Dabei wird zugleich an den Formulierungen deutlich, dass es sich hier gleichzeitig um ein Verbot der Hybris handelt. Erhebt der Mensch sich über das ihm zugewiesene Maß „Und berührt / Mit dem Scheitel die Sterne“ (Vers 15f.), so ist er verloren. Dass die Sohlen personifiziert und als unsicher bezeichnet werden (vgl. Vers 18), hebt deren Bedeutung hervor: Der Mensch ist schon rein äußerlich an die Erde gebunden, weil er sonst den Halt verliert. Doch auch der umgekehrte Fall, dass der Mensch selbstbewusst, also „mit festen, / Markigen Knochen“ (Vers 21f.), auf der Erde steht, verleiht ihm keine Macht; nicht einmal mit Eiche und Rebe könne er sich „vergleichen“ (vgl. Vers 26-28). Dass die Erde als „dauernd“ bezeichnet wird (vgl. Vers 24), verweist bereits auf die folgenden Strophen, in denen die Vergänglichkeit des Menschen der Unvergänglichkeit der Götter, aber auch der Natur thematisiert wird.
Ist in der zweiten und dritten Strophe noch von „dem Menschen“ die Rede gewesen, so findet in der Folge auch sprachlich eine weitere Verallgemeinerung statt, denn nun ist von den Menschen die Rede, und zwar sogar ohne den Artikel (vgl. Vers 30). Götter und Menschen werden nunmehr direkt einander gegenüber gestellt. Dabei wird als zentrale Metapher jene der Wellen benutzt. Die Wellen stehen für die Naturgewalt des Wassers. Diese kann den Göttern nichts anhaben, ja die Wellen wandeln sogar als „ewiger Strom“ (Vers 33) vor den Göttern, deren Bedeutsamkeit damit weiter hervorgehoben wird. Dem gegenüber sind die Menschen buchstäblich als vergängliche Wesen in die Welt – hier: ins Wasser – geworfen und diesem auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die Welle (schon eine einzige genügt also!) „hebt“ und „Verschlingt“ (Vers 34f.) die Menschen, sie „versinken“ (Vers 36). Während also die Götter dem ewigen Strom folgen, ewig leben, sind wir Menschen sterblich.
Die letzte Strophe ist nicht ganz leicht zu entschlüsseln. Dass „Ein kleiner Ring“ (Vers 37) „unser Leben“ (Vers 38) begrenze, geht logisch aus dem zuvor Beschriebenen hervor. Dann jedoch wirft der Text Fragen auf. Wenn sich „viele Geschlechter“ (Vers 39) aneinander reihen, so scheint dies zunächst einmal zu bedeuten, dass viele Generationen aufeinander folgen und dass diese eine „Unendliche Kette“ (Vers 42) bilden. Allerdings bleibt offen, ob das Dasein (vgl. Vers 41) der Götter oder der Menschen gemeint ist. Sollte es sich um die Menschen handeln, so würde dies schlicht betonen, dass die sterblichen Menschen in einer unendlichen Reihe ihr Dasein auf der Erde fristen, dass also die Gattung des Menschen für unendliche Zeit auf der Erde Gast ist.
Dieser Gedanke leuchtet aber nicht so recht ein, denn dann wäre zumindest die Gattung der Menschheit unsterblich, da ihre Kette ja unendlich fortbestehen würde. Die
„Grenzen der Menschheit“ bestünden dann darin, dass der Einzelne nichts sei. Denkbar ist jedoch auch, dass das Dasein der Götter gemeint ist. Diese bilden demnach eine Kette, an der das irdische Leben hängt, von der wir Menschen also buchstäblich abhängen. Diese Deutung erscheint vor dem Hintergrund der klaren Machtverteilung zwischen Göttern und Menschen wohl als die plausiblere, zumal mit der Kette möglicherweise ein Bezug zur antiken Mythologie hergestellt wird, der zufolge die Erde an einer goldenen Kette hänge, an deren anderem Ende Zeus ziehe – im Wettstreit allerdings nicht mit den Menschen, sondern mit den anderen Göttern.
Alles in allem sei festgehalten, dass dieses Gedicht ein Aufruf zur Demut der Menschen gegenüber den Göttern darstellt. Mit einer – zugegebener Maßen nicht ganz unerheblichen – Akzentverschiebung vom Schöpfer auf die Schöpfung könnte man dieses Gedicht nicht nur vom Titel her, sondern auch inhaltlich auf die gesellschaftliche Gegenwart unserer Tage übertragen. Die Geschichte der letzten 230 Jahre ist voll von Beispielen, die belegen, wie fern uns die in dieser Hymne verarbeitete Lebenseinstellung geblieben ist und zu welch katastrophalen Folgen dies geführt hat.
Joseph von Eichendorff (1788-1857)
Die zwei Gesellen[9]
Es zogen zwei rüst’ge Gesellen
Zum erstenmal von Haus,
So jubelnd recht in die hellen,
Klingenden, singenden Wellen
Des vollen Frühlings hinaus.
Die strebten nach hohen Dingen,
Die wollten, trotz Lust und Schmerz,
Was Rechts in der Welt vollbringen,
Und wem sie vorübergingen,
Dem lachten Sinnen und Herz. –
Der erste, der fand ein Liebchen,
Die Schwieger kauft’ Hof und Haus;
Der wiegte gar bald ein Bübchen,
Und sah aus heimlichem Stübchen
Behaglich ins Feld hinaus.
Dem zweiten sangen und logen
Die tausend Stimmen im Grund,
Verlockend’ Sirenen, und zogen
Ihn in der buhlenden Wogen
Farbig klingenden Schlund.
Und wie er auftaucht vom Schlunde,
Da war er müde und alt,
Sein Schifflein das lag im Grunde,
So still war’s rings in die Runde,
Und über die Wasser weht’s kalt.
Es singen und klingen die Wellen
Des Frühlings wohl über mir:
Und seh’ ich so kecke Gesellen,
Die Tränen im Auge mir schwellen –
Ach Gott, führ’ uns liebreich zu dir!
Aporien im Angesicht Gottes
Die Frage, wie man zu leben habe, ist so alt wie die Menschheit selbst und stellt sich jedem einzelnen in allen Lebensabschnitten. „Was soll ich mit meinem Leben anfangen?“ – dies ist vielleicht nichts anderes als die ins Praktische gewendete und entsprechend umformulierte Frage: „Worin besteht der Sinn des Lebens?“
Gerade Jugendliche und junge Erwachsene sind davon durchdrungen und sehen sich folglich mit dem Problem konfrontiert, wegweisende Entscheidungen treffen zu müssen. Im 21. Jahrhundert bieten sich jungen Menschen so viele Möglichkeiten wie vielleicht niemals zuvor, was die Entscheidungsfindung nicht eben erleichtert. Zugleich wird ihnen suggeriert, als junge, mündige Erwachsene könnten und müssten sie sich selbstbewusst entscheiden und es sei ihre Pflicht, die sich ihnen heute bietenden Chancen zu nutzen. Philosophisch unterfüttern und legitimieren könnte man diese Lebenseinstellung beispielsweise durch Kants Definition der Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“.
Es stellt sich jedoch manchem vielleicht die Frage, ob der Mensch wirklich so mündig ist, wie er zu sein glaubt, oder – mit Blick auf die Aufklärung etwas kritischer gefragt – wie er glaubt, sein zu müssen. Nach welchen Kriterien geben wir die Antwort auf die eingangs gestellte Frage? Wer leitet uns beim Suchen (und Finden) dieser Kriterien? Handelt es sich überhaupt um einen bewussten Prozess, oder folgen wir letztlich – bei aller kognitiven Intelligenz – nicht doch unserem Instinkt?
Das vorliegende Gedicht Joseph von Eichendorffs kann als Ausdruck der Überzeugung gelesen werden, dass auch das moderne, sich seiner selbst bewusste Individuum eine höhere Macht braucht, die es beschützt und – wie auch immer die einzelnen Entscheidungen getroffen werden – zu einem guten Ende geleitet. Es handelt sich um ein Gedicht, das dem christlichen Gottesverständnis verpflichtet ist und mit der Bitte an Gott, dass er uns zu sich führen solle, zugleich ein Plädoyer für Demut des Menschen gegenüber Gott und seiner Schöpfung darstellt.
Worum geht es? In den ersten beiden Strophen wird die Ausgangslage geschildert: Zwei junge Männer brechen von zu Hause aus auf, um ihren Tatendrang zu befriedigen. Sie sind voller Idealismus, guter Absichten und wirken auf ihr Umfeld sympathisch. Im zweiten Abschnitt, der die dritte bis fünfte Strophe umfasst, wird geschildert, wie unterschiedlich das Leben der beiden verläuft. Der eine heiratet, wird Familienvater und lebt auf jenem Hof und in jenem Haus, das ihm die Schwiegereltern gekauft haben: ein Leben in Wohlstand und Sicherheit, dem im vorliegenden Gedicht nur eine einzige Strophe gewidmet zu werden braucht. Der andere erliegt den sinnlichen Verführungen der Umwelt und ist im Alter einsam. Er erleidet buchstäblich Schiffbruch. Die Schilderung dieses zweiten Lebenslaufs umfasst zwei Strophen; ihr wird damit doppelt so viel Raum gewidmet wie der ersten. Es folgt das Fazit des lyrischen Ichs: Bei aller Rührung über jene jungen Männer, die sich voller Elan aufmachen, ihrem Leben einen Sinn zu verleihen, bleibt letztlich nur die Hoffnung auf Gottes Gnade.
Es drängen sich zwei Fragen auf: Sind denn nun beide „Gesellen“ gescheitert? Und wenn ja: Woran sind sie gescheitert?
1818 erstmals verfasst und 1837 in der vorliegenden Fassung veröffentlicht, gehört dieses Gedicht Joseph von Eichendorffs in den Kontext der Spätromantik. Die Utopien, denen die Frühromantiker in ihren Werken Ausdruck verliehen hatten, wurden entweder als unerreichbar angesehen oder ins Jenseits verschoben. Somit hatte sich auch die Funktion des Wunderbaren, der Phantasie, der Poesie gewandelt. Sie wurden nicht mehr als etwas angesehen, das mit der irdischen „Wirklichkeit“ in Einklang zu bringen bzw. Teil dieser Wirklichkeit sei, sondern es entstand (wieder) jene klare Trennung zwischen Verstand und Phantasie, die auch die Aufklärer sahen. Wenn es das Wunderbare überhaupt noch gab, dann als etwas Göttliches, bzw. von Gott als Gnade Erteiltes. Im Gedicht „Die zwei Gesellen“ wird dies einmal mehr deutlich.
Die beiden ziehen „Zum erstenmal“ (V. 2) in die weite Welt hinaus, wobei diese sich im Stadium des „vollen Frühlings“ (V. 5) befindet: So wie die jungen Männer, befindet sich auch die Natur in voller Blüte; deren Schönheit wird ausgedrückt in dem Bild der „hellen, / Klingenden singenden Wellen“ (V. 3f.). Die Welt ist in Bewegung, die Wellen können zunächst einmal als Symbol für Abwechslung und Dynamik angesehen werden. Der emotionale Überschuss im Innern der beiden Gesellen kommt durch die Formulierung „So jubelnd“ (V. 3) besonders zur Geltung, und zwar zum einen durch das Partizip, das Begeisterung zeigt, und zum anderen durch das wie eine Interjektion verwendete „So“: Der eigentlich zu erwartende Vergleich „so – wie“ wird nicht zu Ende geführt, der innere Jubel der beiden ist unvergleichlich. Der Binnenreim in Vers 4 lässt die Euphorie der beiden bis in die Sprache hinein dringen. Äußere Natur und innere Verfassung der Gesellen sind eins, der Gesang ist Ausdruck unbändiger Lebensfreude und wird auf die Wellen projiziert. Die Kehrseite dieses Gesangs, die in der Verlockung in den Untergang besteht, ist noch nicht absehbar für die beiden Gesellen; vorläufig ist die Natur ihnen wohlgesonnen und Ausdruck von Lebensfreude, wie auch die Alliteration in Vers 5 („vollen Frühlings“) zusätzlich unterstreicht.
Es ist nur folgerichtig, dass sich die Euphorie der beiden auf ihre Mitmenschen überträgt oder diesen doch zumindest Freude bereitet, wie in Vers 10 zum Ausdruck kommt („dem lachten Sinnen und Herz“). Allerdings deutet sich bereits hier ein Konflikt an, der nicht so recht zum Gesamteindruck zu passen scheint: Die beiden Gesellen empfinden offenbar „Lust und Schmerz“ (V. 7) zugleich. Der Schmerz könnte aus jenem Abschied von der Heimat (und der unbeschwerten Kindheit) resultieren, der Voraussetzung dafür zu sein scheint, nach den „hohen Dingen“ streben zu können. Hier deutet sich also an, dass die euphorische Stimmung brüchig sein könnte.
Die Bestätigung folgt auf dem Fuße. Mithilfe einer starken Zeitraffung wird dargestellt, wie es dem ersten ergeht. Der vordergründig entstehende Eindruck, er werde glücklicher Familienvater, wird sofort unterlaufen durch die dreifache Verwendung des Diminutivs („Liebchen“ – „Bübchen“ – „Stübchen“), der das gefundene „Glück“ ins Lächerliche zieht und gleichzeitig der ganzen Enge dieses Lebens Ausdruck verleiht. Der typisch romantische Blick durch das – hier nicht erwähnte – Fenster hinaus in die Natur wird weniger durch Sehnsucht, als vielmehr durch Saturiertheit („behaglich“, V. 15) geprägt, doch es liegt auf der Hand, dass die angestrebten „hohen Dinge“ (vgl. V. 6) nicht erreicht worden sind. Eher deutet sich eine ökonomische Abhängigkeit von den Schwiegereltern an. Die Alliteration in Vers 12 („Haus und Hof“) mag die Eintönigkeit dieses nicht selbst erarbeiteten Besitzes zusätzlich unterstreichen. Der erste Geselle hat sich also fesseln lassen, und es kann dem Leser des Gedichts überlassen bleiben darüber nachzudenken, was bzw. wer den nun wohl nicht mehr ganz so jungen Mann wohl gefesselt haben könnte.
Ganz anders ergeht es dem zweiten Gesellen. Er folgt einer klaren Abwärtsbewegung hinab in den Grund; die dunklen Vokale an den Versenden der vierten und fünften Strophe geben die düstere Stimmung und Gefahr wieder. Wofür auch immer die „Sirenen“ stehen mögen – für die Verführung durch Frauen beispielsweise, die ihn wie einst Odysseus vom Weg abbringen wollen: Im Gegensatz zu diesem, scheint der Geselle nicht über die notwendige Listigkeit zu verfügen, jedenfalls verfällt er den Verlockungen und wird, wie die Syn-ästhesie „Farbig klingenden“ (Vers 20) deutlich macht, von seinen Sinneswahrnehmungen verwirrt, sodass er sich verirrt. Zu spät taucht er als alter Mann wieder auf; jeglicher Lebenswille ist ihm abhanden gekommen: Er ist müde (V. 22) und er spürt die Kälte der Einsamkeit (vgl. Vers 24f.): Offenbar haben die Genüsse, die ihm zuteil geworden sind, ihm nicht zu dauerhaftem Glück verholfen; er ist genauso gescheitert wie der erste Geselle. Während dieser jedoch ein philisterhaftes Leben geführt hat, ist jener den Verlockungen des Gesangs, also der Kunst und der Phantasie, erlegen. Das Singen der Wellen (vgl. V. 4) hat sich als Lug und Trug herausgestellt (vgl. V. 16); die Vermischung der Seh- und Hörsinns kann als Symptom dafür gesehen werden, dass die Kunst nicht die Utopie eines die Welt bereichernden Lebens hat Wirklichkeit werden lassen und mit der „Wirklichkeit“ nicht vereinbar ist.
Hier wird das spezifisch Spätromantische greifbar: Das Wunderbare übt noch eine Macht aus, aber keine (mehr), die auf eine Verbesserung der Welt abzielt. Die Poesie ist hier eben nicht, um mit Walter Benjamin zu sprechen, der Statthalter der Utopie, sondern sie führt den Menschen in die Irre, sie stellt eine Gefahr für ihn dar.
Dieser Einsicht verleiht ein offenbar vom Leben gezeichnetes lyrisches Ich Ausdruck. Auch dieses Ich kennt die klingenden „Wellen / Des Frühlings“ (V. 26f.), und noch einmal wird deren Verlockung und Schönheit mithilfe eines Binnenreims ausgedrückt („singen und klingen“, V. 26), doch es kennt „die Realität“ und beweint das Schicksal der „kecke[n] Gesellen“ (V. 28), wobei die Tränen wohl durchaus in erster Linie Tränen der Rührung sind und nicht (oder zumindest nicht ausschließlich) Tränen der Trauer: Das Leben birgt vielfältige Gefahren, und wie auch immer wir uns entscheiden – wir scheitern und sind auf Gottes Gnade angewiesen. Er soll uns „liebreich“ zu sich führen (V. 30). Die Unterwerfung dieses lyrischen Ichs unter den göttlichen Willen wird durch die Interjektion „Ach“ (V. 30) verdeutlicht. Gott ist der Kapitän des Schiffes, das über den Fluss gleitet und dabei zu Bruch gehen kann, er ist Herr über unser Schicksal. Von seiner Gnade – so das lyrische Ich am Ende – sind wir abhängig, und wenn wir diese Demut nicht bewahren, gehen wir unter.
Es bleibt dem Leser überlassen, wie er mit dieser Sicht auf das Leben umgeht und erst recht, ob er sich diese Einstellung zu eigen machen möchte. Es wäre jedoch sicherlich verfrüht und übereilt, dem lyrischen Ich, das durchaus in die Nähe zum Dichter gerückt werden kann, seinerseits Philisterhaftigkeit oder Fatalismus vorzuwerfen.
Denn kann man auch offenlassen, ob das lyrische Ich hier auf das eigene Leben zurückblickt: Es ist offensichtlich, dass es Sympathie für jene Suchbewegung empfindet, die die beiden Gesellen durchlaufen, und es ist zumindest zu erahnen, dass derjenige, der länger gesucht hat – also der zweite Geselle – mit etwas mehr Wohlwollen bedacht wird als der andere.
Doch das zutiefst romantische Lebensmotto „Der Weg ist das Ziel“ liefert in diesem Gedicht nicht die Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach dem Sinn des Lebens, dazu ist die Bedeutung, die der Gnade Gottes beigemessen wird, wohl zu groß.
Eduard Mörike (1804-1875)
Gebet[10]
Herr! schicke was du willt,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, daß beides
Aus deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden
Und wollest mit Leiden
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
Liegt holdes Bescheiden.
Die fromme Demut des bescheidenen Mittelwegs
Die Revolutions- und Kriegszeit zwischen 1789 und 1815 hatte das deutschsprachige Bürgertum ermüdet und ernüchtert. Alles in allem wurden die Ergebnisse des Wiener Kongresses, der eine politische Restaurationsphase einläutete, mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen, weil man sich wieder in einer gesicherten Ordnung befand. Man zog sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück in die (familiäre) Privatheit. Zunächst ironisierend-parodistisch verwendet, setzte sich rückwirkend für einen Teil der Literatur, die etwa zwischen 1815 und 1850 entstanden war, die Epochenbezeichnung „Biedermeier“ durch, die das Lebensgefühl jener Jahre zum Ausdruck bringen soll, nämlich Genügsamkeit und Schlichtheit. Die Macht der Phantasie, des Wunderbaren, die noch in der Romantik prägend für Kunst und Philosophie gewesen war, nahm in der literarischen Darstellung rapide ab. Es wurde nicht mehr versucht, das Transzendente ins Immanente zu integrieren, die Welt zu romantisieren, was nur möglich ist, wenn man an eine zu verwirklichende, dynamische Utopie glaubt, sondern angestrebt wurde nunmehr der „gesunde Mittelweg“, was demütige Bescheidenheit zu erkennen gibt: Zwar lebten Einflüsse aus der klassisch-romantischen Zeit fort, doch es wurde versucht, eine Synthese herzustellen zwischen Idealismus und „Realismus“.
Der Gegensatz zur Jugendbewegung des Sturm und Drang, aber auch zur Romantik, vor allem zur frühen Romantik eines Novalis, ist mit den Händen zu greifen. Zugleich wurde die Literatur nicht mehr als selbstreferentieller, autopoietischer Raum wahrgenommen, also sie bezog sich expliziter als zuvor auf die außerliterarische Wirklichkeit. So konnte sich auch insbesondere für die Epoche zwischen 1850 bis 1880 der Begriff des „poetischen Realismus“ durchsetzen, doch auch das Biedermeier und die Dichter des Vormärz und des Jungen Deutschlands (zu denken ist zum Beispiel an so unterschiedliche Autoren wie Heinrich Heine und Georg Büchner) lassen sich bereits als Vertreter einer solchen Tendenz ansehen.
Eduard Mörike (1804-1875) ist schon aufgrund seiner Lebensdaten ein idealtypischer Vertreter des Biedermeier; als junger Erwachsener lebte er in einer Gesellschaft, die klar vom Geist der Restauration geprägt war. Zugleich wurde er durch seine Familie pietistisch geprägt und versuchte sich als evangelischer Pfarrer, während er dichtete.
So ist es bereits bei oberflächlicher Betrachtung nicht überraschend, dass er im Jahre 1848 ein Gedicht veröffentlichte, das den Titel „Gebet“ trägt. Es besteht aus zwei Strophen zu vier bzw. fünf Versen. Ein kurzes Gedicht also, das mit wenigen Worten auskommt. Seine Grundaussage ist, dass das lyrische Ich demütig und klaglos Liebe und Leid aus Gottes Händen annehme und dass es zugleich hoffe, dass beides nicht zu dominant sein möge, sondern dass die Balance gewahrt bleiben möge, da in der Mitte das Glück liege.
Das Reimschema der ersten Strophe ist der umarmende Reim, der hier durchaus inhaltlich seine Entsprechung findet: So, wie die äußeren Versenden die beiden inneren umschließen, so soll auch Gottes Allmacht das Leben des lyrischen Ichs umfassen, also letztlich beschützen. Schon der erste Vers beginnt mit der an ein Gebet erinnernden direkten Anrede „Herr!“ (Vers 1). Die Geste der Unterwerfung, die dahinter zum Vorschein kommt, wird inhaltlich noch im gleichen Vers bestätigt, denn der Wille Gottes ist ausschlaggebend für alles, was geschieht. Die Formulierung „schicke was du willt“ (Vers 1) zeigt deutlich, dass Gott der Gebende und der betende Mensch der Empfangende ist, und was auch immer der Inhalt ist – „Liebe oder Leid[es]“ (Vers 2) – beides wird akzeptiert, wie die beiden nächsten Verse zeigen. Ja, mehr noch: Beides führt zu einem seligen Vergnügen des lyrischen Ichs (vgl. Vers 3), solange es aus den Händen Gottes „quillt“ (Vers 4). Dabei zeigt die Verwendung des Verbs „quellen“, dass auf die Fruchtbarkeit göttlicher Schöpfungsmacht und -kraft hingewiesen wird. Aus Gottes Händen empfangen wir einen so vielfältigen Reichtum, dass dieser nicht nur heraus tropft, sondern eben heraus quillt. Zum blühenden Leben gehören sowohl Liebe als auch Leid, sowohl Freude und Glück als auch Schmerz. Die Alliteration („Liebes“ – „Leides“) verstärkt die Antithetik beider Begriffe und untermalt damit auch lautlich das Allumfassende der göttlichen Allmacht. Das Vergnügen des lyrischen Ichs mag daraus resultieren, dass es diese eine Macht gibt, die beides zu geben in der Lage ist, denn das bedeutet letztlich auch, dass das menschliche Individuum nicht gezwungen ist, selbst aktiv an der Gestaltung des eigenen Lebens bzw. „Schicksals“ mitzuwirken, weil die göttliche Allmacht alles umfasst. In diesem Vergnügen käme somit auch ein gewisses Behagen zum Ausdruck. Das lyrische Ich ist passiv-empfangend und darf dies auch sein.
Zugleich mag das Vergnügen, also die Freude des Ichs, auch aus der eigenen Demut hervorgehen. Diese Lebenseinstellung der Bescheidenheit führt zu einer tiefen Zufriedenheit. Der im ersten Vers verwendete Imperativ „Schicke“ drückt aus, dass sich das lyrische Ich dem Willen des Herrn unterwerfen möchte. Es fleht geradezu danach, etwas geschickt zu bekommen und versichert noch im gleichen Atemzug, dass es alles mit Freude annehmen werde. Rein semantisch betrachtet, wäre es sicherlich denkbar, diese Strophe zu paraphrasieren: „Herr, was auch immer du mir zu schicken gedenkst – ob Liebe oder Leiden – beides macht mich glücklich, weil ich es aus deinen Händen erhalte!“ Doch die Verwendung des Imperativs unterstreicht den gebetsartigen, bittenden Charakter dieser ersten vier Verse. Die Glaubensgewissheit des Betenden kommt zusätzlich darin zum Ausdruck, dass die gesamte Strophe im Indikativ verfasst ist. Der Konjunktiv wird nicht benötigt, weil das Empfangene die Realität ist und weil die Freude des Empfangens alles Denkbare umfasst.
Die Verwendung der archaisierenden Verbform „willt“ (Vers 1) bringt möglicherweise auch sprachlich zum Ausdruck, dass der geäußerte Wunsch die Gegenwart überschreitet und von überzeitlicher Gültigkeit ist. Insofern könnte man das Gedicht als Wendung gegen die „Moderne“ auffassen, als Antwort auf die Säkularisierung der vorhergehenden Jahrzehnte. Andererseits kommt in dieser Form jedoch unterschwellig vielleicht auch zum Ausdruck, dass die Vollkommenheit der Form (hier: des Reimschemas) ebenso wie die Totalität der Unterwerfung unter den Willen Gottes etwas Gewaltsames, etwas Ge- oder Erzwungenes in sich birgt. Der äußere Reim („willt“, Vers 1 – „quillt“, Vers 4) ist nur deshalb kein unreiner Reim, wie es das Wortpaar „willst“ – „quillt“ wäre, weil der modernen Form des Verbs „wollen“ ein Laut entnommen wird. Hier deutet sich möglicherweise eine Brechung an, die allerdings nur latent und – wenn überhaupt – nicht im Bewusstsein des Sprechenden zu finden ist.
In der zweiten Strophe wird das lyrische Ich ein wenig mutiger, es äußert nämlich eine Bitte an den Herrn, wie die selten vorkommende, hier gleich doppelt verwendete Imperativ-Form „wollest“ (Vers 5, Vers 6) bereits zeigt, ebenso wie das Ausrufezeichen am Ende des siebten Verses. Die betende Person nimmt zwar alles an, doch sie bittet darum, dass sie nicht überschüttet werde (vgl. Vers 7) mit Extremen. Sie möchte weder zu viel der Freude noch zu viel des Leides erhalten, was die unterwürfige Formulierung der ersten Strophe partiell zurücknimmt. Offensichtlich ist das Vergnügen dann doch nicht völlig losgelöst vom Inhalt der göttlichen Sendung zu sehen. Dabei ist die Formulierung „Mich nicht überschütten“ (Vers 7) ebenfalls auffällig, denn offensichtlich möchte das Ich sich nicht selbst verlieren. Es möchte sich selbst erhalten bleiben, auch wenn die Demut in dieser Passage rein sprachlich so weitreichend ist, dass das Personalpronomen „Ich“ vollends verschwunden ist: Das sprechende Subjekt erscheint nur noch als Akkusativ-Objekt. Dies täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es auf die eigene Wahrnehmbarkeit Wert zu legen scheint. Insofern könnte man hier von einer Spannung zwischen inhaltlichem Wunsch und sprachlicher Darstellung dieses Wunsches sprechen.
Die beiden letzten Verse des Gedichts liefern die Begründung für diese Bitte, dass nämlich in der Mitte „holdes Bescheiden“ (Vers 9) liege, dass also in der Mitte der Weg zum Glück zu finden sei. In diesem kurzen Hauptsatz wird der persönliche Wunsch des sprechenden Ichs objektiviert, weil eine generalisierende Aussage über das Glück getroffen wird. Diese passt auch zum bisher Gesagten. Schaut man sich den Text und die formale Gestaltung der Strophe jedoch genauer an, so entsteht der Eindruck, als bitte das lyrische Ich um etwas, was es bisher noch nicht erhalten hat, dass es also möglicherweise in einer gewissen inneren Spannung lebt und vielleicht gerade deshalb so inbrünstig und unterwürfig um göttliche Gnade bittet.
Zunächst einmal verwundert nämlich die Verwendung der adversativen Konjunktion „doch“. Wird auch zwischen den ersten drei Versen der letzten Strophe und den beiden letzten Versen ein inhaltlicher Gegensatz ausgedrückt, steht nämlich den beiden Polen der Freude und des Leids als eigentlicher Kontrast deren Vermittlung gegenüber, so wäre es im Hinblick auf den logischen Zusammenhang näherliegend, die kausale Konjunktion „denn“ zu verwenden. Damit könnte der Grund für den Wunsch des lyrischen Ichs zum Ausdruck gebracht werden. So wird zwar indirekt ausgesagt, dass die betende Person den inneren Zustand holden Bescheidens ersehnt, und in der Tat könnte man die beiden letzten Verse indirekt als Aufforderung an Gott ansehen, diesen Zustand herbeizuführen. Aber es bleibt in diesem doch sehr explizit formulierten Gedicht, das auf sprachliche Bilder fast ganz verzichtet – sieht man einmal von der metaphorischen Verwendung der Verben „quellen“ und „überschütten“ ab – der leise Eindruck eines logischen Bruchs bestehen. Diese inhaltliche Ungereimtheit findet eine Entsprechung in der formalen Gestaltung. Nicht nur sind die beiden Strophen unterschiedlich lang, sondern auch die Endreime sind nicht als rein zu bezeichnen. Die beiden Wortpaare „Freuden“ – „Leiden“ (Vers 5, Vers 6) und „überschütten“ – „Mitten“ (Vers 7, Vers 8) können eine gewisse Dissonanz nicht verbergen. Ähnlich wie schon hinsichtlich der ersten Strophe festgestellt worden ist, so muss auch hier konstatiert werden, dass der Zustand der Harmonie und des Glücks, der erfleht wird, noch nicht erreicht wird – und dies bei aller Demut gegenüber dem gebenden Herrn.
In dieser Hinsicht kann man einen sehr leisen Anklang an die Romantik finden, denn es geht einmal mehr darum, dass ein für die Zukunft erwünschter Zustand noch nicht eingetreten ist. Doch der Umgang mit diesem Erfahrungsmuster ist ein völlig anderer als wenige Jahrzehnte zuvor. Nicht der Dichter ist es, der als Genie (wie zur Zeit des Sturm und Drang) oder als irdischer Statthalter und Verkünder der Utopie des Goldenen Zeitalters (wie in der Romantik) den ersehnten Zustand selbst herbeiführen kann, sondern letzteres vermag einzig und alleine Gott. Für den Menschen ist nur der Mittelweg der Bescheidenheit gangbar. Insofern ist dieses Gedicht geradezu ein Manifest menschlicher Unterwerfung unter den göttlichen Willen – allerdings um den Preis einer Bezwingung der eigenen Subjektivität. Diesen Preis kann nur die Frömmigkeit des Individuums begleichen – im menschlichen Glauben an die allmächtige Gnade Gottes.
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
Herbsttag[11]
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren laß die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Zwischen Gebet und Warnung – Zerrissenheit als Krisensymptom
Der Herbst gilt gemeinhin vielen Menschen als die Jahreszeit, die für Übergang und Verfall steht. Der Sommer ist zu Ende, der Winter bricht jedoch noch nicht herein. Die Wärme lässt nach, dennoch gibt es hin und wieder noch schöne Tage, die es erlauben, draußen die Sonne zu genießen und mit Freunden zusammen zu sitzen. Doch die Blätter an den Bäumen färben sich allmählich gelb, braun, vielleicht auch rot, was ein untrügliches Zeichen ist für das Ende der Reifezeit, die der Sommer verkörpert. Die Vergänglichkeit allen Lebens wird uns im Herbst vor Augen geführt.
In Zeiten eines epochalen Umbruchs lag und liegt es nahe, sich des Herbstes als Metapher zu bedienen, um die genannten Aspekte hervorzuheben. Eine solche Zeit war sicherlich die Jahrhundertwende um 1900. Nicht zufällig haben in der Literaturgeschichte die französischen Begriffe „décadence“ und „fin de siècle“ für diese Epoche weithin eine beachtliche Geltung erlangt, weil vor allem die Künstler und Intellektuellen damals im Bewusstsein lebten, dass die bestehende Gesellschaftsordnung nicht mehr lange Bestand haben könne. Sie sollten ja auch Recht behalten, wie Ausbruch, Verlauf und Konsequenzen des Ersten Weltkriegs zeigten.
Rainer Maria Rilke, einer der berühmtesten deutschsprachigen Dichter dieser Zeit, verfasste im September des Jahres 1902 das Gedicht „Herbsttag“, das sicherlich zu den bekanntesten Gedichten deutscher Sprache überhaupt zu zählen ist.
Das Gedicht umfasst drei Strophen wachsenden Umfangs; sie bestehen aus drei, vier bzw. fünf Versen. Im Ton eines Gebets richtet sich ein im Hintergrund bleibendes lyrisches Ich an den Herrn, er möge den Sommer beenden und den Herbstanfang einläuten, da es Zeit sei (vgl. Vers 1). Diese Bitte wird in der zweiten Strophe dahingehend konkretisiert, dass die Früchte zur vollkommenen Reife gelangen mögen. Der Duktus des Gedichts ändert sich zwischen der zweiten und der dritten Strophe. Der gebetsartige Ton wandelt sich in eine sehr apodiktische Sprechweise, die festlegt, dass wer zum jetzigen Zeitpunkt kein Haus besitze und alleine sei, lange einsam und rastlos bleiben werde.
Bereits der Titel des Gedichts gibt das Thema vor. Der Herbst hat offensichtlich bereits begonnen, und es geht um einen ganz bestimmten Tag, wie sich zeigen wird.
Schon der erste Vers, der vielleicht zu den berühmtesten der deutschsprachigen Lyrik zu zählen ist, hat es in sich. Sehr auffällig ist zunächst die Anrede „Herr“, die stark an ein Gebet erinnert und die vollständige Unterwerfung des Sprechers gegenüber dem Herrn, dem Schöpfer, also Gott zum Ausdruck bringt. Der Doppelpunkt untermauert die exponierte Stellung dieser Anrede. Nicht minder prägnant ist der erste Satz („es ist Zeit“, Vers 1). Hier fällt zunächst auf, dass sehr klar und unmissverständlich festgestellt wird, dass der Zeitpunkt für etwas Neues gekommen sei. Wofür – das wird erst im Folgenden deutlich. Zu konstatieren ist allerdings auch, dass es das lyrische Ich, also ein menschliches Wesen, ist, das festlegt, dass dieser Zeitpunkt nunmehr eingetreten ist. Nicht der angesprochene – ja, angebetete – Herr bestimmt demnach darüber, sondern ein gläubiger Mensch. Dann folgt in einem zweiten kurzen, prägnanten Hauptsatz die Aussage, die an den Titel anknüpft. Daraus, dass der Satz im Präteritum steht, ist zu folgern, dass der Sommer vergangen ist. Offensichtlich war er von beachtlicher Länge und Wärme, hat also Mensch und Natur voll und ganz umfasst. So kann das in diesem Zusammenhang überraschende Adjektiv „groß“ (Vers 1) wohl gedeutet werden. Es ist somit naheliegend, dass der Herbst beginnen muss. Dies wird metaphorisch und in Imperativen zum Ausdruck gebracht. So, wie die beiden entsprechenden Verse formuliert sind, kann man eher von einer Aufforderung als von einer Bitte sprechen. Der Schatten soll über die Sonnenuhren fallen (vgl. Vers 2), wobei auffällt, dass ein Besitzverhältnis zum Ausdruck kommt durch das Possessivpronomen „deinen“ (Vers 2), wodurch die Macht des Herrn hervorgehoben wird. Das Nomen „Sonnenuhren“ ist zweideutig; es spielt sowohl auf das Sonnenlicht an, das nunmehr erlöschen soll, als auch auf das Vergehen der Zeit. Die Zeit des Sonnenscheins ist buchstäblich abgelaufen. Diese Forderung ist sehr klar und präzise formuliert und identisch mit dem zweiten Vers des Gedichts. Auch der dritte Vers enthält exakt einen Imperativsatz, der mit der Konjunktion „und“ an den vorhergehenden gereiht wird. Die „Winde“ bringen endgültig das Ende der sommerlichen Wärme, sorgen für Abkühlung und können hier auch als Symbol für den Verfall stehen. Sie sollen losgelassen werden, was als Personifikation nahelegt, dass sie bereits darauf warten, losbrausen zu können. Nun ist ihre Zeit also gekommen. Das Ende des dritten Verses reimt sich auf das Ende des ersten; das zweite Versende ist somit isoliert, auch wenn es sich auf das Nomen „Fluren“ im dritten Vers reimt. Es dominieren eindeutig dunkle Vokale, vor allem an den Versenden, was ebenso wie die zweifach vorkommende männliche Kadenz bedrohlich und düster wirkt. Das dominierende Metrum ist der fünfhebige Jambus, allerdings wird dies gleich zu Beginn durch die Betonung der ersten Silbe („Herr“) unterlaufen, ebenso zu Beginn des zweiten Verses („Leg“). Die Intensität der Bitte wird auf diese Weise auch rhythmisch untermalt.
Die zweite Strophe setzt die Bitten fort, ja sie stellt eigentlich eine sehr kunstvoll formulierte Aneinanderreihung von nicht weniger als vier Imperativsätzen dar. Schon der erste Imperativ („Befiehl“, Vers 4) sticht ins Auge, denn er stellt quasi eine potenzierte Aufforderung dar. Das lyrische Ich befiehlt dem Herrn, etwas zu befehlen. Dabei scheint ein ungebrochenes Vertrauen in die Schöpferkraft Gottes zu bestehen. Die letzten Früchte (vgl. Vers 4) des Jahres sollen „voll“, also reif und prall sein. Hier wird somit die Fruchtbarkeit besungen – paradoxerweise zu einem Zeitpunkt, zu dem der Sommer bereits vergangen ist und der Herbst Einzug halten soll. Aus diesem Grund werden die in der ersten Strophe ausgesprochenen Bitten zurückgenommen oder zumindest relativiert, wie der folgende Vers denn auch zeigt. Den Früchten sollen „noch zwei südlichere Tage“ (Vers 5) zuteil werden, damit die vollendete Reife (vgl. Vers 6) eintreten kann. Der Süden wird hier als Ort der Wärme thematisiert, wobei die Komparativform „südlichere“ in diesem Kontext als eine Relativierung zu verstehen ist: Es sollen zwei milde Tage ins Land gehen, die zumindest „südlicher“, also wärmer, sind als übliche Herbsttage.
Sowohl der erste als auch der zweite Vers der Strophe sind deckungsgleich mit je einem Imperativsatz. Dies gilt zunächst auch für den dritten Vers, der die Reifung der Früchte fast schon als Ergebnis eines gewaltsam vorangetriebenen Prozesses darstellt. Diese Gewalt ist notwendig, weil die Zeit buchstäblich drängt, und sie wird gesteigert durch den vierten und letzten Imperativ, der – hier kulminiert der Eindruck der gebotenen Eile – noch in den dritten Vers gezwängt und durch ein Enjambement mit dem Rest des Satzes verbunden wird. Der Herr soll dem „schweren“ (Vers 7), also stark alkoholhaltigen Wein „die letzte Süße“ (Vers 7) verleihen, indem er diese in ihn hinein jagt. Man könnte beinahe von einer geforderten Vergewaltigung der Natur sprechen. Das Adjektiv „letzte“ drückt einmal mehr den Wunsch nach Perfektion aus. Die im Frühling erblühte, im Sommer zur Reife gelangte Natur soll just zu jenem Zeitpunkt, zu dem der Herbst eintritt, das Stadium der Vollendung erreichen. Insofern ist hier in geradezu klassischer Weise von einer Krisensituation die Rede, von einem Moment also, der einen epochalen Umbruch bedeutet.
Das unvollständige Reimschema der ersten Strophe (a-b-a) wird hier zu einem umarmenden Reim (a-b-b-a) ergänzt; insofern wird formal jene Vollendung hergestellt, die inhaltlich gefordert wird. Parallel zum Reimschema verläuft der Wechsel zwischen männlicher und weiblicher Kadenz. Das Metrum ist wieder der fünfhebige Jambus, der allerdings erneut an zentraler Stelle (zu Beginn des dritten Verses) ins Stolpern gerät. Der Eindruck vollkommener Harmonie kommt folglich nicht zustande.
Zwischen den beiden besprochenen und der dritten Strophe besteht ein inhaltlicher Bruch, der auch die sprachliche Gestaltung betrifft. Das lyrische Ich, das es nach wie vor vermeidet, „Ich“ zu sagen, drückt in apodiktischer Weise, also mit dem Anspruch allgemeingültiger Objektivität, aus, dass das Jetzt einen Moment des Umbruchs darstellt. Auf diese Weise wird indirekt die Begründung für die so unmissverständlich formulierten Bitten, für den Aufruf zur Eile geliefert. Es handelt sich um den letztmöglichen Zeitpunkt, um für den kommenden Winter vorzusorgen – ja, eigentlich ist es zur Vorsorge sogar bereits zu spät. Denn „Wer jetzt kein Haus hat“ (Vers 8), der wird keine Gelegenheit mehr dazu bekommen, sich eines zu bauen. Mithilfe von Anapher und Parallelismus wird sogleich die zweite Feststellung formuliert, dass nämlich, wer „jetzt allein“ (Vers 9) sei, für lange Zeit alleine bleiben werde. Die anbrechende Zeit ist also eine unwirtliche, menschenfeindliche Phase, deren Ende zwar angedeutet wird, aber in weiter Ferne liegt, wie das Adverb „lange“ (Vers 9) zeigt. Während im Sommer Gelegenheit dazu bestanden hat, sich ein sicheres Zuhause aufzubauen und mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, ja Beziehungen zu knüpfen, die den Winter überdauern können, wird dies im Herbst und im Winter nicht mehr möglich sein. Gewarnt wird hier also vor der drohenden Isolation des Individuums von der Gesellschaft bzw. von geliebten Menschen. Die letzten drei Verse des Gedichts umschreiben nichts anderes mehr als jenen Zustand, der eigentlich um jeden Preis zu vermeiden gewesen wäre, doch dazu ist es nun zu spät. Auffällig ist hierbei, dass die Einsamkeit zunächst einmal begleitet wird von geistiger Tätigkeit („wachen, lesen, […] schreiben“, Vers 10). Offensichtlich wird also gerade der Beruf des Dichters als eine Tätigkeit angesehen, die aus der Einsamkeit erwächst, außerdem aus dem Zustand geistiger Anspannung, wie das Verb „wachen“ nahelegt. Die Vereinsamung wird gerade durch den verzweifelten Versuch, mit „lange[n] Briefen“ (Vers 10) mit der Außenwelt in Kontakt zu bleiben, hervorgehoben. Die geistige Unruhe wird jedoch durch körperliche Unrast begleitet, die durch das als Adverb verwendete Adjektiv „unruhig“ (Vers 12), vor allem aber durch die Wendung „hin und her“ als ziellos charakterisiert wird. Dabei ist die Umgebung solcher Wanderungen sehr unwirtlich, denn die „Alleen“ (Vers 11), von denen die Rede ist, sind gesäumt von Bäumen, die keine Blätter mehr tragen. Diese „treiben“ (Vers 12) – man sieht es förmlich vor dem inneren Auge – auf der Straße, wohl ebenso ziellos und fremdgesteuert wie das wandernde einsame Individuum. Die zahlreichen Alliterationen, die geballt in den letzten drei Versen zu finden sind, stehen in merkwürdigem Widerspruch zum trostlosen Inhalt, denn sie verleihen dem Text etwas zutiefst Poetisches. Dies alles wird ins Futur gesetzt, ist also noch nicht der gegenwärtige Zustand, aber der bereits erwähnte apodiktische Ton bewirkt, dass man es nicht wagt, die Prognose anzuzweifeln. Die Zukunft wird eine Zeit des Verfalls sein, vor dem sich nicht schützen kann, wer nicht bereits vorgesorgt hat. Zum Zeitpunkt des besungenen Herbsttages jedoch ist es bereits zu spät, irgendetwas Versäumtes nachzuholen.
Der angesprochene Bruch zwischen den beiden ersten Strophen einerseits und der letzten andererseits ist sowohl inhaltlich als auch sprachlich und formal ein tief greifender.
Formal fällt auf, dass die in der zweiten Strophe vollzogene Vollendung des umarmenden Reims in der dritten überschritten wird. Das Schema „a-b-b-a-b“ erweckt den Eindruck, als träte etwas Neues zu dem bereits Vollendeten hinzu, das eben diese Vollendung aufhebt und rückgängig macht. Zwar ist das letzte Versende nicht isoliert, reimt es sich doch auf das Ende des zweiten und dritten Verses, doch es wirkt in gewisser Weise deplaziert. Auch die sprachlich-formale Einheit aus Vers und Satz, die in den beiden ersten Strophen weitgehend Bestand hatte, geht ab dem dritten Vers der letzten Strophe verloren; die aneinander gereihten Infinitive, die zu den Futur-Formen gehören, signalisieren sprachlich, dass die inhaltlich-formale Ordnung verloren gehen wird. Hat sich das lyrische Ich zunächst noch mit klaren Sätzen an den Herrn gewandt, so treiben die Infinitive nunmehr ähnlich ziellos umher wie die beschriebenen einsamen Personen. Gleichzeitig jedoch wird das eher Subjektive der beiden ersten Strophen ersetzt durch eine geradezu erbarmungslose Objektivität in der dritten Strophe. Man fragt sich, wo der Herr dort geblieben ist. Er scheint aus Sicht des sprechenden Menschen in der herbstlich-winterlichen Zukunft keine Rolle mehr zu spielen. Jedenfalls kann er denjenigen offensichtlich nicht retten, der nicht frühzeitig vorgesorgt hat. In den Genuss des Rausches, hervorgerufen durch den in der zweiten Strophe erwähnten schweren Wein, kann derjenige nicht mehr kommen. Die dritte Strophe folgt insofern zusammenhanglos und isoliert auf die beiden anderen, als hier ausschließlich der negative Fall desjenigen geschildert wird, der die Früchte des Sommers aufgrund eigener Versäumnisse nicht genießen kann.
Das lyrische Ich ist also offensichtlich an diesem „Herbsttag“ geprägt von dem Gefühl, dass innerhalb kurzer Zeit noch viel zu geschehen habe, damit nicht am Ende alles zu spät und somit unwiderruflich verloren sei. Es steht im Hintergrund offenbar die Angst vor der Isolation von den Mitmenschen und vor einer Konfrontation mit einer in diesem Fall feindlich gesonnenen Natur. Möglicherweise, könnte man spekulieren, ist der mehrere Dimensionen umfassende Bruch innerhalb dieses Gedichts aber auch Ausdruck einer inneren Krise des Dichters selbst, dessen Zerrissenheit sich in der Spannung zwischen den ersten beiden Strophen und der letzten Ausdruck verschafft. Es könnte das Symptom einer Schaffenskrise sein, einer Suche nach einem neuen Ton, wie Rilke sie in den ab 1902 entstandenen „Neuen Gedichten“ finden sollte und der die so genannten „Dinggedichte“ prägte. Im Gedicht „Herbsttag“ drückt sich noch ein lyrisches Ich aus, das sich vor dem Thema, über das es sich äußert, stark zurücknimmt, das aber seine Beobachtungen noch nicht an einen einzigen konkreten Gegenstand bindet und auf diesen konzentriert, sondern das noch versucht, die eigene Stimmung im Spiegel einer weiter gefassten metaphorischen Naturdarstellung auszudrücken. So gesehen, tritt neben die dargestellte jahreszeitliche und historische Krisensituation eine dritte Ebene, die persönliche nämlich, die allerdings eben aufgrund der inneren Spannung nicht in eine einheitliche Form gebracht werden kann, weil die mehrdimensionale Zerrissenheit Symptom einer ebenso vielschichtigen Krisenerfahrung ist – einer Erfahrung, die vielleicht auch auf dem Gefühl beruht, dass der Glaube an den Herrn nicht mehr in unbegrenzter Weise Hoffnung und Zuversicht zu stiften vermag.
Jakob van Hoddis (1887-1942)
Weltende[12]
Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
In allen Lüften hallt es wie Geschrei.
Dachdecker stürzen ab und gehn entzwei
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut.
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken.
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen.
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken.
Rächende Raserei der gottlosen Natur
Wenn vom „Weltende“, also vom Ende der Welt, die Rede ist, so greift man zu kurz, wenn man sich mit Assoziationen wie Dekadenz, also Verfall, und Tod des einzelnen Menschen auseinandersetzt. „Weltende“ – das bedeutet den radikalen Schnitt, den Niedergang der gesamten Schöpfung und damit auch den Untergang der Menschheit, die bekanntlich nur ein Teil der Schöpfung ist. Anders formuliert: „Weltende“ – das bedeutet das Erreichen der letztmöglichen Grenze. Was dahinter liegt, entzieht sich unserer Kenntnis. Unserem Verständnis entzieht sich möglicherweise auch die Ursache der Katastrophe. Denn würden wir sie kennen, könnten wir das Ende der Welt vielleicht noch hinauszögern.
Die Vorstellung von einem Ende, also Untergang, der Welt hat die unterschiedlichsten Kulturen in unterschiedlichsten Epochen umgetrieben und fasziniert. Dabei rührt die Faszination wohl vor allem daher, dass das Ende der Welt zu denken, bedeutet, das Undenkbare zu denken. Es fehlt nämlich den Menschen jeglicher Bezugspunkt, der auf individueller oder kollektiver Erfahrung gründen würde. Die Faszination ist außerdem besonders ausgeprägt, wenn die eigene Gegenwart als nicht mehr akzeptabel, ja vielleicht sogar als dem Untergange geweiht angesehen wird.
Besonders ausgeprägt war dieses Gefühl in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Die bestehende, stark hierarchisch geprägte gesellschaftliche Ordnung wurde als nicht mehr hinnehmbar erkannt, und man erwartete das Aufbrausen eines gewaltigen Sturms, der das Morbide für immer dahinfegen würde. Künstler und Intellektuelle, die dieses Gefühl literarisch oder plastisch zur Darstellung brachten, gehörten einer kleinen Gruppe avantgardistischer Künstler an, die gleichwohl in weiten Teilen Europas parallel zueinander wirkten – ob es nun die italienischen Vertreter des futurismo waren oder eben die deutschsprachigen Expressionisten. Sie waren gleichermaßen Analytiker der bestehenden Wirklichkeit ihrer Zeit und Propheten des Untergangs.
Geradezu prototypisch für die skizzierte Thematik und deren Gestaltung in der Literatur ist das berühmte Gedicht „Weltende“ von Jakob van Hoddis aus dem Jahre 1911. Das Gedicht besteht aus zwei Strophen zu je vier Versen. Deren Enden reimen sich in der ersten Strophe nach dem Schema des umarmenden Reims, in der zweiten Strophe nach dem Kreuzreim. Die Kadenzen der Versenden sind in der ersten Strophe allesamt männlich, in der zweiten Strophe weiblich. Von strophenübergreifender Gültigkeit ist das verwendete Metrum, der fünfhebige Jambus. Alle Verse der ersten Strophe umfassen zehn, alle Verse der zweiten Strophe elf Silben. Der formale Bau des Gedichts ist also geprägt von Gleichmaß und Harmonie und kann als konventionell bezeichnet werden. Dies mag, bezieht man den Titel des Gedichts mit ein in die Überlegungen, den Rezipienten zunächst einmal überraschen, denn das Thema des Gedichts ist keineswegs ein konventionelles, geht es doch – wie bereits erläutert – um das Neue schlechthin.
Es stellt sich somit die Frage, wie dieses Neue inhaltlich und sprachlich dargestellt wird. In der ersten Strophe geht es zunächst einmal darum, dass dem Bürger der Hut vom Kopf fliegt und dass offenbar Lärm zu hören ist. Ja, schlimmer noch: Dachdecker stürzen von den Dächern und sterben, während zu lesen ist, dass an den Küsten die Flut steige. In der zweiten Strophe wird die Intensität des Erlebens gesteigert. Von einem Sturm ist die Rede, der das Meer aufpeitscht und für eine Katastrophe an den Küsten sorgt. Sogar „Eisenbahnen fallen von den Brücken“ (Vers 8), es handelt sich demnach um eine veritable Natur-katastrophe. Verglichen damit, scheinen die Menschen noch glimpflich davonzukommen, leiden doch die meisten von ihnen (lediglich) an einem Schnupfen.
Schon der Versuch, den Inhalt des Gedichts wiederzugeben, zeigt, dass hier viele unterschiedliche Symptome einer Unwetter-Katastrophe aneinander gereiht werden. Von einem inhaltlich wirklich kohärenten Text kann folglich nicht die Rede sein; es fehlt gewissermaßen der logische Zusammenhang zwischen den Sätzen. Es liegt nahe, sich einmal genauer mit der Syntax zu befassen. In der ersten Strophe fällt auf, dass jeder Vers identisch ist mit einem in sich geschlossenen Hauptsatz. Die vier Subjekte dieser Sätze lauten „Hut“, „es“, „Dachdecker“ und „Flut“; sie stehen in keinerlei Zusammenhang zueinander. Der parenthetische Einschub „liest man“ (Vers 4) könnte als fünfter Hauptsatz aufgefasst werden, dann lautete das fünfte Subjekt dieser Strophe „man“; am Befund des fehlenden Bezugs zwischen den Subjekten würde sich jedoch nichts ändern.
Zu Beginn der zweiten Strophe wird diese eindeutige Zuordnung unterbrochen. Der fünfte Vers des Gedichts nämlich enthält einen kurzen, aber vollständigen Hauptsatz sowie den Beginn eines zweiten, der im folgenden Vers zu Ende geführt wird, was durch ein Enjambement bewirkt wird. Dieser zweite Hauptsatz zieht einen erweiterten Infinitiv nach sich, dessen Ende mit dem Schluss des sechsten Verses zusammenfällt. Die letzten beiden Verse sind wiederum identisch mit je einem Hauptsatz. Alles in allem ist die Syntax also eindeutig parataktisch geprägt; die Aussagen sind für sich genommen allesamt klar verständlich. Doch ein Blick auf die Subjekte der zweiten Strophe („Sturm“, „Meere“, „Menschen“, „Eisenbahnen“) und deren Bezüge zueinander bringt keine neuen Eindrücke im Vergleich zur ersten Strophe; es fehlt ein übergeordneter Sinnzusammenhang. Das „Weltende“ bedeutet demnach wohl zugleich das Ende des Sinns.
Die Untersuchung der Syntax und der grammatikalischen Subjekte bringt aber auch zum Vorschein, dass es sich um eine umfassende Zerstörung zu handeln scheint; es sind sowohl die Natur daran beteiligt als auch die Menschen sowie die Erzeugnisse der modernen Industrie. Die inhaltliche und sprachliche Analyse vermag nun, indem sie sich unter anderem mit der Frage nach der Art des Verhältnisses zwischen Natur, Mensch und Industrie befasst, zu zeigen, in welcher Weise der Text das Weltende beschreibt, ob es Ansätze zu einer Ursachenanalyse gibt und wie dieses Gedicht literarhistorisch und ideengeschichtlich in den jeweiligen Kontext eingeordnet werden kann.
Zunächst einmal wird im ersten Vers dargestellt, dass dem Bürger der Hut vom Kopf fliege. Der Hut steht dabei sicherlich als Insignie des Bürgertums für eine bestimmte gesellschaftliche Schicht, die zu einigem Wohlstand gelangt ist. Dass dieses Symbol des Besitzes und des gesellschaftlichen Ansehens dem Bürger vom Kopf fliegt, deutet bereits unmissverständlich an, dass die Gesellschaftspyramide in ihrer Existenz gefährdet ist. Die Verwendung des bestimmten Artikel könnte auf einen ganz bestimmten Bürger hindeuten, doch im vorliegenden Kontext scheint es angemessener, von einem typisierten, stilisierten Bürger auszugehen; dem Bürgertum als solchen scheint der Besitz abhanden zu kommen; ein gesellschaftlicher Umbruch steht also bevor. Das Adjektiv „spitz“ beschreibt die Form des Kopfes, meint aber wohl zugleich die Intellektualität der betroffenen Personengruppe. Eine kognitiv-rational vorgehende Gesellschaftsschicht wird hier offenbar in ihrer Verletzbarkeit angesprochen. Das „Geschrei“ (Vers 2), von dem in der Folge die Rede ist, könnte von diesen Bürgern ausgehen, doch letztlich muss dies offenbleiben, da das Subjekt des Satzes – wie bereits erwähnt – unbestimmt ist („es“, Vers 2). Zudem handelt es sich hier um einen Vergleich, was bedeutet, dass das, was „In allen Lüften hallt“ (Vers 2), auch ein ganz anderes Geräusch sein kann, beispielsweise der schlichte Luftzug jenes Sturms, der dem Bürger den Hut vom Kopf fegt. Doch bereits diesen Bezug zwischen den beiden Versen muss der Leser herstellen; durch den Text selbst wird er nicht explizit erzeugt. Das Nomen „Geschrei“ deutet allerdings relativ klar auf Wehklagen hin, insofern könnte man von der sich steigernden Darstellung einer Krise sprechen. Dies wird im dritten Vers denn auch bestätigt. Denn dass Dachdecker abstürzen, bedeutet deren Tod. Allerdings stellt sich keine Trauer ein, was vor allem daran liegt, dass diese Arbeiter verdinglicht werden (sie „gehn entzwei“, Vers 3). Das ganze scheint sich im Landesinneren abzuspielen, denn was an der Küste geschieht, erfahren die Menschen offenbar nur indirekt („liest man“, Vers 4). Der des Lesens Mächtige – auch die Zeitung kann sicherlich als Gegenstand dem Bürgertum zugeordnet werden – steht demnach in eigentümlicher Distanz zum Geschehen; möglicherweise hat er noch nicht begriffen, was geschieht, vielleicht will er auch die Augen davor verschließen. Doch auch wenn es nur medial vermittelte Wirklichkeit ist, gibt es Anlass zur Beunruhigung, denn „an den Küsten […] steigt die Flut“ (Vers 4), das Wasser schickt sich also an, das Land zu verschlingen – und mit ihm die Menschen. Soweit ist es allerdings noch nicht, nur der Rekurs auf den Titel legitimiert eine solch pessimistische Sichtweise, gleichwohl geben ja auch die in den ersten drei Versen geschilderten Vorgänge nicht eben Anlass zu Gelassenheit. Die bereits erwähnte Klarheit der Sprache steht in eigentümlichem Kontrast zu dem doch recht chaotischen Treiben, zumal die Katastrophe weite Teile der Bevölkerung zu betreffen scheint und sich auch räumlich stark ausgebreitet hat.
In der zweiten Strophe wird der Eindruck des Chaotischen weiter verstärkt, zudem ist die Möglichkeit, vor dem Treiben die Augen zu verschließen, nicht mehr existent. Schon der erste prägnante Satz „Der Sturm ist da“ macht es unmissverständlich klar: Die Naturkatastrophe ist im Hier und Jetzt angekommen. Nicht mehr nur als mediale Vorahnung oder Warnung, sondern als reale, wahrnehmbare Tatsache. Der Mensch hat die Kontrolle über die Natur, sofern er sie denn jemals besessen hat, verloren. Dies wird schon sprachlich deutlich, da „die wilden Meere“ (Vers 5) in Form einer Personifikation angesprochen werden. Das Adjektiv „wild“ ist hier in seiner Bedeutung mit „unbezähmbar“ und „unkontrollierbar“ gleichzusetzen. Das Verb „hupfen“ wirkt verharmlosend, und die Diskrepanz zwischen Ton und Inhalt ist hier als Ironie aufzufassen. Das Meer nimmt sich das Land zurück, es fordert quasi seinen ehemaligen Raum wieder ein. Dabei lässt es sich auch von den von Menschenhand geschaffenen Dämmen nicht aufhalten (vgl. Vers 6), sondern es zerdrückt diese (Vers 6). Der Sturm fegt also nicht nur die bestehende Gesellschaftsordnung hinweg, sondern er bewirkt auch den vollständigen Untergang des Landes, das sich die Menschen erschlossen haben.
In geradezu lächerlichem Verhältnis zu den beschriebenen Vorgängen steht die Wahrnehmung der „meisten Menschen“ (Vers 7), die „einen Schnupfen“ (ebd.) haben. Sie sind also nur mit sich selbst und ihren Alltagsproblemen beschäftigt, ohne die heraufziehenden Gefahren zu erkennen. Zudem sind sie offensichtlich verweichlicht und haben sie sich von der Natur geistig entfremdet. Zwar sind sie aufgrund ihrer technischen Intelligenz in der Lage, Gebäude und Deiche zu bauen, doch ihre natürliche Umgebung nehmen sie nicht richtig wahr, und sie leiden letztlich an dieser fehlenden Wahrnehmung. Selbst die Eisenbahnen, die zu dieser Zeit modernsten und effektivsten Transport- und Verkehrsmittel, „fallen von den Brücken“ (Vers 8), können also den Naturgewalten nicht standhalten. Sowohl die Eisenbahnen als auch die Brücken sind vom Menschen geschaffen worden, doch sie haben keinen Bestand. Der technische Fortschritt und seine Errungenschaften sind bedeutungslos angesichts der sich anbahnenden und gerade ablaufenden Katastrophe. An dieser Stelle endet das Gedicht abrupt. Dies ist zum einen damit zu erklären, dass jeder weitere Vers nur ein weiteres Beispiel für das bereits Dargestellte liefern könnte. Zum anderen ist aber auch denkbar, dass am Ende auch das Schreiben und Dichten selbst dem Untergang geweiht ist. Angesichts der stattfindenden Naturkatastrophe ist es obsolet geworden zu schreiben; die gesamte Kultur wird von der Natur hinweggefegt; der Mensch und seine Erzeugnisse haben keinen Bestand mehr.
Es ist geradezu die Umkehrung der biblischen Schöpfungsgeschichte, die hier dargestellt wird – das Verb „erzählt“ wäre unpassend. Dabei ist die Darstellung selbst bereits Ergebnis dessen, was beschrieben wird, denn es wird nichts kohärent in Zusammenhängen geschildert, sondern es werden quasi einzelne Schlaglichter auf das „Weltende“ geworfen. Alles andere würde nämlich bedeuten, dass einer den Überblick über das bewahren könnte, was hier vor sich geht, und diese Möglichkeit wird negiert. Es gibt keine ordnende Instanz, die über allem steht, es gibt somit auch keinen Gott. Ob dieser Zustand die Folge der Naturvergessenheit und Technikbesessenheit der Menschen ist, wird nicht ausdrücklich gesagt, doch es liegt nahe. Nicht zufällig ist bereits im ersten Vers auf den Kopf, also die Rationalität der Menschen, angespielt worden, und diese vermag die Bürger nicht vor dem Untergang zu retten. Der Sturm könnte also als Rache der Natur angesehen werden, und zwar als eine unerbittliche, erbarmungslose Rache, die die Welt ins Chaos stürzt. Am Ende der Welt steht die Raserei, die jeglichen Sinns entbehrt – zumindest ist dieser dem Menschen nicht ersichtlich.
Auch dem Pantheismus wird im vorliegenden Gedicht eine klare Absage erteilt; Gott ist weder über noch in der Natur zu erkennen; er ist sozusagen die Leerstelle, die vom Text nicht gefüllt wird. Das syntaktisch konstatierte Fehlen eines übergeordneten Sinns entspricht also dem Fehlen einer übergeordneten (göttlichen) Instanz. Folglich sind die Menschen und ihre Erzeugnisse der Gewalt der Natur hilflos ausgeliefert. Das Machtverhältnis zwischen Natur und Mensch ist abschließend geklärt; für letzteren ist das Ende der Welt gekommen. Was fehlt, ist der Entwurf einer besseren Zukunft – sei es mit den oder ohne die Menschen. Fest steht also aus Sicht des Textes, dass ein umfassender Umbruch bevorsteht bzw. bereits im Gange ist, doch wohin er führt, wird nicht thematisiert – auch insofern handelt es sich um ein abruptes Ende des Gedichts. Der Titel des Gedichts ist Programm – es geht um das „Weltende“, also um das Ende schlechthin.
Was bleibt, ist die Raserei einer gottlosen (oder entgötterten) Natur im Geiste einer Rache am Menschen. Es besteht ein Riss zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, der zu einer Spannung führt, die sich unter anderem im Verhältnis zwischen Form und Inhalt des Gedichts widerspiegelt: Die traditionelle, konventionelle Form des Gedichts steht im Kontrast zur verwendeten Sprache und dem dargestellten Inhalt; es fehlt möglicherweise (noch) an einer geeigneten Darstellungsweise des auch für den avantgardistischen Künstler Unbegreiflichen.
III. Mensch und Natur
Die Natur ist der ursprüngliche Lebens- und Erfahrungsraum des Menschen, und insofern kann es nicht überraschen, dass sie eines der zentralen Themen der Literatur überhaupt ist. Gerade in der Lyrik nimmt sie über die Jahrhunderte hinweg einen breiten Raum ein. Bezogen auf die deutschsprachige Literaturgeschichte, kann man sagen, dass die Natur ab dem 18. Jahrhundert zum zentralen Gegenstand lyrischer Texte wird. Dies hängt damit zusammen, dass sich in der Aufklärung das Subjekt ins Verhältnis zu seiner Umwelt setzt, um die eigene Identität zu definieren – die Auseinandersetzung mit Natur und Gesellschaft wird zu einem gedanklichen Prozess, der nicht zuletzt über die künstlerische Gestaltung subjektiver Eindrücke seinen Ausdruck findet. Es geht also so gut wie nie um eine rein positivistische Beschreibung der Natur, sondern deren Wahrnehmung ist immer verbunden mit der Frage nach dem Verhältnis zwischen Subjekt und Lebensraum. Die Sicht auf die Natur wandelt sich im Laufe der Epochen also ebenso wie die literarische Darstellung und die Funktion für das sich aussprechende Ich. Zur Zeit der Empfindsamkeit und des Sturm und Drangs dient die Natur häufig als Spiegel der menschlichen Seele; sie wird zur Projektionsfläche von Ängsten und Wünschen eines Individuums, dessen momentane Stimmungslage jeweils spürbar wird. Häufig spiegeln sich in der Wahrnehmung der Umgebung die Sicht des lyrischen Ichs auf sich selbst und die eigene Entwicklung. Die Jahreszeiten werden zu Metaphern für bestimmte Lebensabschnitte, wie der natürliche Kreislauf des Lebens zum Bild für Werden und Vergehen des Einzelnen wird. So ist verständlich, warum Naturgedichte häufig auch Liebesgedichte sind – und umgekehrt. Ab der Romantik wird die Natur immer häufiger der Stadt gegenüber gestellt und damit buchstäblich zur personifizierten Kehrseite des zivilisatorischen Fortschritts. Dabei wird dem Bewusstsein Ausdruck verliehen, dass der Mensch trotz aller technischen Errungen-schaften Teil der Natur ist, ihr also letztlich ausgeliefert bleibt. Ängste und unbefriedigte Bedürfnisse, die sich im Unbewussten angesammelt haben, kehren wieder, häufig in der Nacht, in der der Mensch zur Ruhe kommt. Der Mond wird zum Symbol der Sehnsucht und des Unerreichbaren, der Wald zum Symbol des Lebensraums, der sich dem Zivilisierungs-prozess (noch) entzieht und somit gleichermaßen als Rückzugsort wie als rätselhafte Bedrohung angesehen werden kann. Die Entzauberung der Natur wird nun immer stärker in den Vordergrund gerückt bis in die Lyrik des späten zwanzigsten Jahrhunderts. Damit einher geht die Säkularisierung: Die Natur wird zum entgötterten Raum, ihr unmittelbares Erleben ist nur noch als elegische Erinnerung darstellbar. In modernen Naturgedichten werden romantische Motive häufig nur noch zitiert, ja parodiert: Die Hoffnungen und Sehnsüchte jener Zeit werden als illusorisch und nicht mehr haltbar dargestellt.
Ludwig Christoph Heinrich Hölty (1748-1776)
Die Mainacht
Wenn der[13] silberne Mond durch die Gesträuche blickt
Und sein schlummerndes Licht über den Rasen geußt
Und die Nachtigall flötet,
Wandl’ ich traurig von Busch zu Busch.
Selig preis ich dich dann, flötende Nachtigall,
Weil dein Weibchen mit dir wohnet in einem Nest,
Ihrem singenden Gatten
Tausend trauliche Küsse gibt.
Überschattet von Laub, girret ein Taubenpaar
Sein Entzücken mir vor; aber ich wende mich,
Suche dunkle Gesträuche,
Und die einsame Träne rinnt.
Wann, o lächelndes Bild, welches wie Morgenrot
Durch die Seele mir strahlt, find ich auf Erden dich?
Und die einsame Träne
Bebt mir heißer die Wang herab.
Larmoyante Abschottung des einsamen Subjekts
In unzähligen Gedichten schildert ein lyrisches Ich die Schönheit der Natur. Häufig ist dabei vom Frühling die Rede, und fast immer wird dieser Jahreszeit metaphorisch das blühende Leben schlechthin zugewiesen. Oftmals entspricht dabei die Stimmung des lyrischen Ichs der äußeren bunten Vielfalt, und es lässt sich dann von Gedicht zu Gedicht die Frage, was worauf einen Einfluss ausübt – die Natur auf die Stimmungslage des Menschen oder die Gefühle des Ichs auf die Wahrnehmung der Natur – stellen und jeweils unterschiedlich beantworten.
Im vorliegenden Gedicht „Die Mainacht“ von Ludwig Christoph Heinrich Hölty, das sich der literarischen Stilrichtung der Empfindsamkeit zuordnen lässt, ist das anders. Dort wird beschrieben, wie einsam sich ein Mensch inmitten der auflebenden Natur fühlen kann.
Das Gedicht besteht aus vier Strophen zu jeweils vier Versen. In der ersten Strophe wird die idyllische Atmosphäre eines nächtlichen Waldes geschildert, in der sich das lyrische Ich traurig „von Busch zu Busch“ (Vers 4) fortbewegt. Es folgt ein Lobpreis der flötenden Nachtigall (vgl. Vers 5), deren Weibchen ihr „Tausend trauliche Küsse“ (Vers 8) im heimischen Nest gebe. Auch ein Taubenpaar ist Teil der beschriebenen Natur, doch gleichzeitig schlägt die Stimmung erneut ins Negative; das lyrische Ich sucht die Einsamkeit und weint. In der vierten und letzten Strophe schließlich wird von der konkreten Wahrnehmung abstrahiert. Es wird die Frage gestellt, wann denn endlich jenes lächelnde Bild (vgl. Vers 13) erscheine, das die Seele des Naturbetrachters erleuchten würde. Da die Sehnsucht sich einstweilen nicht erfüllt, steigert sich das Gefühl der Traurigkeit noch.
Ein wenig erbaulicher Gedicht-Inhalt, wie es scheint. Es wird ein Beispiel dafür geliefert, dass jemand sich inmitten freudiger Wesen befinden und gleichzeitig sehr unglücklich sein kann – anders gesagt: Man kann sich einsam fühlen, ohne alleine zu sein.
Der erste Teil der ersten Strophe ist geprägt von einem dreiteiligen Temporalsatz, in dem die Natur mithilfe mehrerer Personifikationen beschrieben wird. Der „silberne Mond“ (Vers 1), häufig ein Symbol der Sehnsucht, gießt „schlummerndes Licht über den Rasen“ (Vers 2). Die nächtliche Dunkelheit wird also nicht absolut gesetzt; „die Gesträuche“ (Vers 1) werden vom Mond durchdrungen. Dieser sieht offenbar, was geschieht. Die im Titel bereits erwähnte „Mainacht“ ist eine Nacht der Stille; selbst das Licht scheint zu schlafen. Dadurch, dass das Licht zugleich mit einer Flüssigkeit – naheliegend ist sicherlich Wasser – verglichen wird, könnte man sagen, dass dieses Licht Leben spendet. Die Natur schläft, doch sie ist nicht tot; von den beiden Söhnen der Nacht, Hypnos und Thanatos, ist offenbar nur der Erstgenannte anwesend. Dies wird denn auch schon im folgenden Vers bestätigt, denn „die Nachtigall flötet“. Es ist also Musik zu hören; die Schönheit der Natur ist mit mehreren Sinnen wahrnehmbar.
Inmitten dieser geradezu paradiesischen Umgebung – man kann von einem locus amoenus sprechen – befindet sich eine einzelne traurige Person, deren Isolation schon durch das Personalpronomen „ich“ hervorgehoben wird. Dass sie „von Busch zu Busch“ (Vers 4) wandelt, zeigt, dass sie offenbar dieser Atmosphäre nicht viel Positives abgewinnen kann. Was zwischen den Büschen zu sehen ist, wird jedenfalls nicht beschrieben. Das Verb „wandeln“ deutet darauf hin, dass sich diese Person langsam und nicht eben dynamisch fortbewegt. Der Gegensatz zwischen Natur und Individuum wird durch die syntaktische Struktur der Strophe untermauert; der Hauptsatz steht dem dreiteiligen Temporalsatz unversöhnlich gegenüber. Es findet keinerlei Interaktion zwischen Mensch und Natur statt.
Die Konjunktion „Wenn“ aus dem ersten Vers wird gleich zu Beginn der zweiten Strophe aufgegriffen („dann“, Vers 5); es wird eine logische Verklammerung beider Strophen erkennbar. Dabei scheint sich die Stimmung des lyrischen Ichs zunächst zu verbessern („Selig“, Vers 5); offenbar springt quasi ein Funke auf das Individuum über. Jedenfalls wird beschrieben, warum das lyrische Ich die „flötende Nachtigall“ (Vers 5) preist, nämlich weil sie ein Weibchen habe, das ihr Küsse gebe. Wiederum prägen also zahlreiche Personifikationen das Bild. Das Ich stellt sich vor, es handle sich um ein Nachtigallenpärchen, das zusammen „in einem Nest“ (Vers 6) wohne. Eingedenk des Inhalts der ersten Strophe kann konstatiert werden, dass ein einsames Ich seine eigenen Sehnsüchte auf die Natur projiziert, hier auf die Tierwelt, nämlich zwei Nachtigallen. Die beiden leben in Harmonie miteinander, und es fällt auf, dass die singende Nachtigall ein Geschlecht hat, sie ist nämlich männlich (vgl. Vers 7). So, wie das lyrische Ich sein Klagelied über die eigene Einsamkeit singt, singt ein Nachtigallen-Gatte seiner Gattin ein (Liebes-)Lied; es liegt nahe, dass die „Tausend trauliche[n] Küsse“ (Vers 8) die Belohnung für den Gesang sind. Dabei ruft das Adjektiv „traulich“ die Assoziation „Geborgenheit“, „Sicherheit“ hervor, die ja auch zum Bild des Nests passt. Die beiden Nachtigallen führen das Leben, das sich das klagende, einsame Ich zu leben wünscht.
Diese Naturbeschreibung setzt sich zunächst in der dritten Strophe fort. Wenn auch das Partizip „Überschattet“ (Vers 9) im vorliegenden Kontext eher negative Konnotationen nach sich zieht, bleibt es dabei, dass die Tierwelt das positive Vorbild für die Menschen darstellt. Diesmal ist es „ein Taubenpaar“ (Vers 9), das girrend unter dem Laub sitzt. Wieder wird eine Atmosphäre der Geborgenheit kreiert, wieder wird vor Freude gesungen. Diesmal wenden sich die Vögel sogar direkt an das Ich, denn sie girren ihm ihr „Entzücken […] vor“ (Vers 10). Doch plötzlich schlägt die Stimmung wieder um – ähnlich wie schon im ersten Vers. Gerade angesichts dieses gemeinsamen Glücks wendet sich das lyrische Ich ab, ja es sucht sogar die Einsamkeit der „dunkle[n] Gesträuche“ (Vers 11). Offensichtlich ist diese Person also nicht willens oder nicht in der Lage, mit der Außenwelt zu kommunizieren und schottet sich bewusst ab: Sie will mit ihrem Gefühl der Einsamkeit allein sein und flieht geradezu aus dem Licht des Mondes ins Dunkel des Schattens. „Die einsame Träne rinnt“ (Vers 12), sie führt also ein Eigenleben und nimmt gar die Gefühlslage des lyrischen Ichs an. Für einen Moment ist das menschliche Subjekt ausgelöscht, zumindest aus grammatikalischer Sicht. Es hat sich im Dunkel versteckt und ist für den Mond nicht mehr sichtbar, quasi nicht mehr existent.
Es scheint, als könne die Isolation und Einsamkeit dieses Menschen nicht weiter gesteigert werden – und in der Tat: Die vierte Strophe bringt etwas Neues. Es wird angedeutet, woher die Traurigkeit des Ichs kommen könnte, denn dieses sucht offenbar ein „lächelndes Bild“ (Vers 13), das die Nacht der Trauer beenden könnte. Der Vergleich „wie Morgenrot“ (Vers 13) macht deutlich, dass diese „Mainacht“ eben keine Nacht des Lebens, sondern eine Nacht des Todes, der Hoffnungslosigkeit, der Trennung ist. Die Morgenröte brächte Licht in die Seele dieses Menschen (vgl. Vers 14). Doch die Formulierung „auf Erden“ deutet an, dass sich die Sehnsucht auf das Jenseits zu beziehen scheint. Möglicherweise hat das Ich seine Geliebte verloren, ist diese gestorben und die Einsamkeit die Folge dieses nicht zu kompensierenden Verlustes. Er wiegt so schwer, dass er auch durch die irdische Schönheit der Natur nicht beglichen werden kann und dass er eine nicht überschreitbare Grenze zwischen Mensch und Natur zieht. Dieses Individuum befindet sich also zwischen dem Reich des Lebens und dem Reich der Toten. Genau dieses Gefühl der Isolation drückt sich denn auch in der weiter gesteigerten Darstellung der Trauer aus, wie der Komparativ „heißer“ (Vers 16) verdeutlicht. Am Ende des Gedichts gibt es keinen Hoffnungsschimmer; diese Mainacht ist für das lyrische Ich so dunkel, dass das „schlummernde“ Mondlicht nicht ausreicht, um die Lage zu ändern.
Auffällig und paradox ist an diesem Gedicht, dass die Nacht durchaus in ihrer Schönheit beschrieben wird, dass sich das lyrische Ich an eben dieser Schönheit jedoch nicht erfreuen kann. Natur und Ich klaffen auseinander. Man könnte auch sagen, dass es dem empfindsamen Subjekt nicht möglich ist, die Umwelt unbefangen wahrzunehmen, weil der Schmerz im eigenen Inneren zu stark ist. Auf diese Weise gerät das Ich in den Mittelpunkt der Darstellung, was durchaus einen Bezug zum literarhistorischen Kontext des 18. Jahrhunderts herstellt. Die Gefühle eines Individuums entsprechen nicht der Umgebung und verlieren dennoch nicht an Gültigkeit oder Bedeutung. Allerdings fehlt der Schritt heraus aus der Einsamkeit, der beispielsweise im Sturm und Drang, erst recht aber in der Romantik vollzogen wird: Es gibt keine Utopie und auch keine Kraft wie die Einbildungskraft, also die Phantasie, die den ersehnten Zustand in die irdische Welt, in die Immanenz, integrieren könnte. Auch eine Hinwendung zur Gesellschaft oder zu einem menschlichen Du findet noch nicht statt. Erst wird eine flötende Nachtigall mit „du“ angesprochen (vgl. Vers 1f.), dann ein nicht näher bestimmtes „lächelndes Bild“ (Vers 13). Aber das konkrete Bild der Geliebten findet noch keinen Eingang in die sprachliche Darstellung – geschweige denn die Geliebte selbst. So bleibt eine gewisse Anonymität bestehen, die aber zur Stimmung nicht so recht passen will. Bezeichnender Weise trägt das Gedicht den unpersönlichen Titel „Die Mainacht“, der zwar einerseits eine bestimmte Nacht nennt, aber andererseits recht vage bleibt. Das konkrete Leben wird nicht in das Gedicht integriert, sondern es geht lediglich um Projektionen des empfindenden Ichs.
Dazu passt auch die Form des Gedichts. Die Versenden reimen sich nicht, was jedem Vers eine geradezu moderne Individualität zu verleihen scheint, doch der Rhythmus ist gleich bleibend, ja bei genauem Hinsehen kann von einer starren Form gesprochen werden. Die ersten beiden Verse jeder Strophe umfassen jeweils zwölf Silben, die dritten Verse jeder Strophe sieben und die vierten Verse acht. Auch die Betonungen sind, wenn man jeweils die ersten, zweiten, dritten und vierten Verse miteinander vergleicht, jeweils identisch verteilt. Von einem einheitlichen Metrum kann man nicht sprechen, die Verse sind von Trochäen und Daktylen geprägt. Dabei liegt jeweils in der Mitte der beiden ersten Verse jeder Strophe eine Zäsur vor, die dadurch entsteht, dass dort zwei betonte Silben unmittelbar aufeinander folgen. Ist diese metrische Form auch eigenwillig, so ist aufgrund des starren Rhythmus’ bezogen auf einen Vergleich zwischen den Strophen festzuhalten, dass sich der spontane, oberflächlich erzeugte Eindruck der Individualität durch eine genauere Betrachtung nicht bestätigt – ebenso wenig, wie das lyrische Ich als autonom handelndes Individuum auftritt. Wie die Einzigartigkeit jedes Verses durch das starre Metrum verloren geht, verliert sich die Individualität des klagenden lyrischen Ichs hinter jenen Büschen, hinter denen dieses sich vor dem Licht der Umwelt versteckt. Insofern ist es auch sicherlich nicht völlig abwegig, von einem larmoyanten Ich zu sprechen. In diesem Gedicht werden die Grenzziehung, die Abschottung, der Rückzug in die Einsamkeit besungen, nicht aber der Versuch einer Grenzüberschreitung eines autonom handelnden Individuums.
Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803)
Die Sommernacht[14]
Wenn der Schimmer von dem Monde nun herab
In die Wälder sich ergießt, und Gerüche
Mit den Düften von der Linde
In den Kühlungen wehn;
So umschatten mich Gedanken an das Grab
Der Geliebten, und ich seh in dem Walde
Nur es dämmern, und es weht mir
Von der Blüte nicht her.
Ich genoß einst, o ihr Toten, es mit euch!
Wie umwehten uns der Duft und die Kühlung,
wie verschönt warst von dem Monde,
Du o schöne Natur!
Elegische Naturbetrachtung
Wenn ein Gedicht den Titel „Die Sommernacht“ trägt, so assoziieren wohl die meisten Leser positive Sinneswahrnehmungen. Von einem lauwarmen Luftzug könnte die Rede sein oder von Menschen, die die Nacht im Freien verbringen, sich vielleicht von der Hitze des Tages erholen und möglicherweise auf einer Wiese liegend den Sternenhimmel betrachten.
Auf die vorliegende Ode von Klopstock treffen diese Hypothesen bezüglich des Inhalts nicht zu. Zwar wird die Schönheit der Natur beschrieben, doch die Atmosphäre wird in erster Linie geprägt vom Verlustschmerz des lyrischen Ichs, das in Folge der inneren Einsamkeit die schöne Natur nicht ungebrochen wahrnehmen kann; äußere Harmonie und innere Zerrissenheit können nicht miteinander in Einklang gebracht werden.
Die Ode besteht aus drei Strophen zu jeweils vier Versen. In der ersten Strophe wird in einem mehrteiligen Temporalsatz wird geschildert, dass die nächtliche Atmosphäre in den Wäldern mit mehreren Sinnen wahrgenommen wird. Der Mond spendet kärgliches Licht, die Düfte der Bäume sind zu riechen, weil sie sich durch den Wind, der zudem über den Tastsinn wahrnehmbar ist, im Wald ausbreiten können. Das Semikolon am Ende der Strophe zeigt an, dass der Satz grammatikalisch nicht beendet ist; er findet seine Fortsetzung in der nächsten Strophe. Hier wird die idyllische Atmosphäre zurückgenommen, denn es geht um die Trauer des lyrischen Ichs, das an geliebte, verstorbene Menschen denkt und den Luftzug offenbar aus diesem Grunde nicht spürt. Die dritte Strophe richtet sich in die Vergangenheit und stellt dar, dass das lyrische Ich einst gemeinsam mit den nun Verstorbenen die Natur hat genießen können. Das Gedicht wird also insgesamt von einem elegischen Grundton geprägt und stellt letztlich dar, wie die Wahrnehmung der äußeren Natur von unserem inneren Seelenzustand abhängig ist.
Wie bereits angedeutet, besteht die erste Strophe ausschließlich aus einem Temporalsatz, der seinerseits in zwei unterschiedlich lange Teile gegliedert ist. Die vorherrschende Bewegungsrichtung verläuft zunächst von oben nach unten. Der Mondesschimmer wird personifiziert und „ergießt“ (Vers 2) sich „herab / In die Wälder“ (Vers 1f.). Es handelt sich also nicht um eine stockdunkle Sommernacht, sondern der Mond ist als Lichtquelle sichtbar. Im zweiten Abschnitt dieses Teilsatzes ändert sich die Richtung von der Vertikalen in die Horizontale. Die Linde – offenbar ist eine bestimmte gemeint – verströmt Düfte (vgl. Vers 3), die „in den Kühlungen wehn“ (Vers 4), was wohl so zu verstehen ist, dass die Luft, die die Gerüche transportiert, gleichzeitig kühlt, also als Kühlung spürbar ist. Menschen werden in dieser ersten Strophe nicht erwähnt; es geht einzig und allein um die Natur. Man könnte hier auch von einer Leerstelle sprechen, denn es muss ja jemanden geben, der die beschriebenen Sinneswahrnehmungen fühlt.
Die Tatsache, dass diese Naturbeschreibung innerhalb eines Nebensatzes abgehandelt wird, deutet bereits an, dass es eigentlich um anderes geht, und dieser Eindruck bestätigt sich denn auch in der zweiten Strophe. Schon deren erstes Wort „So“ (Vers 5) stellt den Bezug zum Beginn der Ode her und antwortet quasi auf die einleitende Konjunktion „Wenn“ (Vers 1). Die gesamte Atmosphäre ändert sich nun; die Gefühlslage des lyrischen Ichs wird in den Blick genommen. Das Verb „umschatten“ steht in einem gewissen Kontrast zum Schimmer des Mondes und legt nahe, dass die sprechende Person des Lichtes nicht teilhaftig werden kann – jedenfalls nicht im übertragenen, metaphorischen Sinne. Es wird auch sogleich klar, wie es dazu kommt, denn es beherrschen nunmehr die „Gedanken an das Grab / Der Geliebten“ (Vers 5f.) jenen Hauptsatz, der den Temporalsatz der ersten Strophe ergänzt. Dabei muss zunächst offen bleiben, ob es sich hier um eine Pluralform oder eine feminine Singularform handelt, ob es also um geliebte Menschen im allgemeinen Sinne geht oder um die verstorbene Geliebte. Fest steht, dass es sich hier um eine Totenklage handelt. Die Dominanz dieses Gefühls der Trauer wird sprachlich dadurch hervorgehoben, dass die Gedanken das Subjekt des Satzes bilden, während das lyrische Ich zunächst nur als Akkusativ-Objekt vorkommt. Es geschieht etwas mit ihm, es wird nämlich umschattet von seiner eigenen Trauer; es ist nicht Herr der Lage, kann seine Gedanken und Gefühle auch nicht steuern. Möglicherweise würde es gerne die Natur genießen, doch es will ihm nicht gelingen. Gerade dies hebt die Heftigkeit der Trauer weiter hervor. Der Kontrast zwischen erster und zweiter Strophe, zum Ausdruck kommend schon durch die Gegenüberstellung der Worte „Wenn“ und „So“ sowie der Teilsätze Temporalsatz und Hauptsatz und durch die Polarität zwischen Licht und Schatten, könnte kaum schärfer sein. Eine romantische Verschmelzung (man denke nur an die Verse „Wenn dann sich wieder Licht und Schatten / Zu ächter Klarheit wieder gatten“ von Novalis) findet hier gerade nicht statt, noch nicht einmal die Utopie einer solchen Vereinigung der Gegensätze wird entworfen. Es folgt der zweite Hauptsatz, der durch die nebenordnende Konjunktion „und“ mit dem ersten verbunden ist und in dem nun das lyrische Ich gleichzeitig das Subjekt ist. Wenn das Ich „in dem Walde / Nur es dämmern“ (Vers 6 f.) sieht, so wird zum einen ausgesagt, dass die übrigen Sinne offensichtlich nicht angesprochen werden. Die Dämmerung ist sichtbar, die Nacht beginnt offenbar gerade erst, oder sie neigt sich bereits dem Ende entgegen. Für ersteres spricht, dass das Adverb „nun“ im ersten Vers ebenso wie das Verb „ergießt“ eine gewisse Dynamik zum Ausdruck bringt und an den Beginn von etwas Neuem denken lässt. Diese Deutung geht jedoch nicht zwingend aus dem Text hervor. In jedem Fall nimmt das Ich das Licht als Dämmerung wahr, und damit wäre nicht der Mond, sondern die Sonne die Lichtquelle. Dieser Unterschied in der Wahrnehmung ist durchaus von Bedeutung, allerdings nicht leicht zu erklären. Denn der Mond steht häufig für die Sehnsucht, für das Unerreichbare, während die Sonne eher als Symbol des Lebens, der Wärme steht. Insofern wäre es bezüglich der Gefühlslage des Ichs näher liegend, wenn vom Mond die Rede wäre. Eine mögliche Erklärung könnte darin bestehen, dass es sich in der Tat um den Sonnenuntergang, also den Anbruch der Sommernacht, handeln würde, was dann als das Ende des Lebens und die Herrschaft des Todes verstanden werden könnte. Der dritte Hauptsatz scheint etwas klarer in seiner Bedeutung fassbar zu sein. Wieder ändert sich das grammatikalische Subjekt, das nunmehr vom unpersönlichen, neutralen Personalpronomen „es“ gebildet wird. Diesmal tritt das Ich als Dativ-Objekt auf, wenn die entsprechende Passage lautet: „und es weht mir / Von der Blüte nicht her“ (Vers 7 f.). Die Blüte kann hier sicherlich als Symbol des Lebens, der Fruchtbarkeit angesehen werden, und wenn das lyrische Ich den Geruch dieser Blüte nicht aufnehmen kann – schließlich wird nicht gesagt, dass kein solcher Duft ausströmt –, so wird damit zum Ausdruck gebracht, dass die klagende, trauernde Person von den eigenen Gefühlen und der Vergangenheit so umfangen ist, dass es die Gegenwart nicht in vollem Maße sinnlich erfahren kann.
Zum Beginn der dritten Strophe rückt das Ich für einen Moment ins Zentrum. Es habe „einst“ (Vers 9) gemeinsam mit den Toten, die hier direkt angesprochen werden, die Natur genossen (vgl. Vers 9). Damit scheint die Frage, wer mit den bzw. der Geliebten gemeint sein könnte, beantwortet zu sein. Wieder bleibt hier ein Eindruck des Vagen, Unbestimmten zurück, weil erneut von „es“ die Rede ist. Aber die emphatische Formulierung „o ihr Toten“ deutet an, dass es sich um ein sehr starkes Gefühl gehandelt haben muss. Der erste Vers – der einzige in dieser Ode, der identisch mit einem kompletten Satz ist – wird als Ausruf besonders hervorgehoben.
Es folgen zwei abschließende Hauptsätze, die anaphorisch mit „Wie“ beginnen und die Schönheit der Natur ein weiteres Mal emphatisch zum Ausdruck bringen, diesmal allerdings im Präteritum: Der besungene Zustand ist vorbei und für das lyrische Ich nicht wiederherstellbar. Zunächst werden Geruchs- und Tastsinn angesprochen und gleichzeitig die Gemeinschaftlichkeit der Wahrnehmung hervorgehoben, wobei das Wir, also die Gemeinschaft aus lyrischem Ich und den Verstorbenen, nicht das Subjekt bildet, sondern das Akkusativ-Objekt des Satzes. Im letzten Satz wird die Schönheit der Natur abschließend besungen, zugleich jedoch als nicht mehr wahrnehmbar beklagt, wobei der Mond die Natur noch „verschönt“ habe (vgl. Vers 11) – jene Natur, die ohnehin schon als „schön“ (vgl. Vers 12) angesehen wird. Die Interjektion „o“ (Vers 12) steigert die Emphase und wird selbst noch dadurch hervorgehoben, dass sie zwischen das Personalpronomen „Du“ und die „schöne Natur“ eingefügt wird. Die Umgebung wird nunmehr aufgrund des erfahrenen Verlustes anders wahrgenommen als in der als glücklich und harmonisch gepriesenen Vergangenheit. Ich und Natur verschmelzen gegenwärtig nicht miteinander, sondern das Ich betrachtet die Umwelt isoliert von dieser und grenzt sich damit weiter von ihr ab. Gleichzeitig besteht eine Grenze zwischen lyrischem Ich und den Geliebten, die gleichbedeutend ist mit der Grenze zwischen Immanenz und Transzendenz, Diesseits und Jenseits. Ob eine gemeinsame Existenz nach dem Tode in Aussicht gestellt werden kann, muss offen bleiben, zumindest legt der Text nichts dergleichen nahe. Bezeichnender Weise sind die vorkommenden Tempora ausschließlich das Präsens und das Präteritum; das Futur fehlt.
Die hohe Bedeutung, die der sensitiven Wahrnehmung zukommt, lässt eine Zuordnung der Ode zur Epoche der Empfindsamkeit zu. Ein lyrisches Ich spricht über seine Gefühle und schiebt die rationale Weltbetrachtung in den Hintergrund. Es fehlt jenes Element des Aufbegehrens gegen die bestehende Ordnung, die im Sturm und Drang häufig zu erkennen ist, dennoch durchweht, geistesgeschichtlich betrachtet, der Hauch des 18. Jahrhunderts das Gedicht. Das Individuum drückt sich und seine Gefühle aus und wird zum Subjekt der Darstellung. Zugleich muss jedoch festgehalten werden, dass, wenn auch der bestimmte Artikel „Die“ im Titel anderes andeutet, insgesamt der Eindruck des Vagen, Unbestimmten dominiert; die Individualität ist begrenzt. Dies spiegelt sich auch in der sehr strengen formalen Darstellung wider. Bis in die Silbenzahl hinein ist jeder einzelne Vers durchkomponiert; die beiden ersten Verse jeder Strophe umfassen jeweils 11, die dritten Verse jeweils 8 und die vierten Verse jeweils 6 Silben. Dass sich die Versenden nicht reimen, stellt gleichzeitig eines der Merkmale der Odenform dar. Die strenge Formgebung entspricht der eingeschränkten Individualität der inhaltlichen Darstellung, da das Gedicht dadurch nicht frei von einer gewissen Typisierung ist.
Alles in allem ist festzuhalten, dass es sich um ein elegisches Gedicht handelt, dessen Rückwärtsgewandtheit die Trauer des lyrischen Ichs besonders nachdrücklich zur Darstellung kommen und zugleich die Frage aufkommen lässt, ob sich das klagende Ich nicht zu sehr von seiner Umwelt, dem Hier und Jetzt, abkapselt. Anders gesagt: Es fehlt der Ansatz einer Versöhnung des Ichs mit dem gegenwärtig zu führenden Leben.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Aus dem Tagebuch der Reise in die Schweiz
15. Junius 1775, aufm Zürichersee.[15]
Ich saug’ an meiner Nabelschnur
Nun Nahrung aus der Welt.
Und herrlich rings ist die Natur,
Die mich am Busen hält.
Die Welle wieget unsern Kahn
Im Rudertakt hinauf,
Und Berge wolkenangetan
Entgegnen unserm Lauf.
Aug mein Aug, was sinkst du nieder?
Goldne Träume, kommt ihr wieder?
Weg, du Traum, so gold du bist,
Hier auch Lieb und Leben ist.
Auf der Welle blinken
Tausend schwebende Sterne,
Liebe Nebel trinken
Rings die türmende Ferne;
Morgenwind umflügelt
Die beschattete Bucht,
Und im See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.
Euphorische Lebensfahrt durch Mutter Natur zur Selbsterkenntnis
Gedichte sind häufig subjektiver Ausdruck konkreter Erfahrungen und Erlebnisse. Es hat sich in der Literaturwissenschaft daher der Begriff der „Erlebnisdichtung“ einbürgern können. Schon aus der Überschrift des vorliegenden Gedichts von Johann Wolfgang von Goethe lässt sich schließen, dass es sich auch hierbei um Erlebnisdichtung handeln könnte, denn es werden ein exaktes Datum und ein bestimmter Ort genannt; der Leser erfährt also zumindest etwas über die Umstände der Entstehung des Textes.
In der Tat wird aus der Sicht eines lyrischen Ichs eine Fahrt über das Wasser beschrieben. Dabei steht zum einen die Wahrnehmung der Natur im Mittelpunkt, zum anderen jedoch auch die Selbstreflexion des Betrachters.
Das Gedicht besteht aus zwei Strophen unterschiedlicher Länge. Die acht Verse umfassende erste Strophe schildert euphorisch das Einswerden des lyrischen Ichs mit Mutter Natur, deren Herrlichkeit beschrieben wird. Zugleich wird deutlich, dass es sich um die Fahrt in einem Kahn handelt, der mit Ruderschlägen vorangetrieben wird. Die zweite Strophe umfasst zwölf Verse und ist inhaltlich zweigeteilt. In den ersten vier Versen wird geschildert, wie sich das Ich geradezu dagegen sträubt, sich gedanklich der vergangenen Nacht zu- und damit von der unmittelbaren Gegenwart abzuwenden, um das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Die folgenden acht Verse zeigen, dass dieses Verweilen im Hier und Jetzt tatsächlich gelingt, es wird die Umgebung eindrucksvoll geschildert.
Die erste Strophe ist geprägt von einem gleichmäßigen, dynamischen Rhythmus. Es alternieren Verse mit vier- und dreihebigem Jambus; das Reimschema ist der Kreuzreim. Diese formale Dynamik spiegelt den Inhalt wider. Schon im ersten Vers wird das Verhältnis zwischen Ich und Natur deutlich; letztere wird als Nahrung und damit Leben spendende Mutter geschildert. Dass von „meiner Nabelschnur“ (Vers 1) die Rede ist und dass das Ich an ihr saugt, führt dem Leser deutlich die enge, geradezu schicksalhafte Verbundenheit beider vor Augen. Das Adverb „Nun“ (Vers 2) steht stellvertretend für die Situierung der sprechenden, genießenden Person im Hier und Jetzt. Gleichzeitig wird deren Selbstbewusstsein durch das „Ich“ am unmittelbaren Beginn des Gedichts hervorgehoben. Etwas konkreter wird die Situation in den folgenden Versen geschildert. Der Blick schweift umher in die Umgebung („Und herrlich rings ist die Natur“, Vers 3); ein weiteres Mal wird die Mütterlichkeit der Natur zum Ausdruck gebracht („Busen“, Vers 4), wobei hier Erotik und Mütterlichkeit miteinander verschmelzen. Die Macht der Natur wird in den nächsten Versen deutlich, denn „Welle“ (Vers 5) und „Berge“ (Vers 7) bilden jeweils das Subjekt des Satzes. Die Alliteration in Vers 5 („Welle wieget“) unterstreicht die Harmonie der Umgebung und den gleichmäßigen „Rudertakt“ (Vers 6) der Fortbewegung. Zugleich wird deutlich, dass das lyrische Ich sich nicht alleine in dem Kahn, sondern gemeinsam mit anderen auf dem Weg befindet. Doch die Natur ist nicht nur das Vehikel, sondern zugleich die Kulisse dieser Reise, wenn geschildert wird, dass „Berge […] unserm Lauf“ (Vers 7f.) „entgegnen“ (Vers 8). Der Neologismus „wolkenangetan“ (Vers 7) zeigt nicht nur die Kreativität des Ichs, sondern zugleich dessen Begeisterung von der Schönheit der Natur. Offensichtlich sind die Gipfel der Berge verdeckt von den Wolken – diese Vorstellung liegt jedenfalls angesichts der Ortsangabe recht nahe. Es spricht einiges dafür, dass diese Fahrt im Kahn zugleich als Allegorie für die Fahrt durch das Leben, ja als Lebensfahrt, bezeichnet werden kann; ob die angedeutete Aufwärtstendenz („hinauf“, Vers 6) allerdings als Annäherung an den (christlichen) Himmel anzusehen ist und insofern der Weg ins Jenseits führt, muss offen bleiben und wird durch den Text nicht so recht klar.
Sowohl formal auch inhaltlich liegt eine Zäsur zwischen den beiden Strophen. Die ersten vier Verse der zweiten Strophe sind im vierhebigen Trochäus verfasst; das Reimschema hat sich ebenfalls gewandelt, nunmehr liegt der Paarreim vor. Das Metrum wirkt in gewisser Weise bedrohlich, und dieser Eindruck wird auch durch den Inhalt gedeckt. Schon die bange Frage „Aug mein Aug, was sinkst du nieder?“ (Vers 9) zeigt, dass sich die Stimmung (neben der Bewegungsrichtung) ändert. Plötzlich befasst sich das lyrische Ich mit dem eigenen Inneren, was nicht nur die direkte Anrede deutlich werden lässt, sondern auch die Tatsache, dass hier die Frage nach eigenen Ängsten gestellt wird. Worauf sich diese richten, wird im zweiten Vers gesagt („Goldne Träume, kommt ihr wieder?“, Vers 10). Die Träume der Nacht sollen offenbar verdrängt, zumindest aber zurückgedrängt werden. Dass diese Träume als „golden“ bezeichnet werden, irritiert dabei allerdings den Leser ein wenig, da das Goldene für gewöhnlich Reichtum, Vollkommenheit und auch das Göttliche symbolisiert. Die Irritation kann zumindest teilweise in den beiden folgenden Versen aufgelöst werden, indem ein Traum explizit angesprochen wird. So viel versprechend dieser auch sein mag – es wird unterstrichen, dass auch im Hier und Jetzt „Lieb und Leben“ (Vers 12) zu finden ist. Es findet also eine Abwendung von einem (möglicherweise nicht lebbaren) Traum, also von der Imagination statt und damit einhergehend eine Hinwendung zum konkreten Leben, zur realen Erfahrung. Hier liegt also nicht, wie es häufig der Fall ist, wenn Träume abgewehrt werden sollen, die Flucht vor der Wirklichkeit statt, sondern eher das Gegenteil. Es geht nicht um die Verdrängung von Wünschen, sondern gerade um deren Integration ins Leben.
Die Vertreibung des Traums („Weg, du Traum“, Vers 11) gelingt, wie die das Gedicht abschließenden acht Verse zeigen. Es findet ein erneuter Wechsel im Metrum statt; nunmehr alternieren Verse, die im dreihebigen Trochäus verfasst sind, mit Versen, die aus drei Versfüßen gebildet sind, nämlich einem Trochäus, einem Daktylus und einem weiteren Trochäus. Das verwendete Reimschema ist nun wieder der Kreuzreim. Diese kunstvolle formale Gestaltung entspricht der klaren sprachlichen Gliederung dieser Verse. Jeweils ein Distichon bildet einen Hauptsatz, wobei der erste und der vierte in der Satzgliedstellung „Adverbiale – Prädikat – Subjekt“ konstruiert sind und eine Klammer bilden um die beiden anderen Sätze, in denen jeweils die Folge „Subjekt – Prädikat – Akkusativobjekt“ vorliegt. Diese formale und sprachliche Klarheit drückt inhaltlich vier Aussagen aus, die völlig unabhängig voneinander zu sein scheinen und deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass die Schönheit und die Vielfalt der Natur noch klarer zum Vorschein kommen. Die Euphorie der ersten Strophe ist durch die entschlossene Hinwendung zum konkreten Erleben noch gesteigert worden. Es deutet sich hier etwas Weiteres an, das ebenfalls Auskunft über den Seelenzustand des lyrischen Ichs zu geben vermag.
Zunächst einmal wirkt das Ich wie verzaubert von den Sternen (vgl. Vers 13f.). Diese blinken, üben also einen Reiz aus, wofür zudem die Hyperbel „Tausend“ (Vers 14) stehen könnte. Das Blinken symbolisiert möglicherweise das Durchschimmern des Transzendenten ins irdische Leben. In jedem Fall wird beschrieben, wie sich der Himmel im Wasser spiegelt, und so kann auch der subjektive Eindruck entstehen, als schwebten die Sterne (vgl. Vers 14).
Dann werden die Nebel personifiziert, und zwar zum einen dadurch, dass ihnen das Adjektiv „lieb“ zugewiesen wird und zum anderen dadurch, dass sie „trinken“ (Vers 15), also die fernere Umgebung (vgl. Vers 16) den Augen entziehen. Der Effekt ist, dass sich das lyrische Ich noch stärker auf das konzentriert, was sich in unmittelbarer Nähe befindet. Mit der „türmende[n] Ferne“ (Vers 16) könnten die Berge gemeint sein, die turmhoch gen Himmel ragen.
Dass der „Morgenwind“ (Vers 17) weht, steht für das neu sich entfaltende Leben des anbrechenden Tages, was zugleich für einen neuen Lebensabschnitt des lyrischen Ichs stehen könnte, das sich ja soeben vom Vergangenen, also von den Träumen, getrennt und wohl auch befreit hat. Das Verb „umflügelt“ weist in genau diese Richtung, denn auch die Flügel stehen in dem Zusammenhang eindeutig für Freiheit und dynamische Leichtigkeit. Dass die Bucht (noch) im Schatten liegt (vgl. Vers 18), deutet zwar in gewisser Weise einen Gegensatz zu dieser Leichtigkeit an, doch einiges spricht dafür, dass auch die „beschattete Bucht“ bald zu neuem Leben erweckt und insofern erhellt werden wird.
Der letzte dieser vier lose aneinander gereihten Hauptsätze bezieht sich auf eine bestimmte „reifende Frucht“ (Vers 20), die sich „im See bespiegelt“ (Vers 19). Sicherlich ist denkbar, dass damit Obstbäume gemeint sein könnten, die in jener Bucht wachsen und sich im Wasser spiegeln, als die Kahnfahrt sich dem Ufer und damit vielleicht auch ihrem Ende nähert.
Weiterführend für das Verständnis des Textes wäre es aber möglicherweise, dass eigentlich das lyrische Ich selbst die „reifende Frucht“ ist und dass dieses Gedicht damit ein Text ist, der symbolisch den Reifungsprozess einer jungen Person schildert. Dies würde auch zur metaphorischen „Lebensfahrt“ passen, von der bereits die Rede gewesen ist. Diese Fahrt wäre dann zum einen gleichbedeutend mit dem Vorgang der Reifung selbst, zum anderen käme hier aber auch bereits das Ergebnis dieses Prozesses zum Ausdruck. Ob dieser Vorgang jemals abgeschlossen sein wird, bleibt offen; das Partizip Präsens macht jedoch klar, dass er zum Zeitpunkt des geschilderten Erlebnisses noch nicht beendet ist. Insofern weist der letzte Vers über das Gedicht hinaus.
Das Selbstbewusstsein, mit dem das lyrische Ich sich selbst, also seine Gefühle, Empfindungen, Erlebnisse und Entwicklung, ins Zentrum des Gedichts stellt, rückt dieses eindeutig in die literarische Stilrichtung des Sturm und Drang. Sein Verfasser ist zum Zeitpunkt der Niederschrift gerade einmal 25 Jahre alt gewesen, was die Authentizität der beschriebenen Jugendlichkeit noch steigert. Auffällig ist die starke Hinwendung zum Diesseits, zum Hier und Jetzt, worin sich das Gedicht beispielsweise von Gedichten der Empfindsamkeit wie „Die Mainacht“ von Hölty oder „Die Sommernacht“ von Klopstock unterscheidet. Auch die Konkretheit der Darstellung erreicht einen höheren Grad, als es in den beiden genannten Gedichten der Fall ist. Dies gilt sowohl für die inhaltliche als auch für die formale Darstellung. Der Reichtum des Lebens und die Vielfalt der Natur werden durch die beiden unterschiedlichen Reimschemata sowie insbesondere die fünf unterschiedlichen Metren geradezu mustergültig umgesetzt.
Diese Vielfalt kann jedoch nur erkannt und genossen werden, weil die Geister der Vergangenheit nicht beschworen, sondern abgewehrt werden zugunsten einer bewussten Hinwendung zum genießenden, konkreten Erleben der Gegenwart. Dies könnte mit der Reifung der sich im See bespiegelnden Frucht gemeint sein. Diese fällt nicht wie der ins eigene Abbild verliebte Narziss ins Wasser, sondern sie gelangt zu einer veritablen Selbsterkenntnis.
Friedrich Hölderlin (1770-1843)
An Heinze
Rings um ruhet[16] die Stadt; still wird die erleuchtete Gasse,
Und, mit Fackeln geschmückt, rauschen die Wagen hinweg.
Satt gehn heim von Freuden des Tags zu ruhen die Menschen,
Und Gewinn und Verlust wäget ein sinniges Haupt
Wohlzufrieden zu Haus; leer steht von Trauben und Blumen,
Und von Werken der Hand ruht der geschäftige Markt.
Aber das Saitenspiel tönt fern aus Gärten; vielleicht, daß
Dort ein Liebendes spielt oder ein einsamer Mann
Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit; und die Brunnen
Immerquillend und frisch rauschen an duftendem Beet.
Still in dämmriger Luft ertönen geläutete Glocken,
Und der Stunden gedenk rufet ein Wächter die Zahl.
Jetzt auch kommet ein Wehn und regt die Gipfel des Hains auf,
Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond
Kommet geheim nun auch; die Schwärmerische, die Nacht kommt,
Voll mit Sternen und wohl wenig bekümmert um uns,
Glänzt die Erstaunende dort, die Fremdlingin unter den Menschen
Über Gebirgeshöhn traurig und prächtig herauf.
Die kompensatorische „Fremdlingin unter den Menschen“
„Besonders ist die Nacht klar und sternenhell und einsam und eine rück- und vorwärts tönende Glocke aller Erinnerung, ich halte sie für eines der gelungensten Gedichte überhaupt.“ Mit diesen Worten hat sich der Dichter Clemens Brentano im Jahre 1810 in einem Brief an den Maler Philipp Otto Runge über dieses Gedicht geäußert, das drei Jahre zuvor unter dem Titel „Die Nacht“ erstmals separat erschienen war.[17] Es bildet ursprünglich die erste von neun Strophen der Elegie „Brod und Wein“, die in den Jahren 1800/1801 entstanden ist. Dem Zitat des begeisterten Romantikers Brentano ist, was die Schönheit dieser Verse angeht, nichts hinzuzufügen. Zu fragen wäre bestenfalls, wie es geschehen konnte, dass Hölderlin weder zu Lebzeiten noch heute als Dichter der Romantik angesehen wurde, wenn er doch die gleichen Themen und Motive, eine ähnliche Sprache und eine ähnliche Philosophie vertreten hat. Eine schlüssige Antwort auf diese Frage ist, um es vorwegzunehmen, auf der Grundlage des vorliegenden Gedichtes nicht zu geben. Allerdings deuten sich bereits Differenzen zu Gedichten der zeitgenössischen (Früh-) Romantiker an, die zumindest den Ansatz einer Erklärung liefern. Die traditionelle Literaturgeschichtsschreibung widmete häufig den Autoren Jean Paul, Friedrich Hölderlin und Heinrich von Kleist ein Kapitel, das überschrieben war mit dem ebenso nichts sagenden wie fragwürdigen Etikett „Zwischen Klassik und Romantik“. Dabei deutet vieles darauf hin, dass es sinnvoller ist, die (Weimarer) Klassik und die Romantik – ohnehin zwei gleichzeitig auftretende Stilrichtungen bzw. Epochen – als unterschiedliche Reaktionen auf die gleichen historischen, philosophischen und ästhetischen Entwicklungen in der Zeit um 1800 anzusehen und insofern zusammenzufassen. Dann wäre es auch leichter, die drei genannten Autoren aus dem Abseits herauszuholen und in die Darstellung der literarhistorischen Tendenzen dieser Zeit zu integrieren.
Doch gerade Hölderlins schönes „Nacht“-Gedicht verdient es nicht, zum literatur-historischen Streitobjekt zu werden. Der Text steht für sich und kann auch ohne feste Epochenzuordnung angemessen rezipiert werden.
Um 1800 wurden sich viele Menschen der Tatsache bewusst, dass der Mensch der Natur in Demut entgegentreten sollte, bei aller Intellektualität und Fähigkeit zur Selbstreflexion, die ihn von anderen Lebewesen unterscheidet. Eine Phase, die uns bis heute immer wieder vor Augen führt, dass wir die Natur letztlich nicht steuern können, ist die Nacht. Selbst die Industrialisierung und Elektrifizierung haben nicht verhindern können, dass der Tageszeiten-Rhythmus unser Leben nach wie vor sehr stark prägt. Die Nacht ist die Zeit der Erholung, des Schlafes, der Phantasie, der Liebe – kurz: jene Zeit, in der der Mensch wieder zu sich selbst kommt. Jedenfalls sollte er dies können, und es ist sicherlich kein Zufall, dass beispielsweise Schlafstörungen häufig in direktem Zusammenhang mit unserer Arbeitswelt stehen und dass sie behandelt werden müssen, um weitere Krankheiten zu vermeiden.
Im Grunde genommen, ist dies das Thema des Gedichts „Die Nacht“. In den ersten sechs Versen wird dargestellt, wie die Nacht über eine Stadt hereinbricht, wie sich das Leben allmählich beruhigt, die Menschen nach getaner Arbeit nach Hause fahren und den Markt leer zurücklassen. Im zweiten Teil des Gedichts, der ebenfalls aus sechs Versen besteht, wird der Blick in die Natur gerichtet. „Fern aus Gärten“ tönt Musik („Saitenspiel“, Vers 7), die Brunnen versiegen nie und rauschen zeitlos vor sich hin, ein einsamer Nachtwächter ruft die Uhrzeit in die Dunkelheit, während die abendlichen Glocken läuten. Der dritte Abschnitt, ebenfalls bestehend aus sechs Versen, schildert die Ankunft der Nacht. Der Mond, hier bezeichnet als „das Schattenbild unserer Erde“ (Vers 14), geht auf, die Sterne sind am Firmament zu sehen – kurz: Die Nacht ist über die Natur hereingebrochen, und zwar „wohl wenig bekümmert um uns“ Menschen (Vers 16), unter denen sie eine „Fremdlingin“ (Vers 17) ist und bleibt.
Schon diese Inhaltswiedergabe deutet an, dass das Gedicht klar strukturiert ist. Dies hängt damit zusammen, dass mehrere Polaritäten geschildert werden, beispielsweise Tag – Nacht; Stadt – Natur; Mensch – Natur; Mensch – Nacht. Geschichtsphilosophisch ließe sich noch die Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart hinzufügen, die der Dichotomie Nacht – Tag entspricht. Die Dunkelheit, Rätselhaftigkeit der Nacht ist in der Gegenwart – zumindest vordergründig betrachtet – verloren gegangen, heutzutage regiert der Mensch mithilfe der klaren, hellen Vernunft oder besser gesagt: mit dem kühl kalkulierenden Verstand. Dass dies jedoch nur auf den ersten Blick so ist und dass die Nacht immer wieder über die Menschen hereinbricht, ist eines der Themen der gesamten Elegie „Brod und Wein“.
Zunächst einmal wird ein scheinbares Paradoxon geschildert: Die Stadt ruht „Rings um“ (Vers 1). Dieser kurze, prägnante, in sich abgeschlossene Satz bildet den Anfang des Gedichtes und zeigt sogleich eine der genannten Polaritäten deutlich auf. Warum ruhet die Stadt? Warum wird die Gasse still (vgl. Vers 1)? Die Antwort wird indirekt bereits im ersten Vers gegeben: weil die Dunkelheit hereinbricht, sodass die Gasse erleuchtet werden muss. Dies bestätigen denn auch die nächsten Verse. Die Wagen „rauschen […] hinweg“ (Vers 2), was die Geschwindigkeit thematisiert, in der das Leben tagsüber abläuft. Die Menschen gehen nach getaner Arbeit „Satt“ (Vers 3) und „Wohlzufrieden“ (Vers 5) nach Hause, wobei sich die Zufriedenheit noch steigert, wenn „Gewinn und Verlust“ (Vers 4) einander gegenüber gestellt werden. Es wird offenbar wirtschaftlicher Gewinn erzielt, doch es wird hier implizit in Frage gestellt, ob dieser Gewinn gleichzeitig Glück bedeutet. Die Zufriedenheit hat etwas Saturiertes an sich, und wenn „ein sinniges Haupt“ (Vers 4) nachrechnet, ob sich der Tag gelohnt hat, so wird klar, dass die rationale Seite des Menschen die emotionale verdrängt hat und dass diese Verdrängung bei einigen bis in die Nacht hinein anhält: Selbst der Feierabend, der eigentlich der Erholung „von [den] Freuden des Tags“ (Vers 3; man könnte diese Formulierung als leicht ironisch auffassen und das Wort „Freuden“ durch „(An-) Forderungen“ ersetzen) dienen soll, wird von den Gedanken an die Arbeit und den wirtschaftlichen Verdienst vereinnahmt. Es „ruht der geschäftige Markt“ (Vers 6), das heißt der Markt – jener Ort, an dem sich das tägliche Leben abspielt – ist gar nicht mehr geschäftig, sondern er steht „leer […] von Trauben und Blumen“ (Vers 5). Hier ist interessant, dass Tag und Nacht sich zu vermischen scheinen: Es wird gesagt, was nicht mehr vorhanden ist (Trauben und Blumen, Geschäftigkeit), aber so, als wäre diese Belebtheit noch aktuell. Damit wird angedeutet, dass es am nächsten Tag weitergehen wird.
Schon das Wort „Aber“ (Vers 7) macht unmissverständlich klar, dass nun etwas Neues beginnt. „Fern aus Gärten“ (ebd.), also weit entfernt vom Marktplatz, tönt „Saitenspiel“, also Musik, die hier stellvertretend für die Kunst schlechthin steht. Diese ist aus der Stadt verdrängt worden, hat aber immer noch einen Platz im Leben der Menschen, abseits vom Trubel des Tages. Nicht zufällig tönt diese Musik aus „Gärten“ herüber, also aus einem Bereich, der der Natur vom Menschen noch eingeräumt wird: Die Musik ist in die zivilisierte Natur verbannt worden. Wer dort spiele, wird gefragt, doch die Antwort bleibt offen. Bezeichnenderweise könnte es „ein Liebendes“ (Vers 8) sein oder „ein einsamer Mann“. In jedem Fall eine einzelne Person, die alleine zu sein scheint mit ihren Gefühlen Liebe bzw. Sehnsucht, wobei sich die Sehnsucht sowohl räumlich in die Ferne als auch zeitlich in die Vergangenheit zu richten scheint („Ferner Freunde gedenkt und der Jugendzeit“, Vers 9). Die Natur ist unbeeinflusst vom Treiben der Menschen, die Brunnen rauschen „Immerquillend und frisch“ (Vers 10), stehen also für ewiges Leben. Die Menschen hingegen sind einerseits der Dimension der Zeit unterworfen („der Stunden gedenk“, Vers 12), also vergänglich, andererseits auch in der Nacht noch kalkulierend („rufet ein Wächter die Zahl“, Vers 12). Diese Formulierung erinnert zumindest von ferne an das Gedicht „Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren“ von Novalis und verdeutlicht, dass jenes Zeitalter, das Novalis besingt, (noch) nicht angebrochen ist: Die Zahlen sind „Schlüssel aller Kreaturen“, jedenfalls der menschlichen (vgl. auch Vers 4).
Die (von Menschen) „geläutete[n] Glocken“ (Vers 11) ertönen „Still in dämmriger Luft“ (ebd.): Sie läuten die Nacht ein, ihr Klang wird durch die eingezogene Stille hervorgehoben. Dabei stehen die Glocken für die Religiosität der Menschen und insofern sicherlich auch für deren irrationale Seite. Bei aller kalkulierenden Rationalität ist der Glaube an Gott offenbar noch vorhanden, vielleicht gerade wegen der täglichen Arbeitsbelastung.
Doch dieser Religiosität wird nicht nachgegangen – im Gegenteil: Die einbrechende Nacht kommt ohne Gott aus, bzw. sie ist vielleicht selbst als Göttin anzusehen, was zwar nicht mit dem monotheistischen Christentum vereinbar ist, doch mit der poly- und pantheistischen Antike. Nur nebenbei kann an dieser Stelle erwähnt werden, dass Hölderlin ein glühender Anhänger der griechischen Antike gewesen ist und darin seinem Freund Friedrich Schiller nah verwandt war.
„Ein Wehn“ (Vers 13) „regt die Gipfel des Hains auf“ (ebd.), sorgt also für Bewegung, allerdings eine ganz andere als die tägliche Belebtheit des Marktes. Geradezu euphorisch („Sieh!“, Vers 14) wird der Mondaufgang geschildert. Dabei fungiert der Mond – typisch romantisch – als Gegenbild der Erde, er steht buchstäblich für die Schattenseite der menschlichen Existenz, also für Gefühle, das Rätselhafte, rational nicht Erklärbare, die Phantasie; dies alles hat in der modernen Welt keinen Platz mehr – ähnlich wie die bereits thematisierte Kunst, die ja gerade auf dem basiert, was soeben aufgezählt worden ist. Dass der Mond „geheim“ kommt (Vers 15), kann vor diesem Hintergrund nicht verwundern.
Die Nacht selbst wird in den letzten vier Versen mithilfe mehrerer Personifikationen beschrieben, und es wird deutlich, dass sie glorifiziert wird. Sie ist jene Macht, die ewig herrschen wird, und zwar unabhängig von dem Leben, das die Menschen tagsüber führen. Sie braucht den Menschen nicht und erregt zugleich Erstaunen beim (menschlichen) Betrachter („die Erstaunende“, Vers 17). Sie ist und bleibt eine „Fremdlingin unter den Menschen“, das heißt diese existieren parallel zu ihr, aber ohne innere Bindung: Die Nacht und die Menschen verstehen sich gegenseitig nicht mehr – sie sind sich fremd. Diese Fremdheit könnte es sein, die die Nacht bei aller Pracht „traurig“ erscheinen lässt (Vers 18): Sie bedauert möglicherweise die Menschen, die sich von ihrer eigenen Natur entfremdet haben, weil sie nur noch ihre rationale Seite wahrnehmen und die Gefühle unterdrücken.
So ist auch die Form des Gedichtes zu erklären, sie unterstreicht den Inhalt. Denn das Gedicht ist – ganz in der Tradition der antiken Literatur – in elegischen Distichen verfasst, das heißt es gehören jeweils zwei Verse zusammen, wobei der erste Vers einen Hexameter bildet (einen sechshebigen Daktylus bestehend aus sechs kompletten Versfüßen), der zweite jedoch einen Pentameter (einen sechshebigen Daktylus bestehend aus zweimal zweieinhalb Versfüßen, sodass eine Zäsur nach der dritten und vor der darauf unmittelbar folgenden betonten Silbe entsteht). Diese genuin klassische Form der Elegie, also des Klageliedes, ist es, die das Gedicht inhaltlich und formal nahe an die Klassik rücken lässt – bei allen motivischen Parallelen zur romantischen Literatur. Diese zeichnet sich gerade dadurch aus – jedenfalls in ihren frühen Texten –, dass ein auf die als zerrissen empfundene Gegenwart folgendes, goldenes Zeitalter der Vereinigung der Gegensätze antizipiert wird. Genau dieser utopische Grundton fehlt allerdings den Texten Hölderlins. Brentano hat sicherlich recht, wenn er schreibt, die dargestellte Nacht sei „eine rück- und vorwärts tönende Glocke aller Erinnerung“, also ein Text, der sowohl in die Gegenwart als auch in die Zukunft weist, doch es handelt sich eben um eine Erinnerung, um eine Klage über die Nacht der Gegenwart, und nicht um den utopischen Entwurf einer neuen Gesellschaft: Nacht und Tag bleiben unvereinbare Gegensätze, allerdings kann man sicherlich positiv konstatieren, dass die Nacht immer wieder hereinbrechen wird und die Wunden, die der Tag geschlagen hat, heilen kann, wenn die Menschen es zulassen. Nicht eine Utopie, eine Synthese der Gegensätze, ist der Zukunftsentwurf, den Hölderlin hier anbietet, sondern der ewige Wechsel zwischen Tag und Nacht. Einen ewigen Tag könnten die Menschen in dieser Hinsicht nicht aushalten.
[...]
[1] Frühwald 1995. S. 332.
[2] Uerlings 2000. S. 79f.
[3] Novalis 1999. Band 1. S. 395. Mit „< >” eingeklammerte Wörter wurden von Novalis während der Niederschrift gestrichen.
[4] Novalis 1999. Band 2. S. 324.
[5] Novalis 1999. Band 2. S. 814.
[6] Conrady 41995. S. 39.
[7] Goethe 1998. Band 1. S. 44-46.
[8] Goethe 1998. Band 1. S. 146f.
[9] Eichendorff 1984. S. 267f.
[10] Conrady 41995. S. 289.
[11] Karthaus 1997. S. 187.
[12] Conrady 41995. S. 443.
[13] Conrady 41995. S. 123.
[14] Conrady 41995. S. 106.
[15] Goethe 1998. Band 1. S. 102f.
[16] Hölderlin 2000. S. 232.
[17] Vgl. Hölderlin 2000. S.513.
- Arbeit zitieren
- Mario Paulus (Autor:in), 2013, Wortgemälde in verdichteter Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231254
Kostenlos Autor werden


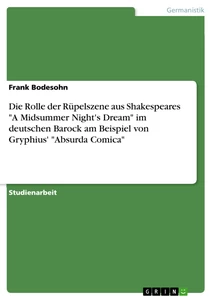

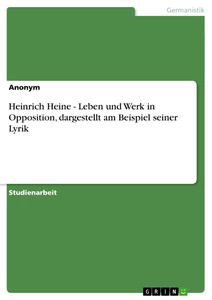

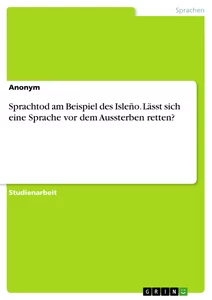















Kommentare