Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Danksagung
1 Einleitung und Zielsetzung
2 Pädagogische Grundlagen als Basis der wissenschaftlichen Betrachtung
2.1 Pädagogik und ihre Inhalte
2.2 Erziehung als pädagogische Aufgabe und Lernen als ihre Antwort
2.3 Lernen – eine Definition
2.4 Lernen in Raum und Zeit
3 Lerntheorien
3.1 Pädagogische Theorien des Lernens
3.1.1 Können Lernen
3.1.1.1 Mimetisches Lernen
3.1.1.2 Leibliches Lernen
3.1.2 Leben Lernen
3.1.2.1 Biografisches Lernen
3.1.2.2 Das Lernen der Lebenskunst
3.2 Handlungs- und erfahrungsorientiertes Lernen
3.3 Konstruktivistisches Lernen
3.4 Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura
3.4.1 Das Erfahrungslernen
3.4.2 Das Erwartungslernen
3.4.3 Das Modelllernen
3.4.4 Das korrektive Lernen
3.4.5 Einsatz und Wirkung von Bekräftigung und Bestrafung in Anlehnung an die operante Konditionierung
3.4.6 Die Einflüsse kognitiver Prozesse auf das Verhalten
3.4.7 Der gegenseitige Einfluss von Person und Umwelt
3.5 Kooperatives Lernen
3.6 Zusammenfassung
4 Entwicklungspsychologische Aspekte der Kindheit
4.1 Das Selbstkonzept in der Kindheit
4.2 Die Entwicklung des Sozialverhaltens
5 Aggressive Kinder
5.1 Aggression & Aggressivität – eine Definition
5.2 Das Selbstkonzept bei aggressiven Kindern
5.3 Kriterien zur Rechtfertigung von Interventionen
5.4 Diagnostik der »Störung des Sozialverhaltens«
5.4.1 Diagnose nach DSM-IV und ICD-
5.4.2 Trainingsspezifische Diagnostik
5.5 Ursachen und Erklärungsansätze von aggressivem Verhalten
5.5.1 Genetische Anlagen
5.5.2 Anlassbezogene Aggression
5.5.3 Personale Komponenten
5.5.3.1 Die emotionale Komponente
5.5.3.2 Die Verhaltenskomponente
5.5.3.3 Entwicklungshintergründe
5.5.4 Gelerntes aggressives Verhalten
5.5.5 Interpersonale Aspekte
5.5.6 Das Prozessmodell aggressiven Verhaltens nach Kaufmann
5.6 Interventionsmöglichkeiten
5.7 Zusammenfassung
6 Das Training mit aggressiven Kindern
6.1 Das verhaltenstherapeutische Menschenbild
6.2 Das Training mit aggressiven Kindern als Erziehungsmaßnahme
6.3 Die Rolle des Trainers
6.4 Das Einzeltraining
6.5 Das Gruppentraining
6.6 Die Eltern- und Familienberatung
6.7 Die Effektivität des Trainings
6.8 Eine zusammenfassende und kritische Betrachtung
7 Erlebnispädagogik
7.1 Eine Begriffsanalyse
7.1.1 Das Pädagogische in der Erlebnispädagogik
7.1.2 Das Erlebnis
7.1.2.1 Definition und Merkmale
7.1.2.2 Die pädagogische Nutzbarkeit von Erlebnissen
7.1.3 Erlebnispädagogik – eine Definition
7.2 Ein historischer Abriss der Erlebnispädagogik
7.2.1 Jean-Jaques Rousseau
7.2.2 David Henry Thoreau
7.2.3 Kurt Hahn
7.3 Das Menschenbild in der Erlebnispädagogik
7.4 Merkmale einer erlebnispädagogischen Aktion
7.4.1 Das Prinzip Sicherheit
7.4.2 Aus Grenzerfahrungen lernen
7.4.3 Das Prinzip Freiwilligkeit
7.4.4 Das Prinzip Unmittelbarkeit
7.4.5 Das Prinzip Ganzheitlichkeit – oder passender: die Vielseitigkeit der Erlebnispädagogik
7.4.5.1 Körper, Kognitionen und Emotionen im Zusammenspiel
7.4.5.2 Wahrnehmen mit allen Sinnen
7.4.5.3 Ästhetisches Lernen
7.4.6 Das Flow-Erleben
7.4.6.1 Voraussetzungen und Charakteristika des »Flow«
7.4.6.2 Flow-Erleben bei aggressiven Kindern
7.4.7 Das Solo
7.5 Nach der Aktion die Reflexion
7.5.1 Reflexion – eine Definition
7.5.2 Reflexionsmodelle
7.5.2.1 The mountains speak for themselves
7.5.2.2 Outward Bound Plus
7.5.2.3 Metaphorisches Modell
7.5.3 Begründung und Nutzen von Reflexion
7.5.4 Schwierigkeiten im Umgang mit Reflexionen
7.5.5 Methodische Anregungen
7.6 Der Transfer
7.7 Soziales Lernen durch Gruppenprozesse in der Erlebnispädagogik
7.7.1 Gruppe – eine Definition
7.7.2 Psychosoziale Prozesse in der erlebnispädagogischen Gruppe
7.7.2.1 Die Orientierungsphase (Forming)
7.7.2.2 Die Machtkampfphase (Storming)
7.7.2.3 Die Vertrautheitsphase (Norming)
7.7.2.4 Die Differenzierungsphase (Performing)
7.7.2.5 Die Trennungsphase
7.7.3 Der Gruppenrahmen
7.7.4 Die Gruppengröße und -zusammensetzung
7.7.5 Die Rollen der Gruppenleiter
7.7.6 Soziales Lernen – Lernen in und durch Gruppen
7.7.7 Gruppenprozesse – Hinweise für die Arbeit
7.7.8 Vorteile und Nachteile in der Arbeit mit Gruppen und damit verbundene Herausforderungen
7.8 Erlebnispädagogische Aktivitäten in der Praxis
7.8.1 Handlungsfelder der Erlebnispädagogik
7.8.2 Bergwandern
7.8.3 Klettern
7.8.4 Höhlentouren
7.8.5 Aktionen auf dem Wasser
7.8.6 Fahrradtouren
7.8.7 City Bound
7.8.8 Seilgärten
7.8.9 Problemlösungsaufgaben
7.8.10 Exkurs: Bergwandern mit (aggressiven) Kindern
7.9 Zur Wirksamkeit erlebnispädagogischer Maßnahmen
7.9.1 Wirkmodelle und methodische Herangehensweisen an den Forschungsgegenstand
7.9.1.1 Lerntheoretische Begründung
7.9.1.2 Begründung durch die Spezifik der Beziehung
7.9.1.3 Begründung durch die Aktivierung archetypischer Elemente
7.9.1.4 Begründung durch Isomorphie und Metaphorik
7.9.2 Studien zur Wirksamkeit von Erlebnispädagogik – ein Überblick
7.10 Kritik an der Erlebnispädagogik
7.11 Chancen, Risiken und Grenzen – Erlebnispädagogik in der Zusammenfassung
8 Diskussion der Leitfragen
8.1 Ergänzbarkeit des Trainings mit aggressiven Kindern durch eine erlebnispädagogische Maßnahme
8.1.1 Kriterien der Ergänzbarkeit
8.1.1.1 Übereinstimmung der Ziele
8.1.1.2 Kompatibilität der Menschenbilder
8.1.1.3 Einigkeit in Bezug auf das Lernverständnis
8.1.1.4 Anschlussfähigkeit
8.1.1.5 Differenz und Vielfalt
8.1.2 Vorteile und Nutzen der erlebnispädagogischen Ergänzung
8.2 Wirksamkeit der kombinierten Maßnahme
8.2.1 Effektivität
8.2.2 Nachhaltigkeit
9 Fazit: Ein Verhaltenstraining mit erlebnispädagogischen Elementen bei aggressiven Kindern
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Vorwort und Danksagung
Hoch oben auf der Anden Gipfel
die Sonne schillernd lacht,
die Lüfte umwehen sacht
des Waldes grüne Wipfel.
Der Inka Wunder Pracht,
der heiligen Ruinen Stein,
der Ort des Glückes Sein
im Angesicht des Mythos Tracht.
Des tiefen Meeres Blau
umgeben weißer Mützen Milch.
Der Inseln schwimmend Schilf
erwacht in glitzerndem Tau.
Tief unten in des Cañons Schlucht
die Oase paradiesisch lockt.
Oben stolz der Kondor hockt,
des Fluges Anblick reinste Sucht.
Die weiße Stadt in Andens Grau
beschützt von mächtigen Vulkanen,
kann keiner wohl das Schicksal ahnen
des Klosters gläubigen Frau.
In Ostens dichtem Grün,
der Flüsse reisend Strom,
des Vöglein Daches Thron,
die Blumen farbig blüh`n.
Maria Steudel (nach meinem zehn-wöchigen Peruaufenthalt)
Die geschilderten Eindrücke in Peru waren zwar nicht der Schlüssel zum hiesigen Thema, doch gaben sie mir während der Erarbeitung immer wieder Inspiration, um an meinem Ziel festzuhalten.
Weniger spektakulär ist dagegen die Quelle, welche den Ursprung meiner Arbeit darstellt. Hierfür diente die Reality-Sendung "Teenager außer Kontrolle – Letzter Ausweg Wilder Westen", in der sich verhaltensauffällige Jugendliche in einer Resozialisierungsmaßnahme einer Therapie in der amerikanischen Wildnis unterziehen. Auch wenn das ausschließlich für die breite Gesellschaft konzipierte Unterhaltungsformat in der pädagogischen Fachwelt für Diskussionen sorgte, wuchs in mir die Überlegung nach dem erzielbaren Wirkungspotenzial, das in der eigentlichen Idee der Sendung stecken könnte, fände sie eine angemessene Umsetzung.
Denn denke ich zurück an das persönliche Erlebnis, als ich das erste Mal einen Hügel über Cusco bestieg, an den Kräfte zehrenden Aufstieg bei schwerer Atmung, den immer wieder aufkeimenden Wunsch während etlicher Pausen umzukehren und schließlich an den Moment, als ich umgeben von kahlen Hügeln mit einem Lächeln im Gesicht auf dem Gipfel stand und den wenig reizvollen, aber dennoch unvergesslichen Anblick einer graubraunen Landschaft genoss und an das Gefühl von Freiheit, das mich in jenem nicht enden wollenden Augenblick vollkommener Zufriedenheit umfing, dann wird mir stets bewusst, weshalb es gerade der Schwerpunkt Erlebnispädagogik sein sollte, der mich in den letzten Monaten so intensiv begleitete. Obwohl meinen Erlebnissen der pädagogische Rahmen fehlte, so war ich doch davon überzeugt, dass im Kern einer solchen Herausforderung ein großes Potenzial zur Weiterentwicklung eines Menschen verborgen liegt, welches sich pädagogisch nutzen lässt.
Bei meinen Recherchen zur Verhaltenstherapie stieß ich auf das Programm »Training mit aggressiven Kindern«, welches sich als konkretes und bekanntes Beispiel für eine verhaltensthera-peutische Intervention eignete, die ihre Ergänzung durch eine erlebnispädagogische Maßnahme finden sollte.
Von dem anfänglichen Gedanke, die Verhaltenstherapie mit der Erlebnispädagogik in Form einer interdisziplinären Kooperation zu verbinden, habe ich mich bald abgewendet und den Fokus auf eine ausschließlich pädagogische Betrachtungsweise gelenkt. Begründen lässt sich diese Ent-scheidung einerseits durch bereits vorhandene Auseinandersetzungen anderer Autoren mit dieser Thematik und andererseits durch den Vorteil einer klaren wissenschaftlichen Linie, an der sich meine Argumentationen orientieren. Aufgrund der recht durchlässigen Grenze zwischen der Pä-dagogik und der Therapie sowie des gegenseitigen Austausches beider Wissenschaftsdisziplinen, sind Überschneidungen jedoch unvermeidlich, sodass Aspekte aus dem verhaltenstherapeutischen Bereich auch in der Pädagogik auftauchen können und umgekehrt. Der Blick auf den Zusammen-hang zwischen dem »Training mit aggressiven Kindern« und der erlebnispädagogischen Maßnahme als ergänzender Baustein erfolgt dennoch aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive, die gestützt auf die operative Pädagogik, die bisherige Praxis in einem neuen Kontext betrachtet.
An dieser Stelle sei noch der Hinweis auf die geschlechtsneutralen Formulierungen zur besseren Lesbarkeit gegeben. Gemeint sind dabei immer beide Geschlechter.
Abschließend möchte ich diesen Platz nutzen, um einigen Personen für ihre Unterstützung zu danken. Allen voran sei hierbei mein Betreuer Prof. Dr. Stephan Ellinger zu nennen, welcher mit Hilfe seiner gezielten Fragen den Weg meiner Arbeit beeinflusste und mir darüber hinaus das Gefühl vermittelte, das richtige Thema gewählt zu haben. Dies half mir bis zum Ende der Arbeit meine Motivation aufrechtzuerhalten. Weiterhin ist Dr. Oliver Hechler zu nennen, welcher mir in einer verständlichen Art den grundlegenden Unterschied zwischen Pädagogik und Therapie er-klärte. Ich danke außerdem Sebastian Stiller, der mir bei Fragen zur Erlebnispädagogik Rede und Antwort stand und mich bei seiner Exkursion die Praxis erleben ließ. Ein weiterer Dank gilt meinen Freunden und Verwandten Bella Steudel, Christian Arnold, Veronika Di Fede, Jan-Niels Genzmer und Lev Keyfman, die mir unentwegt Verbesserungsvorschläge machten, wertvolle Tipps gaben und zudem dabei halfen, meine Arbeit zu optimieren. Zu guter Letzt möchte ich einen Dank an die Wasserwacht der DRK-Ortsvereinigung Frankfurt Nordwest aussprechen, die es mir durch ihre Aktivitäten ermöglichte, auch mal von meiner Arbeit abzuschalten und neue Energie zu sammeln.
1 Einleitung und Zielsetzung
Mit der Reality-Sendung „Teenager außer Kontrolle – Letzter Ausweg Wilder Westen“ hat der Begriff Erlebnispädagogik mittlerweile auch Einzug in die Haushalte der Zuschauer erhalten, die nicht im Wissenschaftsbetrieb beschäftigt sind und bei denen der Eindruck eines Allheilmittels gegen abweichendes Verhalten Heranwachsender entsteht. Im Gegenzug sorgte die Sendung unter den Fachleuten für Empörung und ließ die Diskussion über Erlebnispädagogik erneut entfachen. So setzte sich bspw. Kirchherr (2009) mit dieser Thematik kritisch auseinander, wobei sie kein pädagogisch schlüssiges Konzept in der Arbeit mit den Jugendlichen erkennen konnte. Auch werde durch die Fokussierung hinsichtlich der Einhaltung von Regeln und drohenden Konsequenzen bei Nichtbeachtung von den eigentlichen pädagogischen Grundgedanken Abstand genommen. Darüber hinaus bestehe sogar die Gefahr einer Schädigung der Jugendlichen durch die öffentliche Dar-stellung der karikierten Charaktere. Eine Wirksamkeit dieser intervenierenden Maßnahmen, welche in der Sendung dargestellt werden, kann aufgrund der fehlenden Evaluation nicht nachgewiesen werden. Aus dieser Problematik heraus kristallisiert sich die Frage, ob der grundlegende Ansatz, verhaltenstherapeutische Maßnahmen in Zusammenhang mit erlebnispädagogischen Bemühungen zu bringen, überhaupt sinnvoll und pädagogisch wertvoll erscheint. Doch andere Quellen vermitteln indes ein dem Ansatz inne liegendes Potenzial, welches einer tiefer gehenden Betrachtung durchaus überlegenswert ist. Dies freilich unter der Voraussetzung, dass die Umsetzung nach einem gut durchdachten und reflektierten pädagogischen Konzept, eingebettet in festen Rahmenbedingungen und fernab der Öffentlichkeit, erfolgt.
Demnach liegt das Hauptaugenmerk in dieser hermeneutisch konzipierten Arbeit auf der Vorstel-lung, erlebnispädagogische Inhalte mit einem verhaltenstherapeutischen Angebot so zu verbinden, dass daraus ein pädagogisches Gesamtkonzept als Alternative zu den herkömmlichen Interventions-methoden bei Verhaltensstörungen entstehen kann. Das »Training mit aggressiven Kindern« nach Petermann und Petermann (2008) bildet dabei als Beispiel einer verhaltenstherapeutischen Maß-nahme die Interventionsgrundlage, welche durch erlebnispädagogische Inhalte eine Erweiterung erfahren soll. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten der gegenseitigen Ergänzbarkeit des Trainings mit aggressiven Kindern und der Erlebnispädagogik aufgezeigt werden. Das Ziel dieser Überlegungen soll sein, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie durch die Kombination beider Herangehensweisen die Effektivität und Nachhaltigkeit im Gegensatz zur Anwendung nur einer dieser Maßnahmen gesteigert werden kann. Daraus ergeben sich zwei Leitfragen:
- Kann eine erlebnispädagogische Maßnahme das Training mit aggressiven Kindern ergänzen und das Erlernen sozial angemessener Verhaltensweisen unterstützen?
- Hat eine solche Kombination auch das Potenzial, die Effektivität zu steigern und für eine nachhaltigere Wirksamkeit gegenüber Einzelmaßnahmen zu sorgen?
Um diese Fragen beantworten zu können, muss im ersten Kapitel zunächst die Grundlage für die wissenschaftliche Betrachtungsweise dieser Thematik gelegt werden. Demzufolge ist zu klären, was unter Pädagogik im Allgemeinen verstanden wird und wie die Begriffe der Erziehung und des Lernens kontextuell einzuordnen sind. Die Erklärungen basieren auf Pranges operativer Pädagogik (2005), welche gleichzeitig als Maßgabe für die pädagogische Betrachtungsweise der hier behandelten Gegenstandsbereiche zu sehen ist. Dieser Autor und Pädagoge wurde gewählt, weil er nicht nur ein klares Verständnis von Erziehung und Lernen vermittelt, sondern auch den Kern der pädagogischen Handlungsweise aufzeigt. Somit kann das Training mit aggressiven Kindern ebenso wie die Erlebnispädagogik als pädagogische Maßnahmen mit unterschiedlichen methodischen Zugängen definiert werden, womit eine Auseinandersetzung mit dem Thema auf einer klaren erziehungswissenschaftlichen Ebene möglich wird.
Im Anschluss daran werden die gängigen Lerntheorien vorgestellt. Sie dienen als Basis für das Verständnis von Lernvorgängen, die im Zuge der Aneignung sozial angemessener Verhaltens-weisen sowie anderer Kompetenzen und Fähigkeiten von zentraler Relevanz sind. Dabei soll es um die Vereinbarkeit verschiedener Lerntheorien gehen, was später bei der Frage nach der Ergänz-barkeit beider Maßnahmen erneut aufgegriffen wird. Grundsätzlich dient das Verständnis über menschliche Lernvorgänge auch als Erklärungsansatz für aggressives Verhalten und ist folglich eine wichtige Information in Bezug auf die Entstehung und die Veränderung sozialer Verhaltens-weisen.
Außerdem relevant für die Auseinandersetzung mit dem menschlichen Verhalten ist die Entwick-lungspsychologie, die im dritten Kapitel kurz besprochen wird. Berücksichtigung finden neben dem Selbstkonzept auch die Entwicklung des Sozialverhaltens in der Kindheit, welche gleichermaßen für das Vorverständnis von Bedeutung sind.
Es folgt die Beschreibung des Klientels - der aggressiven Kindern. Zu diesem Zweck werden Aggression und Aggressivität definiert, die Ursachen für aggressives Verhalten aufgezeigt sowie dessen Merkmale und Ausprägungen dargestellt.
Anschließend wird die Hauptmaßnahme »das Training mit aggressiven Kindern« in Verbindung mit deren Inhalten, Zielen und Methoden erläutert. Außerdem werden Studien zur Effektivität des Trainings gegenübergestellt und in Bezug auf die Wirksamkeit bewertet.
Das sechste Kapitel widmet sich schließlich der Erlebnispädagogik. Dieses umfangreiche Thema wird deshalb so ausführlich behandelt, da dem Leser ein präziser Eindruck über deren Möglich-keiten vermittelt werden soll. Der Fokus richtet sich dabei auf die Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern. Um ein umfassendes Verständnis dieser Zusammenhänge zu erlangen, müssen neben den Prinzipien der Erlebnispädagogik auch die grundlegenden entstehungsgeschichtlichen Hintergründe und Ideen genannt werden. Ein besonderes Augenmerk wird außerdem auf das Erleben in und mit Gruppen gelegt, das für das Erlernen sozial angemessener Verhaltensweisen eine wichtige Rolle spielt. Auch hier werden Studien vorgestellt, die den aktuellen Forschungsstand wiedergeben und über die Wirksamkeit erlebnispädagogischer Maßnahmen informieren. Danach wird sich mit kritischen Aspekten der Erlebnispädagogik auseinandergesetzt. Dieser Abschnitt ist von großer Bedeutung. Denn darin soll gegen unberechtigte oder oberflächliche Kritiken argumentiert werden, um der Erlebnispädagogik mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen und ihr somit eine feste Position innerhalb der pädagogischen Präventions- und Interventionspraxis zu sichern. Damit die erlebnis-pädagogischen Ideen überhaupt eine angemessene Umsetzung erfahren können, müssen zunächst die in der Auslegung der Erlebnispädagogik entstandenen Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden. Dazu gehören eine klare Definition der erlebnispädagogischen Begriffe, die Einordnung in den pädagogischen Kontext und eine realistische Vorstellung über die praktische Umsetzbarkeit. Letzten Endes dient dieses Kapitel der Konkretisierung der erlebnispädagogischen Möglichkeiten und Chancen sowie der Hervorhebung ihrer Grenzen.
Die beiden letzten Kapitel setzen sich abschließend mit der Beantwortung der Leitfragen auseinander. Hierbei werden anhand der Kriterien von Ergänzbarkeit die Anknüpfungspunkte zwischen der Erlebnispädagogik und dem Training mit aggressiven Kindern erläutert als auch deren Unterschiede, die in ihrer Kombination das Wirkungsspektrum der einzelnen Maßnahmen erweitern können. Außerdem werden Aspekte aufgezeigt, die sich mit den Möglichkeiten der Effektivitäts-steigerung und einer nachhaltigen Wirksamkeit beschäftigen.
Mit dieser Arbeit wird das Ziel verfolgt, dem Mythos Erlebnispädagogik eine klare Gestalt zu verleihen und damit die tatsächlichen Potenziale aufzuzeigen, die sich in der kombinierten Anwendung mit einem Verhaltenstraining gewinnbringend nutzen lassen.
2 Pädagogische Grundlagen als Basis der wissenschaftlichen Betrachtung
2.1 Pädagogik und ihre Inhalte
"Ein Hauptzug aller Pädagogik: Unbemerkt führen.“
(Morgenstern 2008: 275)
Die Pädagogik verfolgt eine lange Tradition und war immer wieder Wandlungsprozessen unter-zogen, indem sie in der griechischen Antike der Politik, später der Rhetorik, der Ethik oder vormals der Philosophie zugeordnet wurde (Böhm 2000: 404). Pädagogik hat ihren Ursprung in der grie-chischen Bezeichnung 'paideia', was wörtlich übersetzt bedeutet, das Kind zu führen. Entgegen der engen Bedeutung des etymologischen Wortes 'paidagogos' (den Sklaven oder Knaben zur Schule führen) meint Pädagogik von Anfang an „[...] die Lehre und die Theorie von der menschlichen Bildung und Erziehung“ (Böhm 2004: 750) und darin „[...] jede Höherentwicklung des Menschen durch Bildungs- und Erziehungsprozesse“ (Stein 2009: 11). Dabei setzt sich die Pädagogik, spätestens seit Einführung des Bachelorstudienganges als synonym bezeichnete Erziehungs-wissenschaft, neben den bereits genannten Themen mit denen des Lernens und der Sozialisation auseinander. Die Erziehungswissenschaft beobachtet, interpretiert und erklärt die jeweiligen Phänomene innerhalb der Prozesse und trifft auf dieser Grundlage Vorhersagen, die wiederum dazu dienen, den in der pädagogischen Praxis tätigen Professionellen Handlungswissen bereitzustellen. Schlussfolgernd setzt sich die Pädagogik mit vier zentralen Gegenstandsbereichen auseinander: Erziehung, Bildung, Sozialisation und Lernen. Obwohl sich die Begriffe häufig überschneiden und keiner einheitlichen Definition unterliegen, soll hier für ein klares Verständnis folgende Differen-zierung vorgenommen werden.
Erziehung meint die intentionale Einwirkung einer bereits erzogenen, erwachsenen Person auf die Entwicklung eines Heranwachsenden, während Bildung im Sinne einer Selbstbildung, Subjek-tivierung oder Einverleibung von Wissensbeständen zu verstehen ist, die sich der Erziehung anschließt bzw. sie ergänzt und in der selbständigen Auseinandersetzung mit der Welt stets freiwillig und autonom geschieht. Sozialisation deckt darüber hinaus alle sonstigen Umwelt-einflüsse (Peergroup, soziales Milieu) und zufällige Einwirkungen (Vorbilder) auf die Entwicklung des Menschen als soziales Wesen ab. Lernen ist schließlich das Produkt aller fremd- und selbst-wirksamen Einflüsse, welches bewusst oder unbewusst zur Veränderung oder Erweiterung der Persönlichkeit führt und den Menschen ein Leben lang begleitet. Zwei Begriffe, die Erziehung und das Lernen, sind für diese Arbeit von besonderer Bedeutung und bedürfen der eingehenden Betrach-tung, so wie sie auch bei Prange im Zentrum pädagogischen Handelns stehen.
2.2 Erziehung als pädagogische Aufgabe und Lernen als ihre Antwort
Prange (2005) unterteilt die Erziehung in zwei Teilbereiche. Auf der einen Seite steht das Erziehen und ist dem Erzieher zugedacht, auf der anderen Seite befindet sich das Lernen, welches in der Verantwortung des Edukanten liegt. Demzufolge sind an der Erziehung mindestens zwei Personen beteiligt, die sich in einer kommunikativen Interaktion befinden.
Erziehung allgemein wird beschrieben als „[...] intensive[s] Führen und Ziehen, um eine bestimmte Gestalt hervorzubringen oder zu ermöglichen“ (ebd., 35). Dabei versucht der Erzieher das Lernen in Richtung auf erwünschtes Verhalten zu lenken. Diese Aussage impliziert die Tatsache, dass die Intention des Erziehers nicht zwangsläufig mit dem übereinstimmt, was der Zögling letztendlich lernt. In der Erziehung handelt es sich also nicht um ein Kausalitätsprinzip, wie es aus den Naturwissenschaften bekannt ist. Dennoch kann man von einer scheinbaren Ursache-Wirkungskette sprechen, da jeder erzieherische Eingriff oder Versuch der Einwirkung auf das Kind eine Folge nach sich zieht und sei es die, dass dabei keine Wirkung erzielt wird. Wer erzogen werden soll und welches Ziel damit verbunden ist, wurde soeben genannt. Nun bleibt noch die Frage nach dem 'Wie' des Erziehens offen.
Die Brücke zwischen Erziehen und Lernen bildet 'das Zeigen' als Grundform erzieherischen Han-delns. Das Zeigen gewinnt jedoch erst eine erzieherische Bedeutung, wenn es auf das Lernen bezogen wird. Die Zeigegebärde ist zum einen gerichtet auf Sachverhalte und zum anderen ver-bunden mit der Rückwendung auf das zeigende Subjekt, das der Gebärde erst ihren Sinn verleiht. Dem Kind wird also etwas gezeigt, in der Hoffnung es möge etwas daraus lernen. Dies kann in einer Vorbild- oder Modellfunktion (s. Kap. 3.4.3), mehr oder weniger intentional (ostensives Zeigen), oder dadurch geschehen, dass man dem Kind einen Sachverhalt erklärt (repräsentatives Zeigen) oder an ein bestimmtes Verhalten appelliert (direktives Zeigen). Ziel dieser Zeigeformen und damit die pädagogische Absicht ist, dem Kind etwas so zu zeigen, dass es in der Lage sein wird, es selbst wieder hervorzubringen.
„Was immer vermittelt und gezeigt werden soll, es bedarf dazu einer Vorstellung, wie es in die Situation eingeführt, erschlossen und lernbar gemacht werden kann, wie man das Gelernte sichert und dafür sorgt, dass es in Zukunft reaktiviert und ergänzt, überholt und benutzt werden kann.“ (Prange 2005: 74)
Wie bereits festgestellt wurde, führt das Zeigen nicht unweigerlich auch zum Lernen. Es ist sozusagen „[...] die Unbekannte in der pädagogischen Gleichung“ (ebd., 82). Lernen ist etwas elementares und unvermeidliches. Es ist an sich gegeben und individuell, während das Erziehen versucht, gelassen oder von anderen übernommen werden kann. Aber ohne die Fähigkeit zu lernen, kann keine Erziehung stattfinden. Ob und in welcher Form schließlich etwas gelernt wurde, zeigt sich erst im Nachhinein und bestimmt den Gegenstand des reaktiven Zeigens - die Rückmeldung. Um dem Zeigen eine gewisse Zuverlässigkeit zu verleihen, sind drei Aspekte zu beachten. Das Gezeigte muss zum einen verständlich sein und zum anderen zumutbar, das heißt auf den bisherigen Erfahrungen aufbauend. Und drittens sollte das Gezeigte anschlussfähig sein und somit in der Zukunft anwendbar. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der die vorher genannten mit einschließt, ist die Übung. Mit dem Zeigen können Lernprozesse in Gang gesetzt werden, während durch das Üben Handlungs- und Verhaltensweisen erprobt, modifiziert und gefestigt werden. Für diesen Zweck können Lernarrangements geschaffen werden, die auf den ersten Blick nicht erzieherisch wirken und dennoch nicht spurlos am Lernenden vorübergehen (z. B. ein Ausflug). Übung erzeugt schließ-lich Gewohnheiten und findet mit der Automatisierung ihr Ende. Doch soll das nicht heißen, dass Gewohnheiten nicht wieder aufgegeben und durch andere ersetzt werden können (Prange 2006: 56).
Der letzte Aspekt deutet bereits auf die Zielsetzung (Gewohnheitsänderung) des Trainings mit aggressiven Kindern hin und lässt Ansätze der erlebnispädagogischen Arbeit (Lernarrangements) erkennen. Auf diesen Zusammenhang wird jedoch später noch genauer eingegangen.
2.3 Lernen – eine Definition
„Lernen ist ein Weg, eine Reise, die sich wohl planen, aber nicht kontrollieren läßt.“
(Schödlbauer 1999: 54)
Die Fähigkeit zu lernen ist dem Menschen angeboren. Andernfalls würde er geistig ein ewiger Fötus bleiben, ausgestattet mit ein paar wenigen Reflexen und Überlebensinstinkten. Lernen erfolgt oft beiläufig, wenn man von der bewussten Aneignung von Wissensbeständen absieht und die Reflexion über das Gelernte auf der Metaebene belässt. Erst die kognitive Auseinandersetzung lässt das Erlernte bewusst steuerbar und übertragbar werden. Dies trifft vor allem auf das schulische Lernen zu, während das Erlernen von Verhaltensweisen vielmehr unbewusst geschieht.
Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass Lernen eine längerfristige Veränderung als natürliche Folge von Erfahrungen ist und mentale Repräsentationen voraussetzt (Seel & Hanke 2010: 11). Oder anders formuliert: „Lernen ist eine erfahrungsbedingte Veränderung der Möglichkeit eines lebenden Systems, in einer Umwelt einen Zustand einnehmen zu können, der anschlussfähig an die Fort-setzung der eigenen Autopoiesis ist“ (Treml & Becker 2007: 107). Lernen meint außerdem „[...] die erfahrungsreflexive, auf den Lernenden sich auswirkende Gewinnung von spezifischem Wissen und Können“ (Göhlich & Zirfas 2007: 17). Schott (2003) geht noch einen Schritt weiter und versteht Lernen als „[...] wechselseitige Einflußnahme von Sinnlichkeit, Verstand, Gefühl und Wollen“, das sich dem Erleben als Instrument bedient - mehr noch - das darin seine Existenzgrundlage findet (ebd., 251). Es kann außerdem in den verschiedenen Formen des Neulernens (Erwerb von Wissen und Fähigkeiten), Hinzulernens (Anknüpfung an vorhandenes Wissen oder Fähigkeiten) oder Umlernens (Veränderung von Wissen und Fähigkeiten verbunden mit einem Verlernen) auftreten, wobei die Übergänge fließend sind und nicht selten zwei oder alle Arten dicht beieinander in einem Lernprozess vorkommen (Dinkelaker 2011: 133). Lernen kann letztendlich stets als eine Form der Weiterentwicklung (im positiven wie im negativen Sinne) betrachtet werden.
2.4 Lernen in Raum und Zeit
Lernen geschieht in einem bestimmten Raum zu einer bestimmten Zeit.
Raum kann dabei konkret beschrieben werden als Klassenzimmer, Wald oder Bolzplatz, aber auch abstrakt als Erfahrungs-, Handlungs- oder Lehrraum. Letzterer ist ein pädagogisch inszenierter Raum, in dem Materialien als Anregung oder zur Förderung des Lernens dargeboten werden. Dieser Raum gestaltet sich aber erst dann zu einem Lernraum, wenn der Lernende ihn als solchen aktiviert. Aber auch Erfahrungs- und Handlungsräume können pädagogisch genutzt werden, indem der Raum den Lernenden animiert Erfahrungen zu machen oder handelnd tätig zu werden. Daraus können schließlich Lernprozesse erwachsen. Dabei ist es wichtig, Räume so zu gestalten, dass sie den Vorstellungen und Interessen des Lernenden entsprechen und ihm Möglichkeiten geben, sich selbständig in ihnen zu bewegen und sich mit den darin enthaltenen Dingen auseinanderzusetzen (Göhlich & Zirfas 2007).
Die Aneignung von Wissen und Fertigkeiten geschieht innerhalb eines Zeitrahmens, durch den die Qualität der erworbenen Kenntnisse mitbestimmt wird. Die Verfügbarkeit von Zeit wird dabei häufig, wie zum Beispiel in der Schule, vorgegeben. Dieser Umstand setzt die Kinder einem gewissen Druck aus, sich die dargebotenen Wissensbestände innerhalb einer bestimmten Zeitspanne anzueignen. Mit der historischen Entwicklung sind die Zeiträume immer kleiner geworden, während der Lernumfang gestiegen ist. Dadurch werden die Kinder mit einer Beschleunigung des Lernens konfrontiert, das eine langfristige Veränderung innerer Strukturen, was der Definition des Lernens entspricht, kaum noch möglich macht. „Zeigen braucht die Zeit als Nacheinander von Terminen, um in Situationen [bzw. Räumen] platziert zu werden, und Lernen braucht die Modalzeit des Zeitigens [Bewirkens], um das Gezeigte in die eigenen Ordnungen hier und jetzt einzufügen“ (Prange 2005: 124; Ergänzungen: M. S.). Doch auf die Bedeutung der Modalzeit wird heutzutage kaum noch Rücksicht genommen. Genauso wie Räume sinnvoll gestaltet werden sollten, ist es auch notwendig, die Zeiten so zu wählen, dass sie altersentsprechend und auf die Ressourcen des Lernenden zugeschnitten sind und somit das Zeitigen ermöglichen (Göhlich & Zirfas 2007).
Inwiefern Zeiten und Räume sinnvoll im Training mit aggressiven Kindern und in der Erlebnis-pädagogik genutzt werden, wird noch zu sehen sein.
3 Lerntheorien
3.1 Pädagogische Theorien des Lernens
„Die Umgebung lernunterstützend zu gestalten, d.h. so, dass sie anregend, klärend, aber auch stärkend wirkt, ist die vornehmste pädagogische Aufgabe.“
(Göhlich & Wulf & Zirfas 2007: 9)
Lernen aus pädagogischer Sicht heißt, das „[...] Verhältnis zwischen Lernendem und Welt als Möglichkeit der Weiterentwicklung [...] zu begreifen“ (Göhlich & Wulf & Zirfas 2007: 7). Dabei gründet jedes pädagogische Handeln auf die Initiation oder Beeinflussung von Lernprozessen (Dinkelaker 2011: 133).
Göhlich, Wulf und Zirfas (2007) legen ihrem Lernbegriff eine Systematik zugrunde, welche das Lernen in vier Dimensionen einteilt: Wissen-, Können-, Leben- und Lernen-Lernen. Dabei können die Lerndimensionen den von Prange (2006) aufgeführten Formen des Zeigens zugeordnet werden.
Das Wissen-Lernen, bei dem es um konkrete, objektive und vermittelbare Inhalte geht, bezieht sich auf die Operation des repräsentativen Zeigens. Wenn das Lernen von Fertigkeiten (Können-Lernen) gefragt ist, kommt das ostensive Zeigen ins Spiel, bei dem Gelegenheiten der Übung, des Nach-ahmens und des Erfahrungslernens geboten werden und die (Weiter-)Entwicklung von Handlungs-praktiken angestrebt wird. Leben-Lernen ist verbunden mit einer Befähigung zur selbständigen Bewältigung des Lebens. Dazu gehört, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, seine Ressourcen gewinnbringend zu nutzen, aber auch kritisch zu denken und als Individuum eigene Haltungen zu entwickeln. Dem kann das direktive Zeigen zugeordnet werden, dass nicht nur eine appellierende Funktion erfüllt, sondern auch auf eine Selbsterziehung hinwirkt und eine gewisse Eigenmotivation voraussetzt. Zu guter Letzt kann dem Lernen-Lernen das reaktive Zeigen gegenübergestellt werden, das mittels Rückmeldung Auskunft darüber gibt, wie etwas gelernt wurde. Diese Dimension des Lernens bzw. Zeigens überspannt die drei anderen Aspekte und wirkt immer mit.
Die wesentlichen und für diese Arbeit relevanten Dimensionen des Lernens sind das Können- und das Leben-Lernen und werden im Folgenden näher besprochen. Dabei werden vor allem solche Lernformen erläutert, die im Zusammenhang mit dem Erlernen sozialer und kommunikativer Fähigkeiten stehen.
3.1.1 Können lernen
3.1.1.1 Mimetisches Lernen (Wulf 2007)
Kern dieser Lernform ist die Nachahmung einer bei anderen Menschen wahrgenommenen Hand-lung, die jedoch nicht einfach reproduziert, sondern aus der etwas Eigenes erzeugt wird. Dies geschieht aber erst dann, wenn die verinnerlichte Repräsentation nach Außen getragen und die Handlung selbst vollführt wird. Dieser Prozess ist eingebettet in die umgebende Kultur, bei dem sich die eigene Lebenswelt im ständigen Austausch mit den Lebenswelten anderer befindet und somit die Orientierung im sozialen Feld ermöglicht.
Die Autoren distanzieren sich zwar von den klassischen Lerntheorien (aus Psychologie und Bio-wissenschaften), doch können klare Verbindungslinien zwischen dem mimetischen Lernen und dem Modelllernen nach Bandura, worauf später noch eingegangen wird, gezogen werden. Auf eine detaillierte Darstellung dieser Lernform wird aus genanntem Grund an dieser Stelle verzichtet.
3.1.1.2 Leibliches Lernen (Liebau 2007)
Damit ist gemeint, wie der Mensch als fühlendes, sich selbst und die Umwelt wahrnehmendes sowie in diese eingreifendes Wesen lernt, sich in der Welt zu artikulieren, sie sinnlich in sich aufzunehmen und seine Fähigkeiten im gestalterischen, körperlichen und intersubjektiven Bereich auszubilden. Die Übung steht dabei im Mittelpunkt und bildet die Grundlage aller Entwicklungs-prozesse, die auf das 'Können' (die Befähigung) hin ausgerichtet sind.
Leibliche Weltzugänge schafft sich der Mensch unter anderem über seine Sinne, die allesamt bei der Wahrnehmung dessen, was um ihn herum geschieht, beteiligt sind. Der Mensch ist gleichzeitig in der Lage und aufgrund der Fülle von Sinneseindrücken gar dazu genötigt, eine Selektion der aufgenommenen Reize vorzunehmen. Dies richtet sich nach den Interessen der Person und wird dadurch zu einem individuellen Vorgang, was dem konstruktivistischen Ansatz, der weiter unten noch besprochen wird, schon sehr nahe kommt. Weiter erschließt sich der Mensch die Welt durch Bewegung und Handlung, sprich durch Selbsttätigkeit. Die Welt zeigt sich dem Menschen, wie sie tatsächlich ist. Er aber nimmt sie so war, wie er denkt, dass die Welt sei. Gleichzeitig zeigt sich der Mensch auf kommunikativer Ebene wiederum der Welt und wird durch sie so wahrgenommen, wie er sein Ich nach Außen hin, durch Mimik und Gestik, Sprache und Kleidung, symbolisiert. In beide Richtungen können aufgrund der subjektiven Wahrnehmung Fehlinterpretationen auftauchen und Dissonanzen in der Interaktion entstehen. Auch darauf wird später noch einmal eingegangen.
3.1.2 Leben lernen
3.1.2.1 Biografisches Lernen (Delory-Momberger 2007)
Damit ist das lebenslange Lernen gemeint, wobei die Lehre aus dem Leben selbst gezogen wird und aus den gemachten Erfahrungen. „Die erworbenen Erfahrungen bilden organisierte biographische Ressourcen, die die Wahrnehmung der Umwelt strukturieren und dem Erleben der Gegenwart und der Zukunft eine Gestalt geben“ (ebd., 144). Über die Zeit häuft der Mensch Wissen an, das von objektiviertem Wissen, über prozedurales bis hin zu sozialem Wissen über sich und andere reicht. Durch die Kumulation dieses Erfahrungswissens generiert der Mensch sein individuelles bio-grafisches Wissen. Es unterscheidet sich somit vom erworbenen Faktenwissen und kann nicht zertifiziert werden. Biografisches Lernen wird von Sozialisations- und Bildungsprozessen begleitet und erfolgt eher selten in einer bewussten Aneignung. Es kann sich durch Gelegenheiten vollziehen, durch Irritationen und Krisen. Es wird getragen von emotionalen und symbolisch-wiederkehrenden Erfahrungen und kann durch reflektierendes Lernen bewusst gemacht und vertieft werden. Trotz aller Individualität, die dem biografischen Lernen zugrunde liegt, ist es stets eingeflochten in soziale Gefüge, Institutionen und vorgegebene Strukturen. „Jedes Lernen, ob strukturiert oder nicht, ob gewollt oder nicht, ist ein sozial festgelegter und sozial konstruierter Akt, doch Lernen findet nur statt in Verbindung mit der Einzigartigkeit einer Biographie“ (ebd., 151).
3.1.2.2 Das Lernen der Lebenskunst (Zirfas 2007)
Hierbei wird das Lernen „[...] als reflexiver Erfahrungsprozess verstand, der die subjektiven Auseinandersetzungen und Resultate fokussiert, die sich aus den bewussten und unbewussten, geplanten und ungeplanten Aktivitäten der (pädagogischen) Umwelten ergeben“ (ebd., 163). Erfahrungen verstehen sich hier in einem eingeschränkten Sinne als etwas Neues, das gewohnte Denk- und Verhaltensmuster in einem reflexiven Prozess aufhebt, erweitert oder verändert.
Eine Pädagogik der Lebenskunst fokussiert eine Lebensgestaltung, die auf ein erfüllendes und glückliches Leben abzielt, indem sie Rahmenbedingungen schafft, die den Menschen befähigen sollen, sich aufgrund erlangter Erfahrungen durch Selbstsorge diesem Ziel zu nähern. Der Aus-gangspunkt des Lernens wird bei dieser Form in der Erkenntnis gesehen, mit dem bisherigen Wissen und der vermeintlichen Sicherheit nicht weiter zu kommen. Der Prozess des Verlernens kann durch eine negative Erschütterung in Gang gebracht werden, so wie es Sokrates durch seine Gesprächsführung häufig bei seinen Zuhörern erwirkte. Ausschlaggebend für das Erlernen der Lebenskunst ist Offenheit gegenüber alternativer Lebens-, Verhaltens-, Handlungs- und Denk-weisen sowie die Fähigkeit zur differenzierten Wahrnehmung. Das Ziel ist ein höchst anspruchs-volles und besteht nicht etwa in einem bloßen Hinzulernen, sondern verfolgt die Neustrukturierung der eigenen Lebensform, gewissermaßen das Ersetzen des Alten.
Weniger idealistisch und dennoch in diese Richtung gehend ist die aktive Auseinandersetzung mit sich und der Welt in metakognitiver und reflexiver Gestaltung. Auch die Reformpädagogen vertraten die Auffassung, das Leben sei nur im Leben selbst zu lernen. Die Pädagogik kann deshalb nur begrenzt die Lebenskunst lehren, sie kann aber Erfahrungsräume bereit stellen, in denen reflektierendes Denken angeregt wird und Erkenntnis- sowie Veränderungsprozesse aktiviert werden können. Wie noch zu sehen sein wird, bietet die Erlebnispädagogik dafür geeignete Lernfelder.
3.2 Handlungs- und erfahrungsorientiertes Lernen
„Gibt es einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Es gibt ihn. In der Tat.“
(Werner Mitsch, zit. n. Gudjons 2008: 153)
Wie schon aus dem Begriff hervorgeht, lernt das Individuum aufgrund seiner eigenen Tätigkeiten und der daraus resultierenden Erfahrungen. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Name Dewey genannt, welcher auch den für die Erlebnispädagogik charakteristischen Ausspruch „Learning by doing“ prägte. Seiner Auffassung nach ist Lernen aus Erfahrungen wesentlich wirkungsvoller als das Lernen einer Theorie. Denn jede Theorie entwickelt sich aus den Erfahrungen heraus. Demzufolge bedient sich jedes Individuum bei dieser Lernform an der ursprünglichen Quelle und schöpft daraus sein Wissen und Können (Heckmair & Michl 2008a: 46).
Dieser Annahme kann ich aus der Erfahrung mit meinem „Mogli“, einem zehnjährigen Jungen, den ich regelmäßig im Rahmen des Mentorenprojektes „Balu & Du“ traf, zustimmen. Denn auch er erinnerte sich an die Momente am besten, in denen er selbst aktiv sein konnte und fand diejenigen Treffen am besten, bei denen wir Museen besuchten, die zum eigenen Tätigwerden animieren (z. B. Experiminta und Kindermuseum).
In der Theorie des „experiential learnings“ (Eberle 2002: 166), so wie man handlungs- und erfahrungsorientiertes Lernen im englischen Sprachraum bezeichnet, wird Lernen als zirkulärer Prozess verstanden. Demnach steht zu Beginn eine Handlung, aus welcher eine konkrete Erfahrung folgt, die wiederum über Beobachtungs- und Reflexionsprozesse zu einem abstrakten Konzept weiter verarbeitet und generalisiert wird und das schließlich in einer neuen Situation Anwendung findet. Das Erfahrungswissen wird somit durch erneutes Handeln und weitere Erfahrungen stets neu- und umgestaltet, sodass aus dem Entwicklungsprozess ein Wachstum der eigenen Persön-lichkeit resultiert. Die pädagogische Arbeit beschränkt sich nach Dewey dann nur noch auf die Bereitstellung von Lerngelegenheiten und das Schaffen von Anreizen zur Betätigung im Sinne des informellen Lernens (vgl. Heckmair & Michl 2008a: 48f.). Ganz so radikal wurden Deweys Ansichten jedoch nicht in die Praxis übertragen. Es geht aber in diese Richtung.
Heckmair und Michl (2008a) haben sich mit der Aktualität handlungsorienierter Ansätze beschäftigt und deren Möglichkeiten thesenartig formuliert. Folglich sollten diese Methoden auf die Interessen der Adressaten abgestimmt sein, sie in ihrer Lebenswelt abholen oder den Grundstein für Erfahrungen in anderen, vielleicht noch unbekannten Bereichen legen. Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. Können Kinder und Jugendliche in einem ihnen bekannten Raum agieren, fühlen sie sich sicher und sind interessiert. Situationen und Standorte, die aus ihrer Lebenswelt hinausführen, bergen zunächst das Gefühl von Unsicherheit und Skepsis, rufen aber auch Neugier hervor. Solche Momente bieten die besondere Gelegenheit neue Perspektiven einzunehmen, von außen auf sich selbst und seinen Alltag zu blicken und dadurch neue Lebens- oder Lösungswege aufzudecken. Des Weiteren können handlungsorientierte Methoden Kontrastphasen der Ruhe und Entspannung ermöglichen. Denn „[...] vielleicht sind die körperlichen Anstrengungen und die Leistung, das äußere Erobern und Erleben nur die Voraussetzung für die pädagogisch wertvollen Augenblicke der Pause und des Miteinander-Redens“ (ebd., 57). Von der persönlichen Seite weggehend hat gemeinsames Handeln auch einen verbindenden Charakter und führt Individuen als Gruppe zusammen, die geschlossen auf ein Ziel hinarbeiten. Dabei ist der Weg dahin die ent-scheidende Komponente, welche den Lernprozess fördert und in Erinnerung bleibt. Der wichtigste Aspekt, der jedes pädagogische Handeln anbelangt und vor allem das erfahrungs- und handlungs-orientierte Agieren betrifft, ist die Tatsache der Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit der Effekte. „Personen, Konstellationen, Ausgangsbedingungen, Stimmungen und Gefühle sind viel-fältig und in ihrer Mischung einmalig“ (ebd., 59), genau wie die damit in Beziehung stehenden, nicht wiederholbaren Erlebnisse und den daraus resultierenden Erfahrungen. Es ist deshalb noch einmal festzuhalten, dass pädagogisch inszenierte Lerngelegenheit und Arrangements immer nur dem Versuch der Annäherung an die mit der (erlebnis)pädagogischen Aktion intendierten Ziele dienen.
3.3 Konstruktivistisches Lernen
„Alle sehen dasselbe, aber doch jeder anders und auf seine Weise nach dem jeweiligen Standort.“ (Prange 2009: 174)
Die konstruktivistische Lerntheorie (vgl. Göhlich & Zirfas 2007) geht davon aus, dass sich jeder Mensch seine Wirklichkeit selbst konstruiert und objektive Erkenntnisse nicht möglich sind. Wissen oder Annahmen über die Wirklichkeit können deshalb nicht eins zu eins von einem Menschen an den anderen weitergegeben werden. Stattdessen nimmt der Mensch die Welt mit seinen Sinnen wahr und interpretiert das Aufgenommene auf der Grundlage seiner bisherigen Erfahrungen, um es schließlich in seinen bereits vorhandenen Wissenskanon zu integrieren (vgl. Leibliches Lernen). Lernen ist nach dieser Auffassung als ein aktiver, dynamischer Prozess zu verstehen, der von der Umwelt angeregt und beeinflusst, vom Individuum jedoch angetrieben und gesteuert wird. In diesem Zusammenhang ist Lernen stets auch eingebettet in soziale Kontexte und kann als kommunikativer Vorgang verstanden werden, der im Sinne der Ko-Konstruktion durch Abgleich und Verständigung der jeweils subjektiven Konstruktionen ein gemeinsames Bild von der Welt erschafft.
Die Konstruktion der Wirklichkeit lässt sich auch neurologisch erklären. Denn jeder Mensch nimmt seine Umwelt selektiert wahr. Aus den wahrgenommenen Reizen kreiert er schließlich ein Bild. Und da jeder Mensch eine andere Selektion der Reize vornimmt, entstehen auch in jedem Gehirn andere Bilder und Eindrücke (Damasio 2007: 231ff.).
Dem Konstruktivismus gegenüber steht der Kognitivismus (vgl. Göhlich & Zirfas 2007), der Ler-nen als einen Informationsverarbeitungsprozess versteht. Der Mensch nimmt die Reize aus seiner Umwelt wahr und verarbeitet die Informationen selbständig auf der Grundlage seines mentalen Modells, seiner bereits vorhandenen Informationen. Dabei werden objektive Informationen über ein Medium an den Rezipienten übertragen. Lernprobleme werden dabei zurückgeführt auf fehlerhafte Informationen, unangemessene Medien oder eine gestörte Informationsaufnahme. Aus der kogniti-vistischen Lerntheorie hat sich schließlich der moderne Konstruktivismus entwickelt und durchge-setzt, der auch die kognitiven Elemente der Reizverarbeitung berücksichtigt.
Eine Lernumgebung sollte somit offen gestaltet sein, um konstruktives Lernen zu ermöglichen. Das heißt, was und wie gelernt wird, bleibt dem Lernenden überlassen. Die Bereitstellung von Materialien oder situativen Kontexten und die Unterstützung durch den Lehrenden kann den Lernprozess jedoch stark beeinflussen. An diese Stelle tritt das pädagogische Moment, das in der Eingangsdefinition beschrieben wurde.
Ziel pädagogischer Bemühungen soll sein, eine Umgebung zu schaffen, in der Wissen und Fähig-keiten durch die Bearbeitung von möglichst authentischen und bedeutungsvollen Problemen von Anfang an unter praktischen Gesichtspunkten erworben werden können (Reinmann & Mandl 2006: 629). Dabei sollen die neu zu erlernenden Inhalte an das Vorwissen anknüpfen und in den je-weiligen Lebenskontext passen. Eine Verbindung zwischen den eigenen Interessen, dem situativen Kontext und lebensnaher Inhalte bildet eine gute Basis für die konstruktive Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand.
Zu erwähnen ist an dieser Stelle der Einwand, dass der Konstruktivismus eine „[...] alte Idee unter neuem Namen“ (Göhlich & Wulf & Zirfas 2007: 103 - Fußnote) ist und sich bereits die Reform-pädagogen und ihre Vordenker (Rousseau, Pestalozzi u. a.) mit den Inhalten dieses Ansatzes beschäftigt hatten.
3.4. Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura
Diesem Kapitel wird besonders große Beachtung geschenkt, da sich die Inhalte zu großen Teilen auch mit der pädagogischen Theorie des Lernens überschneiden und die sozial-kognitive Lern-theorie als Grundlage für das Training mit aggressiven Kindern dient. Sie bietet außerdem Erklärungen dafür, warum sich Menschen so und nicht anders verhalten, warum manche Personen ein Verhalten an den Tag legen, das objektiv betrachtet selbstschädigend ist und sie liefert Begründungen dafür, warum der Apfel bekanntlich nicht weit vom Stamm fällt.
Die aus der Psychologie bekannte sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura beschreibt die wechselseitige Determination von Mensch und Umwelt und grenzt sich somit von der reinen Vererbungstheorie sowie dem radikalen Behaviorismus ab. Bandura nennt zwei Möglichkeiten, wie Reaktionsmuster erworben werden. Diese können zum einen durch unmittelbare Erfahrung oder zum anderen durch Beobachtung erlernt werden. Auf beide Komponenten sowie deren Einfluss-faktoren soll im Folgenden eingegangen werden. Dabei beziehen sich alle Ausführungen auf die deutsche Übersetzung der sozial-kognitiven Lerntheorie nach Bandura von 1979, ergänzt durch passende Beiträge anderer Autoren.
3.4.1 Das Erfahrungslernen
Jeder Mensch ist jeden Tag begleitet von Ereignissen, die er wahrnimmt, verarbeitet und erinnert. Der daraus entstehende Zusammenhang zwischen der Situation, dem eigenen Tun und den Folgen wird als Erfahrung im Gedächtnis abgelegt. Neuerliche Erfahrungen werden mit den bereits vorhandenen abgeglichen und wirken in ihrer Gesamtheit auf das zukünftige Denken und Tun.
Verhaltensweisen stabilisieren sich oder werden aufgegeben in Abhängigkeit von der Reaktions-konsequenz. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Verhalten, dem eine positive Konsequenz folgt, bestärkt und somit beibehalten wird. Dies geschieht umso deutlicher, je bewusster sich die Person über den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang ist. Wenn bspw. eine Frau bei ihrem Frisör immer wieder einen tollen Haarschnitt bekommt, so wird sie als zufriedene Kundin sicher weiterhin diesen Frisör aufsuchen und ist sich über den Grund für ihre Wiederkehr bewusst. Hier spielt die motivationale Funktion eine wichtige Rolle. Der Mensch kann so in vielen Fällen die Reaktion auf sein Verhalten voraussehen und sein Handeln dementsprechend planen. Im Beispiel würde die Frau schließlich erneut zum gleichen Frisör gehen, in der Erwartung, anschließend wieder mit einem schönen Haarschnitt heimzukehren. Diese Gewohnheiten sind wichtig, um nicht jede Situation neu einschätzen zu müssen.
Der Mensch lernt also aus seinen Erfahrungen und deren Folgen. Positive Erfahrungen veranlassen ihn, sein Verhalten aufrechtzuerhalten, während negative Erfahrungen Anstoß zu einer Verhaltens-änderung geben. In der Regel lernt man nur dann etwas Neues, wenn Ereignisse auffällig genug sind, dass sie zur Kenntnis genommen werden (vgl. Prange 2005: 117).
3.4.2 Das Erwartungslernen
Ein Teilbereich des Erfahrungslernens ist das Erwartungslernen. Danach können Menschen die wahrscheinlichen Konsequenzen ihres Handelns oder von Ereignissen aufgrund ihrer Erfahrungen einschätzen und ihr Verhalten folglich regulieren.
Im Laufe der Entwicklung gewinnen zunächst neutrale Symbole, Ereignisse oder Situationen einen bestimmten Vorhersagewert, sodass die Reaktionen in zunehmendem Maße den Erwartungen zufolge automatisiert werden. Das gleiche kann aber auch stellvertretend geschehen, indem eine Person (Modell) bspw. ängstlich auf eine Situation reagiert und der Beobachter diese Angst internalisiert. Dies geschieht häufig bei Säuglingen, welche die Ängste der Mutter zu ihren eigenen machen. Bandura spricht dann von „modellierten Affekten“ (ebd., 73).
Der Sonderfall des Symbolischen Erwartungslernens bezieht sich auf Erfahrungen, die mit Stereotypen, Emotionen oder übergeordneten Prinzipien im Zusammenhang stehen. Es handelt sich dabei vor allem um subjektive Assoziationen, welche in einer neuen Situation ein bestimmtes Verhalten oder Gefühle auslösen, die eigentlich keinen Bezug zu der assoziierten Situation haben. Solche Phänomene spielen zum Beispiel bei Vorurteilen eine Rolle oder beim Erwerb von Fetischen. Auf diese Weise kann ein Mann, der im gleichen Kleidungsstil wie der gewalttätige Vater auftritt, bei einem Kind Angst oder Aggression auslösen, weil es die Kleidung mit Gewalt assoziiert. Diese Form des Lernens ist aus der behavioristischen Verhaltenstheorie auch als klassische Konditionierung bekannt.
Bandura betont noch eine zweite Seite der Medaille, nämlich die selbsterregenden Faktoren (ebd., 75f.). Das heißt, dass eine Konditionierung auch teilweise abhängig von den eigenen Kognitionen ist. Demnach könnte eine gedankeninduzierte Angst, an einem Freitag den 13. geschähen Unglücke, durch die Veränderung der Gedanken wesentlich leichter beeinflusst werden, als eine auf unmittelbarer Erfahrung beruhende Angst. So würde ein Mensch, dem an einem Freitag den 13. etwas Negatives widerfahren ist und der dieses Ereignis auch mit genau diesem Tag kognitiv und emotional verbindet, in der Folge mit ängstlicher Erwartung dem nächsten Freitag den 13. ent-gegensehen. In diesem Fall ist die Angstreaktion nicht einfach durch kognitive Mittel zu verändern. Häufig sind dafür wiederholt Erfahrungen notwendig, welche der bisherigen Erwartung wider-sprechen und ein Umlernen ermöglichen. Lassen sich Assoziationen, die sich ungünstig auf das Verhalten auswirken, hauptsächlich auf fehlerhafte kognitive Verbindungen zurückführen, dann kann dem durch eine Veränderung der Gedanken recht mühelos entgegengewirkt werden. Denn wird der berüchtigte Freitag der 13. als ein Tag wie jeder andere angesehen, muss man sich auch nicht mehr vor ihm fürchten.
3.4.3 Das Modelllernen
Doch nicht nur die persönlichen Erfahrungen prägen das Verhalten einer Person, das Lernen am Modell spielt eine ebenso große Rolle und findet über die Beobachtung gezeigter Verhaltensweisen anderer Menschen ihren Ausgangspunkt. Ob eine solche Beobachtung den Lernprozess anregt, ist abhängig von der Attraktivität und der Präsenz des Modells sowie dem Funktionswert des gezeigten Verhaltens einerseits und der individuellen Wahrnehmungseinstellung und -kapazität andererseits. Um ein Verhalten modellieren zu können, bedarf es also zunächst der Aufmerksamkeit des Beobachters.
Eine Mutter berichtete einmal, wie sie im Winter den festen Schnee unter dem Auto weggetreten hatte und ihr Sohn es ihr ein paar Tage später gleich tat, dann aber kein Schnee mehr an besagter Stelle war und er mit dem Fuß gegen das Auto stieß.
Kinder ahmen oftmals das Verhalten anderer Personen nach, ohne dabei den Sinn der Handlung zu verstehen. Das liegt darin begründet, dass das was man sieht, nicht exakt wiederholbar ist und auch nicht das Motiv der Handlung erklärt. Stattdessen werden lediglich Repräsentationen dessen ge-bildet, was der Mensch wahrnimmt. Sie können verbal und/oder visuell in der eigenen Vorstellung verankert sein, wobei der Mensch in seiner Entwicklung tendenziell von der visuellen zur verbalen Vorstellung übergeht. Doch allein die symbolische Kodierung, welche das Erinnern beobachteter Verhaltensweisen ermöglicht, ist nicht ausreichend, um sich ein Verhalten dauerhaft anzueignen. Dafür sind Wiederholungen in Form der Übung notwendig.
Übungen sind in der Erziehung unabdingbar und eine Notwendigkeit, wenn es darum geht, Gewohnheiten auszubilden (vgl. Prange 2005: 131). Dabei besteht jede Handlung aus Teil-komponenten, die mit zunehmender Komplexität auch mehr Teilfertigkeiten erfordert. Ist eine oder sind mehrere Teilfertigkeiten nicht oder ungenügend ausgeprägt, so müssen erst diese geübt und angeeignet werden, bevor ein komplexes Verhalten gezeigt werden kann. Bandura würde bestä-tigen, dass kein Kind selbständig essen kann, wenn es die Auge-Hand-Koordination noch nicht gelernt hat. Beobachtung alleine führt folglich selten zur Perfektion. Modelllernen schließt immer den zwischenmenschlichen Austausch und Rückmeldeprozesse mit ein, welche die Aneignung von Teil-fertigkeiten unterstützen und somit Bestandteile einer jeden Erziehung sind.
Der Anreiz ist als letzte Komponente zu nennen, welche Bandura als Voraussetzung dafür angibt, ob ein beobachtetes Verhalten modelliert wird oder nicht. Ist mit der Handlung also eine positive bzw. mit dem Unterlassen der Handlung eine negative Konsequenz verbunden und ist diese für den Beobachter von Bedeutung, so ist es eher wahrscheinlich, dass er das beobachtete Verhalten auch tatsächlich nachahmen oder aber unterlassen wird. Bei dem beschriebenen Beispiel kann also aufgrund der negativen Rückmeldung der Mutter angenommen werden, dass eine Wiederholung des gezeigten Verhaltens zunächst ausbleiben wird.
Folgende schematische Darstellung soll den Prozess des Modelllernens noch einmal verdeutlichen (ebd., 32):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.4.4 Das korrektive Lernen
Verhaltensgewohnheiten können nur dann verändert werden, wenn sie durch korrektive Lern-erfahrungen abgelöst werden. Gespräche haben sich indessen als eher unwirksames Mittel zur Verhaltensänderung erwiesen, insofern eine anschließende Ausführung der besprochenen neuen Verhaltensweisen ausbleibt. Sich auf diese neuen Erfahrungen einzulassen, ist mit Anstrengung verbunden und abhängig von der Leistungseffizienzerwartung der Person. Das heißt, Menschen, die durch ihre Verhaltensänderung Erfolge erwarten, sind eher gewillt, ihre subjektiv empfundenen Hindernisse zu bewältigen und sich in scheinbar bedrohliche Situationen zu begeben. Die Erfolgs-erwartung kann durch andere Personen, welche die Situation unbeschadet und gefolgt von positiven Konsequenzen überstanden haben, verstärkt werden und dadurch auch die Erwartung an die eigene Leistung steigern. Im Gegenteil werden Menschen, die aufgrund schwacher Erwartungen vorzeitig aufgeben, ihr Verhalten über lange Zeit beibehalten.
Als eine wirksame Methode zur Korrekturerfahrung erweist sich die teilnehmende Modellierung (ebd., 89; vgl. „leibliches mimetisches Lernen“, Liebau 2007: 105). Dabei kann eine Person durch persönliche Mitwirkung und unter Anleitung des Modells korrigierende Erfahrungen in der Realität machen. Hierfür wird die Person in kleinen Schritten an ihr Zielverhalten herangeführt, stets unterstützt durch das Modell.
3.4.5 Einsatz und Wirkung von Bekräftigung und Bestrafung in Anlehnung an die operante Konditionierung
Egal ob das Lernen durch unmittelbare Erfahrung oder am Modell stattfindet, die Bekräftigung hat eine wichtige Funktion im Hinblick auf den subjektiven Nutzen eines Verhaltens. Wird positives Verhalten weder beachtet, noch verstärkt, unangemessene Verhaltensweisen jedoch mit Aufmerk-samkeit belohnt, so hat das positive Verhalten keine Chance sich durchzusetzen. Diese Art der Bekräftigung ist extrinsisch motiviert, erfolgt also willkürlich von außen. Die Konsequenz ist keine natürliche Folge des Verhaltens, sondern wird von einer anderen Person durch ihren Willen hervor-gerufen. Anders erfolgt die intrinsische Bekräftigung. Hier stehen das Verhalten und die daraus resultierende Konsequenz in einer natürlichen Beziehung zueinander.
Bandura beschreibt drei intrinsische Beziehungstypen. Die extern erzeugte Konsequenz ergibt sich, wenn ein Mensch im Regen Unterschlupf sucht und dadurch weniger nass wird. Wenn Essen den Hunger vertreibt oder das Adrenalin einen Kick verleiht, dann würde Bandura von dem zweiten Typ sprechen, dessen Konsequenz im Inneren eines Organismus spürbar ist. Die Selbstbekräftigung beschreibt schließlich den dritten intrinsischen Beziehungstyp, bei dem die erzeugte Zufriedenheit die vorangegangene Handlung bestärkt. Demnach kann ein Ereignis für eine Person durch die Kombination der drei Typen und zusätzlicher extrinsischer Verstärkung eine besondere Bekräf-tigung bewirken.
So erlebte ich die Besteigung des Huayna Picchu als äußerst positive Erfahrung, indem ich meine körperliche Fitness spürte, eine grandiose Aussicht genießen konnte, sich ein absolut zufriedenes Gefühl einstellte und ich die Bewunderung anderer Menschen entgegengebracht bekam. Dieses Erlebnis und einige andere motivierten mich, wieder mit dem Bergwandern anzufangen.
Doch Bandura gibt zu bedenken, dass nicht jede Belohnung sinnvoll ist. Wird ein Verhalten belohnt, das aufgrund persönlichen Interesses sowieso schon ausgeführt wird und sich die Beloh-nung auch nicht auf eine Leistungssteigerung bezieht, so kann dies unter Umständen sogar kontra-indiziert sein. Bestärkende Anreize sind vor allem dann angebracht, wenn bestimmte Fähigkeiten gefördert oder eine dauerhafte Verhaltensänderung bewirkt werden soll. Dabei ist zu berück-sichtigen, dass Belohnungen möglichst intermittierend gegeben werden, damit sie später durch soziale und selbstbewertende Anreize abgelöst werden können. Eine optimale Wirkung, um ein Verhalten dauerhaft zu verändern, erzielen deshalb variabel und mäßig eingesetzte Bekräftigungen.
Des Weiteren wird eine Anerkennung nicht immer auch als belohnend empfunden, nämlich genau dann nicht, wenn andere für die gleichwertige Leistung eine wesentlich höhere Belohnung erhalten. Dieses subjektiv empfundene Ungleichgewicht kann eine durchaus ernst gemeinte Belobigung zunichte machen. In gleicher Weise verhält es sich bei einer ausbleibenden Bekräftigung. Sie wirkt dann verstärkend, wenn eigentlich eine Bestrafung erwartet wurde oder umgekehrt wird sie als Strafe empfunden, wenn mit einer Belohnung gerechnet wurde. All diese Wechselwirkungen, die sich sowohl auf die eigenen Erfahrungen und Erwartungen als auch auf das beobachtete Verhalten anderer und die mit dem Verhalten einhergehenden Konsequenzen beziehen, regulieren das menschliche Verhalten.
Die Selbstregulation ist hierbei von großer Bedeutung. Menschen bewerten ihr eigenes Verhalten bzw. ihre Leistung im Vergleich zu anderen Personen oder nach Maßgabe ihrer eigenen Standards und nach den Leistungserwartungen an sich selbst. Die Selbstbewertungsstandards entwickeln sich im Laufe der Kindheit und orientieren sich an unterschiedlichen Modellen. Eine positive Selbsteinschätzung führt in der Regel zur Selbstbelohnung, eine negative Bewertung der eigenen Handlungen zur Selbstbestrafung. Ein Kind kann sich demzufolge nach Erhalt der Note 3 in einer Mathematikarbeit belohnen, wenn es in diesem Fach auf niedrige Leistungsstandards zurückgreift, während gleichzeitig ein anderes Kind bei der Note 2 enttäuscht über seine vom eigenen hohen Standard abweichenden Leistungen sein kann. Menschen entwickeln Standards in verschiedenen Bereichen ihres Lebens, die teilweise stark voneinander divergieren und abhängig von dem Wert sind, den sie ihnen beimessen. Der Nutzen persönlicher Standards liegt in der selbstregulierenden und motivierenden Funktion, sodass der Mensch nicht permanent auf äußere Rückmeldungen angewiesen ist, um mit sich selbst zufrieden zu sein oder sich in bestimmten Bereichen zu verbessern. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass unangemessene Standards zu permanenter Unzufriedenheit führen, wenn sie unerreichbar bleiben oder das Entwicklungspotenzial hemmen, wenn sie auf niedrigster Stufe verharren. Daneben können sich abweichende Standards nicht nur persönlich, sondern auch sozial auswirken und bis hin zu gefährlichem Problemverhalten führen. Dieses wird bestärkt, wenn verhaltenshemmende Selbstbestrafungsreaktionen durch kognitive Um-deutung oder Rechtfertigungen deaktiviert werden. Beispiele hierfür sind die Entmenschlichung des Opfers einer Gewalttat oder eine von sich weg führende Schuldzuweisung.
Diese lerntheoretischen Erkenntnisse verdeutlichen die Komplexität von Bekräftigungs- sowie Bestrafungsmechanismen und deren variable Wirkung aufgrund individueller und sozialer Faktoren.
3.4.6 Die Einflüsse kognitiver Prozesse auf das Verhalten
Kognitive Prozesse finden vor allem während der Aneignung eines bestimmten Verhaltens oder einer Fertigkeit statt, indem über die bevorstehende Handlung nachgedacht wird.
Ich lerne bspw. gerade Kajak fahren und muss mir immer wieder Gedanken darüber machen, auf welcher Seite ich das Paddel wie ins Wasser tauchen muss, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.
Sobald ein Verhalten oder ein Bewegungsablauf nach ausreichender Übung automatisiert wurde, nimmt die kognitive Konzentration auf die auszuführende Handlung ab und es wird möglich, sich während der Tätigkeit anderen Gedanken zu widmen. So kann man beim Fahrrad fahren Hörbuch hören oder während der Heimfahrt mit dem Auto an die schönen Ereignisse der letzten Tage denken.
Doch nicht nur dann, wenn etwas Neues gelernt wird, bedient sich der Mensch seinen kognitiven Fähigkeiten. Er ist den ganzen Tag über damit beschäftigt, Entscheidungen gegeneinander abzu-wägen, Lösungen für Probleme zu finden oder zukünftige Ereignisse zu planen. Dies ist nur möglich, wenn über die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nachgedacht wird, Konsequenzen bedacht werden und vorhandenes Wissen abgerufen wird. Wie bereits oben erwähnt, werden eigene oder auch stellvertretende Erfahrungen als symbolische Repräsentationen im Gedächtnis abgelegt. Diese „Werkzeuge des Denkens“ (ebd., 173) erleichtern die Bewältigung neuer, komplexer Situa-tionen durch die Anwendung, Übertragung und Kombination einzelner Handlungsschritte oder Ver-haltensweisen. Erst die symbolische Repräsentation von Mengen in Zahlen befähigt den Menschen mit unüberschaubaren Größenordnungen umzugehen. In diesem Zusammenhang wird der Sprach-entwicklung (ebd., 174ff.) eine besondere Bedeutung zugeschrieben, die hier jedoch nicht näher erläutert werden soll.
Kognitive Repräsentationen oder das Denken allgemein unterliegen Verifizierungsprozessen. Dem-nach werden die Gedanken und die daraus resultierende Entscheidung, ein bestimmtes Verhalten zu zeigen oder eine Handlung auszuführen, im Hinblick auf das erwartete Ergebnis überprüft. Denk- und Vorgehensweise können daraufhin beibehalten oder revidiert und umgestaltet werden. Dazu braucht es nicht zwingend eigene Erfahrungen. Das Denken kann auch durch Evidenzerlebnisse oder Urteile anderer Menschen verifiziert werden. Dieser Prozess ist jedoch nicht gefeit vor Fehlinterpretationen, welche bspw. durch selektive Verarbeitung des Wahrgenommenen oder Ver-meidung korrigierender Erfahrung zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Die Wahl einer bestimmten Umgebung und sozialen Gruppe, welche das eigene Verhalten hauptsächlich beein-flussen und Modellierungszwecken dienen, können Denkfehler verstärken oder die Möglichkeiten der Wahrnehmung einschränken. Fehler bei der Informationsverarbeitung können ebenso Ursache sein wie unverrückbare Überzeugungen.
Wie sich das Denken über die bevorstehende Handlung und der daraus resultierenden Wirkung, die nachfolgend wahrgenommene Wirklichkeit und schließlich die aus der Nachkontrolle gewonnene Schlussfolgerung gegenseitig bedingen und ineinandergreifen, zeigt sich eindrucksvoll in der Inter-aktion von Regulierungssystemen, womit das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung be-gründet werden kann. Indem eine Person ihren Erwartungen zufolge eine bestimmte Verhaltens-weise zeigt, stimuliert sie ihre Umgebung so, dass die Konsequenz dem antizipierten Resultat entspricht.
Ein zehnjähriger Junge, mit dem ich heilpädagogisch arbeite, fürchtet sich vor den Konsequenzen von Regelverstößen. Die Mutter und später er selbst berichteten von folgendem Vorfall: Er kam unabsichtlich zu spät zum Musikunterricht. Aufgrund seiner Angst Ärger zu bekommen, versteckte er sich zwischen Musikinstrumenten und weinte. Daraufhin reagierte die Lehrerin verärgert und bestätigte somit seine Erwartung, die er aufgrund seines Verhaltens jedoch selbst erzeugte und die nicht, wie er schlussfolgerte, auf sein Zuspätkommen zurückzuführen war.
[...]
- Arbeit zitieren
- Maria Steudel (Autor:in), 2012, Der Einsatz erlebnispädagogischer Methoden im "Training mit aggressiven Kindern", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230992
Kostenlos Autor werden





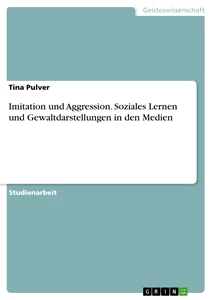
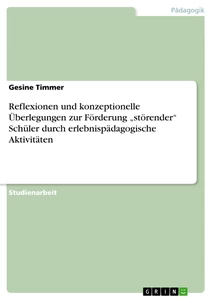













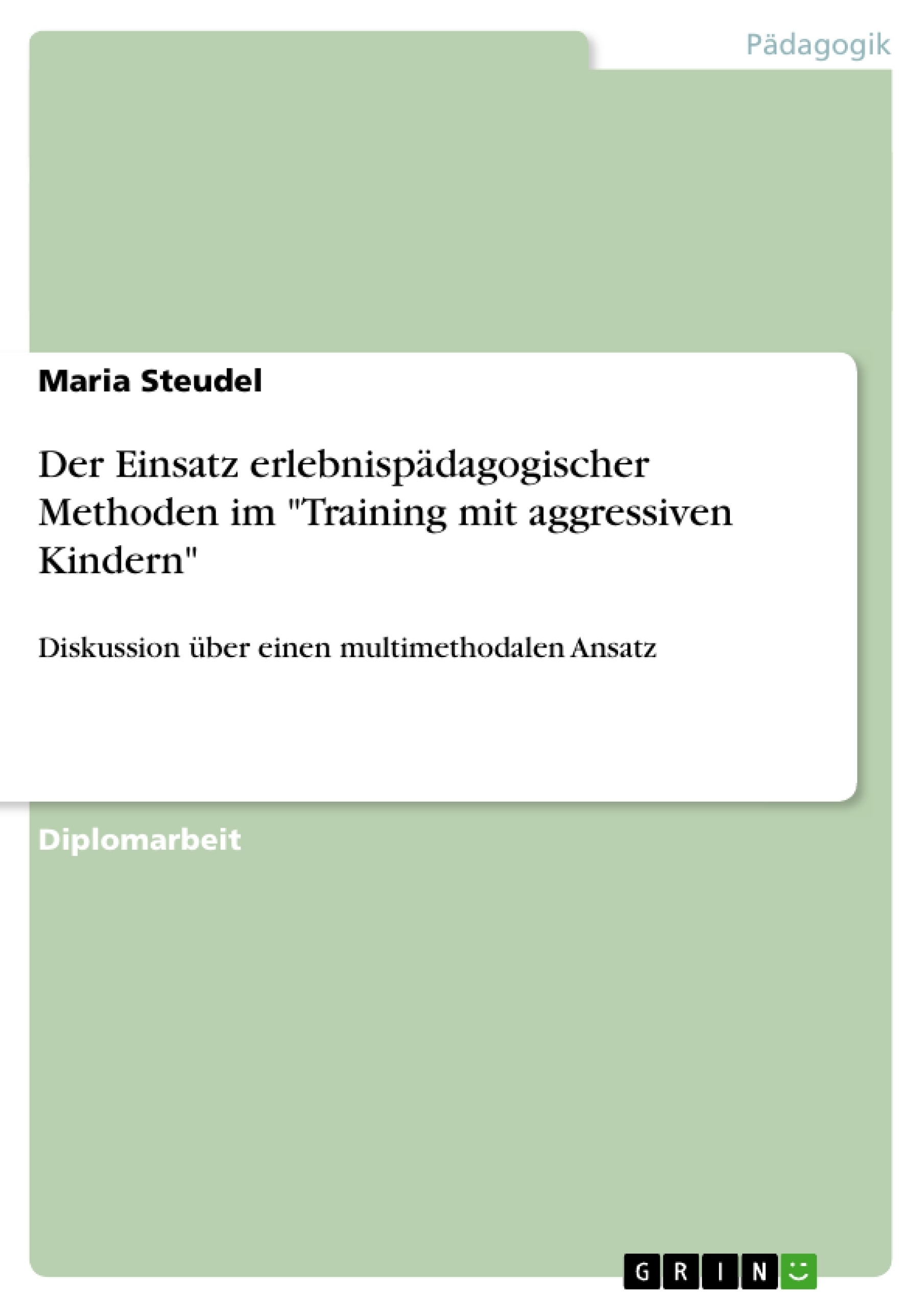

Kommentare