Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffserklärungen
2.1. Systemtheorie
2.2. Paradigmenwechsel
2.3. Normbegriff
2.3.1. Allgemeine Erklärungen
2.3.2. Merkmale sozialer Normen
2.3.3. Funktion sozialer Normen
2.3.4. Systemtheoretischer Normbegriff nach Luhmann
2.4. Abweichendes Verhalten
2.4.1. Abweichung als nicht gelingende Integration
2.4.2. Abweichendes Verhalten mit systemischer Qualität
3. Exkurs in soziologische Theorien normativer Integration
3.1. Solidarische Integration nach Durkheim
3.2. Integration durch Normen nach Parsons
3.3. Funktionalistische Systemtheorie nach Luhmann
4. Paradigmenwechsel und Systemtheorie
4.1. Bezugskategorien
4.2. Begriffssklärung
5. Erosion der Leitdifferenz Norm/Abweichung
5.1. Integration und die Differenz von Norm und Abweichung
5.2. Allzuständigkeit und Hilfebedürftigkeit
5.3. Hilfe und Kontrolle
5.4. Kritisches Resümee
6. Gegenstandsbestimmung (Was)
6.1. Gegenstand der Sozialen Arbeit
6.2. Gegenstand der Sozialarbeitswissenschaft
6.3. Fazit
7. Gegenstandserklärung (Warum und Wozu)
7.1. Warum
7.2. Wozu
8. Gegenstandsbereich (Wer und Wo)
8.1. Adressaten durch unspezifische Hilfebedürftigkeit
8.1.1. Konstruktionsprozesse auf Gesellschaftsebene
8.1.2. Organisationsprogrammatische Konstruktionsprozesse
8.1.3. Konstruktionsprozesse auf Interaktionsebene
8.2. Abgrenzungsversuche
9. Gegenstandsbearbeitung (Wie und Womit)
9.1. Handlungskonzepte
9.1.1. Normative Ausrichtung
9.1.2. Grundhaltungen
9.1.3. Professionelle Kompetenzen
9.1.4. Ziele
9.2. Handlungsformen, Interventionen und Ergebnisse
9.2.1. Handlungsformen
9.2.2. Interventionen und Ergebnisse Sozialer Arbeit
9.3. Resümee
9.4. Zwischen Abgrenzung und Beliebigkeit
10. Zusammenfassung
11. Ergebnisse
11.1. Pro und Kontra systemtheoretischer Sozialarbeitswissenschaft
11.1.1. Pro
11.1.2. Kontra
11.2. Stellenwert der Unterscheidung von Norm und Abweichung .
11.2.1. Konsens
11.2.2. Macht und Geschichtlichkeit
11.2.3. Steuerungsfähigkeit
11.2.4. Zusammenfassung
11.3. Praxistheoretische Konkretisierung
11.3.1. Normative Konstruktion von Hilfebedürftigkeit
11.3.2. Normen in der konkreten Hilfe
11.3.3. Resultat
12. Schlussbemerkung
13. Literaturverzeichnis
Zu den Autoren
Diese Veröffentlichung ist das Ergebnis einer Diplomarbeit im grundständigen Studiengang Sozialarbeit an der Fachhochschule Köln. Sie erscheint in der Schriftenreihe Sozial - Management - Beratung im GRIN-Verlag. In dieser Reihe werden Schriften zu dem Themenkomplex Sozialmanagement & Sozialwirtschaft veröffentlicht1.
Hinweise, Anregungen und kritische Anmerkungen zu dieser Schriftenreihe nimmt der Herausgeber gern entgegen unter: m.scheller@SozialManagementBeratung.de.
1. Einleitung
Die Wissenschaft der Sozialen Arbeit, die Sozialarbeitswissenschaft, ist noch nicht besonders alt. Sie hat mit der Systemtheorie als Referenzrahmen vor etwa fünfzehn Jahren begonnen, erstmals von anderen Disziplinen relativ un- abhängige Theorieansätze zu entwickeln (vgl. Puhl/ Löcherbach 2002: 36). Seit einigen Jahren liegen der Sozialen Arbeit Theoriekonzepte vor, die - un- ter dem Dach der Systemtheorie - zu einer neuen Reflexion über Profession und Disziplin Sozialer Arbeit anregen. Die entsprechenden Autor(inn)en adap- tieren dabei einen aus der soziologischen Systemtheorie Luhmanns stam- menden Paradigmenwechsel in die Sozialarbeitswissenschaft. Dieser zeich- net sich insbesondere dadurch aus, dass es in einer funktional ausdifferen- zierten Gesellschaft fraglich geworden sei, ob über Normen noch eine ge- samtgesellschaftliche Sozialintegration ermöglicht werden könne. Das Para- digma der normativen Sozialintegration müsse zugunsten einer rein funktional betrachteten Inklusion in Teilbereiche der Gesellschaft verlassen werden. Im Verlauf dieser Arbeit wird ersichtlich, dass damit wissenschaftliche Überzeu- gungen in radikaler Weise in Frage gestellt werden, an denen sich insbeson- dere die Soziale Arbeit nicht erst seit Alice Salomon orientiert hat. Die Ausei- nandersetzung mit den Konsequenzen, die systemtheoretische Modelle für die Soziale Arbeit bereithalten könnten, hat in der Sozialarbeitswissenschaft stark kontroverse Diskussionen ausgelöst und die Autorenschaft polarisiert. Das Thema hat damit auch in der Ausbildung an den Hochschulen eine große Relevanz.
Die Leitdifferenz Norm/ Abweichung sei erodiert, so die Vertreter(innen) des Paradigmenwechsels, und biete daher nicht mehr ausreichend Orientierungs- kraft für Soziale Arbeit. Demgegenüber wird kritisiert, dass mit der Abkehr vom normativ-sozialintegrativen Paradigma eine Beliebigkeit zu rechtfertigen sei (vgl. Heiner 1995: 435). Eine Beliebigkeit in dem Sinne, dass eine aus- schließlich funktional und beobachterabhängig begriffenes Gesellschaftsbild keine ausreichende Orientierung für richtiges oder falsches Handeln bieten Erster Teil - Begriffserklärungen und soziologischer Exkurs 7 könnte und damit ein „anything goes“ (Pfeifer-Schaupp 1995b: 134) ermöglichen würde.
Da sich der Fokus auf die Unterscheidung von Norm und Abweichung als Leitdifferenz professioneller Sozialer Arbeit, ihrer Erosion und dem in diesem Zusammenhang eingeläuteten Paradigmenwechsel konzentriert, werden im ersten Teil dieser Arbeit Begriffe und Zusammenhänge erläutert. Um ein Ver- ständnis und eine Gesamteinordnung zu ermöglichen, muss im ersten Teil dieser Arbeit zunächst erläutert werden, welchem systemtheoretischen Ansatz die Vertreter(innen) des Paradigmenwechsels zuzuordnen sind und was unter den zentralen Begriffen Paradigma, Norm und Abweichung zu verstehen ist. Im Anschluss daran wird in einem Exkurs die sozialintegrative Funktion der Unterscheidung von Norm und Abweichung, anhand klassischer soziologi- scher Gesellschaftstheorien von Émile Durkheim und Talcott Parsons, vorge- stellt. Im themenrelevanten Umfang wird davon die Systemtheorie Luhmanns abgegrenzt, auf die sich die in dieser Arbeit einschlägigen Autor(inn)en in be- sonderem Maße propädeutisch stützen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit werden zunächst die Argumente, die für eine Erosion der Leitdifferenz sprechen, systematisiert und anschließend kritisch betrachtet. Über die vier Bezugskategorien Gegenstandsbestimmung, Gegen- standserklärung, Gegenstandsbereich und Gegenstandsbearbeitung wird dann der sozialarbeitswissenschaftliche Paradigmenwechsel und dessen Konsequenzen dargestellt und diskutiert. Die zunächst in ihrer Auswahl und inhaltlichen Bestimmung begründeten Bezugskriterien dienen dabei der Über- sichtlichkeit und Eingrenzung. Innerhalb jeweils einer Kategorie werden Aus- sagen, Argumente und Zusammenhänge aus einer kritischen Perspektive heraus diskutiert.
Im dritten Teil dieser Arbeit werden in einem abschließenden Ergebnis die kritischen Aspekte zum Paradigmenwechsel zusammengefasst und in einer vertiefenden Diskussion der Frage nachgegangen, welchen Stellenwert die Unterscheidung von Norm und Abweichung für Soziale Arbeit haben kann. Dabei wird die These vertreten, dass sich Soziale Arbeit auch weiterhin an Erster Teil - Begriffserklärungen und soziologischer Exkurs 8 einem normativen Bezugsrahmen orientieren kann. „Die Wahrheit ist ins Ge- rede gekommen“ (Kleve 1999a: 109). Und da wollen wir ein wenig mitreden ...
2. Begriffserklärungen
Bevor der Paradigmenwechsel im zweiten Teil dieser Arbeit beschrieben und diskutiert werden kann, müssen zunächst die zentralen Begriffe Systemtheo- rie, Paradigmenwechsel, Norm und abweichendes Verhalten näher beschrie- ben werden, damit ein Verständnis für die gesamte Arbeit sichergestellt wer- den kann. Auf die Moral-, Ethik und Wertbegriffe, die häufig im Zusammen- hang mit Norm und Abweichung stehen, kann hier nicht eingegangen werden, da dies den (normativ-gesetzten) Rahmen der Arbeit überschreiten würde2.
2.1. Systemtheorie
Systemtheorie ist ein Oberbegriff für verschiedene, teilweise stark konträre Theorien. Um Missverständnissen vorzubeugen, muss das, was hier unter Systemtheorie, systemtheoretischen Beiträgen oder deren einschlägigen Au- tor(inn)en verstanden wird, spezifiziert werden. In Anlehnung an Obrecht kann die Systemtheorie zunächst in eine realistische und eine antirealistische Er- kenntnistheorie unterschieden werden (vgl. Obrecht 2001: 81). Zu den Vertre- ter(inne)n der letzteren Variante gehören, auf der Ebene der Sozialarbeitswis- senschaften, beispielsweise Bardmann, Hermsen und Kleve. Diese Au- tor(inn)en vertreten einen prozessorientierten Phänomenalismus, also die Idee, dass nur die prozesshaften Erscheinungen von Dingen erkannt werden können, nicht jedoch ihr Wesen. Die erste Variante kann wiederum in zwei weitere Ansätze unterschieden werden.
Erstens: In die, die Systeme mit Ausnahme ihrer bloßen Existenz ausschließlich in ihrer Prozesshaftigkeit und Funktionalität begreifen. Ihre Vertreter(innen) auf der Ebene der Sozialarbeitswissenschaft sind beispielsweise Merten, Eugster, Bommes, Scherr, Fuchs und Schneider. Auf der Ebene der Soziologie wird diese Richtung durch Niklas Luhmann vertreten.
Zweitens: In die, die Systeme vor allem in ihrer Substanz begreifen, also dem, was trotz sich verändernder Eigenschaften gleich bleibt. Parsons und Bunge vertreten diese Sichtweise auf der Ebene der Soziologie; Lüssi, StaubBernasconi und Obrecht auf der Ebene der Sozialarbeitswissenschaften. Auch wenn auf der einen Seite Parsons und Lüssi und auf der anderen Seite Bunge und Staub-Bernasconi/ Obrecht dies auf eine - hier nicht näher zu bezeichnende - unterschiedliche Weise tun.
Die Vertreter(innen) der antirealistischen Erkenntnistheorie orientieren sich, auf der Ebene der Sozialarbeitswissenschaft, meist an Luhmanns soziologi- scher Systemtheorie. Da sich Luhmann wiederum am autopoietischen Kon- zepten Maturanas und Varelas orientiert, die als Vertreter der antirealistischen Erkenntnistheorie gelten, kann hier von einem gegenseitigen Bezug ausge- gangen werden.
Wenn in dieser Arbeit von Systemtheorie die Rede ist, sind gleichsam immer die prozessorientierte Systemtheorie nach Luhmann, aber auch die konstruk- tivistischen Ansätze nach Maturana, Glaserfeld und v. Förster gemeint. Diese Arbeit berücksichtigt auch die Ansätze von Puhl und Miller, die eher zwischen den Konzepten von Luhmann und Bunge einzuordnen sind. Dies soll der Aus- gewogenheit der Darstellung, als „Gegengewicht“ zu den radikal- konstruktivistischen Ansätzen von Kleve und Bardmann, dienen.
2.2. Paradigmenwechsel
Ein Paradigma ist ein wissenschaftlicher Standpunkt, ein Denkschema, mit dem Fragestellungen oder Bezugsprobleme erklärt und gelöst werden. Solche Paradigmen stehen häufig in Einklang mit gesellschaftlichen Normen oder dem Zeitgeist und werden als Denknorm von einer wissenschaftlichen Ge- meinschaft akzeptiert (vgl. Engelke 1999: 39f.). Ein Paradigmenwechsel be- deutet, dass eine wissenschaftliche Gemeinschaft ihre Sichtweise aufgibt und durch eine neue ersetzt3.
Der Begriff des Paradigmenwechsels hat demnach zwei zu beachtende Komponenten: Es ist einerseits das Postulat eines Paradigmenwechsels und andererseits die sich bereits durchgesetzte Neuorientierung von Wissenschaftlern zu unterscheiden.
In dieser Arbeit wird kann davon ausgegangen werden, dass sowohl Normen als auch der Zeitgeist in Frage gestellt wird. Ob und in welchem Umfang sich systemtheoretische und konstruktivistische Denkweisen in der Konzeption einer Sozialarbeitswissenschaft letztendlich durchsetzen werden, bleibt abzuwarten und in diesem Rahmen kritisch zu betrachten (s. 11).
2.3. Normbegriff
Um „gefahrlos“ von der Unterscheidung von Norm und Abweichung sprechen zu können, muss klar sein, was genau unter Norm , von der abgewichen wer- den kann, zu verstehen ist. Die Vertreter(innen) des Paradigmenwechsels beziehen sich auf den Normbegriff Luhmanns. Um die Möglichkeit zu verbes- sern, den luhmannschen Normbegriff (2.3.4) neben anderen Erklärungen ein- zuordnen, wird zunächst ein Überblick über den Normbegriff aus einer un- überblickbaren Anzahl existierender Normdefinitionen (2.3.1-2.3.3) heraus gegeben.
2.3.1. Allgemeine Erklärungen
Von einigen Sozialpsycholog(inn)en werden Normen als Verhaltensgleichf ö r migkeit verstanden, wobei diese Sichtweise von Normen nur die Regelmäßigkeit sozialen Verhaltens, also den allgemeinen Gegenstand der Soziologie, betrachtet (vgl. Lamnek 2000: 470).
Normen, begriffen als ethisch-moralische Zielvorstellung , können als Orientie- rungsmaßstab für ein aus Wertvorstellungen resultierendes Handeln gelten. Dieser Normbegriff kommt der in der Soziologie gebräuchlichsten Definition von Norm schon sehr nahe, da diese bereits ein erwartbares Verhalten und deren Bewertung bzw. Sanktionierung impliziert und zu ihren Elementen macht. So besteht in der Soziologie weitgehend Einigkeit darüber, dass Nor- men allgemeing ü ltige Verhaltensregeln darstellen, deren Einhaltung von an- deren Mitgliedern der Gesellschaft erwartet und bei Verstoß entsprechend sanktioniert werden (vgl. ebd.). In diesem Sinne sind Normen von Individuen geäußerte Erwartungen, welche zu Standards, Regeln oder Vorschriften füh- ren, die besagen, „ da ß etwas der Fall sein soll oder mu ß oder nicht der Fall sein soll oder mu ß “ [Hervorhebung im Original] (Opp 1983: 4). Hier wird er- sichtlich, dass eine solche Normdefinition das „Sollen“ zu einem ihrer zentra- len Elemente macht und somit einen präskriptiven Charakter aufweist. Dieser Normentypus ist in der soziologischen und sozialpsychologischen Literatur deutlich gewichtiger vertreten, als solche Normdefinitionen, die das „Sein“ zu ihrem Element machen und somit deskriptiver Natur sind. Das „Sollen“ vari- iert, abhängig von der Intensität der Sanktionierung, graduell zu einem „Kann“ oder „Muss“ (vgl. Faltin 1990: 14).
2.3.2. Merkmale sozialer Normen
Sowie in der Soziologie als auch in der Sozialpsychologie versteht man unter einer sozialen Norm eine Regel, die für das Verhalten der Gesellschaftsmit- glieder „den ‚richtigen’ (d.h. sozial angemessenen/ erwünschten/ vorgeschrie- benen) Weg zur Zielverwirklichung markiert“ (Wiswede 2000: 580). Nach Faltin zeichnen sich soziale Normen durch bestimmte Prädikate aus. So ergibt sich der präskriptive Charakter sozialer Normen aus der Verbindlichkeit oder Sanktioniertheit, die soziale Abweichung erst sichtbar macht und damit auch die Grundlage der sozialen Kontrolle bildet. Soziale Normen beziehen sich auf ein bestimmtes Verhalten, Handeln und/ oder Denken. Somit zeich- nen sie sich durch eine Verhaltensbezogenheit aus. Die Situationsbezogen- heit ergibt sich im Zusammenhang mit der Verhaltensbezogenheit, da Verhal- ten immer situativ erfolgt. Die Erwartungshaltung der Gesellschaft bezüglich der Einhaltung sozialer Normen wird durch die Erwartungsbezogenheit reprä- sentiert, die den kollektiven Charakter sozialer Normen kennzeichnet. Die Re- gelmäßigkeit bzw. Stabilität ergibt sich im Zusammenhang mit der Verbind- lichkeit und verweist auf das sich regelmäßig vollziehende, erwartete Verhal- ten. Die Wichtigkeit eines Verhaltens für die Gesellschaft wird durch die So- ziale Relevanz gekennzeichnet, woraus sich letztlich der Gültigkeitsgrad einer Norm ergibt, der wiederum ein Indikator für einen sich vollziehenden, gesell- schaftlichen Wandel darstellen kann (vgl. ebd. 1990: 14 ff.).
Die Gebote sozialer Normen richten sich in der Regel nicht an einzelne, son- dern an mehrere Individuen (vgl. Bellebaum 2001: 36). Somit ist die Identifika- tionsebene sozialer Normen üblicherweise kollektivistisch. Diese Normen sind als „anthropologische“ Voraussetzung für das Handeln anzusehen, weil sie funktional mit Instinkten vergleichbar sind. Tiere genießen aufgrund ihrer Ins- tinkte Verhaltenssicherheit, da diese das Handeln spezialisieren, steuern und stabilisieren. So dienen soziale Normen zur Kompensation menschlicher „Ins- tinktarmut“ und bieten die erforderlichen Regeln, die dauerhafte Kontakte und damit zwischenmenschliches Zusammenleben überhaupt erst ermöglichen (vgl. ebd.).
2.3.3. Funktion sozialer Normen
Konkretisieren lassen sich die wichtigsten Funktionen sozialer Normen, wie Wiswede vorschlägt, indem man sie auf fünf Funktionen reduziert. Zunächst haben soziale Normen eine Orientierungsfunktion, die determiniert, wie an- gemessenes Verhalten zu erfolgen hat. Die Stabilisierungsfunktion bewirkt eine Verlässlichkeit der Verhaltenserwartung, die eine Berechenbarkeit des Verhaltens anderer erst ermöglicht und damit einhergehend eine Prognose auf das zu erwartende Verhalten zulässt. So verfügen Normen über eine Prognosefunktion. Soziale Normen führen zu einer Reduzierung von Verhal- tensmöglichkeiten um schließlich das sozial „sinnvollste“ Verhalten herauszuselektieren. Diese Funktion wird Selektionsfunktion geanannt. Erst die Koordinationsfunktion bewirkt die Effizienz funktionaler Abläufe, indem sie zwischenmenschliches Handeln koordiniert (vgl. ebd. 2000: 515 ff.).
2.3.4. Systemtheoretischer Normbegriff nach Luhmann
Luhmann betrachtet die präskriptiven und deskriptiven Elemente von Normen ausschließlich auf funktionaler Ebene. „Sein“ und Sollen“ werden somit „funk- tionale Äquivalente“ (Habermas 1971: 240). Die Merkmale und Funktionen des luhmannschen Normbegriffs sind, wie im Folgenden ausgeführt, insbe- sondere (Verhaltens-) Erwartungen, Reduktion von Komplexität und Stabili- sierung.
Die Bildung von Normen beginnt mit einem Problem. Genauer: Mit der doppel- ten Kontingenz. Dem Problem, dass kein Handeln zustande kommen könnte, wenn Alter sein Handeln davon abhängig macht, wie Ego handelt und Ego wiederum sein Handeln an Alter anschließen will. Beide müssen, um sich nicht gegenseitig zu „blockieren“, aus einer unendlichen Menge an Möglich- keiten genau diejenigen auswählen, die sich wiederholbar aufeinander bezie- hen lassen (vgl. Baraldi u.a. 1999: 37ff.). Parsons, der den Begriff der doppel- ten Kontingenz erstmals als solchen bezeichnete, versucht dies, ähnlich wie Habermas, mit normativen Konsens zu lösen. Luhmann dagegen setzt auf Zufall, auf „versuchsweises Handeln“ (Krause 2001: 16ff.). Alter und Ego müssen sich nur irgendwie als wechselseitig Verhaltend wahrnehmen. Das kann dann der Grund sein, um zu sehen, ob sich dies nicht wiederholen lässt. Wiederholungen führen schließlich zu wechselseitigen Erwartungen. Die dop- pelte Kontingenz lässt sich demnach durch gegenseitige Erwartungen, den so genannten „Erwartungserwartungen“ (Luhmann 1969: 32), überwinden.
Dass Erwartungen Verhaltensmöglichkeiten reduzieren (Komplexitätsredukti- on) und Verhalten stabilisieren, gründet sich nicht in einem Konsens, den Alter und Ego über ihr gegenseitiges Verhalten geschlossen haben, sondern viel- mehr auf einem Zufall, dem anschließend Konsens unterstellt wird (kontrafak- tischer Konsens).
Luhmann unterscheidet lernbereite und nichtlernbereite Erwartungen (vgl. ebd.: 34). Lernbereite Erwartungen beziehen sich auf das Wissen, auf Kogni- tion im Allgemeinen. Gemeint ist damit, dass die lernbereite Erwartung im Ent- täuschungsfall nicht weiter aufrechterhalten wird. Wenn beispielsweise nach Bekanntgabe der Lottozahlen festgestellt wird, dass die genannten Zahlen ohne Ausnahme nicht mit denen auf dem Tippschein übereinstimmen, sieht der Normalfall nicht vor, dass dennoch auf einem Gewinn insistiert wird. Der Lottoschein wird zerrissen; gewonnen wird höchstens an Erfahrung. Die nicht- lernbereiten Erwartungen werden im Enttäuschungsfall jedoch durchgehalten. Normen haben nach Luhmann „die Funktion, Erwartungen auch für den Fall, dass ihnen zuwidergehandelt wird, als Erwartungen zu sichern“ (Luhmann 1993b: 16). „Normen ziehen, so könnte man sagen, in ein Kommunikations- system, [...] ein Sicherheitsnetz4 der Stabilität ein, das auch dann noch hält, wenn Verhalten abweicht“ (ebd.). Wann genau Erwartungen lernbereit bzw. nichtlernbereit sind, legt ein soziales System selbstreferentiell im Voraus fest (vgl. Luhmann 1969: 36). So genannte Normprojektionen versuchen „künfti- ges Erwarten auf das Schema konform/ abweichend zu verpflichten“ (Luh- mann 1993c: 16).
Für Luhmann sind Normen unverzichtbar. Ihre Unverzichtbarkeit liegt in der Absicherung der Autopoiesis (s. 3.3) begründet (vgl. ebd.: 23). Personen kön- nen ohne Normen ihre Identität weder behaupten noch darstellen (vgl. ebd. 1969: 40). Luhmann gibt zudem an, dass „Letztorientierungen in Form von Normprojektionen“ (ebd. 1993b: 25) existieren. Systeme stabilisieren sich da- bei durch die Orientierung an ihrer Umwelt. Normen haben damit eine unver- zichtbar-notwendige Komponente (vgl. ebd. 1969: 40; ebd. 1993b: 24f.).
In diesem Kontinuum ist die Notwendigkeit jedoch nur eine Seite der Unter- scheidung. Normen, und damit auch die Letztorientierungen von Normprojek- tionen, sind immer auch kontingent, wie dies ausführlicher in 3.3 dargestellt wird.
2.4. Abweichendes Verhalten
Definitionen über Abweichendes Verhalten gibt es (fast) so viele, wie über die Normen, von denen sie abweichen. Exemplarisch soll hier die Sichtweise Mertons (2.4.1) dargestellt werden, die exemplarisch zur Abgrenzung von Luhmanns Vorstellungen (2.4.2) dargestellt werden.
2.4.1. Abweichung als nicht gelingende Integration
Merton versucht abweichendes Verhalten durch die Anomietheorie zu erklä- ren. Der Begriff Anomie, der einen Zustand der Regellosigkeit beschreibt (s. 3.1), wurde von Émile Durkheim eingeführt. Er nutzte den Begriff zur Be- schreibung sozialer Desintegration durch Arbeitsteilung (funktionaler Differen- zierung). Neben der Anomietheorie gibt es noch die Subkulturtheorie, Theo- rien des differentiellen Lernens, der labeling approach und andere Ansätze5, mit denen abweichendes Verhalten erklärt wird. Das „ sozial abweichende Verhalten “ ist nach Merton genauso ein „Produkt der sozialen Strukturen [...] wie das konformistische Verhalten (Merton 1995: 117)6. Normen legitimieren und begrenzen die Möglichkeiten bzw. die Mittel, die für die Erreichung kul- turell vorgegebener gesellschaftlicher Ziele in Frage kommen können. Wenn aufgrund einer bestimmten Position in der Sozialstruktur, das Erreichen von gesellschaftlichen Zielen gefährdet erscheint, werden auch illegitime Mittel gewählt. Abweichendes Verhalten steht somit für eine nicht gelungene Integ- ration von Menschen in die Gesellschaft; einer Nichtintegration von kulturell vorgegeben Zielen und der Stellung des Menschen in der Gesellschaftsstruk- tur, hervorgerufen durch eine desintegrierende, sich funktional differenzieren- de Gesellschaft.
2.4.2. Abweichendes Verhalten mit systemischer Qualität
Wie in 2.3.4 bereits dargestellt, legen die Normprojektionen fest, dass zwi- schen konformen und abweichenden Erwartungen unterschieden wird. Diese Sichtweise bezieht sich weniger auf Desintegration als Ursache, denn auf eine systemisch bedingte Differenz wechselseitiger Erwartungen. „Die Jugendli- chen stören die Ordnung, weil die Ordnung die Jugendlichen stört“ (Luhmann 1987: 116). Somit hat abweichendes Verhalten für Luhmann keine desintegra- tive, sondern vielmehr eine systemische Qualität. Abweichendes Verhalten ist damit ausschließlich ein Produkt von Beobachtungsleistungen.
3. Exkurs in soziologische Theorien normativer Integration
An dieser Stelle wird exemplarisch anhand Émile Durkheims und Talcott Par- sons Gesellschaftstheorie in stark verkürzter Form7 auf den Zusammenhang von Normen und Sozialintegration eingegangen. Der Exkurs ist nötig, um den (zunächst soziologischen) Paradigmenwechsel besser verdeutlichen zu kön- nen.
3.1. Solidarische Integration nach Durkheim
Bereits 1893 konstatierte Émile Durkheim in seinem ersten Hauptwerk „Über die soziale Arbeitsteilung“ in groben Zügen eine funktionale Ausdifferenzierung der modernen Gesellschaft, die schließlich eine Vervielfältigung von Normen als funktionale Anpassungsleistung an den sich verändernden Lebenslagen bewirke. Durkheim greift Herbert Spencers Idee der arbeitsteiligen Gesellschaft auf, geht jedoch nicht davon aus, dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt nur auf Verträge reduzieren lasse (utilitaristische Ethik). In seiner Theorie ergänzt er das Konzept der Gesellschaftsverträge nach Rousseau mit seiner Idee der solidarischen Integration.
Durkheim entwickelt die Vorstellung eines Kollektivbewusstseins, das die mo- ralisch-normative Struktur der Gesellschaft beherbergt und eine unverzichtba- re Instanz für die Integration der Gesellschaft darstellt (vgl. Bettmer 2001: 3). In diesem Kollektivbewusstsein sind ein Grundbestand an in der Gesellschaft geteilten Normen, die das Zusammenleben der Gesellschaftsmitglieder re- geln, institutionalisiert. Als Beispiel seien hier Rechtsvorschriften, moralische Gebote sowie religiöse Zeremonien genannt. Die funktionale Ausdifferenzie- rung der Gesellschaft bewirkt nach Durkheim einen Wandel von der mechani- schen, auf Gleichheit beruhenden, Solidarität zur organischen Solidarität, in der eine Spezialisierung der Gesellschaftsmitglieder vorherrscht. Mit dieser Pluralisierung der Lebenslagen erodiert das Kollektivbewusstsein im gleichen Maße, so dass Durkheim die Gesellschaft in die Anomie driften sieht.
3.2. Integration durch Normen nach Parsons
Auch in Parsons Theorie kommt der normativen Integration eine gesell- schaftserhaltende Funktion zu. Parsons räumt - wie Durkheim - normativen Aspekten einen sehr großen Raum ein und wendet sich ebenfalls von utilita- ristischen Konzepten ab, da auch er in diesen keine Erklärung sieht, die den Zusammenhalt der Gesellschaft begründen könnten (vgl. Schimank 1996: 84). Parsons setzt hier das Zusammenspiel einer normativen Ordnung und einer kollektiv organisierten Bevölkerung voraus. Er stützt sich weitgehend auf Durkheims Gesellschaftstheorie, ergänzt diese aber mit den Ansätzen von Max Weber, Thomas H. Marschall sowie Vilfredo Pareto und führt eine syste- mische, auf Struktur-Funktionalismus basierende, Sichtweise von Gesellschaft ein (vgl. Möhle 2001: 42). Parsons Systemtheorie legt den Fokus bei der Be- trachtung der Gesellschaft auf Handlungen, im Sinne von Handeln oder Inter- aktion, die er zu Systemen zusammenfasst. Im Zusammenhang mit der Ge- wichtigkeit des Zusammenwirkens von Normen und Integration ist das parsonssche AGIL-Schema von großer Bedeutung. Dieses Schema zeigt die funktionalen Erfordernisse auf, die ein soziales System wie die Gesellschaft erfüllen muss. Hier sind insbesondere die Erhaltung von Normen („latent pat- tern maintenance“) sowie die Integration („integration“) zu nennen vgl. ebd.: 43). Die Integration erfolgt auch bei Parsons über Normen, die durch das Normerhaltungssubsystem mittels übergeordneter Werte überdauern können. Das funktionale Erfordernis der Integration sieht Parsons in erster Linie durch das Rechtssystem bewerkstelligt. Die normative Ordnung bedarf der kulturel- len Legitimation, die einen Konsens bezüglich verbindlicher Norm und Wert- vorstellungen voraussetzt. Diese gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen sind dem sozialen Wandel anpassbar. So verhält sich nach Parsons der Wandel in der Struktur eines sozialen Systems proportional zum Wandel seiner normati- ven Kultur (vgl. ebd.: 46).
3.3. Funktionalistische Systemtheorie nach Luhmann
„Es gibt selbstreferentielle Systeme. Das heißt zunächst nur in einem ganz allgemeinen Sinne: Es gibt Systeme mit der Fähigkeit, Beziehungen zu sich selbst herzustellen und diese Beziehungen zu differenzieren gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt“ (Luhmann 1984a: 31). Dieses Zitat beinhaltet zwei wesentliche Aussagen zu der Systemtheorie Luhmanns.
Erstens: Systeme sind real existierende Systeme. Luhmann unterscheidet zwischen lebenden Systemen (z.B. Organismen) und Sinnsystemen. Letztere wiederum in psychische und soziale Systeme. Unter einem psychischen Sys- tem versteht Luhmann (menschliches) Bewusstsein; unter sozialen Systemen werden Gesellschaft, funktional ausdifferenzierte Teilsysteme (Funktionssysteme), Organisations- und Interaktionssysteme verstanden. Zweitens: Für Luhmann ist der Systembegriff kein Begriff der Einheit, sondern vielmehr der Differenz, der „System-Umwelt-Differenz“. Systeme existieren immer nur im Bezug auf ihre Umwelt, also durch Unterscheidungen, die sie selbstreferentiell, also immer auf sich selbst beziehend, treffen. In diesem Sinne sind sie als geschlossene Systeme zu sehen (vgl. Baraldi [u.a.] 1999: 195). Sie nehmen ihre Umwelt nur nach Maßgabe ihres eigenen Differenzschemas wahr und sichern so ihre Autopoiesis ab.
Das von den Kognitionsbiologen Maturana und Varela adaptierte Konzept der Autopoiesis geht über das der Selbstreferentialität hinaus. Autopoiese bedeu- tet, dass sich Systeme über systemeigene Operationen selbst reproduzieren, indem sie gleichartige Operationen aneinander anschließen (operative Ge- schlossenheit). Bei psychischen Systemen ist die systemreproduzierende Operation Bewusstsein, bei sozialen Systemen Kommunikation (vgl. Kleve 1999a: 98). Kommunikation ist in der Systemtheorie Luhmanns ein allumfas- sender Begriff und beschränkt sich nicht nur auf verbale- oder nonverbale Verständigung, sondern beinhaltet zudem auch von Systemen als solche in- terpretierte Handlungen. Kommunikation ist alles; dort wo Kommunikation en- det, endet auch Gesellschaft (vgl. Krause 2001: 135).
Nicht jede Operation ist jedoch anschlussfähig. Systeme müssen Operationen aus der Überfülle des Möglichen, der Kontingenz, aneinander anschließen. Es muss also etwas die Steuerung und Strukturierung der Auswahl ermöglichen. Dazu dient Luhmann der „Sinn“. Systeme, die sich des „Sinns“ bedienen, werden als Sinnsysteme bezeichnet. Jeder „bestimmte Sinn qualifiziert sich dadurch, daß er bestimmte Anschlussmöglichkeiten nahelegt und andere un- wahrscheinlich oder schwierig oder weitläufig macht oder (vorläufig) aus- schließt“ (Luhmann 1984a: 102).
Bevor ein System eine Operation anschließen kann, wählt es aus der Kontin- genz seiner Umwelt Möglichkeiten aus, indem es der Entscheidung immer eine Unterscheidung voranstellt. Die Unterscheidung ist dem System selbst nicht bewusst. Für den Beobachter entsteht ein Blinder Fleck. Die „blinde“ Un- terscheidung kann durch die Beobachtung 2. Ordnung, die ihrerseits wieder einen Blinden Fleck generiert, wahrgenommen werden. Wenn eine Person beispielsweise etwas trinkt, ist ihr nicht bewusst, dass sie für die Entscheidung hierzu zunächst eine Unterscheidung machen muss (beispielsweise trinken oder nicht trinken). Erst wenn sie selbst oder ein Dritter die Entscheidung re- flektiert, wird die Auswahl aus der Kontingenz von Möglichkeiten bewusst. Warum (aus welcher Unterscheidung heraus) das Trinken reflektiert wurde, kann nur in der Beobachtung 3. Ordnung erkannt werden, usw.
An dieser Stelle wird der Subjekt-Objekt-Verlust luhmannscher Systemtheorie deutlich. Das Subjekt (Mensch) ist nicht mehr in der Lage, die Wirklichkeit (Objekt) unabhängig vom Standpunkt des Beobachters zu beschreiben. Eine Objektivität in der Denkart Durkheims und Parsons ist nicht mehr gegeben.
Die Wirklichkeit konstruiert8 sich beobachterabhängig, so dass der Mensch nicht mehr das Maß aller Dinge ist (Aristoteles).
Luhmann greift Durkheims Idee einer funktional differenzierten Gesellschaft und Parsons systemische Komponente auf und reduziert Gesellschaft in sei- ner Theorie mittels einer ausschließlich funktionalen Betrachtung. In einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft gibt es Teilsysteme bzw. Funktionssysteme (Rechts-, Erziehungs-, Wirtschaftssystem, politisches Sys- tem etc.), die, ausgestattet mit einem speziellen Sinn, eine bestimmte ge- samtgesellschaftliche Funktion wahrnehmen. Eine solche Funktion wird immer ausschließlich von einem bestimmten Funktionssystem erfüllt (vgl. Baecker 1994: 97). Für jedes Funktionssystem lässt sich ein binärer Code spezifizieren (beispielsweise „Macht/ keine Macht“ für das politische System). Die Funkti- onssysteme operieren ausschließlich anhand dieser Unterscheidung, stellen anschlussfähige Kommunikationen her und differenzieren sich so von ihrer Umwelt. Kommunikationen anderer Systeme können immer nur in Bezug auf den eigenen Code interpretiert werden. So „entdeckt“ das politische System das Waldsterben erst dann als ein zu bearbeitendes Thema, wenn es mit wei- terer Nichtbeachtung einen möglichen Stimmenverlust (keine Macht) in Verbindung bringt. Diesen Vorgang der „Verständigung“ mehrerer Systeme mittels völlig verschiedener Leitunterscheidungen nennt Luhmann Kopplung. Bei einem Gespräch entsteht beispielsweise immer eine Kopplung von psychischen Systemen (in Form von Personen) mit einem Sozialen System.
Dieses Beispiel macht auch deutlich, dass Luhmann dem Menschen keinen Platz mehr innerhalb der Gesellschaft zuschreibt. Das menschliche Bewusst- sein koppelt sich temporär an Systeme, nimmt immer wieder an Gesellschaft teil, aber nie als Ganzes, als menschliche Einheit. „Die Teilnahme ist dabei grundsätzlich eine nur mögliche, dabei temporär universell immer wieder mög- liche und dauerhaft nur partikular mögliche“ (Krause 2001: 63). Luhmann de- komponiert den Menschen in lebende Systeme und psychische Bewusstseine, welche nur durch Kopplungen an der Gesellschaft teilhaben können (vgl. ebd.).
Diese Sichtweise verunmöglicht den Gedanken einer dauerhaften Vollintegration von Menschen in die Gesellschaft. Zum Einen, weil autopoietische Systeme nur nebeneinander existieren und nicht mit-einander „verschmelzen“ können. Die Verbindung von Teilen zu einem Ganzen ist somit nicht mehr möglich. Zum Anderen, weil soziale Systeme ständig vom Zerfall bedroht sind und „sich von Moment zu Moment neu konstituieren“ (ebd.: 64). Ein Beispiel: Nach dem Gespräch (keine weitere anschlussfähige Kommunikation mehr möglich) hat sich das Soziale System (Gespräch) aufgelöst.
Unter Integration versteht Luhmann nichts anderes, als eine wertfreie und wechselseitige „Einschränkung der Freiheitsgrade“ (ebd. 1997: 605) für Selek- tionen von Systemen. Die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft „fordert“ hingegen von allen Systemen eine hohe operative Anschlussfähigkeit, um an den verschiedenen Funktionssystemen der Gesellschaft teilnehmen zu kön- nen (Krause 2001: 64). Aus diesen Gründen kommt Luhmann zu folgendem Schluss: Integration ist zwar Jederzeit möglich, aber für den Menschen oft- mals problematisch. „Die moderne Gesellschaft ist überintegriert und dadurch gefährdet“ (Luhmann 1997: 618). Alleinerziehende Mütter müssen aufgrund ihrer erzieherischen und pflegerischen Aufgaben sehr stark mit ihren Kindern, also im Interaktionssystem Familie, integrieren. Ihre Integration führt dann da- zu, dass sie aus Gründen der Selektionsreduktion oftmals nur über eine unzu- reichende Ausbildung verfügen oder geringe berufliche Chancen und finanzi- elle Ausstattung vorweisen können (vgl. Peuckert 1999: 165ff.). Die Gesell- schaft müsste dann im Gegenteil für Desintegration sorgen (vgl. Luhmann 1997: 604).
Durkheim, Parsons u.a. sehen zwischen Integration und Normen einen engen Zusammenhang: Normen (und damit auch die Abweichung von diesen) er- möglichen und steuern die Integration von Menschen in die Gesellschaft. Im folgenden Abschnitt offenbart sich, dass Luhmann neben der bereits ausge- führten dauerhaften Vollintegration auch den Stellenwert von Normen für die Integration ablehnt.
Dem ständig drohenden Zerfall von Systemen treten erwartbare Erwartungen entgegen (vgl. Luhmann 1969: 30f.). Dies können auch Normen sein (s. 2.3). Nur ist es so, dass sich die verschiedenen Systeme, gemäß ihrer Eigenlogik ausdifferenzieren. Dabei folgen sie nicht „dem einen [...] normativen Code“ (Krause 2001: 66). Das, was beispielsweise im Funktionssystem Wirtschaft normativ „erlaubt“ und „gesollt“ ist, kann noch lange nicht in ein Interaktions- system, wie der Familie, übertragen werden. Um Sozialintegration dennoch zu ermöglichen, versuchen insbesondere die sozialen Systeme ihre Erwartungs- erwartungen zu verallgemeinern (vgl. ebd. 2001: 64). Die Folge davon ist, dass immer mehr Normen kodifiziert werden, um die Unterschiede „abmildern“ zu können9 und gleichzeitig größere Unsicherheit, aber auch zunehmende Toleranz oder gar Gleichgültigkeit darüber entsteht, dass Erwartungen diffe- rieren können. Normen sind demnach nicht nur notwendig, sondern vor allem auch kontingent.
Darüber hinaus kann auch kein Steuerungszentrum der Gesellschaft mehr angenommen werden, da Systeme in einem „Nebeneinander“ und nicht in einem hierarchischen „Übereinander“ existieren. Kein Funktionssystem kann die Funktion eines anderen übernehmen oder gar über ein anderes herrschen (vgl. Luhmann 1997: 753). Hier gilt, was Friedrich Schiller für das Verhältnis von Politik und Kunst feststellt: „Der Gesetzgeber kann ihr Gebiet sperren, aber darin herrschen kann er nicht“ (Schiller 1967: 593). Damit kann kein Sys- tem Erwartungen für andere oder gar alle Systeme stabilisieren über die dann (Sozial-) Integration gelingen kann.
Die funktional ausdifferenzierte Gesellschaft nach Luhmann verunmöglicht somit einen (moralisch-normativen) Integrationsbegriff, der eine auf Dauer angelegte „Vollintegration“ des (ganzen) Menschen durch Normen beinhaltet. Luhmann führt stattdessen die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion ein.
Inklusion bezeichnet die „Chance der sozialen Berücksichtigung von Perso- nen“ (Luhmann 1997: 620). Auch hier geht Luhmann nicht von einer „Vollin- klusion“ aus, sondern sieht Teilinklusionen, die ständig wechseln können, als den Normalfall an. Personen nehmen an Familie, an Wirtschaft, an Erziehung etc. teil, aber nie ausschließlich und nur partikular. Mit steigender funktionaler Differenzierung ist beobachtbar, dass die Inklusionsbedingungen und Exklusi- onsentscheidungen zunehmend an die Funktionssysteme abgegeben werden (vgl. Bardmann/ Hermsen 2000: 94). Die Systeme entscheiden über In- oder Exklusion nur aufgrund ihrer systemeigenen Logik (s. 7.1). In manchen Teilen der Erde, so Luhmann, scheine sich die Unterscheidung von Inklusion und Exklusion sogar zu „einer Meta-Differenz“ (ebd. 1997: 632) zu entwickeln. Damit meint er, dass sich die Unterscheidung Inklusion/ Exklusion vor die je- weiligen Unterscheidungen der Funktionssysteme schiebt. Beispielsweise be- stimmt eine Exklusion vom Rechtssystem, dass das Rechtssystem überhaupt nicht gemäß seines binären Codes eine Entscheiden treffen kann, da es die exkludierte Person gar nicht „wahrgenommen“ hat. Zudem können Exklusio- nen sich wechselseitig verstärken und bedingen (s. 7.1). Aus diesen Gründen rechnet Luhmann damit, „daß sich ein neues, sekundäres Funktionssystems bildet, das sich mit den Exklusionsfolgen funktionaler Differenzierung befaßt“ (ebd.: 633). Aufgrund wirtschaftlicher, politischer und auch religiösen „Ressourcenabhängigkeit dieser Bemühungen“ (ebd.) bezweifelt er jedoch, dass sich ein solches System bereits gebildet hat.
Unter „Hilfe“ versteht Luhmann einen „Beitrag zur Befriedigung der Bedürfnisse eines anderen Menschen“ (ebd. 1975: 134). Bedürfnisse sind jedoch kontingent. Jeder Einzelne kann demnach zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Bei Hilfe geht es somit immer um individuelle und temporäre Befriedigung von Bedürfnissen.
In der ausdifferenzierten Gesellschaft wird die Hilfe zunehmend auf Organisa- tionssysteme übertragen. Diese wiederum spezialisieren sich auf Leistungen, über deren „Zuteilung“ sie durch Personal und Programme (s. 9.1.3) entschei- den können. Nur die Methodik des Personals und die Organisationsprogram- matik sind wechselseitig entscheidend, ob geholfen wird oder nicht. Organi- sierte Hilfe gestaltet sich demnach unabhängig von Moral und Reziprozität (vgl. ebd.: 143). Erst wenn sich Tatbestand und Programm decken, wird Hilfe zu einer erwartbaren Leistung.
4. Paradigmenwechsel und Systemtheorie
Im zweiten Teil dieser Arbeit wird der Paradigmenwechsel mit dem Fokus auf die Unterscheidung von Norm und Abweichung mittels vier Bezugskategorien dargestellt und diskutiert. Vorab wird die Auswahl und inhaltliche Bestim- mung der einzelnen Bezugskategorien begründet bzw. erläutert (4.1-4.2). In einer Diskussion werden daran anschließend die Argumentationslinien, die für die Erosion der Leitdifferenz Norm/ Abweichung und den damit eingeleite- ten Paradigmenwechsel sprechen, dargestellt (5). Vorab soll angemerkt wer- den, dass sich die entsprechenden Autor(inn)en weder auf eine einheitliche Argumentationslinie, noch auf die Konsequenzen, die der Paradigmenwech- sel mit sich bringt, in vollem Umfang geeinigt haben. Der zweite Teil dieser Arbeit stellt somit den Versuch dar, verschiedene Ansätze in ihren gleichen und differenten Aussagen zusammenzufassen und kritisch zu betrachten.
4.1. Bezugskategorien
Da der Paradigmenwechsel gerade in Bezug auf seine Auswirkungen auf Sozialarbeitswissenschaft dargestellt werden soll, wird neben dem Fokus auf die Unterscheidung von Norm und Abweichung, noch eine weitere Möglich- keit zur Systematisierung benötigt. Hier bietet sich eine Orientierung an den Bezugskategorien des Fachausschusses II, der Konferenz der Fachbereichs- leitungen der Fachbereiche für Sozialwesen, an (vgl. Klüsche 1999: 9). Die Bezugskategorien Gegenstandsbestimmung, Gegenstandserklärung, Ge- genstandsbereich und Gegenstandsbearbeitung ermöglichen ein analyti- sches Raster, an dem die Betrachtung des Paradigmenwechsels innerhalb einer Sozialarbeitswissenschaft übersichtlich eingegrenzt werden kann. Gleichzeitig bleibt aber auch der gesamt zu fassende Umfang erkennbar.
4.2. Begriffssklärung
Die Gegenstandsbestimmung (6) ist äquivalent zur Definition Sozialer Arbeit; der Beschreibung von dem, was Soziale Arbeit ist und was sie nicht ist (vgl. Klüsche 1999: 22). Unter der Gegenstandserklärung (7) werden die „Genese, Dynamik und Folgen“ (ebd.: 23) des Gegenstandes verstanden. Die Gegen- standserklärung versucht zudem Hilfemotive für die Tätigkeit Sozialer Arbeit zu begründen und bildet insgesamt den Rahmen für Theorien und Forschung der Sozialarbeitswissenschaft. Der Gegenstandsbereich (8) versucht die in- stitutionellen, organisatorischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Adressaten und professionell Tätigen zu erfassen. Er begrenzt den Be- reich des Handlungsfeldes Sozialer Arbeit. Die Gegenstandsbearbeitung (9) soll die für Soziale Arbeit typischen Handlungskonzepte verdeutlichen.
5. Erosion der Leitdifferenz Norm/Abweichung
„Die theoretische Reflexion der Sozialen Arbeit [... ist] an der Leitdifferenz von Konformität und Devianz orientiert“ (Baecker 1994: 93). Warum Soziale Arbeit als Profession überhaupt tätig werden will, wer ihre Akteure und Ad- ressaten sein sollen, wohin sie Menschen, Gruppen oder gar die Gesell- schaft verändern will, wie sie dies tun möchte, wann genau und wie lange sie tätig sein will oder dies alles tun soll, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Unterscheidung von Norm und Abweichung. In der auf Durkheim und Parsons gegründeten Sichtweise bieten Normen (und Abweichungen von diesen) für die Beantwortung obiger Fragestellungen Wegweiser, Erläuterun- gen und Begründungen, und sind aus diesem Grund für die Soziale Arbeit von fundamentaler Bedeutung.
Im folgenden Kapitel wird gezeigt, wie und warum die Leitdifferenz Norm/ Abweichung erodiert und als „theorieleitendes Paradigma der Sozialarbeit und Sozialpädagogik fragwürdig“ (Böhnisch 1994: 20) geworden ist. Die Ar- gumentationslinien systemtheoretischer Beiträge zur Sozialarbeitswissen- schaft für eine Erosion des Leitparadigmas und die Forderung nach einer theoretischen Abkehr von diesem lassen sich in drei Themenbereichen dis- kutieren: Im Zusammenhang von Norm und Abweichung mit Integration (5.1), der Ausbildung einer Allzuständigkeit und der Festlegung von Hilfebedürftig- keit durch Soziale Arbeit (5.2) und im Spannungsverhältnis von Hilfe und Kontrolle (5.3).
[...]
1 http://www.grin.com/group/244/sozial-management-beratung
2 Zur Vertiefung vgl. Reinhold 2000.
3 In diesem Zusammenhang kann vorweggenommen werden, dass ein Paradigmenwechsel im Rahmen luhmannscher Systemtheorie mit dem Wechsel einer Leitdifferenz einhergeht (vgl. Krause 2001: 182).
4 Zu diesen Sicherheitsnetzen oder kommunikative Wirklichkeiten , wie Luhmann sie auch nennt, werden auch Werte und Moral gezählt (vgl. Krause 2001: 33).
5 Zur Vertiefung vgl. Lamnek 1997.
6 Merton hält abweichendes Verhalten (in Form von Innovation, Ritualismus, Apathie oder Rebellion) ebenso für eine Anpassung an anomische Strukturen wie Konformität. Zur Vertiefung vgl. Merton 1995 und Lamnek 1997.
7 Vgl. zur Vertiefung in Bezug auf Durkheim bzw. Parsons: König 1976 bzw. Staubmann 1989.
8 Luhmann sieht auch das Beobachten als realen Vorgang. Darin sieht er eine Möglichkeit die Differenz zwischen Realismus und Konstruktivismus aufzuheben oder zu umgehen: Es sei gleich, ob die Umwelt real (Realismus) oder Ergebnis unserer Wahrnehmung ist (Konstruktivismus), da das Bezugnehmen darauf real sei (vgl. Reese-Schäfer 2001: 37f.).
9 Das Recht behandelt ja gleiche Fälle gleich und ungleiche Fälle ungleich (vgl. auch Baecker 1994: 103).
- Arbeit zitieren
- Paul Pott (Autor:in)Stephan Quiring (Autor:in), 2003, Aufbruch in die Beliebigkeit? Über die Unterscheidung von Norm und Abweichung als Leitdifferenz für die Wissenschaft der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230340
Kostenlos Autor werden





















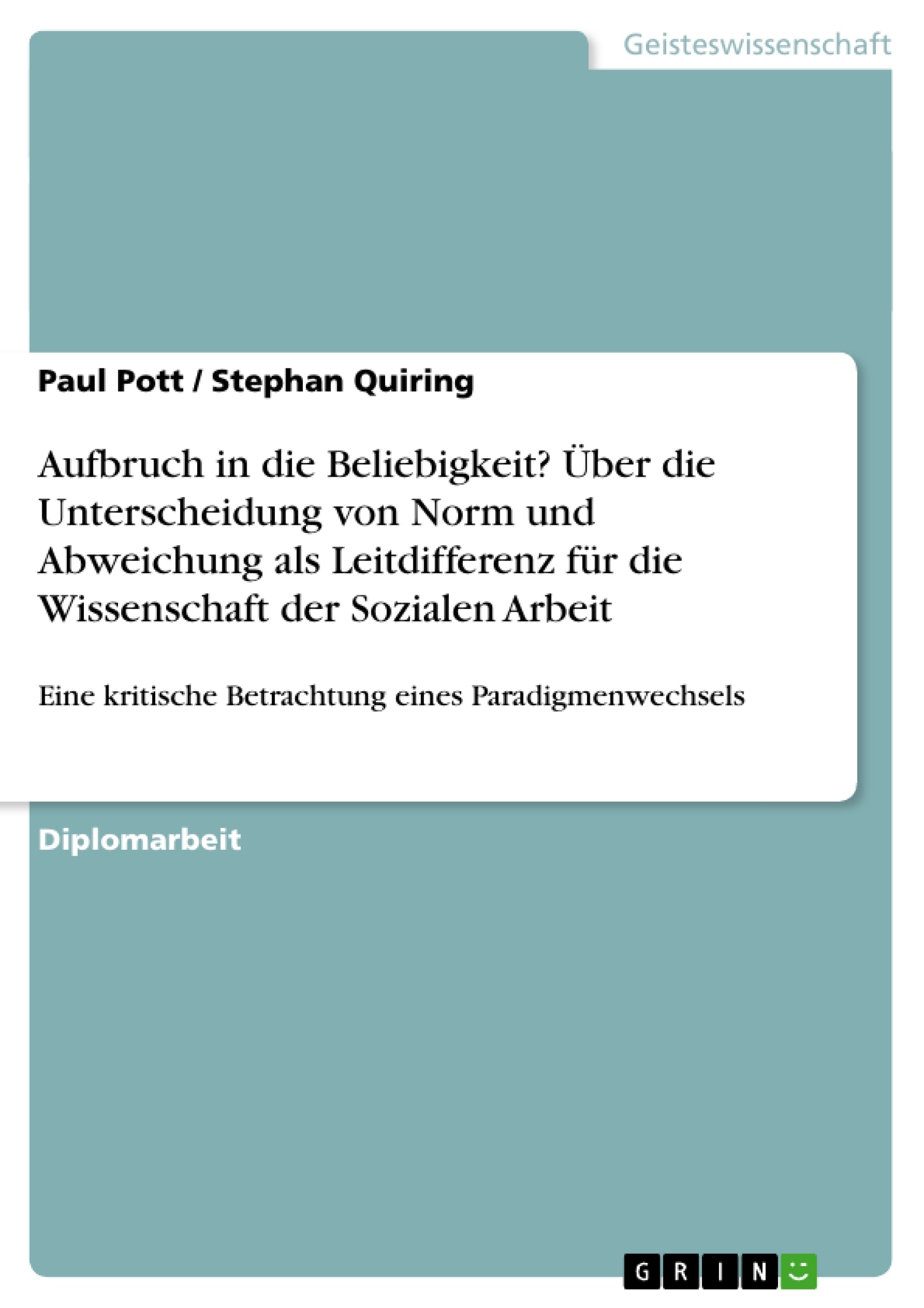

Kommentare