Leseprobe
INHALT
1. Einleitung
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Der demografische Wandel
2.1.1 Erklarungen zur Begrifflichkeit
2.1.2 Bestimmungsfaktoren des demografischen Wandels
2.1.2.1 Die Fertilitat
2.1.2.2 Die Mortalitat
2.1.2.3 Die Migration
2.1.3 Prognose fur die Zukunft
2.1.4 Auswirkungen auf die Situation in der Pflege
2.2 Die bisherige Generationenabfolge des stationaren Altenwohnbaus
2.2.1 Die 1. Generation - Leitbild: Verwahranstalt
2.2.2 Die 2. Generation - Leitbild: Krankenhaus
2.2.3 Die 3. Generation - Leitbild: Wohnheim
2.2.4 Die 4. Generation - Leitbild: Familie
2.3 Eine neue Generation: „Pflege im Quartier“
2.3.1 Begriffserklarung und Zielvorstellung
2.3.2 Internationale Entwicklung
2.3.3 Nationale Entwicklung
2.3.4 Empfehlungen des KDA
2.3.4.1 Das KDA-Modell zur Lebensqualitat
2.3.4.2 Die drei Grundprinzipien der 5. Generation
3. Zielstellung
4. Methodik
4.1 Studiendesign
4.2 Literaturrecherche
4.2.1 Einschlusskriterien
4.2.2 Beschreibung des Vorgehens
4.2.3 Informationsquellen und Suchstrategien
4.2.3.1 Recherche nach „Summaries“
4.2.3.2 Recherche nach „Syntheses“ und „Studies“
4.2.3.4 Recherche mittels Internet-Suchmaschine
4.2.3.5 Handsuche
4.3 Auswahl der Literatur
4.4 Datenextraktion
4.4.1 Auswahl der zu extrahierenden Literatur
4.4.2 Analysepunkte und Vorgehen
5. Ergebnisse
5.1 Ergebnisse der Literaturrecherche
5.1.1 Deskriptive Aufbereitung aufgenommener Quellen
5.1.2 Beschreibung extrahierter Literatur
5.2 Ergebnisse der Datenauswertung
5.2.1 Moglichkeiten der Alltagsgestaltung und Partizipation
5.2.2 Starken
5.2.3 Problemfelder
6. Diskussion
6.1 Ergebnisdiskussion
6.2 Methodendiskussion
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkurzungsverzeichnis
Glossar
Anhang
Anhang 1: Tabellen im Rahmen der Recherche nach „Systems“
Anhang 2: Tabellen im Rahmen der Recherche nach „Syntheses“ & „Studies“
Anhang 3: Tabellen im Rahmen der Recherche mit der Internet-Suchmaschine
Anhang 4: Tabellen im Rahmen der Handsuche
Anhang 5: Zusammenfassung der Literaturrecherche & Datenextraktion
Anhang 6: Sieg-Kriterien des Wettbewerbs „Pflege im Quartier, 2012“
Anhang 7: Beurteilung der Ubersichtsarbeit nach Behrens & Langer, 2010
Anhang 8: Tabellen im Rahmen der Projektmodelle
1. Einleitung
Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt Flexibilitat eine essentielle Voraussetzung dar, um den zukunftigen Veranderungen innerhalb der deutschen Bevolkerung begegnen zu konnen. Dies ist zumindest eines der Fazits, die am 04. Oktober 2012 auf dem ersten Berliner Demografiegipfel getroffen wurden. Zahlreiche Politiker kamen zusammen, um die Sachlage rund um ein alter und bevolkerungsarmer werdendes Deutschland zu thematisieren und diesbezugliche Losungen zu diskutieren. Konkrete Strategien blieben jedoch aus (vgl. Vogel, 2012).
Flexibilitat wird dabei auch innerhalb des pflegerischen Hilfe- und Versorgungssystems notwendig sein, denn schon jetzt wird die Angst vor einem zukunftigen Pflegenotstand geschurt (vgl. Amrhein, 2011). Generell gelten die Bevolkerungsveranderung und der damit verbundene steigende Anteil alter Personen schon seit langer Zeit als Schlagwort fur eine nahende Bedrohung fur die Menschheit, was in Schirrmachers Bestsellerbuch „Das Methusalem-Komplott“ zum Ausdruck kommt:
„Wenn die Mehrheit einer Gesellschaft zu den Alteren gehort, schwindet automatisch die Ressource Zukunft.“ (Schirrmacher, 2006, S. 24)
Inwieweit dessen Befurchtungen begrundet sind, soll zu Beginn dieser Forschungsarbeit gezeigt werden. Der erste Teil beleuchtet die Thematik „Demografie“ und deren Auswirkungen auf die nachsten 20 Jahre. Ein besonderer Fokus besteht hierbei auf dem Gesundheitssystem und dem Netzwerk der Altenhilfe. Darauf aufbauend schliefit sich letztlich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einer neuen Form der Hilfe und Unterstutzung an, der „Pflege im Quartier“. Diese wird bereits von einflussreichen Institutionen, wie dem Kuratorium Deutsche Altershilfe, als potenzielle Losung und somit als neue „Funfte Generation[44] der Altenpflege pradestiniert (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 9), was bereits eine enorme aktuelle Relevanz andeuten lasst.
Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, das Potenzial dieses neuen Konzepts der Versorgung zu erschliefien, um letztlich Aussagen treffen zu konnen, inwieweit es als Losung fur die demografischen Herausforderungen betrachtet werden kann.
Um dies qualitativ zu gewahrleisten, wurde eine systematische Ubersichtsarbeit erstellt, die aus einem grofien Umfang an Literatur Evaluationen verschiedener Modellprojekte beleuchtet und vereint. Dabei werden methodisches Vorgehen und entsprechende Ergebnisse ausfuhrlich im Hauptteil dieser Arbeit prasentiert und im abschliefienden Part kritisch eingeschatzt.
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Der demografische Wandel
Zunachst wird der Begriff „Demografie“ naher erlautert. Anschliefiend stehen die prognostizierten Auswirkungen fur die zukunftigen Jahre im Vordergrund.
2.1.1 Erklarungen zur Begrifflichkeit
Dem Griechischen entlehnt, versteht man unter „Demografie“ die wissenschaftliche Untersuchung menschlicher Populationen, wobei Grofie, Zusammensetzung, Verteilung, Dichte, Wachstum und andere Eigenschaften analysiert und deren Ursachen und Folgen erklart werden (vgl. Hofimann, Lettow & Munz, 2012, S. 9).
Demografisches Denken begann bereits vor Jahrhunderten. Angefangen bei agyptischen Ermittlungen der Volkszahlen in den Jahren weit vor Christus bis hin zu der ersten wissenschaftlich bedeutsamen Vorausberechnung der „Tragfahigkeit der Erde“ durch den Berliner Gelehrten und Probst Johann Peter Sufimilch im 18. Jahrhundert. Dieser protestierte heftig gegen die haufig vorausgesagten Katastrophen rund um Hungersnote, Umweltverschmutzung und Platzmangel, die mit einem Bevolkerungswachstum einhergehen sollen. Sufimilchs Berechnungen zufolge, ist die Erde in der Lage, weit mehr als die damalige Weltbevolkerung von ungefahr 750 Millionen Menschen zu beheimaten; namlich in etwa 14 Milliarden (vgl. Birg, 2005, S. 9).
Mehrere Jahrhunderte spater aufierte sich auch der deutsche Bevolkerungswissenschaftler Herwig Birg zu diesem Thema:
„Wenn die gesamte Erdbevolkerung von z.Zt. 6 Mrd. Menschen zu einer Vollversamml ung oder zu einem grofien Open-Air-Konzert zusammenkommen wollte, wurde heute immer noch ein Versammlungsplatz von der Grofie der Insel Mallorca ausreichen.“ (Birg, 2005, S. 10)
In Anbetracht der derzeitigen Weltbevolkerungszahl von etwa 7 Milliarden Menschen (vgl. Deutsche Stiftung Weltbevolkerung, 2011) stellt sich nun die Frage, worin dann die Problematik einer Bevolkerungsveranderung liegt. In Deutschland tritt seit geraumer Zeit die Sorge im Hinblick auf die zukunftige Versorgungspolitik und Wirtschaftlichkeit der Bundesrepublik auf. Grund hierfur ist nicht die mogliche Gefahr einer Ubervolkerung im Land, sondern ein prognostizierter Ruckgang erwerbsfahiger Burger, begleitet von einem stetigen Anstieg von Personen im Rentenalter fur die zukunftigen Jahre (vgl. Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2010, S. 8).
In der Bevolkerungswissenschaft wird diese Veranderung auch als „Demografischer Umbruch“ oder „Ubergang“ betitelt. Diese Umbruche traten in der Vergangenheit bereits mehrmals auf; allerdings nicht in der ausgepragten Form, die nun bevorsteht. Bisher standen noch nie mehr alte Menschen den Jungen gegenuber, weshalb auch keine Erfahrungswerte dabei helfen konnten, wie mit diesem Sachverhalt in der Zukunft umgegangen werden sollte (vgl. Schinkel, 2007, S. 10).
In den Hintergrund ruckt dabei die Tatsache, dass der sogenannte demografische Wandel bereits im vollen Gange ist. Seit nahezu vier Jahrzehnten reicht die Zahl der Neugeboren nicht mehr aus, um die Elterngeneration zu ersetzen (vgl. Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2011, S. 6). Dadurch, dass mehr Menschen sterben als geboren werden, wurde die deutsche Bevolkerung ohne Zuwanderungen aus dem Ausland in den Jahren von 1998 bis 2100 von 82,1 Millionen auf 24,3 Millionen geschrumpft sein (vgl. Birg, 2005, S. 98). Da jedoch auch diese allmahlich zuruckgeht, kann der Uberschuss an Sterbefallen seit 2003 nicht langer kompensiert werden und wird auf lange Sicht keinen weiteren Ausgleich darstellen (vgl. Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2011, S. 6). Ein Gleichgewicht bei dem Anteil junger und alter Menschen in der deutschen Bevolkerung besteht unterdessen seit Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr. 1939 war in den Daten des Statistischen Bundesamtes letztmalig eine hohere Anzahl der Unter-15-Jahrigen als die der Uber-50-Jahrigen auffindbar (vgl. Grunheid, 2009, S. 16).
2.1.2 Bestimmungsfaktoren des demografischen Wandels
Die Bevolkerungsveranderung ist grob auf drei verschiedene Faktoren zuruckzufuhren. Zu diesen zahlen: Fertilitat, Mortalitat und Migration (vgl. Sporket, 2011, S. 25).
2.1.2.1 Die Fertilitat
Im Rahmen der Demografie beschreibt die Fertilitat das Fortpflanzungsverhalten sowie den Vorgang der Erzeugung von Nachwuchs und stellt von allen drei Einflussfaktoren den Grofiten dar. Um die Fertilitat statistisch feststellen zu konnen, greift man auf unterschiedliche Kennzahlen zuruck. Die beiden Wichtigsten bilden die rohe Geburtenziffer und die Gesamtfertilitatsrate (vgl. Schinkel, 2007, S. 11).
Die durchschnittliche Zahl der Kindergeburten je Frau liegt in Deutschland gegenwartig bei rund 1,4 (vgl. Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2011, S. 11).
Die Ursachen fur eine solche Fertilitat sind ganz unterschiedlich. Zum einen spielt der steigende Drang zur Individualisierung eine grofie Rolle. In diesem Zusammenhang stehen sinkende Eheschliefiungen bei gleichzeitig steigendem Scheidungsverhalten, das immer ofter auftretende Singlebewusstsein und das Streben nach materiellen Werten. Aufierdem fuhrten soziale Sicherungssysteme dazu, dass Kinder, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr zwingend notwendig fur die elterliche Altersversorgung sind. Kinder befriedigen somit grofitenteils emotionale Bedurfnisse, welche jedoch alternativ auch durch eine berufliche Karriere erfullt werden konnen (vgl. Schinkel, 2007, S. 14).
Entscheidend bei der Aufzahlung der unterschiedlichen Ursachen ist, dass diese nicht monokausal zu betrachten sind und zudem durch wirtschaftliche, politische und kulturelle Einflusse bedingt werden (vgl. Schinkel, 2007, S. 17).
2.1.2.2 Die Mortalitat
Die Mortalitat, oder auch Sterblichkeit, beschreibt fur einen bestimmten Zeitraum die Anzahl der Todesfalle im Verhaltnis zur Bevolkerungsgesamtzahl (vgl. Hofimann et al., 2012, S. 26). Sie bildet den zweitwichtigsten Bestimmungsfaktor und umfasst Kennzahlen, wie die rohe Sterberate, das Medianalter und die Lebenserwartung (vgl. Schinkel, 2007, S. 18).
In Deutschland ist die Mortalitatsrate durch eine zunehmende Lebenserwartung sowie einem Ruckgang der Sauglings- und Kindersterblichkeit gepragt. In den Jahren 2006 bis 2008 betrug die Lebenserwartung bei Geburt durchschnittlich fur Jungen 77,2 Jahre und fur Madchen 82,4 Jahre. In den alten Bundeslandern liegt sie dabei insgesamt etwas hoher als in den neuen. Die Gesamtzahl der Sterbefalle ist bis 2001 fast kontinuierlich zuruckgegangen und stagniert seitdem bei etwa 820.000 bis 850.000 im Jahr (vgl. Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2011, S. 13).
Ursachen fur eine geringere Sterberate sind der Ruckgang der Sauglingssterblichkeit, der medizinische Fortschritt sowie eine Veranderung der Todesursachen. Wahrend die Menschen fruher an Infektionskrankheiten starben, sind heute Erkrankungen des Herz- Kreislaufsystems und bosartige Tumorbildungen Haupttodesursache. Aber auch der personliche Lebensstil, die Ernahrung und ein neues Bewusstsein fur eine gesunde Lebensfuhrung sind nennenswerte Faktoren (vgl. Schinkel, 2007, S. 21).
2.1.2.3 Die Migration
Die Migration stellt eine geografische Ortsveranderung von Menschen uber eine bestimmte Mindestdistanz und fur einen bestimmten Mindestzeitraum hinweg zur Errichtung eines neuen dauerhaften oder vorubergehenden Wohnsitzes dar. Es wird dabei zwischen Binnen- und Aufienwanderung unterschieden. Wahrend Binnenwanderung innerhalb einer betrachteten Einheit stattfindet, wie zum Beispiel innerhalb eines Staates, erfolgt Aufienwanderung uber die Grenzen der betrachteten Einheit hinweg, also beispielsweise eine Auswanderung in ein benachbartes Land (vgl. Hofimann et al., 2012, S. 39).
Seit 1991 war die Wanderungsbilanz in Deutschland mit Ausnahme weniger einzelner Jahre positiv und bewegte sich in unterschiedlichen Zeitraumen zwischen 129.000 und 354.000 Personen jahrlich. Von 2003 bis 2007 ging der jahrliche Saldo aus Zu- und Fortzugen allerdings auf durchschnittlich 74.000 Personen deutlich zuruck. Dies war sowohl auf hohere Auswanderungen der Deutschen als auch auf geringere Zuzuge von deutschen Aussiedlern sowie auslandischer Personen zuruckzufuhren (vgl. Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2011, S. 18).
2.1.3 Prognose fur die Zukunft
Die Statistischen Amter des Bundes und der Lander veroffentlichen regelmafiig Informationen, die die Veranderungen innerhalb der Bevolkerung behandeln. Dadurch lassen sich mithilfe der zuvor benannten Bestimmungsfaktoren aus dem Kapitel 2.1.2 Prognosen fur spatere Jahre vorhersagen, die erfahrungsgemafi aus vergangenen Jahren eine hohe Genauigkeit besitzen. Die in diesem Kapitel beschriebenen Veranderungen orientieren sich an der zwolften koordinierten Bevolkerungsvorausberechnung der statistischen Amter. Insgesamt umfasst sie zwolf Varianten sowie drei Modellrechnungen. Fur diese Prognose wird die Variante 1-W1 verwendet, die wie folgt erklart wird:
„Diese Variante markiert die untere Grenze der „mittleren“ Bevolkerungsentwicklung, welche sich bei der Fortsetzung der aktuell beobachteten Trends in der Entwicklung der Geburtenhaufigkeit und der Lebenserwartung ergeben wurde. Der Aubenwanderungssaldo, der der Differenz der Zuzuge nach und Fortzuge aus Deutschland entspricht, steigt dabei bis zum Jahr 2014 auf 100 000 Personen und verharrt dann auf diesem Niveau.“ (Statistische Amter des Bundes und der Lander, 2011, S. 6).
Aus dieser Annahme heraus ergeben sich laut der Statistischen Amter des Bundes und der Lander (vgl. 2011, S. 8ff.) unterschiedliche Wandlungen innerhalb der deutschen Bevolkerung, die nachfolgend aufgefuhrt werden. Bis zum Jahr 2030 werden nur noch in etwa 77 Millionen Menschen in Deutschland leben. Gegenuber dem Jahr 2008 entspricht dies einem Ruckgang von rund 5,7 Prozent. Am deutlichsten erkennbar ist die schrumpfende Bevolkerung an der Gruppe der Unter-20-Jahrigen. Statt den heutigen 15,6 Millionen werden im Jahr 2030 nur noch 12,9 Millionen Kinder und Jugendliche leben; ein Ruckgang von 17 Prozent. Die Anzahl der 20- bis 65-jahrigen Personen wird um etwa 15 Prozent sinken; das bedeutet, es werden rund 7,5 Millionen weniger Menschen in Deutschland leben, die sich im erwerbsfahigen Alter befinden. Die Altersgruppe der 65-Jahrigen und Alteren wird hingegen von 16,7 Millionen im Jahr 2008 um rund ein Drittel auf 22,3 Millionen Personen im Jahr 2030 ansteigen. Die auf Gesamtdeutschland aufgefuhrten Veranderungen werden in den einzelnen Bundeslandern unterschiedlich ausfallen. Durch Binnenwanderung innerhalb des Landes ergeben sich vor allem in den ostdeutschen Landern verstarkt eine Alterung sowie ein Bevolkerungsruckgang. Die Zahl der Neugeborenen wird sich bis 2030 in allen Bundeslandern verringern. Der absolute Ruckgang betragt im Vergleich zum Jahr 2008 in den alten Landern rund 55.000 und in den neuen rund 37.000. Relativ gesehen bedeutet dies fur die neuen Lander 36 Prozent weniger Geburten, fur die alten lediglich 10 Prozent. Die Lebenserwartung fur die deutsche Bevolkerung wird sich bis zum Jahr 2030 voraussichtlich fur Jungen um knapp vier und fur Madchen um etwa drei Jahre erhohen. In diesem Zusammenhang steht auch die Erhohung der Sterbefalle in Deutschland. Im Jahr 2030 ist gegenuber 2008 mit knapp 150.000 mehr Sterbefallen zu rechnen, also mit einer Erhohung von 17 Prozent. Aus all diesen Punkten lasst sich die naturliche Bevolkerungsbilanz fur das Jahr 2030 ermitteln. Die abnehmenden Geburten und die zunehmenden Sterbefalle fuhren zu einer Zunahme des Geburtendefizits in Deutschland. Dieses wird sich von 160.000 aus dem Jahr 2008 voraussichtlich bis 2030 um etwa 150 Prozent auf 410.000 erhohen.
2.1.4 Auswirkungen auf die Situation in der Pflege
Die beschriebenen prognostizierten demografischen Veranderungen in Deutschland werden ebenfalls Auswirkungen auf das Sozialsystem und dem Bereich Pflege haben. Seit Dezember 1999 wird durch die Statistischen Amter des Bundes und der Lander alle zwei Jahre eine Pflegestatistik durchgefuhrt, um so Daten zum Angebot sowie zur Nachfrage pflegerischer Versorgung zu erhalten. Die nun folgenden Ausführungen zur gegenwartigen Situation in der Pflege und den kunftigen Veranderungen basieren auf der Pflegestatistik von 2009, welche derzeit die aktuellste Publikation darstellt.
Laut §14 Abs.1 SGB XI sind pflegebedurftige Menschen Personen, die wegen einer korperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung fur die gewohnlichen und regelmaBig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des taglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich fur mindestens sechs Monate, in erheblichem oder hoherem MaBe der Hilfe bedurfen.
Im Jahr 2009 wurden 2,34 Millionen Menschen in Deutschland gezahlt, die nach dieser Definition als pflegebedurftig galten. 83 Prozent dieser Personen waren uber 65 Jahre alt; davon 35 Prozent 85 Jahre und alter. Von diesem Personenkreis wurden 69 Prozent Zuhause versorgt. Dazu zahlten 1,07 Millionen Personen, die von ihren Angehorigen gepflegt und 555.000 Pflegebedurftige, die von einem ambulanten Pflegedienst versorgt wurden. Die ubrigen 31 Prozent der Zupflegenden lebten vollstationar in einer entsprechenden Pflegeeinrichtung. In absoluten Zahlen waren dies 717.000 Personen (vgl. Pfaff, H., 2011, S. 4ff.).
In Anbetracht der Tatsache, dass bis zum Jahr 2050 erwartet werden kann, dass etwa 40 Prozent aller Deutschen 60 Jahre und alter sein werden (vgl. Schinkel, 2007, S. 31), kann ebenfalls ein Anstieg der Zahl an Pflegebedurftigen angenommen werden. Im Vergleich zum Jahr 2007 hat die Anzahl dieser bis zum Jahr 2009 bereits um 4,1 Prozent zugenommen, wahrend sie vergleichsweise zu 1999 um ganze 16 Prozent anstieg (vgl. Pfaff, 2011, S. 6).
Laut der Statistischen Amter des Bundes und der Lander (vgl. 2010, S. 27) sind bis zum Jahr 2030 etwa 3,37 Millionen Menschen zu erwarten, die pflegerische Unterstutzung benotigen. Dies ergibt seit 2007 einen Zuwachs an Pflegebedurftigkeit um ganze 50 Prozent. Zu beachten ist hierbei, dass fur diese Vorausberechnung der „Status-Quo- Ansatz“ (siehe Glossar) gilt. Bei dem Modell der „sinkenden Pflegequote“ (siehe Glossar) steigt die absolute Anzahl der Pflegebedurftigen zwar nicht im gleichen Umfang an; dennoch werden selbst unter diesem Ansatz im Jahr 2030 rund 3 Millionen Zupflegende geschatzt.
Der Zuwachs an Pflegebedurftigkeit fuhrt hypothetisch zu neuen Anforderungen, denen sich Deutschland stellen muss. Die Nachfrage nach pflegerischer Unterstutzung wird womoglich stark steigen; weitere Angebote sollten demnach konzipiert werden. Inwieweit die zunehmende Nachfrage dabei abgedeckt werden kann, hangt stark von den Pflegearrangements ab. Hierbei lassen sich hausliche, ambulante und vollstationare Pflege voneinander unterscheiden.
Auf welche Form der Pflege letztlich zuruckgegriffen wird, ist stark an die Verfugbarkeit familiarer Pflegepersonen geknupft. Demografisch bedingt sinkt das Potenzial, dass Tochter oder Schwiegertochter die pflegebedurftigen Eltern im Eigenheim pflegerisch unterstutzen, was gegenwartig den grofiten Anteil an hauslicher Pflege darstellt (vgl. Rothgang, 2005, S. 126-127).
Wenn die Zahl der Frauen im mittleren Alter in Relation zur spateren Pflegequote gesetzt wird, ergibt sich ein Indikator fur dieses Potenzial, welcher sich von 2000 bis 2040 halbiert. Das steigende „Partnerpflegepotenzial“, welches dadurch erklart werden kann, dass verwitwete Personen der Kriegsjahrgange allmahlich durch Nachkriegsjahrgange ersetzt werden, kann dabei keinen Ausgleich schaffen. Zudem ist mit einer hohen Berufstatigkeit von Frauen zu rechnen. Da Beruf und hausliche Pflege nur schwer miteinander vereinbar sind, sinkt hierdurch ebenfalls das Potenzial fur familiare Pflege (vgl. Rothgang, 2005, S. 127).
Ebenso fuhrt die Tatsache, dass die Haufigkeit an Ein-Personen-Haushalten ansteigt und dass die kulturelle Uberzeugung, seine Familie pflegen zu mussen, an Bedeutung verliert, dazu, dass die hausliche Pflege zukunftig seltener in Erscheinung tritt (vgl. Rothgang, 2005, S. 128).
Der Trend zur professionellen Pflege durch ambulante oder vollstationare Angebote wird somit steigen. Hiermit sind wiederum zwei Hauptprobleme verbunden.
Zum einen wird die Pflegeversicherung mehr ausgelastet, da Pflegesachleistungen hohere Ausgaben bedeuten als Pflegegeld (vgl. Rothgang, 2005, S. 127). Die entsprechenden Einnahmen werden jedoch sinken, da die Zahl der erwerbsfahigen Burger im Verhaltnis zu dem Personenkreis der Uber-65-Jahrigen zuruckgeht (vgl. Rothgang, 2005, S. 130).
Zum anderen sind viele professionelle Pflegekrafte notwendig, um den Pflegebedarf abzudecken. Der Gesamtbedarf an Pflegekraften wird in den kommenden Jahren stetig ansteigen. Bis zum Jahr 2050 wird er sich fast verdoppeln. Dem gegenuber steht der Anstieg der uber-50-jahrigen Pflegekrafte, falls nicht mehr neuausgebildetes Fachpersonal gewonnen werden kann. Die gegenlaufigen Trends - immer weniger Pflegepersonal fur immer mehr Pflegebedurftige - stellen eine Gefahr dar, zu Engpassen und Mangeln in der Qualitat zu fuhren (vgl. Berufsgenossenschaft fur Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege - BGW, 2007, S. 22-23).
Der demografische Wandel hat aufierdem Auswirkungen auf den Grad der Pflegebedurftigkeit. Durch eine Zunahme der Personenzahl uber 80 Jahre und einer steigenden Lebenserwartung lasst sich hypothetisch schlussfolgern, dass ebenfalls mehr hochaltrige Pflegebedurftige existieren werden. Damit verbunden ist eine hohere Wahrscheinlichkeit an Multimorbiditat und einem haufigeren Aufkommen von Schwerstpflegebedurftigkeit. Dadurch steigen die Anspruche und Anforderungen an die pflegenden Personenkreise (vgl. Kleinicke, 2008, S. 79).
2.2 Die bisherige Generationenabfolge des stationaren Altenwohnbaus
Langst fuhrte der demografische Wandel in fruheren Jahren zu Veranderungen in den gesellschaftlichen Strukturen sowie zu unterschiedlichen Anforderungen an die sozialen Begebenheiten, wodurch ebenfalls die unterschiedlichen Wohnformen stationarer Altenpflegeeinrichtungen gepragt waren. Die Entwicklung und Bestandteile der einzelnen Konzepte zum Wohnen im Alter in den entsprechenden Einrichtungen lassen sich in einer vom Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) geschaffenen Generationenabfolge ubersichtlich klassifizieren und werden nachfolgend beschrieben (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 14).
2.2.1 Die 1. Generation - Leitbild: Verwahranstalt
Die erste klar einzugrenzende Wohnform in der Altenpflege entstand in der Zeit ab circa 1940. Sie stellte 20 Jahre lang die vorherrschende Bauform fur Altenpflegeeinrichtungen dar und wird seither mit dem Begriff „Verwahranstalt“ in Verbindung gesetzt. Hintergrund fur diese Betitelung ist, dass der Zupflegende mehr oder weniger als Heiminsasse in der Einrichtung verwahrt und minimal versorgt wurde. Die vordergrundige Funktion dieser Pflegehauser war insbesondere wahrend der Kriegs- und Nachkriegszeit eine Moglichkeit darzustellen, fur Schlaf- und Essplatze sorgen zu konnen. Die eigentliche Pflege konnte wahrenddessen nur unter schwierigen Bedingungen durchgefuhrt werden. Ein hoher Bedarf in Kombination mit geringen Mitteln fuhrte zu einfachsten Versorgungsformen innerhalb dieser Institutionen. Einzig die Konstruktion von Zwei- bis Vierbettzimmern galt als Innovation im Vergleich zu den Schlafsalen vorhergehender Unterbringungsformen. Hohe Belegungsdichten sowie das Fehlen von Gemeinschaftsraumen sind typische Merkmale der „1. Generation[44] (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 15).
2.2.2 Die 2. Generation - Leitbild: Krankenhaus
Die zweite Wohnform entstand uberwiegend aus den Mangeln der vorhergehenden heraus. In den spateren 1960er und wahrend der 1970er Jahre wurde die Konzeption zunehmend durch die Geriatrie gepragt, was letztlich dazu fuhrte, dass Krankenhauser eine Vorbildfunktion fur die Wohngestaltung einnahmen. Die eigentliche Pflege ruckte mehr in den Vordergrund und es wurden zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Pflege von Bettlagerigen zu erleichtern. Die Einrichtung selbst war stereotypisch raumlich organisiert und es lag eine Uberbetonung auf der Technik. Als Wohnform wurde dieses Pflegeheim, ahnlich wie das eigentliche Krankenhaus, kaum angesehen. Nur wenige Gemeinschaftsraume dienten der Befriedigung der Kommunikationsbedurfnisse und Aktivierung sowie Rehabilitation erfolgten uberwiegend auberhalb einer Station (vgl. Michelli-Auli & Sowinski, 2012a, S. 16).
2.2.3 Die 3. Generation - Leitbild: Wohnheim
In dieser Konzeption der Altenpflege, die ab 1980 entstand, wurden neben Pflegeerfordernissen erstmalig auch Wohnbedurfnisse berucksichtigt. Die Einrichtungen dieser Generation wurden nun als Lebensraum und Wohnstatte verstanden und der Mensch als ganzheitliches Wesen ruckte in den Fokus der Betrachtung. Dies fuhrte dazu, dass nicht langer nur Defizite, sondem auch verbliebene Moglichkeiten sowie deren Aktivierung in den Vordergrund ruckten, wonach sich auch die raumliche Umgebung gestaltete. Individuelle Wohn- und Schlafbereiche sowie eine geringere Belegungsdichte sollten zu mehr Individualitat, Privatsphare und Kommunikation fuhren. Es wurde ein pflegerisches Angebot gestaltet, um die Selbststandigkeit der Pflegebedurftigen anzuregen. Insgesamt entwickelte sich die einstige Verwahrpflege mehr zur medizinischen Assistenz innerhalb eines anerkannten Wohnkomplexes (vgl. Michelli-Auli & Sowinski, 2012a, S. 16-17).
2.2.4 Die 4. Generation - Leitbild: Familie
Die vierte Generation in dem Altenwohnbau stellt das Hausgemeinschaftskonzept fur alte Menschen dar, welches seit circa 1995 besteht. Diese Gemeinschaft ist eine Gruppe aus etwa acht bis zwolf Senioren, die in einer wohnungsahnlichen Umgebung zusammenleben. Das Gemeinschaftsleben spielt sich dabei uberwiegend in einem speziellen Wohn- und Essbereich ab, in dem eine Kochkuche integriert ist. Hier ist eine sogenannte Prasenzkraft permanent uber den Tag verteilt anwesend und ubernimmt hauswirtschaftliche sowie betreuende Tatigkeiten. Dadurch sollen die Bewohner stets einen Ansprechpartner vorfinden konnen, der sie zudem aktiv zu selbststandigen Tatigkeiten in Rahmen alltaglicher Aktivitaten animiert und unterstutzt - stets im Rahmen der vorliegenden Fahigkeiten und Vorlieben. Zudem sollen Gerausche, Geruche und vertraute Bewegungen innerhalb der Wohnkuche die Zupflegenden stimulieren und anregen. Dieses Konzept hat sich bislang insbesondere bei der Dementenbetreuung bewahrt (vgl. Michelli-Auli & Sowinski, 2012a, S. 17-18).
2.3 Eine neue Generation: „Pflege im Quartier“
In Anbetracht der demografischen Herausforderung mussen Angebote zum Wohnen und zur Betreuung besser miteinander vernetzt werden. Dies soll dort geschehen, wo altere und jungere Menschen zusammenleben, um sich gegenseitig zu unterstutzen: in Wohngebieten und Stadtteilen (vgl. Evangelisches Johanneswerk, 2012, S. 14).
2.3.1 Begriffserklarung und Zielvorstellung
„Pflege im Quartier“ umschlieBt im idealen Fall eine Versorgung von alteren, kranken und behinderten Menschen in deren direkten Wohnumfeld mit pflegerischen, betreuerischen und medizinischen Dienst- und Beratungsleistungen. Dabei mussen sozio-kulturelle Angebote und Nachbarschaftshilfe einbezogen werden (vgl. Muller T., S. 4).
Einerseits soll dadurch das autonome Wohnen in der vertrauten Umgebung gesichert werden, selbst wenn Hilfe- und Pflegebedarf bestehen; andererseits sollen Eigeninitiative, Verantwortung und gegenseitige Unterstutzung gestarkt werden (vgl. Evangelisches Johanneswerk, 2012, S. 14). Letztlich versucht dieses Pflegekonzept somit eine 24-stundliche Versorgungssicherheit fur ein selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Wohnsituation zu bewirken, um Heimaufnahmen hierdurch langfristig zu vermeiden (vgl. Muller T., S. 4).
Unter einem Quartier ist in diesem Sinne daher nicht nur eine raumliche Abgrenzung zu verstehen, sondern ebenfalls ein Raum mit einem sozialen Bezugssystem, in dem soziale Aktivitaten stattfinden.
2.3.2 Internationale Entwicklung
Die Veranderungen der Bevolkerung sind nicht nur in Deutschland zu spuren. Insbesondere in den USA wird es aufgrund demografischer Entwicklungen notwendig sein, geeignete stadtische Konzeptionen zu schaffen, um den demografischen Herausforderungen zu begegnen. Diese sind mit der Quartierspflege vergleichbar, da ebenfalls eine langzeitige Selbsthilfe innerhalb eines begrenzten Areals unterstutzt werden soll (vgl. Plouffe & Kalache, 2010, S. 733-734). Das Versorgungsmodell „Neighborhood Naturally Occurring Retirement Community“ (NNORC) ruckt dabei verstarkt in den Fokus der Forschung. Darin werden formelle und informelle Dienste gemeinsam mit einer funktionierenden Nachbarschaft vernetzt, um eine selbststandige sowie hausliche Versorgung nachhaltig zu gewahrleisten (vgl. Bronstein, Gellis & Kenaley, 2011, S. 105). Auch besondere Bauformen, wie das „Village“-Modell, bei dem sogenannte Seniorendorfer mit integrierten Pflegestutzpunkten konzipiert werden, sollen eine Losung darstellen (vgl. McDonough & Davitt, 2011, S. 529-530).
2.3.3 Nationale Entwicklung
Bereits in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde erkannt, dass Senioren besondere Wunsche in Bezug auf ein zufriedenstellendes und sicheres Wohnen besitzen. So kam es, dass die Bielefelder Gemeinnutzige Wohnungsbaugesellschaft (BGW) speziell auf deren Wunsche zugeschnittene Wohnraume anbot, die eine besonders soziale Komponente beinhalteten. Es wurden Anlagen mit seniorengerechten Wohnungen gebaut, die einer Vereinsamung der Bewohner vorbeugen sollten. Um ebenfalls Versorgungssicherheit zu gewahrleisten, wurde eine Kooperation mit dem Verein Alt und Jung eingegangen, mit dem 1996 das erste gemeinsame Wohnprojekt geschaffen wurde. Dies galt als Geburtsstunde des „Bielefelder Modells“, bei dem die Mieter auf Hilfsangebote eines Servicestutzpunktes zugreifen konnten; jedoch nur im Bedarfsfall dafur zahlen mussten. Eine Betreuungspauschale, wie beim Betreuten Wohnen entfiel ganzlich (vgl. Jocham, 2008, S. 449).
Nach der nationalen Etablierung des stationaren Wohnbaukonzeptes der „4. Generation[44] wurde das KDA von der Stiftung Deutsches Hilfswerk um eine Erarbeitung eines Leitfadens zur Neuausrichtung vollstationarer Pflegeeinrichtungen gebeten. Wahrend des Projektverlaufs zeigte sich, dass verschiedene Tragerschaften bereits daran arbeiteten, bestehende Konzeptionen mit innovativen Ideen weiterzuentwickeln. In Anbetracht der festgestellten Fortschritte und aus der Notwendigkeit heraus, die Strukturen der hauslichen Versorgung weiter auszubauen, empfahl das KDA eine neue Form des Wohnens im Alter und rief damit eine weitere Generation des Altenwohnbaus aus. Diese wird erstmals kompakt und systematisch in dem 2012 erschienenen Buch „Die 5. Generation: KDA-Quartiershauser“ von Peter Michell-Auli und Christine Sowinski aufbereitet und zusammenhangend vorgestellt. Die darin beschriebenen und eigens vom KDA entwickelten „KDA-Quartiershauser“ verknupfen neue Ideen zur stationaren Pflege mit der Zielstellung der „Pflege im Quartier“ und gelten national neben dem „Bielefelder Modell“ mitunter als leitgebende Modelle dieser neuen Pflegeform (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 9).
Auch deutsche Politiker sind sich mittlerweile dessen bewusst, weitere Strategien konzipieren zu mussen, um den demografischen Begebenheiten zu begegnen. Daher wurde im Juni 2012 das Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz beschlossen, dessen vollstandige Bestimmungen seit Januar 2013 in Kraft getreten sind. Der Fokus darin liegt insbesondere in der Forderung von Selbsthilfekompetenzen sowie in der Unterstutzung pflegender Angehoriger, um eine hausliche Pflege zu erleichtern (vgl. Bundesministerium fur Gesundheit, 2012, S. 2-3).
In diesem Zusammenhang gewinnt die Quartierspflege zunehmend an Bedeutung.
2.3.4 Empfehlungen des KDA
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) ist eine gemeinnutzige Institution mit beratender Tatigkeit, die seit uber 50 Jahren Losungskonzepte und Modelle fur die Arbeit mit alteren Menschen entwickelt und dabei unterstutzend wirkt, diese in der Praxis umzusetzen. Bisherige Altenwohnformen und Einrichtungstypen - insbesondere die der „4. Generation[44] - wurden stark durch die Empfehlungen und Anforderungen dieser Vereinigung gepragt (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 9).
2.3.4.1 Das KDA-Modell zur Lebensqualitat
Ein alter Mensch besitzt andere Anspruche und Bedurfnisse, als ein junger Mensch. Um diese These wissenschaftlich fundiert darzulegen, wurden in einer Forschungsarbeit von Jackie Brown, Ann Bowling und Terry Flynn eine Grofizahl an Studien zusammengefasst, die diese Thematik untersuchten (vgl. Brown, Bowling & Flynn, 2004). Aus deren Ergebnissen entwickelte das KDA letztlich ein Modell zur Lebensqualitat, welches auf der folgenden Seite in Abbildung 1 dargestellt wird. Das Modell setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Das „Ich“ als Zentrum sowie die Lebensbereiche, die sich darum gruppieren. Einzig das „Ich“ kann festlegen, welchen Stellenwert die einzelnen Lebensbereiche zugeschrieben bekommen, da im Laufe des Lebens verschiedene Schwankungen innerhalb der Prioritatensetzung bestehen. Zudem kann nur das „Ich“ bestimmen, wie zufrieden es ist und welche Moglichkeiten bestehen, die Zufriedenheit zu erhohen (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 21).
Eine enorme Wichtigkeit innerhalb dieses Modells nimmt zusatzlich das Normalitatsprinzip ein. Normalisierung bedeutet dabei Selbstbestimmung, Autonomie und das Gefuhl, eigenstandig zu sein. Durch dieses Prinzip wird das Vertrauen in die eigenen Fahigkeiten gestarkt und die Bereitschaft zur Mitsprache und Entscheidungsfindung gefordert. Es gilt ebenfalls als wichtige Grundlage bei der Dementenbetreuung und soll dazu fuhren, dass sich demenziell Erkrankte an fruhere Kompetenzen erinnern (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 22).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: KDA-Lebensqualitatsmodell (Quelle: Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 21)
2.3.4.2 Die drei Grundprinzipien der 5. Generation
Das KDA entwarf eine Konzeption, wie die Versorgung im Quartier bestmoglich gewahrleistet werden kann und gilt als Empfehlung (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 9). Diese besteht aus drei Prinzipien.
Das „Prinzip der Privatheit“ beschreibt die personliche Unterkunft der Bewohner innerhalb einer stationaren Einrichtung.
Auch bei erheblicher Pflegebedurftigkeit besteht das Recht auf Privatheit, was aus der „Charta der Rechte hilfe- und pflegebedurftiger Menschen“ hervorgeht (vgl. Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend & Bundesministerium fur Gesundheit, 2010, S. 11-12).
Um dies optimal gewahrleisten zu konnen, empfiehlt das KDA eine Weiterentwicklung der Konzeption „Zimmer“ zum Konzept „Appartement“. Bei den bisherigen Generationen des Altenwohnbaus stellten stets Einzel- oder Mehrbettzimmer Ruckzugsmoglichkeiten fur den Pflegebedurftigen oder seine Angehorigen dar. Das Zimmer ist dabei ein Teil eines grofieren Ganzen; es ist lediglich ein kleiner Part, der gemeinsam mit anderen Raumlichkeiten zum eigentlichen Wohnraum wird. Privatheit ist dadurch nur bedingt moglich. Dies soil sich durch ein Appartement anders gestalten, denn es bezeichnet eine Art Wohnung, die eigenstandig fur sich steht (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 29-30).
Das Konzept basiert auf einer ZimmergroBe von etwa 18 m[2] mit eigenem Bad. Zusatzlich wird es durch personliche Turschilder und einer Turklingel, einem personlichen Briefkasten sowie einer FuBmatte vor der Appartementtur erweitert. Die Eingangstur soll mittels eines Appartementschlussels durch jeden Pflegebedurftigen selbst abschlieBbar sein; hierbei werden keine Unterschiede bei dem Grad der Pflegebedurftigkeit gemacht. AuBerdem gilt eine eingebaute Pantry-Kuche als neue Innovation, mit der stets die Moglichkeit besteht, dass Pflegebedurftige selbststandig uber Nahrungsmittel und Speisen verwalten. Weiterhin konnen Angehorige intensiver einbezogen werden, indem diese gemeinsam mit den Zupflegenden kochen und speisen - wie in der Zeit vor dem Einzug. Durch eine personliche Gestaltung des Appartements, insbesondere durch die Mitnahme privaten Eigentums, soll das Gefuhl des Privatbesitzes, der Eigenverantwortlichkeit und der Selbstbestimmung erzielt und somit eine optimale Privatheit erreicht werden (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 3132).
Das Prinzip „Leben in Gemeinschaft“ beschreibt die jeweiligen stationaren Angebote und basiert stark auf den Hausgemeinschaftskonzept der „4. Generation[44]. Es handelt sich hierbei erneut um ein Wohnkonzept in kleineren Gruppen, dass durch familienahnliche Strukturen gekennzeichnet ist. Durch einen gemeinsam gestalteten Alltag wird ein Zusammenleben von Zupflegenden, Mitarbeitern und Angehorigen erreicht. Eine Wohnkuche bildet weiterhin den Mittelpunkt der Wohngruppe und soll ermoglichen, dass die Pflegebedurftigen je nach ihren Fahigkeiten und Vorlieben in hauswirtschaftliche Tatigkeiten einbezogen werden konnen. Koordiniert wird dies durch stets prasente Mitarbeiter, die kommunikative, hauswirtschaftliche und unterstutzende Dienste leisten (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 57-59).
Das Grundprinzip „Leben in Offentlichkeit“ beschreibt das gesamte Quartier. Mit einem sozialraumorientierten Versorgungsansatz soll ermoglicht werden, dass die Bewohner ihr Quartiershaus verlassen und schlieBlich Zugriff auf eine vertraute EinkaufsstraBe, Restaurants, Kirche oder Parks erhalten (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 80). Das Leben der Zupflegenden wird sich somit nicht mehr ausschlieBlich auf das Private und auf die Gemeinschaft innerhalb der Einrichtung beschranken. Das Leben der Zupflegenden war in ihrer Vergangenheit durch Aktivitaten im offentlichen Stadtbereich gepragt. Dies soll in der „5. Generation[44] aufgegriffen werden. Ein funktionierendes Quartier muss demnach ein wertschatzendes gesellschaftliches Umfeld besitzen, damit die Bewohner fureinander Verantwortung ubernehmen konnen. Zudem muss eine tragende soziale Infrastruktur bestehen, die im Sinne der Nachbarschaftsarbeit zu sozialen Netzwerken ausgebaut werden kann und schlieBlich zu gegenseitiger Unterstutzung und Hilfe fuhrt. Bedarfsgerechte Wohnangebote, barrierefreie offentliche Gebaude und die Bereitstellung von Freizeitangeboten sind weitere wesentliche Grundlagen eines seniorengerechten Quartiers. Um einen langen Verbleib Zuhause beziehungsweise innerhalb des Quartiers zu gewahrleisten, mussen zudem ausreichend bedarfsgerechte Dienstleistungen und Angebote vor Ort sein. Dies schlieBt nicht nur pflegerische Dienste, sondern ebenfalls Handwerker und ahnliches ein. Ein zusatzlicher wichtiger Aspekt, der fur ein funktionierendes Quartier unablassig ist, ist eine wohnortnahe Beratungsstelle. Diese muss gegeben sein, um eine Vielzahl unkoordinierter Leistungen systematisch vernetzen zu konnen. Ebenfalls wird uber diese Anlaufstelle der wesentliche Bedarf der jeweiligen Bewohner festgestellt und durch entsprechende Angebote abgedeckt. Es bestehen zudem Moglichkeiten der Unterstutzung im Rahmen personlicher Angelegenheiten, wie zum Beispiel bei Behordengangen (vgl. Michell-Auli & Sowinski, 2012a, S. 82-83).
3. ZIELSTELLUNG
Wahrend der ErschlieBung des theoretischen Hintergrundes dieser Arbeit fiel auf, dass Auskunfte zu dem Themenfeld der Quartierspflege in nicht-gebundelter Form auf unterschiedlichste Literaturen verstreut sind. Die Sichtung qualitativer Informationen bedarf dabei umfassender Recherchen. Aus diesem Kontext heraus, wird das Zwischenziel angestrebt, zu erschlieBen, welches Spektrum an relevanter Literatur zum Forschungsthema auffindbar ist. Daran knupft das eigentliche Ziel dieser Forschungsarbeit an. Aufgrund aktueller Relevanz sowie zukunftiger Bedeutung der „Pflege im Quartier“ soll eine generelle Ubersicht zu diesem Thema angefertigt werden, um damit den aktuellen Forschungsstand zu dieser neuen Konzeption erfassen und deskriptiv prasentieren zu konnen. Dabei besteht ein besonderer Fokus auf der Klarung, inwieweit das Konzept der Pflege das notige Potenzial besitzt, den demografischen Herausforderungen entgegenzusteuern.
Um dies qualitativ umzusetzen, stehen drei verschiedene Teilfragen im Fokus:
Fragestellung 1: Welche Moglichkeiten im Rahmen der Alltagsgestaltung und Partizipation bestehen fur die im Quartier lebenden Personen im Alter ab 65 Jahren?
Fragestellung 2: Welche Starken besitzt das Konzept „Pflege im Quartier“?
Fragestellung 3: Welche Problemfelder sind mit dem Konzept „Pflege im Quartier“ verbunden?
4. Methodik
4.1 Studiendesign
Zum Erreichen der Zielstellung wurde das Studiendesign einer systematischen Ubersichtsarbeit gewahlt. Es wurde strategisch nach geeigneter Literatur gesucht, die anschliebend im Rahmen einer Inhaltsanalyse extrahiert und ausgewertet wurde.
4.2 Literaturrecherche
Aufgrund der jungen Themenprasenz ging der Autor hypothetisch davon aus, selbst bei einer systematischen Recherche nur mabigen Erfolg bei der Sichtung von qualitativer Literatur uber die Quartierspflege zu haben. Bereits die anfangliche uberblickverschaffende Quellensuche fur die Erschliebung des theoretischen Hintergrundes zeigte, dass nur wenig Literatur zu sichten ist, die wissenschaftliches Niveau bietet. Um das angestrebte Zwischenziel zu erreichen und somit feststellen zu konnen, welches generelle Literaturangebot zum Forschungsthema geboten wird, fiel die Entscheidung auf eine sensitive Recherche.
4.2.1 Einschlusskriterien
Wahrend der Suche wurden Quellen eingeschlossen, die inhaltlich das Konzept der „Pflege im Quartier“ in Deutschland beleuchteten. In diesem Zusammenhang sollte auch Literatur aufgegriffen werden, die Aussagen zu speziellen Formen dieser Art der Pflege macht, wie dem „Bielefelder Modell“ und den „KDA-Quartiershausern“. Aufgenommene Literatur musste Erfahrungen oder evaluierte Einschatzungen zu der Konzeption liefern sowie Ruckschlusse auf die drei Teilfragen dieser Arbeit zulassen. Letzteres bedeutete, dass fundierte Aussagen zu Starken und Problemen der Quartierspflege getroffen sowie bestehende Moglichkeiten zur Partizipation und Alltagsgestaltung beleuchtet werden mussten. Entscheidend bei der Wahl relevanter Quellen war, dass aufgefuhrte Treffer Aussagen zu bestehenden Netzwerken und der sich umschliebenden Nachbarschaft gaben, um damit zu verhindern, lediglich Literatur zu reinen Formen des „Betreuten Wohnens“ einzuschlieben.
Der angesprochene Personenkreis sollte Menschen im Alter ab 65 Jahren umfassen, da nur so relevante Ruckschlusse im Hinblick auf den demografischen Wandel und der zukunftigen Pflegesituation gewahrleistet werden.
Ein bedeutsames Einschlusskriterium war zusatzlich die Aktualitat der Quellen, welche maximal funf Jahre alt sein durften. Begrunden lasst sich dies damit, dass ein so junges Thema, wie das dieser Forschungsarbeit, fur eine qualitative Auswertung auch aktuelle Literatur bedarf. Bei der Erarbeitung des theoretischen Vorwissens ist zudem aufgefallen, dass altere Quellen nur bedingt mit Quartierspflege in Verbindung gesetzt werden und somit keinen zeitgemaben Forschungsstand bieten. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass wichtige Informationen alterer Literatur ebenso in aktuellen Quellen Erwahnung finden.
Uberdies wurde nur deutsch- oder englischsprachige Literatur aufgenommen, die aus Deutschland stammt, um nicht durch das Einbeziehen internationaler Quellen bei der Datenauswertung die Ubertragbarkeit der Ergebnisse dieser Forschungsarbeit auf nationale Gegebenheiten zu gefahrden.
4.2.2 Beschreibung des Vorgehens
An erster Stelle vor der eigentlichen systematischen Recherche stand eine Suche nach Lekture far den theoretischen Hintergrund. Zu diesem Zweck wurde eine Google-Suche favorisiert, bei der einzelne Suchbegriffe, wie „demografischer Wandel“, „Pflege im Quartier“ sowie „Quartierspflege“, verwendet wurden. Hierdurch erschloss sich das Buch von Schinkel (2007) sowie von Michell-Auli und Sowinski (2012). Beide Bucher stellten eine effektive Grundlage fur die Erarbeitung des Vorwissens dar. Aber auch eine Suche im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig mit selbigen Suchbegriffen fuhrte zu weiterer Literatur. Zudem liefien sich im Laufe der spateren methodischen Recherche zusatzliche Quellen erschliefien, die den theoretischen Hintergrund stetig bereicherten.
Um einen moglichst systematischen Charakter bei der eigentlichen Literaturrecherche fur den Ergebnisteil dieser Arbeit zu erzielen, entschied sich der Autor dazu, diese mit einer elektronischen Suche methodisch nach dem Vorbild des 6-S-Modells nach Haynes zu starten, welches in Abbildung 2 dargestellt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: 6-S-Modell (Quelle: DiCenso, Bayley & Haynes, 2009)
Laut dieses Modells ist es ratsam, die Literatursuche in der hochsten Stufe der Pyramide „Systems“ zu beginnen. Diese Stufe wird dabei von computergestutzten Informationssystemen gebildet, die wissenschaftliche Ergebnisse uber einen Sachverhalt pragnant darstellen und neue Erkenntnisse zeitnah aufnehmen (vgl. DiCenso, Bayley & Haynes, 2009).
Aufgrund des jungen Themas und der Annahme der damit verbundenen wenigen Publikationen wurde von der Suche in dieser Klassifikation allerdings abgesehen. Ebenfalls mit derselben Begrundung ausgeschlossen wurden die beiden Stufen „Synopses of Syntheses“ und „Synopses of Studies“.
Die Literaturrecherche begann somit auf der zweithochsten Stufe „Summaries“, unter denen Richtlinien zu verstehen sind, die auf Basis fundierter Forschungsergebnisse entwickelt werden. Hieran schloss sich eine Suche nach „Syntheses“, systematischen Ubersichtsarbeiten, sowie nach „Studies“, publizierten Einzelstudien, an.
Aufgrund eines quantitativ mabigen Literaturfundes wahrend der Recherche nach dem 6-S-Modell nach Haynes fiel der Entschluss, eine weitere umfangreiche Suche nach geeigneten Quellen durchzufuhren. Dies sollte mittels einer ausgewahlten Internet- Suchmaschine erfolgen. Durch eine systematische Variation der Suchbegriffe wurde eine erhebliche Anzahl relevanter Quellen erschlossen, die zudem auf zusatzliche Literatur verwiesen.
Es folgte somit eine ausgedehnte Kontrolle der Textverweise und Literaturverzeichnisse bisher gesichteter Quellen, wodurch sich die Zahl aufgenommener Literatur vergroberte.
Die durchgefuhrte Handsuche wurde durch eine weitere Recherche auf Homepages ausgewahlter Quellen erweitert, die im Rahmen der Erschliebung des theoretischen Rahmens wiederholt erwahnt wurden.
Abschliebend erfolgte der dialogische Austausch via elektronischer Mitteilung mit einer Koordinatorin eines wahrend der Recherche gesichteten Projektes zum Thema „Pflege im Quartier“.
4.2.3 Informationsquellen und Suchstrategien
In diesem Abschnitt werden die jeweiligen Quellen benannt, die als Recherchegrundlage dienten sowie die unterschiedlichen Strategien, die verfolgt wurden, um relevante Literatur zu erschlieben.
4.2.3.1 Recherche nach „Summaries“
Fur eine gezielte Suche nach existierenden Expertenstandards wurde in der Datenbank des Deutschen Netzwerkes fur Qualitatsentwicklung in der Pflege (DNQP) gesucht [Stand: 14.12.2012]. Die DNQP beschrankt sich bei der Entwicklung von Expertenstandards ausschlieblich auf pflegerische Fragestellungen und bildete somit die erste Wahl bei der Suche nach „Summaries“ fur das Forschungsthema. Die Ermittlung geeigneter Literatur wurde per Handsuche durchgefuhrt.
Eine anschliebende Suche nach Leitlinien erfolgte in der Datenbank der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaft e.V. (AWMF) [Stand: 14.12.2012]. Die Suche in der Datenbank erfolgte nach Fachgebieten, welchen die zu interessierenden Leitlinien zugeordnet sein könnten.
[...]
- Arbeit zitieren
- Nils Neu (Autor:in), 2013, Pflege im Quartier: Das Wohnkonzept der Fünften Generation, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230273
Kostenlos Autor werden

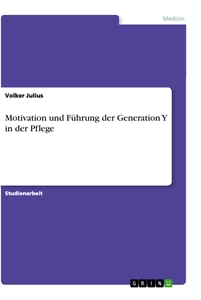














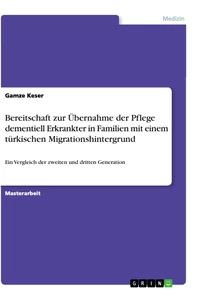



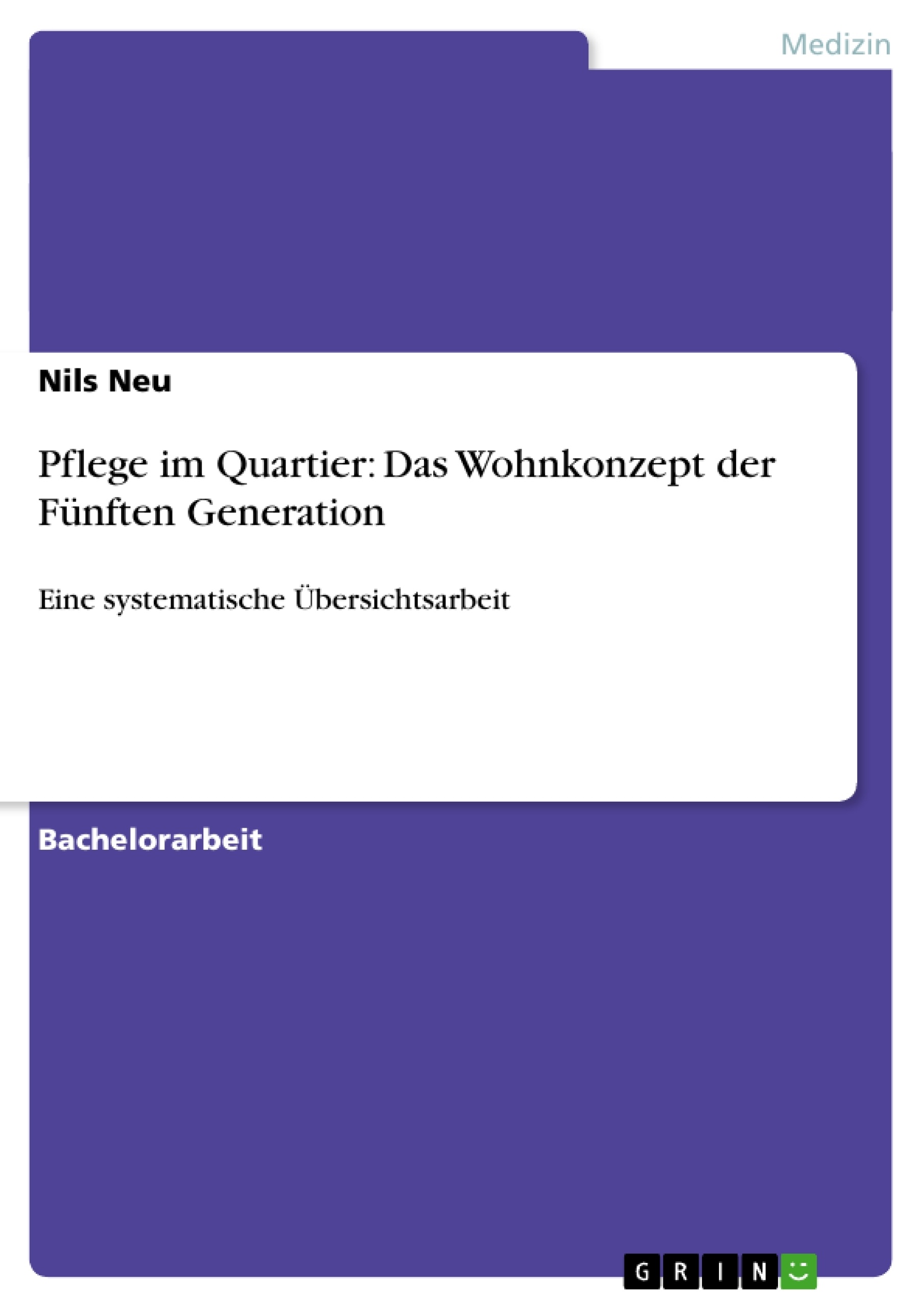

Kommentare