Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Hauptteil
Schumanns Werk und Werdegang
Schumann als Kritiker
Literatur und Musik
Zusammenfassung
Literatur
Einleitung
Nachdem Liszt sich in Weimar niedergelassen und seine Virtuosenlaufbahn aufgegeben hatte, konnte er sich einem neuen Ziel zuwenden: der poetischen Musik.
Dazu zählte auch die Aufführung signifikanter Werke Schumanns; 1849 „Scenen aus Göthe’s Faust“, 1851 „Die Braut von Messina“, 1852 „Manfred“ und schließlich 1854 die 4. Sinfonie d-Moll, das Klavierkonzert a-Moll und das Konzertstück für 4 Hörner F-Dur. Auf eine Bitte Franz Brendels, dem damaligen Herausgeber der „ Neuen Zeitschrift für Musik“, rezensierte er die soeben erschienen „Gesammelten Schriften über Musik und Musiker“ im Jahr 1855.
Neben der Würdigung Schumanns als Komponist und Wegbereiter einer Symbiose aus Literatur und Musik verlangte dessen Kritikertätigkeit Liszts besondere Aufmerksamkeit. Durch Schumanns literarische Bildung war es ihm möglich, die Musikkritik zu einer Kunstform sui generis zu machen. Die Bedeutung Schumanns Kritikertätigkeit spiegelt sich dementsprechend auch in Liszts Aufsatz wieder und bildet neben der Programmmusik den Kernpunkt seiner Würdigung.
Diese Arbeit folgt dem Textaufbau und will neben den anderen zwei Aspekten vor allem Liszts Würdigung der Musikkritik Schumanns behandeln.
Hauptteil
Schumanns Werk
„Töne sind höhere Worte“[1] schrieb Schumann in sein Tagebuch. An anderer Stelle im Jahr 1828: „Jeder Tonkünstler ist Dichter, nur ein höherer.“[2] Einem Komponisten sind also Schumanns Ansicht nach, beide Talente zu eigen, oder vielmehr: ein Komponist ist in beiden Künsten mehr oder weniger befähigt. In keinem anderen traten beide in größerer Vollkommenheit in Erscheinung als bei ihm: Der romantische Komponist, auf den Spuren Beethovens (Liszt schreibt auf Seite 171: „[...]da dieser Meister ein Künstler ist, der in gerader Linie [...] aus Beethoven hervorgegangen ist“) und Schuberts, der „[...]die alten Schläuche noch geeignet hielt für seinen jungen Wein“[3], und der Literat, der völlig neue Wege beschritt und die Kritik damit aus der konservativen Verspannung ihrer Zeit löste.
Als Liszt 1855 seinen Aufsatz verfasste, hatte er seine konzertierende Virtuosenkarriere hinter sich gelassen und widmete sich dem Komponieren in Weimar. Schumann, ein Jahr älter, dämmerte, dem Wahnsinn nahe, dahin mit wenigen hellen Lichtblicken und sollte ein Jahr später sterben.
Dennoch möchte Liszt darauf verzichten, „die ganze Wichtigkeit einer Künstlerlaufbahn“[4] darzulegen:
„Wir glauben jedoch, dass der Moment noch nicht gekommen ist, in welchem wir den ganzen Umfang seiner Erscheinung übersehen und sagen dürften: “Seht, das hat er gewollt, erstrebt, versucht – das hat er erreicht, geleistet. Hier hat er den Weg zu seinem Ziel nicht ganz zurückgelegt, hier hat er das Ziel umgangen.“ Erst wenn die neuesten Werke des Meisters veröffentlicht sind, werden sich die wesentlichen Punkte seines Schaffens feststellen lassen“[5]
Schon hier wird man auf Liszts teleologisches Geschichtsbild aufmerksam. Er sieht das Schaffen als einen Weg zur Perfektion hin an, nicht jede Periode als ein in sich gelungener, abgeschlossener und legitimer Teil des Ganzen. Dieses „große Ziel“[6], das er Schumann unterstellte, ließe sich womöglich nur mit einigem Abstand erkennen.[7] So gab es seiner Ansicht nach zwei verschiedene Arten von Werken:
Zum einen solche, denen allen derselbe Geist bzw. dieselbe Größe innewohnt, wie zum Beispiel das Oeuvre Goethes oder Hugos:
„Den Eindruck [...], den ein Drama Goethes oder Hugos hervorruft, kann durchaus der richtige sein, ohne dass wir mit den übrigen Schöpfungen dieser Dichter vertraut sein müßten“[8]
Dazu gehören auch Beethoven und Mozart. Auf der anderen Seite stehen Dichter wie Rousseau und Byron, deren Schaffen ein Gedanke innewohnt, der nicht nur in einem Fragment erfasst werden kann, sondern dem Überblick über das gesamte Schaffen bedarf. Besonders zu erwähnen in dieser Gruppe ist Jean Paul. Er schuf sich eine „eigentümliche Sprache“[9], gleich einer hundertköpfigen Hydra, und ohne den vollständigen Überblick über sein Werk, kann man auch das einzelne nicht genießen. Jean Paul war für Schumann von enormer Bedeutung. Florestan und Eusebius lassen sich auf ihn zurückführen, und über Beethoven schrieb er: „Wenn ich Beethovensche Musik höre, so ists, als läse mir jemand Jean Paul vor“[10]. Dem sollte man allerdings nicht zuviel Gewicht beimessen, da er völlig vereinnahmt war von beiden, und so eine gewisse Gleichstellung nicht überraschen sollte. Selbst Schumanns Musik wurde von dem Komponisten Stephen Heller mit Jean Paul verglichen.[11] Man muss dennoch beachten, dass Jean Paul enorm populär zu dieser Zeit war, weit über Deutschland hinaus, und in Schumann einen seiner glühensten Verehrer fand. Er schrieb am 25. April dazu in sein Tagebuch: „Ich stand bey deinem Grabe und weinte; du schaust an meinen Thränen[sic!] und lächelst, Jean Paul“[12]. Während über die Jahre hinweg seine Verehrung für ihn blieb, wuchs die für Shakespeare in den 50ern des 19. Jahrhunderts, was damit zusammenhängt, dass Shakespeares Werk in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder entdeckt wurde, nachdem ihm ein barbarischer und geschmackloser Ruf anhing.[13] Zu dieser Zeit plante er eine Anthologie („Der Dichtergarten“) der bekanntesten Autoren, die Stellen, welche von Musik handeln, zusammenfassen sollte. Rauchfleisch sieht darin den Versuch, durch die Strukturierung der Außenwelt Stabilität im Inneren zu erreichen.[14]
Vom Typus her, glich Schumanns Werk dem von Jean Paul. Liszt schrieb dazu:
„Infolgedessen läßt sich nur durch den Vergleich seiner verschiedenen Kompositionen erkennen, was er durch die gewählte Ausdrucksweise und Form hat ausdrücken wollen, wodurch man schließlich der Idee des Einzelwerkes habhaft werden und die Ausdehnung seines Gefühlsinhalts ermessen kann.“[15]
Dennoch erkennt Liszt schon ungefähr ein Ziel Schumanns darin, „[...]die klassischen Formen mit Romantik zu durchdringen oder, wenn man will: den romantischen Geist in klassische Kreise zu bannen.“[16] Das Paradoxon, das Schumann sich selber damit schuf charakterisiert Liszt auf Seite 173:
„Wie könnte man Schumann gegenüber verkennen, dass er [...]dahin strebte [...] seinen im Innere oft dumpfe, trübe Tonalitäten annehmenden Hang zum Bizarren und Phantastischen mit der klassischen Form in Einklang zu bringen, während sich gerade diese Form mit ihrer Klarheit und Regelmäßigkeit seinen eigentümlichen Stimmungen entzog!“[17]
Schumann war ein Gefangener der Sonatenform. Liszt schreibt dazu:
„Die Form ist in der Kunst das Gefäß eines immateriellen Inhalts – Hülle der Idee, Körper der Seele“[18]
Ohne Idee findet jedoch kein Fortschritt statt. Diese Idee, neben den von Liszt oben angesprochenen dumpfen und trüben Neuerungen, war bei Schumann die Verbindung von Instrumentalmusik und Literatur. Die Form war lediglich etwas, das man sich durch handwerkliches Geschick aneignen konnte, er bezeichnet sie sogar als starr.[19]
„Musik und Literatur waren hunderte von Jahren hindurch wie durch eine Mauer getrennt und die auf beiden Seiten Wohnenden schienen sich nur dem Namen nach zu kennen“[20]
Liszt bezeichnet Schumann als „Eingeborenen beider Länder“[21]. Damit schließt er den ersten Abschnitt mit einer Erkenntnis, die wohl die Faszination durch Schumann für ihn zu einem großen Teil ausmachte.
[...]
[1] Schumann, Robert: Tagebücher, hrsg. v. Georg Eismann, Basel u.a., 1971, Band 1 S. 96.
[2] ebenda S. 42.
[3] Liszt, Franz: Ausgewählte Schriften, in: Gesammelte Schriften von Franz Liszt, hrsg. v. Julius Kapp, Leipzig, 1910, Band 4, S. 174.
[4] ebenda, S. 166.
[5] ebenda, S. 166-167 .
[6] ebenda, S. 167.
[7] ebenda.
[8] ebenda, S. 168.
[9] ebenda, S. 170.
[10] Schumann, Robert: Tagebücher, hrsg. v. Georg Eismann, Basel u.a., 1971, Band 1, S. 97.
[11] Er schreibt am 18.9.1839 an Schumann: „[...] Ihre Compositionen sind Jean Paulsche Frucht-Blumen- u Dornenstücke, u Siebenkäs, Schoppe – Leiberger (Euseb[ius] – Florestan), Lenette Pelzstiefel usw finden sich Note für Note darin.“ In: Heller, Stephen: Briefe an Robert Schumann, hrsg. v. Ursula Kersten, Frankfurt u.a., 1988, S. 142.
[12] Schumann, Robert: Tagebücher, hrsg. v. Georg Eismann, Basel u.a., 1971, Band 1, S. 40.
[13] Jensen, Eric: Schumann, Oxford, 2001, S. 55.
[14] Rauchfleisch, Udo: Robert Schumann, Stuttgart u.a., 1990, S. 18
[15] Liszt, Franz: Ausgewählte Schriften, in: Gesammelte Schriften von Franz Liszt, hrsg. v. Julius Kapp, Leipzig, 1910, Band 4, S. 170-171.
[16] ebenda, S. 172.
[17] ebenda, S. 173.
[18] Ebenda, S. 200
[19] ebenda, S. 201. Hanslick dagegen spricht in seinem 1854 erschienen Buch „Vom musikalisch Schönen“ von tönend bewegter Form.
[20] ebenda, S. 175.
[21] ebenda, S. 176.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Weidele (Autor:in), 2003, Franz Liszts Aufsatz zu Robert Schumann, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/22992
Kostenlos Autor werden




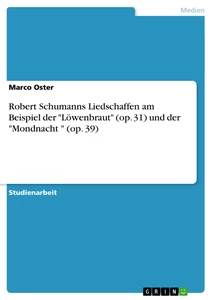






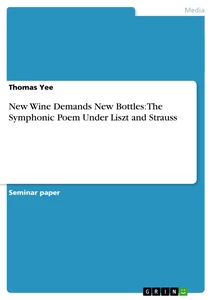



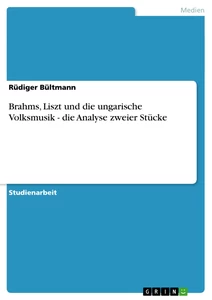




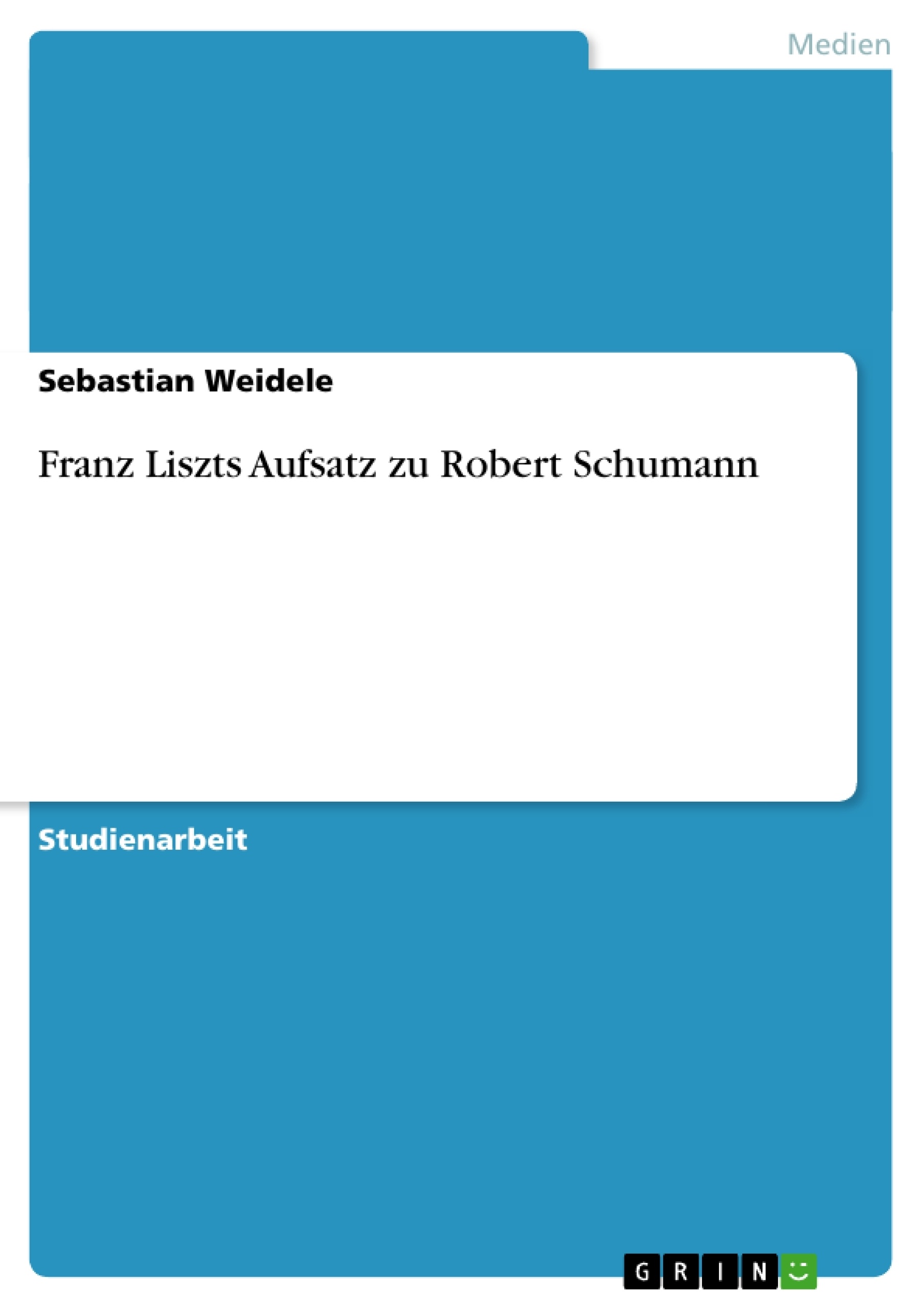

Kommentare