Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Zusammenfassung
1. Theoretischer Hintergrund und Stand der empirischen Forschung
1.1 Populärwissenschaftlicher Anstoß
1.2 Intelligenz und Emotion
1.2.1 Implikation des Intelligenzbegriffs
1.2.2 Erweiterung des Intelligenzbegriffs
1.2.3 Das Modell Gardners und seine Kriterien getrennter Intelligenzen
1.3 Gesetzmäßigkeit von Gefühlen
1.3.1 Von der Gesetzmäßigkeit zu einem einflußnehmenden Mechanismus
1.4 Konzeptualisierung Emotionaler Intelligenz
1.5 Relevante Konzepte für die vorliegende Arbeit
1.5.1 Basisemotionen
1.5.1.1 Widersprüchliche Forschungsergebnisse
1.5.1.2 Universelle Gesichtsausdrücke
1.5.1.3 Prototypische Anschauung
1.5.1.4 Nähe zwischen prototypischen Ansatz und universellen Gesichtsausdrücken
1.5.1.5 Kritische Bemerkungen und Interindividuelle Unterschiede
1.5.2 Gesichtsausdrücke als non-verbale Zwischenrufe
1.5.3 Reduktion der Aussagekraft auf zwei grundlegende Dimensionen
1.5.4 Kreismodell der Emotionen
1.5.5 Vaskuläre Theorie der Gefühle
1.5.6 Kontext versus Gesichtsausdruck
1.6 Implikationen der Forschungsergebnisse für die vorliegende Arbeit
1.6.1 Kombination kontextueller Information mit Gesichtsausdrücken
1.6.2 Gestellte versus natürliche Gesichtsausdrücke
1.6.3 Relevanz unterschiedlicher Sinneskanäle
1.6.4 Konkretisierung der vorliegenden Arbeit
1.6.4.1 Das Problem eines objektiven Kriteriums
1.6.4.2 Die Auswahl darzustellender Emotionen
1.7 Fragestellungen und Hypothesen
2. Methodenteil
2.1 Stichprobe
2.2 Testmaterial
2.2.1 Der Judgement on Emotions Task (JET)
2.2.1.1 Herstellung
2.2.1.2 Bemerkung zu Auswahlkriterien
2.2.1.3 Fertiges Testmaterial und Antwortformat
2.2.1.4 Auswertung
2.2.2 Fremdbeurteilungsskalen
2.3 Untersuchungsdurchführung
3. Statistische Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
3.1 Schwierigkeitsparameter und Trennschärfe
3.2 Normalverteilung
3.3 Testgütekriterien – Reliabilität und Validität
4. Diskussion der Ergebnisse
5. Literaturverzeichnis
6. Anhang
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:Schwierigkeitsindex und Trennschärfe der Testitems
Tabelle 2: Veränderung der Reliabilität bei schrittweiser Itemelimination
Tabelle 3: Validitätskoeffizienten - Korrelation zwischen Fremdbeurteilung und Gesamttestscores
Tabelle 4: Reliabilität der Validitätskriterien
Tabelle 5: T-Test für unabhängige Stichproben mit Geschlecht als Gruppierungsvariable
Tabelle 6: Ergebnisse des Altersvergleichs bezüglich beider Auswertungskriterien
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Schematisierte Darstellung der Wirkungsweise von emotionalen Intelligenzleistungen
Abbildung 2: Verdeutlichung der zwei verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten zur fehlenden Reaktion von einzelnen Testpersonen
Abbildung 3: Empirisches Kreismodell der Emotionen nach Russel
Abbildung 4: Verteilung der Gesamtscores (Targetkriterium)
Abbildung 5: Verteilung der Gesamtscores (Konsenskrit.)
Abbildung 6: Screeplot für Konsenskrit
Abbildung 7: Screeplot für Targetkrit
Zusammenfassung
In der vorliegenden Diplomarbeit wird versucht, die ersten Entwicklungsschritte zur Herstellung eines objektiven Leistungstests zur Erfassung der Sensitivität für Emotionen bei Anderen, zu setzen. Den konzeptuellen Hintergrund der Testerstellung bildet das erst jüngst in die akademische Psychologie eingeführte Konzept der emotionalen Intelligenz. Aufbauend auf diesen Intelligenzbegriff wird auch die Erkennung von Gefühlen bei anderen Personen als eine psychometrisch meßbare Fähigkeit verstanden, zu deren Erfassung es eines objektiven Leistungstests fehlt. Die Operationalisierung der zu untersuchenden Fähigkeit erfolgt mit Hilfe von Basisemotionen. Diese decken einen weiten Bereich des emotionalen Spektrums ab. Basisemotionen ermöglichen die Konstruktion von Items, die weniger komplex als zusammengesetzte Emotionen sind, und erlauben es daher einfacher den durchgeführten Konstruktionsansatz zu überprüfen. Den getesteten 174 Schülern (Durchschnittsalter 17, SD=0.7) aus allgemein bildenden höheren Schulen wurden Videoaufnahmen vorgespielt, in denen Laiendarsteller insgesamt 36 verschiedene, selbst erlebte, Geschichten zu den neun Basisemotionen “Freude”, “Zuneigung”, “Angst”, “Abneigung”, “Ärger”, “Traurigkeit”, “Schuld”, “Unruhe” und “Verlegenheit” erzählten. Eine objektive Auswertung war durch das Vorgeben eines geschlossenen Antwortformats (“Multiple-choice”) gewährleistet. Die Ergebnisse zeigten die geforderte Normalverteilung der Daten, obwohl sehr viele Items nur geringe Schwierigkeitsindizes aufwiesen, was aber auf das Benützen von Basisemotionen in dieser Testvorform zurückgeführt wird. Die innere Konsistenz des an sich homogenen Testverfahrens wurde mit etwa .70 bestimmt, während die Validität aufgrund eines zu mangelhaften direkten Validitätskriteriums nur über das Geschlecht bewertet werden konnte. Tatsächlich fanden sich bezüglich des Geschlechts, wie vorhergesagt, sehr signifikante Dekodierungsvorteile für die weiblichen Schüler. Eine nächste Entwicklungsstufe dieses Tests müßte eine Ausweitung der Stichprobe auf nicht AHS Schüler und die Einführung komplexerer Items in die Testskala bringen.
1. Theoretischer Hintergrund und Stand der Empirischen Forschung
1.1 Populärwissenschaftlicher Anstoß
Mit der Erscheinung des Buches „Emotionale Intelligenz“ (Goleman, 1996) gewann ein neues Intelligenzkonstrukt ungeahnte Popularität. Versprachen uns noch bis zur Mitte unseres Jahrhunderts die Forscher im Bereich der akademischen Intelligenz eine Erklärung späterer Erfolge aus Tests, so fällt dies nun dem Konzept der emotionalen Intelligenz zu. Eine Unzahl menschlicher Eigenschaften und Charakteristika scheint nun durch ein besseres Kennenlernen unserer emotionalen Intelligenz beeinflußbar. Gefühlsmanagement, Selbstmotivation, Mitgefühl, soziale Kompetenz und ähnliche Konzepte werden in die Nähe dieses neuen Konstrukts gerückt (Huber, 1996). Obwohl dies verführerisch klingt, bleiben einige Ideen, die dem Konstrukt der emotionalen Intelligenz zu Grunde liegen, unbeachtet.
1.2 Intelligenz und Emotion
1.2.1 Implikation des Intelligenzbegriffs
Der Begriff Intelligenz weist zunächst auf den Charakter einer Fähigkeit hin. Wie Jensen (1996) argumentiert, sind Zuwächse im Intelligenzbereich nur in sehr geringen Ausmaßen möglich. Obwohl noch in den 60er Jahren amerikanische Forscher überzeugt waren, über Trainingsprogramme einen Intelligenzzuwachs erzielen zu können, erfüllten sich diese hochgesteckten Erwartungen nicht. Eine Folge solcher Erwartungen waren „head start“ Programme, die Kindern, die aus sozial benachteiligten Schichten stammten und einen Rückstand im Intelligenzbereich aufwiesen, eine entsprechende Frühförderung zukommen ließen. Intelligenz wurde als plastisch und veränderbar betrachtet, deren Training Menschen zu höheren Leistungen verhelfen könnte. Nicht zufällig fiel diese Denkweise in eine Zeit, die in Amerika von Ideen der Gleichberechtigung und Demokratisierung von Bildung und Lebensmöglichkeiten geprägt war. Trotz der breiten Unterstützung für solche Projekte, waren die Ergebnisse in bezug auf den Intelligenzgewinn enttäuschend. Diese Enttäuschung war deshalb um so größer, weil selbst Kinder, die man vom Kleinkindalter bis zum Schulalter in solche Programme miteinbezog, nur bescheidene Zuwächse im Intelligenzbereich aufweisen konnten (Jensen, 1996). Diese Zuwächse wurden überdies von Kritikern auch noch als Übungseffekte gewertet, die sich aus der Verwendung von Items aus Intelligenztests im Unterricht ergaben.
Emotionale Intelligenz sollte daher als nur beschränkt veränderbar angesehen werden. Primäres Ziel sollte deshalb die Entwicklung einer möglichst exakten Meßmethode sein. Erst wenn das Vorhandensein entsprechender empirischer Daten es indiziert, sollte man sich mit einer gegebenenfalls vorhandenen Möglichkeit zum Training emotionaler Intelligenz beschäftigen. Diese Reihenfolge ergibt sich notwendigerweise auch aus dem Bedürfnis, spätere Trainingsprogramme auf ihren Erfolg hin evaluieren zu können.
1.2.2 Erweiterung des Intelligenzbegriffs
Emotionale Intelligenz an herkömmliche („akademische“) Intelligenz anzulehnen wirft die Frage auf, warum eine solche Erweiterung des herkömmlichen Intelligenzbegriffs überhaupt notwendig wurde. An dieser Stelle soll eine ausführliche Beschreibung verschiedener Intelligenzmodelle vermieden werden (für einen leicht verständlichen Überblick siehe etwa Shaver & Tarpy, 1993). Eine Kritik an herkömmlichen Intelligenzmodellen und den daraus entstandenen Testinstrumenten ist ihre rein akademische Bedeutung. Die Tests würden, so Neisser (1983, zitiert in Benjafield, 1997), vor allem die Fähigkeit, Tests in Prüfungssituationen abzulegen, messen und gäben wenig Aufschluß über Fähigkeiten, die in natürlichen Situationen benötigt werden.
1.2.3 Das Modell Gardners und seine Kriterien getrennter Intelligenzen
Eine Folge aus solcher Kritik war das Werk Gardners (1983/1993a), der Intelligenz nicht als „one thing, but many things“ (zitiert in Benjafield, 1997, S.323) begreift. Sein multipler Intelligenzansatz geht von einer gesonderten Entwicklung einzelner Fähigkeiten aus, die für die Bewältigung von Aufgaben zusammenspielen, prinzipiell aber unabhängig voneinander sind. Diese Unabhängigkeit ergibt sich aus der Repräsentation einzelner Funktionen durch voneinander getrennte Hirngebiete. Die Erkenntnisse für Gardners Modell stammen aus der Arbeit mit Patienten, die selektive Hirnschädigungen erlitten haben. Gardner behauptet, drei wesentliche Kriterien gefunden zu haben, durch die sich einzelne Intelligenzen abgrenzen lassen.
Diese drei Kriterien sind (1) ein Symbolsystem, (2) Prodigies (Wunderkinder) und (3) das Vorhandensein einer einzigartigen Entwicklungsgeschichte. Ein Symbolsystem dient der Repräsentation unseres Wissens über die Welt. Eine Intelligenz muß sich daher eines Symbolsystems bedienen (oder zumindest bedienen können?), um als eine getrennte Intelligenz bewertet zu werden. Das uns geläufigste Symbolsystem ist die menschliche Sprache. Andere Symbolsysteme wären bildnerische oder musikalische Darstellungen. Anstatt den Weg zu einem bestimmten Zielort in Worten zu beschreiben, könnte man auch eine Karte zeichnen. Musik könnte ebenfalls als Symbolsystem genutzt werden, wenn beispielsweise ein bestimmtes Musikstück gewählt wird, weil es einen momentanen emotionalen Zustand widerspiegelt. Die ausgewählte Musik wäre ein Symbol, daß im Rahmen emotionaler Fähigkeiten (expressiver Teil) benutzt wird. Eine emotional intelligente Leistung bei diesem Vorgang wäre etwa das Erkennen des eigenen Gefühlszustandes.
Prodigies (Wunderkinder) sind überdurchschnittlich begabte Personen, die wegen ihrer herausragenden Begabung in einem Teilgebiet besonders interessant sind. Die gleichzeitige Normalentwicklung anderer Fähigkeiten, verleiht dem Konzept autonomer Intelligenzen wesentliche Glaubwürdigkeit.
Das Kriterium einer eigenen Entwicklungsgeschichte bedeutet für Gardner (1998), daß alle Individuen in einem beliebigen Teilbereich vom gleichen Wissensniveau starten; von diesem Punkt weg, sollten sich Individuen mit höherer spezifischer Intelligenz weiteres Wissen in einer Weise beschaffen, die sich von der ihrer Mitmenschen unterscheiden läßt. Für das Studium emotionaler Intelligenz würde dies bedeuten, daß einzelne Individuen zur Förderung ihrer emotionalen Leistungen unterschiedliche Lernwege nähmen (etwa die Konfrontation mit Neuheiten…etc…).
Einen weiteren Einwand gegen die alleinige Betrachtung akademischer Intelligenz liefert auch die Erkenntnis, daß Personen mit sehr guten Leistungen in Intelligenztests, manchmal nur bescheidene Leistungen an ihrem Arbeitsplatz erbringen (Wagner & Sternberg, 1985). Während akademische Intelligenztests einen doch beträchtlichen Varianzanteil der Schulleistungen aufzuklären vermögen – die Aufklärungsrate liegt zwischen .16 und .49 für verschiedene Maße der Schulleistung – sinkt diese Vorhersagekraft laut Wagner und Sternberg bei der Vorhersage für die Leistung am Arbeitsplatz stark ab. Wagner und Sternberg schreiben von einer aufgeklärten Varianz von nur etwa 4%. Eine zuverlässige Vorhersage ohne die Einbeziehung anderer Prädiktoren, wie etwa Achievement Motivation (Atkinson, 1958, zitiert nach Wagner & Sternberg, 1985) ist zumindest nach diesen Darstellungen nicht möglich. Ein anderer Weg führt zur Entwicklung umfassenderer Intelligenzmodelle, die Bereiche erfassen sollen, die bisher noch nicht als Prädiktoren herangezogen wurden. Wagner und Sternberg beschreiten genau diesen Weg, obwohl sie nicht emotionale Intelligenz studieren, sondern versuchen, praktische Intelligenz zu erfassen, die ebenfalls einen wesentlichen Teil zur Erklärung alltäglicher Leistungen beitragen könnte.
Emotionale Intelligenz ist als ein weiterer Mosaikstein zu betrachten, der nicht getrennt von anderen Fähigkeitsmaßen zum Erfolg führen kann, so wie auch nur eine Kombination von sozialen, emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten zu mehr Erfolg im Leben führen kann (Goleman, 1996).
1.3 Gesetzmäßigkeit von Gefühlen
Über emotionale Intelligenz zu sprechen, ist für viele Menschen ein Widerspruch in sich selbst. Die Angst vor einer Rationalität in unseren Gefühlen liegt wohl auch darin, daß damit gleichzeitig eine Aufgabe individueller Freiheit gesehen wird (Frijda, 1988). In einer Welt, die immer mehr von Regeln und Normen in allen Bereichen kontrolliert wird, bleibt der Individualität oft nur ein kleiner Bereich. Rationalität in unserer Gefühlswelt zu finden, würde diese Freiheit bedrohen. Emotionale Intelligenz ist aber oft mit der Frage nach einem konstruktiven Umgang mit Gefühlen verbunden. Für Goleman (1996) fallen unter emotionale Intelligenzleistungen beispielsweise Fähigkeiten sich selbst zu motivieren, wenn man Enttäuschungen mitmachen mußte. Des weiteren werden auch die Fähigkeiten, Impulse zu unterdrücken und Gratifikationen hinauszuschieben als Kennzeichen emotionaler Intelligenz gewertet. Ein solcher konstruktiver Umgang mit Gefühlen könnte sehr rasch Normwirkung entfalten.
Frijda (1988) geht noch weiter als Goleman. Während Goleman (1996) eine Sicht vertritt, bei der emotionale Intelligenz als eine Fähigkeit im Umgang (Expression, Erkennung, Verwertung) mit an sich irrationalen Gefühlen verstanden wird, sind für Frijda Emotionen selbst nicht irrational und noch viel weniger unvorhersagbar. Frijda entwickelte in seiner Arbeit ein System von Gesetzen, das die Entstehung und den Ausdruck, sowie die Beibehaltung und die Regulation von Gefühlen lenkt.
1.3.1 Von der Gesetzmäßigkeit zu einem einflußnehmenden Mechanismus
Durch die zumindest vermutete Existenz von Gesetzen über Emotionen gewinnt das Konzept emotionaler Intelligenz weiter an Bedeutung. Wenn sich nämlich schon die einzelnen Prozesse des Gefühlslebens in engeren, als bisher vermuteten, Bahnen bewegen, dann ist es auch vorstellbar, daß es Mechanismen gibt, die in der Lage sind, solche Bahnen zu beeinflussen. Anzunehmen, daß es in der Ausprägung dieser Mechanismen interindividuelle Unterschiede gibt, erscheint damit nur noch als der nächste logische Schritt in diesem Mosaik. Bevor noch näher auf emotionale Intelligenzleistungen eingegangen werden soll, ist aber noch ein Schritt im gerade erwähnten Erklärungsmuster zu betrachten.
Wir haben im letzten Absatz angenommen, daß es Mechanismen gibt, die in der Lage sind, den Ablauf von Emotionen zu beeinflussen. Diese Beeinflussung wird von einem individuellen appraisal (=Bewertung) der jeweiligen Situation abhängig gesehen. Dazu sind zwei Bemerkungen angebracht. (1) Diese Bewertung kann, wie alle anderen Entscheidungen auch, fehlerhaft sein oder zumindest von allen Außenstehenden als eine Fehlleistung aufgefaßt werden. (2) Bei dieser Entscheidung handelt es sich um eine kognitive Leistung, allerdings muß es sich um keine bewußte Bewertung handeln. Zur besseren Illustration mag ein Beispiel beitragen, daß Golemans Buch (1996) entnommen ist:
Die letzten Augenblicke im Leben von Gary und Mary Jane Chauncey, einem Ehepaar, das mit ganzer Hingabe an ihrer elfjährigen Tochter Andrea hing, die durch eine Gehirnlähmung an den Rollstuhl gefesselt war. Die Chaunceys saßen in einem Zug, der von einer Brücke stürzte, deren Pfeiler im Mississippidelta von einem Lastkahn gerammt worden waren. Die Eheleute dachten zuerst an ihre Tochter und als das Wasser durch die Fenster in den Wagen strömte, taten sie alles, um ihre Tochter zu retten; irgendwie schafften sie es, Andrea durch ein Fenster zu schieben, wo sie von Rettungsmannschaften in Empfang genommen wurde. Dann ging der Wagen unter, und sie ertranken. (S. 19)
Haben in diesem Fall, die Eltern wirklich entschieden, sich selbst zu opfern, um ihrer Tochter ein Weiterleben zu ermöglichen? Oder hat die Entscheidung gar nicht wirklich stattgefunden, sondern war sie schon determiniert durch die evolutionäre Notwendigkeit, seine Gene an die nächste Generation weiterzugeben, und daher für ein Überleben seiner Nachkommen zu sorgen? Hätte jemand, der seine Gefühle unter Kontrolle gehabt hätte, eine bessere Lösung erreichen können? Spekulationen über den Ausgang dieses Falles sind müßig, das Grundargument sollte aber einsichtig werden; das kognitive appraisal, das einen Teil der emotionalen Reaktion darstellt, kann von Faktoren mitbestimmt werden, die nicht wünschenswert für das eigene Fortkommen sind. Emotionale Intelligenz eröffnet eine Kontrolle dieser Gefühle, wodurch auch destruktive appraisals beherrscht werden können. Eine stark vereinfachte Schematisierung dieser Vorstellung findet man in Abbildung 1.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1. Schematisierte Darstellung der Wirkungsweise von emotionalen Intelligenzleistungen.
Trotz des aufkommenden Gefühls, das von verschiedenen Faktoren abhängig ist, bleibt daher die Möglichkeit, durch emotionale Intelligenzleistungen ein anderes Ergebnis zu erzielen.
1.4 Konzeptualisierung Emotionaler Intelligenz
Die in Abbildung 1 enthaltene Wirkungsweise stellt nur eine Vereinfachung dar. Besonders die Darstellung der „emotionalen Intelligenzleistung“ als ein einheitlicher Faktor vernachlässigt die Teilbereiche, die unter dem Begriff emotionaler Intelligenzleistungen zu subsumieren sind. Einen Versuch einer umfassenden systematischen Erfassung dieser Einzelfähigkeiten stellt der Artikel von Salovey und Mayer (1989-90) dar. Für sie ist emotionale Intelligenz ein Spezialfall sozialer Intelligenz. Während sich soziale Intelligenz im Umgang zwischen verschiedenen Personen zeigt, ist emotionale Intelligenz „die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die Gefühle anderer zu beobachten, zwischen diesen Gefühlen zu unterscheiden und die dabei gewonnene Information zur Lenkung des eigenen Denkens und der eigenen Handlungen zu benutzen“ (Salovey & Mayer, S. 189, meine Übersetzung). In weiteren Überlegungen zerlegen Salovey und Mayer emotionale Intelligenz in drei Teilfähigkeiten. Diese weiter unterteilbaren Teilfähigkeiten sind (1) die Fähigkeit zur Bewertung („appraisal“) und des Ausdrucks von Emotionen, (2) die Fähigkeit der Regulation von Emotionen und (3) die Fähigkeit zur Nutzziehung („utilization“) aus Emotionen.
Die Bewertung und der Ausdruck von Emotionen können sich dabei auf sich selbst oder andere beziehen. In beiden Fällen kann dies verbale oder nonverbale Informationskanäle betreffen. Eine höhere Fähigkeit in diesen Bereichen führt dazu, daß Gefühle bei einem selbst oder bei Anderen besser eingeschätzt werden können. Eine hohe Fähigkeit im Ausdrücken von Gefühlen sollte es ermöglichen, Gefühle im richtigen Ausmaß zu zeigen und sozial anerkannte Verhaltensweisen im Gefühlsbereich auszuführen. Personen mit hoher Fähigkeit in diesem Bereich sollten als warme und mitfühlende Menschen eingeschätzt werden (Salovey & Mayer, 1989-90).
Die Fähigkeit zur Regulation von Emotionen spaltet sich weiter auf in die Fähigkeit, Gefühle bei sich selbst oder bei Anderen regulieren zu können. Dazu gehören vor allem sogenannte Meta-Erfahrungen mit Gefühlslagen („mood“), die als das Ergebnis eines Regulationsmechanismus gesehen werden können (Salovey & Mayer, 1989-90). Durch diese Erfahrungen sind emotional intelligente Personen auch in der Lage, die Gefühle anderer Menschen zu beeinflussen und zu verändern. Diese Fähigkeit fand in der Literatur schon unter dem Konzept der Eindrucksbildung Beachtung.
Der letzte Komplex von Fähigkeiten, die einen Teil der emotionalen Intelligenz ausmachen soll, ist die Fähigkeit zur Nutzziehung aus Emotionen. Diese Fähigkeit bezieht sich vor allem auf die Bildung geeigneter Problemlösestrategien, was durch die gezielte Nutzung von Emotionen erreicht werden kann. Darunter fallen so unterschiedliche Elemente wie die Erzeugung verschiedener Zukunftspläne durch Veränderungen in der Gefühlslage, die Veränderung der Gedächtnisorganisation durch Gefühle, das Unterbrechen ablaufender Handlungen zur Verwirklichung von notwendigeren Bedürfnissen und die Motivationserzeugung für Handlungen durch Emotionen (Salovey & Mayer, 1989-90).
1.5 Relevante Konzepte für die vorliegende Arbeit
Während diese Taxonomie nicht unbestritten ist (Neubauer, in Druck), können doch einige der von Salovey und Mayer (1989-90) genannten Fähigkeiten als unabdingbare Teile emotionaler Intelligenz gewertet werden. Darunter fallen insbesondere die Regulation von Gefühlen (wenn auch möglicherweise nicht bei Anderen) und das Erkennen von Emotionen, was auch der Mittelpunkt dieser Arbeit sein soll. Zum weiteren Fortschritt der wissenschaftlichen Arbeit in diesem Bereich wäre es nämlich dringend erforderlich, die Selbstbewertungsfragebögen, die bis jetzt einen Großteil der Datenerhebungsinstrumente darstellen, durch objektivere Methoden zu ersetzen. Diesem Ziel widmet sich die vorliegende Untersuchung.
1.5.1 Basisemotionen
Von großem Nutzen für die Entwicklung eines objektiven Tests werte ich Ergebnisse aus Studien zu sogenannten Basisemotionen. Basisemotionen könnte man sich beinahe als automatisierte Emotionen vorstellen. Das heißt, mit Auftreten einer Situation, die eine Basisemotion bewirkt, sind beispielsweise emotional regulative Fähigkeiten besonders gefordert, wenn sie noch Einfluß auf die Manifestation des Gefühles haben sollen. Der Gedanke einer quasi automatisierten Emotionskette bei Basisemotionen wird auch in der Literatur unterstützt. Ortony und Turner (1990) setzten das Kriterium für eine Basisemotion mit einer festen („hardwired“) Verbindung zwischen appraisal und Ausdruck des Gefühls. Die Analogie zu maschinellen Prozessen ist in dieser Definition besonders evident.
Für die Entwicklung eines Tests zur Erkennung von Gefühlen wäre das Vorhandensein von sogenannten Grundemotionen, die in irgendeiner Form am Aufbau weiterer Emotionen beteiligt wären, natürlich sehr vorteilhaft. Das Erkennen von solchen Grundemotionen könnte kontrastiert werden mit dem Erkennen von komplexeren Emotionen, und dadurch wäre es möglich, eine Skala von Items zu entwickeln, die ihrer Schwierigkeit nach ansteigen und zwar nach einem Kriterium des Grades an Basiseigenschaften eines Items. Das bedeutet, daß es – das Vorhandensein von Basisemotionen vorausgesetzt – dann möglich wäre, eine theoretische Fundierung des ansteigenden Schwierigkeitsgrades verschiedener Items zu entwickeln. Eine solche theoretische Fundierung wäre etwa im Rahmen eines kombinatorischen Modells vorstellbar. Ein solches Modell würde komplexere Gefühle als Emotionen definieren, die aus mehreren Grundemotionen zusammengesetzt wären. Eine Gruppe von Basisemotionen könnte einer Ebene aus etwas komplexeren Gefühlen untergeordnet sein, welche selbst weitere Ebenen aus jeweils noch komplexeren Gefühlen über sich hätte. Ein Beispiel dafür wäre Ehrfurcht, das man sich als eine Mischung aus Erstaunen und Angst vorstellen könnte. Ähnlich wie in herkömmlichen Intelligenzmaßen könnte man dann ein Fähigkeitsmaß verwenden, das aus der Lösung unterschiedlich schwieriger Aufgaben bestehen würde. Wäre die Existenz von Basisemotionen gesichert, wäre ein solches Fähigkeitsmaß auch ein sinnvolles d.h. aussagekräftiges Maß. Jemand mit einem niedrigeren Wert in einem solchen Test wäre dann vermutlich in der Lage, einfachere Gefühle zu erkennen, die entweder fundamental (im Sinne von nicht weiter teilbar) oder nur aus zwei oder drei anderen Gefühlen bestehen würden. Eine Person mit hohem Wert könnte auch komplexe Gefühle richtig erkennen, die aus vielleicht bis zu einem halben Dutzend anderer Gefühle bestehen würden. Bevor man sich allerdings eines solchen kombinatorischen Modells bedient, ist es aufgrund unten folgender Widersprüche notwendig, die Eignung von Basisemotionen in einer Testform alleine zu ermitteln.
1.5.1.1 Widersprüchliche Forschungsergebnisse
Wie im letzten Absatz bereits angedeutet, ist die Existenz solcher fundamentaler Emotionen nicht gesichert. Es gibt konträre Darstellungen in der Wissenschaft, wobei Ortony und Turner (1990) die Existenz von Basisemotionen überhaupt bestreiten. Besonders kombinatorischen Modellen, wie im letzten Absatz erörtert, erteilen sie eine deutliche Absage. Zur Unterstützung ihrer Aussagen führen sie vor allem die Uneinigkeit darüber an, welche Emotionen Basisemotionen sind, und das Problem, daß einige dieser fundamentalen Emotionen nicht wirklich Emotionen seien.
Das erste Argument betrifft die unterschiedliche Auffassung unter Emotionsforschern bezüglich der Anzahl und dem Inhalt sogenannter Basisemotionen. Dabei erteilen Ortony und Turner (1990) denjenigen Modellen, die mehr als zwei Grundemotionen propagieren eine Absage, und betrachten die Beschäftigung mit Modellen, die nur zwei Grundemotionen („pleasantness“, „unpleasantness“) enthalten, als wenig sinnvoll. Modelle mit mehr als zwei Basisemotionen werden als falsch, solche mit zwei Basisemotionen als nicht erkenntnisfördernd eingestuft. Dabei sind Ortony und Turner bereit, gewisse Unterschiede in der Benennung einzelner Gefühle zu ignorieren. Zum Beispiel erkennen sie an, daß mit „rage“ und „anger“ bei zwei verschiedenen Forschern das Gleiche gemeint sein könnte. Solche Veränderungen in der Benennung „reduce the disagreement, they do not and cannot eliminate it“ (Ortony & Turner, p. 316). Das Problem sei, daß manche Forscher von sehr übergeordneten Basisemotionen („happiness“, „sadness“) ausgehen, während andere eine (meist größere Zahl) spezifischer Basisemotionen propagieren.
Das zweite Argument, welches von Ortony und Turner (1990) behandelt wurde, ist die Feststellung, daß einige der Emotionen, die einzelne Forscher als Basisemotionen bezeichnet haben, nicht einmal als Emotionen gewertet werden können. Das Kriterium, an dem man Emotionen von Nicht-Emotionen unterscheiden kann, ist die sogenannte affektive Wertigkeit („affective valence“). Emotionen müssen im Sinne von „gut“ oder „schlecht“ bewertbar sein. Dazu gehören zum Beispiel „happiness“ und „sadness“, oder „fear“ und „relief“. Nicht dazu gehört aber etwa „surprise“, das aber trotzdem als Emotion von einzelnen Emotionsforschern angeführt ist. Eine Überraschung kann sowohl negativ als auch positiv oder auch einfach affektiv neutral sein. Daher erfüllt diese „Emotion“ nicht einmal das grundlegende Kriterium für eine Emotion und kann daher schon gar keine Basisemotion sein. Es wäre eher als ein kognitiver Zustand zu bewerten. Aus diesem oder ähnlichen Gründen fallen auch andere propagierte Basisemotionen wie „interest“ und „desire“ weg. Von den 14 verschiedenen Modellen, die Ortony und Turner (1990) bewerten, beinhalten aber bereits sechs der Modelle zumindest eine dieser fragwürdigen Emotionen. Wenn aber bereits eine der Basisemotionen in einem Modell nicht als Emotion, sondern „nur“ als ein kognitiver Zustand gesehen werden kann, welchen Stellenwert behält dann das restliche Modell?
In einer Antwort auf die breitgefächerte Kritik von Ortony und Turner, bestimmt Izard (1992) die Kriterien für Emotionen genauer. Um Zustände wie „surprise“ oder „interest“ als Basisemotionen zu erhalten, räumt sie ein, daß Emotionen auch Motivationen sein können. Sie können aber niemals Motive sein. Motive seien kognitiv artikulierte Ziele. Emotionale Erfahrungen hingegen sind Zustände, die ein direktes und unmittelbares Produkt bestimmter neuronaler Prozesse darstellen, die mit dieser bestimmten Emotion verbunden sind. Als Kriterien nach der eine Emotion als Basisemotion eingestuft wird, gelten dabei ihre theoretische Rolle in der Evolution, ihre biologischen und sozialen Funktionen und ihre primäre Entwicklung in der Ontogenese. In einem solchen Kontext erhalten dann auch Zustände wie „interest“ wieder eine Bedeutung als Emotion. Interesse (Izard, 1992) motiviert das Spielverhalten von Kindern und ermöglicht daher die Entdeckung von neuen Wirkungsweisen und das Verstehen bestimmter Vorgänge. Daher ist „interest“ eine fundamentale Emotion, weil sie das Fundament eines anderen Verhaltens (z.B.: Bewältigungsstrategien, Anpassung...) ist. Diese Argumentation bleibt aber fragwürdig, weil selbst Ortony und Turner (1990) nicht daran gezweifelt haben, daß etwa “Interesse” fundamental wäre, sondern lediglich daran, daß es eine Emotion sei.
1.5.1.2 Universelle Gesichtsausdrücke
Eine Richtung in der Emotionsforschung nützt die Expression von Emotionen in Gesichtern, um zu einem Konzept von Basisemotionen zu gelangen. Vertreter dieser Richtung sind Ekman (1993), Katsikitis (1997) und King (1998). Sie alle haben gemeinsam, daß sie die Bewegung der Gesichtsmuskulatur bei der Empfindung von Emotionen für besonders aussagekräftig halten. Durch diese Wissenschaftler wuchs auch das Interesse an der Informationsquelle Gesicht. Den Höhepunkt dieser Forschung bildete die Behauptung universell gültiger Gesichtsausdrücke
Implikation für das Studium um die Emotionen. Das Studium von Gesichtsausdrücken und insbesondere die behauptete Existenz universeller Gesichtsausdrücke haben aber mehr bewirkt, als die Klärung von Einzelfragen. Sie schafften es vor allem, das Studium der Emotionen attraktiver zu machen. Außerdem war dadurch ein Abgehen von der starren Haltung möglich, daß Emotionen hauptsächlich gelernt werden würden. Die Behauptung universeller Gesichtsausdrücke führte daher zu einer Kompromißhaltung. Diese Kompromißhaltung bezieht nun sowohl Lernen als auch natürliche Ausstattung mit ein (Ekman, 1993). Darüber hinaus wurde durch ein singuläres Ausdrucksbild von Emotionen auch die gedankliche Grundlage geschaffen, nach einer emotionsspezifischen Physiologie zu suchen. Wenn sich schon bestimmte Emotionen über einen vorgegebenen Komplex aus Muskelbewegungen bemerkbar machen würden, ist es nur naheliegend zu betrachten, ob auch spezifische physiologische Veränderungen stattfinden, während eine Emotion abläuft. Während es im allgemeinen auch Laien klar ist, daß mit einem Angstanstieg auch eine Veränderung der Pulsrate und ähnlicher Parameter miteinhergeht, stellt die Überlegung spezifischer Veränderungen für einzelne Emotionen eine ganz andere Qualität von Betrachtung dar. Diese Überlegungen stehen auch im Kontrast zu einer sehr einflußreichen Vorstellung über die Entstehung von Emotionen, die heute in beinahe jedem Lehrbuch, das sich auch mit Emotionen beschäftigt, abgedruckt ist. Die Rede ist von Schachter und Singers Experiment (zum Beispiel in Taylor, Peplau & Sears, 1994; Shaver & Tarpy, 1993), das spezifische Gefühle aus kognitiven Bewertungen und Interpretationen erklärt. Ihnen zufolge gibt es nur eine, grundsätzlich bei allen Emotionen qualitativ gleichwertige, Erregung, die je nach gegebener Informationslage als eine spezifische Emotion interpretiert wird.
Eine weitere Frage, die im Zusammenhang mit dem Studium des Gesichtsausdruckes aufgetaucht ist, ist die Frage nach den notwendigen Auslösern von Emotionen. Bei der Photographie von universellen Gesichtsausdrücken haben viele Forscher Personen gebeten, Emotionen nachzuempfinden. Bei diesen gestellten Aufnahmen wurde entdeckt, daß Personen durch das Posieren auch die Emotion, oder zumindest Teile der Emotion, empfanden, die sie mimen sollten. Ist daher alleine das Arrangement der Gesichtsmuskulatur in einer bestimmten Stellung ausreichend, um diejenige Emotion hervorzurufen, die mit diesem Gesichtsausdruck verbunden ist? Erinnern wir uns an dieser Stelle auch an Ortony und Turners (1990) Kriterium einer „hardwired“ Verbindung zwischen Emotion und Reaktion. Da der Einfluß dieser Möglichkeit – Posieren führt zu spezifischer Emotion – für diese Studie von entscheidender Bedeutung ist, werde ich mich diesem Teil unten (1.6.2 – gestellte vs. natürliche Gesichtsausdrücke) genauer widmen.
1.5.1.3 Prototypische Anschauung
Ein Problem in der Nutzung universeller Gesichtsausdrücke ist ihre mangelnde Eindeutigkeit (Ortony & Turner, 1990). Die Argumentation für Basisemotionen, die anhand von universellen Gesichtsausdrücken bestimmbar wären, lautet etwa folgendermaßen: Erfahren Angehörige verschiedener Kulturen, die bestenfalls noch nie miteinander in Kontakt getreten sind, eine bestimmte Emotion und antworten auf diese Emotion mit einem vergleichbaren Gesichtsausdruck, wird die Emotion als eine Basisemotion betrachtet. Der Gebrauch desselben Gesichtsausdruckes ist dabei nur manifestes Symbol der biologischen Stellung einer solchen Basisemotion. Ortony und Turner meinen, daß es nur bestimmte Komponenten von Emotionen gebe, die mit bestimmten Komponenten von Gesichtsausdrücken zusammenhängen würden. Diese Darstellung führt zu einer prototypischen Sichtweise von Emotionen. Dabei zerlegt man Emotionen in Komponenten. Für jede Emotion, so wird postuliert, gibt es eine Menge von Komponenten, die als typisch für diese Emotion angesehen werden. Je mehr dieser Komponenten eine beliebige emotionale Reaktion aufweist, desto leichter wird sie der entsprechenden Emotion zugeordnet. Oder um es in den Worten von Fehr und Russel (1984) zu sagen:
More prototypical members share more attributes in common with each other; less prototypical members have fewer attributes in common with each other and have a greater number of attributes in common with members of adjacent concepts. (p. 466)
In der Wirklichkeit vorkommende emotionale Reaktionen spiegeln dabei den Prototyp einer Emotion in unterschiedlichem Ausmaß wider. Es ist glaubhaft anzunehmen, daß durch unsere Erfahrungen mit der sozialen Umwelt, beziehungsweise vielleicht auch durch genetische Überlieferung, eine Art Blaupause von Gefühlen in uns entsteht, die über Komponenten aufgebaut ist. Dann wäre eine Gefühlsäußerung um so leichter erkennbar, je mehr prototypische Komponenten in dieser Gefühlsäußerung vorhanden wären. Umgekehrt wären Personen, die typische Komponenten mit einer größeren Sicherheit abgespeichert haben, im Vorteil bei der Beurteilung von emotionalen Reaktionen. Je mehr nicht-typische Komponenten eine emotionale Reaktion enthalten würde, desto schwieriger wäre eine solche Reaktion zu identifizieren. Eine solche emotionale Reaktion mit vielen Fremdkomponenten (Komponenten aus anderen Gefühlen als dem Prototyp des ausgedrückten Gefühls) könnte dann vielleicht nur von Personen identifiziert werden, die ein reiches Spektrum emotionaler Erfahrung besitzen. Denn nur solche Personen hätten die Erfahrung gemacht, daß Emotionen auch Fremdkomponenten enthalten könnten.
[...]
- Arbeit zitieren
- Arnold Ackerer (Autor:in), 1999, Entwicklung eines objektiven Tests zur Erkennung von Emotionen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21678
Kostenlos Autor werden
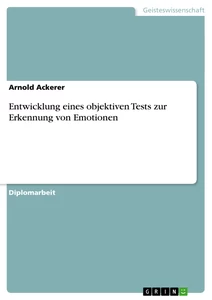



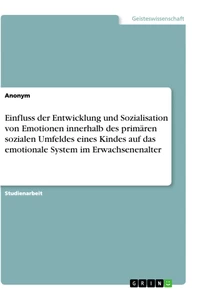

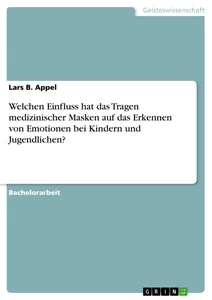
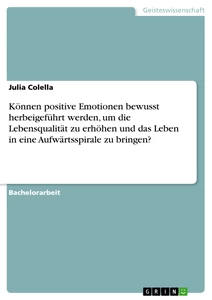












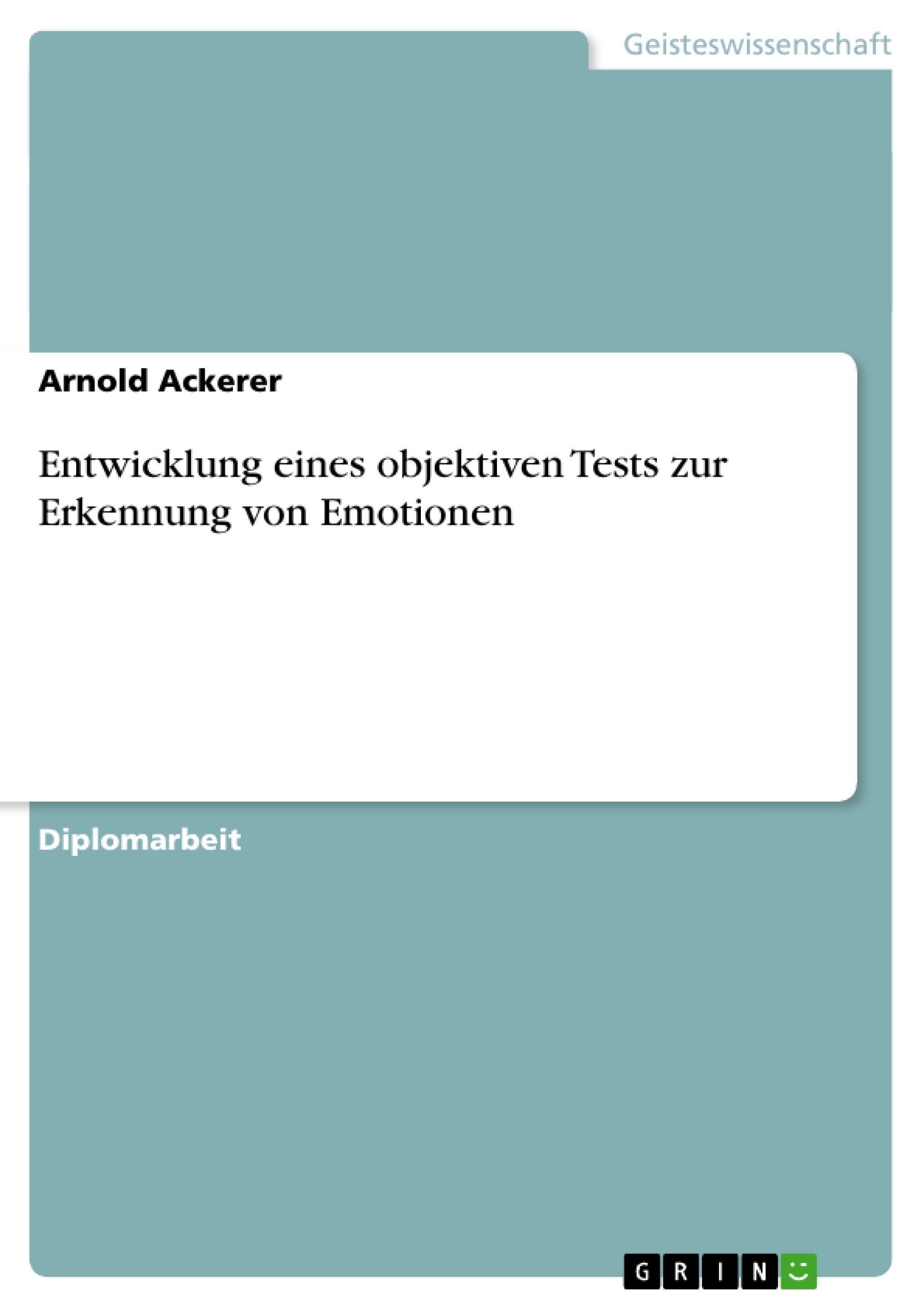

Kommentare