Leseprobe
INHALT
Vorwort
Einleitung
1. Grundlegendes zur Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland
2. Die Klinik (KJPP)
3. Patienten der KJPP
4. Musiktherapie in der KJPP
5. Erste Erfahrungen in Einzel- und Gruppenmusiktherapien
6. Fallbeispiel: Florian
Meine musiktherapeutische Arbeit mit Florian
Die erste Stunde
Die zweite Stunde
Die dritte Stunde
Vierte und letzte Stunde
7. Reflektion der Erfahrungen mit Florian
Entwicklungspsychologie
Wandlung und Krise
Musiktherapeutisches Verstehen
8. Zusammenfassende Diskussion und Ausblick
Über Klinik und Praktikum
Die Bedeutung von Geschlecht und Geschlechterrollen
Die Qualität des Persönlichen
Das Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Perspektiven
Zwischen Freiheit und Bedeutungsmangel
Anhang
Eingruppierung von Musiktherapeuten
E-Mail an die kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen
„Ayelevi“ (Lied mit Anleitung)
Literatur- und Quellenverzeichnis
Vorwort
Diese Hausarbeit ist die Frucht eines gut zweijährigen Weiterbildungsstudiums und eines mehrmonatigen Musiktherapiepraktikums, das ich ab Sommer 2011 in einer Klinik für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie und Psychotherapie absolvierte. Dass daraus meine Studien-Abschlussarbeit entstehen würde, war eigentlich gar nicht vorgesehen. Doch als ich meinen Bericht zum Praktikum verfassen wollte, musste ich feststellen, dass meine Erfahrungen aus der Klinik sich dem Versuch widersetzten, sie in das vorgesehene Format zu zwingen. Zu vielfältig, widersprüchlich und zu intensiv war das Erlebte, so dass die Niederschrift unversehens zu einem sehr viel ausführlicheren Bericht geriet. Also verzichtete ich auf die geplante Hausarbeit zum Thema „Stimme und Musik begleiten ein Kind durch Schwangerschaft, Geburt und die ersten Babymonate“ und widmete mich ganz dem hier vorliegenden Thema.
Nun hoffe ich, dass die entstandene Mischung aus Erfahrungsbericht und Reflektion ein nützliches und kurzweiliges Lesererlebnis bieten kann – vor allem für andere Studierende, die sich für musiktherapeutisches Arbeiten im Umfeld der Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie interessieren. Ich würde mich freuen, wenn andere sich anregen ließen, dem hier Beschriebenen eigene Erfahrungen hinzuzufügen.
Ich danke herzlich meiner Praktikumsmentorin, Musiktherapeutin Teresa Schlummer, für ihre kompetente und großzügige Unterstützung während des gesamten Praktikums. Dankbar bin ich auch unseren Wegbegleitern und Lehrern in Klein Jasedow, sowie den Seminarleiterinnen und –leitern von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg, allen voran unserem Studienleiter und musiktherapeutischen Mentor Prof. Dr. Hans-Helmut Decker-Voigt. Sie alle haben mit ihrer Arbeit dafür gesorgt, dass ich den „Ernstfall“, die musiktherapeutische Begegnung mit Patienten, weniger „ernst“ als mit froher Zuversicht erleben konnte, wie das Wiedersehen mit einem guten Bekannten.
Ulf Grebe, im Februar 2012
Einleitung
Wenn Kinder oder Jugendliche psychisch erkranken, erleben viele Menschen das als Zumutung. Wir stellen uns Kindheit und Jugend gerne als vermeintliche Oasen des Gesundseins und der Vitalität vor, während das Kranksein im psychiatrischen Sinne als eine der bedrohlichsten Formen mangelnden Wohlergehens empfunden wird. Es rührt an das Hoheitsgebiet unseres Selbst, wo Verstand und Gefühl, Selbstkontrolle und Identität verankert sind. Als wären diesbezügliche Bedrohungen nicht bei Erwachsenen schon schrecklich genug, kommt bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen noch eine Dimension hinzu: ihre Unfertigkeit als Person und daher rührende Bedürftigkeit. Wenn Kinder und Jugendliche psychisch erkranken, ist unser Gefühl von Hilflosigkeit dem Kranksein gegenüber besonders stark. Eine „Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie“, die für nichts anderes da ist, als sich um an Gemüt und Geist erkrankte junge Menschen zu kümmern, erscheint damit eigentlich als Gipfel des Unzumutbaren. Wer wollte gerne damit zu tun haben?!
Ein angehender Musiktherapeut sollte die Sache etwas anders sehen. Als ich mein Praktikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie plante, hatte ich schon die Erfahrung gemacht, dass psychische Störungen und psychiatrische Erkrankungen zum Kindes- und Jugendalter dazu gehören, kaum weniger als Mumps, Masern und Akne. Als Diplom-Pädagoge und Lerntherapeut begegnen mir seit Jahren täglich Mädchen und Jungen mit Teilleistungsstörungen, Entwicklungsverzögerung, Aufmerksamkeitsstörungen, sozialen Problemen, Ängsten, Tics oder Zwängen. Zu mir kommen sie „nur“, weil sie sich mit dem Erlernen der Mathematik schwer tun, doch für einige von ihnen sind die Besuche beim Kinder- und Jugendpsychiater etwas annähernd Normales, so wie ihre regelmäßigen Termine in der Ergotherapiepraxis, bei der Psychotherapeutin, oder eben beim Dyskalkulietherapeuten.
Passend dazu findet sich auf der Internetseite der Bundespsychotherapeutenkammer BPtK die Aussage, 21.9 % der Kinder und Jugendlichen seien „psychisch auffällig“ und 9.7 % „psychisch krank“. Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen und ADHS führen demzufolge die Liste der häufigsten Diagnosen an[1]. Psychisch kranke Kinder und Jugendliche, kann man daraus entnehmen, sind etwas ganz Alltägliches.
Es gibt weitere gute Gründe, sich dem Feld der Kinder- und Jugendpsychiatrie zuzuwenden: Die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ist einer der wichtigsten Einsatzbereiche von Musiktherapeuten, neben den Einsatzfeldern Psychosomatik, Rehabilitation, Geriatrie, Arbeit für Menschen mit Behinderung und Frühgeborenenversorgung. Als Wesensmerkmal von Musiktherapie wird im Allgemeinen ihr nicht sprachlicher, ausdruckszentrierter und spielerischer Zugang zum Patienten angesehen. Dementsprechend erscheint sie bestens geeignet für die Anwendung im Kindes- und Jugendalter, und das lässt sich auch in einer entsprechenden Schwerpunktbildung der Arbeit niedergelassener Musiktherapeuten auf diesem Gebiet ablesen.[2]
Ein drittes, nicht von der Hand zu weisendes Argument ist die Tatsache, dass viele stationäre Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland Musiktherapeuten beschäftigen und Praktikanten eine Chance geben, erste Berufserfahrung zu sammeln – so auch die beiden Kliniken im er Stadtgebiet.
Nicht nur aus diesen Gründen war für mich das Praktikum mit jungen Psychiatriepatienten ein Glücksfall – Näheres verraten die folgenden Kapitel.
Was möchte diese Arbeit leisten, und was darf von ihr erwartet werden?
Als ein Erfahrungsbericht möchte die Arbeit in erster Linie ein Zeugnis davon ablegen, wie es im Innern einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie aussieht und zugeht. Wie wird dort gearbeitet? Wer kommt dort als Patient hin, und was bedeutet das für ihn oder für sie? Welche Funktion hat Musiktherapie im klinischen Ablauf, und welche Rolle spielt der Musiktherapeut/die Musiktherapeutin darin?
Aus der klinisch-musiktherapeutischen Praxis zu erzählen, ist das Hauptanliegen, angefangen von der Arbeitsweise der Musiktherapeuten über die Schilderung individueller musiktherapeutischer Interaktionen mit Patienten bis hin zur Ausgestaltung des Musiktherapieraumes.
Den zweiten Schwerpunkt stellt die musiktherapeutische Behandlung eines dreizehnjährigen Jungen dar, dessen Fall ausführlich berichtet wird, um anschließend diskutiert und auf seinen allgemeinen Erkenntniswert hin untersucht zu werden.
Als drittes Anliegen der Arbeit haben sich schließlich drei Themen herauskristallisiert, die so richtig erst während der gedanklichen Verarbeitung meiner Praktikumszeit auf die Agenda drängten: (a) das Spannungsfeld zwischen ärztlich-psychologischer und musiktherapeutischer Perspektive, (b) die Rolle der Musiktherapie zwischen Narrenfreiheit und Bedeutungsmangel und (c) die Relevanz von Geschlecht und Geschlechterrolle für die musiktherapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Alle drei Themen werden hier nur „im Vorbeigehen“ beleuchtet, keines konnte abschließend erörtert werden, doch als Diskussionspunkte sind sie mir wichtig geworden und haben daher ihren Platz erhalten.
1. Grundlegendes zur Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland
Menschliches Verhalten hat viele Facetten. Welche davon als „normal“ und welche davon als „gestört“ anzusehen sind, ist durch keine Definition zufriedenstellend klärbar.[3]
Pubertierende sind zu echten Leistungen fähig - das ist eine Nachricht von hohem Neuigkeitswert. Denn gemeinhin gilt die Pubertät nur als zeitweiliges Irresein.[4]
„Krank“ und „gesund“, „normal“ und „gestört“ sind Kategorien, denen sich menschliches Erleben und Verhalten nur allzu gerne entzieht. Das trifft umso mehr für eine Lebensphase zu, deren Wesen es ist, „Normales“ in Frage zu stellen und die den menschlichen Körper einer radikalen Umgestaltung unterzieht, wie sie sonst nur Säuglingen widerfährt. Was wir als „Störung“ oder „Kranksein“ bewerten, kann auch Ausdruck einer Veränderungskraft sein, die wesenhaft und überlebenswichtig für den Menschen und mit der im Kindes- und Jugendalter immer zu rechnen ist. „Es ist also gesund und normal, dass Jugendliche anders fühlen, denken und handeln als Erwachsene. Sie leben entwicklungsbedingt in einer anderen Wirklichkeit.“[5].
Manchmal wird seine Wirklichkeit einem Kind oder Jugendlichen zur Qual. Vielleicht weil sie in einem schwer erträglichen Gegensatz zum Erleben eigener oder fremden Wünsche und Erwartungen steht, vielleicht schränkt sie auch seine Freiheit ein, sich auszudrücken, Beziehungen einzugehen oder sein Leben aktiv zu gestalten. Vielleicht bereitet sie seelische und körperliche Schmerzen oder mindert auf eine andere Weise ihr „umfassendes körperliches, geistiges und seelisches Wohlergehen“, als das Gesundheit von der Weltgesundheitsorganisation WHO definiert wird[6]. In so einem Fall wird es zur Notwendigkeit, das Leiden zu benennen. Jede Hilfeleistung, die über die persönlich-empathische Ebene hinaus geht, sollte sich da auf eine gemeinsame sprachliche, diagnostische, therapeutische und rechtliche Grundlage berufen können.
Eine solche Grundlage ist die „International Classification of Diseases“ (ICD), ein weltweit einheitliches und in Deutschland für die kassenärztliche Versorgung verbindliches[7] Klassifizierungssystem, das derzeit in seiner zehnten Überarbeitung (IDC-10) verwendet wird. In der ICD wird versucht, alle medizinisch bekannten Krankheiten von ihrer phänomenologisch beobachtbaren Seite zu beschreiben und zu klassifizieren. Psychische Störungen werden im Kapitel F aufgeführt, deshalb bestehen die entsprechenden Diagnosen alle aus einer Zahl (für die Unterrubrik) kombiniert mit dem Buchstaben F (z. B. F81.2 für: Psychische und Verhaltensstörungen/ Umschriebene Störungen schulischer Fertigkeiten/ Rechenstörung). Von besonderer kinder- und jugendpsychiatrischer Relevanz ist das Kapitel F9 – Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend, mit so häufig verwendeten Unterkapiteln wie F90 – hyperkinetische Störungen, F91 – Störungen des Sozialverhaltens oder F95 – Ticstörungen.[8]
Das System ist stark vereinfachend und kann der Fülle der feinen Unterschiede zwischen den Krankheitsphänomenen nicht immer gerecht werden. So können sich hinter ein- und derselben ICD-10-Diagnose noch recht unterschiedliche individuelle Krankheitsbilder auftun. Außerdem bleiben hier die Krankheits- Ursachen weitgehend unberücksichtigt. Eine Diagnose nach ICD-10 ist also weitgehend beschreibender Natur und erleichtert den fachlichen Austausch über die äußerlich wahrnehmbare Seite von Krankheit. Streng genommen beinhaltet sie aber keine Aussagen über Ursachen, Genese und zu erwartenden Verlauf.[9] Gleichwohl gilt es als „ein wichtiges Ziel der Forschung, zu diagnostischen Klassifikationen zu kommen, die zugleich therapierelevant sind“.[10]
Für die psychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen gab es 2010 in Deutschland etwa 1.600 Ärzte für Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie, von denen 750 niedergelassen waren[11]. Der große Rest verteilt sich auf pädiatrische oder kinder- und jugendpsychiatrische Kliniken oder Stationen an Universitätskliniken, Landeskrankenhäusern, kommunalen oder privaten Krankenhäusern. Im Rahmen der wohnortnahen psychiatrischen Versorgung gibt es auch Ambulanzen, Tageskliniken oder Suchtkliniken in unterschiedlicher Trägerschaft, an denen Fachärzte beschäftigt sind.
Deutlich höher dürfte noch die Zahl der in Deutschland tätigen nicht ärztlichen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten liegen, eine Berufsgruppe, deren Zuständigkeit sich mit der der Psychiater teilweise überschneidet und die überwiegend von Psychologen gebildet wird. Aber auch Diplom-Pädagogen, Sozialpädagogen und andere können eine entsprechende Approbation erlangen. PsychologInnen machen einen erheblichen Anteil des Fachpersonals an kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken aus, wo sie – üblicherweise unter ärztlicher Leitung – gleichrangig mit den Fachärzten arbeiten, aber anders als diese vorwiegend für den Bereich Psychodiagnostik und Psychotherapie zuständig sind.
Nicht zu vergessen bei der Aufzählung professioneller Hilfeleister sind auch die Mitarbeiter von Jugendämtern, Heimen und betreuten Wohngruppen sowie Kinderärzte, Lehrer und Erzieher, Krankenschwestern und –pfleger, KrankengymnastInnen, Ergotherapeuten und Motopäden. Sie alle tragen Verantwortung für das Wohl der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen, und jeder von ihnen kann in die Lage kommen, Teil des Fürsorgenetzes für ein betroffenes Kind oder eine(n) Jugendliche(n) zu werden.
Wie schon erwähnt, gehört nur ein relativ kleiner Teil der kinder- und jugendpsychiatrischen und –psychotherapeutischen Einrichtungen in Deutschland zum Typus der vollstationären Klinik oder Klinikstation. Während der Begriff „Psychiatrie“ im Bewusstsein vieler Menschen noch mit den „geschlossenen“ Stationen verknüpft ist, in denen eine Unterbringung mit vorübergehendem Freiheitsentzug einhergeht, wird meistens übersehen, dass psychiatrische Hilfeleister zum ganz überwiegenden Teil auf freiwilliger Basis aufgesucht werden, zum Beispiel durch den Besuch eines niedergelassenen Arztes, eines psychologischen Psychotherapeuten, einer Beratungsstelle oder einer Klinikambulanz. Tatsächlich findet ein „Freiheitsentzug“ im rechtlichen Sinne nur in einer geringen Zahl von Fällen und unter gesetzlich streng geregelten Bedingungen statt:
Eine Unterbringung des Kindes, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist, bedarf der Genehmigung des Familiengerichts. Die Unterbringung ist zulässig, wenn sie zum Wohl des Kindes, insbesondere zur Abwendung einer erheblichen Selbst- oder Fremdgefährdung, erforderlich ist und der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch andere öffentliche Hilfen, begegnet werden kann. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.
(§ 1631b BGB)[12]
Dies gilt z. B. als gegeben, wenn ein Jugendlicher Selbstmordabsichten äußert, deren Umsetzung in die Tat nicht auszuschließen ist. Oder es liegt ausgeprägte Gewalttätigkeit vor. Sobald die akute Bedrohung abgewendet ist, muss auch die Zwangsmaßnahme in eine geeignete Maßnahme auf freiwilliger Basis umgewandelt werden. Martin Baierl, der als Psychologe an einer der größten kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken arbeitet, schreibt in seinem „Praxishandbuch“, dass die betroffenen Jugendlichen, wenn sie zum ersten Mal eine Kinder- und Jugendpsychiatrie von innen sehen, selbst meist „völlig überrascht“ seien darüber, „dass die Fenster (in der Regel) nicht vergittert sind, die Atmosphäre sich meist nicht grundlegend von der einer Jugendhilfe unterscheidet, viele andere Jugendliche dort ‚ganz normal’ aussehen und sich auch ‚ganz normal’ verhalten, dass normale Alltagskleidung und keine Zwangsjacken getragen werden.“[13]
Die Einsicht des Kindes oder Jugendlichen in die Notwendigkeit und Angemessenheit von Hilfsmaßnahmen beschreibt Baierl als sehr wichtigen Faktor für die bevorstehende Arbeit an der Genesung. Wie auch im folgenden Kapitel nachzulesen ist, wird eine moderne Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie allein durch bauliche Gestaltung dazu beitragen, dass Patienten ihre verständlichen Sorgen schon beim Erstkontakt ein Stück weit loslassen können.
Musiktherapie ist in stationären kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen ein häufig anzutreffendes „Kann“-Angebot, dessen Ausgestaltung und Stellenwert jedoch von Klinik zu Klinik stark variiert. In einer eigenen Mail-Umfrage[14] unter allen gut 140 Kliniken, die deutschlandweit im Verzeichnis der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP) aufgeführt sind, konnte ich einen Rücklauf von 37 Antworten verzeichnen. 28 Einrichtungen schrieben, dass bei ihnen Musiktherapie im Angebot sei, 9 verneinten dies. Unter den Erstgenannten beschäftigt nach eigener Aussage knapp die Hälfte Musiktherapeuten (m/w) auf mindestens einer ganzen Stelle. Die restlichen Einrichtungen, darunter auch Großstadtkliniken wie z. B. die er Uniklinik, bieten für Musiktherapie nur eine Teilzeitbeschäftigung von bis zu 20 Wochenstunden. Auf meine Frage nach dem Stellenwert der Musiktherapie im Vergleich zu anderen (Psycho-) Therapien antworteten wenige Einrichtungen. Demnach würde die Musiktherapie eher auf der Ebene von Ergotherapie rangieren. In drei Fällen wurde jedoch betont, dass Musiktherapeuten gleichberechtigte Mitglieder des therapeutischen Teams seien. (Dieses Aussagen müssen einander nicht ausschließen. Wie in Kapitel 4 nachzulesen ist, bringt die Einstufung analog Ergotherapie jedoch in der Regel eine entsprechend geringere Entlohnung mit sich.)
Wagt man es, das Verhältnis der Mailantworten „Musiktherapie: ja“ auf alle Einrichtungen hochzurechnen, dann ergäbe das eine erfreulich große Verbreitung von ca. 75%. Ob dies tatsächlich so ist, konnte ich allerdings auch durch Anfragen bei verschiedenen Berufsverbänden nicht in Erfahrung bringen. Immerhin signalisierten drei Einrichtungen, dass ihre Stelle für Musiktherapie wegen Mangel an Bewerbern derzeit unbesetzt sei.
2. Die Klinik (KJPP)
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (nachfolgend KJPP genannt) ist eine relativ junge Einrichtung, gegründet 2005. Mit einer weiteren großen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie teilt sie sich das Einzugsgebiet einer deutschen Großstadt und der angrenzenden Gemeinden. Dabei entfallen mehrere bevölkerungsreiche und strukturschwache Stadtteile in die Zuständigkeit der KJPP.[15]
Das Beratungs- und Behandlungsangebot der KJPP richtet sich an Kleinkinder, Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren, die unter akuten oder länger anhaltenden seelischen Störungen oder Erkrankungen leiden. Der erste Kontakt findet in der Regel mit der Institutsambulanz statt, die sowohl beratend als auch diagnostisch die Weichen für weitere Behandlungsmaßnahmen stellt. Zielgruppe der Klinik sind Patienten, die in den Praxen niedergelassener Ärzte kein ausreichendes Behandlungsangebot vorfinden. Dies gilt etwa für: „Patienten mit Essstörungen, Angst- oder Zwangsstörungen, depressiver Symptomatik, Psychosen, ADHS, Vorschulkinder, Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen und solche mit einem Migrationshintergrund und daraus resultierenden Schwierigkeiten.“[16]
Laut Eigendarstellung legt die KJPP großen Wert auf eine umfassende medizinische und psychologische Diagnostik sowie auf die enge Zusammenarbeit mit den behandelnden Haus- und Fachärzten, „um wiederholte stationäre Behandlungen zu vermeiden oder abzukürzen.“ Wird eine teil- oder vollstationäre Versorgung dennoch für nötig erachtet, so stehen hierfür eine Tagesklinik (16 Plätze), eine Kleinkinderstation (9 Plätze, davon 3 Mutter-Kind-Einheiten), eine Schulkinderstation (10), eine offene Jugendstation (8), eine Intensivstation (8) und eine Station für den qualifizierten Entzug bei Suchterkrankungen (9 Plätze) bereit. In allen Stationen zusammen werden so ständig zwischen 50 und 60 Patienten behandelt.
Das Behandlungskonzept der KJPP folgt dem Stand der Forschung, wonach psychische Erkrankungen des Kindes- und Jugendalters meist von einer Vielzahl von Faktoren abhängen und dementsprechend der Behandlung auf mehreren Ebenen („multimodale Therapie“) bedürfen. In der Praxis bedeutet das die Einbeziehung verschiedener Personengruppen in die diagnostischen und therapeutischen Prozesse. Neben Ärzten und Psychologen sind das qualifizierte Berufsgruppen wie Musiktherapeuten, Ergotherapeuten, Bewegungstherapeuten und Heilpädagogen sowie wichtige Bezugspersonen aus dem Patientenumfeld wie Lehrer oder Erzieherinnen. Großen Wert wird zudem auf die Einbindung der Familie und der Rückgriff auf familiäre Ressourcen gelegt. In Fällen, wo dies wenig oder gar nicht möglich ist, fällt auch die Aktivierung und Pflege von Jugendamtskontakten in die Zuständigkeit der Klinik. Für schulpflichtige Kinder und Jugendliche, die von der Klinik aus ihre Heimatschule nicht besuchen können, werden außerdem mehrere Lehrkräfte beschäftigt, die an der klinikeigenen „Hilde-Domin-Schule“ in kleinen Gruppen Primar- und Sekundarstufenunterricht erteilen.
Der therapeutische Schwerpunkt der Klinik liegt gemäß einer konzeptuellen Selbstdarstellung „auf familienzentrierten Maßnahmen und einem verhaltenstherapeutischen Vorgehen.“ Grundsätzlich wird aber Offenheit für andere therapeutischen Verfahren erklärt. (In meiner Praktikumszeit habe ich die praktische Dominanz verhaltenstherapeutischer Methoden bestätigt gefunden, während es kaum Anhaltspunkte für tiefenpsychologische oder systemische Interventionen gab. Dieser Eindruck wurde auf Nachfrage von einer Stationspsychologin bestätigt.) Eine weitere wichtige Aufgabe sei „die Erprobung neuer Therapieformen sowie die Überprüfung der Wirksamkeit von Behandungsmaßnahmen.“[17]
Das Behandlungsangebot der KJPP im Überblick:
- Psychotherapie
- Gruppentherapie
- Elternberatung, Elterntraining und Familientherapie
- Pflege- und Erziehungsdienst
- Medikamentöse Therapie
- Bewegungstherapie
- Musiktherapie
- Ergotherapie
- Reittherapie
- Sozialdienst
Das Personal
Die KJPP wird von Prof. Dr. (…) geleitet, einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Leitende Psychologin ist (…). Ein Oberarzt und drei Oberärztinnen teilen sich die Zuständigkeit für die verschiedenen Stationen und die Ambulanz. Pro Station gibt es ferner eine Assistenzärztin (Männer sind hier die Ausnahme), eine Psychologin sowie mehrere Fachkräfte im Pflege- und Erziehungsdienst. Der Bereich der sogenannten Fachtherapien (Ergo-, Musik- und Bewegungstherapie sowie Training sozialer Kompetenzen) wird derzeit von drei Bewegungstherapeuten (2m/1w), einer Musiktherapeutin, zwei Ergotherapeuten (m/w) und einer Sozialpädagogin gebildet, die im Erdgeschoss des Klinikgebäudes einen eigenen Trakt mit neun Räumen zur Verfügung haben.
Gebäude und Gelände
Die KJPP ist noch „jung“, was sich in der freundlich-hellen Bauweise angenehm bemerkbar macht. Das bungalowartige, maximal zweigeschossige Gebäudearrangement liegt ein wenig abgeschieden auf der grünen Wiese im Rücken des Klinikums (…), in den Außenbezirken der Großstadt , doch gut erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Räumlich klug getrennte Wohnbereiche der verschiedenen Alters- und Therapiegruppen gewährleisten Privatsphäre und gestatten vielfach Ausblick ins Grüne. Ein eigener Garten, Sitzgelegenheiten im Freien sowie ein moderner Tartan-Sportplatz bieten Gelegenheit zu Freiluftaktivitäten direkt vor der Haustür. Auch die Schulräume sind zum Teil im Klinikgebäude untergebracht. Eine Sporthalle ist in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen.
Die Stationen sind farblich und räumlich klar voneinander abgegrenzte Bereiche, in denen die Kinder und Jugendlichen schlafen, wohnen, essen und zum Teil ihre Freizeit verbringen. Die 12 bis 20 qm großen, hellen Zimmer haben in der Regel zwei Bewohner. Fotos, Kuscheltiere, Musikinstrumente und andere persönliche Besitztümer verleihen den Zimmern zumindest ansatzweise das Flair eines vorübergehenden Zuhauses.
3. Patienten der KJPP
Die Patienten der Klinik habe ich meistens zweimal „kennengelernt“: zum einen, wenn sie mir in einer musiktherapeutischen Einzel- oder Gruppensitzung begegneten und zum anderen, wenn ihr Fall in der wöchentlichen Teambesprechung mit Chefarzt auf den Tisch kam. Meist war die Therapiesitzung für mich die erste Begegnung, was noch dadurch befördert wurde, dass ich normalerweise nicht täglich in der Klinik war. Doch auch die Musiktherapeutin, Teresa Schlummer, lernte viele ihrer Patienten erst im Musiktherapieraum kennen und beschäftigte sich erst dann näher mit den ärztlichen und psychologischen Befunden. Sie wollte so die persönliche Kontaktaufnahme möglichst von Krankheitsvermutungen oder –diagnosen und fachlichen Wertungen frei halten und sich unvoreingenommen einen eigenen Eindruck verschaffen. Doch meist blieb auch, nachdem man die Patienten schon ein wenig kannte, ein Spannungsverhältnis zwischen diesen so unterschiedlichen Perspektiven bestehen. Das ging so weit, dass ich manchmal die in der Visite besprochene Person während der musiktherapeutischen Begegnung nicht wiederzuerkennen glaubte. Diese Ambivalenz zwischen Diagnose und persönlichem Eindruck, die mir eine für unsere Profession wichtige Erfahrung zu sein scheint, möchte ich an folgendem Fall veranschaulichen:
Hannes*, ein kleiner untersetzter Junge von 13 Jahren mit starker Brille, kurzen struppigen Haaren und tarnfarbener Bundeswehrhose kommt in die Trommelgruppe. Er wirkt auf mich im ersten Moment etwas begriffsstutzig. Seine Körperhaltung und Mimik sind wie „heruntergefahren“, er hat die Hände viel in den Hosentaschen und spricht einsilbig, eher leise und mit wenig Melodie. Doch im Laufe der Trommelstunde überrascht Hannes mich. Nicht nur, dass er im rhythmischen Tun erkennbar auftaut, er lässt auch eine kleine Bemerkung fallen, die ausgesprochen schlagfertig und witzig ist. Und als wir mit Trommeln im Kreis sitzen, kann man sehen, dass Hannes sich hier ganz zu Hause fühlt. Er trommelt gut, mit fast schon lässiger Geste.
Am selben Tag ist „Visite“, womit nicht nur die wöchentliche Runde des Chefarztes und seiner KollegInnen durch eine Station gemeint ist, sondern auch die anschließende Teambesprechung, an der auch die Fachtherapeuten zu mehreren Kollegen teilzunehmen pflegen. Der Ablauf ist immer ähnlich: Prof. Dr. (..., der Chefarzt, greift in den Aktenwagen, ruft den Namen des Patienten in die Runde und eröffnet so die Besprechung des Falles. Da die meisten Teilnehmer der Besprechung schon beim Rundgang dabei waren, haben sie die fragliche Person frisch vor Augen, und es gibt zu den aktenkundigen Informationen auch eine aktuelle Befindlichkeit. Diese wird ebenso thematisiert wie die aktuellen Befunde der medizinischen oder psychologischen Abteilung aus Diagnostik und Therapie, Berichte von Elterngesprächen, Rückmeldungen der Fachtherapeuten oder auch mal einer Lehrerin. Nach mal mehr, mal weniger ausführlicher Diskussion wird vom Chefarzt beschlossen, wie die Behandlung weitergehen soll.
Hannes ist Bewohner der Station für ältere Kinder, K2. Aus der Besprechung seines Falles notiere ich mir an diesem Tag einige Stichworte: „Hat Schwierigkeiten in Gruppen, kann sich nicht abgrenzen, kann sich nicht einschätzen, ‚verpeilt’, sprachlich schwach, ‚wie unter einer Glocke’. Ist er überfordert? Autistoid? Unsicher, weil er wenig gelernt hat?“
Im Laufe der Wochen wird das Bild, das die Visiten von Hannes zeichnen, schärfer. Nach eingehender Diagnostik wird die Autismus-Vermutung fallen gelassen. Ich erfahre, dass Hannes sich gerne zurückzieht und die Gesellschaft anderer Kinder nicht sucht. In den Trommelstunden fügt er sich hingegen scheinbar mühelos ein, spielt gruppendienlich und fällt hin und wieder mit schlagfertigen Bemerkungen aus seiner sonst wortkargen Rolle.
Ich erfahre, dass Hannes sehr unter der labilen Beziehung zu seiner Mutter leide, die schwer depressiv und suizidgefährdet sei.
Nach einer etwas längeren Pause im Praktikum erfahre ich, dass Hannes‘ Mutter sich am letzten Wochenende das Leben genommen hat. Erschüttert über dieses Ereignis wende ich mich an die Musiktherapeutin, Frau Schlummer, und frage sie, ob nicht die Musiktherapie etwas für Hannes tun könne. Sie sagt dazu, sie wolle abwarten, ob er ein dahingehendes Bedürfnis zeige. Ansonsten werde sie ihn mit dem Thema in Ruhe lassen. Seine Betreuung auf der Station werde den Notwendigkeiten angepasst.
Als Hannes kurz darauf das nächste Mal in die Trommelgruppe kommt, beginne ich erst zu verstehen, wie sie das meint: Nichts in seinem Verhalten lässt ahnen, was ihm zwischenzeitlich widerfahren ist. Er beteiligt sich rege, geht in Kontakt zur Gruppenleitung und zur Gruppe, erlaubt sich sogar ein paar Albernheiten. Nimmt er hier die Chance einer Auszeit wahr? Es hat ganz den Anschein.
Hannes‘ Geschichte an der KJPP ging noch ein wenig weiter. Bis er entlassen werden konnte, registrierte ich noch einige Schilderungen des Betreungspersonals, wonach er durchaus angemessene Reaktionen der Trauer und Verzweiflung zeigen konnte und dies auch tat. Doch auch unsere eigenen Erfahrungen mit ihm aus den Trommelstunden, wo er lebhaft, gewitzt und integriert gewirkt hatte, standen am Ende nicht mehr im Gegensatz zur Wahrnehmung der Ärzte und Psychologen: Autismus, Depression, Suizidgefahr – die schwerwiegenden Anfangsvermutungen – konnten im Verlaufe seines Aufenthaltes zurückgenommen werden.
Hannes wurde bis zuletzt vielschichtig und intensiv betreut. Von Seite der Klinik wurden die ihn stützenden Personen seines persönlichen Umfeldes, vor allem sein Vater, beraten und vernetzt. Es wurde ihm geholfen, den Abschied von seiner Mutter in einer für ihn körperlich und seelisch verkraftbaren Weise mit zu vollziehen. Und schließlich wurde eine Betreuungsform gesucht und gefunden, die ihm für die kommende Zeit eine Lebens- und Lernperspektive bieten konnte. Als Hannes nach mehrmonatigem Aufenthalt von der KJPP in die Obhut seines Vaters und einer betreuten Wohngruppe übergeben werden konnte, war sein Leben ein völlig anderes als zuvor. Doch er hatte den endgültigen Verlust seiner Mutter in einer Umgebung erlitten, die ihn schützte, die für ihn sorgte und ihm frohe Momente ermöglichte und die im Hintergrund darauf hinwirkte, dass sein Leben in verantwortlichen Bahnen weiter gehen konnte.
Auch die Wahrnehmung des Patienten und der Person Hannes hat im Laufe seiner Betreuung eine gewaltige Veränderung durchlaufen. Ähnlich wie den Ärzten und Psychologen, die anfangs Hannes’ kommunikative und lebenszugewandte Seite anscheinend nicht bemerkt hatten, war es auch der Musiktherapeutin und mir ergangen: Der Hannes, den wir in den Trommelstunden erlebten, schien nicht nur „ein anderer“ als der, der uns zunächst in den Visiten vorgestellt wurde. Unser Blick konnte in den relativ kurzen Momenten der Begegnung auch nicht das Drama umfassen, das sich in und um diesen Jungen abspielte. Für uns war es also wichtig, darüber aufgeklärt zu werden, denn es hätte auch sein können, dass er die Stunden im Musikraum für etwas anderes gebraucht hätte als eine Auszeit.
Ich habe eingangs von zwei unterschiedlichen, mitunter gegensätzlich scheinenden Perspektiven gesprochen. Natürlich gibt es in einer Einrichtung dieser Größe nicht nur zwei, sondern mehr. Doch das Erlebnis dieses Gegensatzes zweier Perspektiven hat mir nachdrücklich gezeigt, wie ausschnitthaft – und damit begrenzt – jede Wahrnehmung für sich genommen sein kann, und wie wichtig es ist, sich für andere Möglichkeiten zu interessieren. Schnelle Urteile, ganz gleich, ob in der Musiktherapiestunde oder bei der Visite gefällt, werden allzu leicht von einer neuen „Wirklichkeit“ über den Haufen geworfen (siehe auch Diskussion in Kapitel 8).
Neben Hannes habe ich noch etwa ein Dutzend weitere PatientInnen kennen gelernt, manche näher, andere weniger nah. Bestimmte Krankheitsdiagnosen bzw. Einweisungsgründe traten dabei vermehrt in Erscheinung. Bei den Mädchen waren es (besonders häufig) Essstörungen, außerdem Zwangsstörungen und Selbstverletzendes Verhalten. Bei den Jungen häuften sich die Befunde Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Störung des Sozialverhaltens, Verdacht auf Autismus oder Mutismus und Angststörungen. Nach Geschlechtern ähnlich häufige Einweisungsgründe schienen Depressive Störungen, „Schulabsentismus“ und Suchterkrankung zu sein. (Diese Schilderung folgt allein meiner subjektiven Wahrnehmung. Eine Auskunft der Klinik zur Häufigkeit von Einweisungsgründen und Diagnosen konnte mir auf Nachfrage nicht gegeben werden.)
Wie im Einleitungskapitel schon erwähnt, gehören Angststörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen und Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen (ADHS) zu den häufigsten Diagnosen bei Kindern und Jugendlichen. Baierl[18] beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendliche in dieser Lebensphase mindestens einmal depressiv werden mit 12 % für die Jungen und 20 % für die Mädchen. Damit seien zu einem beliebigen Messzeitpunkt zwischen 4 % und 8 % der Jugendlichen als depressiv einzustufen.
[...]
[1] KiGGS-Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen des Robert-Koch-Institutes von 2006, zitiert nach: http://www.bptk.de/presse/zahlen-fakten.html)
[2] Bolay u. a., in: Schulte-Markwort & Resch 2008, 90
[3] Baierl 2008, 16
[4] Manfred Dworschak in: DER SPIEGEL 15/2010, „Helden auf Bewährung“
[5] Baierl 2008, 17
[6] http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheit
[7] http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_statistische_Klassifikation_der_Krankheiten_und_verwandter_Gesundheitsprobleme
[8] Anmerkung UG: Krankheitsbezeichnungen und diagnostische Begriffe sind in dieser Arbeit durch Kursivschrift kenntlich gemacht, sofern es sich um Bezeichnungen analog ICD-10 handelt – umgangssprachliche Bezeichnungen dagegen nicht. Auf die Angabe von diagnostischen Kennziffern wird dagegen verzichtet.
[9] Vgl. Baierl 2008, 25 ff.
[10] Remschmidt 2011, 105 f.
[11] http://de.wikipedia.org/wiki/Kinder-_und_Jugendpsychiatrie_und_-psychotherapie
[12] http://dejure.org/gesetze/BGB/1631b.html
[13] Baierl 2008, 102 f.
[14] Siehe Anhang, S. 85
[15] Alle direkten Hinweise auf die Institution und ihr Personal wurden auf Wunsch der Klinikleitung vor Veröffentlichung anonymisiert. Die Musiktherapeutin war davon ausdrücklich ausgenommen.
[16] Selbstdarstellung der Klinik im Internet
[17] N.N. (Ärztliche Leitung): „Konzept für die kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und Behandlung in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie der Städtischen Kliniken in (…).“
(Internes Papier)
* Alle Patientennamen in dieser Arbeit sind geändert.
[18] Baierl 2008, 187
- Arbeit zitieren
- Ulf Grebe (Autor:in), 2012, Musiktherapie in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209370
Kostenlos Autor werden










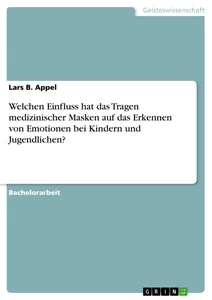









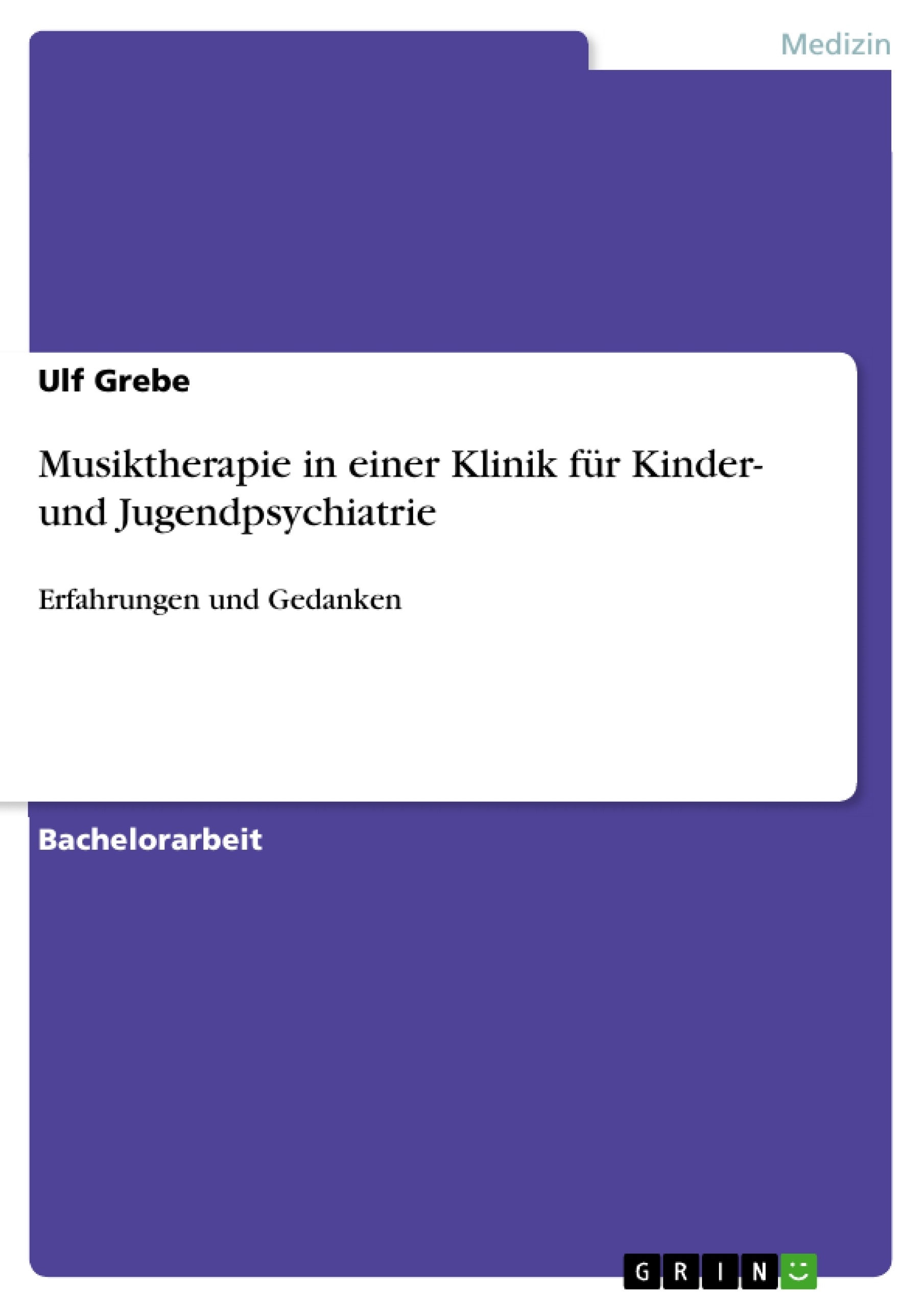

Kommentare