Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
TABELLENVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
1 PROBLEMSTELLUNG
2 ZUR THEORIE DER INKLUSION
2.1 Spezifische Aspekte zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen
2.1.1 Definitionen der Begrifflichkeiten
2.1.1.1 Behinderung
Definition von Behinderung
Neues Verständnis von Behinderung
2.1.1.2 Integration
2.1.1.3 Inklusion
2.2 Gegenüberstellung von Integration und Inklusion
2.3 Geschichtlicher Hintergrund der Inklusion
2.3.1 Überblick der historischen Entwicklung der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderungen
2.3.2 Von der Exklusion zur Inklusion – ein kurzer Abriss
2.3.3 Vom Versehrtensport zu inkludierten Sportgruppen
2.4 Inklusion im Sport
2.4.1 Inkludierter Schulsport und Vereinssport
2.4.1.1 Ausgewählte Aspekte zum Schulsport
Der Schulsport in Thüringen
Sportunterricht und seine Bedingungen
Inkludierter Sportunterricht
Voraussetzungen für inkludierten Unterricht
2.4.1.2 Ausgewählte Aspekte zum Vereinssport
Der Sportverein
2.4.1.3 Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen in Sportvereinen
Zur Bedeutung von Vereinssport für Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen
Zur Problematik von Freizeit bei Kindern und Jugendlichen ohne Behinderungen
2.4.1.4 Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Sportvereinen
Zur Bedeutung des Sportvereins für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
Vorstellung ausgewählter Projekte und Studien
Zur Problematik von Freizeit bei Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen
2.5 Inklusion im Sport unter Berücksichtigung der UN-Behindertenrechts-konvention
2.5.1 Die UN-Behindertenrechtskonvention
2.5.2 Spezifische Aspekte zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
2.5.3 Sport im Fokus der UN-Behindertenrechtskonvention
2.6 Spezifische Fragestellung
3 Methodik
3.1 Untersuchungsverfahren
3.2 Untersuchungspersonen
3.3 Untersuchungsdurchführung
3.4 Untersuchungsauswertung
4 DARSTELLUNG, INTERPRETATION UND DISKUSSION DER ERGEBNISSE
4.1 Einstellung der Lehrkräfte zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
4.1.1 Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber der Inklusion von Menschen mit Behinderungen
4.1.2 Einstellungen der Lehrkräfte unter Berücksichtigung der Art der Behinderung
4.1.3 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Lehrkräfte
4.1.4 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Lehrkräfte
4.1.5 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen zwischen Lehrkräften in Primarstufe, Sekundarstufe und Sonderschulen
4.1.6 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften in der Primarstufe, Sekundarstufe und Sonderschulen
4.1.7 Vergleich der Einstellung zu SuS mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sekundarstufe
4.1.8 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sonderschule
4.1.9 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften in der Sekundarstufe und Sonderschule
4.1.10 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften mit und ohne Berufserfahrung
4.1.11 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften mit und ohne Inklusionserfahrung
4.1.12 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention
4.1.13 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Lehrkräften mit und ohne Kontakte(n) im privaten Bereich
4.1.14 Kommentare zum inkludierten Sport an Schulen
4.2 Einstellungen der Lehrkräfte zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen
4.2.1 Einstellungen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter gegenüber der Inklusion von Menschen mit Behinderungen
4.2.2 Einstellungen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter unter Berücksichtigung der Art der Behinderung
4.2.3 Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körperbehinderungen gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Übungsleiterinnen und Übungsleiter
4.2.4 Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Lernbehinderungen gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Übungsleiterinnen und Übungsleiter
4.2.5 Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Berufserfahrung
4.2.6 Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Inklusionserfahrung
4.2.7 Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper-und Lernbehinderungen zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention
4.2.8 Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper- und Lernbehinderungen zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kontakte(n) im privaten Bereich
4.2.9 Kommentare zum inkludierten Sport in Vereinen
5 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
LITERATUR
INTERNETQUELLEN
WEITERFÜHRENDE LITERATUR
ANHANG
TABELLENVERZEICHNIS
Tab. 2.1.1: Zusammenfassung ICDH und ICF (ICF, 2005, S. 5)
Tab. 2.2.1: Gegenüberstellung Integration und Inklusion (In Anlehnung an Hinz, 2002, S. 359)
Tab. 2.4.1: Überblick über die Freizeitbedürfnisse und deren Einschränkung bei Menschen mit Behinderungen (In Anlehnung an Markowetz, 2007, S. 338)
Tab. 3.2.1: Verteilung der Befragten hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen
Tab. 3.2.2: Verteilung der Lehrkräfte nach Schulart/Tätigkeitsfeld und Ausbildung im Sport
Tab. 3.2.3: Verteilung und Art der Lizenzen bei Übungsleiterinnen und Übungsleitern
Tab. 3.2.4: Angabe der Sportarten, die in den Vereinen betrieben werden
Tab. 4.1.1: Einstellungen der Lehrkräfte gegenüber der Inklusion von Menschen mit Behinderungen ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.2: Einstellungen der Lehrkräfte unter Berücksichtigung der Art der Behinderung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.3: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz (SK) der Lehrkräfte ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.4: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz (SK) der Lehrkräfte ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.5: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Lehrkräften in Primarstufe, Sekundarstufe und Sonderschulen ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.6: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Primarstufe, Sekundarstufe und Sonderschulen ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.7: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sekundarstufe ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.8: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sonderschule ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.9: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Sekundarstufe und Sonderschule ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.10: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Berufserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.11: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Inklusionserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.12: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.1.13: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Kontakte(n) im privaten Bereich ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.1: Einstellungen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter gegenüber der Inklusion von Menschen mit Behinderungen ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.2: Einstellungen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter unter Berücksichtigung der Art der Behinderung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.3: Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körperbehinderungen (GK) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Übungsleiterinnen und Übungsleiter ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.4: Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Lernbehinderungen (GL) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Übungsleiterinnen und Übungsleiter ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.5: Vergleich der Einstellungen KuJ mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit und ohne Berufserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.6: Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Inklusionserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.7: Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Tab. 4.2.8: Vergleich der Einstellungen zu KuJ mit Körper- (GK) und Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kontakte(n) im privaten Bereich ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Abb. 2.1.1: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (nach Brockhaus, 2006a, S. 498)
Abb. 2.4.1: Organisation des Sports an den Thüringer Regelschulen (In Anlehnung an den Thüringer Lehrplan für Regelschulen; Rusch, 1991, S. 80)
Abb. 2.4.2: Das Inklusionsdreieck (In Anlehnung an Hinz, 2010, S. 20)
Abb. 2.5.1: ICF-basiertes Teilhabemodell im Sport, angepasst von Anneken (2012, S. 140)
Abb. 3.2.1: Verteilung der befragten Lehrkräfte hinsichtlich ihrer Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen
Abb. 3.2.2: Verteilung der Übungsleiterinnen und Übungsleiter hinsichtlich ihrer Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen
Abb. 3.2.3:Verteilung der Lehrer nach Schultyp und Ausbildung
Abb. 3.2.4: Angabe der Sportarten, die in den Vereinen betrieben werden
Abb. 4.1.1: Einstellungen der Lehrkräfte in der Gesamtgruppe ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.2: Einstellungen der Lehrkräfte unter Berücksichtigung der Art der Behinderung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.3: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Lehrkräfte ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.4: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Lehrkräfte ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.5: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen(GK) zwischen Lehrkräften in Primarstufe, Sekundarstufe und Sonderschulen ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.6: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Primarstufe, Sekundarstufe und Sonderschulen ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.7: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sekundarstufe ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.8: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sekundarstufe ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.9: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK)zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sonderschule ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.10: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL)zwischen Lehrkräften in der Primarstufe und Sonderschule ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.11: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Lehrkräften in der Sekundarstufe und Sonderschule ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.12: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften in der Sekundarstufe und Sonderschule ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.13: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK)zwischen Lehrkräften mit und ohne Berufserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.14 Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Berufserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.15: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Lehrkräften mit und ohne Inklusionserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.16: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Inklusionserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.17: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Lehrkräften mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.18: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.19: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Lehrkräften mit und ohne Kontakten im privaten Bereich ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.1.20: Vergleich der Einstellungen zu SuS mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Lehrkräften mit und ohne Kontakten im privaten Bereich ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.1: Einstellungen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter in der Gesamtgruppe ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.2: Einstellungen der Übungsleiterinnen und Übungsleiter unter Berücksichtigung der Art der Behinderung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.3: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen (GK)gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Übungsleiterinnen und Übungsleiter ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.4: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen (GL) gegenüber der wahrgenommenen Selbstkompetenz der Übungsleiterinnen und Übungsleiter ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.5: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen (GK)zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit und ohne Berufserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.6: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit und ohne Berufserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.7: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Inklusionserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.8: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Inklusionserfahrung ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.9: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.10: Vergleich der Einstellungen zu Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kenntnis über die UN-Behindertenrechtskonvention ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.11: Vergleich der Einstellungen Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen (GK) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kontakten im privaten Bereich ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
Abb. 4.2.12: Vergleich der Einstellungen Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen (GL) zwischen Übungsleiterinnen und Übungsleitern mit und ohne Kontakten im privaten Bereich ('1 = trifft zu' bis '3 = trifft nicht zu')
1 PROBLEMSTELLUNG
„Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein; sie muß zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen“ (Goethe J.-W., Maxime und Reflexionen, 1833)
Dieses Zitat aus “Maximen und Reflexionen“ von Johann Wolfgang Goethe soll verdeutlichen, was Inklusion bedeutet. Ungleichheit gibt es zur Genüge in jeder Gesellschaft. Das Ziel jedoch ist, die Verschiedenheit in der Gesellschaft anzuerkennen und gleichzeitig die Bedingung für eine gleichberechtigte Teilhabe aller zu erreichen. Das ist Inklusion.
Um diese Vision populärer zu machen, tourte die “Aktion Mensch“ bis Anfang Oktober 2012 durch insgesamt 15 deutsche Städte. Das Projekt wurde nicht nur von zahlreichen Inklusionsexperten, Bürgermeistern und Ministern unterstützt. Auch Andreas Bourani, ein bekannter Musiker, beteiligte sich durch ehrenamtliches Engagement an der Aktion. Er trat im Rahmen der Tour dreimal auf und drehte während der sechs Wochen dauernden Städtetour auch das Musikvideo zu seinem Lied “Wunder“. An diesem inkludierten Musikvideo wirkten über 1000 Menschen mit, es wurde in Gebärdensprache übersetzt, im Fernsehen ausgestrahlt und ist auf der Homepage von “Aktion Mensch“ zu finden. Durch das Engagement vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer konnte die Tour weitere 15.000 Unterstützer für die Idee der Inklusion gewinnen (vgl. Aktion Mensch, 2012a).
Auch Thüringen war ein Anlaufpunkt der Städtetour. In Erfurt nahmen 500 Zuschauer an dieser Aktion teil. Es stellte sich heraus, dass sich die Landeshauptstadt Thüringens bereits 2002 der “Erklärung Barcelona“ und damit der Erklärung für eine barrierefreie Stadt anschloss. Jedoch wird seitens der Unterstützer dieser Erklärung eingestanden, dass es bis zu ihrer vollständigen Umsetzung noch ein weiter Weg sein wird. Besonders im Bereich Schule existieren noch große Hürden, die es zu überwinden gilt.
Inklusion beginnt in den Köpfen der Menschen und sollte daher in allen Orten, ob Großstadt oder Dorf, gefördert werden. Um den Gedanken der Inklusion auch im Bereich der Arbeit zu etablieren, startet die “Aktion Mensch“ einen Wettbewerb, der es sich zum Ziel setzt, große und kleine Betriebe für einen inkludierten Weg zu gewinnen (vgl. Aktion Mensch, 2012b).
Mit dem Wissen, dass Inklusion noch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft umgesetzt wird und auch noch nicht werden kann, setzt sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema Inklusion im Sport auseinander. Ein Fokus liegt dabei auf der Betrachtung der Möglichkeiten zur Veränderung der sozialen Reaktion gegenüber Kindern und Jugendlichen (KuJ) mit Behinderung mithilfe von Sport. Es bietet sich an, gerade die Lebenswirklichkeit von KuJ zu betrachten, denn in dieser Lebensphase werden wichtige Weichen im Bezug auf die Inklusion auch im Erwachsenenalter gestellt.
Doch zunächst widmet sich die vorliegende Arbeit der Definition der grundlegenden Begriffe, um ein verbindliches und einheitliches Fundament für die folgende Untersuchung zu legen. Im Anschluss wird der geschichtliche Hintergrund der Inklusion näher betrachtet. Ein Fokus liegt hierbei auf der Entwicklung im organisierten Sport, der sich aus Schul- und Vereinssport zusammensetzt. Wie Inklusion an Schulen und in Vereinen umgesetzt wird, wird im anschließenden Abschnitt dargestellt. Den Abschluss des theoretischen Teils bilden Ausführungen zur UN-Behindertenrechtskonvention. Diese wird zunächst vorgestellt, um im Anschluss den aktuellen Stand ihrer Umsetzung anhand von Beispielen im Bereich Sport und Schule zu veranschaulichen.
Im Methodikteil werden die der Untersuchung zugrunde liegenden Personen, Verfahren sowie deren Durchführung und Auswertung vorgestellt. Grundlage der Untersuchung ist ein selbst erstellter Fragebogen, mit dessen Hilfe Lehrkräfte und Übungsleiterinnen und Übungsleiter hinsichtlich ihrer Einstellungen und Erfahrungen zum Thema Inklusion im Sport befragt wurden. Dabei konnte angenommen werden, dass ein Großteil sich zurückhaltend bis negativ zur Inklusion äußert, da die Grundstrukturen, Materialien, finanzielle Mittel oder die erforderlichen Ausbildungen zur Umsetzung der Idee der Inklusion in den betroffenen Bereichen oft nicht vorhanden sind.
Das darauffolgende Kapitel widmet sich der Darstellung, Interpretation und Diskussion der Untersuchungsergebnisse, bevor eine abschließende Betrachtung und Ausblick die vorliegende Arbeit abrunden.
2 ZUR THEORIE DER INKLUSION
2.1 Spezifische Aspekte zur Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen
2.1.1 Definitionen der Begrifflichkeiten
Die Vorgehensweise zur Erläuterung der Begrifflichkeiten vollzieht sich in zwei Schritten. Zunächst findet die Enzyklopädie von Brockhaus Anwendung, anschließend wird die Fachliteratur hinzugezogen. Zunächst wird der Begriff Behinderung definiert, danach die Begrifflichkeiten Integration und Inklusion konkretisiert sowie im Anschluss durch eine Gegenüberstellung voneinander differenziert. Für die vorliegende Arbeit ist die Definition dieser Termini unerlässlich, legen sie schließlich das Grundlagenwissen, auf dem sie sich stützt.
2.1.1.1 Behinderung
Bei der Frage nach der Definition des Begriffs Behinderung sollte überprüft werden, ob diese zu einem besseren Verständnis von Menschen mit Behinderung führt oder ob sie das Verhältnis und die Einstellung gegenüber dieser Personengruppe eher negativ beeinflusst. Zum einen kann die genaue Bestimmung von einzelnen Arten der Behinderungen als Orientierung für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen dienen. So ist es beispielsweise von Vorteil, wenn Personen, die ehrenamtlich (z.B. Trainer, Betreuer für Ferienfreizeiten) oder beruflich (Physiotherapeut, Lehrer) mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, über diese Kenntnisse verfügen. Zum anderen kann eine kategoriale Einstufung von Menschen dazu führen, dass schon im Vorfeld ein Denken in Schubladen aufgebaut und diesen Menschen so von Beginn an mit Voreingenommenheit gegenüber gestanden wird (vgl. Rheker, 1993, S. 17).
Brockhaus unterteilt den Ausdruck in zwei Unterpunkte: „Definition von Behinderung […] [und] Neues Verständnis von Behinderung.“ (Brockhaus, 2006a, S. 497)
Demnach sind
„Behinderte, Menschen, die in ihren phys., intellektuellen und psych. Funktionsfähigkeiten nicht nur vorübergehend beeinträchtigt sind und einen individuell spezif. Unterstützungsbedarf haben, um selbstbestimmt und gleichberechtigt am Leben der Gesellschaft teilhaben zu können. Die rechtl. Feststellung von Behinderung erfolgt in Dtl. durch die Versorgungsämter.“ (Brockhaus, 2006a, S. 497)
Definition von Behinderung
Leider gibt es laut Aussage der Brockhaus Enzyklopädie keine allgemein verbindliche und wissenschaftlich festgelegte Definition von Behinderung. Begründet wird dies durch die verschiedenen sozialen, kulturellen, medizinischen, historischen und politischen Zusammenhänge, welche den Begriff durch unterschiedliche Perspektiven definieren. Jedoch hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen Versuch unternommen, eine allgemeingültige Definition aufzustellen. Im Jahre 1980 veröffentlichte sie die ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), welche von den einzelnen Mitgliedstaaten übernommen wurde. Die ICIDH definiert als eine Behinderung für einen Menschen, „wenn eine Schädigung (engl. Impairment) festgestellt wird, aus der sich eine Fähigkeitsstörung (Disability) ergibt, die zu einer Beeinträchtigung (Handicap) bei der Lebensgestaltung führt“ (Brockhaus, 2006a, S. 497).
Durch dieses Handicap kann die betroffene Person eine gesellschaftliche Benachteiligung erfahren, welche im schlimmsten Fall die Isolation des Menschen zur Folge hat.
Neues Verständnis von Behinderung
Durch ein Umdenken weg von dem Krankheitsfolgemodell hin zum bio-psycho-sozialen Modell von Krankheit und Gesundheit stehen nun nicht mehr die Schädigungen im Vordergrund, sondern die Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung nehmen ihren Platz ein. Somit entstand 2001 eine neue Klassifikation mit dem Namen ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Diese beruht auf der Erkenntnis, dass jegliche Umstände einer Person und seiner Umwelt einbezogen werden müssen, um den Begriff Behinderung zu verstehen.
In der folgenden Skizze werden die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF verdeutlicht:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1.1: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (nach Brockhaus, 2006a, S. 498)
Anhand dieser Darstellung erkennt man die Zusammenhänge der einzelnen Faktoren für das Verständnis von Behinderung. Das neue Verständnis von Menschen mit Behinderung geht nun
„[…] prinzipiell von Menschen als handelnden Subjekten aus, die die Chance und das Recht zur Teilhabe (Partizipation) an relevanten Bereichen ihrer Gesellschaft und ihrer Umwelt haben. […] Eine Behinderung wird nach der ICF-Definition als Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit verstanden. Unterschieden werden dabei Beeinträchtigungen in drei Bereichen:
1. Funktion (z.B. geistig/seel., sensor. Funktionen) und Struktur (z.B. des Nervensystems, der Augen und Ohren des menschl. Organismus);
2. Tätigkeiten (Aktivitäten) aller Art (z. B. Lernen und Wissensanwendung, Kommunikation, Mobilität);
3. Partizipation (Teilhabe) an unterschiedl. Lebensbereichen (z.B. persönl. Versorgung, soziale Beziehungen, Bildung und Ausbildung, Erwerbsarbeit, soziales und staatsbürgerliches Leben).“ (Brockhaus, 2006a, S. 497f.)
Zugunsten einer kurzen und übersichtlichen Darstellung werden in der folgenden Tabelle die Unterschiede zwischen den Konzepten von ICIDH und ICF zusammengefasst.
Tab. 2.1.1: Zusammenfassung ICDH und ICF (ICF, 2005, S. 5)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im Verlauf dieser Arbeit wird ausschließlich die Definition von Behinderung aus den Richtlinien der UN-Behindertenrechtskonvention genutzt. Im „Übereinkommen der Vereinen Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“ wird im Artikel 1 folgende Bestimmung festgehalten:
„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“ (Hüppe, 2010, S. 12)
Die Bezeichnung „Menschen mit einer Behinderung“ löst den Begriff „Behinderte“ ab und stellt so das Individuum in den Mittelpunkt (vgl. Doll-Tepper, 2002, S. 17). Auch Rheker (1993, S. 22) stellt die Forderung, dass der Begriff „Behinderte“ aus folgenden Gründen keine Verwendung findet. Zum einen existiert eine große Vielfalt von Behinderungstypen, bei der jeder einzelne wiederum verschieden ausgeprägt ist. Zum anderen beinhaltet der Begriff eine Charakterisierung und Gruppierung in eine bestimmte Richtung, was die Isolierung von Menschen mit Behinderungen fördert. Man sollte sich bewusst machen, dass eine Behinderung nur einen geringen Teil des Individuums selbst ausmacht.
2.1.1.2 Integration
Laut Brockhaus ist Integration Im Allgemeinen die „(Wieder-)Herstellung einer Einheit; Einbeziehung in ein größeres Ganzes“ (Brockhaus, 2006c, S. 370). Neben der allgemeinen Definition findet eine weitere Differenzierung in den Bereichen Mathematik, Molekulargenetik, Philosophie, Psychologie, Soziologie und Wirtschaft statt. Wichtig für diese Arbeit ist die Definition in der Soziologie:
„Bez. 1) für eine gesellschaftl. Prozess, der durch einen hohen Grad harmon., konfliktfreier Zueinanderordnung der versch. Elemente (Rollen, Gruppen, Organisationen) sowohl in horizontaler (arbeitsteiliger, funktionsspezialisierter) als auch vertikaler (herrschafts-, schichtenmäßiger) Hinsicht gekennzeichnet ist, sowie 2) für Prozesse der bewusstseinsmäßigen oder erzieher. Eingliederung von Personen und Gruppen in oder ihrer Anpassung an allgemein verbindl. Wert- und Handlungsmuster. Der Grad der I. bestimmt das Ausmaß des Konsens‘ der Gesellschafts-Mitgl. Aber die gemeinsamen Ordnungsprinzipien und damit die gesellschaftl. Stabilität. Totale I. bedeutet ein »Einfrieren« des gesellschaftl. Status quo und eine Unfähigkeit zu Wandel und Anpassung. Zu geringe I. gefährdet bes. in Industriegesellschaften den empfindl. Funktionszusammenhang komplexer gesellschaftl. Reproduktionsbedingungen.“ (Brockhaus, 2006c, S. 370f.)
Zudem interessant ist auch die Definition von Integrationspädagogik, die unkommentiert wie folgt bestimmt wird.
„Integrationspädagogik, Teilgebiet der Pädagogik, das sich in Theorie und Praxis mit der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern, insbes. in Kindergarten und Schule, beschäftigt. Integrationsklassen bestehen v.a. an Grundschule, i.d.R. sind zwei Lehrer (Grundschullehrer und Sonderschullehrer oder Erzieher) anwesend. Die räuml. Gestaltung der Schule, v.a. der Klassenzimmer, und die Unterrichtsmethoden müssen an die Bedürfnisse der Behinderten angepasst werden.“ (Brockhaus, 2006c, S. 371)
Laut Semmerling (2004, S. 740) werden durch den Begriff der Integration „inhaltliche Probleme gesellschaftlicher Entwicklung aufgenommen, und in ihren Voraussetzungen, Auswirkungen und Lösungsmöglichkeiten für Bildungsprozesse untersucht“. Im Bezug auf das derzeitige Schulsystem kommt er zu der Erkenntnis, dass „Differenzierung und Integration […] als wechselwirksam miteinander verbundene Prinzipien gesehen [werden]; der Integration wird insgesamt die regulative Funktion zugedacht“ (Semmerling, 2008, S. 741). Weiterhin findet sich dort ausführlich die „historische Grundlegung […] [und] die Integration als konstritutives Regulativ der Theorientwicklung in der Didaktik“ (Semmerling, 2004, S. 742-749) wiedergegeben.
Für den Sport heißt Integration das Eingliedern eines Sportlers/Mitglieds in eine/n Mannschaft/Verein. Dabei gibt es unterschiedliche Organisationsformen wie der Integrationssport in Regelschulen, Sportvereine für Menschen mit Behinderungen und Vereine für Menschen ohne Behinderungen (vgl. Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S. 19).
Weis deutet auf das integrative Spannungsfeld zwischen Sporttreiben und Wettkampf hin, wenn er sagt: „Sport mag integrieren, Wettkampf trennt dabei geleichzeitig desto stärker, je ernster er genommen wird“ (Weis, 2003, S.271).
2.1.1.3 Inklusion
Um diesen Begriff eindeutig zu bestimmen, hilft die Brockhaus Enzyklopädie eher wenig mit der Definition „[lat. »Einschließung«, »Einsperrung«] die, -/-en, die Relation des Enthaltenseins, v.a. in der Mengenlehre gebräuchlich […]“ (Brockhaus, 2006c, S. 305f.) und bietet eine allgemeine und recht eindeutige Bestimmung des Begriffes. Das „Lexikon zur Soziologie“ hingegen untergliedert Inklusion wie folgt:
„[1] In der sozialwissenschaftlichen Systemtheorie die Einbeziehung einer größeren Zahl von Einheiten (Personen, soziale Rollen, soziale Mechanismen) in spezifische Funktionskreise, wie sie im Prozess der funktionalen Ausdifferenzierung sozialer Systeme erforderlich wird. In T. Parsons` Theorie […] gilt I. als einer der Aspekte des Entwicklungsprozesses, besonders der modernen Gesellschaften.
[2] Ein differenzierungstheoretisches Konzept für die Teilhabe von Personen an gesellschaftlichen Teilsystemen. Die Lebensführung der Personen in der modernen Gesellschaft ist durch eine rollenförmige multiple Partialinklusion in die verschiedenen Teilsysteme (u.a. Wirtschaft, Bildung, Massenmedien, Sport, Familie) gekennzeichnet.“ (Fuchs-Heinritz, 2011, S. 306.)
Schaut man nun in den Bereich der Pädagogik, wird der Begriff wie folgt definiert:
„Inklusion [lat. »Einschluss«]: Über die Systemtheorie eingeführter Begriff, der die Einbeziehung von Personen in die funktional ausdifferenzierten Sozialsysteme bezeichnet. Den Funktionsprinzipien gemäß ist damit die Unterscheidung von Laien und Profession, also Schüler/Lehrender [Lernender] vs. Lehrer, Klient vs. Arzt etc. verbunden. Ein- und Ausschluss (Exklusion) unterliegen selbst historisch-gesellschaftlichen Prozessen, wie z.B. bei der Ausgrenzung Behinderter aus dem Bildungssystem, oder generell, für die I. in Arbeitsverhältnissen sichtbar wird. Der Begriff der I. wird in der Handhabung der Differenz von I. und Exklusion deshalb auch zunehmend genutzt, um die Folgen funktionaler Differenzierung für Menschen und gesellschaftliche Strukturen sichtbar zu machen.“ (Tenorth & Tippelt, 2007, S. 338)
Das Inklusionskonzept selbst stellt allerdings keinen Teilbereich der Sonderpädagogik dar, vielmehr ist es ein Querschnittbereich der Erziehungswissenschaften. Dabei geht es von der Verschiedenheit des einzelnen Menschen aus, wodurch Heterogenität und Vielfalt mehr ein Gewinn für die Gesellschaft darstellt als eine Schwierigkeit, die bezwungen werden muss. Die Veränderung der Strukturen und Sichtweisen sind zwingend erforderlich, um jedem Individuum die erforderliche Hilfe und Förderung zu ermöglichen, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben (vgl. Doll-Tepper & Schmidt-Gotz, 2008, S. 363f.).
Booth nahm eine Untergliederung in drei Ebenen vor:
- Die Perspektive auf Teilhabe von Individuen,
- die Perspektive auf die Teilhabe an Systemen und
- die Perspektive auf die Teilhabe an Werten.“ (Hinz, 2010, S. 5)
2.2 Gegenüberstellung von Integration und Inklusion
„In der internationalen Diskussion ist der Begriff Integration durch Inklusion abgelöst worden. Dieser Begriffswandel markiert nicht nur einen Etikettenwechsel, sondern eine Ausweitung und Akzentverlagerung von der Einfügung in zu einer Veränderung des sozialen Ganzen selbst.“ (Hölter, 2008, S. 97)
Im vergangenen Kapitel wurde bereits der Unterschied zwischen der Integration und der Inklusion hervorgehoben. Jedoch ist dieser Unterschied nicht jedem bewusst, was dazu führen kann, beide Begriffe synonym zu gebrauchen, bzw. falsche Schlüsse aus einer falsch verstandenen Definition zu ziehen. So ist der Begriff Integration noch im heutigen gesellschaftlichen Diskurs stark von der Eingliederung von Immigranten besetzt, deutlich seltener dagegen im Bezug auf körperlich oder geistig beeinträchtigte Personen. Des Weiteren besitzt die Integrationsentwicklung viele qualitative und quantitative Probleme, die ein Umdenken in Richtung Inklusion zur Folge haben. Ein quantitatives Problem ist beispielsweise, dass gemeinschaftlicher Unterricht ein ergänzendes System blieb. Somit hat der gemeinschaftliche Unterricht zwar einen Platz im gegliederten Schulsystem bekommen, wirklich verschmolzen ist er mit ihm jedoch nicht. Ein weiteres Problem ist die finanzielle Förderung integrativer Maßnahmen von Inklusion, welche derzeit zu kurz kommt. Genau diesem Stillstand wirkt der Inklusionsgedanke mit folgenden Kernpunkten von Hinz entgegen und legt somit entscheidende Unterschiede zwischen den beiden Begriffen fest:
- „Menschen mit Behinderungen werden als Minderheit betrachtet und nicht mehr als ,functionally limited‘, gleichzeitig werden sie jedoch nicht mehr als abgegrenzte Gruppe gesehen.
- Nicht nur die Dimensionen mehr oder weniger behinderter Entwicklungsmöglichkeiten, sondern aller Dimensionen von Heterogenität sind hier im Blick: Neben der ability auch gender, ethnicity, nationality, first language, races, classes, religions, sexual orientation, physical conditions und andere mehr.
- Inklusion orientiert sich deutlich an der Bürgerrechtsbewegung, kämpft gegen jede Form von gesellschaftlicher Marginalisierung und vertritt die Vision einer inklusiven Gesellschaft. In dieser Betrachtung wird der Begriff Inklusion quasi übersetzt verwendet. Dies geschieht insofern bewusst, als alle bisherigen Übersetzungsversuche nicht haben überzeugen können. Weder ,einschließende‘ Pädagogik, die eher Assoziationen zum Gefängnis aufkommen lässt, noch eine einbeziehende Schule (Bierwer 2001, 277), die wiederum und weiterhin Außenstehende in etwas hineinzieht, führt hier weiter.“ (Hinz 2004, 46f.)
Da es in der Literatur immer wieder zu Überschneidungen der Begriffe der Inklusion und Integration gibt und einige Autoren diese Begriffe offenbar als gleicher ansehen und nutzen, soll die folgende abschließende Tabelle die Unterschiede deutlich machen:
Tab. 2.2.1: Gegenüberstellung Integration und Inklusion (In Anlehnung an Hinz, 2002, S. 359)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Integration versteht die Eingliederung einer kleinen in eine größere Gruppe. Somit muss sich die kleinere Gruppe der größeren anpassen, indem sie deren Regeln und Bedingungen übernimmt. Dadurch kann es passieren, dass diese überwiegend der Fremdbestimmung unterworfen ist. Die größere Gruppe ist aufgrund ihrer numerischen und anderweitigen Überlegenheit oft weniger bereit, sich ähnlich stark an der Integration der Minderheit zu beteiligen (vgl. Hüppe, 2012, S. 92).
Bei der Inklusion ändert sich die Gesellschaft dahingehend, dass individuelle Unterschiede zur Normalität gehören und somit jede Person anerkannt wird. Damit bekommt jeder Mensch die Chance auf ein freies und selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft. Durch die Barrierefreiheit aller Einrichtungen und Institutionen ist es überflüssig, diese in separierter Form anzubieten (vgl. Hüppe, 2012, S. 92).
Anzumerken ist, dass die Begriffe Integrationssport und integrativer Behindertensport nur im deutschen Sprachraum existent sind, dagegen in der internationalen Verkehrssprache integration, inclusion und sogar infusion im Bezug auf körperliche Ertüchtigung und Sport von Menschen mit Behinderungen verwendet wird (vgl. Doll-Tepper, 2002, S.20.). Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die internationale Diskussion den Inklusionsgedanken aufnimmt. Er nutzt die Integration optimiert ihre Gedanken und erweitert das Verständnis (vgl. Sander, 2003). Inklusion ist im Besitz eines Index, der Schulen klare Leitlinien gibt und international entwickelt, genutzt und angesehen wird (vgl. Boban & Hinz, 2003).
2.3 Geschichtlicher Hintergrund der Inklusion
Um den geschichtlichen Hintergrund der Inklusion plausibel darzustellen, teilt sich dieses Kapitel in drei Teile. Während sich der erste Abschnitt kurz mit der historischen Entwicklung der Gesellschaft auseinandersetzt und sich dabei mit der Frage beschäftigt, ob Menschen mit Behinderung schon immer ausgeschlossen waren, bzw. wieso sie ausgeschlossen wurden, beschäftigt, fokussiert der mittlere Teil in einem Abriss die Bedeutung und Wende von der Exklusion zur Inklusion. Der dritte Teil in diesem Kapitel wendet sich der Geschichte des Behindertensports zu, um Inklusion im Sport besser verstehen zu können. Hierbei tritt die Frage, warum es bis heute separate Vereine gibt, die ausschließlich Menschen mit oder ohne Behinderung aufnehmen, in den Blickpunkt.
2.3.1 Überblick der historischen Entwicklung der Gesellschaft zu Menschen mit Behinderungen
Die Bedeutung der geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft kulminiert in der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen mit Behinderung, obgleich geistiger oder körperlicher Art, als „minderwertig“ oder „Untermenschen“ eingestuft wurden, so dass man sie unter dem Deckmantel der Euthanasie ermordete. Erst aus dem Verständnis der Geschichte resultieren die Erkenntnisse, die auch für Betrachtungen der Inklusionen im Sport von großer Bedeutung sind.
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts herrschte überwiegend der sozialökonomische Haushalt, der sich komplett selbst versorgte. Jener bestand aus dem Hausherren, seiner Familie und dem Gesinde. Diese große Anzahl von Menschen unter einem Dach verlangte geordnete Verhältnisse. Jeder hatte Pflichten, denen er nachkommen musste, aber auch Rechte, die in dieser Kooperationsgemeinschaft bestanden. Der Großteil des Lebens spielte sich in diesem Haushalt ab. Aber was passierte hier mit einem Menschen mit Behinderung – einem Kind mit einer Behinderung oder einem von Demenz betroffenen Großelternteil beispielsweise? Da niemand von der Arbeit im Haushalt ausgeschlossen wurde, steuerten auch sie ihr Bestmögliches hinzu. Nun stellt sich jedoch die Frage, wer sich um sie kümmerte? Ohne Frage besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen stärkeren und schwächeren Menschen. Die Schwächeren sind auf die Stärkeren angewiesen und in der damaligen Gesellschaft wurde die Maxime der Fürsorge in einer Gemeinschaft gelebt. So war es selbstverständlich, dass die Stärkeren sich um ihre hilfebedürftigen Mitmenschen kümmerten.
Zur jener Zeit war „das menschliche Handeln eine raumzeitliche Einheit aus produzierender und sozialer Tätigkeit, aus dem Bearbeiten von Sachen und der sozialen Sorge um Menschen“ (Dörner, 1994, S. 370).
Aber auch Menschen mit Behinderung, die weder einer Arbeit nachgingen, noch in einem Haushalt eingegliedert waren, fühlte man sich solidarisch verbunden. Hier sprach man von „würdigen Armen“, wusste, dass sie keiner Arbeit nachgehen konnten und spendete daher gerne Almosen (vgl. Dörner, 1994, S. 370ff.).
Wie kam es nun, dass Menschen mit Behinderungen aus der Gemeinschaft verdrängt wurden und sie den Menschen ohne Beeinträchtigungen immer fremder und verstörter vorkamen?
Ein wahrscheinlicher Grund ist die Industrialisierung, das Zeitalter der Moderne zur Mitte des 18. Jahrhunderts. In diesem Zeitraum entwickelte sich das System der Kleinfamilie. Kurz umschrieben wurde die Arbeit aus den Haushalten in die Fabriken verlegt. Damit entfiel für Menschen mit Behinderung ein beträchtlicher Teil ihrer Betätigungsmöglichkeiten. Waren auch die Frauen berufstätig, verschärfte sich dieser Zustand weiter. Die Fürsorge hatte in vielen Familien nicht mehr genügend Platz – körperlich und geistig beeinträchtigte Personen wurden pflegebedürftiger und fingen aus damaliger Sicht an, eine Last für die moderne Gesellschaft zu werden. Aus dieser Problematik entstand die „Soziale Frage“, mit deren Lösung sich Professor Autenrieth an der Uni Tübingen beschäftigte. Er riet im Jahre 1806 dazu, die gleichmäßige Verteilung von psychisch Kranken über die Gesellschaft, beispielsweise in einer Pflegefamilie, vorzunehmen. Dadurch solle die Belastung gleichmäßig verteilt werden. Weiterhin sprach er jedoch nicht nur von der „Last“ sondern auch davon, dass infolgedessen „die Originalität und Kreativität wahrgenommen und allen zugute kommen könnte“ (Dörner, 1994, S. 374). Autenrieth kam zu diesem Zeitpunkt aus den USA und empörte sich über die Einrichtungen, welche psychisch Kranke in riesigen Gebäuden einsperrte. Mit Entsetzen stellte er fest, dass diese Einrichtungen nun auch in seinem Heimatland Zuspruch fanden. Behörden und andere Vereinigungen stellten soziale Institutionen wie Krüppelheime, Zuchthäuser, Gefängnisse, Irrenanstalten, Waisenhäuser, Kindertagesstätten, Pflegeanstalten und Seniorenheime für die betroffenen Mitglieder der Familien bereit, um die familiäre Pflegeperson als Arbeitskraft in der Produktion zu sichern. Damit war ein wesentlicher Grundstein für die Isolierung der Schwächeren gelegt. Die Pflege und das Kümmern um die bedürftigen Familienmitglieder war nun nicht mehr länger die Aufgabe der Familie, wodurch sich das Verständnis füreinander allmählich aus den Köpfen der Gesellschaft auf ein Minimum reduzierte, da an ihrer Stelle das Bewusstsein der Selbstversorgung trat. Dörner formulierte diese Entwicklung folgendermaßen:
„Während sie [Behinderte] in den alten Haushalten im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch an der Arbeit beteiligt waren, wurden sie in den sozialen Institutionen grundsätzlich von der Möglichkeit abgeschnitten, sich durch Bearbeiten von Sachen zum Nutzen von Dritten als Menschen zu verwirklichen, worüber die Würde des Menschen sich legitimiert.“ (Dörner, 1994, S. 374)
Den Schwächeren zu helfen, das Ziel der Gründer von sozialen Einrichtungen, verlor an Bedeutung und der Mensch wurde immer mehr zu einem Objekt von Versorgung, Therapie, Wirtschaft, Verwaltung, Verwissenschaftlichung und Erziehung. Die Kluft zwischen dem sozialen System und dem System der Wirtschaft wurde immer größer. Es war nur eine Frage der Zeit bis zur „Medizinisierung“ der sozialen Frage (vgl. Dörner, 1994, S. 370ff.).
Die ersten sozialen Einrichtungen ab 1800 waren noch von der Strömung der Aufklärung beflügelt – den Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zur Mündigkeit verhelfen – und kümmerten sich hingebungsvoll um ihre Schützlinge. Doch die Entwicklung der Gesellschaft war ein rasanter Prozess und führte dazu, dass die Erwartungen der Gesellschaft an solche Anstalten überhandnahmen. Wie in der reinen Marktwirtschaft typisch, wurden die Kosten mit dem Nutzen abgewogen. Somit wich im 19. Jahrhundert das pädagogische Denkmodell dem medizinischen. Verrückte sind nun Kranke, die es mit allen medizinischen Mitteln zu heilen galt. So geschah es sich, dass immer mehr Menschen in solchen Anstalten für „geistig tot“ erklärt wurden und sich die Theorie vom „Untermenschen“ unaufhaltsam und schleichend in den Köpfen der Gesellschaft verankerte. Das Füreinanderdasein, Helfen, ein Wesenszug, der zum Menschsein gehört, wurde professionalisiert, neue Berufsgruppen kristallisierten sich heraus, sprich das „füreinander da sein“ wurde kommerzialisiert. Die Aufgabe, anderen zu helfen, übernahmen andere und so verloren viele die Befähigung zum Helfen und die Empathie für Hilfebedürftige. Die Wirtschaft hatte enormen Einfluss auf die Kultur, sodass zum Ende des 19. Jahrhunderts das ökonomische Prinzip massiv in den Vordergrund trat sowie das „Überleben des Tüchtigen“. Um 1890 herum glaubte man zu wissen, dass die Geisteskrankheit eine Erbkrankheit sei. Dies führte dazu, dass diese Personen nicht nur vom anderen Geschlecht getrennt eingesperrt wurden, sondern man sah es als effektiver an, sie zu sterilisieren. Solch eine Operation wurde erstmals im Jahre 1892 von dem Schweizer August Forel durchgeführt, damals ein wertgeschätzter Sozialreformer und Psychiater. Zu dieser Zeit störte sich kaum jemand an der Verwendung des Begriffs „Untermenschen“ für körperlich und geistig beeinträchtigte Personen, was nicht nur die totale gesellschaftliche Ausgrenzung dieser bedeutete, sondern gipfelten 1920 schließlich in der „Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens“ (Dörner, 1994, S. 379).
Begründet wurde die Tötung folgendermaßen:
„Wenn ich als mündiger Bürger dieses Recht [aktive Sterbehilfe] etwa bei Krebs für mich beanspruche, dann müssen diejenigen, die nicht für sich selbst sprechen können, also geistig Behinderte, psychisch Kranke, Altersverwirrte und Bewußtlose, vom Staat dieselbe Gnade zugesprochen bekommen, da sie sicher noch mehr als ich unter ihrer hoffnungslosen und qualvollen Existenz leiden.“ (Dörner, 1994, S. 380)
Zu dieser Zeit begründete man das Töten von Menschen mit einer Behinderung also zum einen durch radikal ökonomische Erwägungen, dass soziale Einrichtungen (zu) viel Geld kosten und zum anderen trat das oben genannte psychologische Mitleid in den Fokus, dass selbst in der heutigen Zeit noch Vertreter findet Frage (vgl. Dörner, 1994, S. 370ff.).
Die weitere Entwicklung bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ist hinlänglich bekannt. Anzumerken ist, dass schon im Ersten Weltkrieg circa 70.000 psychisch Kranke in Anstalten getötet wurden, als „Ausgleich“ für die gefallenen gesunden Soldaten Frage (vgl. Dörner, 1994, S. 370ff.).
Erst langsam entwickelte sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Integrationsbewegung. Im Jahr 1958 entstand der noch heute existierende gemeinnützige Verein „Lebenshilfe e.V.“ – zur damaligen Zeit hieß er „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind e.V.“. Der Verein wurde in Marburg von Eltern und Fachleuten erweckt und machte es sich zur Aufgabe, die Anstalten durch Wohn- und Arbeitsräume zu ersetzen, die sich an der Gesellschaft ausrichten. Um die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen, wurden Gesetze, z.B. das Schwerbehindertengesetz, und Institutionen, z.B. Behindertenwerkstätten, geschaffen, die eine Verbindung des sozialen Systems mit dem Wirtschaftssystem ermöglichten. Dörner sieht 1994 eine Vision der Entwicklung für die Zukunft die besagt,
„[dass] es auf kommunaler Ebene überall ein Forum geben [wird], auf dem sich regelmäßig alle, die im Naturschutz, in der Entwicklungshilfe und in der Behindertenförderung sich engagieren, treffen und austauschen; denn sie alle können voneinander lernen, da sie historisch dasselbe tun und derselben Entkolonisierungsbewegung angehören.“ (Dörner, 1994, S. 390)
Nimmt man sich einen Augenblick Zeit, um diese Zukunftsvision von Dörner im Jahre 2012 zu reflektieren, kommt man zu einem eher ernüchternden Ergebnis. Allein die Entwicklung des Schulsystems zeigt, wie weit der Weg bis zu diesem Ziel noch ist (vgl. Dörner, 1994). Auch in der heutigen Zeit gibt es vier hauptsächliche Schultypen: die Grundschule, die Regelschule, das Gymnasium und die Sonderschule, die einen Sonderstatus einnimmt, welcher im Folgenden näher erläutert wird.
Die Entstehung von Sonderschulen entspringt der sozial-religiösen Einstellung. So gründete sich bereits vor etwa 200 Jahren eine Schule für Taubstumme, was als „Akt der Teilhabe […] [und als] Befreiung aus der Isolation“ (Häberlein-Klumper, 2009, S. 35) angesehen wurde.
Solche Einrichtungen zielten darauf ab, Kinder anzunehmen, die – aus welchen Gründen auch immer – aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Wie dieser Ausschluss zustande gekommen war, wurde im oberen Abschnitt bereits angeschnitten. Zusammengefasst waren es folgende drei Gründe:
1. Die Entstehung von Kleinfamilien
2. Durch die Folgen des Wirtschafts- und Produktionssystems wurde die Arbeit ausgelagert, der Leistungsgedanke wurde übermächtig und die Menschen nach ihrer Befähigung von Arbeitsleistung und ihrer Bildung gruppiert. Erwerbs- und bildungsunfähige Personen erklärte man zu behinderten, letzten Endes zu nicht lebenswerten „Untermenschen“.
3. Da sich kaum einer mehr um pflegebedürftigen Familienmitglieder kümmern konnte, entstand die soziale Frage, welche in der „Fremdpflege“ und somit der Exklusion endete (vgl. Häberlein-Klumper, 2009, S. 36).
2.3.2 Von der Exklusion zur Inklusion – ein kurzer Abriss
Im oberen Teilkapitel wurde der Terminus Exklusion angesprochen, doch was bedeutet er konkret und welche Ebenen gibt es zwischen diesem Begriff bis hin zur Inklusion? Hinz (2004, S.) hat dazu eine Systematik erstellt, die im Folgenden vorgestellt wird.
Die Exklusion stellt einen Zustand dar, in der Personen aus einem bestimmten System ausgeschlossen werden. So wurden Kinder mit geistigen, aber auch körperlichen Beeinträchtigungen aus dem Bildungs- und Erziehungssystem ausgeschlossen.
Die erste Ebene auf dem Weg zur Inklusion, die den betroffenen Personen etwas Teilhabe ermöglicht, ist Segregation. Hierbei werden die Menschen nach bestimmten Kriterien in eigens für sie entwickelte Institutionen und somit auch von der Mehrheitsgesellschaft isolierte gesellschaftliche Systeme untergliedert. Ein treffendes Beispiel hierfür ist die Schule. Die Kriterien sind hierbei die Leistungen, aber auch das soziale Milieu, aus dem die Kinder stammen. Der Teil der Kinder, welcher die Kriterien erfüllt, befindet sich im Normalbereich und besucht die Regelschule. Kinder, die die Kriterien überdurchschnittlich erfüllen, besuchen das Gymnasium und die Gruppe, welche den Durchschnitt nicht erfüllen, werden in das System der Sonderschulen eingestuft. Anhand der Beschreibung der Segregation lässt sich feststellen, dass unser derzeitiges unterteiltes und gelebtes Schulsystem der Ebene der Segregation entspricht.
Von der Segregation weiter zur Inklusion passiert man die Ebene der Integration. Fest steht, dass auch hier anhand von bestimmten Kategorien die durchschnittliche Person ermittelt wird, deren Gruppe deutlich größer ist als jene, die die Anforderungen deutlich über- oder untererfüllen. Es wird versucht, Personen, die den Durchschnitt knapp nicht erreichten, besonders aber die, welche ihn deutlich unterschreiten, mit dem Durchschnitt wieder zu vereinen. Ziel ist es, Menschen einzubeziehen, die durch Exklusion und Segregation ausgeschlossen waren. Um am Beispiel von Schule zu bleiben, bedeutet dies, dass Menschen mit Behinderungen in den Schulunterricht eingebunden werden. Zu erwähnen ist hierbei, dass diese Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung eingegliedert werden und – wie eben beschrieben – den Großteil die „Normalen“ ausmachen, diese also den Integrationsprozess positiv oder negativ beeinflussen können.
Die Inklusion schließlich steht für den vollständigen Abbau von jeglichen Barrieren zwischen verschiedenen Gruppen und kann am ehesten mit dem Leben vor der Industrialisierung verglichen werden. Demnach bilden alle Menschen eine gemeinsame Gruppe, in der es keinen dominanten Personenkreis gibt. Es stellt sich nicht mehr die Frage, wer wie integriert werden könnte, da sich die Gruppe von vornherein in einem heterogenen Zustand befindet und alle Teil derselben Gruppe sind. Niemand muss mehr bestimmte Kriterien erfüllen, um zu beweisen, dass er in die Gruppe gehört. Die Marginalisierung und der Ausschluss von einzelnen Menschen existiert bei der Inklusion nicht mehr.
Betrachtet man die Allgemeine Pädagogik, stellt man fest, dass Heterogenität und Vielfalt der Menschen nichts Exotisches darstellen. Aus diesem Grund erübrigen sich spezifische Ansätze bzw. Konzepte vollends. Die Inklusion entfaltet sich in der Allgemeinen Pädagogik und stellt keinen autarken Gegenstand mehr dar (vgl. Hinz, 2004). Wird nun die Sonderpädagogik fokussiert, kommt man zu dem Resultat, dass diese den Menschen differenziert betrachtet, sie sucht nach Sonderheiten und differenziert ihn immer weiter. Würde sie dieser Aufgabe nicht nachkommen, könnte sich die Sonderpädagogik der Allgemeinen Pädagogik anschließen oder gar abgeschafft werden (vgl. Wurzel, 2008, S. 138f.).
2.3.3 Vom Versehrtensport zu inkludierten Sportgruppen
Laut Aussage von Wedemeyer-Kolwe ist der heutige Forschungsstand über die Entstehung und Entwicklung des Behindertensports sehr gering. Dafür nennt er zwei Gründe:
„[Erstens] tut sich die Sportgeschichte bis heute schwer damit, ihre Forschungen auf marginale und marginalisierte Gruppen in der Sporthistoriographie (und dazu gehört der Behindertensport) zu richten.
[Zweitens] produzieren Außenseitergruppen entweder nur wenig bis gar keine Quellen oder Eigenliteratur, oder sie wurden nicht systematisch gesammelt bzw. wurden für unwichtig erachtet und haben sich daher aufgrund ihres Randcharakters nur selten erhalten, was wiederum als gesellschaftliche Marginalisierung aufgefasst werden kann.“ (Wedemeyer-Kolwe, 2010, S. 348)
Menschen mit und ohne Behinderung besitzen grundsätzlich die gleichen Bedürfnisse, die bei jedem Individuum natürlich unterschiedliche Gewichtung erfahren. Nach der Maslow‘schen Bedürfnishierarchie – eine ausführliche Definition des Begriffes ist im Anhang 1 zu finden – lässt sich die Bewegung, die den Sport ausmacht, in die physiologischen Bedürfnisse einordnen. Damit kann sie als ein Grundbedürfnis der Menschen und somit auch als Grundlage für die Entwicklung der Persönlichkeit und von Motivation betrachtet werden (vgl. Rheker, 1996, S. 25). Zwar existierte diese Theorie noch nicht schriftlich, aber 1910 gründet sich – womöglich mit ähnlichen Absichten – der erste deutsche Gehörlosensportverband (vgl. Fediuk, 2008b). Der Beginn von organisiertem Sporttreiben KuJ mit einer Beeinträchtigung ist bereits im 19. Jahrhundert zu finden. In den diversen Anstalten für blinde, gehörlose und körperbehinderte KuJ war der Sport in das Freizeit- und Schulleben integriert. Der Auftrag des Sports war zum einen die Befähigung zur Erlangung von Bildung und Produktivität für den Arbeitsmarkt sowie zum anderen das Erlernen von Disziplin, Selbstständigkeit, Ausdauer und Regeln. Parallel dazu begannen die Erwachsenen mit Behinderung damit, erste Sportverbände zu gründen. Während einige gehörlose Menschen den Anfang machten, folgten die blinden, die in der Weimarer Republik erste Sportgruppen bildeten (vgl. Wedemeyer-Kolwe, 2010, S. 348f.).
Der Ausgangspunkt für eine breite Entwicklung des Behindertensports ist letztlich in den beiden Weltkriegen zu finden. Während dieser ergänzten sportliche Betätigungen die medizinischen Behandlungen in den Lazaretten. Der Sport diente in diesem Zeitraum hauptsächlich zur Behandlung der psychischen Folgeschäden von Soldaten mit einer körperlichen Beeinträchtigung (vgl. Fediuk, 2008b).
Gleichzeitig hier bildete sich um 1919 eine zivile Selbsthilfeorganisation mit separaten Sportgruppen, deren Aufgabe – neben dem Erhalt der persönlichen Leistungsfähigkeit, dem Freizeitvergnügen und des Treffpunktes für Geselligkeit – darin bestand, den Erhalt oder die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten.
Während der Zeiten des Nationalsozialismus‘ unterlagen die Menschen mit Behinerderung einer Einstufung in zwei Kategorien. Die erste Kategorie erfasste Arbeits- und bildungsfähige Menschen, die speziell gefördert wurden. KuJ, die dieser Kategorie angehörten, wurden in die Hitlerjugend eingegliedert und erhielten Sonderbanner wie z.B. Bann G für Hörgeschädigte, Bann B für Blinde, Bann K für Körperbehinderte. Lernschwache Kinder waren Teil der regulären Hitlerjugend. Neben der nationalsozialistischen Erziehung schloss dies auch den Sport ein. Auch Erwachsene mit Behinderungen, die das Regime als nützlich und somit lebenswert ansah, wurden in gesonderte Sportgruppen eingegliedert.
Arbeits- und bildungsunfähige beeinträchtige Personen hingegen waren Bestandteil der zweiten Kategorie. Diese Menschen wurden vollständig aus der Gesellschaft ausgeschlossen, viele von ihnen zwangssterilisiert und umgebracht.
Kriegsversehrte wurden durch die Einführung des Reichsversehrtensportabzeichens und von Leistungssportwettkämpfen besonders geehrt und gefördert. Auch bekamen sie gezielte Rehabilitationsmaßnahmen, um für ihr Land wieder „nützlich“ zu werden (vgl. Wedemeyer-Kolwe, 2010, S. 349f.).
Auf diese Weise bildeten sich nach dem Zweiten Weltkrieg erste Sportgruppen von Kriegsversehrten heraus, sodass am 19/20. August 1950 die ersten deutschen Versehrtensportmeisterschaften in Leichtathletik und Schwimmen stattfanden. Diese Meisterschaften führten in den Jahren 1951/52 zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Versehrtensport (ADV). Im Jahre 1960 fand die Umbenennung in Deutscher Versehrtensportbund statt. Aber nicht nur in Deutschland entwickelte sich der Behindertensport. In Großbritannien, genauer gesagt in London, wurden die „Stoke Mandeville Games“ ins Leben gerufen, eine Sportveranstaltung für Querschnittsgelähmte, die parallel zu den Olympischen Sommerspielen ausgetragen wurde und sich später zu einem internationalen sportlichen Ereignis entwickelte. Diese Veranstaltung kann als Vorform der Paralympischen Spiele angesehen werden (vgl. Fediuk, 2008b).
Durch die Abnahme der Kriegsgeschädigten änderten sich grundlegende Strukturen. Eine Folge war die Abänderung des Verbandsnamen 1975 – mittlerweile hieß er „Deutscher Versehrtensportverband e.V.“ – in „Deutscher Behindertensportverband“ (DBS). Das Sportangebot reichte nun vom Leistungs- und Wettkampfsport über Präventions- und Rehabilitationssport bis hin zum Freizeitsport.
Offensichtlich ist jedoch, dass sich Sportgruppen, Vereine und Verbände entwickelten, die eine strikte Trennung von Menschen mit und ohne Behinderung vollzogen und nur die jeweilige „Gruppe“ aufnehmen (vgl. Rheker, 1996, S. 80f; Fediuk, 2008a).
Eine schnelle Überwindung dieses Zustands ist derzeit nicht in Sicht. Dazu sei an dieser Stelle erwähnt, dass der Organisationsaufwand, der für die Arbeit mit Menschen mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung notwendig ist, die Sportvereine vor große Probleme stellt. Sowohl damals als auch heute waren und sind enorme Defizite in dieser Organisation vorhanden, die das Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung erschweren. Auf diese Problematik wird im anschließenden Abschnitt noch näher eingegangen.
Um gemeinsamen Sport von Menschen mit und ohne Behinderung zu ermöglichen, muss jedoch als erster Schritt Kooperationsbereitschaft auf beiden Seiten vorhanden sein. Menschen mit Behinderung sollen und müssen inklusiver Bestandteil unserer sozialen Umwelt werden, auch um negative Einstellungen ihnen gegenüber abzubauen. Dies gestaltet sich deutlich schwieriger, wenn diese Gruppen noch nie miteinander zu tun gehabt hat, sei es im Kindergarten, in der Schule oder im Beruf. Es gibt zwar Bestrebungen und Theorien dazu, aber die Realität sieht oft noch anders aus. Dazu ausführlicher in den folgenden Kapiteln.
Sport kann und muss Begegnungssituationen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung schaffen (vgl. Fediuk, 2008b). Auf welche Weise dies geschehen kann, zeigt das anschließende Kapitel.
2.4 Inklusion im Sport
Sport stellt einen wichtigen Faktor in unserem Leben dar. Wir treiben Sport, um körperlich fit zu bleiben oder es zu werden. Allerdings gibt es noch viel mehr Gründe, Sport zu treiben. Dazu zählen auch, seine körperlichen Grenzen kennenzulernen, diese auszutesten und auszubauen. Des Weiteren bietet Sport die Möglichkeit sich selbst etwas zu beweisen. Dies wird möglich durch die Auswahl von Individualsportarten. Ein Großteil der Menschen treibt Sport wiederum der Gemeinschaft wegen. Eine Sportgruppe ist Ausgangspunkt für das Knüpfen neuer Beziehungen, zudem gibt sie den Menschen verschiedene Zieldimensionen. Die Vielfalt der Möglichkeiten des Sports und dessen Institutionen bietet ein großes Angebot, um nicht nur die kognitiven und koordinativen Fähigkeiten zu schulen. Durch gemeinsamen Sport wird auch der soziale Umgang miteinander gelernt, gelebt und kann den Ausgangspunkt von Inklusion darstellen.
Betrachtet man die Inklusion im Sport, dürfen die Spiele, die ebenfalls dem Sport zugeordnet werden, nicht in Vergessenheit geraten. Sie stellen einen wichtigen Bezugspunkt für die Inklusion dar. Spiele werden unter anderem definiert als der Versuch, ein Problem zu bewältigen (vgl. Maslow, 1991, S. 167f.). In Bewegungsspielen und dem Spiel im Allgemeinen entstehen nicht nur Interaktionen, sondern auch Kommunikation – sowohl verbal oder nonverbal –, es werden Gefühle geweckt, Neugierde entsteht. Motivation und Emotionalität sind durchaus positive Nebenprodukte.
Dabei können Spielsituationen überall geschaffen werden, speziell aber in Vereinen und der Schule. In Letztgenanntem bestehen sowohl in den Pausenzeiten als auch in der Unterrichtszeit selbst die Möglichkeiten, Spielsituationen zu schaffen.
Das Spiele nicht nur in den Sportunterricht gehören und für den Kompetenzerwerb und die Kompetenzförderung nicht wegzudenken sind, sollte jedem Pädagogen klar sein. Um die Eigenschaften von Spielen kurz darzustellen, hilft die Untergliederung von Wilhelm (2006). Hierbei werden zusätzlich Beispiele und Möglichkeiten genannt, wie das Spiel die Inklusion körperlich- und geistig beeinträchtigter Personen unterstützt.
- Durch freie Spielzeiten – sowohl im schulischen Unterricht als auch im Verein, in dem KuJ ihre Spielgefährten und die Spiele aussuchen, wird die Interaktion und Kommunikation gefördert. Dafür bieten die Trainer/Lehrer den KuJ eine Auswahl von Spielen entsprechend ihrer unterschiedlichen Entwicklung an. Die Spiele helfen somit, Beziehungen zu anderen aufzubauen, aber auch eigene Entscheidungen zu treffen, Kompromisse einzugehen und eigene Wünsche zugunsten der Mehrheit hintenanzustellen.
- Um kognitive Fertigkeiten, wie das Lesen und Buchstabieren, zu erlernen und zu verbessern, können Spiele hinzugezogen werden. So sind Kartenspiele durchaus in der Lage, eine höhere Motivation bei den Schülern hervorzurufen als ein Buch es vermag. Weiterhin können sich die möglichen Probleme im Lernprozess verringern, bezieht man das Buchstabieren in ein Spiel mit ein. Es ist festzustellen, dass sich das Lernspiel im heutigen zukunftsweisenden Unterricht im Methodenkatalog etabliert hat.
- In besonderem Maße fördert das Rollenspiel die Sprachentwicklung der Mitwirkenden. Es versetzt die KuJ in die Rolle einer anderen Person – in einem Stück spielt vielleicht ein Kind ohne Beeinträchtigung einen Rollstuhlfahrer oder einen Hörgeschädigten –, was das Verständnis über die Lage anderer verändern und verbessern kann.
- Speziell in der Schule sollten die Lehrkräfte es den KuJ in den Pausenzeiten ermöglichen, Bewegungsspiele durchzuführen. Dabei wird ihnen nicht nur die Aufgabe der Organisation zuteil, sondern auch die der Animation. Die Lehrkräfte sollten den KuJ Möglichkeiten anbieten, den Klassenraum zu verlassen, andere aus der Parallelklasse zu treffen und je nach Witterungsbedingungen Orte schaffen, die zum gemeinsamen Spielen anregen (vgl. Wilhelm, 2006, S. 120f.).
2.4.1 Inkludierter Schulsport und Vereinssport
Der Entwicklung und derzeitigen Lage von Schule und Verein widmet sich der folgende Abschnitt Hierbei liegt das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung der Inklusion in den beiden Institutionen.
2.4.1.1 Ausgewählte Aspekte zum Schulsport
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Lage des Schul- und Vereinssportwesens. Als Beispiel für den Schulsport gerät der Thüringer Lehrplan näher in den Fokus. Weiterhin werden die Bedingungen von Sportunterricht aufgeführt und dargestellt, welche Voraussetzungen nötig sind, um inkludierten Unterricht zu verwirklichen.
Seit 1842 gehört Sportunterricht – zur damaligen Zeit hieß es Turnunterricht – in Preußen zum Bestandteil der Lehrpläne in den öffentlichen Schulen. Damals diente er zur „vernunfts- und naturbezogenen Erziehung des männlichen Geschlechts und zur Prävention von „entnervender Verzärtelung […] [und] luxuriöser Weichlichkeit“ (vgl. Stuttgarter Nachrichten, 15.5.2001).
Die Begriffe Freude und Spaß waren zu diesem Zeitpunkt Fremdwörter im Sportunterricht, da Sport nach Turnvater Jahn als Volkserziehung und der Vorbereitung zum Soldaten angesehen wurde. Diese Einstellung zog sich bis zur Neuzeit und so endete der militärische Aspekt des Schulsports erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Überbleibsel dieser Zeit findet man noch vereinzelt in den verstaubten Ecken von Schulsportlagerräumen. Dort verstecken sich zum Beispiel noch Wurfgeräte, die einer Stielhandgranate ähneln (vgl Stuttgarter Nachrichten, 15.5.2001). Welche Ziele der heutige Sportunterricht in Thüringen verfolgt, verdeutlicht der kommende Abschnitt.
Der Schulsport in Thüringen
Zum Schuljahr 1999/2000 erschienen in Thüringen neue Lehrpläne für alle Fächer. Vorangegangen waren zwei vorläufige Lehrpläne von 1991 und 1995. Der derzeitige Lehrplan verfolgt das Ziel, auf Grundlage einer breiten Grundbildung Schüler zum Handeln zu befähigen und wurde nach dem mutmaßlichen Erwartungsbild der Schüler konzipiert.
Die Prämissen für den Sportunterricht waren unter anderem die Persönlichkeitsbildung aller Schülerinnen und Schüler (SuS), das Kennenlernen vielfältiger Sportangebote, die Sportmündigkeit, die Förderung der Mitgestaltung am Unterricht und die Berücksichtigung der Gegebenheiten an den Schulen. Eine weitere wichtige Prämisse war, dass Sportarten nicht nur auf wettkampftypische Ausprägungsformen reduziert werden.
Die pädagogische Begründung des neuen Lehrplans lässt sich in fünf Punkte gliedern.
1. Grundbildung ist das allgemeine Ziel
2. Im Mittelpunkt der Grundbildung steht der Begriff der Kompetenz
3. Die Lernkompetenz wird durch die Kompetenzbereiche Sach-, Sozial-, Selbst- und Methodenkompetenz unterstützt
4. Der Sportunterricht nutzt Spiel, Sport und Bewegung für die Bildung und Erweiterung der Kompetenzbereiche
5. SuS werden zur Handlungsfähigkeit erzogen, das heißt, sie werden in die Lage versetzt, aus einem Repertoire sportlicher Angebote individuell zu entscheiden und dieses in seiner Freizeit zu betreiben.
Wie der Sport an den Thüringer Regelschulen organisiert wird, zeigt die folgende Abbildung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.4.1: Organisation des Sports an den Thüringer Regelschulen
(In Anlehnung an den Thüringer Lehrplan für Regelschulen; Rusch, 1991, S. 80)
Wie anhand der Skizze erkennbar wird, ist der Sportunterricht an Regelschulen von Offenheit und Verbindlichkeit geprägt. Die Teilung erfolgt in 40% verbindlichen, 40% alternativ-verbindlichen und 20% frei wählbaren Unterricht. Im Vergleich zu den vorherigen Lehrplänen ist der Entscheidungsfreiraum für die Lehrkraft enorm erweitert worden. Über Lehr- und Lernmethoden, die sich im Rahmen der problemorientierten und induktiven Unterrichtsgestaltung finden, entscheidet der Sportlehrer selbst. Möglichkeiten der Subjektorientierung findet er unter anderem durch das Anknüpfen an Erfahrungen, dem Beachten von Interessen und Interessenkonflikten und die Einbeziehung der Schüler oder Lehrerkollegen. Über die Ziele und Themen soll jedoch nicht nur willkürlich entschieden werden, der Lehrplan verlangt eine didaktische Legitimation und das aktive Miteinbeziehen der SuS. So haben die SuS laut Lehrplan nicht nur das Recht auf Mitgestaltung, sondern auch die Pflicht (vgl. Thüringer Lehrplan, 1999).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Lehrplan von 1999/2000 das Lernen nicht nur als Lernen in einem bestimmten Fach sieht, sondern auch als fächerübergreifende Zielstellung. Die Fächer beziehen sich somit aufeinander, ohne dabei ihre eigene Spezifik zu verlieren. Der Schwerpunkt des Sportunterrichts liegt auf der Kompetenzentwicklung, ein für die Inklusion nicht wegzudenkender Begriff.
Sportunterricht und seine Bedingungen
Guter Sportunterricht ist entwicklungsorientiert. Der Sportlehrer muss davon ausgehen, dass jeder einzelne Schüler und jede einzelne Schülerin einzigartig in seiner/ihrer Lernfähigkeit ist, welche es zu stärken und zu entwickeln gilt. Dabei ist es ist nicht mehr das Ziel, die unterschiedlichen Lernentwicklungen unter den SuS gering zu halten, vielmehr geht es darum, jeden in seinem derzeitigen Entwicklungsverlauf zu fördern. Somit besitzt jedes Kind und jeder Jugendliche einen Förderbedarf, der nur auf ihn zugeschnitten ist. Heterogene Klassen – und dies trifft auf jede Klasse zu – brauchen einen individualisierten Unterricht im Rahmen des gemeinsamen Lehrplans, damit die SuS die Möglichkeit erhalten, auf ihrem jeweiligen Niveau zu üben, zu lernen und somit koexistente Lernsituationen herbeizuführen. Durch die Tages- oder Wochenplanarbeit kann dies durch einen speziell für den Einzelnen angefertigten Plan und Materialien durchaus gelingen. Jedoch bedarf es auch gemeinsamer Lernsituationen, die das gemeinsame Arbeiten und soziale Kompetenzen fördern. SuS müssen lernen, dass die Klasse – später weitere Bereiche der Schule – ihre Gemeinschaft ist, in der niemand ausgeschlossen wird. Gelingen kann dies durch ein gemeinsames Thema oder Ziel und die Schaffung von kooperativen, subsidiären Lernsituationen, z.B. den Bau einer Menschenpyramide oder das Erlernen einer Choreografie mit Musikunterstützung im Freien Turnen. Diese Situationen bedürfen der Kommunikation und Kooperation der SuS. Weiterhin fördert es das Lernen nicht nur miteinander, sondern auch voneinander (vgl. Rehle, 2009).
Laut Rehle ergeben sich daher
„folgende Kriterien für die Planung individualisierender und gemeinsamer Lernsituationen:
- Jede individualisierte Lernaufgabe ist grundsätzlich auf Austausch, Ergänzung und Gemeinsamkeit (gemeinsames Thema oder gemeinsames Vorhaben oder gemeinsame Arbeitsformen) zu beziehen.
- Aufgabenstellungen sollten so weitreichend und umfassend sein, dass jedes Kind auf seinem Niveau einsteigen und seinen Teil zum gemeinsamen Vorhaben beitragen kann.
- Die Arbeitsprodukte der Kinder sind unter pädagogisch-diagnostischer Perspektive zu sehen und zu bewerten. Lernprozessanalyse zeigt Anhaltspunkte für etwaige Hilfestellung und somit für weiterführendes Lernen.“ (Rehle, 2009, S. 184)
Besonders der letzte Punkt unterstützt die Gegner der Leistungsbewertung durch das derzeitige Notensystem und fordert ein sachliches, differenziertes und entwicklungsorientiertes Bewertungssystem (vgl. Rehle, 2009, S. 191f.).
Inkludierter Sportunterricht
Die Verschiedenheit der Köpfe diagnostizierte schon der Pädagoge Johann Friedrich Herbart und verwies dabei auf die heterogenen Lerngruppen. Richtet sich der Blick auf das heutige Schulsystem, wird klar, dass es einem differenzierten, selektiven Aufbau gleicht (vgl. Hinz, 2010). Der Ruf nach der Abschaffung von Sonderschulen ertönte bereits vor Jahrzehnten. So forderte Eberwein im Jahre 1970 Chancengleichheit für alle KuJ durch eine Eingliederung der Sonderschule in die Regelschulen und stellte folgende Grundanliegen (Anforderungen) an sie:
4. „Egalisierung der Bildungschancen
5. Soziale Integration
6. Unterrichtsdifferenzierung
7. Veränderte Didaktik und Lehrerausbildung.“ (Lingenauber, 2003, S.39)
Die Umsetzung seiner Anliegen sollte durch speziell ausgebildete Pädagogen erfolgen, die in kleinen heterogenen Klassen stärker auf den Einzelnen eingehen können und so stark differenzierte und individualisierte Lerninhalte vermitteln, was spezifische Methoden, eine spezielle sonderpädagogische Curricula und angepasste Lehrmittel erfordert (vgl. Merz-Atalik, 2008).
Er vertritt die Ansicht, dass es eine Gruppe von SuS mit einer Behinderung gibt, für die es weiterhin zwingend notwendig war, die Form der Sonderschule zu besuchen. Diese sollten aber keineswegs ausgegrenzt werden:
„Sonderschulen für Geistigbehinderte, Sehbehinderte, Höhrbehinderte, Spastiker, Taubstumme und Blinde, die wegen der Besonderheit ihre heilpädagogischen- therapeutischen Auftrags nicht in das Gesamtschulsystem integriert werden können, sollten nach Möglichkeit als selbstständige Schulart den Gesamtschulen bzw. Bildungszentren additiv angegliedert werden, um so zu verhindern, daß sie als moderne, demokratisch legitimierte Gettos den Kontakt zur allgemeinen, gesellschaftlichen Wirklichkeit verlieren.“ (Lingenauber, 2003, S. 41)
Derzeit werden KuJ mit Behinderungen noch immer im Bildungssystem isoliert. Durch das Sonderschulwesen entsteht ein Ungleichgewicht zwischen den Bildungschancen von KuJ mit und ohne Behinderung. Dies kann sogar als ein Verstoß gegen das Gleichheitsgrundsatz von Artikel 1 und 3 des Grundgesetzes angesehen werden, indem es deutlich heißt, dass „niemand […] wegen seiner Behinderung benachteiligt werden [darf]“ (vgl. Grundgesetz Artikel 3 Satz 3). Mehrere Untersuchungen im nationalen und internationalen Rahmen haben gezeigt, dass das gemeinsame Unterrichten von SuS mit und ohne Beeinträchtigung in Gegenüberstellung mit dem Sonderschulwesen für die SuS mit Behinderung mindestens die gleichen Ergebnisse in der Entwicklung aufweist. Ebenso wäre die Verlagerung von SuS mit Behinderungen in Regelschulen nicht nur kostenneutral, auch die pädagogischen Rahmenbedingungen hätten mindestens die identische Qualität. Die Studien heben hervor, dass, wenn Kinder mit Beeinträchtigungen Regelschulen besuchen würden, sie mindestens die gleiche Qualität wie auf einer Sonderschule erhielten und sogar darüber hinaus.
Doch die Entwicklung inklusiver Schulen kommt nur schleppend voran. Zwar entschied die Kultusministerkonferenz am 6. Mai 1994 darüber, dass die automatische Zuweisung von KuJ mit Behinderungen auf eine Sonderschule dem Grundsatz der Gleichheit nicht entspräche und entfernten die entsprechenden Paragraphen. Die Zahlen zeigen jedoch ein Zögern bei der Umsetzung. 2002 wurden 495.300 SuS eingeschult, welche man als sonderpädagogisch förderbedürftig einstufte. Ganze 13 Prozent davon wurden in Regelschulen eingeschult. Erschreckende 83 Prozent besuchten weiterhin die Sonderschule (vgl. Eurich, 2008).
Doch wie kommt diese Zahl zustande? Liegt es an Eltern, der Schule oder dem Staat?
Seit längerem wird vereinzelt das gemeinsame Unterrichten von Schülerinnen und Schülern (SuS) mit und ohne Behinderung in Deutschland ausgeübt. Jedoch herrschen noch enorme Defizite bei der gleichberechtigten Teilhabe aller am Unterricht. Dass das im Unterrichtsfach Sport genauso ist, zeigte sich schon im „Ersten Deutschen Kinder- und Jugendsportbericht“, in dem deutlich auf die Probleme im Bezug auf KuJ mit Behinderung im Sportunterricht verwiesen wurde.
Welche Bedeutung hat für KuJ mit Behinderungen die Teilnahme am Sportunterricht? In den letzten Jahrzehnten gewann das Thema der Inklusion immer mehr an Bedeutung und wurde im Besonderen mit dem Fokus auf die Umsetzung in Klassenzimmern debattiert. Die Betrachtung von Inklusion im Schulsport aus der sportdidaktischen und sportwissenschaftlichen Perspektive blieb eher verhalten. Dies wird auch daran deutlich, dass derzeit kein eigenes Fachgebiet zur Thematik „Sport und Sportunterricht mit Menschen mit Behinderung“ existiert und in der jüngsten deutschlandweiten „DSB-SPRINT-Studie“ in keiner Weise der Schulsport von KuJ mit Beeinträchtigungen erfasst und berücksichtigt wird. Weiterhin scheint ersichtlich, dass die Wichtigkeit der Thematik unterschätzt wird, betrachtet man die Auswertung der Umfrage im „Jugendgesundheitssurvey“. Dort wurden 5.650 SuS nach ihrer Gesundheit befragt. Das Ergebnis ist alarmierend. 11,5 Prozent der SuS offenbarten, dass sie durch eine Behinderung oder eine chronische Krankheit eine Beeinträchtigung im Alltag und demzufolge auch in der Schule, speziell im Sportunterricht erleben. Auch ist zu erwarten, dass die Anzahl der chronischen Erkrankungen durch Umweltfaktoren – Allergien und Diabetes – eher zu- als abnimmt.
Sport kann verschiedene Probleme lösen helfen und so kommt diesem gleichfalls die Aufgabe zu, Kinder speziell zu fördern, die lernunauffällig sind, jedoch eine körperliche Beeinträchtigung besitzen. Zudem besitzen viele KuJ, die speziellen Förderbedarf im Bereich der Kognition benötigen, auch Probleme in der Motorik sowie das Soma betreffend und müssen dementsprechend im Sportunterricht berücksichtigt werden. Nun stellt sich die konkrete Frage, wem eigentlich ein spezieller Förderbedarf zugewiesen werden kann? Laut Kultusministerkonferenz haben diejenigen SuS sonderpädagogischen Förderbedarf, „die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können“ (Doll-Tepper & Schmidt-Gotz, 2008, S. 362). Nicht berücksichtigt werden hierbei jedoch die SuS, welche primär einer Förderung im Sportunterricht bedürfen.
Hieraus lässt sich folgendes Fazit ableiten. Inklusiver Unterricht von SuS mit und ohne Behinderungen muss sowohl die SuS mit sonderpädagogischen Förderbedarf neben den KuJ ohne Beeinträchtigung einbeziehen, aber auch die SuS mit chronischen Erkrankungen. Ein inklusiver Sportunterricht hat das Ziel, unter der Berücksichtigung der Individualität jedes Schülers und jeder Schülerin, zu fördern und zu fordern. Die Relevanz von der Kenntnis über die Art der Behinderung – insbesondere bei geistigen Beeinträchtigungen – und die dementsprechende sonderpädagogische Förderung rückt hier eher in den Hintergrund, um Schubladendenken und mögliche Unterforderungen zu vermeiden. Hauptaugenmerk ist vielmehr die Individualität, denn in Klassen existieren ganz unterschiedliche Mehrheiten bzw. Minderheiten von SuS, deren Bedarf nach Förderung und Hilfe oft stark differiert.
Ein Pädagoge sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass Schulklassen von Heterogenität geprägt sind – längst nicht nur im Sinne der KuJ mit und ohne Behinderungen, sondern unter anderem auch dem sozialen Milieu und der ethnischen Herkunft. Jeder Schüler lernt anders, denkt anders – ist schlicht und ergreifend anders als alle anderen. Insofern sind Klassen seit jeher heterogen, der Unterschied zu früher besteht heute darin, dass versucht wird, diese Heterogenität durch stärker individualisierten Unterricht Rechnung zu tragen.
Doch inkludierter Unterricht bedeutet nicht, dass die Lehrkraft allein diese Aufgabe zu bewältigen hat, jedes Niveau in der Klasse zu bedienen. Als große Unterstützung werden sonderpädagogische Fachkräfte in den Unterricht etabliert, die das kollektive und individuelle Lernen stärken. Sie haben die Aufgabe, mit allen SuS zu arbeiten, erarbeiten gemeinsam mit der Lehrkraft neue Methoden und bringen neue Lern- Arbeits- und Lehrmittel in den Unterricht ein. Die Lehrkraft ist nicht mehr auf sich allein gestellt und bekommt kompetente Unterstützung. Weiterhin besitzt sie einen kompetenten Ansprechpartner, mit dem sie Probleme besprechen und effektiv Lösungen finden kann (vgl. Doll-Tepper & Schmidt-Gotz, 2008, S. 361-370).
Viele Lehrkräfte sind sich bewusst, dass SuS und deren Förderung im Mittelpunkt stehen. Einige sehen sich jedoch noch selbst als Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens an und haben Bedenken, wenn es darum geht, den Unterricht nicht mehr allein zu führen. Wichtig ist jedoch, dass die Bezugspersonen der SuS, z.B. der Lehrer mit dem Physiotherapeuten, keinen Hierarchiekampf austragen, sondern die Fähigkeiten des anderen akzeptieren und gleichrangig vor den SuS und mit ihnen agieren. Jeder Beteiligte genoss eine andere Ausbildung und kann somit sein Fachwissen zum Wohl aller SuS einbringen. (vgl. Sowa, 2000b)
Eine weitere Möglichkeit, die Unterrichtsqualität für SuS mit Behinderungen zu verbessern besteht darin, Experten zu konsultieren. So können im Sport Fachkräfte in Bereichen der rehabilitativen Funktionsgymnastik oder der Physiotherapie hinzugezogen werden, um die individuellen Bewegungsbedürfnisse der SuS zu befriedigen. Zumindest sind solche Maßnahmen auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention möglich (siehe Kapitel 2.5). In der Praxis gestaltet sich dieses Unterfangen aufgrund finanzieller und bürokratischer Hürden jedoch wohl noch oft schwierig.
Ein kurzer Rückblick auf die Maslow‘sche Bedürfnishierarchie zeigt, dass wenn das Bewegungsbedürfnis – in Form von Bewegungs-, Sport- und Spielangeboten – bei Kindern erfüllt ist, dies nicht nur gesundheitlich positive Effekte beinhaltet, sondern die Wege offen stehen für eine bessere körperliche und geistige Entfaltung.
Der Nutzen inkludierten Sportunterrichts ist nicht nur auf der Seite von körperlich und geistig beeinträchtigten SuS zu finden. Auch die SuS, denen die Beteiligung am sportlichen Geschehen schwerfällt und die sich oft gedemütigt und diskriminiert sehen, kann geholfen werden. Die Umgestaltung der Organisation und Zielorientierung auf die individuelle Leistung und Entwicklung bietet sehr gute Aussichten auf neu entfachte Begeisterung und daraus folgende gesteigerte Aktivität. Dies erfordert die Auswahl von speziellen Methoden und Inhalten, die unter der Beachtung von Mehrperspektivität der sportlichen Unterrichtsstunden alle SuS berücksichtigt und somit ein positives Lernklima erzeugt.
Zusammengefasst ist das primäre Ziel von Sportunterricht, alle SuS zur Handlungsfähigkeit im Sport zu führen. Dieses Ergebnis ist gleichzusetzen mit dem Erreichen von gleichberechtigter Teilhabe aller am sportlichen Leben.
Doch wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Das oft noch gelebte Leistungsprinzip verbunden mit dem häufig körperbetonten Handeln veranlasst viele Erziehungs-berechtigte dazu, ihre Kinder vom Sportunterricht auszuschließen. Durch die Mithilfe der Ärzte werden somit die KuJ zu mindestens sportlichen Außenseitern, die anstelle von gemeinschaftlichem Sport diesen womöglich isoliert durchführen, beispielsweise durch Krankengymnastik. Dabei entgehen ihnen viele freudvolle und kommunikative Aspekte des Sports. Stattdessen wird ihnen vor Augen geführt, wie hilfebedürftig und abhängig von anderen sie sind.
Ein kurzer Ausflug in die USA zeigt, dass dort der gemeinsame Unterricht seit einigen Jahrzehnten per Gesetz geregelt und eine Aussortierung von SuS mit Behinderung nicht möglich ist. Deutschland hingegen hält an seiner langen Tradition des Sonderschulwesens fest. Sehr langsam entwickelt sich die Tendenz zur Eingliederung von KuJ mit Beeinträchtigungen in allgemeine Regelschulen. Dabei richtet sich der Fokus nun auf die Ausbildung der Lehrkräfte an den Universitäten. Während in den USA die Lehrkräfte, speziell die Sportlehrer, auf heterogene Gruppen vorbereitet werden, fehlt dies in Deutschland völlig oder wird nur kurz angeschnitten. Durch ihre spezielle Ausbildung ist es Sportlehrkräften aus den USA möglich, eine größere Anzahl von SuS in ihren heterogenen Gruppen zu unterrichten als dies in Deutschland der Fall ist; zudem arbeiten sie in den USA häufig zu zweit (vgl. Doll-Tepper & Schmidt-Gotz, 2008, S. 361-370).
Die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland unterstützt zwar die Inklusion von KuJ mit Behinderungen, jedoch sieht die Realität anders aus, was das folgende Fallbeispiel von Gabriela Thumser verdeutlicht.
Als Frau Thumser, Mutter von drei Mädchen, zum vierten Mal schwanger wurde, erhielt sie einige Wochen später eine Mitteilung über ihr ungeborenes Kind. Die Ärzte diagnostizierten das Down-Syndrom. Thumser war sich der Konsequenzen, die die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom mit sich brachte, bewusst und gebar ihr Mädchen Clara. Dieses Kind stellte sich als wissbegierig und neugierig heraus und wurde von Thumser wie ein Kind ohne körperliche und geistige Behinderung behandelt. Clara besuchte die Vorkindergartengruppe und anschließend einen integrativen Kindergarten. Dort machte sie große Fortschritte in ihrer Entwicklung. Am Ende ihrer Kindergartenzeit beherrschte sie alle Großbuchstaben und konnte auf vielfältige Weise am sozialen Leben teilhaben. Ihre Eltern begannen, nachdem Clara in den Kindergarten kam, sofort mit den Bemühungen, sie in eine normale Grundschule einzuschulen. Man zeigte zwar überall Bereitschaft, solch ein Unterfangen zu unterstützen, doch im Gegenzug herrschten viele Vorbehalte. Zwei Jahre vor ihrer Einschulung im Jahre 2003 änderte sich das Bayrische Gesetz über Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) dahin gehend, dass die Lernzielgleichheit aufgehoben und SuS aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen mussten. Am Ende des Jahres 2003 begannen erste Gespräche mit der Grundschule in Augsburg, die eine Außenklasse einrichten sollte. Im Gespräch mit der Rektorin wurde deutlich, dass diese dem Projekt ablehnend gegenüber stand, indem sie sagte, dass sie keinerlei Aktivitäten einleitet, um für dieses Projekt zu werben. Letztendlich kam die Klasse aus Mangel an Schülern nicht zustande und das Projekt wurde verschoben. Eine weitere „Bewerbung“ an einer freien Evangelischen Schule ergab, dass das Schulkonzept zwar Integration vorsieht, es jedoch zu viele organisatorische Probleme gäbe, dieses umzusetzen. Auch eine Anfrage an einer Montessori-Schule, die freie Kapazitäten besaß und Integration in ihren Präambeln verankert hatte, wurde negativ beantwortet. In der Hoffnung, dass eine Außenklasse im Jahre 2005 zustande kommen könnte, verblieb Clara ein weiteres Jahr im Kindergarten. Leider kam keine Außenklasse zustande, der Rektor zeigte jedoch Bereitschaft, bei Clara eine Einzelintegration vorzunehmen. Ende Oktober begannen die Gespräche mit der zukünftigen Klassenlehrerin. Diese gab sich sehr viel Mühe, besuchte Clara im Kindergarten, um sie näher kennenzulernen. Eine weitere Hürde war der Antrag auf Schulbegleitung, der viele Gutachten, Anträge und Gespräche erforderte.
Nachdem alle Hürden gemeistert waren und die Lehrerin Clara bereits vier Monate begleitete, versetzte das Schulamt sie in die mobile Reserve, wo sie trotz großer Bemühungen aufseiten von Familie Thumser bleiben musste. Der Versuch, die neue Klassenlehrerin auf Clara vorzubereiten, scheiterte an der Zurückhaltung der Pädagogin. Zwar besuchte sie die Familie, vermied dabei aber jeglichen Kontakt mit Clara. In der Schule ging Clara mit einem ehemaligen Kind aus ihrer Kindergartengruppe gemeinsam in eine Klasse und wurde im Allgemeinen von ihren Mitschülern ohne Probleme aufgenommen. Anders verhielt es sich mit der Klassenlehrerin. Weder ermöglichte sie Clara die aktive Teilnahme am Unterricht noch kümmerte sie sich um sie und gab die Verantwortung in allen Belangen an die Schulbegleiterin ab. Seit Januar versuchte nun die Schule mitsamt dem Rektor, Clara in eine Sonderschule zu überführen. Trotz einer inszenierten Gesprächsrunde mit Fachleuten hielten sie an diesem Entschluss fest und so konnte die Familie ihre Tochter nur mit der Hilfe eines Anwalts weiterhin an der Schule halten.
Aufgrund verschiedener Probleme wurde die Schulbegleiterin seitens der Familie gekündigt und Clara durfte ohne Betreuung nicht mehr in die Schule. Die Juristin im Schulamt zeigte jedoch Verständnis für die Lage und erlaubte der Familie, Clara ohne Begleitung in die Schule zu schicken, übernahmen jedoch keinerlei Haftung und knüpften diese Möglichkeit an die Bedingung, dass keine Schulbegleiterin mehr Clara betreuen dürfe. Das Ergebnis war enttäuschend. Die Schülerin wurde durch die weitere Nichtbeachtung der Lehrerin ausgegrenzt. Es gab für sie keine Aufgaben, weder im Unterricht, noch außerhalb in Form von Hausaufgaben. Am Ende des Schuljahres wurde ein Beratungsrektor von der Regierung zur den Thumsers geschickt mit der Aufgabe, Clara in eine Sonderschule zu überweisen. An dieser Stelle ist die Inklusion vollends gescheitert. Clara besuchte daraufhin die Sonderschule. Zwar gab es die Möglichkeit, dass sie eine andere Grundschule besuchen könne, jedoch mit der Folge, dass ein anderes Kind mit einer Behinderung diese verlässt (vgl. Thumser, 2009, S. 96-107).
Was lässt sich nun anhand dieses aktuellen Fallbeispiels feststellen? Positiv ist hervorzuheben, dass Inklusion bis zum Ende der Kindergartenzeit stattgefunden hat. Clara wuchs in einem normalen Umfeld auf und besuchte wie alle Kinder in ihrem Alter den Kindergarten, was zur Folge hatte, dass auch die Kinder in der Kindereinrichtung mit Clara in Kontakt kamen und lernten, miteinander zu spielen, zu basteln, und vieles mehr. Clara bildete einen Teil der Gruppe. Ganz anders verlief ihre Schulzeit. Völlig unverständlicherweise behinderte das Schulamt die weitere Inklusion von Clara. Warum wird eine Lehrerin versetzt, die sich mit Herzblut für die Aufnahme eingesetzt und monatelang vorbereitet hat? Wie kann es sein, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer sich weigert, sich auf ein Kind mit einer Beeinträchtigung einzulassen? Warum erschwert der Staat es einer Familie, ihr Kind mit Down-Syndrom gleichberechtigt wie alle anderen auch aufwachsen zu lassen? Ist es überhaupt noch möglich, einem Kind, das die Sonderschule besucht, eine annähernd normale Kindheit zu ermöglichen? Wenigstens die letzte Frage kann mit der Beschreibung von einem Tagesablauf eines Kindes beantwortet werden, der eine Sonderschule 20 km von seinem Zuhause entfernt besucht.
Michael ist acht Jahre alt und besucht eine Sonderschule. Jeden Tag kommt 7.30 Uhr eine Bus der Lebenshilfe und fährt ihn dorthin. An der Schule angekommen, muss er so lange im Fahrzeug warten, bis die Schultür geöffnet wird und man ihn in die Pausenhalle führt. Dort warten alle auf das Klingelzeichen. Wenn dies ertönt, gehen die SuS in die Klassenräume. Der Klassenlehrer lässt einen Sitzkreis bilden, in dem sich gegenseitig von dem Geschehen des letzten Tages berichtet wird.
Gegen 15.20 Uhr ist die Schule zuende und Michael wartet auf den Bus. Erst gegen halb fünf abends kommt er zu Hause an, wird von seiner Mutter empfangen, geht auf sein Zimmer und spielt noch ein wenig. Danach darf er sich etwas im Fernseher anschauen und geht 20 Uhr zu Bett (vgl. Sowa, 2000a, S.21f.).
Dadurch, dass Sonderschulen seltener vertreten sind als Regelschulen, kommt es zu erheblichem Freizeitverlust durch die Fahrtzeiten (vgl. Karl, 1991, S. 25). Diese sind darüber hinaus auch nicht zu vergleichen mit der Fahrt in einem regulären Schulbus. Während dieser schon als gesellschaftliches „Mikrosystem“ angesehen werden kann – die Hierarchiekämpfe untereinander, wer darf hinten sitzen, wer steigt als erster ein, Gespräche und Verabredungen – werden KuJ mit Beeinträchtigungen von jenen ohne Behinderungen durch gesonderte Fahrzeuge eindeutig getrennt und somit isoliert. Noch schlimmer wird es, wenn die Regelschule ganz in der Nähe von der Wohnung des beeinträchtigten Kindes liegt und es sehen kann, dass die Nachbarskinder in diese Schule gehen, auf dem Weg dorthin spielen, raufen, rennen. Einem solchen Kind wird es durch die fehlende gemeinsame Sozialisationsinstanz Schule deutlich erschwert, Freunde in seiner Umgebung und außerhalb der Sonderschule zu finden. Insofern begünstigen Sonderschulen die soziale Ausgrenzung ihrer Schüler. Aber nicht nur die Ausgrenzung durch den Besuch einer anderen Bildungseinrichtung oder ein langer Fahrweg erschwert es KuJ mit Behinderungen, sich in die Gesellschaft einzugliedern. Weitere Faktoren stellen die vermehrten Besuche beim Arzt, die Rehabilitationsmaßnahmen, Krankengymnastik und andere zusätzliche Therapien dar, die die Freizeit der Kinder ebenfalls beschneiden und den Kontakt zu anderen Kindern erschweren.
Voraussetzungen für inkludierten Unterricht
Ein inklusiver Unterricht muss viele Fragestellungen lösen, bevor er richtig umgesetzt wird. Im vorherigen Abschnitt wurde das Problem der häufigen außerschulischen oder isolierten Krankengymnastik und anderer Rehabilitationsmaßnahmen angesprochen. Dem kann entgegengewirkt werden, indem die therapeutischen Maßnahmen Teil des Unterrichtsgegenstandes werden. Dafür drängt sich der Sportunterricht geradezu auf. Betrachtet man den Schwimmunterricht, stellt man schnell fest, dass sich dieser besonders hierfür eignet (vgl. Schuler, 2000). Ein Musterbeispiel gibt die Schweiz ab. Für eine spezielle Entwicklungsförderung aller SuS arbeiten dort bereits in den Grundschulen Therapeuten/Therapeutinnen und andere Fachkräfte gemeinsam mit den Lehrkräften (vgl. Hölter, 2008, S. 115f.).
Um eine positive Entwicklung der Schulen in Richtung Inklusion zu gewährleisten müssen die Dimensionen von Kulturen, Strukturen und Praktiken verstanden und umgesetzt werden. Hinz ist der Auffassung,
„dass Entwicklungsschritte in Richtung Inklusion produktiv zu werden versprechen, wenn sich
- Schulkulturen auf gewaltfreie Kommunikation und eine lebensbereichernde Pädagogik stützen und Werte wie Gleichwürdigkeit und Authentizität betonen,
- Schulstrukturen an Prinzipien von Democratic Schools orientieren und entspezialisierte, systematisch angelegte schulinterne und –externe Unterstützungssysteme etablieren und
- Schulpraktiken auf Ansätze des kooperativen Lernens in heterogenen Gruppen und Formen bürgerzentrierter Planung einbeziehen.“ (Hinz, 2010, S. 21)
Das folgende „Inklusionsdreieck“ trägt zur Veranschaulichung der oben genannten Punkte bei:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.4.2: Das Inklusionsdreieck (In Anlehnung an Hinz, 2010, S. 20)
Dass jede Schule auf Anhieb eine inklusive Schule werden kann, ist freilich eine in jeder Hinsicht utopische Vorstellung. Eher stellt Inklusion einen Prozess dar, den jede Schule beschreiten kann, wenn sie dies möchte und dabei unterstütze wird. Ein Grundstein auf dem Weg zur Inklusion ist die Ressourcenanalyse der eigenen Schule, was einen Schulentwicklungsprozess erst möglich macht. Sie bildet die Rahmenbedingung und Grundvoraussetzung für die Entwicklung einer Schule zur inklusiven Schule.
Esslinger-Hinz nimmt für die Analyse von Ressourcen eine Unterteilung in internale und externale Ressourcen vor. Als internale Ressourcen sind die Personen und die Umwelt der Personen zu verstehen. Die personalen Faktoren lassen sich in drei Bereiche einteilen: Erstens in schulrelevante Kompetenzbereiche, zweitens in materielle Ressourcen und schließlich in die allgemeinen psychischen und physischen Ressourcen. Bei den schulrelevanten Kompetenzbereichen wird eine direkte Unterteilung zwischen den Lehrkräften – berufliches Wissen, Sach-, Methoden-, Medienkompetenz, Kooperationsfähigkeit – und SuS – Verantwortung, Solidarität, Leistungsstand, Fähigkeit zur Selbst- und Mitbestimmung – vorgenommen. Bei den allgemeinen psychischen und physischen Ressourcen geht es beispielsweise um die Bereiche Interessen, Gesundheit, Optimismus und der motivationalen Bereitschaft. Die materiellen Ressourcen sind z.B. das Taschengeld der SuS oder das Einkommen der Lehrpersonen.
Wird von der Umwelt der Personen gesprochen, sind die Netzwerke und Kontakte gemeint, diese werden auch als soziale Ressourcen bezeichnet. Bei den sozialen Ressourcen handelt es sich bei der Lehrkraft z.B. um externe Hilfe, wie Beratungsgespräche und Bezugspersonen. Bei den SuS geht es unter anderem um die Bildungsnähe des Elternhauses und um die Peers, denen die SuS angehören.
Externale Ressourcen sind hingegen jene, die sich außerhalb von Personen befinden. Diese lassen sich zum einen in der Schule selbst finden, zum anderen in ihrer Umwelt. So handelt es sich bei der Institution Schule um strukturelle Ressourcen, wie Zeit-, Raum-, Arbeitsstrukturen, um ökologische Ressourcen, wie Architektur und Raumwahrnehmung, um materielle, finanzielle Ressourcen, z.B. den baulichen Zustand des Gebäudes und die Ausstattung der Schule, sowie schulkulturelle Ressourcen, wie Werte, Image und Normen der Schule.
Bei der Umwelt der Schule handelt es sich um die Netzwerke und Kontakte, z.B. Elternverein, Kontakte zu Stadt, Gewerbe und Künstler als Ressourcen und die ökologischen Ressourcen, wie z.B. die Lage der Schule und die soziale Situation im Stadtgebiet.
Indem Ressourcen der Schule einen Handlungsraum bereitstellen, wird Schule gestaltet. Wird die Schule im Fokus der Bedürfnishierarchie von Maslow gesehen, isz davon auszugehen, dass die Schule als Institution Grundbedürfnisse aufweist, die erfüllt werden müssen. Dabei bieten bedürfnisorientierte Konzepte Lösungsvorschläge an. Um konkrete Veränderungen herbeizuführen, ist es erforderlich, dass die Schulen als erstes das Ziel und den Willen besitzen, inklusive Schulen zu werden. Hierbei haben sie die gesellschaftlichen, schulpädagogischen und personellen Anforderungen zu berücksichtigen. Als nächstes steht die Durchführung einer Ressourcenanalyse an. Dabei wird geklärt, welche Ressourcen zur Verfügung stehen und wie diese eingesetzt werden können. Wobei die gezielte Nutzung und Einbeziehung dieser erst den letzten Schritt zu einer inklusiven Schule darstellt (vgl. Esslinger-Hinz, 2006, S. 45-70).
Ein weiteres Problem, dem sich Schulen stellen müssen, die sich der Inklusion verschreiben wollen, ist der materielle Widerstand. Dieser kann zu einem guten Teil durch Kreativität und gegenseitige Unterstützung überwunden werden. Personeller Widerstand kann jedoch zu einem ernsten Problem werden. Diesem können Schulen, die inklusiv werden wollen, durch Aufklärung wie Elternabende, Tage der offenen Tür, Schulprojekte oder Lehrer-Eltern-Stammtische entgegenwirken.
Die Inklusionsbewegung ist eine relativ junge Bewegung, kann sich aber auf die Integrationsforschung und deren über dreißigjähriger Tradition stützen.
Vorurteile in Bezug auf die Integration und deren Widerlegung werden im Folgenden aufgeführt, jedoch hier zugleich in abgewandelter Form auf die Inklusion bezogen.
Das erste Vorurteil besagt, dass Inklusion zwar möglich ist, jedoch nicht alle KuJ einbezogen werden können. Dem ist zu widersprechen. In den 70er Jahren gab es erste Bestrebungen, Kinder mit Behinderungen in Grundschulen einzugliedern. Eine Vorreiterrolle übernahm hierbei die Flämingschule in Berlin. Des Weiteren sind Schulversuche mit gemeinsamem Unterricht in Grund- und Regelschulen seit den 1980er Jahren in Deutschland immer wieder unternommen worden. Diese führten zur heutigen Schulpolitik, die sich – wenn auch schleppend – zum Gedanken der Inklusion hin entwickelt. Ein inklusiver Weg ist möglich, vorausgesetzt, wie schon erwähnt, es stimmen die Rahmenbedingungen wie beispielsweise die Klassenfrequenz oder das Zweipädagogensystem.
Weitere Vorurteile gehen davon aus, dass sich SuS mit Behinderungen benachteiligt fühlen könnten und durch den ständigen Leistungsvergleich mit ihren Mitschülern bloßgestellt und denunziert fühlen.
Jedoch belegen Studien, dass SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf keinesfalls diese Erfahrung machen. So schätzten mehr als 90 Prozent der Lehrer und Eltern das Wohlergehen der Kinder mit Behinderungen als positiv ein und konnten keine negativen Auswirkungen auf die Kinder ohne Beeinträchtigung feststellen. Auch die Problematik des ständiges Leistungsvergleichs ist leicht zu lösen, denn dieser sollte in der heutigen Pädagogik eher die Nebensache sein, wenn nicht sogar ganz aus den Köpfen verschwinden. Hier, wie auch fast überall, ist eine engagierte Lehrkraft nicht wegzudenken.
Weitere Bedenken gegen Inklusion bestehen dahingehend, dass die soziale Akzeptanz von SuS mit Behinderungen auf Seiten ihrer Mitschüler vorrangig negativ geprägt ist. Auch diese Befürchtung erweist sich als nicht stichhaltig. Gerade in der Fähigkeit, die gefühlten Schranken zwischen den Menschen zu verringern, liegt eine der großen Stärken der Inklusion. Durch sie entsteht ein alltäglicher Umgang mit Menschen mit Behinderung, der die soziale Akzeptanz zu erhöhen und einen gehemmten, unsicheren oder gar unwürdigen Umgang der Menschen untereinander zu vermeiden hilft. Je mehr Kontakt entsteht, desto mehr schwinden die Vorurteile und so ist erwiesen, dass die Akzeptanz von KuJ mit Beeinträchtigung in heterogenen Klassen deutlich höher ausgeprägt ist als in homogenen Klassen.
Einige Eltern, Lehrer und Politiker sind der Meinung, dass SuS mit Behinderungen in Regelschulen weniger Förderung bekommen als in Sonderschulen. Ein Blick in die internationale Schulforschung verdeutlicht hingegen, dass keine Erkenntnisse darauf hindeuten, dass SuS mit einer Beeinträchtigung eine geringere Leistungsförderung in Regelschulen bekommen würden. Im Gegenteil: Studien ergaben vielmehr, dass die Leistungsentwicklung mindestens identisch, in vielerlei Hinsicht sogar positiver verlief als an Sonderschulen.
Eine weitere Sorge ist, dass Kinder ohne eine Behinderung benachteiligt werden und einen Leistungsabfall in einer inklusiven Klasse verzeichnen würden. Dem wird widersprochen, vorausgesetzt der Unterricht erfolgt differenziert. Durch eben dieses differenzierte Unterrichtssystem ist es möglich, alle SuS ihrem individuellen Leistungsstand entsprechend unabhängig voneinander zu fördern. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass dadurch die SuS ohne Beeinträchtigungen bessere Lernergebnisse erzielen. Weiterhin lernen SuS einen besseren sozialen Umgang miteinander (vgl. Merz-Atalik, 2008, S. 13-16).
Immer wieder ist von mehrperspektivischem Unterricht die Rede. Meist wird der Begriff zwar zu Papier gebracht, aber die Realität sieht in einigen Bundesländern weiterhin anders aus. So ist der geschlechtlich getrennte Sportunterricht noch immer in einigen Bundesländern verankert. Soll dies die Grundvoraussetzung für inkludierten Unterricht sein? Wie soll Inklusion von KuJ mit Behinderung durchgesetzt werden, wenn noch nicht einmal die Gleichbehandlung der Geschlechter in der Schule gegeben ist (vgl. Wurzel, 2008, S. 139f.)?
Die Umstrukturierung hin zu einer inklusiven Schule ist ein schwerer und langwieriger Prozess, der mit sehr viel Formalien, Stress, Hartnäckigkeit und Herzblut verbunden ist. Es ist aber auch ein lohnender Prozess. Ein Prozess, der allen KuJ die Möglichkeit bietet, sich frei unter anderen KuJ zu entwickeln. Eine Gemeinschaft, in der niemand ausgeschlossen wird.
2.4.1.2 Ausgewählte Aspekte zum Vereinssport
Dieser Abschnitt setzt sich zum einen mit der Entwicklung des Vereinssports, zum anderen mit der Bedeutung des Vereinssports für KuJ mit und ohne Behinderungen auseinander. Damit wird das Sporttreiben von KuJ im außerschulischen Bereich näher betrachtet.
Der Sportverein
Sportvereine
„sind soziale Organisationen, die sich idealtypisch durch die Merkmale freiwillige Mitgliedschaft, Unabhängigkeit vom Staat, Orientierung an den Interessen der Mitglieder, demokratischen Entscheidungsstrukturen und ehrenamtliche Mitarbeit […] auszeichnen.“ (Anders, 2003, S. 549)
Durch die obengenannten Punkte, insbesondere aber durch die ehrenamtlichen Mitarbeiter wird gewährleistet, dass Vereine unabhängig von staatlicher Gewalt agieren können. Des Weiteren nehmen sie durch ihre nicht gewinnorientierte Organisationsstruktur einen Platz als Verbindungsstück zwischen Ökonomie und Staat ein. Ihre Aufgabe besteht unter anderem auch darin, Problemen sowohl in der Sozialpolitik als auch kulturpolitisch entgegenzuwirken (vgl. Markowetz, 2007, S. 377f.).
Seit dem Jahr 1816 gibt es die ersten Sportvereine, die einen großen Teil zur Entwicklung unserer heutigen Gesellschaft beitrugen. Heute sind etwa 28% der Deutschen in diversen Sportvereinen organisiert. Somit wird ein bedeutender Anteil der Freizeitaktivitäten der Deutschen in Sportvereinen betrieben. Besonders in ländlichen Gegenden bilden sie oft den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Die eben genannten Tatsachen zeigen, dass Sportvereine schon jetzt eine enorme Unterstützung für die Inklusion bieten können und bereits bieten. Anders als bei homogenen Sportvereinen für KuJ mit Behinderungen liegt der Organisationsgrad bei den 7-14-jährigen bei 68%.
Trotz der noch immer dominierenden Wettkampfsportarten in den Vereinen, 32% bieten Fußball, 17% Tischtennis, 14% Volleyball, 11% Leichtathletik, ist eine Entwicklung in Richtung Freizeitsport, welcher sich nicht am Wettkampfbetrieb orientiert, zu verzeichnen. Weiterhin stellen sich immer mehr Vereine auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitglieder ein, was sich beispielsweise durch präventive Gesundheitsorientierung und die Einrichtung von Bewegungszentren bemerkbar macht. Sportvereine leben durch die ehrenamtliche Tätigkeit, Etwa jedes dritte Mitglied eines Sportvereins ist ehrenamtlich aktiv (vgl. Anders, 2003).
2.4.1.3 Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen in Sportvereinen
Das folgende Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, welche Bedeutung die Vereine in der Entwicklung von KuJ einnehmen. Dabei spielt der Aspekt von Freizeit eine nicht unbedeutende Rolle. Auch beschäftigt sich dieser Teil der Arbeit mit den Gründen und motivationalen Aspekten, weshalb KuJ Vereine aufsuchen.
Zur Bedeutung von Vereinssport für Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen
Der Vereinssport nimmt für viele KuJ eine wichtige Rolle in ihrem Leben ein. Dies zeigt sich unter anderem in der Ausweitung der Sportangebote, der Zunahme der in Sport investierten Zeit in Sport und der hohen Zahl von KuJ, die immer früher einen Sportverein aufsuchen (vgl. Rheker, 1996, S.96f.). Studien haben ergeben, dass in der Phase der Kindheit der Vereinssport eine enorme Bedeutung für die Identitätsentwicklung aufweist. So werden 41 Prozent der Kinder im Alter von vier Jahren Mitglied eines Sportvereins. Im Jahr 2006 waren im Altersabschnitt zwischen vier bis zwölf Jahren, neun von zehn Mädchen und Jungen Mitglied in einem Verein.
Unter den Gesichtspunkten von Peers und Freundschaften gelangen Strzoda und Zinnecker zu folgenden Erkenntnissen:
„Bei Jungen ist offensichtlich alles entscheidend, ob sie an der sportiven Kultur teilnehmen oder nicht. Sportive Hobbys sind mit einer Zunahme sozialer Bindungen aller Art assoziiert, sowohl formeller (Verein, Schule) wie informeller (Jugendliche). Jungen ohne Sporthobby haben weniger Möglichkeiten zu sozialen Kontakten und dürften deshalb Nachteile beim Erwerb sozialen Kapitals haben.
Bei Mädchen teilt sich das Feld der Hobbys. Auf der einen Seite finden wir Sport und Kunst/Musik. […] Vereinfacht ausgedrückt sind es Mädchen, mit einem Sport-Hobby […], denen aufgrund institutionellen Einbindungen besonders die Möglichkeit zu spezifischen Freizeitlaufbahnen und damit zur Ansammlung von kulturellem (und auch sozialem) Kapital gegeben ist.“ (Schmidt, 2008, S. 375)
Doch diese Erkenntnisse sind nicht neu. Schon 1927 hat Hetzer anhand von der Beobachtung der Kinder ähnliche Schlüsse gezogen. So sah er z.B., dass Regelspiele sowohl die kognitiven Fähigkeiten als auch die soziale Entwicklung fördern. Weiterhin entdeckte er, dass KuJ durch sportliches Können ein verbessertes Selbstwertgefühl aufweisen. Zudem stellte er soziale und gesellschaftliche Vorteile des Sporttreibens fest. Durch die Verpflichtungen einer Mannschaft im Sportverein entwickeln sich Fähigkeiten des Vereinsmitgliedes wie beispielsweise die Gemeinschafts- und Toleranzfähigkeit (vgl. Schmidt, 2008, S. 380ff.).
Durch regelmäßige Besuche in einem Sportverein eignen sich diese Personen wichtige Schüsselqualifikationen wie soziale Kompetenz, Eigeninitiative und Kulturbewusstsein, an. Zwar entscheiden die Eltern zu Beginn über den Verein und die Sportart, aber ab einem gewissen Alter erwerben die KuJ die Fähigkeit, die Sportangebote nach ihren Interessen zu wählen. Dabei lassen sich zwei markante Motive erkennen, die KuJ veranlassen, einen bestimmten Verein zu besuchen. Das erste Motiv ist der Einfluss anderer. Großeltern, Bekannte, Eltern, aber besonders im späteren Verlauf die Peers beeinflussen in hohem Maße die Entscheidung der KuJ über den Eintritt in einen bestimmten Verein und eine bestimmte Sportart. Das zweite maßgebliche Motiv ist von der sachbezogenen Ebene abhängig. Hierbei handelt es sich um das Agieren aufgrund der intrinsischen Motivation der KuJ, also um einen selbstständigen inneren Antrieb ihrerseits. Diese Motivation kann, bewusst oder unbewusst, in der Stärkung des Selbstwertgefühles oder ein Erreichen einer höheren sozialen Akzeptanz bestehen (vgl. Schmidt, 2008, S. 380ff.).
80 Prozent der Kinder fühlen sich in ihrem Sportverein wohl und 71,9 Prozent sind mit den Leistungen ihres Trainers, besonders im Bezug auf seine sozialen Kompetenzen, zufrieden. So lässt sich abschließend sagen, dass die Bindung zum Sportverein an die Atmosphäre und die gute Stimmung – dies sagen 72,2 Prozent der KuJ aus – und das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Mannschaft – diese Aussage machten 66,2 Prozent der Mädchen und Jungen – gekoppelt ist. Diese Zahlen unterstreichen, welch hohen sozialen Auftrag den Vereinen zukommt. Die Gewichtigkeit des Gemeinschaftsgefühls zeichnet sich nicht nur im Amateursport ab, sondern lässt sich in allen Leistungsklassen nachweisen. Sport mit KuJ bietet auch die Möglichkeit, sie auf ihr späteres Leben als Erwachsene vorzubereiten. Hier lernen sie den Umgang mit Erfolg, Niederlagen und Rückschlägen. Sie lernen den Umgang mit anderen, die Akzeptanz von Meinungen, das Einfügen in eine Gemeinschaft und vieles mehr. Somit lässt sich feststellen, dass Sportvereine in großer Verantwortung in Bezug auf die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit stehen. Das Einbeziehen von allgemein-koordinativen und sportartenübergreifenden Srequenzen im Training, aber auch die Forderung nach pädagogisch-psychologisch qualifizierten Trainern ist für eine positive Entwicklung und die Erhaltung der Attraktivität von Sportvereinen für KuJ von Nöten (vgl. Schmidt, 2008, S. 380ff.).
Zur Problematik von Freizeit bei Kindern und Jugendlichen ohne Behinderungen
„Sich Wohlfühlen, das tun und lassen können, was Spaß und Freude macht, und das Leben in eigener Regie gestalten sowie viel mit Familie und Freunden unternehmen“, so definiert Opaschowski (2007, S. 36) den Begriff Freizeit.
Opaschowski unterteilt Freizeit in vier Dimensionen: Als Eigen-, Bildungs-, Sozial-, und Arbeitszeit (vgl. Opaschowski, 1990, S. 17-73). Für das Freizeitverhalten von KuJ ist wohl die Dimension der Sozialzeit die bedeutendste Dimension; dort wird mit Freunden über wichtige Dinge gesprochen und gemeinsam etwas unternommen, Kommunikation findet statt.
Circa zwei Drittel aller Nachmittagsbeschäftigungen sind auf den Sport zurückzuführen. So ist auch hier festzustellen, dass sich das Freizeitverhalten der KuJ positiv für Sportvereine auswirkt. Schon in jungen Jahren veranlassen Eltern, dass ihre Kinder einen Sportverein aufsuchen und schaffen somit – neben dem Kindergarten und der Schule – einen weiteren Weg zur gesellschaftlichen Eingliederung und Sozialisierung.
50 Prozent der Kinder besuchen im Durchschnitt wöchentlich zweimal den Verein, 30 Prozent nehmen sogar bis zu fünfmal in der Woche am Training teil. Auch Mehrfachmitgliedschaften treten heutzutage vermehrt auf, so dass circa ein Drittel aller Vereinsmitglieder sich in etlichen Sportarten betätigt (vgl. Schmidt, 2008, S. 374).
2.4.1.4 Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Sportvereinen
Das folgende Kapitel setzt sich mit der Frage auseinander, welche Bedeutung die Vereine in der Entwicklung der KuJ mit Behinderungen einnehmen. Dabei spielt der Aspekt von Freizeit eine große Rolle. Auch beschäftigt sich dieser Teil der Arbeit mit den Gründen und der motivationalen Aspekte, aus denen KuJ mit Behinderungen Vereine aufsuchen. Weiterhin wird die Problematik der Inklusion in Sportvereinen angesprochen und hierzu verschiedene Studien und Projekte, wie z.B. die PFiFF-Studie, vorgestellt.
Zur Bedeutung des Sportvereins für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
Es gibt verschiedene Sichtweisen zum Sport von Menschen mit Behinderungen, vom traditionellen Ansatz einer Behindertensportpädagogik über den medizinisch-therapeutischen Ansatz, dem interaktionsorientierten Ansatz bis hin zum Normalisierungsprinzip (vgl. Rheker, 1993, S. 54 und 1996, S. 8-17; Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S. 22ff). Bei inkludiertem Sport geht es grundsätzlich um das Entgegenwirken von Aussonderung und Isolierung und zur Unterstützung der gesellschaftspolitischen Gleichheit aller.
Wenn man nach dem Gesetz der Gleichbehandlung – Grundgesetz Artikel 3, Absatz 3 – argumentiert, sollte jedem Menschen mit und ohne Behinderung die Möglichkeit gegeben werden, in jedem Sportverein aktiv zu werden. Fraglich ist jedoch, wie es die einzelnen Vereine sehen und der/die Betroffene selbst. Möchte er überhaupt in einen Verein mit Menschen ohne Behinderung? Aber nicht nur diese Sichtweisen spielen eine Rolle. Wenn beide Parteien oben genannte Fragen bejahen, rücken die Gegebenheiten des Vereins in den Blickpunkt. Wie sieht es mit den räumlichen Bedingungen aus, ist z.B. die Sporthalle barrierefrei und sind qualifizierte Trainer vorhanden, die Menschen mit Behinderung beim Sporttreiben begleiten?
Durch die Entwicklung der Behindertensportverbände ist anzunehmen, dass auch die Trennung in den Köpfen noch immer eine starke Bedeutung hat. Schaut man tiefer in die Struktur und die Geschichte von Behindertensportvereinen, so wird offensichtlich, dass viele noch immer ihr Hauptaugenmerk auf die Rehabilitation legen, während in den Sportvereinen für Menschen ohne Behinderungen ein Trend vom leistungs- und körperbetonten Sport in Richtung Spiel und Spaß erkennbar ist. Laut Rheker (1996, S. 103) und Markowetz (2007, S. 376f.) fühlen sich viele Mitglieder in ihrem Behindertensportverein sehr wohl, jedoch wünschen sie sich, dass auch Menschen ohne Behinderung in ihren Verein eintreten. Eine positive Tendenz seitens der Sportvereine für Menschen mit als auch jene ohne Behinderungen ist darin zu sehen, dass beide Seiten in Richtung heterogene Sportgruppen hinarbeiten. Jedoch ist die derzeitige Inklusionsgeschwindigkeit viel geringer, als es sich die Fachleute, Eltern, Betroffenen und der Staat selbst erhoffen. Ein großes Problem sind dabei die differenzierten Angebote sportlicher Maßnahmen auf beiden Seiten, die ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Inklusionsverständnis bedürfen, um die Schranken abzubauen.
Die Motive für den Eintritt in einen Verein müssen differenziert aus Sicht der Eltern und der KuJ mit Behinderung betrachtet werden. In der Regel wollen die Eltern, dass es ihrem Kind gutgeht. Dabei geht es um die körperliche Gesundheit und deren Erhaltung und Förderung, aber auch um die seelische, soziale Gesundheit ihres Schützlings. Anders hingegen ist es in der Regel bei den KuJ. Ihnen geht es zunächst wohl vielmehr um die Freude am Sporttreiben und – mit zunehmendem Alter mehr und mehr – sicher auch um die Aussicht, andere Menschen kennenzulernen. Positive Begleiterscheinungen wie eine bessere Fitness, ein möglicherweise gestiegener Bewegungsspielraum sind wohl eher gern in Kauf genommene als maßgebliche Motivationen – es sei denn, ihre Eltern haben sie im Vorfeld explizit auf diese Vorzüge hingewiesen und ihnen damit den Vereinsbeitritt schmackhaft gemacht. Generell ist davon auszugehen, dass KuJ mit Beeinträchtigungen ebenso gern Fußball und Badminton spielen oder schwimmen wie alle anderen KuJ auch.
Durch den Besuch eines Sportvereins wird die psychische und physische Entwicklung von KuJ mit Behinderung positiv beeinflusst. Sporttreiben verbessert nicht nur ihre Beweglichkeit und Kondition, das Vereinsleben hält noch weitaus mehr positive Aspekte bereit. Es fördert das Vertrauen in sich selbst und andere, die Konzentrationsfähigkeit, das Reaktionsvermögen und vieles mehr. Aber insbesondere trägt es dazu bei, die Selbstständigkeit und Selbstsicherheit von Menschen zu erhöhen, die einen Hilfebedarf haben. Menschen mit Behinderungen haben wie alle anderen auch einen Bewegungsdrang, der sie dazu verleitet, Sport zu treiben und zu spielen. Natürlich hat der Behindertensport präventive und therapeutische Funktionen. Doch muss auch neben lehrreichen und bildungsorientierten Sequenzen die soziale Seite berücksichtigt werden. Die Inklusion im Sport bietet Menschen mit Beeinträchtigungen eine höhere Lebensqualität und den Zugang zu einem normalisierten, gleichberechtigten Leben (vgl. Markowetz, 2007, S. 339-419).
Vorstellung ausgewählter Projekte und Studien
Viele Eltern sind auf der Suche nach einer inkludierten Lösung für ihr Kind mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung. So geben viele ihre Schützlinge schon im Kleinkindalter in integrative Kindergärten, in denen sie mit Gleichaltrigen eine gemeinsame Kindheit erleben. Früher oder später stellt sich jedoch die Frage, wenn das Kind mit einer Beeinträchtigung im Kindergarten mit den anderen zusammen spielt und lernt, warum soll es nicht gemeinsam mit ihnen auch seine Freizeit verbringen und einen Sportverein aufsuchen? Doch in den meisten Fällen wird die Suche nach einem geeigneten Sportverein, der auch inklusiv agiert, zur Tortur. Viel zu hoch erscheinen bei vielen Trainern die Vorbehalte, noch dazu sehen viele dies vor allen Dingen mit zusätzlichen Problemen und einem erhöhten Zeitaufwand verbunden, den die ehrenamtlichen Mitglieder nicht aufbringen können – oder wollen. Finden die Familien dennoch einen Verein, so ist dieser oft wohnortfern anzutreffen (Markowetz, 2008, S. 183f.). Durch weite Entfernungen und viele Rückschläge bei der Suche wird sich bei den Familien eine nachlassende Motivation begünstigt, die den Gedanken entstehen lässt, dass es vielleicht doch besser wäre, einen Verein aufzusuchen, in dem nur Menschen mit Behinderung trainieren. Maslow vertritt die Ansicht, dass „wenn die Bedrohung überwältigend ist oder wenn der Organismus zu schwach oder hilflos ist, um mit ihr fertig zu werden, neigt er dazu, zu desintegrieren“ (Maslow, 1991, S. 57). Übertragen bedeutet dies, wenn die Familie trotz intensiver Suche immer neue Rückschläge. z.B. durch das ablehnende Verhalten der Vereine gegenüber ihrem Kind, erfährt, kann es passieren, dass sie resigniert und die isolierte Lage ihres Kindes akzeptiert. Aber auch das Kind selbst kann dieses Verhalten entwickeln, wenn es z.B. in einem Verein immer separat und nie gemeinsam mit den anderen Kindern trainiert und spielt.
Im Folgenden werden Projekte und Studien vorgestellt, die sich mit inkludiertem Sport beschäftigen.
Es reicht nicht aus, in einem Bereich, z.B. dem Kindergarten, KuJ mit Behinderung einzubeziehen, diese aber in anderen Lebensbereichen, z.B. Sport und Freizeit, wieder zu isolieren (vgl. Rheker, 2008, S. 159). So entstand in Paderborn bereits 1982 ein Familiensportverein, in dem Familien mit ihren KuJ mit und ohne Behinderungen gemeinsam Sport treiben und weitere Freizeitaktivitäten, wie Spielfeste, Ausflüge und Wanderungen, organisieren (vgl. Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S. 71f; Rheker 1993, S. 57-78; Rheker, 1996, S. 53-63; Rheker, 2008, S. 159-180). Voraussetzungen für die Organisation einer solchen Sportgruppe und viele Anwendungsbeispiele sind bei Rheker (1993, S. 85-214) zu finden. Ein weiteres langjähriges Praxisbeispiel, was erfolgreich gemeinsamen Sport seit dem Jahr 1985 mit Studierenden der Universität-Gesamthochschule Paderborn vollzieht, ist der Paderborner Ahorn-Panther e.V., der anfänglich zwei Sportangebote unterbreitete und heute in 15 Abteilungen 36 Sportgruppen trainiert (vgl. Rheker, 1996, S.83-95; http://www.ahornpanther.de/index.html).
Die Studie „Bewegung, Spiel und Sport mit behinderten Kindern und Jugendlichen“
Seit 1983 ermöglicht es die Universität in Paderborn ihren Studenten, eine Zusatzqualifikation im Bereich Behindertensport zu erlangen. Im Jahre 1987 begann das dreieinhalbjährige Projekt “Bewegung, Spiel und Sport mit behinderten Kindern und Jugendlichen“. Dabei ging es um folgende Fragen:
- „Wieviele Kinder und Jugendliche mit Behinderungen treiben regelmäßig Sport?
- Gibt es eine ausreichende Zahl von geeigneten Sportangeboten oder existieren Defizite?
- Erreicht der organisierte Sport mit seinen Angeboten die Heranwachsenden mit Beeinträchtigungen, d.h., sind die Sportprogramme entsprechend auf die Adressatengruppen ausgerichtet?
- Welchen Stellenwert nimmt der Sport im Freizeitverhalten von KuJ mit Behinderung ein? Aus welchen Gründen treiben sie Sport, wie sehen sie selbst ihren Sport?
- Welcher Art sind die Zusammenhänge sportiver Praxis und Lebensorientierung? In welchem Maße beeinflussen etwa gesellschaftliche Zusammenhänge das Sportengagement und das Sportverständnis von KuJ mit Behinderungen?“ (Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S.13)
Neben einem qualitativen Interviewleitfaden gab es auch eine quantitative Befragung, bei der 166 KuJ mit Behinderungen einen Fragebogen erhielten, wovon 105 KuJ diesen mit Hilfe von Betreuern oder Eltern beantworteten. Dabei kamen unter anderem folgende Ergebnisse heraus:
- Die wichtigste Freizeitbeschäftigung ist Musik oder Radio hören. Passive und konsumierende Freizeitgestaltung nimmt somit einen Großteil der Freizeit ein,
- Der Bereich Kommunikation in der Freizeit ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil, wird mit zunehmendem Alter jedoch geringer,
- Aktive Freizeitbeschäftigungen spielen für KuJ eine untergeordnete Rolle,
- 58,93 Prozent (allein beantwortet) und 71,27 Prozent (mit Hilfe beantwortet) sahen Sport als einen wichtigen Bereich in ihrem Leben,
- Sporttreiben nimmt eine wichtige Rolle im Leben der KuJ mit Behinderung ein.
(vgl. Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S. 39ff.).
Weiterhin wurde untersucht, welche Motivation KuJ mit Behinderungen zugrunde liegt, wenn sie einen Sportverein aufsuchen. Eine zentrale Rolle spielte bei den KuJ der Spaß, gefolgt von Gesundheit und Fitness und dem sozialen Motiv. Weiterhin gaben 46,67 Prozent an, die Anregung zum Sport durch die Familie erfahren zu haben. (vgl. Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S. 41ff.). In Bezug auf die Freizeitgestaltung von KuJ mit Behinderungen kam die Studie zu dem Ergebnis, dass diese noch immer große Benachteiligungen erfahren:
„Sie sind durch äußere Barrieren […], durch Einstellungen und Vorurteile der nichtbehinderten Menschen und durch die Abhängigkeit von Institutionen bzw. Familienangehörigen ausgeschlossen.“ (Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, S. 49)
Inkludierter Sport ist primär im Bereich Freizeitsport anzutreffen. Dabei umfasst der Begriff Freizeitsport hier ein vielfältiges Angebot für alle Sporttreibenden, mit einem wechselseitigen Lernprozess, in dem sich Inhalte des Sportangebotes nach den Wünschen und Bedürfnissen der Mitglieder richten und die in inkludierten Gruppen ohne Erfolgs-, Leistungs- oder Konkurrenzzwang miteinander Sport treiben. Dies sind enorme Anforderungen für die Trainingsleiter/Trainingsleiterinnen (vgl. Ministerium für Stadtentwicklung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 1996, 19ff.).
Die PFiFF-Studie
Ein weiteres Projekt trägt den Namen PFiFF – Projekt zur Förderung integrativer Ferien- und Freizeitangebote – und wird im Folgenden näher erläutert.
Das Modellprojekt PFiFF setzt sich für den Eintritt von KuJ mit Behinderungen in wohnortnahen Vereinen ihrer Wahl ein und schafft damit die Grundvoraussetzung für eine Eingliederung im Lebensbereich Freizeit (vgl. Markowetz, 2008, S. 186). Das von der Jugendstiftung in Baden-Württemberg durchgeführte, finanzierte und dem Assistenz-Modell zugrunde liegende Projekt wurde über einen Zeitraum von drei Jahren betrieben. Das Projekt ging von der Annahme aus, dass die Förderungsmöglichkeiten der Interaktionen von KuJ mit und ohne Behinderungen über ein großes Potenzial verfügen. Dies gilt es zu nutzen. Darüber hinaus versuchte das Projekt, den KuJ mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit zu geben, einen Verein nach ihren Wünschen zu besuchen, was durch professionelle Begleitpersonen und Assistierende verwirklicht werden sollte. So gliederte sich das Projekt in folgende sechs Phasen:
1. „Erstgespräch mit den Eltern und Finden geeigneter Assistent/-innen
2. Kontaktphase der Assistentin/des Assistenten mit dem Kind und der Familie
3. Suche nach einem geeigneten Freizeitverein
4. Integration und Mitgliedschaft im Verein auf Probe
5. Reflexion der Mitgliedschaft auf Probe und der gemachten integrativen Erfahrungen
6. Stabilisierung der Integrationsmaßnahme und Überführung in die ,Normalität‘.“ (Markowetz, 2007, S. 380)
Bevor eine Familie diesen Entschluss fasst und einen Antrag auf Eingliederungshilfe nach den §§ 39/40 Absatz 1 Nummer 8 Bundessozialhilfegesetz (BSHG) oder § 35a Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) stellt, bietet PFiFF e.V. sich als Kontaktstelle an, bei der sie eine kostenfreie Beratung erhalten können. Nach dieser entscheiden die Eltern nun, ob sie einem Antrag auf Vermittlung ihres Kindes in einen Verein und die Begleitung der Maßnahme durch einen/einer Assistenten/Assistentin zustimmen. Fällt die Entscheidung für dieses Projekt, beantragen die Eltern bei den zuständigen Sozial- und Jugendämtern die Eingliederungshilfe.
Nach Zuspruch auf Eingliederungshilfe erfolgt der Kontakt zu einem/einer Assistenten/Assistentin. Dieser Kontakt ist gekennzeichnet durch Gespräche, Besuche mit Hospitationen und den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen. Dabei wird ein Zeitraum von vier bis sechs Wochen veranschlagt, in der der/die Assistent/Assistentin ein bis zweimal in der Woche die Familie bis zu vier Stunden besucht. In dieser Zeit lernt er/sie auch die Familienstrukturen näher kennen.
Ist dies erfolgreich gelungen, beginnt die Suche nach einem geeigneten Verein für das Kind oder den Jugendlichen. Wichtig dabei sind die Wohnortnähe und die Berücksichtigung der Wünsche des KuJ. Durch die Wohnortnähe wird gewährleistet, dass mögliche neue Kontakte auch über den Verein aufrecht erhalten und gepflegt werden können. Zudem besteht die Möglichkeit, dass andere Kinder aus dem sozialen Umfeld der KuJ mit Behinderungen ebenfalls den Verein aufsuchen. Auch durch solche gemeinsamen Besuche können Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen abgebaut werden.
Die Kontaktaufnahme zum Verein nimmt der/die Assistent/Assistentin auf. Mithilfe seiner/ihrer Professionalität versucht er/sie, die verantwortlichen Trainer für seine/ihre Sache zu gewinnen. Im folgenden Schritt erfolgt die Eingliederung in drei Phasen und geschieht über einen Zeitraum von maximal neun Monaten.
Während der ersten Phase sind die KuJ Mitglieder auf Probe. Dabei hilft der/die Assistent/Assistentin dem jeweiligen KuJ in allen Dingen, damit ein möglichst reibungsloser Ablauf gewährleistet ist, der auch dem Trainer die Umstellung erleichtert. Ihm soll dabei das Gefühl vermittelt werden, dass das Kind/der Jugendliche keine zusätzliche Belastung für ihn darstellt. Weiterhin muss darauf geachtet werden, dass der/die Assistent/Assistentin das Kind/den Jugendlichen nicht in Abhängigkeiten bringt, dass er/sie nicht zu sehr auf ihn/sie fixiert.
In der zweiten Phase findet nach einem angemessenen Zeitraum eine Reflexion der gemachten Erfahrungen mit dem Kind auf Probe statt. Hierbei ist von besonderer Bedeutung, dass jeder, der an diesem Prozess beteiligt war, sich äußert, von den Eltern bis zu den Vereinsmitgliedern sollte jeder Meinung Beachtung geschenkt werden. Erst dann wir das Votum für oder gegen ein weiteres gemeinsames Vorgehen erteilt. Ist ein Abbruch der Maßnahme das Ergebnis, gilt es, dies nicht als Rückschlag zu sehen, sondern als Erfahrung. Wenn die mögliche erste Enttäuschung verwunden ist, ist ein zweiter Versuch oft die richtige Wahl, entweder im selben Verein oder in einem anderen, zu entscheiden.
Der ideale Fall ist natürlich ein gemeinsames positives Votum und damit der Übergang in die dritte Phase. Hier geht es um die Stabilisierung der Maßnahmen. Nun ist angedacht, dass sich der/die Assistent/Assistentin immer mehr vom Geschehen distanziert, die Rolle des Beobachters einnimmt. Zusätzlich gibt er/sie Anregungen für die Gestaltung des Trainings und überträgt so schrittweise die Verantwortung an den Trainer. Die Eingliederung des Kindes/Jugendlichen in den Status eines normalen Vereinsmitglieds und somit in die Normalität ist vollzogen (vgl. Markowetz, 2007, S 419-431; Markowetz, 2008, S. 183-198).
Sportvereine bieten einen idealen Raum, um soziale Kontakte zu entwickeln. Sie bieten die Möglichkeit als Inklusionsraum zu agieren für ein gemeinsames Handeln zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Die Individualität jedes Einzelnen darf jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, so Markowetz:
„Mit Blick auf die Wertschätzung der grundsätzlichen Gleichheit aller Menschen und die dennoch objektiv bestehenden individuellen Differenzen sollte es heute wie morgen im Freizeitbereich neben einem breiten integrativen Angebot nach wie vor auch noch spezielle Angebote für sowohl nichtbehinderte als auch behinderte Menschen geben.“ (Markowetz, 2007, S. 379)
Behinderte helfen Nichtbehinderten
In den oben genannten Beispielen für Inklusion sind die Initiatoren ausschließlich Menschen ohne Behinderungen. Im nächsten Praxisbeispiel geht es darum, dass Sportler und Sportlerinnen mit Behinderung den SuS ohne Behinderungen helfen. “Behinderte helfen Nichtbehinderten“ (BhN) – so nennt sich der Verein, im Internet zu finden unter „www.bhn-online.de“ – wurde im Mai 1996 gegründet. Die Idee brachte Reinhild Möller aus den USA mit, wo ähnliche Schulprojekte bereits durchgeführt werden (vgl. Scheid, 2008, S. 143). Dabei gehen Sportler und Sportlerinnen mit körperlichen Behinderungen in die Schulen und stellen so den Kontakt mit KuJ ohne Beeinträchtigung her. Ziele des Projektes sind der Abbau von Berührungsängsten, der Ausbau von Handlungskompetenzen von SuS gegenüber Menschen mit Behinderungen, eine positive Entwicklung der Wahrnehmung und des sozialen Verhaltens im Bezug auf Menschen mit Behinderungen. Weiterhin wird das Ziel verfolgt, den Begriff Leistung in unserer Gesellschaft zu relativieren (vgl. Scheid, 2008, S.144).
Scheid fragte nach der Wirkung der Unterrichtsbesuche von Sportlern und Sportlerinnen mit Behinderung und nahm eine Evaluation an verschiedenen Gymnasien vor. Hier wurde festgestellt, dass eine ablehnende Haltung und Angst gegenüber Menschen mit körperlichen Behinderungen schon zu Beginn gering ausgeprägt war. Durch dieses Projekt wurden demnach Unsicherheiten abgebaut und das Interesse und die Neugierde am alltäglichen Leben und die sportliche Betätigung von Menschen mit körperlichen Behinderungen geweckt. Nach dem Abschluss des Projektes fühlten sich die SuS selbstbewusster und sicherer im Umgang mit Menschen mit körperlichen Behinderungen. Auch die Einstellung zum sportlichen Verhalten änderte sich enorm. Waren es im Vorfeld 40 Prozent der SuS, die ein sportliches Verhalten von Menschen mit körperlichen Behinderungen erwarteten, stieg die Zahl auf 80 Prozent nach Beendigung des Projektes (vgl. Scheid, 2008, S. 149-153). Zwei Drittel der befragten SuS waren am Ende der Meinung, dass, wenn sie einen/eine Mitschüler/Mitschülerin mit einer körperlichen Behinderung in ihrer Klasse hätten, dieser/diese den Schulalltag nicht negativ beeinflussen würde und konnten sich sogar vorstellen, mit ihm/ihr nach der Schule gemeinsam das Schwimmbad zu besuchen (vgl. Scheid, 2008, S. 154f.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Pieter Heubach (Autor:in), 2012, Problematik der Inklusion von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im Sport, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/209215
Kostenlos Autor werden














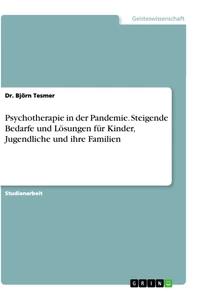





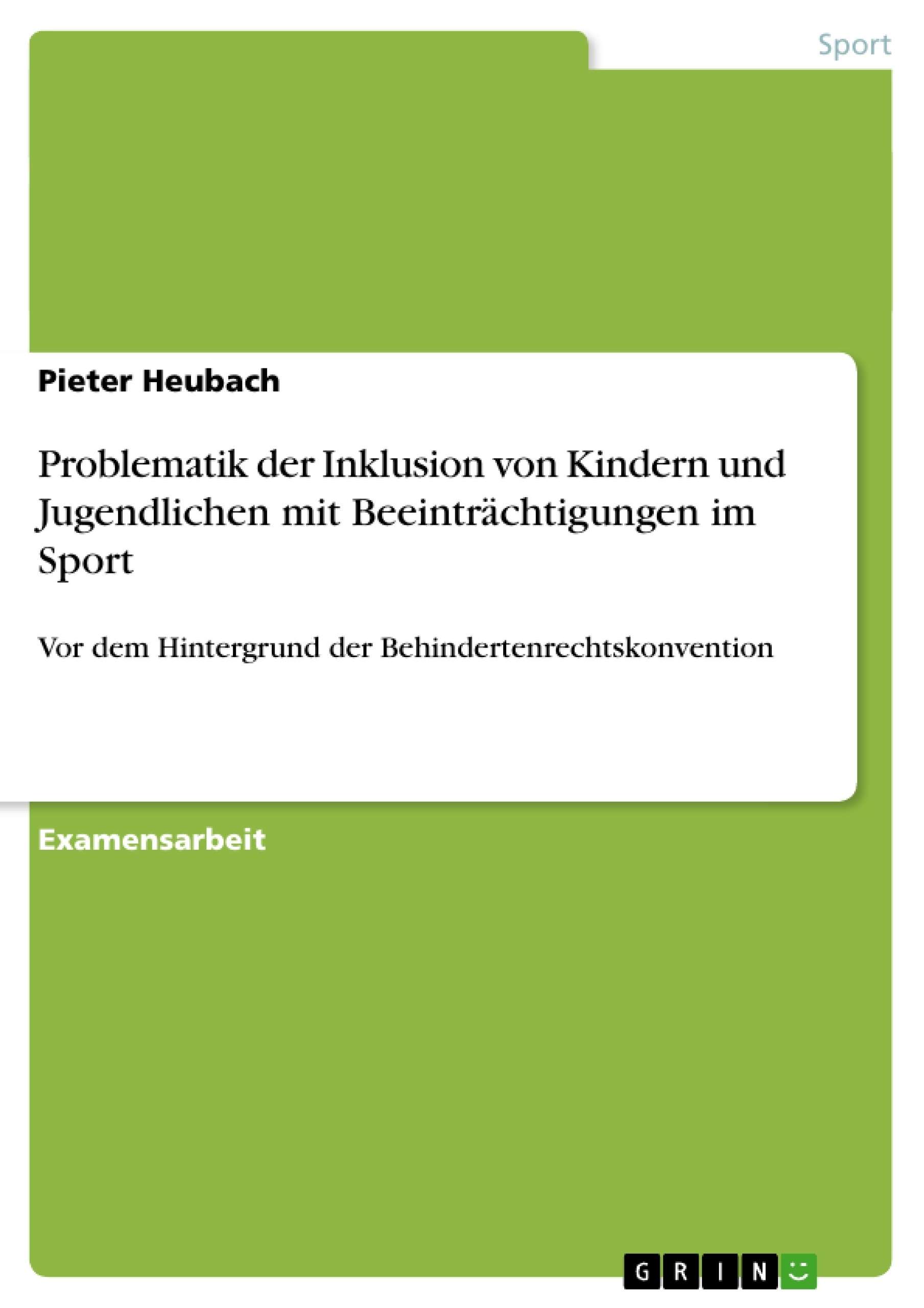

Kommentare