Excerpt
Inhaltsverzeichnis
0. On what this is
1. Ontologie
1.1. Carnaps Metaphysikkritik
1.2. Quines ontologische Verpflichtungen
1.3. Strawsons Unterscheidung in deskriptive und revisionäre Metaphysik
1.4. Materielle oder physikalische Objekte
2. Die Ontotheorie dreidimensionaler Objekte
2.1. Diachrone Identität dreidimensionaler Dinge
2.2. Kritik des Dreidimensionalismus
3. Die Ontotheorie vierdimensionaler Objekte
3.1. Analogie von Raum und Zeit
3.2. Kritik des Vierdimensionalismus
3.2.1. Kritik der Raum-Zeit Analogie
3.2.2. Kritik der Objekt- und Gegenstandsauffassung
3.3. Vor- und Nachteile einer Theorie vierdimensionaler Objekte
4. Mereologie
4.1. Von den Teilen zum Ganzen
4.1.1. Mereologischer Nihilismus
4.1.2. Mereologischer Universalismus
4.1.3. Inwagens Kriterien der Zusammensetzung
4.1.3.1 Exkurs: Inwagens material beings
4.1.4. Zwischenbilanz
4.2. Komplexe Gegenstände
4.2.1. Chisholms mereologischer Essentialismus
4.2.2. Konstituenten und Struktur komplexer Gegenstände
4.2.3. Eigenschaften komplexer Gegenstände
4.3. Diachrone Identität und Veränderung komplexer Gegenstände
4.4. Vom Ganzen zu den Teilen
4.5. Resümee
5. Ein ontotheoretisches Zwei-Ebenen-Modell
5.1. Veränderung und die Theorie der relevanten Teile
5.2. Konstante Teile und veränderliche Ganze
5.3. Die Vierdimensionalität komplexer Gegenstände
5.4. Vierdimensionale Gegenstandsauffassungen
5.5. Ontologische Abhängigkeit
5.6. Eigenschaften des ontotheoretischen Zwei-Ebenen-Modells
6. On what this was
7. Literaturverzeichnis
„The dispute over whether the physical world is really 3D or 4D is (...) empty. It may be both, or it may be neither, or it may be either, depending on which features of the world we wish to focus on.” (McCall und Lowe)
“Spricht man aber genau der Wahrheit der Dinge gemäß, so kann man nicht sagen, dass sich dasselbe Ganze erhält, wenn ein Teil von ihm zugrunde geht. Was aber körperliche Teile hat, kann dem nicht entgehen, dass in jedem Augenblick einige davon zugrunde gehen.“ (Leibniz)
„In Absehung von unseren Zwecken betrachtet, wären Artefakte nichts weiter als Akkumulation oder Aggregate ihrer materiellen Bestandteile; indem wir aber die Sandanhäufung als Deich behandeln, erhalten wir einen neuen, anderen Gegenstand, der seine Existenz unserer Zweckgebung verdankt; es handelt sich gewissermaßen um eine Existenz für uns.“ (Rapp)
0. On what this is
Was gibt es eigentlich alles so?
Was sind die Dinge, die es gibt?
Was ist Teil der Welt?
Was existiert?
Was ist?
Jede dieser Fragen fragt auf ihre Weise nach dem Sein. Die Ontologie als Lehre vom Sein hat in allen ihren Ausprägungen stets versucht, obige Fragen zu beantworten, indem sie jeweils einen Katalog von seienden Entitäten verschiedener Art aufgestellt hat. Ein Blick auf die Vielfalt dieser Versuche[1] macht offensichtlich, dass sich das Sein, oder das, was ist[2], nicht an sich zeigt, sondern sich uns Philosophen immer nur als Für–uns bemerkbar macht. Das Seiende insgesamt zeigt sich und verhält sich zu uns also nicht in einer Weise, die nur eine Möglichkeit des Aufgebautseins des Seins denkbar erscheinen ließe. Im Gegenteil, es ist[3] vielmehr so, dass sich das Für–uns des Seienden unterschiedlich bezüglich seiner Struktur interpretieren lässt.
Allein daraus, dass zwei Beschreibungen dessen, was ist, verschieden sind, folgt allein nicht, dass eine der beiden Beschreibungen unzutreffend sein muss.[4] Möglich ist, dass zwei Beschreibungen des Seienden lediglich unterschiedliche Perspektiven auf das, was ist, haben, ohne sich jedoch zu widersprechen. Denkbar ist weiterhin, dass zwei Beschreibungen des Seienden, die sich offensichtlich gegeneinander abgrenzen und somit unvereinbar scheinen, sich unter der Annahme, dass sie jeweils eine verschiedene Perspektive auf das, was ist, einnehmen, kombinieren lassen.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, dies für die konkurrierenden Beschreibungen des Seienden einmal als dreidimensionale Entitäten und ein anderes Mal als vierdimensionale Entitäten zu leisten. Dazu werden nach einer generellen Einführung in die Ontologie und ihre wichtigsten Begriffe sowie nach einer Klärung der Grenzen dieser Arbeit (Kapitel 1) zunächst die sich scheinbar ausschließenden Beschreibungen dessen, was ist, zuerst als dreidimensionale Entitäten (Kapitel 2) und danach als vierdimensionale Entitäten (Kapitel 3) vorgestellt und diskutiert. Hierbei werden im Fall des Dreidimensionalismus die Probleme der diachronen Identität dargestellt und im Fall des Vierdimensionalismus die Raum-Zeit Analogie sowie der sich ergebende Objekt– oder Gegenstandsbegriff problematisiert.
Über die Vorstellung der konkurrierenden Beschreibungen des Seienden hinaus wird es für eine Kombination derselben notwenig sein, die in letzter Zeit zunehmend an Beachtung gewinnende Theorie der Ganzen und ihrer Teile, die Mereologie, in ontologisch interessanter Weise vorzustellen und einige Kritikpunkte an ihr zu formulieren (Kapitel 4).
Nach dieser Bereitung des Feldes, so wie es sich in der Literatur darstellt, wird es möglich sein, die hier zunächst nur angekündigte Unterschiedlichkeit der jeweiligen Perspektiven zu erläutern und die konkurrierenden Beschreibungen dessen, was ist, in einer Beschreibung zu integrieren (Kapitel 5). Hierbei wird dafür zu argumentieren sein, dass sich durch eine solche Kombination des Dreidimensionalismus und des Vierdimensionalismus die in den Kapiteln 2, 3 und 4 dargestellten Probleme nicht mehr ergeben, sowie dafür, dass einige ontologische Probleme einer Lösung zugeführt werden können.
Es ist ersichtlich, dass die eingangs gestellten Fragen nicht oder zumindest nicht in dem klaren, erwünschten Sinn beantwortet werden. Stattdessen werden Antworten auf folgende Fragen vorgeschlagen:
1. Wann ist etwas ein Gegenstand? Was macht etwas zu einem Gegenstand?
2. Was heißt es, von einem Ding auszusagen, es verändere sich und bliebe doch es selbst?
3. Wie ist das Verhältnis zwischen einem Ganzen und seinen Teilen ontologisch einzuordnen?
Dass die eingangs gestellten Fragen nicht weiter direkt behandelt werden, ist dabei nicht als ein Nachteil oder Versäumnis dieser Arbeit anzusehen. Quine hat auf eine Frage wie diese („Was gibt es?“) in seinem vielbeachteten Aufsatz „On What There Is“ ebenso einfach wie unbeantwortend mit „Alles!“ geantwortet.[5] Dass auf diese Fragen in der mehrtausendjährigen Philosophiegeschichte keine zufriedenstellenden Antworten gegeben werden konnten, könnte seinen Grund darin haben, dass sie unvorteilhaft gestellt sind.
Spricht man über das, was ist, mit dem Ziel, Arten des Seienden auszumachen, so versucht man, sich das, was ist, zum Objekt zu machen. Hierbei von Einfluss ist die Art, wie das, was ist, auf uns wirkt, was also das Für–uns am Seienden ist. Denn das wird nicht nur der Ausgangspunkt und unsere intuitive Basis unserer Beschreibungen sein, sondern auch der Prüfstein der Angemessenheit einer Beschreibung dessen, was ist. So sind wir nicht bereit, eine Beschreibung der Welt, die nicht mit unseren Beobachtungen des Seienden in Übereinstimmung zu bringen ist, zu akzeptieren. An dieser Stelle liegt der Schnittpunkt zwischen Ontologie und Erkenntnistheorie: Wir formulieren unsere Beschreibung dessen, was ist, vor dem Hintergrund und mit dem Ziel der Erklärung des Für–uns des Seienden.
Nimmt man an, dass sich im Für–uns des Seienden nicht das Wesen des Seienden offenbart, – und es ist keinesfalls sicher, dass es überhaupt so etwas wie ein Wesen[6], oder An–sich des Seienden gibt, – so ist eine Frage danach, was als Seiendes ist, eine mit Carnap extern zu nennende Frage.[7] Denn das Seiende vermittelt sich uns als Für–uns und nur als solches können wir es beschreiben. Ein etwaiges Wesen des Seienden oder An–sich des Seienden ist unseren Beschreibungen dessen, was ist, extern. Fragt man nun aber danach, was das Seiende als Für–uns ist, so fragt man nach einer Beschreibung des Für–uns des Seienden. Hierbei kann nun die jeweilige Perspektive auf das Für–uns des Seienden ursächlich für die Unterschiedlichkeit der Beschreibung sein.
Ist es nun so, dass sich der Streit zwischen zwei zunächst rivalisierenden Beschreibungen des Seienden prinzipiell nicht durch die Erfahrung entscheiden ließe, wie es im Fall der in dieser Arbeit vorgestellten Beschreibungen, dessen, was ist – Dreidimensionalismus und Vierdimensionalismus – zu sein scheint, so bewegt sich eine Untersuchung und Zusammenführung der unterschiedlichen Perspektiven und Beschreibungen vor aller Erfahrung und ist somit im besten Sinne: revisionäre Metaphysik.[8]
1. Ontologie
Was ist Ontologie? Eine gängige Antwort hierauf ist, dass sie als Lehre vom Sein sich damit zu beschäftigen hat, was ist. In einem „systematischen Studium der grundlegendsten Struktur der Realität“[9] ist dabei „die begriffliche Erfassung der allgemeinsten Merkmale der Wirklichkeit in die Wege zu leiten.“[10] Ontologie lässt sich auch beschreiben als „diejenige menschliche Aktivität, die darauf abzielt, auf einer hohen Stufe der begrifflichen Allgemeinheit ein theoretisches (also logisch organisiertes) Gesamtbild von allem überhaupt (...) hervorzubringen.“[11] Mit diesen Charakterisierungen der Ontologie ist jedoch keineswegs der genaue Katalog von als existierend angenommenen Entitäten einer jeden Ontologie beschrieben, denn diese Ontologien unterscheiden sich genau darin, dass sie die „Realität“, „Wirklichkeit“ oder „alles überhaupt“ jeweils anders beschreiben.
So lassen sich zwei Verwendungsweisen des Wortes „Ontologie“ unterscheiden.[12] Zum einen wird ein konkreter Vorschlag darüber, was als das Inventar der Welt zu gelten habe, eine Ontologie genannt[13], zum anderen wird die in obigen Zitaten beschriebene Lehre vom Sein als Teilgebiet der Philosophie Ontologie genannt. Diese Mehrdeutigkeit des Wortes „Ontologie“ ist dabei nicht nur Grund potentieller Missverständnisse innerhalb philosophischer Diskussionen, sondern auch inhaltlich schwer zu rechtfertigen. Denn eine Ontologie wie ein Vorschlag bezüglich des Inventars, oder der Struktur der Welt oder auch eine Beschreibung dessen, was ist, genannt wird, ist nichts anderes als eine Theorie darüber, was es gibt. So wird deshalb innerhalb dieser Arbeit eine Beschreibung des Seienden Ontotheorie genannt, um sie gegen die Ontologie abzugrenzen, die als Lehre vom Sein jeweils Ontotheorien hervorbringt und sie zu diskutieren hat.
In diesem Sinn versteht sich vorliegende Arbeit als Beitrag zur Ontologie, indem sie zwei Ontotheorien, Dreidimensionalismus und Vierdimensionalismus, diskutiert und kritisiert und eine neue Ontotheorie vorschlägt. Zunächst werden jedoch Carnaps Metaphysikkritik (1.1.), Quines ontologische Verpflichtungen (1.2.) und Strawsons Unterscheidung in deskriptive und revisionäre Metaphysik (1.3.) vorgestellt, um den allgemeinen ontologischen Hintergrund dieser Arbeit zu formulieren.
1.1. Carnaps Metaphysikkritik
Carnap verneint die Möglichkeit, sinnvoll Ontologie oder Metaphysik zu betreiben. Er versteht metaphysische Aussagen als “knowledge claims about something which is over and beyond all experience”.[14] Ihm geht es in „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ darum, den Erkenntnisgehalt wissenschaftlicher Sätze klarzustellen. Metaphysische Aussagen erfüllen dabei nicht die an wissenschaftliche Sätze gestellten Anforderungen, da sie prinzipiell nicht verifizierbar oder falsifizierbar und somit ohne Sinn sind.[15] Vor diesem Hintergrund unterscheidet er externe und interne Fragen, wobei sich interne Fragen innerhalb eines Bezugsrahmens beantworten lassen, während sich externe Fragen theoretisch nicht beantworten lassen.[16] So wäre der Satz „der Blauwal ist ein Lebewesen“ ein bezüglich des Begriffsrahmens der Lebewesen interner Satz und somit beantwortbar, während die Frage “gibt es Dinge?“ extern zu nennen wäre, da es keinen wohldefinierten Gegenstandsbereich gibt, relativ zu dem wir den Satz verstehen oder verifizieren könnten.[17] Man dürfe somit nicht glauben, dass die Annahme eines sprachlichen Rahmens eine metaphysische Doktrin über die Realität der fraglichen Entitäten impliziere.[18]
Da sich Fragen immer nur relativ zu einem Begriffsrahmen beantworten lassen sind dann auch Fragen, die sich mit der Angemessenheit des Begriffsrahmens selbst beschäftigen, nicht beantwortbar. „Real im wissenschaftlichen Sinn zu sein, heißt, ein Element des Systems sein. Daher kann dieser Begriff nicht in sinnvoller Weise auf das System selbst angewendet werden.“[19]
Die Ontologie als wissenschaftliche Teildisziplin ist heute jedoch lebhafter denn je. Um zu verstehen, wie dies nach Carnaps „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache“ möglich ist, aber auch um das Ontologische dieser Arbeit gegen den Vorwurf der Sinnlosigkeit zu verteidigen, ist es zunächst notwendig, in diesem Kontext auf die Positionen Quines und Strawsons einzugehen.
1.2. Quines ontologische Verpflichtungen
Quine argumentiert dafür, dass es einen entscheidenden Zusammenhang zwischen der Sprache oder Theorie, die wir annehmen, und den in ihr jeweils entstehenden ontologischen Verpflichtungen gibt.[20] Er schreibt: “To be assumed as an entity is, purely and simply, to be reckoned as the value of a variable. (...) A theory is committed to those and only those entities which the bound variables of the theory must be capable of referring in order that the affirmations made in the theory be true.”[21] Zu diesen gebundenen Variablen einer Theorie kommen wir, indem wir systematisch alle wahren Sätze der Theorie in die Sprache der Quantorenlogik erster Stufe übersetzen. Wir können dann schauen, welche Dinge “must fall within the range of the variables of quantification to make those sentences true.”[22]
Quines Maxime hilft uns somit zu erfassen, auf welche Art von Entitäten sich Theorien oder Sprachsysteme verpflichten. Quine greift somit Carnaps Unterscheidung in interne und externe Fragen in folgender Weise auf: Damit eine Aussage oder auch eine Theorie bestehend aus vielen zur Frage stehenden Aussagen wahr sein kann, sind wir verpflichtet anzunehmen, dass die gebunden Variablen auf etwas referieren. Also müssen Entitäten derart angenommen werden, dass sie die Werte der gebundenen Variablen sein können. Ob nun eine Aussage wahr ist, hängt somit wesentlich vom Quantifikationsbereich der Quantoren ab, die die in der Aussage vorkommenden Variablen binden. So lässt sich die Wahrheit einer Aussage nur relativ zum Wertebereich der in ihr vorkommenden Variablen betrachten. Betrachten wir z.B. den Satz „Es gibt Blauwale“ bezüglich des Quantifikationsbereiches der Lebewesen, so ist er wahr, betrachten wir ihn hingegen bezüglich des Quantifikationsbereiches der Autos, so ist er falsch. Auch der Satz „Es gibt Dinge“ wird bezüglich eines dieser beiden Quantifikationsbereiche genau dann wahr, wenn wir zumindest einige der darin enthaltenen Entitäten auch als Dinge auffassen. Sehen wir z.B. Lebewesen nicht als Dinge an, so würden wir mit Quine sagen, dass der Satz „Es gibt Dinge“ bezüglich dieses Wertebereiches der Lebewesen falsch ist, eben weil annahmegemäß keine Entität im Wertebereich der Lebewesen ein Ding ist.
Diese zunächst trivial anmutende Verbindung zwischen unseren als wahr angenommenen Sätzen und der Verpflichtung, bestimmte Entitäten als existent anzunehmen, offenbart uns somit, dass eine Theorie der Welt, aufgefasst als eine Menge wahrer Sätze über die Welt, nicht von einer Beschreibung des Seienden, einem Katalog der Dinge, die sind, oder auch einem Wertebereich der in der Theorie oder der Satzmenge vorkommenden Variablen zu trennen ist. Quine argumentiert nun an anderer Stelle dafür, dass es mehrere nicht ineinander übersetzbare Theorien der Welt oder auch Begriffsysteme geben könne.[23] Die Wahl des Be-griffsystems hat dabei unterschiedliche ontologische Verpflichtungen zur Folge, d.h. unterschiedliche Arten von Dingen, die man annehmen muss, damit die Sätze angenommener Weltbeschreibung wahr sein können. Bei dieser Wahl zwischen Begriffsystemen oder Theorien lassen wir uns, so Quine, vom Kriterium der Einfachheit leiten, “we adopt (...) the simplest conceptual scheme into which the disordered fragments of raw experience can be fitted and arranged.”[24] Somit lässt sich auch nach Carnaps Metaphysikkritik für eine Beschäftigung mit Metaphysik oder auch Ontologie werben: Wenn es also so ist, dass es mehrere Beschreibungen des Seienden geben kann, gilt es, eine möglichst einfache, unsere Erfahrung möglichst gut erklärende oder einordnende Ontotheorie zu finden.
1.3. Strawsons Unterscheidung in deskriptive und revisionäre Metaphysik
Teils mit und teils gegen Strawson lässt sich weiter für eine Sinnhaftigkeit der Metaphysik oder auch Ontologie argumentieren. Zunächst unterscheidet Strawson zwei Arten von Metaphysik –, deskriptive und revisionäre Metaphysik, – wobei erste „sich damit begnügt, die tatsächliche Struktur unseres Denkens über die Welt zu beschreiben“[25], während zweite „das Ziel hat, eine bessere Struktur hervorzubringen“.[26]
In denselben Spannungsfeld zwischen Kontinuität und Bruch positioniert sich auch Putnam, indem er sagt: „I take it as a fact of life that there is a sense in which the task of philosophy is to overcome metaphysics and a sense which its task is to continue metaphysical discussion.”[27] Deskriptive Metaphysik zu betreiben sei nun, so Strawson, „bis zu einem gewissen Punkt [als] Untersuchung des tatsächlichen Wortgebrauchs der beste, ja einzig sichere Weg in der Philosophie“[28], der „keiner weiteren Rechtfertigung bedarf als der der Forschung im allgemeinen.“[29] Im Gegensatz dazu, so ist Strawson zu interpretieren, sei die Rechtfertigungsbedürftigkeit von revisionärer Metaphysik als größer und die Änderung begrifflicher Strukturen als unsicherer Weg in der Philosophie einzuschätzen.
Einen gegenteiligen Metaphysikentwurf entwirft hingegen Lowe: „Setzt sich die Metaphysik hingegen weniger ehrgeizige Ziele – versteht man darunter z.B. den Versuch, unserer zur Zeit allgemein anerkannten Sprechweisen über die von uns unhinterfragt angenommene generelle Beschaffenheit der Welt, in der wir leben, zu analysieren – , so wird das ihre Rechtfertigung erleichtern, jedoch nur auf Kosten der Attraktivität der Metaphysik und des Wertes der metaphysischen Untersuchungen. (...) In diesem Fall sollten wir dann aber zumindest nicht so tun, als ob wir etwas täten, das es Wert wäre, mit dem Namen ‚Metaphysik’ ausgezeichnet zu werden.“[30]
Dieser Disput über den „Wert“ der Metaphysik im deskriptiven Sinn wird hier nicht entschieden, von Interesse ist hier, dass Lowe einer rein deskriptiven Metaphysik abspricht, Metaphysik im eigentlichen Sinn zu sein. So lässt sich auch die Unterscheidung in zwei Methoden der Metaphysik mit Quine kritisieren. Denn ist die Wahl unseres begrifflichen Rahmens keine, die nur ein Ergebnis zuließe, und dafür argumentiert Quine, so ist die Tatsache, dass wir den bestimmten begrifflichen Rahmen haben, den wir haben, keine qualitative Auszeichnung oder Garantie für Sicherheit in der Beschreibung dieses Rahmens. Vielmehr könnte das, was wir, unter der Voraussetzung, dass wir den begrifflichen Rahmen haben, den wir gerade haben, als deskriptive Metaphysik verstehen, eine revisionäre Metaphysik sein, unter der Voraussetzung, dass wir einen anderen begrifflichen Rahmen hätten, als wir haben. Die Bezeichnung einer Metaphysik oder auch Ontologie als deskriptiv oder auch revisionär ist somit relativ zu dem, was gerade Begriffssystem ist. Aus einer solchen relativen Bezeichnung können nun aber keinerlei Schlüsse auf die Qualität einer bestimmten Metaphysik oder auf unsere Sicherheit im Zugang zu ihr gefolgert werden. Die einzigen Kriterien zum Vergleich dieser verschiedenen Versionen der Weltbeschreibung sind also das der Einfachheit und das der Erklärung oder Einordnung unserer Erfahrungen.[31]
Strawson selbst schreibt, dass „kein wirklicher Metaphysiker nach Absicht und Wirkung jemals ausschließlich das eine oder das andere [war]“.[32] In dem Sinn, dass eine bestimmte Metaphysik oder Ontotheorie als deskriptiv oder revisionär jeweils nur relativ zu dem bestehenden Begriffsystem verstanden werden kann, ist auch der in dieser Arbeit vorliegende Beitrag zur Ontologie deskriptiv und revisionär. So werden zunächst die bestehenden Sprachgebräuche der dreidimensionalen und der vierdimensionalen Theorie der Dinge so, wie sie sich in der Literatur finden, beschrieben und kritisiert, um dann in einem eher revisionären Teil eine ontotheoretische Synthese, begründet vorzuschlagen.
In der Summe sollten die Ausführungen in Abschnitt 1.2. und 1.3. dem Leser erklären, warum die Ontologie als philosophische Teildisziplin heute lebhafter denn je ist, und warum sich die Überzeugung vertreten lässt, „dass sich Metaphysik (...) in einem wissenschaftlich respektablen Sinn betreiben lässt.“[33]
Um Dreidimensionalismus und Vierdimensionalismus vorstellen zu können, ist es hilfreich, eine thematische Einschränkung vorzunehmen. Bei der Debatte um Drei- und Vierdimensionalismus stehen die Existenz, Identität und Persistenz der Dinge im Vordergrund. Deswegen werde ich mich im Folgenden auf ein bestimmtes Teilgebiet der Ontologie beschränken: das der materiellen und physikalischen Dinge.[34] In Abschnitt 1.4. werden sie zunächst charakterisiert.
1.4. Materielle oder physikalische Objekte
Diejenigen Entitäten, die wir gewohnt sind als Dinge zu bezeichnen, – von John Austin auch „mittelgroße Trockenwaren“ genannt, – sind Teil der Entitäten, die wir materielle oder physikalische Dinge nennen. Ein Teil sind sie deswegen, weil wir neben den Entitäten, die wir gewohnt sind als Dinge zu bezeichnen, auch noch anderen Entitäten zubilligen, materielle oder physikalische Dinge zu sein. Insofern leistet eine Ontotheorie, die über physikalische und materielle Dinge spricht, zumindest eines: Sie kann prinzipiell auch über die Entitäten reden, die wir gewohnt sind als Dinge zu bezeichnen.
Was aber verstehen wir unter materiellen und physikalischen Dingen? Versteht man materielle Dinge zunächst als Entitäten, die aus Materie bestehen und physikalische Objekte als Entitäten, die die Physik untersucht, so schließen sich die Fragen an, was „Materie“ ist und welche Entitäten die Physik untersucht. Ist man aber bereit anzunehmen, dass die Physik sich zur Aufgabe gemacht hat, alle Entitäten in Raum und Zeit zu betrachten und dass Materie genau das ist, was in Raum und Zeit ist, so wird man auch folgern müssen, dass ein materielles auch immer ein physikalisches Ding ist.[35] An dieser Stelle ist die Definition eines physikalischen Dinges, wie sie in der Literatur zu finden ist, um ein weiteres Kriterium zu ergänzen. Die Physik untersucht Entitäten in Raum und Zeit nur insofern sie sich in irgendeiner Weise auswirken. Denn nur insofern sie sich, vermittels ihrer Eigenschaften oder auf irgendeine andere Weise auf ihr Umfeld auswirken, sind sie den Methoden der Physik zugänglich.
Der Ansatz dieser Arbeit, Ontologie mit Blick auf materielle und physikalische Dinge, also mit Blick auf Entitäten in Raum und Zeit, zu betreiben, ist dabei ein wohl akzeptierter und oft verfolgter Ansatz in der gegenwärtigen ontologischen Diskussion.[36] An dieser Stelle wird jedoch nicht dafür argumentiert, dass abstrakte Entitäten wie „Zahlen“, „Geist“ oder „Mengen“ etc. nicht existieren[37], sondern dafür, dass sie lediglich im Rahmen einer Untersuchung dessen, was wir in Raum und Zeit verorten, nicht betrachtet werden. Dies eben genau darum, weil anzunehmen ist, dass abstrakte Entitäten wie „Zahlen“, „Geist“ oder „Mengen“ nicht in Raum und Zeit verortet sind. Im Folgenden wird also „existiert“ oder „ist“ bedeutungsgleich mit „existiert in Raum und Zeit“ oder „ist in Raum und Zeit“ verwendet.[38] Terminologisch vereinfachend legen wir fest, dass genau die Entitäten, die in Raum und Zeit verortet sind, im Folgenden als „Ding“ oder auch als „Gegenstand“ bezeichnet werden.[39] Nachdem wir nun den Gegenstandsbereich eingeschränkt und konkretisiert haben und einige terminologische Übereinkünfte getroffen haben, sind wir nun bereit, eine Theorie der dreidimensionalen Dinge[40] vorzustellen und zu diskutieren.
2. Die Ontotheorie dreidimensionaler Objekte
Dass ein Objekt dreidimensional ist, besagt zunächst einmal nicht mehr, als dass es in drei Dimensionen ausgedehnt ist. In der ontologischen Debatte darüber, ob die Dinge, die es gibt, drei- oder vierdimensionale Objekte sind, wird darum gestritten, ob sie als bloß räumlich (dreidimensional) oder auch als zeitlich (vierdimensional) ausgedehnt aufzufassen sind.[41]
Wollen wir über eine Klasse oder Art von anzunehmenden Dingen reden, so ist es hilfreich, wenn wir uns darüber klar sind, wann eines dieser Dinge mit etwas identisch ist und wie wir eines dieser Dinge von etwas anderem unterscheiden[42], da uns andernfalls jedes Kriterium fehlte davon zu sprechen, dass ein Exemplar dieser Art vorliege.[43] Wir werden im folgenden zwei prominente Prinzipien der Identifizierung oder Individuation von Dingen vorstellen.
Eine Basis für ein solches Individuationsprinzip schlägt Strawson vor, indem er schreibt: „(...) das System der raumzeitlichen Beziehungen [ist] derart umfassend und überzeugend (...), dass es sich wie kein anderes als Rahmen dafür eignet, unser individuierendes Denken über Einzeldinge zu ordnen.“[44] Folgen wir Strawson in diesem Punkt, so werden wir von einer Ontotheorie der dreidimensionalen wie von einer Ontotheorie der vierdimensionalen Objekte verlangen können, dass sie, eben weil sie jeweils eine bestimmte Art von Dingen als existent annehmen, mit Bezugnahme auf die jeweiligen raumzeitlichen Beziehungen der Dinge erklären können, was die Identitätsbedingungen dieser als existent angenommenen Dinge sind. Ein solcher Vorschlag von Identitätsbedingungen dreidimensionaler Objekte ist: “two individuals are identical if and only if they occupy the same place at the same time.”[45]
Ein zweites prominentes Identitätsprinzip, das auf Leibniz zurückgeht, besagt die Identität der Ununterscheidbaren. Dies wird gängigerweise so interpretiert, dass aus der Gleichheit aller Eigenschaften die Identität der untersuchten oder betrachteten Dinge folgt. Denn unterscheidbar sind zwei Dinge genau dann, wenn sie unterschiedliche Eigenschaften haben. Es ist aber unter Philosophen unklar, ob unter die so betrachteten und miteinander verglichenen Eigenschaften auch sogenannte relationale Eigenschaften fallen sollten.[46]
Bewerten wir beide vorliegenden Vorschläge zur Individuation dreidimensionaler Dinge, so stellen wir fest, dass ausgehend von unserem alltäglichen Sprachgebrauch das Identitätsprinzip von Leibniz überzeugender ist. Denn obwohl wir sagen, dass die Gesamtheit der Teile eines Tisches zu einer an derselben räumlichen Stelle ist[47], wie der Tisch selbst, sind wir zumindest unentschieden in der Frage, ob die Gesamtheit der Teile eines Tisches identisch mit ihm ist.[48] Zum anderen identifizieren wir häufig Dinge, die sich in vielen Eigenschaften gleichen.[49]
Wir tun Wilson jedoch Unrecht, wenn wir seinen mit Strawson begründbaren Vorschlag einer Identitätsbedingung dreidimensionaler Objekte vorschnell ablehnen. So lässt sich dafür argumentieren, dass die zwei Identifikationsprinzipien über unterschiedliche Arten dreidimensionaler Objekte reden. Während Leibniz anzunehmenderweise auch Zusammengesetztes wie z.B. Tische betrachtet, redet Strawson zunächst nur von Einzeldingen: „Wir denken uns die Welt zusammengesetzt aus einzelnen, von uns selbst zum Teil unabhängigen Dingen (...)“, und nennt diese Dinge „unabhängige Einzeldinge“[50], ohne sich dabei explizit auf dreidimensionale Dinge zu beschränken. Mit unabhängig meint Strawson hier zunächst nur soviel, dass unser Reden über diese Einzeldinge[51] nicht von der Annahme anderer Dinge abhänge,[52] und somit Einzeldinge als nicht weiter analysierbare logische Subjekte behandelt werden können.
Würden noch weiter gehen als Strawson und würden uns auf Dinge beschränken, die nicht weiter analysierbar sind, müssten wir uns Sätzen, wie „die Gesamtheit der Teile des Tisches ist an derselben räumlichen Stelle wie der Tisch“ gar nicht erst stellen, da „der Tisch“ auf kein nicht weiter analysierbares Ding referierte und wir den Satz somit als sinnlos verstehen würden. Die oben vorgebrachte Kritik an Wilsons Identifikationsprinzip ließe sich nicht formulieren, wenn wir es als Identifikationsprinzip von dreidimensionalen Dingen, die nicht weiter analysierbar sind, verstehen.[53] Verstehen wir Wilsons Identifikationsprinzip somit als geeignet für den Bereich der dreidimensionalen Einzeldinge, jedoch nicht für den Bereich der Dinge über den wir gewohnt sind zu reden, liegt es zunächst einmal nah, Leibniz Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren als das Prinzip anzunehmen, nach dem wir dreidimensionale Dinge identifizieren. Im Folgenden soll nun das Problem der Identität über Zeit hinweg betrachtet werden, da sich an ihm die Debatte zwischen Drei- und Vierdimensionalismus entzündete.
2.1. Diachrone Identität dreidimensionaler Dinge
Wie können wir uns unsere Rede davon, dass Dinge zu verschiedenen Zeiten da sind, erklären, wenn wir annehmen, dass sie als dreidimensionale Dinge wie oben beschrieben lediglich in den drei räumlichen Dimensionen ausgedehnt sind? Lewis schreibt hierzu: „Something (...) endures iff it persists by being wholly present at more than one time”[54], indem es also als Ganzes zu mehreren Zeiten da ist. Wenn es aber als Ganzes zu mehreren Zeiten da ist, sollte man auch annehmen dürfen, dass es als ein– und dasselbe, also als numerisch Identisches zu mehreren Zeiten da ist. Denn wäre es als Ganzes aber nicht als Selbes zu mehreren Zeiten da, so wäre vollkommen unklar, was mit „als Ganzes“ gemeint sein sollte.[55] Da sich die Dinge, mit denen wir es zu tun haben, verändern können, stellt sich somit das Problem der Identität der diachronen Identität dreidimensionaler Dinge.[56]
Wir gestehen den Dingen zu, sich zu verändern und doch sie selbst zu bleiben.[57] Wie kommen wir dazu, ihnen trotzdem diachrone und numerische Identität zuzuschreiben? Eine Möglichkeit wäre, hier zu behaupten, dass jedes bestimmte Ding zwei Arten von Eigenschaften habe, zum einen Eigenschaften, die sich ändern können, ohne dass das Ding ein anderes wird – sogenannte akzidentelle Eigenschaften, – und zum anderen Eigenschaften, deren Änderung den Identitätsverlust eines Dinges zur Folge hätte, – sogenannte essentielle Eigenschaften.[58]
Dies würde zur Folge haben, dass wir das Leibnizsche Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren als Prinzip der Identität der in ihren essentiellen Eigenschaften Ununterscheidbaren interpretieren. In der Tat sprechen wir so über Dinge, dass sie gewisse Veränderungen als selbe überstehen und bei anderen Veränderungen ihre Identität verlieren.[59] Jedoch ist die Grenze zwischen Veränderungen, die wir einem Ding zugestehen, ohne dass es etwas anderes wird, und Veränderungen, die ein Ding seine Identität verlieren lassen, und somit auch die Grenze zwischen akzidentellen und essentiellen Eigenschaften, unklar.[60] Es müsste sich nämlich begründen lassen, warum gewisse Eigenschaften bezüglich der Identität des Dings als relevant und andere als irrelevant zu gelten hätten. Die Einteilung der Menge der Eigenschaften eines Dinges in essentielle und akzidentelle Eigenschaften in der Natur des Dinges begründet zu sehen bleibt dabei für einen Nicht-Essentialisten unbefriedigend, da er gerade eine solche Natur der Dinge nicht annimmt.
Bleiben wir also in dieser Frage unentschieden und nehmen wir an, dass ein- und dasselbe Ding zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Eigenschaften hat, und folgen wir Leibniz in seinem Prinzip der Ununterscheidbarkeit des Identischen[61], das etwa besagt, dass Identisches in allen Eigenschaften übereinstimmt, so haben wir offensichtlich ein Problem.
Einige dieses Problem umgehende Möglichkeiten den Dingen diachrone und numerische Identität zuzuschreiben, gehen auf unterschiedliche Interpretation von Sätzen derart „Ein Ding A hat zu einer Zeit t eine Eigenschaft F“ zurück.[62] So lässt sich ein Satz dieser Art als „A hat die Eigenschaft F-zu-t“ interpretieren.[63] In dieser Auslegung sind Eigenschaften relational zu Zeiten aufzufassen, es ist also z.B. „rot-gestern-sein“ eine andere Eigenschaft als „rot-heute-sein“. Eine zweite Interpretation des obigen Satz wäre, ihn als „A hat-zu-t die Eigenschaft F“ aufzufassen.[64] In dieser Auslegung ist das „Haben einer Eigenschaft“ relational zur Zeit aufzufassen, also die Zeit des Habens adverbiale Bestimmung des Habens. So wäre dann auch das Haben einer Eigenschaft gestern ein anderes Haben als das Haben derselben Eigenschaft heute.
Diese Interpretationen des Ausgangssatzes „Ein Ding A hat zu einer Zeit t eine Eigenschaft F“ haben, neben all ihrer von unserem Sprachempfinden empfundenen Unplausibilität einen Vorteil: Es ist nicht mehr der Fall, dass ein und dasselbe Ding eine Eigenschaft auf dieselbe Weise hat und nicht hat. Denn in der ersten Interpretation hat beispielweise ein roter Tisch, den ich grün anstreiche, nicht die sich ausschließenden Eigenschaften (gänzlich) grün zu sein und (gänzlich) rot zu sein, sondern vor wie nach dem Anstreichen beide Eigenschaften: „Vor dem Anstreichen rot zu sein“ und „nach dem Anstreichen grün zu sein“.
In der zweiten Interpretation hat er die Eigenschaft rot zu sein auf andere Weise als er die Eigenschaft hat, grün zu sein. Der Tisch ist somit „voranstreichlich“ rot und „nachanstreichlich“ grün. In beiden Interpretationen scheint somit das Problem der diachronen Identität gelöst, denn es ist nicht weiter problematisch, dass z.B. ein- und derselbe Tisch die zwei Eigenschaften „vor dem Anstreichen rot zu sein“ und „nach dem Anstreichen grün zu sein“ hat oder auch, dass er grün und rot ist, solange er es nur auf die zwei Weisen „voranstreichlich“ und „nachanstreichlich“ ist.
2.2. Kritik des Dreidimensionalismus
Wie haben wir uns also dreidimensionale Dinge vorzustellen? Sie sind also zur Gänze zu mehreren Zeiten da. Wo wir sagen, dass es zu einer Zeit t der Fall ist, dass ein dreidimensionales Ding eine bestimmte Eigenschaft hat, müssen wir uns korrigieren und zugeben, dass wir eigentlich sagen, dass entweder das Ding die Eigenschaft-zu-t hat, oder dass es sie t-lich hat. In beiden Fällen wird somit implizit behauptet, dass das Ding keine Änderung seiner Eigenschaften durchlaufen hat. Denn jedes Ding hat, solange es als es selbst existiert, die ihm zukommenden Eigenschaften-zu-t zu jeder Zeit, oder hat, in zweiter Interpretation, die ihm auf eine zeitrelative Weise zukommenden Eigenschaften zu jeder Zeit. Nur so kann uns erklärlich erscheinen, was es heißen soll, dass es als ein- und dasselbe dreidimensionalen Ding zu mehr als einer Zeit zur Gänze existiert. Wenn es aber so ist, dass ein Ding alle seine Eigenschaften, seien diese zeitindexiert oder nicht, auf welche Weise auch immer stets hat, so ist an ihm keine Veränderung möglich.
[...]
[1] Für eine Übersicht siehe Runggaldier/ Kanzian (1998).
[2] Die Begriffe „Sein“, „Seiende“ und „was ist“ werden in dieser Arbeit bedeutungsgleich verwendet.
[3] Es könnte den aufmerksamen Leser verwirren, dass auch in einer Arbeit, die sich mit Ontologie – also mit der Lehre vom Sein – beschäftigt, konjugierte Formen des Verbs „sein“ vorkommen. Es war im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht möglich, eine neue Sprache derart zu entwickeln, dass solche scheinbaren Selbstbezüge zu vermeiden gewesen wären. Für eine Verwendung konjugierter Formen von „sein“ sprach weiterhin, dass im Text damit jeweils Sachverhalte konstatiert werden sollen, es sich jedoch in der hier vorliegenden Arbeit nicht um eine Ontotheorie der Sachverhalte handelt. Auch aus Gründen der Verständlichkeit wurde an der gebräuchlichen Sprache festgehalten. Wir bauen somit, um ein berühmtes Zitat von Neurath zu gebrauchen, unser Schiff auf offener See um. Vgl. Neurath (1932/33), S. 206.
[4] Es könnte sich z.B. um zwei unvollständige Beschreibungen des Seienden handeln, die das Seiende verschieden kategorisieren.
[5] Quine (1961b), S. 1.
[6] Es kann angenommen werden, dass Einzelnes, was ist, neben einem Für–uns auch noch ein Für-anderes hat. Soweit sich ein solches Für-anderes nicht in seinem Für–uns zeigt, sind also auch Fragen nach dem Für-anderes extern zu nennen. Das Wesen ließe sich in dieser Redeweise als das auffassen, was das Seiende neben seinem Für–uns und seinem Für-anderes noch ist.
[7] Vgl. Carnap (1958), S. 206ff.
[8] Zur Unterscheidung revisionärer und deskriptiver Metaphysik siehe Strawson (1972) sowie 1.3. Die in dieser Einleitung geführte Argumentation kommt somit auch zu dem Schluss, dass revisionäre Metaphysik nicht notwendig schlechte oder unbegründete Metaphysik sein muss.
[9] Lowe (1995), S. 12.
[10] Runggaldier/ Kanzian (1998), S. 14.
[11] Meixner (1999), S. 9.
[12] Eine ähnliche Unterscheidung in A- und B-Ontologien entwirft Inwagen (2001a), S. 2.
[13] Zur Illustration dieser Redeweise sei beispielhaft auf Zemach (1970) verwiesen, der bereits im Titel den Plural führt: „Four Ontologies“. Aber auch Informatiker sagen von sich, dass sie „Ontologien“ entwerfen, wenn sie z.B. Klassen für Java entwerfen .
[14] Carnap (1935), S. 15.
[15] Carnap (1931/32)
[16] Carnap (1958), S. 206ff; Vgl. Runggaldier/ Kanzian (1998), S.19, 72.
[17] Vgl. Zimmermann (1981), S.14, 32.
[18] Carnap (1958), S. 350; Vgl. Zimmermann (1981), S.48.
[19] Carnap (1958), S. 341.
[20] Quine (1961b), S. 13f.; Vgl. Runggaldier/ Kanzian (1998), S.73.
[21] Quine (1961b), S. 13f.
[22] Stroud (1990), S. 321.
[23] Quine (1980), S. 59ff.
[24] Quine (1961b), S. 16; Vgl. Runggaldier/ Kanzian (1998), S. 24.
[25] Strawson (1972), S. 9.
[26] Vgl. Runggaldier/ Kanzian (1998), S. 43.
[27] Putnam (1987), S. 457.
[28] Strawson (1972), S. 10.
[29] Strawson (1972), S. 9.
[30] Lowe (1995), S. 12.
[31] Hinzuzufügen wäre das Kriterium der Widerspruchsfreiheit. Bezüglich Versionen der Weltbeschreibung siehe Goodman (1984), S. 19ff.
[32] Strawson (1972), S. 9.
[33] Brandl u.a. (1995), S. 7.
[34] Die in Abschnitt 0. und bisher in 1. getätigten Überlegungen treffen unabhängig von der hier getroffenen Einschränkung des Gegenstandsbereiches dieser Arbeit zu. Für einen Überblick über alternative Versionen der Weltbeschreibung, die nicht von materiellen oder physischen Dinge als Inventar der Welt ausgehen siehe zur Einführung Runggaldier/ Kanzian (1998).
[35] Vgl. Markosian (2000), S. 375; Laycock (1979), S. 91; Zimmermann (1981), S. 103f.
[36] Ontologien mit Blick auf Entitäten in Raum und Zeit finden sich z.B. in Zimmermann (1981); Strawson (1972); Runggaldier/ Kanzian (1998); Denkel (1996); Markosian (2000); Laycock (1979) und Inwagen (1990). Aber auch die Literatur der nächsten beiden Kapiteln zum Drei- und Vierdimensionalismus blickt, aus ihrer jeweiligen Perspektive, auf Entitäten in Raum und Zeit.
[37] Eine solche Position vertritt z.B. Denkel (1996).
[38] An dieser Stelle sei jedoch noch ein Zitat von Quine (1961b), S. 3 diskutiert: “If spatio-temporal reference is lacking when we affirm the existence of the cube root of 27, this is simply because a cube root is not a spatio-temporal kind of thing, and not because we are being ambiguous in our use of ‘exist’.” Behauptet Quine, dass der Satz „existiert“ und der Satz „es gibt Bäume“innerhalb derselben Theorie wahr sein sollen, so ist er auch auf einen Quantifikationsbereich festgelegt, der raum-zeitliche Entitäten genauso wie nicht-raum-zeitliche Entitäten enthält. Enthält der Quantifikationsbereich jedoch nur eine Sorte von Entitäten, so wird auch nur einer der beiden Sätze wahr sein können. Wir sehen erneut, dass „Existieren“ relativ zu einem angenommenen Wertebereich zu verstehen ist. Insofern kann das Existieren einer Entität in Raum und Zeit als ein anderes als ein Existieren einer Entität außerhalb von Raum und Zeit angesehen werden. Existierten jedoch beide Arten von Entitäten bezüglich eines gemeinsamen Quantifikationsbereiches, so stellt sich die Frage was an diesem Existieren von Entitäten innerhalb und außerhalb von Raum und Zeit das Gemeinsame ist. Natürlich kommen wir auf einheitliche Weise dazu, Entitäten innerhalb und außerhalb von Raum und Zeit Existenz zuzuschreiben, nämlich indem wir Existieren als „Wert einer gebunden Variable sein“ explizieren. Da wir in diesem Fall einmal Existieren als Wert einer gebundenen Variable sein, der in Raum und Zeit verortet ist, und einmal als Wert einer gebundenen Variable sein, der nicht in Raum und Zeit verortet ist, verstehen, bleibt unklar, was nun das Gemeinsame an diesem Existieren neben einer einheitlichen Behandlung durch die Quantoren sein sollte. Es ist jedenfalls nicht das Existieren in Raum und Zeit.
[39] „Ding“ wird also gegenüber der gewohnten Verwendungsweise in seiner Bedeutung ausgeweitet und existieren evtl. beschränkt. Somit lässt sich auf die Frage, was existiert, antworten: „Dinge!“
[40] Im Folgenden beschränken wir uns also auf materielle und physikalische Dinge. Bezüglich der Frage, ob Ereignisse als materielle oder physikalische Dinge anzusehen sind wird hier keine Position bezogen. Es wird darum im Folgenden auch nicht von Eigenschaften die Rede sein. Für einen Überblick über die ontologische Ereignistheorie siehe Scheffler (2001).
[41] Theoretisch wären auch Dinge, die in zwei räumlichen Dimensionen und einer zeitlichen Dimension ausgedehnt wären, dreidimensionale Objekte zu nennen. Solche Dinge sind uns jedoch nicht bekannt und hier auch nicht gemeint.
[42] Dabei ist klar, dass wir identifizieren und individuieren können, sobald wir auch nur eines dieser beiden können.
[43] Vgl. Quines berühmten Sinnspruch “No entity without Identity”, Quine (1969b), S. 23. Vgl. Künne (1983), S.24.
[44] Strawson (1972), S. 31.
[45] Wilson (1956), S. 46.
[46] Relationale Eigenschaften sind die Eigenschaften eines Dinges, die es in Verbindung mit anderen Dingen hat. Beispiele relationaler Eigenschaften sind „ist größer als B“ oder „ist 2m rechts von A“ oder auch „ist Onkel von C“. Es ist dabei strittig, ob auch solche relationalen Eigenschaften zur Menge der gleichbleibenden Eigenschaften gezählt werden müssen, wenn ein Ding es selbst bleiben soll. Hiermit verbunden ist die Frage, ob sogenannte Cambridge-Changes – Änderungen relationaler Eigenschaften – echte Veränderungen an den Dingen sind, die sie haben. Vgl. Geach (1969), S. 71.
[47] Hierzu lässt sich auch bemerken, dass eine räumliche Stelle natürlich nicht absolut, sondern nur relativ zu den Orten anderer Dingen zu verstehen ist. Unsere Fähigkeit, eine räumliche Stelle zu einer Zeit zu identifizieren wird hiervon jedoch nicht beeinträchtigt.
[48] Für die Position, dass ein Ding nicht mit der Gesamtheit seiner Teile identisch ist, ist häufig formuliert worden, dass das Ganze mehr als seine Teile ist. Für Überblick über das Verhältnis der Ganzen zu ihren Teilen siehe 4.
[49] Natürlich kann man das Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren unter praktischen Gesichtspunkten kritisieren. Wir kennen einfach nie alle Eigenschaften eines Dinges und können somit nie einer Ununterscheidbarkeit sicher sein. Es ist jedoch unsere Praxis, Dinge die sich in vielen oder allen relevanten Eigenschaften gleichen zu identifizieren. Ein Gegenbeispiel zu Leibniz Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren formuliert Black (1952).
[50] Strawson (1972), S. 17.
[51] Diese Einzeldinge beschreibt Strawson, als die gegenüber anderen „ontisch primär“ oder auch als „grundlegende Einzeldinge“ Strawson (1972), S. 20; S. 50.
[52] Was so eine Abhängigkeit eines Dings von einer Menge anderer Dinge sein könnte, werde ich in Abschnitt 5.5. noch näher erläutern.
[53] Auch ließe sich dafür argumentieren, dass das Identifikationsprinzip von Wilson nichts anderes besagt, als das Leibnizsche Prinzip der Identität der Ununterscheidbaren auf eine besondere Form der anzunehmenden Einzeldinge angewandt. Hierzu müsste man die Thesen vertreten, dass 1. alle Eigenschaften der Einzeldinge relationale Eigenschaften sind oder auf relationale Eigenschaften zurückgehen, und dass 2. unterschiedliche Verortungen der Einzeldinge mit unterschiedlichen relationalen Eigenschaften einhergehen. Unter der Annahme dass 1. und 2. zutrifft, wäre ein Einzelding genau dann ununterscheidbar von einem anderen, wenn es am selben Ort wäre.
[54] Lewis (1986), S. 202.
[55] Vgl. Lowe (1987), S. 152f.
[56] Als diachrone Identität wird die Identität der Dinge über Zeit hinweg bezeichnet.
[57] Vgl. z.B. Seibt (1997), S. 152; Denkel (1996), S. 69f; Merrick (1994), S. 179; Runggaldier/ Kanzian (1998), S. 110.
[58] Vgl. Runggaldier/ Kanzian (1998), S. 110, Brody (1980), S. 73, Denkel (1996), S. 69f.
[59] So ist mein Fahrrad, wenn ich es neu lackiere, immer noch mein und dasselbe Fahrrad. Schmelze ich es jedoch ein, ist es kein Fahrrad mehr. Auf die Identität von zusammengesetzten Gegenständen wird in Abschnitt 4.3. und 5. nochmals und mit anderer Argumentation eingegangen.
[60] Zu einer genaueren Betrachtung essentialistischer Gegenstandskonzeptionen siehe Abschnitt 2.1. und 4.2.1.
[61] Dies ist die Gegenrichtung zu dem zuvor besprochenen Identifikationsprinzip der Identität der Ununterscheidbaren von Leibniz.
[62] Lowe (1988), S. 73.
[63] Myro (1986), S. 391; Vgl. Lowe (1988), S. 73; Merrick (1994), S. 168; Seibt (1997), S. 153; Geach (1998), S. 198.
[64] Lowe (1988), S. 73ff; Vgl. Merrick (1994), S. 168.
- Quote paper
- Malte C. Daniels (Author), 2003, Ontologische Perspektiven - Unsere Sicht auf Gegenstände und ihre Teile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20884
Publish now - it's free



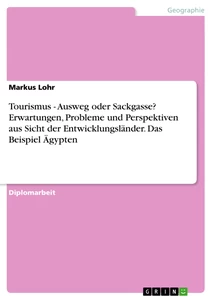










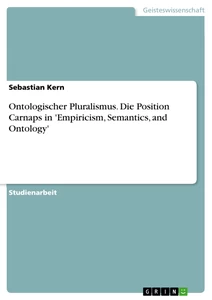



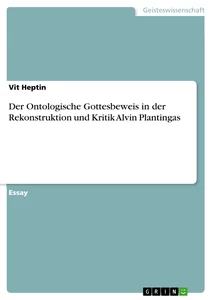



Comments