Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Sicherheitsbegriff: Sicherheit und militärische Intervention
2.1 Wandel des Sicherheitsverständnisses
2.1.1 Abgrenzung der sicherheitspolitischen von der friedenstheoretischen und entwicklungspolitischen Debatte
2.1.2 Der „erweiterte Sicherheitsbegriff“
2.1.3 „Human Security“
2.2 Die militärische Intervention
2.2.1 Der „klassische Interventionsbegriff“
2.2.2 Die „humanitäre Intervention“
2.2.3 „Responsibility to Protect“
2.2.3.1 „Responsibility to React“
2.2.3.2 „Responsibility to Rebuild“
2.3 Zusammenfassung und Festlegung des Kriterienkataloges
3 Die Intervention in das Kosovo und die Folgen
3.1 Die historische Entwicklung des Kosovo-Konfliktes
3.2 Die militärische Intervention der NATO in das Kosovo
3.2.1 Berechtigter Anlass
3.2.2 Rechtmäßigkeit der Absicht
3.2.3 Rechtmäßige Autorität
3.2.4 Nachvollziehbare Erfolgsaussichten
3.2.5 Die militärische Intervention als Ultima-Ratio
3.2.6 Verhältnismäßigkeit der Mittel
3.2.7 Berücksichtigung einer „Responsibility to Rebuild“
3.2.8 Kurze Zusammenfassung
3.3 Die Sicherheitslage in der Post-Konflikt-Situation
3.3.1 Grundlegende Sicherheit
3.3.1.1 Schutz von Minderheiten
3.3.1.2 Reform des Sicherheitssektors
3.3.1.3 Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration
3.3.1.4 Beseitigung von Minen
3.3.1.5 Die Verurteilung von Kriegsverbrechern
3.3.2 Weitere Problemfelder und die aktuelle Situation im Kosovo
4 Schluss
5 Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
„One of the essential functions of an intervention force is to provide basic security and protection for all members of a population, regardless of ethnic origin or relation to the previous source of power in the territory ... Everyone is entitled to basic protection for their lives and property“ (ICISS 2001: 40f.).
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der militärischen Intervention der NATO in das Kosovo[1], dem darauffolgenden Eingreifen der UN in der Post-Konflikt-Phase und den Folgen dieses internationalen Engagements.
Im März 1999 erfolgte die Intervention der NATO in das Kosovo. Grund für die Intervention waren die massiven Menschenrechtsverletzungen im Kosovo als Folge der gewaltsamen Auseinandersetzungen der serbischen Streitkräfte mit albanischen paramilitärischen Einheiten, vor allem der „Befreiungsarmee des Kosovo“ (UÇK). Der ethnische Konflikt zwischen Serben und Albanern in der Region Kosovo hatte sich bereits zu Beginn der 1990er Jahren angedeutet. Doch erst mit zunehmender Gewaltanwendung und Leid der Bevölkerung rückte das Kosovo in den internationalen Fokus. Das Eingreifen der Internationalen Gemeinschaft in das Kosovo unterscheidet sich dabei im Wesentlichen von dem Umgang mit anderen innerstaatlichen Konflikten, die seit Ende der Ost-West-Konfrontation zunehmend eskalieren. Die militärische Intervention der NATO in das Kosovo war die erste „humanitäre Intervention“, die ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates erfolgte und somit gegen das Völkerrecht verstößt. Zudem unterschied sich die Form militärischen Eingreifens deutlich von vorangegangenen „humanitären Interventionen“ der UN, wie in Bosnien-Herzegowina und Somalia zu Beginn der 1990er Jahre. Die NATO führte die Intervention ausschließlich aus der Luft durch. Eine weitere Besonderheit ist die bis dato einzigartige Bandbreite an Post-Konflikt-Maßnahmen, die nach offizieller Beendigung der Kampfhandlungen im Juni 1999 durch die UN-Resolution 1244 eingeleitet wurden und die über bisherige Peacebuilding-Maßnahmen weit hinausgehen.
Der Kosovo-Konflikt ist aufgrund dieser Merkmale wie kein zweiter Fall analysiert und kontrovers diskutiert worden. Im Vordergrund standen dabei folgende Aspekte: Die Frage nach einer möglichen Rechtfertigung der völkerrechtswidrigen Intervention der NATO als „humanitäre Nothilfe“ und die Diskussion um die Form der militärischen Intervention. Damit ausführlich beschäftigt hat sich vor allem Philipp A. Zygojannis (2003). Auch wurde diskutiert, inwieweit die erfolgten Post-Konflikt-Maßnahmen, speziell die etablierte Übergangsverwaltung der UN, als Modell auf zukünftige Konfliktbearbeitungen übertragbar seien. Hier ist vor allem die Arbeit von Dina Rossbacher (2004) zu nennen. Es zeigt sich, dass sich in der Forschung meist auf einen der Aspekte konzentriert wurde. Eine Ausnahme bildet dabei die Arbeit von Beate Kellermann (2006). Sie betreibt in ihrer Arbeit eine umfassende Analyse des Kosovo-Konfliktes, einschließlich der Konfliktentwicklung im Vorfeld und hinsichtlich einer Prognose über den Status des Kosovo. Ein Grund dafür, dass wenige umfassende Studien zum Kosovo existieren, ist zum einen in der Komplexität der Kosovo-Thematik begründet. Ein anderer Grund liegt in dem Andauern der Maßnahmen im Kosovo, wodurch ihre Folgen nicht vollständig absehbar sind. Vor allem in der neueren Beschäftigung mit dem Kosovo-Konflikt ist eine Tendenz, weg von der Bearbeitung der Konfliktursachen hin zu einem deutlichen Schwerpunkt auf die Statusfrage des Kosovo auszumachen.[2]
Im Februar 2008 erklärte das Kosovo einseitig seine Unabhängigkeit. Damit beginnt im Kosovo-Fall neun Jahre nach Beendigung der Kampfhandlungen ein neuer Abschnitt. Insbesondere deswegen stellt sich die Frage, inwieweit die erfolgten Maßnahmen der Internationalen Gemeinschaft eine grundlegende Sicherheit im Kosovo wiederherstellen konnten, welche auch in Zukunft den Schutz menschlichen Lebens gewährleistet und eine Basis für Entwicklung und Frieden bildet. Dies ist die zentrale Frage, mit der sich die vorliegende Arbeit beschäftigen wird. Es hat sich gezeigt, dass in der Forschung diese Frage nicht genügend beantwortet wird und eine umfassende Analyse für den Kosovo dahingehend fehlt. Auch bezüglich dieser Fragestellung finden sich nur Beiträge, die sich entweder auf einzelne Aspekte, wie die Polizeiarbeit konzentrieren, oder sich ausschließlich mit der aktuellen Sicherheitslage auseinandersetzen. Vor allem eine Studie des Institutes für Europäische Politik von 2008 setzt sich mit letzterer auseinander.
Aufgrund dieser Lücke in der bekannten Forschung stellt sich die Frage, mit welchem Konzept und, daran anschließend, anhand welcher Kriterien die erfolgten Maßnahmen hinsichtlich der zentralen Frage diskutiert werden sollen. Deswegen wird die Arbeit zwei gleichwertige Teile umfassen. Im theoretischen Teil soll es darum gehen, geeignete Kriterien zu ermitteln, mit denen die erfolgten Maßnahmen zur Wiederherstellung von Stabilität und der Schaffung grundlegender Sicherheit diskutiert werden können. Im analytischen Teil sollen dann die militärische Intervention und die Post-Konfliktmaßnahmen anhand dieser Kriterien auf die zentrale Fragestellung hin geprüft werden.
Der Kosovo-Konflikt steht dabei in einer Reihe von innerstaatlichen Konflikten, die seit Ende des Kalten Krieges eine neue Diskussion um den Begriff der Sicherheit ausgelöst haben. Es ist demnach für die konzeptionelle Einbettung evident, auf den Begriff der Sicherheit und die neuen Tendenzen innerhalb des Sicherheitsverständnisses auch in Abgrenzung zu anderen Debatten genauer einzugehen. Im Fokus stehen dabei die zentralen Konzepte der „erweiterten Sicherheit“ und der „Human Security“. Das erkenntnisleitende Interesse hierbei ist, zu ermitteln, welches der gegenwärtigen Sicherheitskonzepte am ehesten geeignet erscheint, einen normativen Rahmen vorzugeben und Handlungsanweisungen im Umgang mit innerstaatlichen Konflikten zu schaffen. Die These ist, dass insbesondere das Konzept der „Human Security“ diesen Anforderungen gerecht wird, was es zu prüfen gilt. Hierfür wird vor allem die Arbeit von Mary Kaldor (2007) herangezogen werden.
In einem zweiten Schritt innerhalb der theoretischen Auseinandersetzung gilt es zu klären, welche Schlussfolgerungen aus einem veränderten Verständnis von Sicherheit für militärische Interventionen zu humanitären Zwecken entstehen. In der Forschung werden dahingehend zwei Konzepte diskutiert: Die „humanitäre Intervention“ und das neuere Konzept der „Responsibility to Protect“ (R2P) der International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) von 2001. Die Intervention der NATO wurde unter dem in der Forschung kontrovers diskutierten Begriff der „humanitären Intervention“ geführt. Hinsichtlich der zentralen Fragestellung muss hinterfragt werden, ob das Konzept der „humanitären Intervention“ angemessene Kriterien für die Schaffung einer grundlegenden Sicherheit auch für die Post-Konflikt-Zeit beinhaltet. Militärische Interventionen zu humanitären Zwecken sind keine Konfliktlöser, dennoch sind militärische Komponenten oft erforderlich, um Stabilität und eine grundlegende Sicherheit in einem Gebiet wiederherzustellen. Letztere sind elementare Grundlagen für die Entwicklungsfähigkeit einer Region oder eines Landes. Die Betrachtung einer militärischen Intervention, die den Anspruch hat, menschliches Leid zu beenden sowie zu stabilisieren und Grundlage für Sicherheit zu sein, kann somit nicht isoliert von ihren Folgen betrachtet werden. Deswegen muss die Frage nach bestehenden Kriterien in der Forschung für die Einschätzung der Sicherheit in Post-Konflikt-Situation unweigerlich folgen.
Aus der kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff der Sicherheit und den bestehenden Konzepten zu einer Intervention zu humanitären Zwecken, soll ein umfassender Kriterienkatalog ermittelt werden.
Im analytischen Teil soll zunächst ein Überblick über die Geschichte und die Entwicklung des Konfliktes im Kosovo vorangestellt werden. Danach soll anhand der ermittelten Kriterien zunächst die militärische Intervention der NATO kritisch analysiert werden. Es wird dabei aber nur am Rande auf die völkerrechtliche Debatte eingegangen werden, da diese nicht Schwerpunkt dieser Arbeit sein soll. Es steht die Frage im Vordergrund, inwieweit die Intervention eine Stabilität wiederherstellen konnte.
Hieran anschließen wird eine Beschäftigung mit den erfolgten Maßnahmen in der Post-Konflikt-Zeit im Kosovo. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt dabei auf den Maßnahmen, die explizit zur Schaffung einer grundlegenden Sicherheit erfolgten. Eine Beschäftigung mit der aktuellen Situation im Kosovo soll in Form eines problemorientierten Rahmens erfolgen. Dabei geht es im Wesentlichen darum, das Bild der Sicherheitslage im Kosovo zu vervollständigen, um auch Aussagen über mögliche zukünftige Entwicklungen treffen zu können.
Diese Arbeit mit der Kosovo-Thematik betreibt keine Wirkungsanalyse. Vielmehr liegt das Interesse auf bereits bestehender Forschungsliteratur zum Kosovo und deren Positionierung. Des Weiteren verfolgt diese Arbeit keine Auseinandersetzung mit der völkerrechtlichen und entwicklungspolitischen Debatte. Interne und externe Akteure, Strukturen der Übergangsverwaltung im Kosovo und Institutionenbildung, sowie Demokratisierungsprozesse werden nur dort hervorgehoben, wo sie unmittelbar für die zentrale Fragestellung relevant erscheinen. Auch liegt es nicht im Interesse dieser Arbeit, die Statusfrage des Kosovo zu erörtern. Der Rahmen dieser Arbeit bedingt, dass keine abschließende Sicherheitsanalyse der Situation im Kosovo vorgenommen werden kann. Vielmehr geht es darum, explorativ einen Kriterienkatalog zu erstellen, anhand dessen der Erfolg der Maßnahmen im Kosovo hinsichtlich einer grundlegenden Sicherheit bewertet werden soll.
2 Der Sicherheitsbegriff: Sicherheit und militärische Intervention
2.1 Wandel des Sicherheitsverständnisses
Zur Zeit des Kalten Krieges stand das Prinzip der Nicht-Intervention an erster Stelle. Nach 1945 war durch die Charta der UN der Einsatz von Gewaltanwendung gegenüber Mitgliedsstaaten erheblich eingeschränkt worden. Parallel entwickelte sich ein Gesetzeswerk aus verschiedenen Menschenrechterklärungen und –Konventionen, welche das Verbot der Misshandlung von Individuen, auch der eigenen Bevölkerung, durch Staaten umfasste (Kaldor 2007: 38). In den späten 1980er Jahren wurde die Position des Individuums durch eine wachsende Überzeugung, Menschenrechte in der internationalen Staatenpolitik zu verankern, gestärkt. Das Prinzip der Nicht-Intervention basierte im Wesentlichen auf der Akzeptanz, dass alleinig die Staaten Rechte im Völkerrecht besäßen und nicht Individuen (Kaldor 2007: 38).
Dieser Wandel in den internationalen Normen hin zu einer Stärkung der Rechte von Individuen in den späten 1980er und dann zentral in den 1990er Jahren lässt sich maßgeblich durch vier Faktoren begründen: Ein wesentlicher Faktor war das Ausbreiten der sogenannten „Neuen“ oder „Postmodernen Kriege“ vor allem in Afrika und in Osteuropa. Diese werden auch oft als Bürger- oder interne Kriege bezeichnet. Charakteristisch an diesen Kriegen ist, dass eine direkte Auseinandersetzung zwischen den Konfliktparteien eher selten und die meiste Gewalt gegen Zivilisten gerichtet ist (Kaldor 2007: 39). Ein zweiter Faktor war der Zuwachs an humanitären Nicht-Regierungsorganisationen (NROs) (Kaldor 2007: 39). Durch ihre Präsenz in vielen Kriegsgebieten wurde ihre Arbeit zunehmend als Nicht-Regierungs-Intervention angesehen. Ihre Tätigkeit konzentrierte sich meistens auf die Schaffung von „humanitären Korridoren“ in den Krisengebieten, durch welche die Hilfe für die Zivilbevölkerung möglich wurde (Kaldor 2007: 40). Dieses Engagement schlug sich in der internationalen Anerkennung 1988 durch die UN-Resolutionen 43/131 und 45/100 nieder. Diese Resolutionen hielten weiterhin an der Souveränität der Staaten fest, erkannten aber die Wichtigkeit einer internationalen Gemeinschaft hinsichtlich des Schutzes von Opfern und der Schaffung von „humanitären Korridoren“ in Krisengebieten an (Kaldor 2007: 40). Der dritte Faktor war der Anstieg und die zunehmende transnationale Vernetzung unterschiedlicher Menschenrechtsgruppen (Kaldor 2007: 41). Der vierte Faktor war das Ende des Kalten Krieges. Dieses ermöglichte gemeinsames internationales Handeln, entfachte einen globalen Diskurs über Menschenrechte und ließ die „Neuen Kriege“ mehr in den Vordergrund treten (Kaldor 2007: 42).
Diese Entwicklungen regten auch eine neue Debatte um den „traditionellen“ Sicherheitsbegriff[3] an: Maßgeblich war die Erkenntnis, dass Staaten selbst Auslöser von Konflikten sein können und die Souveränität dieser dann keinen Schutz mehr für die Zivilbevölkerung darstellt (Weller/Kirschner 2005: 12). Solche als instabil bezeichneten Staaten können eine Gefährdung für ganze Regionen darstellen. Szenarien wie 1994 in Ruanda warfen die Frage auf, wie die Weltgemeinschaft mit solchen Situationen umzugehen habe. Bereits 1991 stellten die Staats- und Regierungschefs der NATO fest, dass der Begriff der Sicherheit mehr umfasse: Er schließe sowohl politische, wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Elemente als auch die Verteidigungsdimension mit ein (Frank 2001: 18). Dadurch wurde der Wandel der Sicherheitspolitik von einer eindimensionalen Betrachtung des Ost-West-Konfliktes zu einer mehrdimensionalen Frage regionaler und globaler Stabilität deutlich (Frank 2001: 18). Die Motive für diese Entwicklung seien dabei sehr unterschiedlich: Auf der einen Seite sei die Suche nach neuen Aufgaben des Militärs nach Ende des Ost-West-Konfliktes. Dann gebe es den entgegengesetzten Versuch, die Sicherheitspolitik vom Militärischen weg neu zu orientieren. Nicht zuletzt gab es verstärkt die normative Forderung, nicht den Staat, sondern das Individuum bzw. die Menschheit zum Objekt der Sicherheit zu erheben (Müller 1997: 1; Roithner 2006).
Eine wesentliche Kritik an den neuen Tendenzen innerhalb des Sicherheitsverständnisses ist, dass der Begriff der Sicherheit dadurch inzwischen einem „inflationären Gebrauch“ unterliege (Müller 1997: 1). Es gibt verstärkt die Auffassung, dass eine begriffliche Klarheit geschaffen werden müsse (Müller 1997: 1; Roithner 2006; Siedschlag 2006: 5). Die wichtigsten Argumente hierfür sind, dass eine Klarheit des Begriffs auch Klarheit über die Mittel gebe, mit denen globale Probleme angegangen werden sollen, und dass so auch die unterschiedlichen Sicherheitsbelange besser differenziert werden könnten (Müller 1997: 1; Roithner 2006). Die begriffliche Differenzierung ist besonders im Rahmen dieser Arbeit von Bedeutung, da die Debatte der normativen Konzeption im Sicherheitsbereich eng mit der Debatte um militärische Interventionen verknüpft ist.
2.1.1 Abgrenzung der sicherheitspolitischen von der friedenstheoretischen und entwicklungspolitischen Debatte
Die Frage ist zunächst, welches Grundverständnis hinter dem Begriff der Sicherheit steht. Hierfür bietet sich die Definition von Stock an. Er beschreibt als grundsätzliche Ursache für ein Streben nach Sicherheit die Gefahr. Die Gefahr sei die Möglichkeit eines negativen Ereignisses, „das im Hinblick auf verschiedene mit einer Wertschätzung behaftete Werte und Güter ein Übel, einen Verlust oder Schaden darstellt“ (Stock 1974: 58f.). Der Begriff der Sicherheit habe eine Zukunftsorientierung. Ziel der Sicherheit sei die Gewissheit des zukünftigen Bestandes von Werthaftem (Stock 1974: 59, 61). Sicherheit entstehe durch das Vorhandensein von Ordnungssystemen wie Rechtssicherheit (Stock 1974: 70). Stock bezeichnet Sicherheit als „Schutz des Schutzes“, als Sicherung der Schutzfunktion. Dadurch werde Sicherheit zum Wert (Stock 1974: 77). Absolute Sicherheit sei dagegen nicht erreichbar. In diesem Zusammenhang wird von Risiken[4] gesprochen, die annähernd abgeschätzt werden könnten und die gemeinhin mit Wahrscheinlichkeitsformeln ausgedrückt werden (Stock 1974: 85). Es lässt sich festhalten, dass Sicherheit herrscht, wenn nicht nur kurzfristig, sondern auch auf lange Sicht ein zuverlässiger und für die Zukunft sicherer Schutz erreicht werden kann. Dieses Verständnis von Sicherheit, das Stock aus den völkerrechtlichen und politischen Entwicklungen seit Ende des Zweiten Weltkrieges ableitet, kann als immer noch zeitgemäß betrachtet werden.
„Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.“ (Willy Brandt, hier zit. in Nuscheler 2004: 247)
Eine Abwandlung dieses Zitates von Willy Brandt aus der Zeit des Kalten Krieges erscheint 2001, ebenfalls mit Quellenbezug auf Willy Brandt, in dem Sammelband „Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen. Kompendium zum erweiterten Sicherheitsbegriff“ (Hrsg. Bundesakademie für Sicherheitspolitik 2001), nur dass diesmal das Wort Frieden durch das Wort Sicherheit ersetzt wurde (Frank 2001: 28). Diese Begriffsersetzung findet sich verstärkt in der neueren Forschung und in der internationalen Politik wieder. Um dieser Tendenz der Verwischung entgegenzuwirken, sollen im Folgenden die friedenstheoretische und die entwicklungspolitische Debatte kurz skizziert werden.
Die friedenstheoretische Debatte setzt bei der Erfahrung an, dass moderne Gesellschaften im Laufe der Zeit weitgehend erfolgreich Normen und Institutionen für einen gewaltfreien Austrag von Konflikten entwickelt hätten (Weller/Kirschner 2005:14). Zusammengefasst worden sind die zusammenwirkenden Faktoren der Friedensbedingungen insbesondere von Dieter Senghaas unter dem Begriff des „Zivilisatorischen Hexagons“ (Senghaas 2004: 31). Dieses beinhaltet die Faktoren Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit, politische Teilhabe, Interdependenz und Affektkontrolle, Verteilungsgerechtigkeit und eine Kultur konstruktiver Konfliktbearbeitung. Diese Faktoren ständen aber immer in Gefahr, wieder zur Disposition zu stehen. Sie seien keine Versicherung gegen einen gewaltsamen Konfliktaustrag. Sie würden aber spürbar die Neigung zur Gewaltanwendung senken (Weller/Kirschner 2005:15). Frieden bzw. „positiver Frieden“ umfasst einen Zustand der Abwesenheit struktureller Gewalt (Galtung 1980). Sucht man hier die Verbindung zum Sicherheitsbegriff, so könnte der Zustand des Friedens als der Garant für den zukünftigen Bestand von Werthaftem bezeichnet werden. Frieden ist somit ein Wert, der eine hohe Sicherheit garantieren kann. Es zeigt sich, dass Frieden und Sicherheit aber in keiner Weise identisch sind, sich aber bedingen. Gleichzeitig gilt es, diesen Wert durch Ordnungssysteme zu sichern.
Die aktuelle entwicklungspolitische Debatte geht von der Erkenntnis aus, dass gewaltsam ausgetragene Konflikte eine massive Behinderung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung darstellen (Weller/Kirschner 2005:17). Ein besonderes Augenmerk liege auf der Rolle gesellschaftlicher Konflikte in Entwicklungsprozessen. Daraus ergibt sich die Fragestellung, wie entwicklungspolitische Maßnahmen konstruktiv auf den Verlauf von Konflikten einwirken und kontraproduktive Effekte vermieden werden können. (Weller/Kirschner 2005:18). Es wird also deutlich, dass entwicklungspolitische Maßnahmen sich vor allem mit Friedenszeiten und Konfliktpräventionsmaßnahmen beschäftigen, sowie mit der Frage, wie nach gewaltsamen Konflikten und einer „Rehabilitationszeit“ weiterführende Entwicklungen eingeleitet werden können. Dies macht deutlich, dass in einer Krisennachsorge Entwicklungsbemühungen bereits mit eingreifen können, dass es aber in der Stabilisierungsphase zunächst darum geht, den konkreten Auslöser des Konfliktes zu beseitigen und eine Stabilität wiederherzustellen, die nicht selten der Vorkonfliktsituation entspricht. Die Sicherheit sei nunmehr nicht nur Folge von positiver Entwicklung, sondern auch Voraussetzung dieser (Weller/Kirschner 2005: 18).
Zwei zentrale Begriffe haben sich mittlerweile in der sicherheitspolitischen Debatte herausgebildet. Der Begriff der „erweiterten Sicherheit“ und der Begriff der „menschlichen Sicherheit“ bzw. „Human Security“[5]. Neben dem traditionellen Sicherheitsverständnis treten bei beiden Konzepten veränderte Perspektiven auf die Bedingungen und die Inhalte von Sicherheit in den Vordergrund (Weller/Kirschner 2005: 16). Die „erweiterte Sicherheit“ geht von vielfältigen Unsicherheitsquellen auch jenseits militärischer Bedrohungen aus und diskutiert nicht nur militärische Maßnamen zu deren Bearbeitung. Die „Human Security“ stellt nicht den Staat, sondern das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung und fragt nach der Rolle des Staates für die menschliche Sicherheit (Weller/Kirschner 2005: 16f.).Die beiden Begriffe werden im Folgenden vorgestellt und dahingehend hinterfragt, welche konkreten Handlungsanweisungen die jeweiligen Konzepte für Krisensituationen bereitstellen.
2.1.2 Der „erweiterte Sicherheitsbegriff“
In einem „erweiterten Sicherheitsbegriff“ wird von einer Vielzahl von Unsicherheitsquellen auch jenseits militärischer Bedrohungen ausgegangen. In der wissenschaftlichen Debatte selbst lassen sich zwei Richtungen ausmachen.
Eine Richtung beschäftigt sich vor allem mit der generellen Frage nach den Feldern, die für eine zukunftsfähige positive Stabilität eine Rolle spielen. So versteht Jochen Hippler den Begriff „erweiterte Sicherheit“ als eine „Sicherheit“ [die] nicht primär militärisch erreicht werden kann, sondern Antworten auf zahlreiche andere Fragen erfordert“ (Hippler 2003). Diese „Fragen“ betreffen beispielsweise die Kluft zwischen Arm und Reich, den Klimawandel, die Migration, Terror und Kriminalität (Hippler 2003). Daraus folge die Notwendigkeit eines breiten Spektrums an nicht nur militärischen Maßnahmen zur Bedrohungsbearbeitung (Weller/Kirschner 2005:16).
Die zweite Richtung erfasst den „erweiterten Sicherheitsbegriff“ lediglich als Ergänzung zum traditionellen Sicherheitsbegriff. Das traditionelle Sicherheitsverständnis mit seinen militärischen Mitteln dürfe nicht ersetzt oder aufgegeben werden. Moderne Streitkräfte seien in einem funktionierenden Bündnis unerlässlich (Frank 2001: 28; Weller/Kirschner 2005: 16f.). Es wird auch die Stellung „nichtmilitärischer Aspekte“ hervorgehoben. Die Legitimationsgründe für das Militär seien teilweise durch die „erweiterten“ Sicherheitsaufgaben neu begründet worden. Ausschließlich militärische Instrumente würden aber wenig zur „Auflösung der Asymmetrien“ in den internationalen Beziehungen oder der Verbesserung der humanitären Situation in der Welt beitragen (Roithner 2006). Aus dieser Richtung des „erweiterten Sicherheitsbegriffes“ ergibt sich eine Durchsetzungstendenz des Paradigmas eines „umfassenden“ und „ressortübergreifenden“ Sicherheitsverständnisses im Sinne eines „ganzheitlichen“ Ansatzes (Siedschlag 2006: 2).
Der Begriff der „erweiterten Sicherheit“ wird vor allem wegen seiner Ungenauigkeit und des Fehlens einer Anweisung für eine funktionale politische Umsetzung stark kritisiert. Es wird die Tendenz beanstandet, den „erweiterten Sicherheitsbegriff“ auf beinahe jedes Feld öffentlichen Handelns anzuwenden. Kritische Stimmen sehen dadurch die Eigenständigkeit bestimmter Felder wie der Entwicklungspolitik in Gefahr (Lieser 2004). Der Hauptvorwurf ist, dass eine Vermischung ziviler und militärischer Aufgaben einen Widerspruch zum Neutralitätsprinzip darstelle (Lieser 2004). Was daraus folge, sei eine „securitization“ oder Versicherheitlichung. Eine Totalisierung von Sicherheit eröffne somit einer Militarisierung von Problembearbeitungsstrategien den Raum (Maihold 2005: 43). Durch die „Entgrenzung“ verliere der Begriff der Sicherheit als analytischer Begriff jede Trennschärfe. Dadurch könne eine schleichende Militarisierung aller Lebensbereiche drohen, weil sich der Begriff mit den gängigen Instrumenten nationaler Sicherheit verknüpfe (Müller 1997: 2).[6] Deswegen wird von einigen Kritikern sogar gefordert, den Begriff der traditionellen Sicherheit beizubehalten, ohne sich jedoch gegenüber den Veränderungen im globalen Geschehen zu verschließen. Bedrohung nationaler Sicherheit seien demnach Ereignisse oder Konstellationen, die die Existenz eines der drei Bestandteile Staatsgebiet, Gesellschaft oder/und politisches System bzw. Rechtsstaat bedrohe oder die Beziehungen innerhalb und zwischen den Bestandteilen zu stören vermögen. Dies alles in dem Maße, dass eine Gewaltanwendung drohe (Müller 1997: 2).
Die Vertreter des „erweiterten Sicherheitsbegriffs“ dagegen sehen in der „Allianz“ ziviler und militärischer Bereiche „ein innovatives Modell ressortübergreifenden Handelns“ (Klingebiel/Roehder 2004: 2; Siedschlag 2006: 2). Als positiv wird die Schärfung des Bewusstseins für die Notwendigkeit nicht-militärischer Strategien im Umgang mit Bedrohungen empfunden. Die Erweiterung des Blicks auf das Zusammenspiel von Sicherheit, Frieden und Entwicklung kann als positiv bewertet werden. Der Begriff berücksichtigt die nichtmilitärischen Herausforderungen und schafft damit ein Bewusstsein für die Bedingungen langfristiger Stabilität. Die Gefahr, aus dem „erweiterten Sicherheitsbegriff“ auch ein erweitertes Rollenverständnis des Militärs abzuleiten, wird aber auch hier erkannt (Weller/Kirschner 2005: 16f.). Vor allem der „Krieg gegen den Terror“ würde „Widersprüchlichkeiten einer Sicherheitspolitik“ offenbaren, die mit dem Einsatz von Gewalt gegen Bedrohungen angehen wolle, was aber diametral zu den Normen und Zielen einer „zivilisierten Welt“ stehe (Weller/Kirschner 2005:17).
Der Begriff der „erweiterten Sicherheit“ birgt zudem die Schwierigkeit, dass er primär Bedingungen für einen Zustand nachhaltiger Stabilität subsumiert, ohne konkrete Handlungsanweisungen zu geben, was sich in den Diskussionen um die Wahl der Mittel widerspiegelt. Nicht zuletzt deswegen hat sich in der internationalen Debatte um Sicherheit der Ansatz der „Human Security“ besonders hervorgetan (Roithner 2006).
2.1.3 „Human Security“
Der Begriff der „menschlichen Sicherheit“ oder „Human Security“ stammt aus dem Human Development Report 1994 des United Nations Development Programme (UNPD).[7] Der Mensch rückt in diesem Verständnis in den Vordergrund. Der Staat wird als Instrument zum Schutz des menschlichen Lebens und zu Förderung der menschlichen Wohlfahrt gesehen (Thakur 2008: 110; Weller/Kirschner 2005: 16). Ziel des Konzeptes der „Human Security“ ist eine Neudefinition der Verknüpfung von Sicherheit und Entwicklung. Menschliche Sicherheit ergänze menschliche Entwicklung vor allem in den Situationen, in denen spezielle Notlagen vorliegen. Wenn Mindestvoraussetzungen menschlicher Sicherheit fehlen, sei menschliche Entwicklung nur schwer umzusetzen (Busumtwi-Sam 2008: 81). Es ergeben sich für die menschliche Sicherheit demnach drei Dimensionen, die in einem spannungsreichen Beziehungs- und Abhängigkeitsverhältnis stehen: Die sicherheitspolitisch-humanitäre Dimension, die menschenrechtliche Dimension und die entwicklungspolitische Dimension (Werthes 2008: 191f.). Innerhalb des „Human Security“-Konzeptes lassen sich drei Richtungen festmachen.
Ein erster umfassenderer Ansatz bezieht ein breites Spektrum von Faktoren ein, die Einfluss auf menschliche Wohlfahrt und Menschenwürde haben (Busumtwi-Sam 2008: 81). Problematisch an diesem Ansatz ist die konzeptionelle Unschärfe des Begriffs, da versucht wird, alle Ursachen mangelnder menschlicher Unsicherheit zu erfassen. Die geforderte Unterscheidung zwischen menschlicher Sicherheit und menschlicher Entwicklung werde dadurch nicht deutlich (Busumtwi-Sam 2008: 83). Ein zweiter engerer Ansatz konzentriert sich ausschließlich auf bewaffnete Konflikte (Busumtwi-Sam 2008: 81). Der ursprüngliche Zweck, einen neuen Sicherheitsansatz in einen neuen, auf Individuen konzentrierten Entwicklungsansatz zu verankern, wird von vielen Kritikern deswegen als nicht erfüllt betrachtet (Busumtwi-Sam 2008: 83). Ein weiterer Kritikpunkt an dem Beschränken auf bewaffnete Konflikte besteht darin, dass es bereits klare Konzepte durch die UN für eine Friedensstiftung gebe (Busumtwi-Sam 2008: 84). Eine dritte und neuere vielversprechende Tendenz ist, das allgemeine Konzept des UNDP präziser zu formulieren und neu zu definieren (Busumtwi-Sam 2008: 84). Dabei wird für einen einzigen, einheitlichen Rahmen plädiert, der den engeren mit dem umfassenderen Ansatz in Einklang bringt und konkretisiert (Busumtwi-Sam 2008: 82). Einen ersten Schritt in diese Richtung unternahm 2003 ein Bericht der Commission on Human Security (CHS). „Human Security“ wird hier als die Vermeidung negativer Ereignisse definiert. Diese negativen Ereignisse seien vor allem „Unsicherheiten, die das menschliche Überleben bedrohen“ oder gegenwärtige „Gefahren plötzlichen Mangels“ (Busumtwi-Sam 2008: 84; hier zitiert nach: CHS 2003: 8). Der Umfang und der Gegenstandsbereich des traditionellen Sicherheitsansatzes wird durch dieses konkretere Konzept der „Human Security“ neu definiert. Bedrohungen, die auch die menschliche Entwicklung betreffen, werden in die Betrachtung mit einbezogen. Zum wichtigsten Bezugsobjekt werden Individuen und Gemeinschaften (Busumtwi-Sam 2008: 85). Letztlich geht es bei der menschlichen Sicherheit um den Schutz von Menschen vor kritischen und lebensbedrohlichen Situationen unabhängig von den Ursachen (Thakur 2008: 111).
Das Konzept der „Human Security“ beschäftigt sich im wesentlichen mit den notwendigen Bedingungen menschlicher Sicherheit. Es ergeben sich drei Ansprüche: Ein tragfähiges Konzept muss erstens Faktoren und Kontexte erfassen und beschreiben können, die Menschen objektiv, systematisch und nachhaltig in ihrem (Über-)Leben gefährden (Werthes 2008: 195; Busumtwi-Sam 2008: 89). Wobei die Situationen, in denen bestimmte Faktoren und Umstände auftreten, kontextuell unterschiedlich sein können. Ein weiterer Anspruch liegt darin, die unterschiedlichen Bedrohungslagen für eine langfristige Zukunftsfähigkeit fassbar zu machen (Werthes 2008: 195). Dies bedeutet auch, dass Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz, sowie Mitwirkungsmöglichkeiten im Konzept beinhaltet sein müssen (Busumtwi-Sam 89; Kaldor 2007: 189). Abschließend müsse ein quantifizierbarer Schwellenwert identifiziert werden, der eine Auskunft über die Dimension der Unsicherheit gebe (Werthes 2008: 195; Busumtwi-Sam 2008: 86).
Zur Erfassung der Dimension von Unsicherheit schlägt Busumtwi-Sam einen „Mangel-Verwundbarkeits-Ansatz“ vor. Die Verwundbarkeit sei bei denjenigen höher, die durch eine Form des Mangels am wenigsten in der Lage seien, sich zu schützen (Busumtwi- Sam 2008: 86). Das Kriterium der Verwundbarkeit ermögliche es, die Unmittelbarkeit einer Bedrohung abzuschätzen und auch eine Aussage über die Eintrittswahrscheinlichkeit von Bedrohungen abzugeben. Die Konzentration auf Mangelsituationen verknüpfe zudem den Bereich der menschlichen Sicherheit mit dem Bereich der menschlichen Entwicklung und stellt einen Zusammenhang zu bewaffneter Gewalt her (Busumtwi-Sam 2008: 86f.). Werthes schließt an diesen „Mangel-Verwundbarkeits-Ansatz“ an und erweitert ihn durch die Idee der Unterscheidung von Empfindlichkeit und Verwundbarkeit. Im Bereich der Empfindlichkeit könne weitestgehend selbstständig auf negative Ereignisse reagiert werden. Verwundbarkeit dagegen entstehe durch Ereignisse, die schwer zu kontrollieren seien und bei denen auch langfristig kaum eine erfolgreiche Aussicht auf eine selbständige Reaktion bestehe. In einem solchen Fall handele es sich um eine nicht zu akzeptierende Situation (Werthes 2008: 196). Somit stelle die Verwundbarkeit einen Bereich dar, in der eine Einmischung inter- und transnationaler Akteure mehr und mehr legitim erscheine (Werthes 2008: 197).
Der Zugang über den „Mangel-Verwundbarkeits-Ansatz“ bietet ein klareres Bild der Dimensionen menschlicher Sicherheit. Dennoch handelt es sich bei dem Ansatz noch um ein unfertiges Modell. Die Frage nach Instrumenten, Strategien und Akteuren menschlicher Sicherheit bleibt hierin noch unberücksichtigt (Werthes 2008: 197). Zudem fehlen Anhaltspunkte zur Bestimmung der Zustände, wann eine Situation nicht mehr von den Betroffenen zu kontrollieren ist. Werthes führt dazu das Prinzip der Subsidiarität an. Ausgehend vom Einzelnen über die lokale, nationale, regionale bis hin zur internationalen Ebene solle menschliche Sicherheit möglichst eigenverantwortlich gewährleistet werden. Erst bei einer Nichtbewältigung der negativen Ereignisse solle die Verantwortung an die nächst höhere Ebene übergehen (Werthes 2008: 199). Der Bereich der menschlichen Sicherheit nach Werthes beinhalte eine Verantwortung zur Reaktion. Er umfasse Zustände gewaltbasierender Bedrohungen des (Über-)Lebens und physische Gewalt wie beispielsweise Folter. Er umfasst aber auch einen Teil des Bereiches der Menschenrechte, wie fundamentale Menschenrechte, und einen Teil des Bereichs menschlicher Entwicklung, wie lebensnotwendige Grundbedürfnisse (Werthes 2008: 198). In der Diskussion um „Human Security“ herrscht ein breiter Konsens darüber, dass der von Werthes definierte „Kernbereich“ menschlicher Sicherheit ein Bereich „moderner“ Staaten sei, der zunehmend der Verantwortung zur legitimen Einmischung der internationalen Gemeinschaft unterliege (Werthes 2008: 198). Nur die Bereiche weiterer Menschenrechte, Wohlfahrt und Nachhaltigkeit würden noch der alleinigen Führsorgepflicht der „modernen“ Staaten unterliegen. In diesen Bereichen würde eine externe Einmischung stringent abgelehnt werden (Werthes 2008: 199). Der subsidiäre Bereich außerhalb internationaler Verantwortung scheint sich zunehmend zu verkleinern, während sich das Verständnis um internationale Verantwortung zum Schutz von dem ursprünglichen Kernbereich auf Nachbarbereiche ausdehnt.
Der „Mangel-Verwundbarkeits-Ansatz“, wie ihn vornehmlich Werthes und Busumtwi-Sam anlegen, enthält allerdings noch keine Handlungsanweisungen bzw. Richtprinzipien. Solche finden sich gut beschrieben in der Arbeit Mary Kaldors. Kaldor sieht in dem Konzept der „Human Security“ die Möglichkeit gegeben, menschliche Sicherheit in die Praxis umzusetzen. Sie geht wie Busumtwi-Sam und Werthes von einer gegenseitigen Bedingtheit menschlicher Entwicklung und menschlicher Sicherheit aus. Kaldor setzt bei denjenigen Situationen an, die nach Werthes den Bereich der Verantwortung zur Reaktion der internationalen Gemeinschaft betreffen. Dies sind insbesondere die sogenannten „Neuen Kriege“. Sie schaffen besondere Anforderungen an die Wiederherstellung eines zentralen Gewaltmonopols. Diese „Neuen Kriege“ tendieren dazu, über Staatsgrenzen hinauszuwirken, so dass sie immer in einem regionalen Kontext zu sehen seien (Kaldor 2007: 5) Bei der Wiederherstellung von Stabilität auf kurze Sicht gilt das Handeln primär den Symptomen der Krise, nicht den Ursachen (Naumann 2001: 864). Die kurzzeitige Situation, dass ein Gewaltmonopol wiederhergestellt ist, sagt aber noch nichts darüber aus, wie dauerhaft, legitim oder akzeptiert es sei. Hier kommt ein anderes Moment des Sicherheitsbegriffs zum Tragen, der von dem militärisch geprägten Sicherheitsbegriff nicht mit erfasst wird. Kaldor spricht hier von einer „security gap“[8] (Kaldor 2007: 10). Sie zeigt fünf Prinzipien für die Stabilisierung und Implementierung menschlicher Sicherheit und beschreibt kurz Strategien, die sowohl für die Sicherheit als auch für die Entwicklung relevant seien. Das Interessante an diesen Leitprinzipien ist, dass sie gleichfalls als Kriterien zur Überprüfung von Maßnahmen dienen könnten. Als Richtschnur können sie es ermöglichen, auf eventuelle Defizite aufmerksam zu machen und gleichzeitig dadurch eine Prognose für die Langfristigkeit von Stabilität abgeben. Im Folgenden soll deswegen auf diese Prinzipien näher eingegangen werden.
Das erste Prinzip nach Kaldor sei der Vorrang der Menschenrechte.
„In many post-conflict areas, economies have been stabilized and very high rates of growth achieved. Yet individual insecurity as a consequence of joblessness and the high levels of informal economic activity remains a potential contributor of future conflict“ (Kaldor 2007: 187). „Today, however, it is impossible to seperate security and development.“ (Kaldor 2007: 196).
Die Frage ist also, ob ein Großteil an Menschen in Post-Konflikt-Gebieten von Entwicklungen mit erfasst wird. Wenn dies nicht der Fall ist, so kann daraus neues Konfliktpotenzial entstehen oder latente Konflikte können wieder ausbrechen.
Das zweite Prinzip sei das der legitimen Autorität.
„Human security depends on the existence of legitimate institutions that gain the trust of the population and have some enforcement capacity.... Legitimate political authority does not necessarily need to mean a state; it could consist of local gouvernment or regional or international political arrangements like protectorates or transnational administrations.... This principle explicitly recognizes the limitations on the use of military force. The aim of any intervention is to stabilize the situation so that a space can be created for a peaceful political process rather than to win through military means alone... “ (Kaldor 2007: 187).
Kaldor konstatiert, dass eine legitime Autorität den Rückhalt der Bevölkerung voraussetze. Verschiedene Institutionen könnten dabei diese legitime Autorität ausüben. Zugleich zeigt das Kriterium nach Kaldor eindeutig die Grenzen militärischen Eingreifens.
Das dritte Prinzip müsse das Prinzip des Multilateralismus sein.
„Multilateralism is closely related to legitimacy and is what distinguishes a human security approach from neo-colonialism.“ (Kaldor 2007: 188).
Multilateralismus meine die Verpflichtung mit und durch internationale Institutionen zu arbeiten, an aller erster Stelle der UN. Auch bringe das Prinzip die Verpflichtung mit sich, gemeinsame Regeln und Normen zu schaffen und auch Probleme durch Regeln und Kooperation zu lösen (Kaldor 2007: 188f.).
Das vierte Prinzip sei die „Bottom-Up“-Herangehensweise. Diese basiere auf den Schlüsselkonzepten der Entwicklungspolitik: Partnership, Local Ownership und Partizipation.
„Decisions about the kind of security and development policies to be adopted, [...] must take account of the most basic needs identified by the people who are affected by violence and insecurity“. (Kaldor 2007: 189).
Die Notwendigkeit sei dabei, mit allen zu sprechen, auch mit Kriminellen, der Mafia oder Warlords. So sollte es möglich sein „to identify people of conscience and integrity who could act as local guides.“ (Kaldor 2007: 189).
Das fünfte Prinzip ist das des regionalen Fokus. Kaldor kritisiert, dass der Fokus tendenziell eher auf Gebieten gelegen hätte, „that are defined in terms of statehood“ (Kaldor 2007: 190). Neue Kriege und Konflikte hätten aber selten klare Grenzen. So müsse bei Konflikten immer eine ganze Region und nicht nur ein einzelnes Gebiet oder ein Land betrachtet werden. Meist besteht die Gefahr, dass ein Konflikt in einem Landesgebiet Wechselwirkungen mit Grenzgebieten oder einem Nachbarland, beispielsweise durch Flüchtlingsströme, Minderheiten, die in verschiedenen Ländern wohnen oder kriminelle Netzwerke, erzeugt. Dies sei in der Vergangenheit oft vernachlässigt worden (Kaldor 2007: 190). Kaldor sieht in diesem regionalen Fokus auch einen wichtigen Zusammenhang für die Förderung legaler Ökonomie- und Handelskooperationen in der Region. Diese seien wichtig, um Entwicklungen in Richtung „poverty and insecurity and the spread of an illegal/informal economy“ zu verhindern (Kaldor 2007: 190).
Es lässt sich festhalten, dass die Umformulierung nationaler Sicherheit zu einem Konzept der „Human Security“ zu weitreichenden Konsequenzen führt. Denn im Raum steht die grundlegende Frage nach einer Mitverantwortung für Sicherheit und Wohlfahrt über politische Grenzen hinaus (Thakur 2008: 111). Das Konzept der „Human Security“ erscheint am ehesten geeignet, einen normativen Rahmen vorzugeben und Handlungsanweisungen für die Politik hinsichtlich des Umganges mit innerstaatlichen Konflikten zu schaffen.
2.2 Die militärische Intervention
Durch den in den 1990er Jahren eingeleiteten Wandel im Verständnis von Sicherheit, wurde zunehmend akzeptiert, dass es ein Recht für den Gebrauch bewaffneter Kräfte zur Erreichung humanitärer Ziele gebe (Kaldor 2007: 17). Dem Prinzip der Nicht-Intervention, ausgedrückt durch den Artikel 2 (4) der Charta der Vereinten Nationen, stand die wachsende Forderung nach einer Reaktion auf die veränderten Szenarien in Gestalt der sogenannten „Neuen Kriege“ gegenüber.
Dieser Wandel in den internationalen Normen geht einher mit der Zunahme und dem sich verändernden Charakter von Peace-Monitoring-, Peacekeeping- und Peace-enforcement-Operationen seit den 1990er Jahren (Kaldor 2007: 22). Hervorzuheben ist vor allem die veränderte Funktion des Einsatzes militärischer Mittel. Ein Gebiet militärisch zu kontrollieren oder einen direkten militärischen Sieg zu erreichen, hat sich zunehmend erschwert (Kaldor 2007: 81). Die direkten Kämpfe zwischen bewaffneten Gruppen sind seltener geworden und stattdessen konzentriert sich die Anwendung von Gewalt zunehmend auf die zivile Bevölkerung. Ein besonderes Merkmal der „Neuen Kriege“ ist zudem eine häufig auftretende Kombination aus staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, welche jeweils versuchen, die politische Kontrolle über Gebiete zu gewinnen. Die Vorgehensweisen der unterschiedlichen Akteure haben in der Regel gemein, dass sie Angst und Unsicherheit verbreiten und die Gesellschaft polarisieren (Kaldor 2007: 82). Mehr und mehr zeigt die Erfahrung, dass militärische Operationen zum Schutz der Zivilbevölkerung diese Kriege weder gewinnen noch stoppen können, aber sie können Angst und Unsicherheit reduzieren und so einen Raum schaffen, in dem politische Lösungen diskutiert werden können (Kaldor 2007: 82). Techniken wie sichere Zufluchtsorte und „humanitäre Korridore“ könnten ein Teil der Eindämmungsstrategie werden (Kaldor 2007: 83). Ein wachsender globaler Konsens über die Notwendigkeit, menschliches Leid zu verhindern, bedeutet aber noch keinen Konsens über Art und Weise militärischer Interventionen (Kaldor 2007: 22).
2.2.1 Der „klassische Interventionsbegriff“
Es muss zunächst die Frage gestellt werden, auf welche Basis sich eine militärische Intervention gründet. Es ist zu prüfen, inwieweit eine militärische Intervention, die zur Erreichung humanitärer Ziele und zur Wiederherstellung von Stabilität eingesetzt wird und die Grundlage für eine langfristige Stabilität bieten soll, vom „klassischen Interventionsbegriff“ erfasst wird.
„Intervention bedeutet die Einmischung eines Staates oder einer internationalen Organisation unter Androhung oder Ausübung von Gewalt in Angelegenheiten eines Staates, die dessen alleiniger Kompetenz unterliegen, gegen dessen souveränen Willen, mit der Absicht, auf dessen Entscheidungsfreiheit Einfluss zu nehmen“ (Aghayev 2007: 6).
Diese Definition erfasst den Begriff der Intervention in seiner traditionellen Bedeutung. Interventionen sind klassische Instrumente von Staaten, um ihre Interessen durchzusetzen. Mit Ende des Zweiten Weltkrieges veränderte sich jedoch der klassische Interventionsbegriff. Dieser völkerrechtlich geprägte Begriff wurde bis 1945 so aufgefasst, dass unter Staaten nur solche Einmischungen in innere Angelegenheiten anderer als widrig galten, die militärische Gewalt anwendeten (Aghayev 2007: 2f.). Ab 1945 verankerten die UN mit Art. 2 (4) ein umfassendes Gewaltverbot, das auch ein Verbot nicht-militärischer Zwangsausübung beinhaltet.[9] Ein Interventionsverbot liegt aber explizit nur seitens der UN in die Angelegenheiten der Mitgliedsstaaten durch Art. 2 (7) vor. Ein Interventionsverbot gegenüber innerer Angelegenheiten anderer Staaten ist dadurch nicht ausdrücklich festgehalten (Aghayev 2007: 3).
Vier Merkmale lassen sich bei einer „klassischen“ Intervention unterscheiden. Erstens stellt eine Intervention eine Maßnahme eines Staates oder einer internationalen Organisation dar. Ist ein Staat nicht direkt an einer Intervention beteiligt, gewährt aber indirekt eine Operationsbasis für gewaltsame Angriffe gegen einen anderen Staat, so wird dies auch als „verdeckte Intervention“ bezeichnet (Aghayev 2007: 4f.). Zweitens greift eine Intervention in die Angelegenheiten eines anderen Staates ein. Es kann sich dabei sowohl um innere als auch um äußere Angelegenheiten handeln, wenn diese in die staatliche Zuständigkeit fallen. Dieser Zuständigkeitsbereich wird als „domaine réservé“ oder „vorbehaltener Bereich“ bezeichnet. Dieser Bereich reduziere sich aber mit zunehmender Internationalisierung, da zahlreiche Angelegenheiten einer völkerrechtlichen Regelung unterzogen würden. Vor allem in Zusammenhang mit menschenrechtlichen Angelegenheiten sei dadurch ein Rückgriff auf das Interventionsverbot immer schwieriger (Aghayev 2007: 4f.). Ein drittes Merkmal einer Intervention im klassischen Sinne ist die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen den Willen eines betreffenden Staates. Eine „erbetene Intervention“, die also auf Zustimmung eines betroffenen Staates erfolgt, wird an dieser Stelle nicht mit erfasst, da der souveräne Wille nicht verletzt wird (Aghayev 2007: 4f.). Letztendlich handelt es sich bei einer Intervention um eine Maßnahme, mit der die Absicht verfolgt wird, einen Staat zu einer Handlung oder einem Unterlassen zu zwingen und so Einfluss auf seine Entscheidungsfreiheit zu nehmen (Aghayev 2007: 4f.).
Es lässt sich festhalten, dass der „klassische Interventionsbegriff“ den neuen normativen Ansprüchen an eine Intervention zur Erreichung humanitärer Ziele und zur Wiederherstellung von Stabilität nicht gerecht wird. Kritisch ist vor allem auch, dass im „klassischen Interventionsbegriff“ die Intervention eines einzelnen Staates gegeben sein kann. Eine Intervention, die eine Grundlage für langfristige Stabilität sein will, muss sich vor allem durch multilaterales Vorgehen auszeichnen: Die Intervention eines einzelnen Staates kann zu Machtmissbrauch, sowie zum Vorwurf nationalen Interesses und Imperialismus führen, gleichzeitig ergibt sich die Schwierigkeit einer Rechtfertigung eines solchen Vorgehens (Aghayev 2007: 51; Naumann 2001: 854f.).
2.2.2 Die „humanitäre Intervention“
Das wesentliche Merkmal einer „humanitären Intervention“ ist der humanitäre Zweck, weswegen eine militärische Intervention angedroht oder durchgeführt wird (Aghayev 2007: 6). Eine „humanitäre Intervention“ bezeichnet eine militärische Intervention in einen Staat, um einen Genozid, massive Verletzung der Menschenrechte oder schwere Verletzungen der Genfer Konventionen, mit oder ohne die Zustimmung dieses Staates, zu verhindern oder zu unterbinden. (Kaldor 2007: 17).
„Humanitarian intervention is a method of enforcing international law with respect to human rights and the law of war where the state has collapsed or where the state itself violates the law“ (Kaldor 2007: 60).
Der Begriff „humanitär“ in seinem Grundverständnis ist dabei eher irreführend, da eine militärische Gewaltanwendung auch hier nicht ausgeschlossen wird. „Humanitär“ aus der völkerrechtlichen Perspektive meint in diesem Zusammenhang deswegen, „auf den Schutz des Menschen vor existentieller Bedrohung gerichtet“ (Aghayev 2007: 6; Pape 1997: 26). Die Rechtfertigung einer „humanitären Intervention“ erfolgt auf Grundlage der Menschenrechte. Ein wesentlicher Kritikpunkt in der Forschung ist, dass bis heute keine universell anerkannte und maßgebende Definition der Menschenrechte existiert (Aghayev 2007: 6). Dennoch bilden elementare Menschenrechte, wie das Recht auf Leben und Freiheit der Person oder das Genozid- und Vertreibungsverbot, einen essentiellen Bestandteil des Völkergewohnheitsrechtes. Auch finden sie sich in der Satzung der UN in der Anerkennung der Rechtsinhaberschaft des Individuums wieder (Aghayev 2007: 7f.).
In der globalen Debatte um „humanitäre Interventionen“ lassen sich vier Meinungsrichtungen zusammenfassen (Kaldor 2007: 53).[10] Zum einen gebe es die Verfechter der Souveränität. Diese lehnen „humanitäre Interventionen“ ab. Entweder weil sie das Prinzip der Nicht-Intervention unterstützen (Pluralisten) oder weil sie der Meinung sind, dass Interventionen nur mit nationalen Interessen ausgetragen werden (Realisten). Zu den Vertretern gehören in der Regel traditionell Linke und nationalistische Gruppen (Kaldor 2007: 53ff.). Diese Positionen werden im Zuge der Globalisierung und einer wachsenden globalen Verantwortung zunehmend aufgeweicht. Eine zweite Position nehmen die Vertreter des „gerechten Kriegs“[11] ein. Krieg findet nach deren Ansicht zwischen zwei Seiten statt. Vertreter des „gerechten Krieges“ legen den Schwerpunkt mehr auf Wertvorstellungen und Moral sowie militärische Notwendigkeit als auf Legitimität. Wenn der Grund gerechtfertigt ist, bevorzugen sie unilaterale Interventionen, ohne die Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat (Kaldor 2007: 57). Das Ziel sei es, den „Feind“ mit einem Minimum an eigenen Verlusten zu besiegen. Daher favorisieren die Vertreter vor allem Luftangriffe. Neben vielen Intellektuellen wird diese Position von direkten Repräsentanten der betroffenen Opfer regionaler Konflikte unterstützt (Kaldor 2007: 57f.). Kritisch ist, dass die Position der Intervenienten stark der einer weiteren Konfliktpartei ähnelt. Zudem besteht die Gefahr, ausschließlich die Belange bestimmter Gruppen zu unterstützen, wodurch ein Ungleichgewicht und neues Konfliktpotenzial entstehen kann.
Eine dritte Position ist die des „humanitären Friedens“. Die Vertreter dieser Richtung sind zumeist humanitäre Organisationen und Friedensgruppen (Kaldor 2007: 58). Sie teilen die Skepsis der ersten Position. Pazifistische Gruppierungen sehen einen fundamentalen Gegensatz darin, Menschenrechte mit militärischen Mitteln verteidigen zu wollen (Kaldor 2007: 58). Sie unterscheiden sich von der ersten Position aber in der Befürwortung von Interventionen durch die Zivilgesellschaft. Menschenrechtsprotektion und Konfliktprävention beispielsweise seien eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft und nicht der Regierungen (Kaldor 2007: 59). Die letzte Position ist die der Vertreter der Durchsetzung der Menschenrechte (Kaldor 2007: 59f.). Die Frage nach Menschenrechten sei nach dieser Meinung, was die „humanitäre Intervention“ vom Krieg unterscheiden würde (Kaldor 2007: 60). Die Legalität ist grundlegend, da das Konzept der „humanitären Intervention“ auf der Idee eines gestärkten internationalen Rechts basiert (Kaldor 2007: 60). Dies vor allem, seit im Sicherheitsrat die Großmächte durch ein Veto eine „humanitäre Intervention“ aus Eigeninteresse verhindern können (Kaldor 2007: 60). Mit den Vertretern des „humanitären Friedens“ wird die Meinung betreffend der Wichtigkeit der Zivilgesellschaft geteilt. Aber es wird darauf verwiesen, dass eine Zivilgesellschaft nur im Rahmen einer Autorität des Gesetzes existieren und funktionieren könne. In kriegerischen Situationen sei die Zivilgesellschaft das erste Opfer und je länger dieser Zustand andauere, um so mehr würde diese zerstört werden (Kaldor 2007: 61). Letztlich bildet diese vierte Richtung einen Kompromiss zwischen der Position der Nichteinmischung (Souveränisten und Vertreter des „humanitären Friedens“) sowie der Überwältigung (Vertreter des „gerechten Krieges“). Normativ ist die Position eng an das Konzept der „Human Security“ geknüpft (Kaldor 2007: 61).
Die gegenwärtig intensiven Bemühungen, einen Konsens über klare Kriterien für eine „humanitäre Intervention“ zu finden, resultieren vor allem aus den enttäuschenden Ergebnissen „humanitärer Interventionen“ seit den 1990er Jahren (Kaldor 2007: 22). Die stärkste Kritik richtet sich dabei maßgeblich auf die „humanitären Interventionen“ der UN. Die großen Hoffnungen in dieses Modell seien fehlgeschlagen.[12] Mit dem Begriff der „humanitären Intervention“ sei eine Unterstützung der Bevölkerung in Kriegsgebieten, die Unterbindung von Flüchtlingsströmen, die Entwicklung von „safe area policies“ und militärische Protektion assoziiert worden. Aus zwei Gründen sei dieses Konzept gescheitert: Erstens habe es sich gezeigt, dass das Militär nicht fähig sei, Zivilisten zu beschützen und zweitens, dass „humanitäre Interventionen“ kein Ersatz für politische Maßnahmen sein könnten (Duffield 1997:10). Duffield nennt den Ausdruck „humanitäre Intervention“ ein Paradoxon. Es handele sich dabei nicht nur um eine Intervention, sondern um einen komplexen Loslösungsprozess von alten Hilfs- und Entwicklungsvorstellungen, die auf der Idee des Ressourcentransfers und des Ausgleichs von Ungleichheiten basiere. Zugleich sei es ein Prozess hin zu einer Beschäftigung mit einem neuen Hilfsmodell, welches darauf basiere, das Verhalten von Personen zu ändern und ihnen zu helfen, mit Ungleichheiten umzugehen. „Humanitäre Interventionen“ habe demnach nicht die Lösung von Problemen, sondern die Eindämmung von Unsicherheiten zum Ziel (Duffield 1997: 11).
Gegenwärtig werden aus politischer und auch aus völkerrechtlicher Sicht verschiedene Kriterien für die Durchführung einer „humanitären Intervention“ neu diskutiert. Diese lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen:
1. Menschenrechtsverletzung: Rechtfertigung und Zweck einer „humanitären Intervention“ durch eine internationale Organisation oder eine Staatenkoalition können nur schwerwiegende und systematische Verletzungen elementarer Menschenrechte sein (Aghayev 2007: 9). Andere Interventionsgründe sind bei der „humanitären Intervention“ ausgeschlossen.
2. Ultima Ratio: Die Intervention bildet die letzte Maßnahme, nachdem alle weiteren Versuche der friedlichen Beendigung durch nichtmilitärische Mittel und Repressalien erfolglos ausgeschöpft wurden (Aghayev 2007: 50; Zygojannis 2003: 79). Zygojannis merkt dazu an, dass ein zu langes Zögern aber bei früh als aussichtslos feststehenden Verhandlungsversuchen einen effektiven Menschenrechtsschutz sogar verhindern könne (Zygojannis 2003: 80).
3. Legitimität: Ein militärisches Eingreifen, das den Anspruch hat, Menschenrechte zu schützen, muss gegen das Risiko des Machtmissbrauchs abgesichert sein. Eine Bedingung ist deswegen, dass eine „humanitäre Intervention“ nicht von einzelnen Staaten durchzuführen sei (Aghayev 2007: 51). Die internationale Organisation, die am ehesten diesem Legitimitätsanspruch gerecht werden kann, sind die UN (Thakur 2008: 119). In der Forschung wird aufgrund der Kosovo-Erfahrung auch der Fall einer nicht durch die UN mandatierten Intervention diskutiert. Weitgehender Konsens besteht dabei darin, dass aus völkerrechtlicher Perspektive eine solche Intervention ohne Mandat gegen das bestehende Völkerrecht verstoße.[13] Auch aus politischer Sicht wird keine Alternative zu einem Mandat der UN gesehen, da nur diese eine ausreichende Legitimität besitzen (Aghayev 2007: 51; Naumann 2001: 854; Thakur 2008: 119). Dennoch wird dieser spezielle Fall völkerrechtlich als lex ferenda und politisch als Möglichkeit eines letzten Auswegs internationaler Politik diskutiert (Aghayev 2007: 49; Naumann 2001: 854). In dieser Situation dürfe eine „humanitäre Intervention“ nur durch eine Staatenkoalition durchgeführt werden, da nur dieses Vorgehen annäherungsweise eine zulässige Legitimität besäße (Aghayev 2007: 51; Naumann 2001: 854f.). Des Weiteren sei Bedingung, dass trotz fehlendem Mandat eine Feststellung einer Friedensbedrohung durch den Sicherheitsrat der UN vorliege (Aghayev 2007: 50; Zygojannis 2003: 104). Die Wahrscheinlichkeit einer Intervention aus einem anderen Grund als der Beseitigung von Menschenrechtsverletzungen würde durch dieses Vorgehen beschränkt werden (Zygojannis 2003: 76).
4. Proportionalität: Das Kriterium der Verhältnismäßigkeit besagt, dass der Schaden der Intervention den Nutzen nicht überwiegen darf (Aghayev 2007: 50; Thakur 2008: 118). Anders formuliert dürfen auch die zu erwartenden Konsequenzen der Aktion nicht schlimmer sein als die einer Untätigkeit. Eine militärische Intervention gegen Großmächte sei deswegen auszuschließen (Thakur 2008: 118).
5. Nachsorgeverpflichtung: Eine Verpflichtung zur Nachsorge der Intervenienten nach einer „humanitären Intervention“ ergibt sich weder aus den geschriebenen Rechtsnormen noch aus dem Gewohnheitsrecht (Zygojannis 2003: 138). Dennoch sprechen verschiedene Faktoren, vor allem aus politischer Sicht, für eine Nachsorge. Von einigen Vertretern wird sogar eine „obligatorische Nachsorgeverpflichtung“ eingefordert (Zygojannis 2003: 130f.). Im Wesentlichen besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass die Ursachen für Menschenrechtsverletzungen nicht durch militärische Mittel zu beseitigen sind (Zygojannis 2003: 127,129; Naumann 2001: 864). Eine „Krisennachsorge“ stelle daher auch eine notwendige Einschränkung des militärischen Handelns dar (Naumann 2001: 862). Des Weiteren wird das Argument angeführt, dass ein unmittelbarer Abzug der Streitkräfte ein Machtvakuum hinterlassen würde. Mit größter Wahrscheinlichkeit könnte die erreichte Stabilität nicht aufrechterhalten werden (Zygojannis 2003: 127). Ein weiterer Punkt für eine Verantwortung zur Nachsorge sei, dass durch das militärische Eingreifen die Intervenienten zum Bestandteil des Konfliktes, wenn nicht sogar zu einer weiteren Konfliktpartei würden (Zygojannis 2003: 128). Einerseits wird die Nachsorge als Fortsetzung der militärischen Intervention mit vor allem zivilen Engagement verstanden. Von anderer Seite wird angeführt, dass die Nachsorge unter anderer Verantwortung stehen könne als unter der verantwortlichen Instanz der Intervention selbst. Wichtig sei aber vor allem, dass die Nachsorge in der unmittelbaren Phase nach der Intervention in einer eindeutigen Verantwortung liege. (Naumann 2001: 864; Zygojannis 2003: 134). Art, Umfang und Charakteristik einer Nachsorge werden letztlich durch die konkreten Umstände der jeweiligen Situation bestimmt (Zygojannis 2003: 128,134). Schlussendlich lassen sich zwei zentrale Bedingungen für eine verantwortungsvolle Nachsorge festhalten, damit eine Grauzone zwischen militärischer Intervention und Nachsorge verhindert wird. Zunächst müssten die politischen Ziele der Intervention und auch deren Rechtsgrundlage sowie die Durchführung so eindeutig wie möglich formuliert sein (Naumann 2001: 863). Dann müsse auch ein klares Konzept für die Nachsorge erstellt werden. Multinationale Organisationen wie die Vereinten Nationen sind insbesondere geeignet die Nachsorge einer „humanitären Intervention“ durchzuführen“ (Zygojannis 2003: 133). Nur so durchgeführte Nachsorge besitzt genügend Legitimität.
Die fünf Kriterien schließen auch an die grundlegende Kritik aus den Misserfolgen der bisherigen „humanitären Interventionen“ an. Eine wesentliche Neuerung stellt dabei die Forderung nach einer obligatorischen Nachsorgeverpflichtung dar. Dieses Kriterium erwächst aus der negativen Erkenntnis, dass für die Grauzone zwischen Intervention und intensivem Peacekeeping Verantwortung getragen werden müsse. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Zeit nach einer Intervention besondere und kontextuelle Schwierigkeiten birgt, denen bis dato nicht zureichend begegnet werden konnte. Der Verweis auf eine Nachsorgeverpflichtung gibt aber noch keine Anhaltspunkte, auf welche Weise langfristige Stabilität erreicht werden kann.
Die „humanitäre Intervention“ bleibt eines der meist kontrovers diskutierten Themen der Außenpolitik der letzten Dekade. Die „humanitäre Intervention“ sei aus der Sicht vieler Kritiker zu einer Phrase geworden, die das Prinzip der Souveränität durch die Intervention übertrumpfe. Das Argument, in einem „humanitären“ Sinn zu handeln, sei zu einem „Totschlagargument“ geworden, dass abweichende Meinungen als illegitim und antihumanitär abweist (Thakur 2008: 113f.). Vor allem deswegen wurde nach neuen und genaueren Konzepten gesucht.
2.2.3 „Responsibility to Protect“
2000 forderte der damalige UN-Generalsekretär Kofi Annan von der internationalen Gemeinschaft in seinem Bericht an die Generalversammlung einen Vorstoß in Richtung eines Konsenses um die zentralen Fragen, wann auf eine Intervention zurückgegriffen werden sollte und wie und unter welcher Autorität. Die International Comission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) wurde aus einer Initiative der kanadischen Regierung im September 2000 gegründet, um dieser Aufforderung nachzukommen (ICISS 2001: 29).
Der 2001 vorgelegte Bericht trägt den Titel The Responsibility to Protect (R2P). Die Verantwortung zum Schutz enthält die Idee, dass souveräne Staaten eine Verantwortung zum Schutz der eigenen Bevölkerung vor vermeidbaren Katastrophen haben. Wenn der Bevölkerung auf Grund von Bürgerkriegen, oder Versagen des Staates schweres Leid geschieht und die souveränen Staaten diese Verantwortung nicht wahrnehmen können oder wollen, dann müsse die Verantwortung zum Schutz der Bevölkerung an die internationale Gemeinschaft übergehen. Das Gebot der Nicht-Intervention[14] tritt hiernach gegenüber der internationalen Verantwortung zum Schutz zurück (ICISS 2001: VIII; Thakur 2008: 112).
Der R2P-Bericht verfolgt drei Hauptziele: Die sprachliche Begrifflichkeit soll von der „humanitären Intervention“ weg zur „Verantwortung zum Schutz“ geändert werden.[15] Die Verantwortung sei auf nationaler Ebene bei staatlichen Behörden und auf internationaler Ebene beim Sicherheitsrat anzusiedeln.[16] Das dritte Ziel sei, dass dann Interventionen auch korrekt durchgeführt würden. Die Voraussetzungen für eine Intervention müssen nach Ansicht des Berichtes eng gefasst werden und die Messlatte müsse hoch angelegt sein (Thakur 2008: 113).[17] Mit diesen Zielen bewegt sich das Konzept der R2P zu einem Element internationaler Solidarität hin (Thakur 2008: 114).
Die drei Elemente des Berichts sind die „Responsibility to Prevent“, die „Responsibility to React“ und die „Responsibility to Rebuild“ (ICISS 2001: XI). Die R2P bestimmt mit dieser Trias eine Grundlage für Operationen zum humanitären Schutz, die sich wesentlich von traditionellen Konzepten der Kriegsführung und auch von den bisherigen UN-Peacekeeping Operationen unterscheidet (ICISS 2001: 66). Der Bericht basiert auf dem Konzept der „Human Security“. Militärische Kräfte in einem Verständnis von „Human Security“ anzuwenden, steht in einem wesentlichen Unterschied zu klassischen Kriegsführungen und auch dem bisherigen Peace-Enforcement und Peacekeeping. All diese Ansätze definieren ihre Tätigkeit über den Krieg zwischen feindlichen Gruppen. Die Arbeit des Peacekeepings ist es, kriegsführende Parteien zu trennen, Waffenruhe zu überwachen und/oder Waffen einzusammeln (Kaldor 2007: 174). Dabei konnten Peacekeeping-Maßnahmen in der Vergangenheit die Verletzung von Menschenrechten nicht verhindern. Der Schutz von Zivilisten stand in der Vergangenheit an zweiter Stelle nach der Bekämpfung von Feinden. Die große Lücke in allen vergangenen Operationen war die öffentliche Sicherheit (Kaldor 2007: 174). Die Übernahme des Konzeptes der R2P durch die UN-Generalversammlung[18] war ein wichtiger Schritt in die Richtung, diese Lücke zu schließen (Kaldor 2007: 173). Auch wenn das Konzept der „Human Security“ nicht unkontrovers ist, trägt es der Erkenntnis Rechnung, dass internationale Ereignisse nicht isoliert betrachtet werden können und dass deren Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung dabei im Vordergrund stehen müssen. Auch gibt es eine wachsende weltweite Anerkennung, dass menschliche Sicherheit inklusive der Menschenrechte und der Menschenwürde eines der fundamentalen Hauptanliegen moderner internationaler Institutionen sein müsse. Nicht nur deswegen ist das Konzept der „Human Security“ auch für das Internationale Recht und die Internationalen Beziehungen zunehmend zu einem wichtigen Element geworden, da es einen geeigneten konzeptuellen Rahmen für internationales Handeln beinhaltet (ICISS 2001: 6).
Im Folgenden wird sich auf die Ausführung der beiden Elemente der „Responsibility to React“ und der „Responsibility to Rebuild“ beschränkt, da ausschließlich diese im Rahmen dieser Arbeit für die Beurteilung der Intervention in das Kosovo und deren Folgen relevant sind.
[...]
[1] In der Arbeit wird die serbokroatische Schreibweise „Kosovo“ verwendet, da diese im deutschsprachigen Raum am gebräuchlichsten ist. Es soll damit keine wertende Aussage getroffen werden.
[2] Dieser Trend wurde maßgeblich durch die beginnenden Statusverhandlungen des Kosovo 2006 in Wien beeinflusst und fand seine Bekräftigung in der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Februar 2008 (Kellermann 2006: 11).
[3] Das traditionelle Sicherheitsverständnis bezieht sich auf „klassischen“ Bedrohungen nationaler Sicherheit. Eine Bedrohung bestehe dabei aus dem Angriff auf ein Staatsgebiet oder aus der Androhung eines Angriffs (Müller 1997: 1).
[4] Hier sei auf eine aktuelle Beschäftigung bei Ulrich Beck (2007) mit dem Bereich der Risiken und daraus erfolgende politische Handlungsspielräume aus der Sicht einer kosmopolitischen Realpolitik verwiesen („Weltrisikogesellschaft“).
[5] Im folgenden Verlauf wird der in der Forschungsliteratur dominierende englische Begriff der „Human Security“ in Bezug auf dieses Konzept verwendet.
[6] Müller spricht sogar von dem Verdacht, dass mit der Rede von „nichtmilitärischen Bedrohungen“ und einem entgrenzten Sicherheitsbegriff mit den Ängsten der Menschen Politik gemacht werde (Müller 1997: 10).
[7] Später erschienen zwei weitere zentrale Zugänge zum Begriff mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Im Human Security Report der kanadischen Regierung von 2005 wird die individuelle Sicherheit betont. Der zweite Zugang des Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit dem Titel „In Larger Freedom“, betont den Zusammenhang der verschiedenen Arten von Sicherheit und die Wichtigkeit von Entwicklung, insbesondere als Sicherheitsstrategie (Kaldor 2007:182f.).
[8] Naumann beispielsweise spricht auch von einer „selbsttragenden Stabilität“, die nach einer Wiederherstellung eines Gewaltmonopols erreicht werden müsse. In dieser Phase der Krisennachsorge sei die Stabilität noch durch die externen Akteure getragen, aber das Handeln müsse auf die Klärung und Bewältigung der Ursachen für den Konflikt ausgelegt sein (Naumann 2001: 864).
[9] In der Forschung entwickelte sich zudem der sogenannte „erweiterte“ Interventionsbegriff. Er umfasst jede Zwangsmaßnahme, wobei Zwang in diesem Sinne nicht allein die Anwendung militärischer Gewalt bedeutet, sondern auch beispielsweise wirtschaftliche Sanktionen umfassen kann (Aghayev 2007: 3).
[10] Für eine genauere Darstellung sei auf Mary Kaldor (2007), S.53-62 verwiesen.
[11] Die Vorstellung vom „gerechten Krieg“ stammt aus der Zeit vor der Erfindung von Waffen, die eine breite Vernichtungswirkung erzielen (Stock 1974: 104). Eine ausführliche Besprechung über die gegenwärtigen Argumente über „gerechten“ und „ungerechten“ Krieg findet sich bei Kaldor (2007: 154-181). Sie kommt schlussendlich zu der Aussage, dass man, wenn es um die legitime Anwendung von militärischen Kräften gehe, nicht dem Denken von „gerecht“ und „ungerecht“ verfallen dürfe und fordert ein Umdenken in Richtung des Konzeptes der „menschlichen Sicherheit“ (Kaldor 2007: 180).
[12] Duffield spricht vor allem im Kontext der Erfahrungen aus dem Bosnien-Krieg von einem „demise of UN led military humanitarianism“ (Duffield 1997: 10).
[13] Zygojannis nennt die Situation ein Dilemma zwischen dem internationalen Recht und der Politik, wenn de facto eine Menschenrechtsverletzung vorliegt, der Sicherheitsrat in seiner Entscheidung aber durch ein Veto blockiert werde. Das Fehlen eines legitimen Mandates und die Tatsache einer Menschenrechtsverletzung ergäben eine Situation, die eine „humanitäre Intervention im Rahmen der völkerrechtlichen Nothilfe“ zulässig machen könnte. Eine humanitäre Intervention sieht er dann nicht als völkerrechtswidrig an (Zygojannis 2003: 60f.;62).
[14] Thakur spricht bezüglich des Gebots der Nicht-Intervention von einem dreifachen politischen Dilemma der UN: Mitverantwortung, Paralyse oder Illegalität. Mitverantwortung bei humanitären Tragödien bei konsequenter Achtung der Souveränität, Paralyse bei einer Veto-Blockade oder einer Passivität des Sicherheitsrates und eine Illegalität, wenn eine Intervention ohne Autorisierung der UN stattfindet. Letzteres untergrabe zusätzlich die zentrale Rolle der UN (Thakur 2008: 112).
[15] Auch Kaldor, sie spricht sich für eine „neue Sprache“ aus, mit der man Sicherheit besprechen sollte, da das alte Vokabular davon abhalten würde, neue Lösungswege zu finden (Kaldor 2007: 10).
[16] Vergleiche Werthes Forderung nach einem Prinzip der Subsidiarität im Zuge des „Mangel-Verwundbarkeits-Ansatzes“ innerhalb der Debatte um das Konzept der „Human Security“ (Werthes 2008: 199).
[17] Hier werden wiederum die Parallelen zu der Debatte um „Human Security“ deutlich und zeigen den normativen Ursprung des Berichtes auf.
[18] Die UN-Generalversammlung schloss sich im September 2005 diesem Bericht an, wenn auch ohne Aufnahme seiner Legitimitätskriterien und seiner Sorgfaltsprinzipien (Thakur 2008: 121).
- Quote paper
- Stella Krüger (Author), 2009, Die Intervention der NATO und der UN in das Kosovo und die Folgen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207517
Publish now - it's free





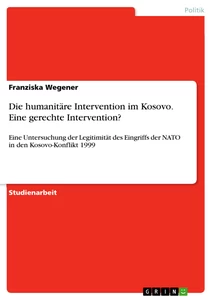
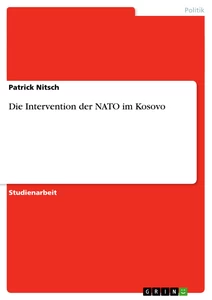













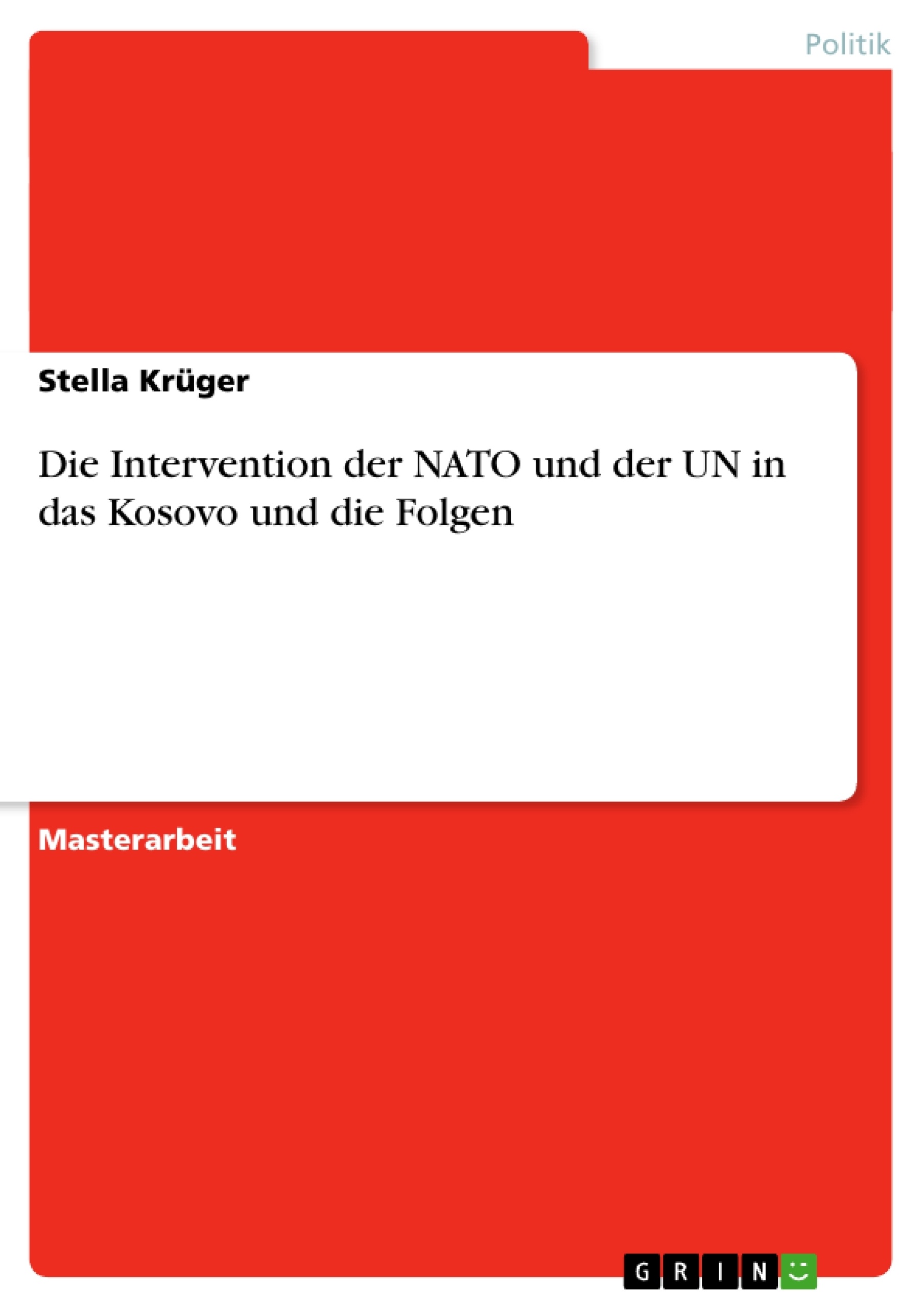

Comments