Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
1.2 Ziele und Forschungsfragen der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Theorie der Kontrasteffekte
2.2 Sozial-kognitive Lerntheorie
2.3 Theorie sozialer Vergleichsprozesse
2.3.1 Begriffsbestimmung
2.3.2 Medienwirkungen auf Grundlage sozialer Vergleichsprozesse
2.3.3 Motive sozialer Vergleiche
2.3.4 Motive sozialer Vergleiche mit Medienakteuren
2.3.5 Prädiktoren sozialer Vergleichsmotive
2.3.6 Probleme bei der Untersuchung sozialer Vergleichsprozesse
2.3.7 Zwischenresümee
3 Begriffliche Grundlagen
3.1 Weibliches Körperbild
3.2 Schlankheit vs. Attraktivität
3.3 Schlankheitskenngrößen
3.4 Körperbildstörungen
3.5 Formen von Essstörungen
4 Darstellung schlanker weiblicher Akteure in den Medien
4.1 Darstellung schlanker weiblicher Akteure in den Printmedien
4.2 Darstellung schlanker weiblicher Akteure im Fernsehen
4.3 Zwischenresümee
5 Mediale und interpersonale Wirkung schlanker Personen
5.1 Wirkung schlanker Medienakteure auf das weibliche Publikum
5.1.1 Korrelationsstudien zur Wirkung schlanker Medienakteuren
5.1.2 Experimentelle Studien zur Wirkung schlanker Medienakteure
5.1.3 Positive Wirkungen auf das Körperbild
5.1.4 Differenzielle Anfälligkeit für Medienwirkungen
5.2 Wirkung schlanker Peers auf weibliche Personen
5.3 Zwischenresümee
6 Experimentelle Untersuchung
6.1 Forschungsleitende Annahmen
6.2 Versuchsplan
6.2.1 Methode
6.2.2 Versuchsteilnehmer
6.2.3 Stimulusmaterial
6.2.4 Messinstrument
6.2.4.1 Abhängige Variablen
6.2.4.1.1 Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper
6.2.4.1.2 Drang nach Schlankheit
6.2.4.1.3 Selbstwertgefühl
6.2.4.1.4 Objektives und subjektives Körperbild
6.2.4.2 Prädisponierende Variablen
6.2.4.2.1 Stimmung
6.2.4.2.2 Motiv des sozialen Vergleichs
6.2.4.2.3 Neigung zu sozialen Vergleichen
6.2.4.2.4 Selbstaufmerksamkeit
6.2.5 Ablauf der Untersuchung
6.3 Untersuchungsergebnisse
6.3.1 Unterschiede zwischen der Kontrollgruppe und den Experimentalgruppen
6.3.2 Experimentelle Ergebnisse zur Wirkung sozialer Vergleiche
6.3.2.1 Die Bedeutung der Vergleichsrichtung
6.3.2.2 Die Bedeutung interpersonaler vs. medialer Vergleichspersonen
6.3.2.3 Die Bedeutung der Vergleichsmotivation
6.3.2.4 Die Bedeutung der Neigung zu sozialen Vergleichen
6.3.2.5 Die Bedeutung von Selbstaufmerksamkeit
6.3.2.6 Die Bedeutung des Körperbildes gemessen am BMI
6.3.2.7 Die Bedeutung der Stimmung
6.3.2.8 Die Bedeutung von Selbstdiskrepanzen
6.3.2.9 Die Bedeutung des Medienkonsums
6.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
6.4 Diskussion der Ergebnisse
7 Resümee
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Plakat der Kampagne des Fotografen Oliviero Toscani in Rom
Abbildung 2: Überblick über die zwei Phasen des Modell-Lernens und deren Prozesse
Abbildung 3: Androider Typ (Apfelttyp) und gynoider Typ (Birnentyp)
Abbildung 4: Auszug aus der Dove Werbekampagne Initiative für wahre Schönheit
Abbildung 5: Körpermaße der betrachteten Models, sortiert nach dem Erhebungsjahr
Abbildung 6: Printwerbung des Unternehmens Sloggi
Abbildung 7: Standbild aus einem TV-Spot der Unterwäschefirma Mey
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Set eines schlanken Peers
Abbildung 9: Ausschnitt aus dem Set eines übergewichtigen Peers
Abbildung 10: Ausschnitt aus dem Set eines schlanken Medienakteurs
Abbildung 11: Ausschnitt aus dem Set der Kontrollgruppe
Abbildung 12: Schematische Zeichnungen weiblicher Körperformen
Abbildung 13: Ausschnitt aus einer original H&M-Werbeanzeige
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Klassifizierung des BMI nach globalem Standard
Tabelle 2: Wesentliche Unterschiede zwischen Stimmung und Emotion
Tabelle 3: Bestimmung der internen Konsistenz einiger Skalen der M-DAS
Tabelle 4: Unterschiede zwischen den Gruppen bzgl. prädisponierender und demographischer Variablen
Tabelle 5: Einfluss der Vergleichsrichtung auf die Wirkung sozialer Vergleiche (EG 1, EG 2)
Tabelle 6: Einfluss der Vergleichsrichtung auf die Wirkung sozialer Vergleiche (EG 1, EG 3)
Tabelle 7: Einfluss der Vergleichsrichtung auf die Wirkung sozialer Vergleiche (EG 2, KG)
Tabelle 8: Einfluss sozialer Vergleiche mit schlanken Peers und schlanken Medienakteuren auf das Körperbild und das Selbstwertgefühl
Tabelle 9: Einfluss des Vergleichsmotivs auf das Körperbild und das Selbstwertgefühl bei sozialen Auf- und Abwärtsvergleichen
Tabelle 10: Einfluss der Vergleichsneigung auf das Körperbild und das Selbstwertgefühl bei sozialen Auf- und Abwärtsvergleichen
Tabelle 11: Einfluss der öffentlichen bzw. privaten Selbstaufmerksamkeit auf das Körperbild und das Selbstwertgefühl bei sozialen Auf- und Abwärtsvergleichen
Tabelle 12: Einfluss des objektiven Körperbildes (gemessen am BMI) auf das Körperbild und das Selbstwertgefühl bei sozialen Auf- und Abwärtsvergleichen
Tabelle 13: Zusammenhang zwischen positiver Stimmung, Körperbild und Selbstwertgefühl
Tabelle 14: Zusammenhang zwischen negativer Stimmung, Körperbild und Selbstwertgefühl
Tabelle 15: Diskrepanz zwischen eigenem aktuellem und eigenem idealem bzw. gesellschaftlich idealem Körperbild
Tabelle 16: Selbstdiskrepanz bezüglich des aktuellen und gesellschaftlich idealen Körperbildes
Tabelle 17: Zusammenhang zwischen Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Drang nach Schlankheit, Selbstwertgefühl und Selbstdiskrepanzen
Tabelle 18: Zusammenhang zwischen dem absoluten Medienkonsum und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, Drang nach Schlankheit und Selbstwertgefühl
Tabelle 19: Bedeutung des Medienkonsums für die Ausprägung der Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, des Drangs nach Schlankheit und das Selbstwertgefühl
Tabelle 20: Einfluss der Vergleichsrichtung auf die Wirkung sozialer Vergleiche (EG 1, KG); Ergänzung zu Abschnitt 6.3.2.1
Tabelle 21: Einfluss der Vergleichsrichtung auf die Wirkung sozialer Vergleiche (EG 3, KG); Ergänzung zu Abschnitt 6.3.2.1
Tabelle 22: Zusammenhang zwischen negativer Stimmung, Körperbild und Selbstwertgefühl für EG 1, EG 2 und EG 3 (Ergänzung zu Abschnitt 6.3.2.7)
Tabelle 23: Zusammenhang zwischen negativer Stimmung, Körperbild und Selbstwertgefühl für KG (Ergänzung zu Abschnitt 6.3.2.7)
Tabelle 24: Zusammenhang zwischen positiver Stimmung, Körperbild und Selbstwertgefühl für EG 1, EG 2, EG 3 und KG (Ergänzung zu Abschnitt 6.3.2.7)
1 Einleitung
1.1 Relevanz des Themas
Das Schönheitsideal der westlichen Industrieländer, welches seit Mitte des 20. Jahrhunderts dominiert, ist vor allem durch Schlankheit gekennzeichnet. Als Folge der Globalisierung überträgt sich diese Vorstellung zunehmend auch auf den Rest der Welt. Vor allem in den Medien und in der Werbung werden uns täglich Bilder von makellosen Schauspielerinnen und extrem dünnen Models1 präsentiert. Zwar muss an der Echtheit dieser Darstellungen aufgrund der Existenz von Bildbearbeitungsprogrammen stark gezweifelt werden, dem medial vermit- telten Perfektionismus kann sich die Bevölkerung dennoch kaum entziehen (vgl. Bündnis 90/Die Grünen, 2007a). Realitätsverfremdungen in den Medien sind besonders meinungsbil- dend. Unentwegt wird im Fernsehen und in Printmedien suggeriert, dass nur besonders schlanke und junge Frauen dem allgemeinen Schönheitsideal entsprechen. Personen, die die- sem Bild nicht gerecht werden, erhalten weniger Beachtung durch ihr Umfeld. Da es jedoch in der Natur des Menschen liegt, Aufmerksamkeit und Beachtung zu erhalten, wird der Mei- nung anderer ein besonders hoher Stellenwert zuteil. Je schwächer das Selbstwertgefühl, des- to stärker lassen wir uns von anderen und deren - großteils durch die Medien bestimmten - Meinung beeinflussen. Darstellungen schlanker Models werden oftmals als Ursache von Ess- störungen gesehen, weil sie Idealvorstellungen dessen prägen, was in der Gesellschaft als körperlich anziehend betrachtet wird. Vor allem bei jungen Frauen bleibt die Diktatur des Schlankheitsideals nicht folgenlos. Schlankheitsikonen aus den Medien können aufgrund der Abweichungen zwischen ihren scheinbar perfekten Körpermaßen und denen einer Normal- bürgerin zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper führen. Daraus resultierende Diäten können Essstörungen auslösen, wobei die Übergänge von harmlosen Abnehmprogrammen zu Essstörungen lange unbemerkt bleiben (vgl. Fichter, 2007, S. 18-19). Ein wichtiges Kennzei- chen von Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht ist die zwanghafte Abhängigkeit des Selbstwertgefühls von Gewicht und Körperumfang. Laut Kinder- und Jugendgesundheitssur- vey des Robert-Koch-Instituts (2003-2006), weisen rund 22 Prozent der 11-17-Jährigen An- zeichen einer Essstörung auf. Jungen sind hiervon nur halb so oft betroffen wie Mädchen (vgl. KiGGs, 2008). Auch wenn gesellschaftliche Schlankheitsideale nicht der alleinige Auslöser für Essstörungen sind, sondern mit komplexen biologischen, psychosozialen und soziokultu- rellen Faktoren in Wechselwirkungen stehen, werden schlanke Vorbilder aus den Medien von Experten als bedeutende Mitverursacher für diese gesehen. Junge Frauen haben zudem häufig eine vollkommen falsche Vorstellung von ihrem Körper. Untersuchungen belegen, dass sie sich in der Mehrzahl wesentlich korpulenter einschätzen, als sie in Wirklichkeit sind. Sie se- hen sich im Spiegel meist völlig anders, als ihr soziales Umfeld sie sieht (vgl. Bündnis 90/Die Grünen, 2007a).
Die in den Massenmedien geführte Debatte darüber, ob die mediale Darstellung schlanker Models negative Auswirkungen nach sich zieht und jungen Frauen als Vorbild dient, scheint kein Ende zu nehmen. Nirgendwo anders hat das Körpergewicht einen so bedeutsamen Stel- lenwert erlangt wie in der Modebranche (seit einigen Jahren bestärkt durch weltweit im Fern- sehen ausgestrahlte Model-Casting-Shows). Was von vielen Frauen als Traumberuf wahrge- nommen wird, ist in Wahrheit ein schonungsloser Wettkampf, bei dem Untergewicht voraus- gesetzt wird. Die Diskussion um mögliche gesellschaftliche und politische Abhilfe findet ihren aktuellen Höhepunkt im Rahmen der Sendung Germany’s Next Topmodel auf Pro7. Kri- tik wird vor allem deswegen laut, weil selbst junge Frauen mit Untergewicht von der - meist männlichen - Jury in der Show als zu dick bewertet werden (vgl. Koch & Hofer, 2008, S. 197). Erst als vor etwa zwei Jahren erstmals durch Mangelernährung verursachte Todesfälle internationaler Topmodels wie Ana Carolina Reston bekannt wurden, haben viele europäische Staaten das Problem aufgegriffen und einschlägige Kampagnen initiiert (vgl. dpa, 2006):
Bei den Modewochen in Madrid wurde 2007 das Gewicht der Models erstmals überprüft - fünf Models wurden aufgrund ihres Untergewichtes ausgeschlossen und durften nicht auf den Laufsteg. Ein Abkommen mit den größten Bekleidungsmarken Spaniens schafft zudem Spezialabteilungen für Übergrößen in Kaufhäusern ab (gegen die „Ausgrenzung“ von übergewichtigen Menschen), schreibt einheitliche Konfektionsgrößen vor und verbietet zu dünne Schaufensterpuppen (vgl. ffr, 2006).
Auch in Italien wurden Maßnahmen ergriffen: Der italienische Starfotograf Oliviero Toscani, der jahrelang für das Modelabel Benetton tätig war, machte die seit Langem als magersüchtig bekannte Schauspielerin Isabelle Caro anlässlich der Mailänder Modewochen zum Mittelpunkt seiner neuen Kampagne für die italienische Modemarke Nolita. Die Kampagne zielt durch ihre schockierenden Bilder darauf ab, vor allem Jugendliche wachzurütteln und auf die Gefahren von Magersucht aufmerksam zu machen (siehe Abbildung 1). Zudem wurde in einer Kooperation von Politik und Modeverbänden ein Anti-Magersucht-Kodex entwickelt, welcher die Gesundheit der Models fördern soll (vgl. taz.de, 2007).
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Plakat der Kampagne des Fotografen Oliviero Toscani in Rom
Quelle: dpa, 2006
In Großbritannien gehen das British Fashion Council, das Ministerium für Kultur, Medien und Sport, sowie zahlreiche Experten aktiv gegen den Schlankheitswahn vor. Im Jahr 2007 wurde die Kommission Model Health Inquiry vom British Fashion Council gegründet, um die Gesundheit von Fotomodels auf dem Laufsteg der zweimal jährlich stattfindenden Londoner Fashion Week zu schützen. In der Kommission setzen sich Modelagenturen, Modedesigner, Models, Vertreter der Medien und Modeindustrie sowie Gesundheitsexperten für gesundheits- fördernde Maßnahmen im Vorgehen gegen Essstörungen ein (vgl. Model Health Inquiry, 2008).
Auch in Deutschland hat die Politik erstmals Maßnahmen ergriffen. Die im Dezember 2007 gegründete Initiative Leben hat Gewicht - gemeinsam gegen den Schlankheitswahn wurde von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen und Bundesbildungsministerin Dr. Annette Schavan in Zusammenarbeit mit der be- kannten Feministin Alice Schwarzer gegründet. Ziel der Initiative ist es, jungen Menschen eine gesündere Einstellung zu ihrem Körper zu vermitteln und das Selbstbewusstsein zu stär- ken. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus Verbänden, Medizin und Hilfseinrichtun- gen möchten die Verantwortlichen Jugendliche und Frauen auf die bestehende Problematik des Schlankheitswahnes aufmerksam machen und einen Bewusstseinswandel in Gang setzen. Neben verschiedenen Präventionsmaßnahmen setzt Leben hat Gewicht vor allem auf freiwil- lige Selbstverpflichtungen und erarbeitete dafür gemeinsam mit der Mode- und Modelbranche eine nationale Charta (vgl. bmg, 2008a).
Die Unstimmigkeiten über schlanke Akteure in den Medien scheinen jedoch nicht nur ein Mittel zur Ausgestaltung medialer Formate zu sein, sondern spiegeln ein äußerst komplexes Zusammenspiel von Werbung und Gesellschaft wider: Werbung kann zum einen als gesell- schaftlicher Indikator gesehen werden; sie dient als verzerrtes Spiegelbild der Gesellschaft und ihrer idealen Selbstbilder. Werbung stellt dar, wie die Gesellschaft sich selbst sehen will. Zum anderen aber dient Werbung als Prägefaktor und arbeitet am gesellschaftlichen Wandel mit; sie dient als Orientierung, vermittelt Wert- und Normvorstellungen und liefert Verhal- tensvorbilder, betreibt Bewusstseinsbildung, formuliert Wünsche, Hoffnungen und Träume (vgl. Koch & Hofer, 2008, S. 198). Werbung ist eine Sozialisationsinstanz: Sie führt vor, was die Gesellschaft für typisch weiblich bzw. männlich hält, welche Rollen den Geschlechtern zugewiesen werden, welche Erwartungen an sie gestellt werden bzw. welches Verhalten ak- zeptiert oder nicht geduldet wird. Ebenso wie die Massenmedien ist Werbung ein Instrument der gesellschaftlichen wie individuellen Wirklichkeitskonstruktion. Ein besonderes Ausmaß an medialer Aufmerksamkeit nimmt (schon seit Jahrzehnten) die Kritik an der stereotypen Darstellung von Frauen und an dem vermittelten Jugend- und Schönheitswahn ein. Jüngeren Datums ist hingegen die Auseinandersetzung mit der Darstellung von Magermodels und die Untersuchung der Wirkung solch fragwürdiger Vorbilder (vgl. Holtz-Bacha, 2008, S. 9-10). Der Werbung wird ein induzierter Schlankheitswahn unterstellt - dazu dienen Models, da sie prominent und stark wahrnehmbar sind und gleichzeitig Normen wie auch Werte repräsentie- ren. Aus diesem Grund wird vor allem der Modewerbung eine nachteilige Wirkung auf Rezi- pienten zugeschrieben. Gerade die Darstellung magerer Models bestätigt einmal mehr, dass Werbung keinesfalls der Realität entspricht und ein Spiegel der Gesellschaft ist, wie es der Werberat oftmals behauptet. Werbung übt Einfluss auf Standards und Vorstellungen aus, die Männer und vor allem Frauen von sich selbst und voneinander haben (vgl. Holtz-Bacha, 2008, S. 9-10 und Koch & Hofer, 2008, S. 198-199).
Die Fokussierung der öffentlichen Kritik auf die Darstellung schlanker Medienakteure2 und ihre (unterstellten) negativen Effekte auf das weibliche Körperbild sollen im Rahmen der vor- liegenden Arbeit hinterfragt werden. Stark vernachlässigt scheint in Zusammenhang mit dem Magerwahn bislang die Untersuchung der Wirkung schlanker Peers3 auf das weibliche Kör- perbild und Selbstwertgefühl. Peers begegnen uns fortlaufend im Alltag und es ist kaum mög- lich, einer Gegenüberstellung mit ihnen aus dem Weg zu gehen. Sie sind ebenbürtiger und greifbarer als überperfektionierte Medienakteure und könnten deshalb einen größeren Einfluss auf das weibliche Körperbild auswirken als bislang vermutet. Abschnitt 1.2 geht weiter auf diesen unterstellten Sachverhalt ein, indem er die Ziele und Forschungsfragen der vorliegen- den Arbeit erläutert.
1.2 Ziele und Forschungsfragen der Arbeit
Die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen stereotyper Körperdarstellungen in der Werbung lassen sich derzeit kaum abschätzen; jedoch steht dieser Aspekt auch selten im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Vordergründig von Interesse sind eher individuelle Folgen, was vor allem mit der interessanteren Berichterstattung zusammenhängt. Dazu liegt eine Vielzahl an Untersuchungen vor, wenngleich sich aufgrund verschiedener methodischer und theoretischer Herangehensweisen keine klare Linie in der Forschung erkennen lässt. In den USA sind Untersuchungen zu den Konsequenzen medial vermittelter Schlankheitsideale auf das Körperbild von Rezipientinnen weit verbreitet. Als Folgen des Medienkonsums werden vor allem der Drang abzunehmen, Senkung des Selbstwertgefühles und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper genannt. Trotz zahlreicher Hinweise ist dieser Wirkungszusammenhang jedoch nicht eindeutig belegt und muss angezweifelt werden. Es liegen unterschiedliche An- sichten über die theoretischen Grundlagen dieser Medienwirkungen und zugleich ambivalente Forschungsergebnisse vor: Je nach Herangehensweise werden positive, negative oder neutrale Wirkungen schlanker Medienakteure auf Rezipientinnen nachgewiesen (vgl. Koch & Hofer, 2008, S. 199). Ob und in welchem Ausmaß die Massenmedien tatsächlich (mit)verantwortlich an Körperbildstörungen junger Frauen sind, konnte bis zum heutigen Zeitpunkt aus kommu- nikationswissenschaftlicher Sicht nicht eindeutig geklärt werden (vgl. Groesz, Levine & Mur- nen, 2002, S. 11-14). Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, ob es tatsächlich Darstel- lungen schlanker Medienakteure sind, die einen Effekt auf das Körperbild von Rezipientinnen haben oder vielmehr gleichgeschlechtliche Peers (welche uns im sozialen Umfeld täglich be- gegnen), werden in der aktuellen Forschung weitgehend vernachlässigt. Die wenigen durch- geführten Experimente zur Wirkung schlanker Peers zeigen jedoch, dass deren Existenz nega- tivere Effekte auf das weibliche Körperbild hat als die Darstellung schlanker Medienakteure (vgl. Trottier, Polivy & Herman, 2007, S. 169). Um in Zukunft wirksamere Konzepte zur Prä- vention und zur Früherkennung von Personen mit Körperbild- und Essstörungen entwickeln zu können ist es wichtig, die Ausmaße von medialen und interpersonalen (d.h. im Kontext durch Peers bewirkten) Effekten auf das weibliche Körperbild genauer zu erforschen. In me- thodologischer Hinsicht soll daher im Rahmen dieser Arbeit ein experimentelles Design ent- wickelt werden, das zuverlässige Kausalaussagen ermöglicht und durch Einbezug von media- len und interpersonalen Stimuli den Effekt auf das Körperbild und Selbstwertgefühl der Rezi- pientinnen untersucht. Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die nicht hinreichend geklärte Frage, ob schlanke Medienakteure und/oder Peers einen Effekt auf das Körperbild und Selbstwertgefühl weiblicher Rezipienten haben, aufzuklären. Liegt ein Effekt vor, so soll weiter hinterfragt werden, ob dieser positiv oder negativ ist und ob eine der beiden Gruppen (Medienakteure/Peers) einen stärkeren Effekt auf das weibliche Körperbild und Selbstwertge- fühl auswirkt. Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Frage, wie weibliche Rezipientinnen ihren eigenen Körper und dessen Schlankheit einschätzen und welche körper- bezogenen Emotionen auftreten, wenn sie mit schlanken Medienakteuren und Peers konfron- tiert werden. Sie stellt mediale und interpersonale Wirkungen gegenüber.4
1.3 Aufbau der Arbeit
Forschungsarbeiten zum Einfluss medial vermittelter Schlankheit auf das weibliche Körper- bild beruhen auf zahlreichen theoretischen Annahmen. Daher werden im Folgenden zunächst die bedeutsamsten theoretischen Grundlagen vorgestellt. Diese erlauben es, Fragestellungen zur Wirkung medial und interpersonal vermittelter Schlankheit auf Rezipientinnen aus unter- schiedlicher Perspektive zu betrachten. Zunächst wird die Kultivationshypothese thematisiert, welche von langfristigen Zusammenhängen zwischen der Medienrealität und der Weltan- schauung von Lesern bzw. Zuschauern ausgeht. Dem folgt die Erläuterung der Theorie der Kontrasteffekte, welche unterstellt, dass die Wahrnehmung extremer Reize die Auffassung nachfolgender Stimuli beeinflusst. Bezogen auf die Wahrnehmung schlanker Personen bedeu- tet dies beispielsweise, dass Frau en, die (sehr dünne) Models in der Werbung sehen, sich selbstals weniger schlank empfinden und an körperbezogenem Selbstwertgefühl verlieren (vgl. Kenrick et al., 1993, S. 195). Im Anschluss daran werden die wichtigsten Annahmen der sozial-kognitiven Lerntheorie erläutert, welche weniger davon ausgeht, dass der absolute Me- dienkonsum beeinflussend wirkt, sondern vielmehr davon, dass bestimmte Charakteristika der medialen Formate in Kombination mit Persönlichkeitsmerkmalen der Rezipienten bedeutsam sind. Da die experimentelle Untersuchung in Abschnitt 6 auf der Theorie sozialer Vergleichs- prozesse aufbaut, wird diese ausführlich erörtert. Bei der bisherigen Forschung zur Wirkung schlanker Medienakteure hat sie sich als bedeutsames Konzept etabliert, welches Wirkungs- zusammenhänge auf geeignete Art und Weise nachweisen kann. Dies liegt daran, dass die Theorie zum einen kurzfristige Wirkungen unterstellt, welche im Experiment gut überprüfbar sind. Des Weiteren werden Charakteristika des Rezipienten berücksichtigt (zum Beispiel se- lektive Wahrnehmung), so dass Wirkungen medialer Formate der Realität entsprechend di- vergieren können.
Auf Basis dieses theoretischen Überblicks wird im Anschluss auf wichtige begriffliche Grundlagen im Kontext von Körperbild und Schlankheit eingegangen. Darüber hinaus werden Bezeichnungen die in Zusammenhang mit abhängigen und prädisponierenden Variablen ste- hen voneinander abgegrenzt, und es wird Klarheit in Bezug auf zahlreiche Wortverwendun- gen geschaffen. Die Definition der verwendeten Terminologie soll Gegenüberstellungen der Ergebnisse erleichtern und vermeiden, dass Untersuchungen voneinander abweichen. Der Begriff „Körperbild“ suggeriert bereits, dass es nicht um den physiologischen Körper als ma- teriellen Funktionszusammenhang geht. Das Körperbild ist ein äußerst komplexes psychi- sches Phänomen. Bilder sind Gegenstand unserer visuellen Wahrnehmung; so geht es beim Körperbild um eine Vision oder Vorstellung, die wir uns vom Körper machen. Um mögliche Wirkungen schlanker Medienakteure und Peers auf das Körperbild junger Frauen besser ver- stehen zu können, ist es erforderlich, zu erläutern, was das Körperbild vom physischen Kör- perzustand unterscheidet, und den Ausdruck von ähnlichen Begrifflichkeiten abzugrenzen. Ebenso unentbehrlich ist es, zwischen den Begriffen „Schlankheit“ und „Attraktivität“ zu differenzieren und die Unterschiede zwischen diesen zu erläutern. Durch präzise Definitionen wird klar, warum in den Ausführungen ausschließlich von Schlankheit gesprochen wird und der Begriff als Basis der empirischen Untersuchung dient.
Im Rahmen des experimentellen Designs stellt sich die Frage, welche Kenngrößen geeignet sind, die Schlankheit von Medienakteuren, Peers und den Versuchsteilnehmerinnen zu bestimmen. Bedeutsame Schlankheitskenngrößen werden vorgestellt und deren Nutzen und Schwachpunkte dargelegt. Das Thema Körperbildstörungen berührt viele Forschungsberei- che, was dazu führt, dass der Begriff in der Fachliteratur mitunter sehr uneinheitlich ge- braucht wird. Um Unklarheiten zu vermeiden, werden Körperbildstörungen (body image di- sorders) zunächst klassifiziert und ihre Hintergründe dargelegt. Unter klinischen Körperbild- störungen werden Störungen verstanden, die in klinisch-diagnostischen Klassifikationssyste- men auftauchen und mit hohem Leid für die Betroffenen verbunden sind - etwa Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht. Da das Verständnis von Essstörungen zentraler Bestandteil der Untersuchung und möglicher Schlussfolgerungen bzw. Präventionsmaßnahmen ist, werden diese mit ihren wesentlichen Merkmalen und seelischen bzw. körperlichen Folgeerscheinun- gen vorgestellt.
Schlankheit ist für die Verbreitung von Inhalten in den Massenmedien besonders wichtig, weil schlanke Akteure das Interesse des Medienkonsumenten zur Botschaft herstellen, erhal- ten oder verstärken können (vgl. Schenk, Donnerstag & Höflich, 1990, S. 112). Medien ver- leihen den schlanken Vorbildern durch ihre Allgegenwart einen hohen Stellenwert. Insbeson- dere der Werbung wird unterstellt, sie trage dazu bei, dass das körperliche Erscheinungsbild zunehmend wichtiger wird. Bevor in Abschnitt 5 näher auf die interpersonale und mediale Wirkung schlanker Personen eingegangen wird, ist es wichtig darzulegen, wie weibliche Schlankheit in den Medien präsentiert wird. In diesem Zusammenhang wird zunächst auf Printmedien, im Anschluss daran auf die Darstellung schlanker weiblicher Akteure im Fern- sehen eingegangen.
Auf Grundlage dieses Forschungsüberblickes werden Hypothesen zu medialen und interper- sonalen Wirkungen abgeleitet und im Experiment überprüft um in der Forschung bestehende Schwachstellen zu hinterfragen. Wirkungen medial und interpersonal vermittelter Schlankheit auf das Körperbild und Selbstwertgefühl von Frauen wurden in Deutschland bisher kaum un- tersucht; die meisten Studien zu diesem Thema fanden in den USA statt. Aufgrund der man- gelnden theoretischen Fundierung ist daher nicht nachvollziehbar, warum und wie sich die Darstellungen schlanker Frauen in den Medien auf das Körperbild junger Frauen auswirken. Hinzu kommt, dass die entsprechenden Studien sehr uneinheitliche Ergebnisse liefern, was an der fehlenden Beachtung von weiteren Variablen liegt, welche die Wirkung schlanker Me- dienakteure bzw. Peers auf das Körperbild zusätzlich beeinflussen können.
Auf Basis der experimentellen Ergebnisse wird abschließend diskutiert, welche Bedeutung die Präsentation schlanker Medienakteure und die alltägliche Gegenüberstellung mit Peers für die Gesellschaft, das weibliche Körperbild wie auch Selbstwertgefühl haben können, mögli- che Schwachpunkte der durchgeführten Untersuchung erläutert und ein Resümee gezogen.
2 Theoretische Grundlagen
Forschungsarbeiten zum Einfluss weiblicher Schlankheit auf das Körperbild junger Frauen beruhen zum Großteil auf der Annahme direkter medialer bzw. interpersonaler Wirkungen. Es wird jedoch nicht analysiert, welche konkreten Wirkungsprozesse sich wie abspielen. Obwohl den überwiegend auf Medienakteure bezogenen Studien keine bestimmte Theorie unterliegt, orientieren sich ihre Annahmen am ehesten am Kultivationsansatz (vgl. Schemer, 2003, S. 529-530). Dieser geht auf die Vielseherforschung des Medienwissenschaftlers George Gerb- ner (1976) zurück und unterstellt, dass den Rezipienten vor allem durch das Fernsehen eine bestimmte Weltanschauung vermittelt wird. Menschen, die mehrere Stunden täglich fernse- hen (sog. Vielseher), werden in ihren Vorstellungen durch das Fernsehen geprägt und nähern ihre eigene Weltanschauung zunehmend der Medienrealität an. Das Fernsehen entspricht ei- ner Sozialisationsinstanz, die den Blick auf die reale Welt verfälscht. Es wird angenommen, dass Medieninhalte homogen sind und Konsumenten diese Inhalte - trotz selektiver Zuwen- dung - kaum umgehen können (vgl. Gerbner et al., 1994, S. 17-41). Umfragen von Kluge und Sonnenmoser weisen einen Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Unzufrieden- heit mit dem eigenen Körper nach: Besonders junge Frauen empfinden Schönheitsideale und den gesellschaftlichen Druck, schlank sein zu müssen, als belastend. Dabei prägen die Medien neben Bekannten und Freunden zu über 50 Prozent Vorstellungen von körperlichen Idealma- ßen (vgl. Kluge & Sonnenmoser, 2000, S. 5 und Kluge & Sonnenmoser, 2001, S. 3). Jedoch gibt es auch zahlreiche Befunde, die der Kultivationshypothese widersprechen (vgl. bei- spielsweise Jane et al., 1999: Es besteht kein signifikanter, positiver Zusammenhang zwischen dem absoluten Medienkonsum und Körperbildstörungen bei jungen amerikanischen Frauen). Negative Kritik in Hinblick auf die mangelnde Beachtung von psychologischen Komponenten und nachvollziehbaren Wirkungsprozessen führte dazu, dass Studien, die Einflüsse auf das weibliche Körperbild untersuchen, zunehmend auf Grundlage von Kontrasteffekten, der sozial-kognitiven Lerntheorie und der Theorie sozialer Vergleichsprozesse durchgeführt wer- den (einen Überblick hierzu bietet Schemer, 2003, S. 530-534).
Im Folgenden wird zunächst beschrieben, über welche Prozesse Darstellungen von Medienak- teuren und Peers das Körperbild von Frauen beeinflussen können. Die drei vorgestellten An- sätze erlauben es, mögliche Fragestellungen zur Wirkung auf Rezipientinnen aus ganz unter- schiedlicher Perspektive zu betrachten. Da die experimentelle Studie in Abschnitt 6 auf der Theorie sozialer Vergleichsprozesse beruht (vgl. Festinger, 1954 und Abschnitt 6 zur Begrün- dung), liegt der Schwerpunkt der theoretischen Ausführungen auf deren Erörterung in Ab- schnitt 2.3. Ungenaue Begriffsverwendungen bei den interessierenden Variablen führten bisher dazu, dass Untersuchungen in hohem Maße voneinander abweichen und Vergleiche der Ergebnisse erschweren. In Abschnitt 3 wird daher auf wichtige begriffliche Grundlagen im Kontext von Körperbild und Schlankheit eingegangen. Ferner werden Terminologien, die in Zusammenhang mit abhängigen und prädisponierenden Variablen stehen, voneinander abgegrenzt, und es wird begriffliche Klarheit geschaffen.
2.1 Theorie der Kontrasteffekte
Studien, die auf Grundlage von Kontrasteffekten Wirkungsannahmen überprüfen gehen davon aus, dass für die Bildung eines sozialen Urteils kognitive Reize und Vergleichsstandards erforderlich sind. Die Kontextabhängigkeit dieser Stimuli wirkt sich auf die Wahrnehmung von nachfolgenden Reizen aus (vgl. Koch & Hofer, 2008, S. 203).
Der Begriff „Kontrasteffekte“ entstammt der Adaptionsniveautheorie (vgl. Helson, 1964) und ist ein Erklärungsansatz für bestimmte Formen der Wahrnehmung und Beurteilung von Rei- zen. In der Literatur taucht die Adaptionsniveautheorie häufig in Zusammenhang mit der Preisbeurteilung von Kunden auf, spielt jedoch auch in Zusammenhang mit körperlicher Wahrnehmung eine entscheidende Rolle. Sie besagt, dass Wahrnehmung immer relativ ist, da sie vom psychologischen Bezugssystem einer Person abhängt. Dabei handelt es ich um gebil- dete innere Referenzgrundlagen, welche dazu dienen, Dinge als schön oder hässlich, dick oder dünn festzulegen. Absolute Urteile, zum Beispiel wie schlank eine Person ist, hängen immer vom Betrachter ab. Dabei spielt die Umwelt von Personen eine entscheidende Rolle. Lebt eine Frau in einer Kultur mit sehr schlanken Frauen, nimmt sie Personen mit unterdurch- schnittlichem Körpergewicht anders wahr als Frauen aus Kulturkreisen mit vielen überge- wichtigen Personen. Für Helson ist der Stimulusbereich, an den sich eine Person anpasst, ent- scheidend für deren Beurteilung von Reizen. Als Adaptionsniveau bezeichnet er den internen Referenzpunkt, an dem Personen neutral eingestellt sind. Das heißt, dass Menschen von die- sem indifferenten Punkt ausgehend andere als schlank oder dick ansehen. Der Punkt subjekti- ver Gleichgültigkeit bildet sich abhängig von auftretenden Hintergrundreizen, den fokussier- ten Reizen und bereits im Gedächtnis gespeicherten Stimuli (vgl. Hellbrück & Fischer, 1999, S. 124-126). Unter Kontrasteffekten versteht man letztendlich die Aussendung von Reizen aus bestimmten Urteilsklassen, die aufgrund ihrer großen Entfernung zum internen Referenzpunkt als untypisch angesehen werden.
Die Relativierung von Wahrnehmungen stellt einen grundlegenden psychischen Prozess dar, der es dem Menschen erlaubt, Neues von Altem, Wichtiges von Unwichtigem oder Schlank- heit von Übergewicht zu unterscheiden. Das Wahrnehmungsfeld von Schlankheit erstreckt sich nach der Adaptionsniveautheorie nicht auf den Körper selbst, sondern auf ein unter Um- ständen sehr vielfältiges Feld aus metrischen, verbalen und visuellen Eindrücken (vgl. Diller, 2000, S. 129-130). Kontrasteffekte stellen ein Wahrnehmungsphänomen dar, das sehr häufig im Zusammenhang mit der sozialen Urteilsbildung untersucht wird. Übertragen auf die Wahr- nehmung schlanker weiblicher Personen bedeutet dies, dass beispielsweise die bildliche Darstellung sehr dünner Körper dazu führen kann, dass Frauen durchschnittlich schlanke Personen nicht mehr als solche wahrnehmen, sondern als weniger schlank. Studien von Kenrick et al. (1993), Champion & Furnham (1999) und Turner et al. (1997) weisen nach, dass Frauen, die schlanken Models gegenübergestellt werden, sich selbst als weniger schlank einschätzen, weniger zufrieden mit ihrem Körper sind und dass ihr körperbezogenes Selbstwertgefühl sinkt. Zudem lassen sich Kontrasteffekte nachweisen, die nicht das Selbstbild, sondern das Verhalten einer Person beeinflussen. Levine und Estroff Marano (2001) weisen nach, dass Frauen, die mit schlanken weiblichen Personen konfrontiert werden (egal ob in einem Film oder auf einem Foto), sich selbst sogar als weniger attraktive Ehepartner sehen (vgl. Levine & Estroff Marano, 2001, S. 41). Ob sich solche Wahrnehmungen auch im Verhalten ausdrücken, wurde in der bisherigen Forschung noch nicht ausreichend untersucht.
2.2 Sozial-kognitive Lerntheorie
Wie die Ausführungen zu Beginn des Abschnittes deutlich machen, geht ein Großteil der For- schung davon aus, dass schlanke Personen direkt Einfluss auf das Körperbild von Frauen nehmen. Es wird nicht weiter darauf eingegangen, welche Wirkungsprozesse im Detail ablau- fen. Die sozial-kognitive Lerntheorie betont den Einfluss von Umweltfaktoren gegenüber intrapsychischen Verhaltensdeterminanten und bezieht gleichzeitig die psychologische Kon- stitution einer Person während der Informationsverarbeitung im Lernprozesses mit ein (vgl. Koch & Hofer, 2008, S. 203-204).
In der Lernforschung unterscheidet man individuelle Lerntheorien von sozialen Lerntheorien, die sich im Gegensatz zu Individualtheorien mit Lernprozessen in der Gemeinschaft beschäf- tigen (vgl. Frey & Irle, 2002, S. 36). Beim kognitiven Lernen wird im wahrgenommenen Verhalten ein Hinweis darauf gesehen, was im Gedächtnis vor sich geht; gedankliche Prozes- se wie Einsicht und Verstehen, Denken und Begründen spielen eine tragende Rolle (vgl. Stei- nebach, 2003, S. 61). Nach der sozial-kognitiven Lerntheorie von Albert Bandura (1989) ist soziales Verhalten nicht angeboren, sondern erlernt, wobei die Psyche des Rezipienten Ein- fluss auf die Verarbeitung von Informationen nimmt. Auch Einstellungen und das Verhältnis zum eigenen Körper können auf Lernprozesse zurückgeführt werden. Verhalten orientiert sich an dem anderer; sie dienen als Modell und werden imitiert. Die sozial-kognitive Lerntheorie beruht auf der Annahme, dass Zuschauer Reize nicht nur passiv aufnehmen, sondern auch aktiv verarbeiten. Den Lernenden bezeichnet man dabei als Beobachter, den Beobachteten als Modell oder Leitbild (vgl. Bandura, 1989, S. 9-14). Wichtig für den Lernprozess ist neben der weitgehenden Identifikation des Beobachters mit dem Modell auch die Verstärkung durch Miterleben und Nachempfinden. Durch die Beobachtung können Verhaltensalternativen hin- terfragt, neue Verhaltensweisen erlernt, Hemmschwellen für vorhandene Verhaltensweisen auf- oder abgebaut werden, und es kann zu einer Auslösung von bereits bestehendem Verhal- ten kommen. Dabei beeinflussen sich Verhalten, Umwelteinflüsse sowie kognitive, biologi- sche und andere Faktoren einer Person gegenseitig und treten in Wechselbeziehungen zuein- ander (vgl. Frey & Irle, 2002, S. 278). Körperbezogenen Lernprozesse werden insbesondere durch die Orientierung an Verhaltensmodellen (z. B. Peers oder Medienakteure), körperbezo- genen verbalen Botschaften (z. B. Größe, Alter oder Gewicht einer Person), Erfahrungen im Umgang mit dem eigenen Körper und die psychische Verfassung des Beobachtenden beein- flusst (vgl. Hendy et al., 2001, S. 558). Auf Grundlage sozial-kognitiver Lernprozesse können sich Wirkungen direkt oder indirekt (über den interpersonalen Einfluss einer anderen Person, die selbst beeinflusst wird) entfalten (vgl. Bandura, 1994, S. 79).
Je größer die Funktionalität und der Erfolg des Verhaltens von Modellen sind, desto eher wird Verhalten erlernt. Im Gegensatz zu Körperfülle hat Schlankheit meist einen vorteilhaften Wert, mit ihr werden positive Aspekte wie Disziplin, Geselligkeit und Erfolg verbunden (vgl. Fouts & Burggraf, 1999, S. 478). Durch diese Funktionalität wird die Wahrscheinlichkeit der Nachahmung eines schlanken Modells erhöht. Es wird vermutet, dass im Sinne der sozial- kognitiven Lerntheorie die mündliche Verstärkung des Aussehens und die Präsentation schlanker Personen zur geistigen Verfestigung der Modelle führt (vgl. Fouts & Burggraf, 1999, S. 473). In einer Studie aus dem Jahr 1997 zeigt Harrison, dass Essstörungen und kör- perliche Unzufriedenheit bei jungen Frauen insbesondere dann auftreten, wenn die interperso- nale Anziehung zu einem schlanken Modell besonders hoch ist (vgl. Harrison, 1997, S. 492). Bandura (1989) unterschiedet zwei Phasen des Modell-Lernens: Die Aneignungsphase mit Aufmerksamkeits- und Behaltensprozessen sowie die Ausführungsphase mit Produktions- und Motivationsprozessen. Aufmerksamkeitsprozesse entscheiden darüber, was aus der großen Menge von Modelleinflüssen selektiv betrachtet und welche Informationen aus den beobacht- baren Ereignissen gewonnen werden. Von der Aufmerksamkeitsphase ist es abhängig, wie genau der Lernende relevante Aspekte des modellierten Verhaltens wahrnimmt. Es wurde nachgewiesen, dass Modellen mit hohem sozialen Status, Sachkenntnis und Kompetenz grö- ßere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aus diesem Grund wird einer Medienperson von der man weiß, dass sie sehr angesehen ist, eher zugehört, als einer Person, deren Ansehen gering ist (vgl. Gage & Berliner, 1986, S. 350).
Personen können nicht durch Ereignisse beeinflusst werden, ohne sich an diese zu erinnern. In sich anschließenden Behaltensprozessen wird das beobachtete Verhalten in einfache Schema- ta umgeformt, klassifiziert und geordnet. Die Speicherung erfolgt stets so, dass Informationen bei Bedarf schnell zur Verfügung stehen. Die symbolische Umsetzung modellierter Informa- tionen in Codes und die kognitive Einübung der Informationen unterstützen den Behaltens- prozess. Emotionale Befindlichkeiten und bereits verankerte Konzeptionen können sich ver- zerrend auf den Prozess auswirken.
Ob beobachtetes Verhalten tatsächlich ausgeführt wird, hängt von der gegebenen Situation, den Persönlichkeitsmerkmalen und der Art der Beziehung zwischen Modell und Lernendem ab. In Produktionsprozessen erfolgt erstmals die aktive Umsetzung des Gelernten - symbolische Konzeptionen werden in entsprechende Handlungsabläufe übersetzt. Diskrepanzen zwischen dem eigenen Verhalten und dem Modell werden durch Selbstbeobachtung registriert und führen (gegebenenfalls) zu korrigierenden Anpassungsprozessen.
Die sich anschließende, vierte Stufe bezieht sich auf motivationale Prozesse. Von einem Modell übernommenes Verhalten wird eher gezeigt, wenn es belohnt wird, als wenn es zu keinem Erfolg führt oder bestraft wird. Die Ausführung von durch Beobachtung gelerntem Verhalten wird vor allem von direkten, stellvertretenden und selbstproduzierten Motivatoren beeinflusst. Beobachtete Kosten und Nutzen anderer beeinflussen die Nachahmung eines Modells ähnlich wie direkt erfahrene Konsequenzen. Menschen werden durch Erfolge anderer aber auch durch ihre eigenen Verhaltensstandards motiviert. Sie führen aus, was sie als angemessen empfinden (vgl. Bandura, 1989, S. 12-14). Abbildung 2 fasst die zwei Phasen des Modell-Lernens mit ihren Prozessen zusammen:
Abbildung 2: Überblick über die zwei Phasen des Modell-Lernens und deren Prozesse
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Bandura, 1989, S. 13
Im Rahmen der medialen Darstellung von schlanken Frauen wird kaum thematisiert, mit wel- chem Aufwand deren Aussehen erreicht wurde. Modelle werden eher imitiert, wenn der Auf- wand, der zur Erreichung des Ziels erforderlich war, im Hintergrund bleibt. Entscheidend ist die Tatsache, dass schlanke Medienakteure als wünschenswerte Personen dargestellt werden. Besonders für Kinder und Jugendliche ist der Einfluss von medialen Verhaltensmodellen be- deutsam, da jene sich viel mit den Medien beschäftigen und meist nur wenige reale Orientie- rungspersonen haben. Die bereits zu Beginn des Abschnitts angesprochene Studie von Kluge und Sonnenmoser (2001, 2000) weist nach, dass in Deutschland Medienfiguren neben Freun- den und Bekannten als Maßstab zur Beurteilung von schlanken Körpern dienen. Bedenkt man, dass Schlankheit in unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt, muss befürchtet werden, dass bereits in frühen Jahren Verhaltensweisen erlernt und Einstel- lungen entwickelt werden, die Mädchen und junge Frauen zu einer Risikogruppe für Essstö- rungen machen (vgl. hierzu Abschnitt 3.5 und Kluge, Hippchen & Fischinger, 1999, S. 103).
2.3 Theorie sozialer Vergleichsprozesse
Die Theorie sozialer Vergleichsprozesse wurde 1954 von Leon Festinger aufgestellt, jedoch im Zeitverlauf in ihren Ansätzen erweitert (vgl. u.a. Merton, 1957; Hyman, 1968 und Goethals, 1986). Ihre Grundannahme besteht darin, dass Menschen das Bedürfnis verspüren, sich ihrer sozialen Umwelt angepasst zu verhalten, sie berücksichtigt aber auch intrapsychi- sche Komponenten und Motive der Rezipienten, sich den Reizen selbst zuzuwenden. Neben der Evaluationsfunktion (Validierung und Selbstbewertung) können der Faktor der Selbstver- besserung (selbstwerterhöhende Funktion) und der Selbstwertdienlichkeit (Demonstration) eine entscheidende Rolle im Rahmen der Zuwendung spielen. Da Individuen unterschiedliche Motive aufweisen, muss es auch verschiedene soziale Vergleiche geben, bei denen unter- schiedliche Personen als Vergleichsstandard dienen. Dabei ergeben sich zwei grundlegende Probleme: Im Großteil bisher durchgeführter Studien wurde der Begriff „sozialer Vergleich“ nicht genau definiert (dies soll im Folgenden geschehen). Des Weiteren soll zwischen der Ursache (die den Vergleichsprozess auslöst) und dem eigentlichen Vergleichsprozess unter- schieden werden. Im Gegensatz zum Uses-and-Gratification-Approach (vgl. Teichert, 1975, S. 269-283 und Katz & Foulkes, 1962, S. 377-388) sind bei der Theorie sozialer Vergleichs- prozesse Motive (die zum Vergleich führen) vorgelagert und vom eigentlichen Vergleichs- prozess getrennt. Die Motive werden in Abschnitt 2.3.3 allgemein vorgestellt und in Ab- schnitt 2.3.4 mit Blick auf den Vergleich mit Medienakteuren erläutert. Motive des sozialen Vergleichs treten nicht zufällig auf, sondern sind an bestimmte Persönlichkeitsmerkmale des Rezipienten gekoppelt. Mit diesen individuellen Eigenheiten beschäftigt sich Abschnitt 2.3.5.
2.3.1 Begriffsbestimmung
Wie die Theorie der Kontrasteffekte (vgl. Abschnitt 2.1) beruht auch die Theorie sozialer Vergleichsprozesse auf der Annahme, dass soziale Urteile durch den Vergleich mit anderen Personen entstehen (vgl. Festinger, 1954, S. 118-119 und Rosch & Frey, 1997, S. 300). Kon- trasteffekte erlauben allerdings keine Aussage über die psychische Verfassung und die Moti- vation von Menschen, Reize selbst aufzusuchen. Sie beschränken sich vielmehr auf die Beo- bachtung, wie Menschen reagieren, wenn ihnen Reize vorgesetzt werden. Insbesondere wenn es um den Einfluss von Persönlichkeitsvariablen geht, stellt die Theorie sozialer Vergleichs- prozesse eine Erweiterung in Bezug auf individuelle Eigenschaften der Rezipienten dar. Individuen orientieren sich aufgrund sozialer Bedürfnisse an ihren Mitmenschen, um sich diesen gegenüber angemessen zu verhalten (vgl. Festinger, 1954, S. 117-123 und Stevens & Fiske, 1995, S. 193).
Soziale Vergleiche sind Prozesse, die vor allem in interpersonalen Situationen stattfinden um es Menschen zu ermöglichen, sich selbst richtig einzuschätzen. Hierzu bedienen sie sich ent- weder an unvoreingenommenen (objektiven) Informationen (zum Beispiel: Wie viel wiege ich?) oder an sozialen Vergleichsinformationen (zum Beispiel: Wie viel wiege ich im Ver- gleich zu meinen Mitmenschen?). Je bedeutsamer der Vergleichsaspekt bzw. der Gruppen- druck, je geringer die persönliche Sicherheit und die Möglichkeit einer Person ist, Aspekte objektiv zu bewerten, desto eher neigt sie zu sozialen Vergleichen (vgl. Festinger, 1954, S. 130). Nach anfänglichem Zweifel machen neuere Studien deutlich, dass soziale Vergleichsin- formationen auch herangezogen werden, wenn objektive Informationen vorhanden sind und sogar bedeutsamer als diese sein können. Bei der Festlegung des Begriffs „sozialer Ver- gleich“ wird auf eine Definition von Wood (1996) zurückgegriffen, da Festinger den Termi- nus in seinen Ausführungen (1954) nicht genauer präzisiert. Nach dieser Festlegung werden soziale Vergleiche als Bewertungsvorgang gesehen, bei dem sich Personen mit anderen vergleichen. Dabei kann es sich um reale Personen aus dem sozialen Umfeld (z. B. Peers) oder auch Medienakteure handeln. “Specifically, social comparison is defined as the process of thinking about information about one or more other people in relation to the self” (Wood, 1996, S. 520-521).
Bei sozialen Vergleichen unterscheidet man drei Richtungen in Bezug auf das jeweilige Ver- gleichskriterium: Vergleiche mit überlegenen Personen (z. B. mit schlankeren Frauen) be- zeichnet man als Aufwärtsvergleiche. Bei Vergleichen mit gleichrangigen Personen handelt es sich um Lateralvergleiche (z. B. mit Frauen gleichen Gewichts) und bei Vergleichen mit un- terlegenen Personen (z. B. mit Frauen höheren Gewichts) um so genannte Abwärtsvergleiche. Aufwärtsvergleiche führen in der Regel zu Frustration und einem geringeren Selbstwertgefühl, während Abwärtsvergleiche das Selbstwertgefühl erhöhen (vgl. Fischer & Wiswede, 2002, S. 161). Festinger hat in seinen Ausführungen den Nutzen von Aufwärts- und Lateralvergleichen thematisiert, die Bedeutsamkeit von Abwärtsvergleichen wurde erst in späteren Studien genauer analysiert (vgl. z. B. Wills, 1981).
Soziale Vergleichsprozesse bedürfen keiner besonderen Fähigkeiten, da sie weitgehend auto- matisiert ablaufen. Wie dargestellt, können sie durch bestimmte Motive ausgelöst werden, welche den Vergleich in eine bestimme Richtung lenken um den gewünschten Zweck zu er- füllen. Drei der bedeutsamsten Motive werden in Abschnitt 2.3.3 näher erläutert; die nachfol- genden Ausführungen in Abschnitt 2.3.2 beziehen sich speziell auf Medienwirkungen durch soziale Vergleichsprozesse.
2.3.2 Medienwirkungen auf Grundlage sozialer Vergleichsprozesse
Insbesondere Mädchen und junge Frauen orientieren sich im Hinblick auf Schlankheit an Me- dienakteuren. Durch den Rückgang direkter sozialer Erfahrungen in unserer Gesellschaft steigt die Bedeutung von sozialen Vergleichen mit Medienakteuren zunehmend an. Soziale Vergleiche mit schlanken Personen führen zu Frustration, geringerem Selbstwertgefühl und Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper (vgl. Crouch & Degelman, 1998, S. 586). Je häufi- ger soziale Aufwärtsvergleiche stattfinden, desto nachteiliger wird das eigene Körperbild wahrgenommen. Trotz der erheblichen Zunahme von Körperbild- und Essstörungen in den letzten Jahren existieren für Deutschland nur wenige Studien zur Bedeutung des Medienein- flusses - die meisten Forschungsbemühungen konzentrieren sich auf die USA und Großbri- tannien. Es wurde noch nicht hinreichend belegt, ob Mediendarstellungen schlanker Frauen zu Körperbild- und Essstörungen führen können (vgl. Striegel-Moore & Cachelin, 2001, S. 643). Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, ob es tatsächlich schlanke Medienakteure sind, die negative Effekte auf das Körperbild der Rezipientinnen haben, oder vielmehr schlan- ke Peers, liegen kaum vor.
Der Einfluss schlanker Models in den Medien ist insbesondere bei jungen Frauen bedeutsam, die einen hohen Medienkonsum aufweisen und wenige reale Personen als Vorbild haben. Ei- ne amerikanische Studie von Grogan aus dem Jahr 1999 verdeutlicht, dass sich drei Prozent der 16- bis 19-Jährigen an Schauspielerinnen orientieren, zehn Prozent an Models und nur drei Prozent an ihren Familienmitgliedern (vgl. Grogan, 1999, S. 107). Je häufiger soziale Vergleiche mit Medienakteuren stattfinden, desto negativer stellen sich die Auswirkungen auf das Körperbild der Rezipientinnen dar (vgl. Carlson Jones, 2001, S. 657 und den Überblick von Schemer, 2003, S. 532-534).
Aus sozialen Aufwärtsvergleichen können aber auch positive Gefühle resultieren: Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Rezipientinnen den Eindruck haben, sie könnten das schlanke Idealbild beispielsweise durch eine Diät oder durch Sport erreichen (vgl. Richins, 1991, S. 75). Die Zwiespältigkeit von sozialen Vergleichen resultiert aus unterschiedlichen Motiven. In den meisten wissenschaftlichen Untersuchungen werden den Probandinnen die sozialen Vergleiche aufgezwungen. In der Realität werden diese allerdings aktiv aufgesucht: Es können die im nachfolgenden Abschnitt erläuterten Motive Selbstbewertung, Selbstverbesserung und Selbstwertdienlichkeit unterschieden werden.
2.3.3 Motive sozialer Vergleiche
Eine der wichtigsten Begründungen dafür, dass Personen soziale Vergleiche durchführen, liegt darin, dass sie ihre Fähigkeiten und Meinungen korrekt beurteilen möchten (vgl. Festin- ger, 1954, S. 117). Das Motiv der Selbstbewertung wird auch dann bedeutsam, wenn Perso- nen die Optik und Wirkung ihres Körpers nicht einschätzen können. Bei sozialen Vergleichen zur Selbstbewertung richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Unterschied zwischen dem Körper der Vergleichsperson und dem eigenen. Nach sozialen Vergleichen mit schlanken Personen schätzen sich Rezipientinnen in der Regel negativer ein und sind unzufriedener mit ihrem Aussehen (vgl. Martin & Gentry, 1997, S. 29). Um Sicherheit und ein gutes Körperge- fühl zu bekommen, eignen sich am ehesten Lateralvergleiche mit gleichwertigen Personen. Eine durchschnittlich schlanke Frau sollte sich nicht mit einem Topmodel vergleichen, da von vornherein klar ist, dass dieses in der Regel eine schlankere Figur hat. Der Informationsge- winn wäre gering, ähnlich wie bei Abwärtsvergleichen mit übergewichtigen Frauen. Um die Frage zu beantworten, wie schlank eine weibliche Person tatsächlich ist, werden Vergleichs- personen mit ähnlichen körperlichen Voraussetzungen gesucht. Bereits die Überprüfung von Ähnlichkeiten bzw. Unterschieden hat zur Folge, dass ein sozialer Vergleich mit der jeweili- gen Zielperson stattfindet. Laut Goethals und Darley (1977) sollte im Falle der Selbstbewer- tung zumindest Ähnlichkeit hinsichtlich relevanter Eigenschaften bestehen (vgl. Goethals & Darley, 1977, S. 265-266).
Neben dem Aspekt der Selbstbewertung wollen Menschen sich kontinuierlich verbessern und auf diese Weise ihre Anpassung an das Umfeld sicherstellen (vgl. Festinger, 1954, S. 124). Beim Motiv der Selbstverbesserung steht für die vergleichende Person weniger der Unter- schied zwischen sich selbst und der schlanken Person im Mittelpunkt als vielmehr der Wunsch und der Wille, selbst auch so aussehen zu wollen. Daraus kann ein positives Körper- bild resultieren, da der schlanke Medienakteur bzw. der schlanke Peer als Vorbild wahrge- nommen wird, was zur Motivation beiträgt (vgl. Richins, 1991, S. 75). Im Falle der Selbst- verbesserung werden vor allem Aufwärtsvergleiche angestrebt, also Vergleiche mit überlege- nen (in diesem Fall schlankeren) Personen (vgl. Frey et al., 2001, S. 91). Dazu können sowohl reale als auch mediale Personen herangezogen werden. Der Vergleich mit einem schlanken Peer kann eine Frau beispielsweise dazu anspornen, sportlich aktiver zu werden und ihre Er- nährung umzustellen. Ein grundlegendes Problem des Motivs der Selbstverbesserung liegt darin, dass die Gegenüberstellung nur Sinn ergibt, wenn sich Personen vorher angemessen selbst bewertet haben. Ein unrealistischer Vergleich und utopische Ziele (gerade im Bereich von Gewichtsreduktion) tragen nicht zu einer Verbesserung des Körperbildes bei. Frauen überfordern sich häufig, indem sie Maßstäbe eines Topmodels bei sich anlegen und überhöhte Ansprüche an die eigene Person stellen. Betrachten Frauen Models in den Medien, spielt das Motiv der Selbstbewertung eine größere Rolle als das der Selbstverbesserung (vgl. Martin & Kennedy, 1994, S. 370). Da die vergleichenden Rezipientinnen kaum mit den Models konkur- rieren können, treten häufig negative Effekte auf.
Es zeigt sich, dass Personen oftmals nach einer vorteilhaften Selbsteinschätzung streben, die nicht zwangsläufig der Realität entspricht. Das Motiv sozialer Vergleiche zur Selbstwertdien- lichkeit wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt erforscht und findet sich noch nicht in der ursprünglichen Theorie von Festinger (vgl. Wills, 1981). Der Zweck des Motivs liegt darin, dass Personen versuchen, sich selbst positiv von anderen abzuheben. Um ein Überlegenheits- gefühl herbeizurufen, stellen sie selbst Vergleiche mit unterlegenen Personen an. Je instabiler das Selbstwertgefühl einer Person ist, desto eher neigt diese zu sozialen Abwärtsvergleichen. “A solution to this problem is to compare oneself with another person who is worse off; the favorable comparison between the self and the less fortunate other enables a person to feel better about his or her own situation” (Wills, 1981, S. 245). Frauen, die sehr unzufrieden mit ihrem Körper sind, sollten beispielsweise eher auf Vergleiche mit übergewichtigen Personen zurückgreifen, um ihr Selbstwertgefühl aufzubauen (einen Überblick dazu bietet Schemer, 2005, S. 82-85).
Zu Beginn dieses Abschnittes wurde dargestellt, dass der eigentliche Vergleichsprozess und dessen Auslöser separat betrachtet werden müssen, da Motive dem sozialen Vergleichspro- zess vorgelagert sind und ihn auslösen. Auch wenn grundsätzlich davon ausgegangen werden kann, dass zum Beispiel das Motiv der Selbstverbesserung zu Aufwärtsvergleichen mit über- legenen Personen führt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch andere Zielpersonen gewählt werden. Da die dargestellten Motive vielfach für die Nutzung bestimmter Medienin- halte relevant sind, wird im Folgenden auf diesen Zusammenhang eingegangen.
2.3.4 Motive sozialer Vergleiche mit Medienakteuren
Im Rahmen der nachfolgenden Ausführungen liegt der Fokus nicht auf der Bedeutung der Theorie sozialer Vergleichsprozesse zur Erklärung des Mediennutzungsverhaltens von Frau- en. In vielen Studien zum Mediennutzungsverhalten wird meist sehr pauschal auf diese Theo- rie verwiesen, weshalb eine Erklärung von Verhaltensmustern nicht verallgemeinert werden kann. Es folgt die Darstellung der in Abschnitt 2.3.3 allgemein erläuterten Motive mit Blick auf den Vergleich mit Medienakteuren. Sollten die Ergebnisse der experimentellen Untersu- chung in Abschnitt 6 zeigen, dass mediale Einflüsse auf das Körperbild junger Frauen stärker sind als interpersonale Einflüsse, können auf Basis dieser Erkenntnis beispielsweise Empfeh- lungen für die mediale Programmgestaltung körperbildgestörter Frauen abgeleitet werden.
Steht das Motiv der Selbstbewertung im Mittelpunkt, so sollten Frauen Medienangebote mit ihnen ähnlichen Akteuren nutzen (z. B. Frauen mit vergleichbarem Körper). Dadurch wird eine realistische Einschätzung des Körpers und der eigenen Schlankheit ermöglicht. Beson- ders unsichere Frauen greifen häufig auf dieses Motiv sozialer Vergleiche zurück. Medien liefern im Gegensatz zum realen Umfeld eine sehr große Auswahl verschiedenster Akteure, was die Auswahl der Zielpersonen erleichtert. Das Aussehen und die (scheinbare) Lebenswei- se von Medienakteuren dienen vielen Frauen als Orientierungshilfe. Es finden häufig Lateral- vergleiche zur Selbstbewertung statt. Die Darstellung von Stereotypen vereinfacht die Wahr- nehmung von Informationen (z. B. über den eigenen Körper), welche im sozialen Umfeld nicht so vereinfacht und schnell aufgenommen werden können (vgl. Hoffner & Cantor, 1991, S. 65). Frauen gelangen durch Medien oft an Informationen, die ihnen in ihrem eigenen Le- ben nützlich sind (z. B. Diättipps). Die Beobachtung von Medienakteuren kann zudem das Gespräch mit Mitmenschen anregen und ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Dies bedeutet, dass das Fernsehen sowohl als Ersatz für soziale Vergleichsmöglichkeiten genutzt werden kann als auch als Hilfestellung für die (reale) Kontaktaufnahme mit anderen Personen. Unter- haltungssendungen werden oft zu sozialen Vergleichen herangezogen, weil Frauen hier In- formationen zur Selbstbewertung finden. Solche Situationen ergeben sich meist aus Unsi- cherheiten, denen Frauen entgegenwirken möchten. Je instabiler die eigene Meinung ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen sich an Medienfiguren und deren Meinun- gen über den idealen Körper orientieren. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass in den meisten Studien zum Themenbereich das tatsächlich relevante Motiv des sozialen Vergleiches nicht überprüft wurde. Es kann daher nur unter Vorbehalt von sozialen Vergleichen zur Selbstbewertung gesprochen werden.
Im Unterschied zu sozialen Vergleichen der Selbstbewertung geht es bei der Selbstverbesse- rung darum, sich von überlegenen Medienakteuren inspirieren zu lassen (soziale Aufwärts- vergleiche). Gerade Frauen, die ihr Aussehen verbessern möchten, stoßen in den Medien (mit größerer Wahrscheinlichkeit als im sozialen Umfeld) auf Personen, die vielfach schlanker als sie selbst sind. Darstellerinnen aus Unterhaltungsprogrammen wie Schönheitsmagazinen kön- nen als Motivationsquelle bzw. Vorbild und der Selbstverbesserung dienen (vgl. Artmann, 2001, S. 43). Das Motiv der Selbstverbesserung stellt eines der entscheidenden Motive hin- sichtlich der Nutzung von Mode- und Schönheitsmagazinen dar (vgl. Thomsen et al., 2002, S. 127). Im Rahmen der gedanklichen Selbstverbesserung werden Ideen und Vorschläge aus dem Medienformat nicht tatsächlich umgesetzt, sondern dienen lediglich als Inspiration. Gleichwohl geht aus solchen Situationen meist ein gesteigertes Selbstbild hervor. Versuchen Frauen hingegen die Tipps und Vorschläge der schlanken Medienakteure tatsächlich umzu- setzen, kann das zu Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper führen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Vergleichspersonen einem Ideal entsprechen, das vom Großteil des weibli- chen Publikums nicht erreicht werden kann. Frustration und Unausgeglichenheit sind die Folge.
Frauen mit hoher Mediennutzung sind vor allem an Sendungen interessiert, bei denen irreale Lebensvorstellungen vermittelt werden. Solche Traumwelten lenken von Problemen im realen Leben ab. Unterhaltungssendungen wie Ratgeber für bessere Ernährung zielen allerdings auch auf Lernerfolge und eine Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens ab. Rezipientinnen orientieren sich an Medienakteuren in Unterhaltungsformaten, da diese Infor- mationen zur Selbstbewertung und Selbstverbesserung bieten. Selbst wenn es sich nur um Pläne für eine Diät handelt (imaginative Selbstverbesserung) können solche motivierenden sozialen Aufwärtsvergleiche bereits die Zufriedenheit mit dem eignen Körper steigern. In Medienangeboten wird auch Negatives (im Sinne von unterlegenen Vergleichspersonen) dargestellt. Das Angebot an Abwärtsvergleichen in den Medien ist vermutlich ebenfalls grö- ßer als im sozialen Umfeld. Gerade Unterhaltungsformate bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Akteurinnen, die weniger schlank sind, zu vergleichen. Durch den Vergleich mit un- terlegenen Akteurinnen fühlen sich Frauen besser und grenzen sich positiv ab. Es entstehen ein Überlegenheitsgefühl und Selbstbestätigung. Besonders bei gestressten und unsicheren Frauen tritt dieses Vergleichsphänomen häufig auf. Rezipientinnen, die übergewichtigen Me- dienakteuren gegenübergestellt werden, spüren kurzfristigen Erfolg durch eine Stimmungs- verbesserung. Unterhaltungsformate wie Talkshows werden häufig aufgrund ihres positiven Realitätsvergleichs genutzt (vgl. Paus-Haase et al., 1999, S. 336). Damit ist zum Beispiel ge- meint, dass Frauen glücklich sind, wenn sie merken, dass sie selbst eine bessere Figur haben als die Talkshow-Gäste im Fernsehen. Die Faszination für solche Formate erklärt sich durch das Motiv der Selbstwertdienlichkeit, da sie den Nutzerinnen ein Überlegenheitsgefühl bieten. Vor allem Menschen mit niedrigem Selbstwertgefühl neigen zu solchen Vergleichen. Es lässt sich vermuten, dass sie Medienangebote mit übergewichtigen Personen häufiger nutzen (ei- nen Überblick dazu bietet Schemer, 2005, S. 85-93).
2.3.5 Prädiktoren sozialer Vergleichsmotive
Motive sozialer Vergleiche entstehen nicht zufällig, sondern sind an gewisse Persönlichkeitsmerkmale gekoppelt. (Dieser Sachverhalt spielt auch in der experimentellen Untersuchung in Abschnitt 6 eine bedeutsame Rolle.) Vergleichsmotive können als Bindeglied zwischen einer Person und der Zuwendung zu bestimmten Menschen im sozialen Umfeld bzw. ihrer Mediennutzung gesehen werden. In der Literatur finden sich zu solchen Prädiktoren einige Anhaltspunkte, die nun auf das Verhalten gegenüber Peers und die Nutzung von Medienangeboten übertragen werden sollen.
Im vorliegenden Kontext werden soziale Vergleiche als Prozesse verstanden, bei welchen das eigene Körperbild im Vergleich zu mehr oder weniger schlanken Personen bewertet wird. Da soziale Vergleichsmotive an das Selbstkonzept von Personen gebunden sind, kommt dem Selbstwertgefühl dabei eine tragende Rolle zu. Bei Personen mit geringem Selbstwertgefühl überwiegt das Gefühl, anderen Personen unterlegen zu sein. Vergleicht sich eine Frau mit geringem Selbstwertgefühl, so treten bei ihr Informationen in den Vordergrund, die das eige- ne Aussehen in den Schatten der schlanken Akteurinnen stellen. Dies dürfte umso wahr- scheinlicher sein, je stärker das Selbstwertgefühl von Aspekten körperlicher Schlankheit ab- hängt. Weiter gehende Analysen von Patrick, Neighbors und Knee (2004) legen nahe, dass dem globalen Selbstwertgefühl eine ähnliche Moderatorfunktion zukommt wie dem Spezifi- schen (z. B. vom Aussehen abhängig). Es scheint daher nicht entscheidend zu sein, warum, sondern dass das Selbstwertgefühl eine gewisse Ausprägung einnimmt (vgl. Patrick, Neigh- bors & Knee, 2004, S. 507 und 513). Um soziale Vergleichsprozesse im experimentellen Vorgehen dieser Arbeit nicht unnötig einzuschränken, beziehen sich die nachfolgenden Aus- führungen stets auf das globale Selbstwertgefühl. Unter diesem wird nach Rosenberg (1965) auch ein generell positives oder negatives Gefühl in Bezug auf die eigene Person verstanden (vgl. Rosenberg, 1965, S. 16-36 und Skala zum Selbstwertgefühl von Rosenberg in Abschnitt 6.2.4.1.3)
Frauen, die ein geringes Selbstwertgefühl besitzen und sehr unsicher sind, sollten eher auf soziale Vergleiche zur Selbstwertdienlichkeit zurückgreifen, um ein Überlegenheitsgefühl zu erzeugen. Im Vergleich mit schlanken Personen gelangen sie in der Regel zu einer negativen Selbsteinschätzung (vgl. Wood, Michaela & Giordano, 2000, S. 563-572). Bei Frauen mit hohem Selbstwertgefühl ist genau das Gegenteil der Fall: Sie nehmen negative Informationen in Bezug auf das eigene Aussehen kaum wahr. Daraus kann geschlossen werden, dass Frauen mit höherem Selbstwertgefühl nach sozialen Aufwärtsvergleichen zufriedener sind als Frauen mit geringem Selbstwertgefühl. Da häufig die Forderung nach geringerer Präsenz schlanker Personen in den Medien erhoben wird, stellt sich die Frage, welche Prozesse bei Abwärtsver- gleichen stattfinden (vgl. Clay, Vignoles & Dittmar, 2005, S. 451-462). Entscheidend dabei ist, welche Folgen diese für Personen mit niedrigem Selbstwertgefühl hätten. Bei Frauen mit geringem Selbstwert würde sich durch Vergleiche mit unterlegenen Personen die Wertschät- zung der eigenen Person erhöhen, da sie sich keinem unrealistischen Idealbild gegenüberstel- len müssten. Der Vergleich mit weniger schlanken Frauen sollte zu einer positiveren Selbst- sicht und zu mehr Zufriedenheit mit dem Körper führen (vgl. Holmstrom, 2004, S. 214). Auch bei Frauen mit hohem Selbstwertgefühl dürften sich Abwärtsvergleiche positiv auf das Körperbild auswirken, jedoch in geringerem Maße, weil sich die Zufriedenheit relativ gese- hen weniger steigern lässt. Frauen mit niedrigem Selbstwertgefühl dürften somit tendenziell mehr von Abwärtsvergleichen profitieren (vgl. Schemer, 2007, S. 59-60).
Auch sehr offene und zuverlässige Menschen neigen zu selbstwertdienlichen Vergleichen, um ein (wenn auch nur kurzfristig) positives Gefühl aufrechtzuerhalten. Dieses Verhalten ist im medialen Bereich genauso relevant wie im sozialen Umfeld. Personen mit geringem Selbst- wertgefühl sollten ihre Vergleichsauswahl so treffen, dass sie auf unterlegene Personen sto- ßen, die Abwärtsvergleiche ermöglichen. Ist dies in den Medien nicht möglich, so kann auf Vergleichspersonen in interpersonalen Situationen zurückgegriffen werden. Oftmals erscheint jedoch der mediale Abwärtsvergleich einfacher als der interpersonale, da er leichter gesteuert werden kann und situationsunabhängig ist. Frauen, die in ihrer Persönlichkeit sehr offen für neue Erfahrungen sind, greifen eher zu Lateral- oder Aufwärtsvergleichen (vgl. Olson & Evans, 1999, S. 1504). Sie sind von Natur aus neugierig und benötigen neue Informationen. Es ist also denkbar, dass sich solche Frauen stark mit weiblichen Akteuren aus Informations- angeboten vergleichen. Als Motiv dient für diesen sozialen Vergleichsprozess vor allem eine realistische Selbstbewertung.
Neben den genannten Persönlichkeitsmerkmalen erweist sich auch das Geschlecht einer Per- son als wichtiges Differenzierungsmerkmal: Frauen neigen generell eher dazu, sich mit ande- ren zu vergleichen als Männer. Diese streben nach selbstwertdienlichen Vergleichen, wohin- gegen Frauen meist das Motiv der Selbstbewertung antreibt (vgl. Wheeler & Miyake, 1992, S. 761-771). Frauen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Motive der Mediennutzung grundle- gend von Männern (dies ist auch einer der Gründe, warum sich die experimentelle Untersu- chung in Abschnitt 6 auf weibliche Personen beschränkt). Eine Studie von Carlson Jones (2001) macht deutlich, dass Mädchen sich eher in Bezug auf ihr Aussehen mit Medienakteu- ren vergleichen als Jungen (vgl. Carlson Jones, 2001, S. 654). Das Motiv der Selbstverbesse- rung ist zudem vom Alter der vergleichenden Person abhängig. Studien lassen vermuten, dass Kinder im Vergleich zu Erwachsenen eher zu sozialen Aufwärtsvergleichen neigen. Dies hängt damit zusammen, dass sie sich noch stärker in der körperlichen Entwicklung befinden (vgl. Duck, 1990, S. 19-27). Es wird vermutet, dass Medien vor allem deshalb als Quelle so- zialer Vergleiche dienen, weil sie eine einfache Alternative gegenüber interpersonalen Ver- gleichen darstellen. Sie können zu einer Verbesserung des eigenen Befindens beitragen (vgl. Schemer, 2005, S. 93-95 und Schemer, 2007, S. 59-60).
Ein weiterer Einfluss auf soziale Vergleichsprozesse kann in der Ausprägung der weiblichen Selbstaufmerksamkeit liegen. Die Theorie der Selbstaufmerksamkeit geht von der Annahme aus, dass eine Person die Möglichkeit hat, den Fokus ihrer Aufmerksamkeit zum einen nach innen auf sich selbst und zum anderen nach außen auf die Umwelt zu richten. Dabei kann zwischen der privaten und der öffentlichen Selbstaufmerksamkeit unterschieden werden (vgl. Abschnitt 6.2.4.2.4). Personen mit hoher privater Selbstaufmerksamkeit nehmen ihre eigenen Gefühle und Gedanken intensiv wahr und reflektieren sich selbst (vgl. Merz, 1986, S. 142). Menschen mit hoher öffentlicher Selbstaufmerksamkeit hingegen sind sich der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Person bewusst, also dass sie von anderen beurteilt und bewertet werden (vgl. Merz, 1986, S. 142). Sie reflektieren fortlaufend ihre Wirkung auf andere und weniger sich selbst. Vergleicht sich eine solche Frau mit schlanken Personen, so wirkt sich dies nega- tiv auf ihr Körperbild aus (vgl. Thornton & Maurice, 1999, S. 384). Selbstaufmerksamkeit kann nicht nur Voraussetzung für soziale Vergleiche sein, sondern auch aus diesen hervorge- hen. Selbstaufmerksamkeit und soziale Vergleiche bedingen sich gegenseitig und können sich verstärken (vgl. Wegner, Hartmann & Geist, 2000, S. 1152). Insbesondere bei weiblichen Personen, die bereits unzufrieden mit ihrem Aussehen sind, wirken sich soziale Vergleiche mit schlanken Personen in der Regel negativ aus (vgl. Stice, Spangler & Agras, 2001, S. 284). Vergleiche können dazu führen, dass sich die vermittelten Vorstellungen von Schlankheits- idealen geistig verfestigen (Prozess der Internalisierung). Faktoren die zu dieser Verinnerli- chung beitragen sind beispielsweise die Wahrnehmung medialer Akteure als reale Personen, Sympathie und positive Begleiterscheinungen der Schlankheit im Alltag (z. B. beruflicher Erfolg). Je mehr soziale Vergleiche mit schlanken Personen stattfinden, desto eher werden Muster aufgenommen und können letztendlich zu selektiver Wahrnehmung bei den Rezipien- tinnen führen (vgl. Altabe & Thompson, 1996, S. 189). Es zeigt sich, dass soziale Aufwärts- vergleiche bei Frauen mit gedanklich verfestigten Schlankheitsidealen zu größerer Unzufrie- denheit, dem Wunsch dünner zu sein und zu Anzeichen von Bulimie und anderen Essstörun- gen führen können (vgl. Cattarin et al., 2000, S. 237 und Botta, 1999, S. 31-33). Als Vergleichsmotiv dient dabei zunächst die Selbstbewertung, an welche sich der Wunsch nach Selbstverbesserung anschließt.
2.3.6 Probleme bei der Untersuchung sozialer Vergleichsprozesse
Ein grundlegendes Problem der bisherigen Forschung im Zusammenhang mit sozialen Ver- gleichsprozessen liegt in der Methodik, da soziale Vergleiche schwer zu untersuchen sind. Haben sie überhaupt stattgefunden? Falls ja, sind sie verantwortlich für die Wirkung auf das Körperbild? In der Regel wird aus dem Ergebnis des Vergleichs darauf geschlossen, ob ein Auf- oder Abwärtsvergleich bzw. ein Lateralvergleich stattgefunden hat (vgl. Wood, 1996, S. 533-535). Die meisten Frauen bewerten ihren Körper schlechter, nachdem sie einem schlan- ken Peer oder Medienakteur gegenübergestellt waren. Man geht in diesem Fall von einem sozialen Aufwärtsvergleich aus. Wie die bisherigen Ausführungen jedoch gezeigt haben, kön- nen Vergleiche mit gleichgestellten, über- bzw. unterlegenen Personen sowohl zu positiven als auch zu negativen Konsequenzen bzgl. der Selbsteinschätzung führen. Es kann also keine pauschalisierte Schlussfolgerung von dem Ergebnis auf den Prozess gezogen werden. Dies ist auch der Grund, warum Probanden in Versuchsanordnungen aufgefordert werden, sich mit anderen Personen im Hinblick auf deren Schlankheit zu vergleichen und warum Kontrollgruppen gebildet werden, die von sozialen Vergleichen ablenken sollen (vgl. Tiggemann & McGill, 2004, S. 23-44). Dieses Vorgehen widerspricht jedoch der Realität, da Frauen im realen Leben nicht explizit zu Vergleichen aufgefordert werden, sondern diese weitgehend automatisch ablaufen. Trotz expliziter Aufforderungen zu sozialen Vergleichen in Bezug auf das Aussehen bleibt oft unklar, ob überhaupt soziale Vergleiche stattgefunden haben bzw. ob diese ursächlich für veränderte Körperbildwahrnehmungen der Frauen sind. Geeignete Versuchsanordnungen müssen sicherstellen, dass soziale Vergleiche stattfinden, die ursächlich für eventuelle Einflüsse auf das Körperbild sind.
Ein weiteres Problem liegt in der Moderatorfunktion des Selbstwertgefühles im sozialen Ver- gleichsprozess. Studien geben in der Regel keinen Hinweis auf den Prozess, der bei den Rezi- pientinnen zu Unzufriedenheit mit dem Körper geführt haben könnte (vgl. z. B. Patrick et al., 2004). Es stellt sich die Frage, welche Prozesse bei sozialen Vergleichen in Abhängigkeit vom Selbstwertgefühl ablaufen. Trotz Argumentationen auf Basis der Theorie sozialer Ver- gleichsprozesse ist nicht nachvollziehbar, wie das Selbstwertgefühl den Prozess moderiert. Körperliche Unzufriedenheit ist empirisch nicht eindeutig auf den Vergleichsprozess zurück- führbar. Auf Basis der Forschung zu interpersonalen Vergleichsprozessen kann nur hypothe- tisch modelliert werden, wie solche Prozessverläufe aussehen könnten: Studien bestätigen, dass Frauen mit hohem und niedrigem Selbstwertgefühl nach sozialen Abwärtsvergleichen ähnlich zufrieden sind. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Frauen mit niedrigem Selbstwertgefühl sehr stark von einem Abwärtsvergleich profitieren, wohingegen Frauen mit stabilem Selbstwertgefühl nur in geringerem Ausmaß Vorteile aus dem Vergleichsprozess ziehen. Letztlich pendeln sich beide Zufriedenheitsniveaus auf einem ähnlichen Level ein. Es wird jedoch vermutet, dass diese Zufriedenheit nicht auf dieselben Prozesse zurückzuführen ist. Trotz einiger Studien zur Moderatorfunktion des Selbstwertgefühls im Zusammenhang mit interpersonalen Vergleichen wurden die Prozesse noch nicht auf die Medienpsychologie und Vergleiche mit schlanken Medienakteuren übertragen. Sowohl empirisch als auch theore- tisch fehlt es an repräsentativen Analysen (vgl. Schemer, 2007, S. 60). Ohne geeignete Ver- suchanordnungen und Überprüfung moderierender Faktoren bergen Wirkungsnachweise sozi- aler Vergleiche stets die Gefahr von Fehlinterpretationen (vgl. Schemer, 2007, S. 65-66).
2.3.7 Zwischenresümee
Wie die Ausführungen deutlich machen, beruht Forschung zum Einfluss weiblicher Schlank- heit auf das Körperbild junger Frauen auf einer Vielzahl theoretischer Annahmen. Die vorge- stellten Ansätze erlauben es, Fragestellungen zur Wirkung auf Rezipientinnen aus unter- schiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Zunächst wurde auf den Kultivationsansatz einge- gangen, welcher auf die Vielseherforschung des Medienwissenschaftlers George Gerbner (1976) zurückgeht und unterstellt, dass gerade Menschen, die mehrere Stunden täglich fern- sehen dadurch kultiviert werden und die Welt so sehen, wie sie im Fernsehen vermittelt wird. Abschnitt 2.1 ging auf Kontrasteffekte ein. Studien auf Grundlage dieser Theorie gehen davon aus, dass für die Bildung eines sozialen Urteils Vergleichsstandards und kognitive Reize nötig sind, deren Kontextabhängigkeit sich auf die Wahrnehmung von nachfolgenden Reizen aus- wirkt. Bei der auf Albert Bandura zurückgehenden sozial-kognitiven Lerntheorie verläuft der Lernprozess in zwei Phasen, die sich in Aufmerksamkeits-, Behaltens-, Produktions- und Mo- tivationsprozesse differenzieren lassen (vgl. Abschnitt 2.2). Das auch als Modell-Lernen be- kannte Verfahren stellt den Einfluss von Umweltfaktoren anstelle intrapsychischer Verhal- tensdeterminanten in den Mittelpunkt und bezieht gleichzeitig die psychologische Konstituti- on eines Menschen während der Informationsverarbeitung im Lernprozess mit ein.
Da die experimentelle Studie dieser Arbeit auf der Theorie sozialer Vergleichsprozesse be- ruht, wurde diese in Abschnitt 2.3 besonders ausführlich dargestellt und auf Probleme bei deren Untersuchung eingegangen. Ihre zentrale Annahme besteht darin, dass Menschen das Bedürfnis verspüren, sich ihrer sozialen Umwelt angepasst zu verhalten. Es werden aber auch intrapsychische Komponenten und Motive der Rezipienten, sich den Reizen selbst zuzuwen- den, berücksichtigt. Die Motive Selbstbewertung, Selbstverbesserung und Selbstwertdienlich- keit sind dem eigentlichen Vergleich vorgelagert und an bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gekoppelt. Motive zielen darauf ab, den Vergleich in eine bestimmte Richtung zu lenken, um den gewünschten Zweck zu erfüllen. Vergleiche zwischen dem Selbst und anderen beeinflus- sen wie kaum ein anderer psychologischer Faktor menschliches Verhalten, Erleben und Emp- finden. Auch Fühlen, Handeln und die Frage, wie sich Personen selbst sehen, hängt in star- kem Maße von sozialen Vergleichen ab. Vergleiche mit schlanken weiblichen Personen be- einflussen, wie korpulent sich eine Frau einstuft, wie zufrieden sie mit sich selbst ist und welche Schritte sie gegebenenfalls unternimmt, um an Gewicht zu verlieren. Vergleiche mit anderen haben sehr vielseitige Konsequenzen und scheinen ständig präsent zu sein. Verarbei- ten Personen Informationen über sich selbst und über ihre Mitmenschen, tun sie dies auf ver- gleichende Art und Weise. Auch wenn andere beurteilt werden, vergleichen wir sie intuitiv mit uns selbst und aktivieren Wissen, das eine Beurteilung unseres Gegenübers erlaubt. Soziale Vergleiche laufen unmittelbar und spontan ab. Sie werden auch dann ausgeführt, wenn objektive Informationen vorhanden sind oder wenn der Vergleich keine für das Urteil relevanten Erkenntnisse liefert. Bei sozialen Vergleichen handelt es sich um fundamentale Prozesse, die seit etwa fünfzig Jahren im Fokus sozialpsychologischer Forschung stehen. Ihre Omnipräsenz und Vielseitigkeit legen nahe, dass sie als theoretische Grundlage für das im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Experiment gewählt wurden.
3 Begriffliche Grundlagen
Im Folgenden wird auf wichtige begriffliche Grundlagen im Kontext von Körperbild und Schlankheit eingegangen; Terminologien die im Zusammenhang mit abhängigen und prädis- ponierenden Variablen stehen werden differenziert, und es wird begriffliche Klarheit geschaf- fen. Dadurch soll vermieden werden, dass ungenaue Begriffsverwendungen bei den interes- sierenden Variablen dazu führen, dass Untersuchungen voneinander abweichen und Verglei- che der Ergebnisse erschweren. Es findet eine Vertiefung von grundlegendem Wissen für die experimentelle Untersuchung in Abschnitt 6 statt. Um besser verstehen zu können, welchen Einfluss Peers und Medienakteure auf das Körperbild von Frauen haben und warum diese meist sehr empfänglich für gesellschaftliche Ansprüche an das körperliche Erscheinungsbild sind, ist es zunächst wichtig, den Begriff „Körperbild“ zu erläutern. Dies erfolgt in Abschnitt
3.1. Im Anschluss daran werden in Abschnitt 3.2 die Begriffe „Attraktivität“ bzw. „Schlank- heit“ definiert und voneinander abgegrenzt. Es wird begründet, warum in den Ausführungen ausschließlich von Schlankheit gesprochen wird und die Terminologie Basis der empirischen Untersuchung ist. Im Rahmen des experimentellen Designs stellt sich die Frage, welche Kenngrößen geeignet sind, die Schlankheit von Medienakteuren, Peers und den Versuchsteil- nehmerinnen zu bestimmen. Abschnitt 3.3 erläutert wichtige Schlankheitskenngrößen und diskutiert deren Vor- und Nachteile. Das Gebiet der Körperbildstörungen ist ein weites Feld und wird in der Fachliteratur häufig sehr unterschiedlich verwendet. Da das Verständnis von Körperbildstörungen zentraler Bestandteil der Untersuchung, ihrer Auswertungen und mögli- cher Schlussfolgerungen ist, werden diese in Abschnitt 3.4 klassifiziert und Hintergründe dar- gelegt. Um Verständnis dafür zu entwickeln, wie gravierend sich mediale und interpersonale Einflüsse auf das weibliche Körperbild auswirken können, ist es zudem bedeutsam, Formen und Symptome von Essstörungen zu kennen. Abschnitt 3.5 rundet die Ausführungen mit einer kurzen Einordnung und Erläuterungen der vier bedeutsamsten Arten von Essstörungen ab.
3.1 Weibliches Körperbild
Die gesamte Beziehung, die ein Mensch zu seinem Körper hat, spiegelt sich in seinem Kör- perbild wider. Das Körperbild ist ein wichtiger Aspekt des Selbstkonzeptes (Wahrnehmung und Wissen um die eigene Person). Im Gegensatz zu objektiv messbaren Körpermerkmalen wie Größe und Gewicht ist das Körperbild letztlich ein Produkt der Vorstellungskraft. Kiener (1973) definiert das Körperbild als „eine psychologische Erfahrung, die sich auf die Gefühle und Haltungen (Einstellungen) dem eigenen Körper gegenüber konzentriert“ (Kiener, 1973, S. 336). Bis heute existiert vor allem in der englisch- und deutschsprachigen Fachliteratur keine einheitliche Meinung darüber, was genau die Bezeichnung „Körperbild“ (body image) eigent- lich umfasst (vgl. Roth, 1998; Thompson, 1990 und Shontz, 1974). Einige Autoren grenzen den Begriff von weiteren Bezeichnungen des Körpererlebens ab, wohingegen andere ihn rela- tiv allumfassend gebrauchen. Shontz (1974) unterscheidet beispielsweise zwischen body fan- tasy, body concept, body schemata, body ego und body image. Deutsche Forscher wie Kiener (1973) und Wiedemann (1986) hingegen grenzen die Begriffe „Körperbild“, „Körperschema“ und „Körper-Ich“ voneinander ab. In englischsprachigen Studien wird der Begriff body image meist für das Körperbild und Körperschema gleichermaßen benutzt. Strauss und Richter- Appelt (1996, 1986) differenzieren zusätzlich Kategorien wie „Körperbewusstsein“ (body awareness), „Körperausgrenzung“ (body boundary) und „Körperbesetzung“ (body cathexis). Ihrer Meinung nach schließt das Körperbild den Begriff „Körperschema“ als Vorstellung vom Äußeren des eigenen Körpers nicht mit ein. Der wesentliche Unterschied der beiden Begriffe „Körperbild“ und „Körperschema“ liegt nach Roth (1998) in der psychologischen Bedeutung: Das Körperbild ist persönlichkeitspsychologisch orientiert, das Körperschema hingegen wahrnehmungspsychologisch. Nach Bielefeld (1986) sollten beide Begriffe unter der überge- ordneten Bezeichnung „Körpererfahrung“ zusammengefasst werden (vgl. Bielefeld, 1986, S. 13-18). Mit großer Übereinstimmung können jedoch die unterschiedlichen Bereiche des Ver- hältnisses zum eigenen Körper als Körperbild subsumiert werden (vgl. hierzu eine differen- zierte Ausführung von Roth, 1998). Für das Untersuchungskonzept dieser Arbeit sollen in Anlehnung an neuere Literatur vor allem zwei Aspekte im Vordergrund stehen: das mentale Körperbild (Körperschema), das wir von der physischen Erscheinung haben, sowie Bewer- tungen und Gefühle bezüglich unseres Körpers. Das Körperbild ist somit kognitiv und emoti- onal zugleich, es kann einer Person bewusst wie auch unbewusst sein (vgl. Meermann, 1991, S. 70). Bereits bei Säuglingen verfestigt sich das Körperbild als Resultat zahlreicher körper- bezogener Erfahrungen. Während der Pubertät gewinnt das Aussehen zunehmend an Bedeu- tung und manifestiert sich weiter. Trotz genetischer Veranlagungen ist die Einstellung einer Person zu ihrem Körper vor allem durch die Gesellschaft geprägt. Besonders stark wirken dabei die Massenmedien, welche ein striktes und eng normiertes Körperleitbild präsentieren. Aufgrund der steigenden Bedeutung des körperlichen Erscheinungsbildes in unserer Gesell- schaft stehen Jugendliche und Erwachsene oftmals unter Druck, diesem Leitbild entsprechen zu müssen (vgl. Daszkowski, 2003, S. 10-13). Die soziale Bewertung kann sich sowohl posi- tiv als auch negativ auf das subjektive Körperbild junger Frauen und Männer auswirken: Be- steht zwischen den objektiv messbaren Körpermaßen und dem subjektiven Körperbild ein Missverhältnis (zum Beispiel denkt eine Person, sie sei übergewichtig, obwohl ihr BMI im Normalbereich liegt), spricht man von einer Körperbildstörung (vgl. Abschnitt 3.4). Da sich Männer und Frauen in ihrer körperlichen Entwicklung grundlegend unterscheiden, entwickelt sich auch das Körperbild geschlechterspezifisch. Schlanke Peers und Medienakteure können sich auf das Körperbild einer Frau anders auswirken als auf das eines Mannes. Aufgrund der ästhetischen Aufgabe ihres Körpers sind Frauen im Vergleich zu Männern meist unzufriede- ner mit ihrem Körper und wünschen sich eine schlankere Figur (vgl. Roth, 1998, S. 41-42). Während bei Männern Kraft und Leistungsfähigkeit des Körpers wichtig sind, steht bei Frau- en ein schlanker Körperumfang im Mittelpunkt (vgl. Argyle, 1985, S. 318).
Frauen haben häufig kein selbstbestimmtes Körperbild. Sie beobachten sich als diejenigen, die von ihrem Umfeld angesehen werden (vgl. Drolshagen, 1995, S. 26). Hinzu kommen ver- zerrte Körperbilder durch die ständige Auseinandersetzung mit medial und gesellschaftlich verbreiteten Idealen. Geht man davon aus, dass der Körper und Stimmungen einer Person in engem Zusammenhang stehen, so sind Frauen einem ständigem Ungleichgewicht ausgesetzt. Im Sinne des Bedeutungszuwachses von Schlankheit können sie nie genug für ihr Aussehen machen und tragen pausenlos ein Gefühl der Unzufriedenheit mit sich herum. Sie hinterfragen ihren Körper und nehmen sich selbst in der Regel negativer wahr als andere (vgl. Rodin, 1994, S. 23).
Das Aussehen wird in unserer Gesellschaft in den persönlichen Verantwortungsbereich der jeweiligen Person gestellt. Frauen haben zahlreiche Möglichkeiten, ihr Aussehen zu verän- dern und den Idealen der Gesellschaft anzupassen. Tun sie dies nicht bzw. entscheiden sich bewusst dagegen, so müssen sie mit negativen Folgen rechnen. Schuldgefühle entstehen durch Defizite zwischen Idealvorstellungen und der realen Situation. Betrachtet man den Körper als Kern unserer psychischen Identität, so wird deutlich, dass Frauen in Bezug auf Schlankheits- normen stark gefährdet sind, Minderwertigkeitskomplexe zu entwickeln (vgl. Rodin, 1994, S. 53). Sie neigen dazu, ihre gesamte Identität und den Wert ihrer Persönlichkeit über das Aussehen zu definieren.
[...]
1 Unter „Models“ werden im Folgenden weibliche Personen verstanden, deren Hauptaufgabe die direkte oder indirekte Präsentation ihres Körpers in den Medien zum Zwecke der Werbung und Verkaufssteigerung ist.
2 Der Begriff „Medienakteur“ steht im Folgenden als Sammelbegriff für alle in den Medien präsentierten (weiblichen) Personen wie beispielweise Models in der Werbung, Schauspielerinnen oder Moderatorinnen.
3 Unter „Peers“ werden im Folgenden Personen vergleichbaren Alters, gleichen Geschlechts und ähnlicher sozialer Herkunft (die eine Person nicht zwangsläufig persönlich kennen muss) verstanden.
4 In der vorliegenden Arbeit werden Hypothesen zu medialen Effekten anhand von Bildern schlanker weiblicher Models überprüft. Weibliche Models stellen nur einen Teilbereich von Medienakteuren dar. Im Rahmen der Untersuchung ist es jedoch aus zeitlichen und finanziellen Gründen nicht umsetzbar, alle theoretisch möglichen schlanken Medienakteure in das Experiment zu integrieren. Es findet eine Verallgemeinerung von Models auf Medienakteure statt, welche künftigen Studien Ansatzpunkte zur detaillierteren Überprüfung liefert.
- Arbeit zitieren
- Melanie Bussinger (Autor:in), 2009, Interpersonale und mediale Wirkung weiblicher Schlankheit auf das Körperbild junger Frauen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/207472
Kostenlos Autor werden






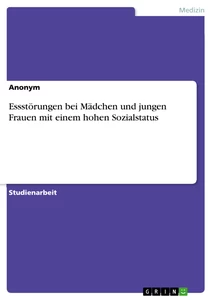













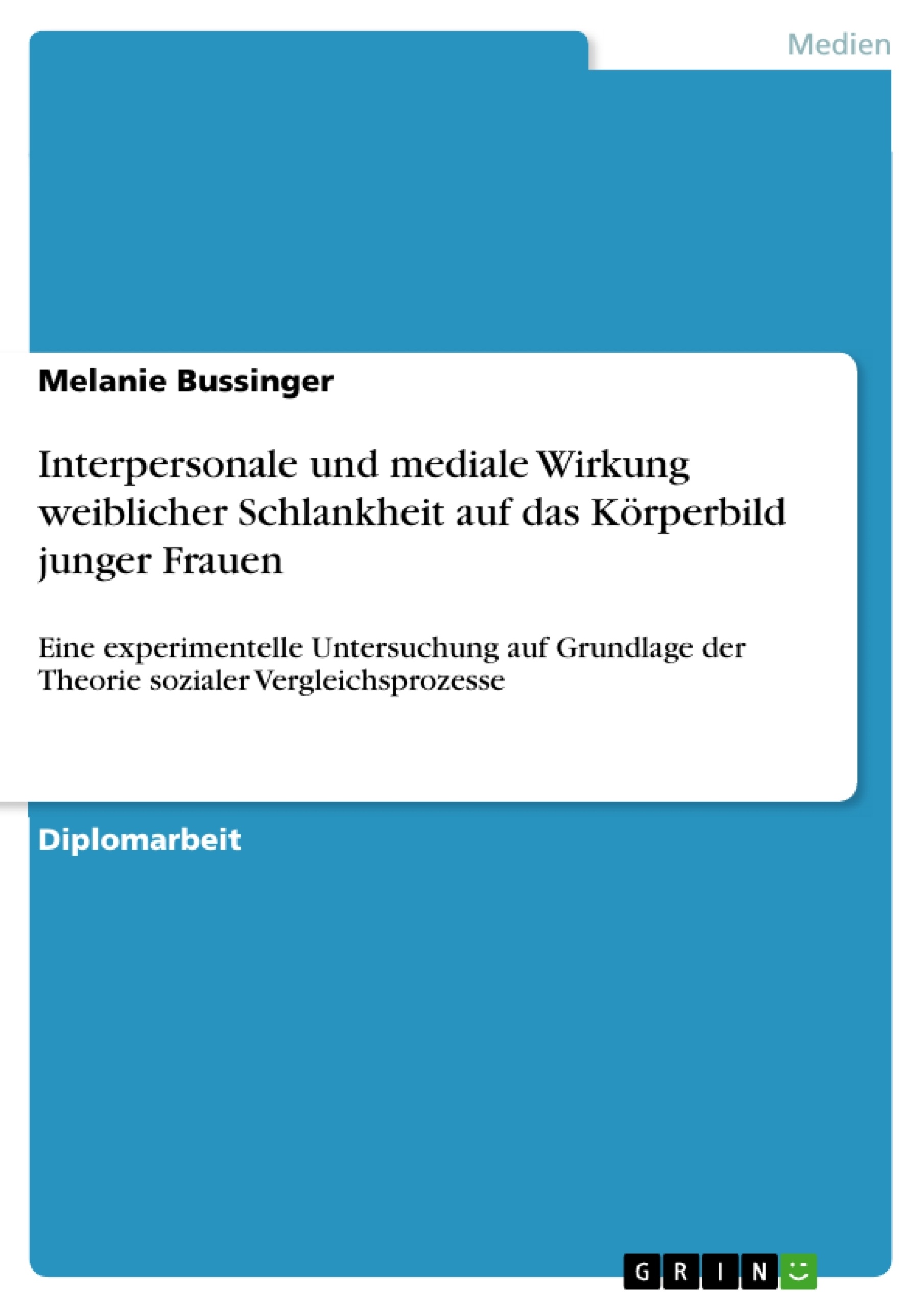

Kommentare