Leseprobe
Georg Heyms Erzählung „Der Irre“ ermöglicht uns, seiner Figur ganz nahe zu kommen, indem der Leser große Teile der Geschichte aus der Perspektive des wahnsinnigen namenlosen Protagonisten wahrnimmt. Wir haben also teil an seinem – eigentlich als Rachefeldzug gegen seine Frau geplanten – Amoklauf von der Anstalt Richtung Stadtzentrum, bei dem „unschuldige Bürger“ auf denkbar brutale Art ihr Leben lassen müssen. Unwillkürlich begibt man sich auf die Suche nach der Motivation des „Irren“ und letztlich auch nach der des Autors, der uns jede Mordtat des Verrückten so schonungslos präsentiert. Dabei stößt der geneigte Leser auf Hintergründe, die ihn zum „Großen, Ganzen“ um die Erzählung führen: Die gezielte und durchdachte Nutzung des „Wahnsinns“ durch den Expressionisten Georg Heym, um einen neuen, kritischen Blick auf die Gesellschaft seiner Zeit zu ermöglichen, in der der „Irre“ letztlich nicht Täter, sondern Opfer und Unterdrückter ist. In der folgenden Auseinandersetzung mit Heyms Erzählung sollen deshalb die Hinweise aus dem Text mit den bekannten expressionistischen Mustern abgeglichen werden, um die Figur des „Irren“ im passenden literaturhistorischen Rahmen zu betrachten und so auch Auskunft über die Intention des Autors geben zu können.
Wie in der Forschungsliteratur mehrfach betont wird, entsprach es nicht dem Wunsch Georg Heyms, mit der Darstellung des „Irren“ psychiatrisches Wissen anzuwenden oder den pathologischen Befund zu einer Fallgeschichte aufzuzeigen.[1] Vielmehr ging es dem Expressionisten darum, den Menschen im „Kern“, in seiner Ursprünglichkeit zu erfassen. Sulzgruber macht auf die grundsätzliche, wie er es nennt, „antipsychologische Einstellung“ der Autoren, die heute dem Expressionismus zugeordnet werden, aufmerksam: „Der Mensch ist nicht mehr Individuum, gebunden an Pflicht, Moral, Gesellschaft oder Familie, zu sehen.“[2] Gezeigt werden soll der „einfache, schlichte Mensch, ohne Zusammenhänge, ohne Milieu, ohne psychologische Weltanschauung.“[3] Damit erklärt sich auch, weshalb der Erzähler des Textes (auch aus einer auktorialen Perspektive, die er zeitweise einnimmt) so gut wie keine Angaben zu dem Wer, Wann und Wo des Textes macht: Der Leser erfährt über den „Irren“ lediglich, dass er zu Beginn der Geschichte just aus einer Anstalt entlassen wurde, um sich nun schnurstracks auf einen Rachefeldzug gegen seine Ehefrau zu begeben, der er die Schuld an seiner Einweisung gibt und möglicherweise zudem bezichtigt, ihn betrogen zu haben („Schlafburschenhure“, S. 30). Eine Spekulation über den Werdegang des „Irren“ erübrigt sich jedoch letztlich, da der Wahrheitsgehalt dessen, was er selbst an Hinweisen über seinen Fall liefert (seine Sicht zu den Ereignissen während des Anstaltsaufenthalts und der Zeit davor), vom Leser in Frage gestellt werden muss. Dieses „System des Weglassens“[4] von Hintergrundinformationen begründet Sulzgruber damit, dass es um das Bild des „Irren“ an sich, den „Irren in Reinkultur“ geht.[5] Zu Beginn der Erzählung scheint, wie Ihekweazu feststellt, „zunächst die Gesellschaft [eingangs repräsentiert durch Anstalt, Ärzte und Wärter, Anm. W. H.] den Sieg davongetragen zu haben“[6], indem der Wahnsinnige als geheilt entlassen wird. Doch der Erzähler lässt schon im zweiten Satz mit der Drohung des „Irren“ gegen die Welt keinen Zweifel, dass der Patient nur oberflächlich diszipliniert wurde. Kaum den Zwängen der Anstalt entkommen, tritt sein gewaltiges Aggressionspotenzial zutage. Was folgt, ist ein Wechsel von Wutanfällen (stets verbunden mit der Erinnerung des „Irren“ an die Zustände in der Anstalt und der Konfrontation mit negativen Gefühlen) und dem ekstatischen, rauschhaften Erleben der Welt – diese Übergänge sind für den Aufbau der gesamten Erzählung prägend. Mit den Gedanken an die Zwänge in der Anstalt, dem Leben „mitten unter Verrückten“ (zu denen sich der „Irre“ offensichtlich selbst nicht zählt[7]) und der Erinnerung an die eigene Ohnmacht gegenüber den Machenschaften von Ärzten und Wärtern, die nach Ansicht des „Irren“ das Verrücktwerden überhaupt erst provozieren („Das war ja rein zum Verrücktwerden“, S. 19), entladen sich Zorn und Hass in dem Entlassenen – Gefühle, die er nun mit Hingabe ausleben kann. Die Vertreter der autoritären Rationalität und Restriktion, die vergebens versuchten, den Geisteskranken zu kurieren, „straft“ er nun, indem er sich beim Gehen über die knackenden Halme eines Kornfelds vorstellt, ihre Schädel und Hirne zu zertreten. Dies ist, wie Ihekweazu feststellt, weiter gefasst als Kritik am „normaldenkenden“, angepassten Bürger zu verstehen, der sich stets durch Vernunft leiten lässt und den „Irren“, indem er ihm sein Denkprinzip aufzwängen will, in dessen Natur und „Lebensfülle“ hemmt – der gezielte Angriff auf Kopf und Hirn erscheint dem Wahnsinnigen nun als angemessene Maßnahme zur Ausschaltung des „feindlichen Prinzips“.[8] Die Visionen, die der „Irre“ während seiner Racheaktionen auslebt, versetzen ihn stets in eine selige Stimmung („Ach, es war wunderschön“, S. 21), oder, im Falle des Mordes an zwei Kindern, die ihm zufällig begegnen, gar in einen rauschhaften Zustand. Auch hier sind es wieder ihre Köpfe, auf die er es abgesehen hat – mit dem Unterschied, dass es sich nun um echte menschliche Schädel handelt, die er zertrümmert. Beim Anblick des fließenden Blutes fühlt er sich gottgleich, nachdem ihn die Kinder zuvor durch ihr Weinen mit seinen eigenen Ängsten in der Anstalt konfrontiert und aus seiner positiven Grundstimmung gerissen hatten. Nun erhält er mit der Umsetzung seiner Gewaltphantasien an den Schwächeren die Kontrolle zurück.[9] Das Gefühl der Macht lässt ihn „in Verzückung um die beiden Leichen herumtanzen“ (S. 23), es versetzt ihn in einen Zustand des „Außersichseins“, wie Schönert es beschreibt.[10] Gestaltet wird dieses Befinden mit dem Bild des Vogels, für den sich der „Irre“ immer dann hält, wenn er sich frei und glücklich fühlt („Dabei schwang er seine Arme wie ein großer Vogel“, S. 23; „Er […] schwebte wie ein Vogel in die Höhe hinauf“, S. 32; „Er war ein großer weißer Vogel“, S. 32). Aufkommen kann dieses Freiheitsgefühl nur mit der ungehemmten Entfaltung des „Irren“ in der Natur. Alles, was ihn an die Einschränkung durch seine Mitmenschen erinnert, und seien es auch zwei unbedarfte Kinder, lösen in ihm die negativen Gefühle der Angst, Wut oder Scham aus. Als ihm eine Frau begegnet, die er aus seiner Vergangenheit zu kennen glaubt, ist sein erster Impuls, die Bekannte anzusprechen – doch dieser Gedanke wird gleich darauf abgelöst durch Scham und, daraus erwachsend, erneut aufflammende unbändige Wut: „Er wollte sie ansprechen, aber er schämte sich. Ach, die denkt, ich bin ja der Verrückte aus Nr. 17. Wenn die mich wiedererkennt, die lacht mich ja aus. Und ich lasse mich nicht auslachen, zum Donnerwetter. Eher schlage ich ihr den Schädel ein.“ (S. 25). Auch hier richtet sich sein Zorn wieder auf den Kopf seines Opfers, das Zentrum jener Vernunft, die den „Irren“ in seiner Freiheit einschränkt. Der Hass auf den „Normalbürger“, der ihn in eine gesellschaftliche Außenseiterposition drängt, versetzt den Wahnsinnigen zum zweiten Mal in einen Blutrausch, der ihn zum „Raubtier“ und das chancenlose Opfer zu seiner Beute macht. Dass der „Irre“ jedoch durchaus auch flexibel auf eine Situation reagieren und die Kontrolle über sich behalten kann, zeigt die darauffolgende Passage: Ein alter Mann, der die blutige Leiche der Frau passiert und gleich darauf ihres offensichtlichen Mörders in Form des „Irren“, gewahr wird, vermag es in Geistesgegenwart, sich auf den Verrückten einzustellen und in dessen Welt einzutauchen, um sein eigenes Leben zu retten (S. 26):
„Am Ende wollte er es zuerst einmal mit Freundlichkeit versuchen. Denn mit dem da war es doch nicht ganz richtig, das sah man ja. ‚Guten Tag‘, sagte der Verrückte. ‚Guten Tag‘, antwortete der alte Mann, ‚das ist ja ein schreckliches Unglück.‘ ‚Ja, ja, das ist ein schreckliches Unglück, da haben Sie ganz recht‘, sagte der Verrückte. Seine Stimme zitterte. ‚Aber ich muß weitergehen. Entschuldigen Sie nur.‘“
[...]
[1] vgl. hierzu Werner Sulzgruber: Georg Heym „Der Irre“. Einblicke in die Methoden und Kunstgriffe expressionistischer Prosa. Erzählen aus der Perspektive des Wahnsinns. Wien 1997, S. 54 u. 61ff.; Edith Ihekweazu: Wandlung und Wahnsinn. Zu expressionistischen Erzählungen von Döblin, Sternheim, Benn und Heym. In: Orbis Litterarum 37 (1982), S. 327 und Jörg Schönert: „Der Irre“ von Georg Heym. Verbrechen und Wahnsinn in der Literatur des Expressionismus. In: Der Deutschunterricht 42 (1990), H. 2, S. 85.
[2] Sulzgruber (1997), S. 61.
[3] Ebd.
[4] vgl. Sulzgruber (1997), S. 31.
[5] Ebd.
[6] Ihekweazu (1982), S. 336.
[7] dies ist, wie Sulzgruber feststellt, als Krankheitsbefund zu bewerten, vgl. Sulzgruber (1997), S. 48.
[8] Ihekweazu (1982), S. 338f.
[9] Schönert (1990), S. 90.
[10] Ebd.
- Arbeit zitieren
- Wiebke Hugen (Autor:in), 2012, „Rein zum Verrücktwerden“ – Georg Heyms Figur des „Irren“ als Opfer gesellschaftlicher Zwänge, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/205716
Kostenlos Autor werden



















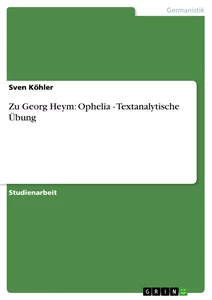
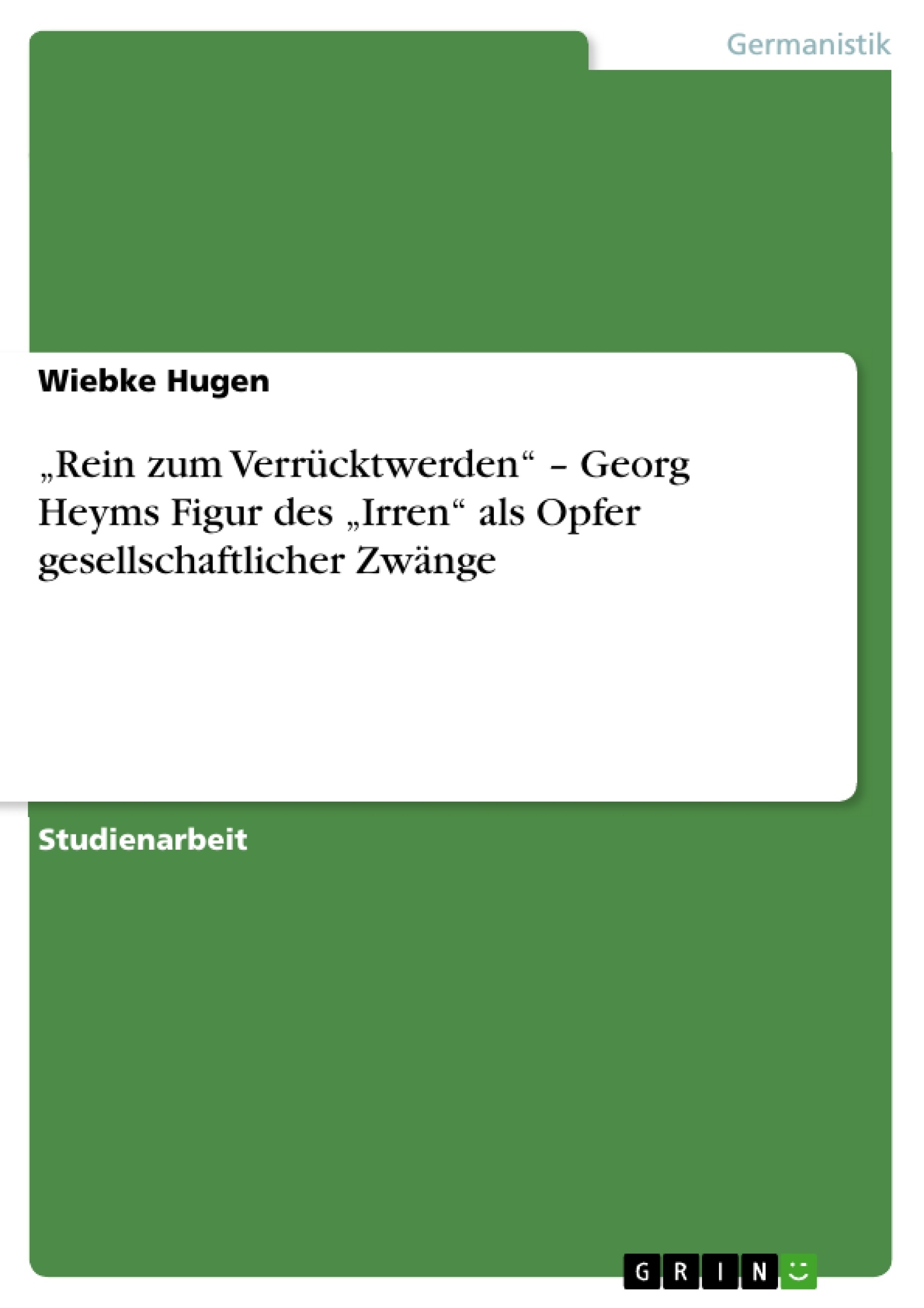

Kommentare