Leseprobe
I. Das Auge
Am Anfang war das Auge. So ließe sich in Abwandlung der Bibelworte sowohl das Schöpfungsprinzip von Alberto Giacometti als auch dasjenige von Samuel Beckett resümieren. In Heinz Bütlers bekanntem Dokumentarfilm Alberto Giacometti – Die Augen am Horizont erklärt Giacometti, dass er in seinen Werken stets mit der Darstellung der Augen begonnen habe, was sich in seiner Zeichnung Annette III von 1962 besonders gut nachvollziehen lässt (Abb. 1). Sie enthielten die Seele, weshalb sie nicht nur am schwierigsten darstellbar seien, sondern auch über das Gelingen der jeweiligen Arbeit entscheiden würden. Diese Feststellung impliziert ein persönliches Erlebnis, das Giacometti einige Jahre zuvor seinem Biographen James Lord geschildert hatte:
„Eines Tages, als ich ein junges Mädchen sah, fiel mit plötzlich auf, dass das einzige, was Leben hatte, der Blick war. Das übrige, der Kopf, der mir als Schädelform wichtig war, bedeutete mir nicht mehr als der Schädel eines Toten. In diesem Moment habe ich mich gefragt – und ich denke oft daran seither –, ob man im Grunde nicht besser einen Totenschädel modellieren sollte. Man will zwar einen lebenden Kopf modellieren, aber was ihn lebendig macht, das ist ohne Zweifel der Blick… Wenn der Blick – das heißt: das Leben – die Hauptsache ist, dann wird ohne Zweifel auch der Kopf zur Hauptsache.“[1]
Fünfhundert Jahre zuvor hatte schon Leonardo da Vinci die Augen als „Fenster zur Seele“ bezeichnet und damit die universelle Bedeutung dieses Organs hervorgehoben, die sich in der bildenden Kunst außerdem in der Darstellung des göttlichen Auges tradiert hat. Besonders häufig findet sich letztere in der ägyptischen Kunst (als Auge des Re und Udjat-Auge) wieder, die Giacometti bekanntlich Zeit seines Lebens als Inspirationsquelle diente. Die Schilderung seines visionären Erlebnisses erklärt also nicht nur, weshalb sich Giacometti in seinem Werk – trotz aller Abstraktionstendenzen – auf die figurative Plastik konzentriert hat, sondern sie erhebt auch den sich im Organ des Auges reflektierenden schmalen Grat zwischen Leben und Tod zu seinem künstlerischen Hauptthema. Evident werden diese Zusammenhänge in Giacomettis 1932 entstandener Plastik Stachel ins Auge (Abb. 2). Sie drückt die permanente Bedrohung des Lebens durch den Tod in der Konfrontation von Augenhöhle und überdimensioniertem Stachel aus, die sich in unmittelbarster Nähe und potentieller Aufeinander-zu-Bewegung befinden. Beide Elemente erscheinen gleichermaßen vital wie morbide: Der lebendige Kopf transformiert sich durch das Verlöschen des Auges zum Totenschädel, während das tote Objekt des Stachels durch die Bewegung zum Leben erweckt wird. Das Auge selbst aber, das in dieser Arbeit als ideeller Protagonist fungiert und in der ägyptischen Kunst u.a. als Talisman nahezu inflationär abgebildet wurde, hat Giacometti aufgrund der geschilderten Schwierigkeiten gerade nicht dargestellt. Seine Plastik drückt aus, dass das Sehen für den Künstler gleichbedeutend ist mit Leben und Schöpfung, während Blendung umgekehrt den Verlust von Schaffenskraft und die greifbare Begegnung mit dem Tod bedeutet.[2]
Um analoge Überlegungen kreist auch das literarische und filmische Werk des vielfach als „Augenmenschen“ bezeichneten irischen Schriftstellers Samuel Beckett. In einem seiner Hauptwerke, dem schlicht als Film betitelten Stummfilm-‚Drama‘ von 1963, steht ebenfalls das Auge als Sinnbild des Lebens im Zentrum (Abb. 3). Film beginnt und endet mit der Großaufnahme eines Auges, zu der das Drehbuch einleitend vermerkt: „Esse est percipi“ – „Sein ist wahrnehmen“.[3] Das herangezoomte Auge ist dasjenige des von Buster Keaton gespielten Protagonisten, der in Film tatsächlich nur über ein Auge verfügt. Das andere ist, wie in der später zu erläuternden Handlung ersichtlich wird, durch eine Augenklappe bedeckt und damit ausgeschaltet. Erläuternd heißt es dazu im Drehbuch:
„Wenn alle Wahrnehmung anderer – tierische, menschliche und göttliche – aufgehoben ist, behält einen die Selbstwahrnehmung im Sein. Die Suche nach dem Nicht-Sein durch Flucht vor der Wahrnehmung anderer scheitert an der Unausbleiblichkeit der Selbstwahrnehmung.“[4]
Allein das verbliebene Auge erhält den Protagonisten in Film also am Leben; jedes Schließen des Lides kann den Tod bedeuten. Die inhaltliche Verwandtschaft mit Giacomettis Plastik ist evident. Der im Drehbuch zu Film beschriebene Versuch, das Phänomen der Wahrnehmung künstlerisch zu erfassen, sowie das zwangsläufige Scheitern an dieser unlösbaren Aufgabe, bildet den Kern sowohl von Giacomettis als auch von Becketts künstlerischem Schaffen, wie nun zu zeigen ist.
II. Warten auf Godot
Giacometti, der seit 1922 in Paris lebte, und Beckett, der 15 Jahre später in die französische Hauptstadt zog, standen in persönlichem Kontakt. James Lord berichtet, dass sie sich 1951 im Café de Flore kennen lernten.[5] In der Folgezeit entwickelten sie bei ihren zufälligen Begegnungen, bei denen sie laut Giacometti oft bis zu sieben Stunden zusammen blieben,[6] eine tiefe gegenseitige Wertschätzung. Über die Inhalte ihrer Gespräche ist nichts überliefert. Bekannt ist aber, dass ihr intensiver Austausch zu Beginn der 1960er Jahre anlässlich der Neuinszenierung von Becketts Theaterstück Warten auf Godot zur künstlerischen Zusammenarbeit führte.
Becketts Stück, das 1953 in Paris uraufgeführt worden war, handelt von der Sinn- und Hoffnungslosigkeit des menschlichen Strebens. Es benennt im Titel unter Anspielung auf Gott einen gewissen Godot als Protagonisten, der den beiden tragikkomischen Figuren Wladimir und Estragon jedoch nie erscheinen wird. Während Wladimir ungeduldig auf Godot wartet und auch aus der Bibel zitiert, hat Estragon Godot bereits vergessen und möchte den öden Ort verlassen, der als Gegenentwurf zum Paradies konzipiert ist. Mit dem Bühnenbild, für das Beckett einen einzigen kahlen Baum vorsah, wurde Giacometti beauftragt. Der Arbeitsprozess war intensiv: Giacometti entwarf kleinere und größere Varianten des Baumes, die er eingehend mit Beckett diskutierte. Bei jeder waren sie sich einig, dass es „vielleicht“ die passende sei. Irgendwann wurde der gipserne Baum schließlich auf die Bühne gestellt; – „vorläufig“, wie beide meinten, was soviel hieß wie: als für die Inszenierung verwendbare Kompromisslösung. Die Entstehungsgeschichte des Bühnenbildes für Warten auf Godot legt also nahe, dass die Ästhetiken von Giacometti und Beckett Übereinstimmungen aufweisen. Versuche eines Vergleichs sind verschiedentlich unternommen worden, unter anderem von Marianne Kesting in ihrem richtungsweisenden Aufsatz Eternisierung der Fluktuation von 1981,[7] oder von Manfred Milz in seiner 2006 erschienenen Dissertation Samuel Beckett und Alberto Giacometti – Das Innere als Oberfläche. Ihre Ergebnisse sind jedoch erweiterbar, wie die eingangs angestellten Überlegungen zur zentralen Bedeutung des Auges in Giacomettis und Becketts Werk bereits gezeigt haben.
Während sich Becketts Ästhetik nahezu im Gesamtwerk von Giacometti spiegelt, berührt Giacomettis Ästhetik hingegen lediglich zentrale Teile von Becketts Werk. Dabei erklären sich die Analogien weniger durch eine gegenseitige Beeinflussung als vielmehr durch eine gemeinsame Problemlage. Deren Wurzeln sind wiederum nicht im Kontakt der beiden Künstler zum Kreis der Existentialisten zu suchen, da sich weder Giacomettis noch Becketts Ästhetik zur Illustration philosophischer Lehren eignet. Sie basiert vielmehr auf persönlichen Erfahrungen, vor deren Horizont die beiden Künstler eine Sicht der Welt entwerfen, die sich der Begrifflichkeit – und damit dem Begreifen im buchstäblichen Sinn – zu entziehen versucht. Maßgeblich dafür war die frühe Begegnung Giacomettis und Becketts mit dem Tod.[8]
III. Der Tod
Giacometti wurde zum ersten Mal 1921 im Alter von 19 Jahren mit dem Tod konfrontiert. Er befand sich auf eine Reise nach Italien in Begleitung des knapp 40 Jahre älteren Niederländers Pieter van Meurs, den er einige Monate zuvor während einer anderen Reise im Zug kennen gelernt hatte. Als die beiden in einem Bergdorf Zwischenstation machten, bekam van Meurs plötzlich heftige Schmerzen. Nach kurzer Bettlägerigkeit starb er nachts im Beisein von Giacometti an Herzversagen. In dieser Nacht, so überliefert James Lord, „hatte sich etwas grundlegendes in Giacomettis Leben geändert. […] Jetzt hatte er die Erfahrung des Todes gemacht. Der Tod war ihm einem Augenblick lang vor Augen getreten mit seiner grausamen Macht, die das Leben in ein Nichts verwandelt. […] Wo vorher ein Mensch gewesen war, blieb nur noch ein Gegenstand; was soeben noch wertvoll […] gewirkt hatte, war jetzt verbraucht und sinnentleert. Giacometti hatte erkannt, dass der Tod in jedem Moment möglich war. Von diesem Augenblick an schien alles andere ebenso verletzbar wie van Meurs. Alles war in seiner Existenz bedroht, vom kleinsten Stück Materie bis zu den größten Galaxien […], und gerade das menschliche Leben schien besonders dem Zufall ausgeliefert, dem unbegreiflichen Schicksal. In der Nacht konnte Giacometti keine Ruhe finden, er wagte nicht einzuschlafen aus Angst, selbst nicht mehr aufzuwachen. Er fühlte sich von der Dunkelheit bedroht, als ob das Verlöschen des Lichts dem Verlöschen des Lebens gleichkäme, als ob mit dem Nicht-mehr-Sehen die Realität völlig verginge. Giacometti ließ die ganze Nacht hindurch das Licht brennen; immer wieder gab er sich einen Ruck, um wach zu bleiben; hin und wieder nickte er trotzdem ein. Im Halbschlaf schien es ihm plötzlich, als ob ihm der Mund offen stünde wie der eines Toten, und er fuhr erschreckt hoch; auf diese Weise, immer zwischen Wachen und Einschlafen, ging es fort bis zum Morgengrauen.“[9] Seit dieser Begebenheit ließ Giacometti beim Zubettgehen das Licht brennen, als könne er den Tod damit auf Distanz halten. Wie einschneidend dieses Erlebnis für ihn gewesen ist, wird ferner in einem Alptraum deutlich, der das Ereignis 25 Jahre später rekapituliert. Giacometti beschreibt ihn unter Betitelung des Toten als T. in seinem Text Der Traum, das Sphinx und der Tod von T. 1946 wie folgt:
„Ich sah T. vor mir, wie er […] tot dalag, die bis auf die Knochen abgemagerten Glieder von sich gestreckt, den Kopf in den Nacken geworfen und mit offenem Mund. Noch nie war mir eine Leiche so nichtig erschienen, ein jämmerlicher Überrest, den man wie einen Katzenkadaver in den Straßengraben wirft. Reglos stand ich an seinem Bett und betrachtete diesen Kopf, der zu einem Gegenstand, einem kleinen Kasten, etwas Messbarem, bedeutungslosen geworden war. […] Als ich in der darauffolgenden Nacht in mein Zimmer kam, stellte ich fest, dass durch einen seltsamen Zufall kein Licht brannte. […] Die Leiche war noch im Zimmer nebenan. Das fehlende Licht war mir unangenehm, und als ich nackt über den finsteren Korridor gehen wollte, der am Zimmer des Toten vorbei zur Toilette führte, packte mich kaltes Grausen. Obwohl ich nicht recht daran glaubte, hatte ich das unbestimmte Gefühl, T. sei überall –– überall, nur nicht in der jämmerlichen Leiche auf dem Bett, jener Leiche, die mir so nichtig erschienen war. T. war grenzenlos geworden […]. Was ich soeben erlebt hatte, war das Gegenteil von dem, was mir einige Monate zuvor mit den Lebenden widerfahren war. Damals begann ich, Köpfe im Leeren zu sehen, im Raum, der sie umgibt. Als ich zum erstenmal deutlich wahrnahm, wie der Kopf, den ich anschaute, erstarrte, völlig bewegungslos wurde und endgültig im Augenblick verharrte, begann ich vor Grauen zu zittern wie noch nie in meinem Leben […]. Das war kein lebendiger Kopf mehr, sondern ein Gegenstand, den ich betrachtete […] wie etwas, das gleichzeitig tot und lebendig ist. […] Alle Lebenden waren tot, und diese Vision wiederholte sich oft, in der Metro, auf der Straße, im Restaurant, beim Anblick meiner Freunde.“[10]
Elf Jahre nach dem Tod von Pieter van Meurs hatte Giacometti eine weitere, körperlich noch unmittelbarere Begegnung mit dem Tod. Nach einem fröhlichen Abend im Café du Dôme, an dem er mit Bekannten aus dem Dada- und Surrealistenkreis zum ersten und einzigen Mal in seinem Leben Drogen genommen hatte, erwachte er am nächsten Morgen in einer fremden Wohnung neben der erkalteten Leiche des jungen Künstlers Robert Jourdan, der über Nacht an den Folgen des Drogenkonsums gestorben war.[11] Auch diese Erfahrung dürfte in seinen späteren Alptraum eingeflossen sein.
Im Jahr darauf, 1933, starb Giacomettis Vater.[12] Das Gefühl der Betäubung nach diesem dritten Todeserlebnis drückt Giacometti kurze Zeit später in den folgenden stakkatohaften Zeilen aus:
„Ich habe keine Angst mehr / gar keine Angst mehr, / früher habe ich gezittert / abends, nachts / dauernd verfolgte mich / der Tod, quälte mich, / jetzt nichts, / das ist schlimmer, das ist / entsetzlich, diese Ruhe.“[13]
Diese Erlebnisse, die den Tod in Giacomettis Wahrnehmung als stete Bedrohung erscheinen ließen, haben sein künstlerisches Werk nachhaltig beeinflusst. Vier Jahre nach dem Tod von Pieter van Meurs, den er während der Krankenwache mehrfach gezeichnet hatte, malt Giacometti einen Totenschädel in bildfüllender Größe.[14] Nach dem Tod seines Vaters entsteht die ersten Schädel-Plastiken mit leeren Augenhöhlen und auf die Totenstarre verweisenden offenen Mündern, wie Kopf auf einem Stab von 1947 (Abb. 4). Dieses Motiv wird Giacometti über 20 Jahre beibehalten, wie beispielsweise das um 1950 entstandene Gemälde Kopf belegt.[15] Außerdem drückt er die Vergänglichkeit des menschlichen Körpers in der Gesamterscheinung seiner Figuren aus, wie sein Gemälde des skeletthaften Stehenden Aktes von 1959 zeigt (Abb. 5). Nicht zuletzt deckt sich Giacomettis Wahrnehmung des menschlichen Körpers auch mit den Erfahrungen aus seiner bildhauerischen Praxis. Seine Figuren bauen sich von einem inneren Gerüst her auf, wie im Atelier entstandene Fotografien belegen (Abb. 6). Der erste Schritt des künstlerischen Schaffens bestand für Giacometti also in der Konstruktion des Skeletts, auf den anschließend das Hinzufügen des gipsernen Fleisches zur Verlebendigung der Figur folgte.[16]
Wie Giacometti ist auch Beckett früh dem Tod begegnet. Sein Vater starb im gleichen Jahr wie Giacomettis Vater, und für den damals 27-jährigen Beckett war dies ebenfalls ein traumatisches Erlebnis. In seinem zwei Jahre zuvor verfassten Essay Proust, eine der frühesten Studien über Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit und zugleich ein Schlüssel zu Becketts eigenem Werk, hatte er den Tod bereits wie folgt reflektiert:
„Welche Meinung auch immer wir über den Tod haben mögen, wir können uns darauf verlassen, dass sie bedeutungslos und wertlos ist. Der Tod hat nicht von uns verlangt, ihm einen Tag freizuhalten.“[17]
Auch Beckett nahm den Tod also als konstante Bedrohung wahr, zu der er hier jedoch noch eine gewisse Distanz ausdrückt. Dies ändert sich mit dem Tod seines Vaters, der ihm die Endlichkeit der menschlichen Existenz unmittelbar vor Augen führt. Seit diesem Erlebnis zweifelt Beckett an der äußeren Erscheinung der Dinge. Er misstraut dem scheinbaren Glück und versucht, sich vor dessen Trugbildern durch emotionale Distanz zu schützen. Dazu geht er als Schriftsteller ins Ausland, um in anderen Sprachen als seiner Muttersprache zu schreiben.[18]
Giacometti hält Beziehungen ebenfalls gern auf Distanz, wie seine Kontakte zum Rotlichtmilieu und seine Gewohnheit belegen, seinen einsamen Schlafplatz im Atelier auch nach der Hochzeit beizubehalten.[19] Den Schweizer Bildhauer und den irischen Schriftsteller verbindet demnach eine innere Einsamkeit, die Beckett schon früh als Grunddisposition des Künstlers beschrieben hat. In seinem Proust -Essay hat er die Kunst als „Apotheose der Einsamkeit“ definiert, denn es gibt ihm zufolge „keine Kommunikation“, weil es „kein Vehikel der Kommunikation gibt.“[20]
Beckett verbringt seine ersten Auslandsjahre in einfachsten Verhältnissen in London, wo ihm die Abneigung der Engländer gegen die Iren zu schaffen macht. Später lebt er in Deutschland, bis ihn die antisemitische Stimmung und die Kriegsvorbereitungen vertreiben. Im Herbst 1937 lässt er sich schließlich – nur unterbrochen durch die Kriegsjahre – endgültig in Paris nieder. Er beginnt, in Französisch zu schreiben und sich auf seine Wahlheimat einzulassen. Sein Leben scheint harmonisch und beständig zu werden – bis ihm eine unerwartete Begegnung, die ihn selbst dem Tode nahe bringt, die Aussichtslosigkeit dieser Erwartung vor Augen führt. Als er eines Tages mit Freunden die Avenue d´Orléans entlanggeht, spricht ihn ein Unbekannter an und bedrängt ihn so hartnäckig, dass Beckett ihn von sich stößt. Daraufhin zieht der Unbekannte ein Messer und sticht zu. Er verletzt Becketts Lungenflügel, was einen längeren Krankenhausaufenthalt erforderlich macht. Nach seiner Genesung wird Beckett zum Prozess gegen den Angreifer vorgeladen und fragt ihn bei dieser Gelegenheit nach dem Motiv für seine Tat. Die erschreckend lapidare Antwort lautet: „Das weiß ich nicht, mein Herr“.[21]
[...]
[1] James Lord: Alberto Giacometti: Die Biographie, Frankfurt/Main 2011 (1München 1987), S. 376.
[2] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 127.
[3] Elmar Tophoven/Erika Tophoven/Erich Franzen (Hrsg.): Samuel Beckett: Hörspiele. Filme, Frankfurt/Main 1995 (1Frankfurt/Main 1976), S. 105-121, hier S. 105.
[4] Tophoven/Tophoven/Franzen 1995 (wie Anm. 3), S. 105.
[5] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 173.
[6] Marianne Kesting: Die Eternisierung der Fluktuation. Über den Prozeß der Wahrnehmung bei Beckett und Giacometti, in: Das Kunstwerk. Zeitschrift für moderne Kunst, 2 XXXIV 1981, Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz,
S. 33-38, hier S. 33.
[7] Wie Anm. 6.
[8] Kesting 1981 (wie Anm. 6), S. 33f.
[9] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 57-58.
[10] Christoph Vitali (Hrsg.): Alberto Giacometti: Werke und Schriften [erschienen anlässlich der Ausstellung Alberto Giacometti 1901 - 1966, Skulpturen, Gemälde, Zeichnungen und Druckgraphik, Schirn Kunsthalle, Frankfurt/Main], Zürich 1998, S. 146-147.
[11] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 123-125.
[12] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 134-135.
[13] Vitali 1998 (wie Anm. 10) , S. 213.
[14] Schädel, 1925, Öl auf Leinwand, 30 x 24 cm, Privatsammlung, Paris.
[15] Öl auf Leinwand, 46 x 37,5 cm, Privatsammlung.
[16] Giacometti notierte 1945: „Es gibt […] Plastiken, die einen grauen Raum regloser Stille erzeugen, andere einen kompakten Raum aus Finsternis, als seien sie als Negativform aus einer schwarzen Masse herausgearbeitet.“ Vitali 1998 (wie Anm. 10), S. 141.
[17] Samuel Beckett: Proust. Essay, Zürich/Hamburg 1960/2001 (1London 1931), S. 14.
[18] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 171.
[19] Lord 2011 (wie Anm. 1), S. 397f.
[20] Beckett 1960/2001 (wie Anm. 17), S. 57.
[21] Lord 2011 (wie Anm. 2), S. 172.
- Arbeit zitieren
- Marion Bornscheuer (Autor:in), 2012, Die Verwandtschaft der ästhetischen Prinzipien von Alberto Giacometti und Samuel Beckett, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/204857
Kostenlos Autor werden











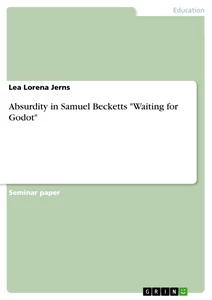




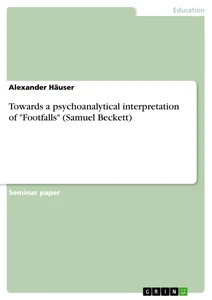




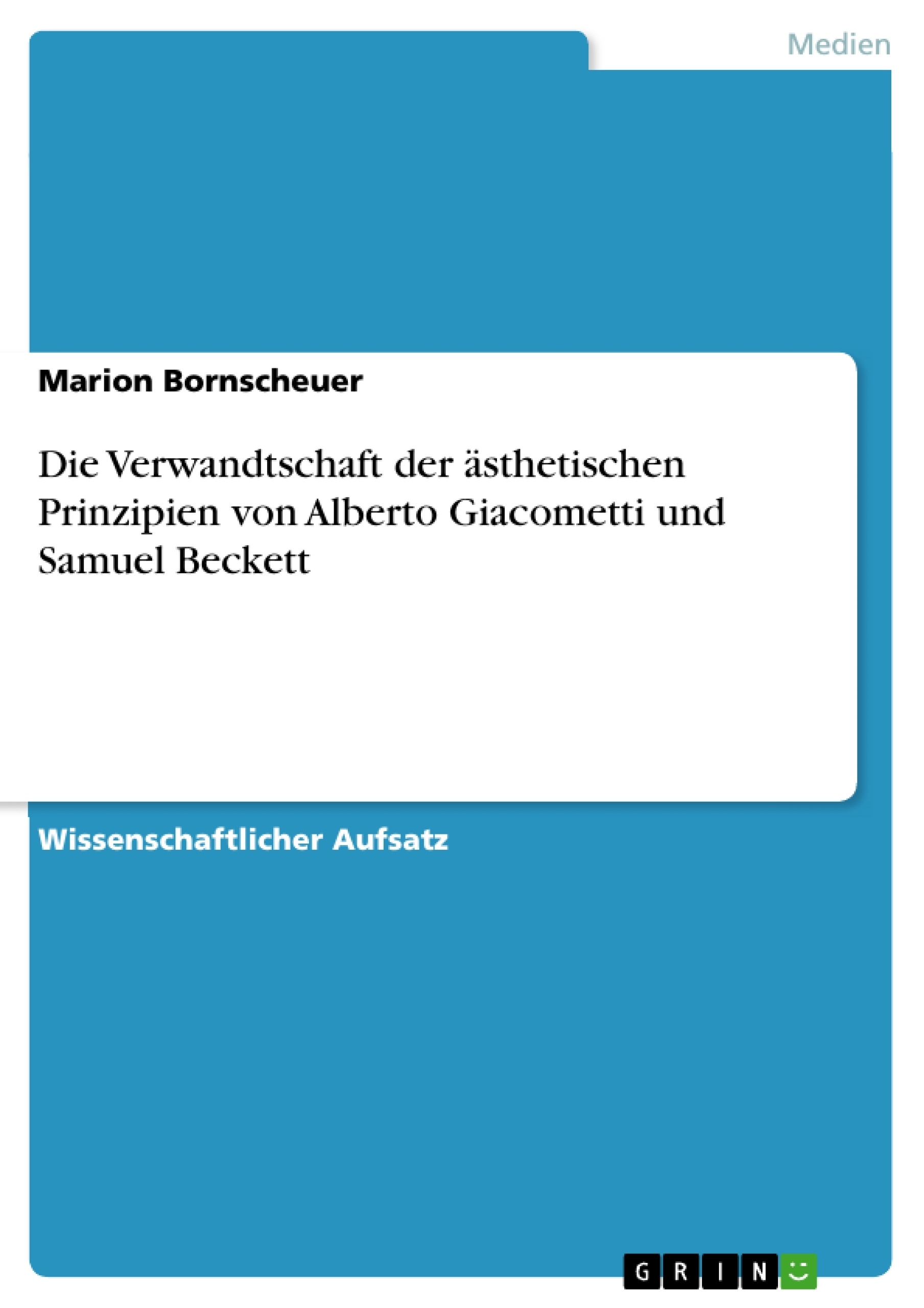

Kommentare