Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einführung
2. Gestaltpädagogik und aktuelle Situation in der Jugendhilfe
2.1. Die Reformen in der Heimerziehung
2.2. Gestaltprinzipien in der Pädagogik
2.3. Jugend im Wandel
2.4. Die Belastungen des Pädagogen in der Jugendhilfe
2.5. Integration therapeutischer Methoden in den pädagogischen Alltag
Die Entwicklung therapeutischer Arbeit in der Jugendhilfe
Das medizinische Modell
Ist therapeutisches Vorgehen eigentlich nötig ?
Die Integration therapeutischer Methoden
3. Erziehungshaltung
3.1. Humanismus in der Erziehung
3.2. Antiautoritäre Erziehung
Welche Grundideen hat die antiautoritären Erziehung?
3.3. Demokratische Erziehung
3.4. Konfluente Erziehung
3.5. Die Erziehungshaltung des Gestaltpädagogen
4. Prinzipien der Gestaltpädagogik
4.1. Bezug zur Gestalttherapie
4.2. Die Gestaltbildung und Figurbildung
Vordergrund – Hintergrund
Konsistenz
Prägnanz
Bedeutung für die Pädagogik
4.3. Homöostase
Psychische Bedürfnisse
Ein Recht zur Vermeidung
4.4. Der ganzheitliche Mensch
Ganzheitliche Wahrnehmung
4.5. Die Wirkung der Umwelt
Umwelt, Handlung und Interaktion
Feldtheorie und Diagnostik
4.6. Das Hier-und-Jetzt-Prinzip
Wirkung der Vergangenheit
Veränderung in der Gegenwart
4.7. Die Bewusstheit
Bereiche der Bewusstheit
Die Bedeutung für die Pädagogik
4.8. Der Orientierungsrahmen der Gestaltpädagogik
Der Nutzen von Theorie
Die Theorie vom Gestaltzyklus des Erlebens
Die Bestandteile des Gestaltzyklus
Der Zyklus am Beispiel aus der Jugendhilfe
Der Pädagoge in der Konfliktsituation
5. Die Arbeit mit Gruppen
5.1. Gestaltansatz und Gruppentheorien
5.2. Das TAO menschlicher Beziehungen
5.3. Ab wann ist eine Gruppe eine Gruppe?
5.4. Der Gestaltzyklus des Erlebens in der Gruppe
5.4. Die Gruppe im Gestaltzyklus des Erlebens
5.4.1. Interessen und Figurbildung
5.4.2. Aktivierung
5.4.3. Handlung und Kontakt
5.4.4. Abschluss und Rückzug
6. Das Erleben des Pädagogen
6.1. Die PädagogIn und der Gestaltzyklus des Erlebens
6.2. Diagnostik oder Hypothesenbildung
7. Psychische Entwicklung und Störungen
7.1. Das Energiekonzept
7.2. Vermeidung
7.3. Psychische Störungen junger Menschen in der Jugendhilfe
7.4. Die gesunde psychische Entwicklung
7.5. Störungen in der psychischen Entwicklung
7.6. Neurotische Störungen
8. Schlusswort
Literaturliste
Vorwort
Schriftliche Darstellungen sind im Grunde „graue“ Theorie. Gestaltpädagogik in einem Buch zu vermitteln erscheint darum widersprüchlich, denn sie fordert prinzipiell zum bewussten Erleben in der Gegenwart – im „Hier-und-Jetzt“ auf. Mein Ziel soll darum der Versuch sein, den Leser und die Leserin mit meiner Darstellung für das zu gewinnen, was ich eigentlich für wesentlich halte, nämlich Gestaltpädagogik selbst zu erleben. Dieses Interesse möcht ich durch praktische Beispiele wecken, die nach meiner Erfahrung auch von Ungeübten nachzuvollziehen sind. Sie sind hiermit eingeladen, wann immer Sie sich darauf einlassen mögen, eines meiner Übungsangebote wahrzunehmen - in Ihren eigenen vier Wänden oder an Ihrem Arbeitsplatz - und dadurch sich selbst oder die Menschen in Ihrer Umgebung noch etwas mehr kennen zu lernen.
Bei den Selbsterfahrungsübungen kann es dennoch immer wieder geschehen, dass Sie eine der Übungen vor ein Problem stellt und/oder Sie sie nicht versuchen wollen. Mögliche Ursache sind, dass Sie ihren Sinn nicht erkennen, keine Lust haben, sie auszuprobieren oder Sie eine emotionale Belastung erkennen oder befürchten. Lassen Sie sich in solchen Augenblicken nicht von einem Zwang leiten, z.B. Leistung erbringen zu wollen oder zu müssen, sondern vertrauen Sie auf ihre Gefühle. Es besteht in diesen Fällen keine Notwendigkeit eine Übung unbedingt auszuführen. Jeder Zwang ist gerade bei Selbsterfahrungsübungen absolut contraindiziert und verhindert vielmehr, was angestrebt wird.
Alle Übungen, die ich Ihnen hier anbiete, sind in dieser oder in abgewandelter Form in meinen Seminaren für Gestalttherapie oder Gestaltpädagogik erprobt worden. Entweder habe ich sie in meiner eigenen Ausbildung selbst erfahren, aus der Literatur abgeguckt und für meine Zwecke abgewandelt oder selbst entworfen. Im Wesentlichen sind sie für die Fortbildung von Therapeuten oder Pädagogen gedacht, aber teils auch für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen geeignet. Sie sind so angelegt, dass aus ihrer Erprobung kein Schaden entstehen kann. Darum trauen Sie sich ruhig, ihre Anwendung auch in ihrem Arbeitsalltag auszuprobieren. Sind sie sich an einem Punkt dennoch unsicher, dann gilt auch hierfür, die Übung einfach wegzulassen. Wollen Sie die Übungen für die Selbsterprobung oder für die Anwendung bei der Arbeit abwandeln, so sollten Sie ihrer Kreativität nichts in den Weg stellen. Beachten Sie aber grundsätzlich das Freiwilligkeitsgebot: Niemand darf zu einer Übung gezwungen werden, auch nicht durch Überredung, denn mit jedem Zwang durchbricht man die Fähigkeit des Menschen, seine psychische Belastung zu regulieren und schafft Risiken, die sonst nicht vorhanden wären.
Besonders würde ich mich natürlich freuen, wenn ich Sie anregen kann, in ihrem Beruf in Zukunft selbst mit Gestaltpädagogik zu arbeiten. Aber seien Sie versichert, wenn Sie lediglich dieses Buch lesen oder sich ausschließlich theoretisch mit Gestaltpädagogik und Gestalttherapie auseinandersetzen, bleiben sie an der Oberfläche ihrer Möglichkeiten. Erleben Sie ein weitergehendes Interesse, dann lassen Sie sich nicht abhalten, entweder die Teilnahme an einer Gestaltselbsterfahrungsgruppe oder eine Ausbildung in Gestaltpädagogik oder -therapie anzustreben.
1. Einführung
Als ich Arno das erste Mal sah, war er 15 Jahre alt. Damals trug er ausschließlich schwarze Kleidung und am liebsten lange Lederhosen. Seine Jacken und Hosen waren mit silbernen Ketten behängt und seine Haare pflegte er aufwendig, machte sie mit irgendeinem Mittel steif, so dass sie sich wie ein Hahnenkamm aufrichten ließen. Er war nicht der erste „Punk“, dem ich begegnete, aber ich hatte vorher keinen so intensiven Kontakt zu jungen Menschen mit einem solchen Äußeren und solchen Verhalten gesucht. Arnos Verhalten und seine ganze Selbstdarstellung wirkten auf mich so, dass ich mich abgelehnt und provoziert fühlte, und ich habe ihm gegenüber diese ablehnenden Gefühle erwidert, freilich ohne dass ich mir dessen anfangs bewusst war. Dabei war sein Verhalten bei seinen früheren Erlebnissen völlig verständlich. Er war in das Jungenheim, in dem ich als Psychologe arbeitete, aufgenommen worden, weil er in seinem Elternhaus nicht mehr zurechtkam. Sein Vater war, wie er mir später erzählte, aggressiv und streng. Arno bezeichnete ihn als "alten Nazi". Der Vater hatte ihn häufig verprügelt und Arno hatte den Eindruck entwickelt, ihm würde „alles“ verboten. Er hatte aber nicht kapituliert, sondern sich selbst eine abweisende und aggressive Haltung zugelegt, mit der er jetzt seinerseits seine Umwelt traktierte. Sätze, wie: „Willst du mich anmachen?“, „Ihr macht mich nicht platt“ oder „Verpisst euch, ich komme alleine klar“, waren seine Standards, die er auch mir gegenüber gebrauchte. Er benutzte sie, egal ob sie gerade auf die Situation passten oder nicht.
Arnos Haltung hat mich damals verärgert. Ich war der Meinung, gute Absichten mit ihm zu haben, wollte ihm helfen und er lehnte mich ab. Ich habe diese Ablehnung zwar von anderen Jugendlichen später noch häufig erfahren, aber bei Arno war sie für mich neu, traf mich unvorbereitet und verletzte mich. Nach meiner damaligen Auffassung war ich doch ein „guter“ Psychologe, weil ich meinen Ärger zurückhielt - mühsam, wie ich mich heute erinnere. Aber meine Versuche, mit Arno umzugehen, waren verkrampft. Wenn er wütend war, wurde ich äußerlich freundlich, was ihn noch mehr „auf die Palme brachte“. So steigerten wir uns gegenseitig, er sich in Wut und ich mich in angespannte Freundlichkeit, hinter der ich meine eigene zunehmende Wut verbarg.
Irgendwann habe ich es dann nicht mehr geschafft. Meine ganzen Anstrengungen waren umsonst und ich konnte meinen aufgestauten Ärger nicht mehr halten. Wir brüllten uns beide an: „Scheiss-Psycho“, „Rotzlöffel“, „Pisser“, „Halt den Mund“, ... . Wir waren nicht sehr wählerisch. Arno reichte es zuerst, er ging einfach. Aber er kam wieder. Wir hatten regelmäßige Treffen vereinbart und er blieb nicht fort. So gab er mir die Chance, mir klarer darüber zu werden, was der Hintergrund für unsere, seine und meine Verhalten war und warum ich bei ihm über lange Zeit so erfolglos war, keinen Kontakt zu ihm bekam. In einem späteren Gespräch vertraute er mir an: „Als wir uns angemacht haben, Psycho, da fand ich dich stark“.
Arno hat an meiner Entscheidung mitgewirkt, mich fortzubilden und mich insbesondere der Gestalttherapie zuzuwenden. Je mehr ich ihn kennen lernte, desto mehr mochte ich ihn und kam mit seinem Verhalten besser klar, weil ich es allmählich verstand und nachempfinden konnte. Ich habe durch ihn viel über mich und meine Arbeit gelernt. Ich begriff, dass mein Dilemma in der Beziehung zu ihm zustande gekommen war, weil ich meine Gefühle verleugnet hatte, nicht zu ihnen stand. Ich hatte mich für ihn verschlossen, ohne mir dessen bewusst zu sein. Meine verkrampfte Haltung war mir dabei sicherlich ins Gesicht geschrieben, in meiner Mimik und Gestik erkennbar, und so war für Arno meine Freundlichkeit ein Betrug, der seinen negativen Erwartungen gegenüber Erwachsenen entsprach.
Ich habe in meiner Gestaltausbildung und in meiner begleitenden Lehrtherapie viele meiner Stärken und Schwächen kennen gelernt und einige meiner eigenen „alten Wunden“ geheilt, die mich gehindert hatten, offen zu sein. Die Auseinandersetzung mit mir selbst hat mir geholfen, meine Gefühle besser wahrzunehmen und sie besser auszudrücken. Ich habe verstanden, dass ich von Arno enttäuscht wurde und zwar im doppelten Wortsinn. Er frustrierte mich, weil er sein Leben nicht so leben wollte, wie ich mir das vorstellte, und ich mich auf seine Vorstellungen auch nicht einlassen mochte. Und er nahm mir auch meine Selbsttäuschung, nämlich meinen falschen Glauben, dass ich tatsächlich in seinem Sinne wirkte. Mir ist in unserer Beziehung deutlich geworden, dass ich ihm zuvor gar keine wirkliche Hilfe war, weil ich nach meinem eigenen Bedürfnis, also für mich gehandelt habe. Mir wurde klar, dass es einem anderen Menschen überhaupt nicht nützt, wenn ich ihm meine Ansichten aufzwingen möchte, selbst wenn mir das konkrete Ziel, dass ich dabei für ihn im Auge habe, noch so wichtig, wenn nicht gar unumgänglich erscheint. Ich habe begriffen, dass ich jemandem nur helfen kann, wenn ich bereit bin, ihn auf seinem Weg zu unterstützen und seinen positiven Entwicklungsmöglichkeiten vertraue.
Das Thema dieses Buches ist die Integration von „Gestaltarbeit“ in die Pädagogik, genauer in die Jugendhilfe. In Fachzeitschriften und -büchern wird für die Übertragung von Gestaltprinzipien auf pädagogische Arbeit der Begriff „Gestaltpädagogik“ verwendet. Er ist eine Schöpfung aus dem Wort „Gestalt“, in dem Sinne, wie es in der Gestalttherapie verwendet wird, und dem Wort „Pädagogik“, eben dem Gebiet, auf das Prinzipien der „Gestaltarbeit“ übertragen werden sollen.
Der Schwerpunkt der Entwicklungen in der Gestaltpädagogik lag zunächst auf der Neugestaltung von schulischem Unterricht, dem Versuch, in der Schule Methoden und Umgehensweisen einzuführen, die dem ganzheitlichen Denken und dem menschlichen Sein besser entsprechen. Da sich die Bedingungen in der Jugendhilfe von denen in einer Schule stark unterscheiden, muss die Gestaltpädagogik hier ein eigenes Gesicht erhalten. Die Möglichkeiten des Gestaltansatzes im Rahmen der vielfältigen pädagogischen Arbeit kann ich bei dieser Eingrenzung natürlich bei weitem nicht erschöpfend darstellen. Allein in meinem Tätigkeitsfeld als Psychologe in der stationären Jugendhilfe habe ich die Erfahrung gemacht, dass Gestaltarbeit bei der Supervision und Fortbildung von Pädagogen[1], bei der Organisationsberatung und bei der Therapie mit jungen Menschen erfolgreich ist. Es arbeiten aber auch Berater in Erziehungsberatungsstellen, in Kinder- und Jugendberatungsstellen, bei der ambulanten Familienhilfe etc. mit gestalttherapeutischen oder -pädagogischen Mitteln und es werden immer weitere Möglichkeiten der Integration des Gestaltansatzes in weitere Tätigkeitsfelder erfolgreich erprobt.
2. Gestaltpädagogik und aktuelle Situation in der Jugendhilfe
2.1. Die Reformen in der Heimerziehung
Gestaltpädagogik kann im Grunde nicht theoretisch vermittelt werden, sie ist kein Manual und auch nicht ausschließlich oder im wesentlichen eine Methode. Gestaltpädagogik wird erst dann realisiert, wenn der Pädagoge oder die Pädagogin sich für die eigene Persönlichkeitsentwicklung öffnet. Ein Pädagoge, der in seiner Arbeit „Gestalt“ einbringen will, muss Gestaltarbeit an sich selbst erlebt haben und für sich als einen Weg zur eigenen Entwicklung akzeptieren. Das bedeutet, dass er bereit sein muss, sich selbst mit seinen eigenen Problemen und Stärken zu erfahren und aus diesen Erfahrungen zu lernen. Eine Beschränkung auf reine Methodik und der ausschließliche Blick auf den pädagogisch betreuten jungen Menschen, sind mit gestaltpädagogischen Grundprinzipien nicht vereinbar. Durch diese Forderung nach Auseinandersetzung mit der eigenen Person, setzt Gestaltpädagogik natürlich einiges mehr an Akzeptanz und innerer Bereitschaft für ihren Erwerb voraus, als Ansätze, die sich auf den Klienten, auf den jungen Menschen als Ziel von Wahrnehmung und Handlung fokussieren oder fixieren.
Ein Mensch bleibt nur dann wirklich lebendig und realitätsbezogen oder erwirbt diese Eigenschaften wieder, wenn er Entwicklungsbereitschaft bezüglich seiner Persönlichkeit besitzt, wenn er Kraft dieser Entwicklungsbereitschaft in der Lage ist, sich veränderten Bedingungen in der Umwelt zu stellen und nicht ängstlich an überholten Ansichten und Verhaltensmustern festhält. Diese Anforderung, die ich hier zunächst auf eine einzelne Person bezogen habe, gilt dabei ebenso für alle Formen menschlicher Gemeinschaften. Man konnte insbesondere der stationären Jugendhilfe lange nachsagen, dass sie von diesen Eigenschaften wenig besessen hat. Sie war bis in die 80er Jahre eher wenig reformfreudig und hat ihre positiven Veränderungen erst unter äußerem Zwang begonnen, der aus unüberhörbarer Kritik und veränderten gesetzlichen Auflagen bestand. Ich will bei dieser Sichtweise selbstverständlich nicht die herausragenden Persönlichkeiten einer menschlichen Pädagogik unterschlagen, die es auch schon lange zuvor gegeben hat (siehe hierzu auch das Kapitel „Humanismus in der Erziehung“). Sie sind die Wegbereiter für die heutige Entwicklung gewesen. Allerdings waren sie zu ihrer Zeit noch „Pioniere“ und mit ihren Idealen und ihren alternativen Einstellungen die Ausnahme.
Junge Pädagogen und Pädagoginnen bringen neue Ansprüche in die Jugendhilfe mit und stellen Überholtes in Frage. Leider höre ich aber zumeist mehr Kritik an Strukturen und eher weniger Forderungen nach und Vorschläge für bessere pädagogische Inhalte. So wird der Trugschluss genährt, dass nur Bedingungen verändert werden müssten, um eine bessere Pädagogik betreiben zu können. Natürlich unterliegen auch Strukturen der Notwendigkeit von Veränderungen, aber die Entwicklung pädagogischer Inhalte darf dabei nicht zum Opfer fallen oder auch nur als zweitrangig betrachtet werden. Ich vermute, dass eine Ursache in der falschen Gewichtung darin zu suchen ist, dass die jungen PädagogInnen leider viel zu häufig und viel zu schnell durch „ältere“ KollegInnen sozialisiert werden und sich an vorhandene Verhaltensmuster anpassen, bevor sie in der Lage sind, mit beruflicher Erfahrung im Hintergrund, auch bestehende erzieherische Vorgehensweisen fundiert und wirksam in Frage zu stellen.
Die pädagogische Entwicklung und die Einführung pädagogischer Alternativen gehen naturgemäß mit „Reibungsverlusten“ und Rückschlägen einher. Dabei sind es häufig nicht einmal die Protagonisten einer konservativen Einstellung zur Erziehung die nötige Fortschritte verhindern. Vieles wird im pädagogischen Alltag der Einrichtungen dadurch gebremst, dass gestiegene oder veränderte Anforderungen, zum Beispiel durch veränderte Konzeptionen, nicht mit einer Entwicklung von Kompetenz der Pädagogen korrespondieren. Mit jeder Generation junger Menschen stellen sich zudem neue Aufgaben, weil sich ihre Probleme und Bedürfnisse anders darstellen. Die Einstellung, dass eine Berufsausbildung zum Pädagogen für ein ganzes Berufsleben genüge, muss darum konsequent abgelehnt werden. Selbst wenn wir in einem Gedankenspiel einmal annehmen, dass eine pädagogische Grundausbildung für den Augenblick genügen würde, dann bleibt immer noch die Sicherheit, dass sie auch bei sorgfältigster Ausgestaltung nicht für die Jugendhilfe der Zukunft ausreichen wird. Die Schlussfolgerung ist, dass die Grundausbildung des Pädagogen regelmäßig ergänzt werden muss durch Fortbildungen, in denen eine Reflexion der Praxis erfolgt, die zu einer fortgesetzten Reflexion der Praxis anregt und anleiten, mit denen eine kontinuierliche Anpassung an veränderte Bedingungen möglich ist. Ich gehe davon aus, dass viele Fortbildungsangebote diese Anforderung nicht erfüllen. Sie haben ein wesentliches Manko, weil sie viel zu stark auf Wissensvermittlung ausgerichtet sind und die Förderung der persönlichen Kompetenz des Pädagogen vernachlässigen. Manche bieten sich auch als ultima Ratio an. Wenn aber die Vermittlung von Theorie im Vordergrund steht, dann wird in der Praxis erschreckend wenig von der Fortbildung realisiert.
Ich möchte im Folgenden deutlich machen, dass eine Fortbildung in Gestaltpädagogik eine geeignete Maßnahme ist, um zu Entwicklungsprozessen von Einrichtungen, Pädagogen und jungen Menschen beizutragen. Dazu möchte ich zeigen,
- dass Gestaltpädagogik dem Lernenden sowohl Chancen zu eigenem Persönlichkeitswachstum, als auch zum Erwerb zusätzlicher Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeit bietet
- dass Gestaltpädagogik aufbauend auf dem Menschenbild der humanistischen Psychologie, auf Konzepte und Methoden zurückgreift, die der Auffassung von menschlicher Erziehung besser entsprechen
- und dass sich Gestaltpädagogik nicht für eine Weiterentwicklung über ihren derzeitigen Stand hinaus verschließt, sondern dies als unausweichlich betrachtet.
2.2. Gestaltprinzipien in der Pädagogik
Die erlebte Gestaltselbsterfahrung und -therapie führt unweigerlich zur Veränderung des Lebensstils. Menschen, die daran teilnehmen, erleben sich und ihre Umwelt wirklicher und intensiver, sind offener für eigene Entwicklungen und können flexibler auf Veränderungen in ihrer Umgebung reagieren. Ich bin darum nicht verwundert, dass die Prinzipien des Gestaltansatzes auch von Nicht-Therapeuten entdeckt worden sind und in verschiedensten Bereichen, inner- und auch außerhalb der Sozialwissenschaften einbezogen worden sind. Sie eröffnen auch hier ein großes kreatives Potential. Menschen aus allen Fachrichtungen interessieren sich hierfür und an Gestaltfortbildungsseminaren nehmen neben Psychologen und Ärztinnen, auch Architekten und Lehrer, Managerinnen und Hausfrauen, Pastoren und Menschen aus vielen anderen Berufsgruppen teil. Aus der einst ausschließlich therapeutischen Methode ist so mehr und mehr ein universelles Konzept entstanden.
Unabhängig davon, in welchen Bereich der Gestaltansatz integriert wird, bleiben die grundlegenden Prinzipien doch gleich. Und dennoch kann man schon bei der Gestalttherapie sagen, dass kein Therapeut in seiner Arbeit dem anderen ganz entspricht, dass keine Therapie völlig wie die andere ist. Der Gestalttherapeut ist nicht eingezwängt in ein starres Therapieschema mit festliegendem diagnostischem Vorgehen und eindeutiger Indikation, sondern er entwickelt auf der Basis der Gestaltprinzipien in der Interaktion mit seinem Klienten die Therapie jeweils neu, behält dabei lediglich seinen individuellen Stil bei. Diese Flexibilität des Gestaltansatzes erleichtert die Integration des Ansatzes in die anderen Bereiche.
Bei der Betrachtung der verschiedenen Integrationen wird immer wieder deutlich, dass jeder Bereich seine Eigenheiten hat. Er schafft den Gestaltprinzipien dadurch neue Möglichkeiten, setzt ihnen aber auch unterschiedliche Grenzen. Bei jeder Integration entsteht dadurch etwas Neues, eine neue Gestalt. Es stellt sich darum die Frage, welche Bedingungen bei der Integration von Gestaltprinzipien in die Jugendhilfe berücksichtigt werden müssen, welche Unterstützung vorhanden ist oder welche Hindernisse sich aufbauen. Global lässt sich sagen, dass Unterstützung und Hindernisse einerseits aus den Bedingungen des pädagogischen Alltags und andererseits aus der jeweiligen pädagogischen Orientierung der Einrichtung entstehen.
Nehmen wir zunächst einmal die Situation der pädagogischen Arbeit in einer Wohngruppe der stationären Jugendhilfe im Vergleich zur klassischen gestalttherapeutischen Umgebung. In der Gestalttherapie wird zumeist mit einem einzelnen Menschen im Rahmen einer Zweierbeziehung von Klient und Therapeut gearbeitet. Selbst wenn dies im Rahmen einer Selbsterfahrungsgruppe geschieht, ist der Einzelne im Vordergrund, während die anderen Teilnehmer im Hintergrund bleiben und motiviert werden, eine förderliche Haltung für die so genannte Einzelarbeit einzunehmen. Ein Pädagoge in der stationären Jugendhilfe kann hingegen in seinem Alltag so gut wie keine Individualtherapie und auch nur wenig andere individuelle Betreuung durchführen. Pädagogik in Wohngruppen ist im Regelfall Arbeit in und mit Gruppen von Jugendlichen.
Unter diesen Bedingungen muss der Erzieher immer wieder seine Aufmerksamkeit schweifen lassen, von der Gruppe zum einzelnen Gruppenmitglied. Er muss permanent abwägen, auf welchen Vorgang in seiner Umgebung er seine Aufmerksamkeit lenkt und die Zielrichtung seiner Aktionen flexibel verändern, je nachdem ob z.B. der Prozess der Gruppe seine Aufmerksamkeit verlangt oder ein Einzelner vermehrt seine Beachtung benötigt. Fixiert er sich auf den einzelnen jungen Menschen, verliert er seine Einflussmöglichkeit auf die Gruppe, deren Aktivitäten dann nur allzu leicht als Störung empfunden werden. Vernachlässigt er den Einzelnen zugunsten der Gruppe, dann unterstützt er unter Umständen die Entwicklung eines Außenseiters und kann einem individuellen Problem nicht gerecht werden. Es gibt nur eine angemessene Schlussfolgerung: Pädagogen müssen in ihrer Flexibilität und Wahrnehmungsfähigkeit für das Wesentliche in Situationen gefördert werden: Sie müssen in ihrer Entscheidungsfähigkeit gestärkt werden, welchen Prozess sie zur Zeit fördern können und wollen und welchem sie ihre Aufmerksamkeit entziehen können und wollen. Eine Fortbildung muss als einen Bestandteil genau diese Zielsetzung haben.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Gestaltprinzipien werden auch durch die Grundwerte bestimmt, wie sie sich in den bewussten, formulierten oder auch unbewussten, verdeckten Zielen der jeweiligen pädagogischen Orientierung einer Einrichtung oder einer Pädagogin widerspiegeln. Der Gestaltansatz trifft für seine Zielsetzung eine eindeutige Aussage. Er beschreibt sich als ein positivistischer Ansatz, der jedem Menschen seine eigene Entwicklungsmöglichkeit zugesteht. Wird darum das Ziel der pädagogischen Arbeit darin gesehen, das Kind oder den Jugendlichen zu lenken oder gar zu zwingen, bestimmte Normen und Werte zu übernehmen, ist die Anwendung von Gestaltprinzipien eingeengt oder eventuell sogar ganz unmöglich. In einem alten Lehrbuch aus dem Jahre 1977 von Wolfgang Brezinka[2], Professor für Erziehungswissenschaften lese ich: "... erzieherische Handlungen sind Handlungen, durch die versucht wird, Menschen eine bestimmte Form zu geben". Ich gehe davon aus, dass von vielen Menschen diese Formulierung leider auch heute noch vertreten wird, obwohl sie eine repressive Einstellung wiedergibt, die dem, der erzogen werden soll, die Selbstbestimmung nimmt.
Gestalttherapie hat aber die Selbstverwirklichung und das persönliche Wachstum des Menschen zum Ziel. Das gestalttherapeutische Paradoxon der Veränderung lautet: „Nicht werden, was man nicht ist, sondern sein, was man ist“. Sie geht somit von der positivistischen Sicht aus, dass jeder Mensch letztendlich die beste Entscheidung über sein Leben selbst treffen kann und muss. Darum ist der Therapeut in der Gestalttherapie auch aufgefordert, dem Klienten zu helfen, die Entscheidung über sein Leben in allen Belangen selbst in die Hand zu nehmen (siehe auch das Kapitel zum Thema Erziehungshaltungen) und ihn auf diesem Weg zu unterstützen.
Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf die Bedingungen der stationären Jugendhilfe lenken und Sie zur Verdeutlichung bitten, dabei auch einmal auf die Empfindungen zu achten, die die gängigen Bezeichnungen, die ich hier auch verwende, bei Ihnen auslösen:
Kinder und Jugendliche wachsen nicht in „Fremderziehung“ auf, weil sie sich diese Umgebung freiwillig gewählt haben. Sie erleben ihre „Unterbringung“, ihre Trennung vom Elternhaus oft als Bestrafung und Folge eigenen Versagens und nahezu immer als Unglück. Nicht selten wurde den jungen Menschen schon lange mit der „Unterbringung im Heim“ gedroht, wenn sie dieses oder jenes Verhalten nicht aufgeben würden. Die „Unterbringung“ wurde als Machtmittel angesehen und so wurden negative Erwartungen erzeugt und genährt.
Dass sich ein junger Mensch quasi aus dem Elternhaus in eine fremde Umgebung flüchtet und hier ein neues Zuhause sucht, kommt nur in wenigen Einzelfällen vor und zeugt von den schlimmen Belastungen, die er erfahren hat. Der Pädagoge muss darum damit rechnen, dass ihm die jungen Menschen, die er betreuen will, zunächst alles andere als freundschaftliche und erwartungsfrohe Einstellungen entgegenbringen. Sie werden ihm in der Regel ablehnend oder misstrauisch gegenüberstehen, wie es auch meinen oben geschilderten, eigenen Erfahrungen entspricht. Er wird nur in seltenen Ausnahmen unmittelbar als Partner oder als Modell für eine sinnvolle und befriedigende Form von Lebensführung gewählt. Sein Rat wird vermutlich als Bevormundung erlebt und seine Kritik mit Sicherheit nicht gewünscht. Pädagogen müssen sich eine gute Beziehung zu jedem jungen Menschen erst schaffen.
Selbst wenn sich die Wirklichkeit verändert hat, ist der schlimme Ruf vergangener Heime noch immer wach. „Erziehungsheime“ hatten zu oft einen Charakter, der den negativen Erwartungen der jungen Menschen entsprach oder ihnen zumindest sehr entgegenkam. Der Erziehungsstil war autoritär, der Umgang im günstigsten Fall von rauer Herzlichkeit geprägt. Unter diesen Umständen war Erziehung tatsächlich eine Demonstration von Macht und Unterdrückung. Der junge Mensch hatte sich anzupassen, musste „gebessert“ werden. Positiv bewertet wurde, wenn er gehorchte und sich „formen“ ließ. Seine mangelnde Bereitschaft sich anzupassen, wurde als problematisches Verhalten angesehen und seine problematischen Verhalten wurden moralisch bewertet. Da er nicht als gleichwertig anerkannt wurde, blieb ihm, wenn er ein akzeptiertes Leben in der Gesellschaft anstrebte, nur die Kapitulation vor den vorgegebenen Normen und Werten, auch wenn er sie nur äußerlich demonstrierte.
Die Jugendhilfe hat sich für Reformen geöffnet und insgesamt ein anderes und positiveres Gesicht bekommen. Ausgelöst insbesondere durch Kritik, aber auch durch Einsicht in pädagogische Notwendigkeiten wurden neue Konzepte und verbesserte Rahmenbedingungen entwickelt. Gleichzeitig wurde auch das Angebot differenzierter, angemessen an die verschiedenen Bedürfnisse, die immer neue Generationen von jungen Menschen mit unterschiedlichen Problemen haben. Es gibt heute Angebote, die nach Alter, psychischer Problematik, Ausbildung etc. unterscheiden. Besonders auffällig ist die Verbesserung des Personalschlüssels, die verbesserte Wohnsituation durch Dezentralisierung außerhalb der Großeinrichtungen und die Auflösung der Bindung von Jugendhilfe an die Wohnsituation in Gruppen. Heute haben die jungen Menschen mehr Platz und Individualraum für sich und die Pädagogen mehr Zeit für einzelne jungen Menschen und damit bessere Chancen für den Aufbau von Beziehungen. Bedeutsam ist auch, dass sich das Verständnis für die pädagogische Aufgabe verändert hat: Die Funktion des Erziehers wird heute wesentlich weniger als sanktionierend und mehr als fördernd gesehen und die Ziele der Jugendhilfe sind neu definiert worden. Maßstab der erfolgreichen Erziehung ist immer weniger die gelungene Anpassung des jungen Menschen an eine vorgegebene Form, sondern die Verbesserung seiner Fähigkeit die Realität zu erfassen und darin angemessener zu reagieren. Diese Auffassung von Pädagogik stimmt mit der Zielsetzung von Gestaltarbeit überein und bildet darum eine Grundlage zur Integration von Gestaltprinzipien in die stationäre Jugendhilfe.
2.3. Jugend im Wandel
Aber auch wenn sich die Jugendhilfe verändert hat, sind die Einstellungen der jungen Menschen gegenüber dem Leben in fremder Unterbringung nicht zwangsläufig positiver geworden und die PädagogIn muss davon ausgehen, dass sie bei den Jugendlichen nicht den Wunsch nach Hilfe in einer Form antrifft, wie sie ihn sich vielleicht erhofft. Neben den negativen Vorerfahrungen mit erwachsenen Bezugspersonen, die sie teils auf alle Erwachsenen generalisieren, nehmen die jungen Menschen Erzieher auch als Vertreter einer Erwachsenengeneration wahr, die verantwortlich ist für die schwierigen Bedingungen, unter denen sie leben und sich entwickeln müssen.
Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die ihnen ein Übermaß an Widersprüchen und Reizen, aber wenig an Orientierung und Lebensperspektive bietet. Die Integration in die Erwachsenenwelt verliert für sie in vielen Bereichen den Wert, angesichts einer Situation, die von nachlassender Solidarisierung, von Arbeitslosigkeit, verheerenden Umweltkatastrophen und -problemen geprägt ist, in der die Orientierung am Wohlstand ihren Bankrott erlebt, in der einerseits Hungersnöte auf der Welt toleriert werden und andererseits die Konsumorientierung pervertiert in Drogen- und Rauschmittelmissbrauch und in der der Expansionsdrang der Konzerne beim Waffenhandel unsere eigene Existenz bedroht. Junge Menschen werden in dieser Welt als Konsumenten umworben, aber nicht als Partner und schon gar nicht als Kritiker mit eigenem Standpunkt akzeptiert. Ich behaupte nicht, dass junge Menschen diese Haltung bewusst vortragen oder sich der Hintergründe gewiss sind, aber die psychische Konsequenz ist unübersehbar. Für viele Jugendliche sind die gesellschaftlich anerkannten und geforderten Werte und Normen der Erwachsenenwelt immer unglaubwürdiger und unattraktiver geworden. Jugendliche lehnen es mehr und mehr ab, in die ihnen angebotene oder angetragene, in vielem unattraktive oder bedrohliche Erwachsenenwelt einzutreten. Es gibt jene die völlig resignieren und viele die versuchen, stattdessen eigene Wege zu gehen oder sich Subgruppen anzuschließen, die ihnen Alternativen anzubieten scheinen. Dabei werden zum Teil Gruppen gewählt, die Stärke und Eindeutigkeit propagieren, mit klaren Feindbildern aufwarten oder fixierte Ziele verfolgen. Jugendliche ohne Orientierung nehmen solche „Hilfen“ ebenso gerne an, wie Erwachsene auch, wenn sie ihre Orientierungslosigkeit als bedrohlich erleben und werden so Mitglieder von Gruppierungen die zum Beispiel dem Rechtsradikalismus zuzuzählen sind oder religiösen Sekten.
Diese Entwicklung ist nicht mehr ausschließlich als Generationskonflikt verstehbar. Wer davon ausgeht, dass früher oder später schon Vernunft bei den Jugendlichen einkehren werde oder wer meint diese „Vernunft“, mit welchen Mitteln auch immer, Jugendlichen aufoktroyieren zu können, der liegt gefährlich schief.
Bei Jugendlichen in der Jugendhilfe zeichnet sich die veränderte Grundhaltung noch deutlicher ab. Der Hintergrund hierfür ist, dass die Jugendhilfe im Spannungsfeld einerseits der gesellschaftlichen Forderung nach traditioneller Integration und andererseits den dafür nicht vorhandenen Bedingungen, sowie dem Widerstand der Jugendlichen steht.
Die Jugendhilfe kann und darf diese Entwicklung weder in ihrer alltäglichen Arbeit, noch in ihren Konzepten und in ihrer öffentlichen Selbstdarstellung verschweigen und ignorieren, will sie ihrem Auftrag gerecht werden. Sie zu ignorieren würde bedeuten, sich von den Jugendlichen ins Abseits stellen zu lassen, denn Jugendliche schaffen, wenn Erwachsene nicht entwicklungsfähig sind, durch aktiven und passiven Widerstand ihre gewünschten Bedingungen selbst. An einem Beispiel möchte ich dies verdeutlichen: Es wird niemals gelingen, einen Jugendlichen zum Schulerfolg zu zwingen. Ich denke, selbst die hartnäckigste erzieherische Maßnahme kann es maximal schaffen, bei einem Jugendlichen den Schulbesuch zu kontrollieren. Aber selbst bei dem Versuch, diesen Schulbesuch dauerhaft zu erreichen, müsste sie scheitern, wenn der Jugendliche ihn nicht will. Gar noch ein echtes Interesse oder einen Lernerfolg erzwingen zu wollen, halte ich für eine völlig irreale Wunschvorstellung.
Diese Entwicklung zu ignorieren hieße, sich selbst zu hohe Ziele zu setzen und sich zu überfordern. Ohne fachlich fundiertes Selbstbewusstsein gegenüber den Belegbehörden ist dies selbstverständlich nicht realisierbar, denn es gilt zu den Grenzen des Machbaren zu stehen und Illusionen auszuräumen, die auch in überzogenen Anforderungen an die Jugendhilfe verborgen sind.
Nun mag nach einem oberflächlichen Blick der Eindruck entstehen, dass ich vor den Bedingungen der Gegenwart oder vor menschlichen Problemen kapituliere. In diesem Fall werde ich aber missverstanden worden. Mein Beitrag soll keinesfalls als resignative Antwort auf eine nicht zu bewältigende Situation angesehen werden, sondern vielmehr als Versuch, die Dinge so realistisch zu sehen, wie sie nun einmal sind. Einige Handlungen von Jugendlichen sind selbstzerstörerisch oder gewalttätig gegen andere und können darum selbstverständlich nicht akzeptiert oder gar positiv bewertet werden. In diesem Punkt bin ich einer Meinung mit Arno Gruen, der über den Umgang mit Extremismus schreibt[3]. Aggressive, sogar destruktive Verhalten eines jungen Menschen rechtfertigen aber nicht den irrigen Versuch, durch im Wesentlichen repressive Maßnahmen die Entwicklungen eines jungen Menschen bewirken zu wollen. Wie anders soll ein junger Mensch eine solche Haltung verstehen, als Versuch, dass man sich seiner bemächtigen will. Hier muss vielmehr eine klare Unterscheidung her zwischen dem Unterbinden eines destruktiven Verhaltens in einem Augenblick und der annehmenden, überdauernden Grundhaltung, mit der die konsequent die Hintergründe für dieses Verhalten bearbeitet werden.
Gerade die repressive Erziehungshaltung sehe ich als eine Folge davon an, dass der betroffene Pädagoge die Augen für die Realität und die Gegenwart verschlossen hat. Sie erscheint dadurch motiviert, dass der Repressive sich durch die Bedingungen in seiner Umgebung überfordert fühlt und es vermutlich auch ist. Aus dieser Überforderung und ihrer einseitigen Verarbeitung entsteht eine Blindheit, die keinesfalls einer realitätsbezogenen Handlungsweise oder einer professionellen pädagogischen oder therapeutischen Arbeit dient. Erst mit der Bereitschaft und Fähigkeit, sich an der gegenwärtigen Realität zu orientieren, sich für sie bewusst zu öffnen, ist ein Therapeut oder Pädagoge in der Lage, flexibel und Erfolg versprechend zu agieren.
Erfreulich viele der neu entwickelten pädagogischen Konzepte sind gegenwartsbezogen. Sie wollen Jugendlichen gerechter werden als bisher. Dieser eigentlich Erfolg verheißende Anspruch, versagt aber leider in der konkreten Arbeit oft, weil er lediglich intellektuell und theoretisch besteht und nicht in ausreichendem Umfang auf geeignete praxisbezogene Methoden zurückgreifen kann. Es gelingt dann zwar noch die Orientierung am Jugendlichen in den Rahmenbedingungen zu verwirklichen, wenn zum Beispiel neue Wohnraumgrößen festgelegt werden, die dem Bedarf mehr entsprechen oder wenn Jugendliche über die Einrichtung ihrer Wohngruppe mitentscheiden dürfen, aber im Alltag fehlt dem Pädagogen oft die fachliche Kompetenz, diesen Anspruch auch konsequent im zwischenmenschlichen Umgang umzusetzen. So entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen Planung und Praxis, in dessen Folge nicht selten über „Etikettenschwindel“ gesprochen wird, wenn einmal mehr ein „intensives, therapeutisch-gruppendynamisches Projekt“ aus der Taufe gehoben wird, in dem die Mitarbeiter dann von den Forderungen, die an sie gerichtet werden, überfordert sind.
Natürlich werden Pädagogen unter solchen Verhältnissen unzufrieden und man kann dann nur hoffen, dass sie ihren Unmut positiv in die Motivation zu weiterer Qualifizierung münden lassen. Die Aus- und Fortbildungsstätten müssen sich dieser Motivation bewusst sein und entsprechende Angebote entwickeln. Sie tun dies, wenn sie gewährleisten, dass die Teilnehmer ihre Alltagserfahrungen bearbeiten können, wenn sie den Pädagogen in seiner Persönlichkeit stärken, wenn sie Bildungsinhalte anbieten, die vermitteln, was es in der pädagogischen Praxis bedeutet, ein Angebot zu machen, dass von den jungen Menschen angenommen wird, dass deren individuellen Stärken zu entdecken und zu fördern versucht, um ihnen so wieder Mut zum Leben zu geben, statt ihre Schwächen zu sanktionieren und ihnen so tagtäglich ihre „Minderwertigkeit“ vor Augen führt. Und Pädagogen müssen in der Aus- und Fortbildung insbesondere die Möglichkeit haben, zu erfahren, was es bedeutet, einen jungen Menschen dort abzuholen, wo er steht. Ich betone hier bewusst das Wort „erfahren“ und meine damit, dass das Erleben von eigenen Persönlichkeitswachstumsprozessen Voraussetzung ist, für ein angemessenes Verständnis dieser Vorgänge bei anderen Menschen.
2.4. Die Belastungen des Pädagogen in der Jugendhilfe
Die Arbeit des Pädagogen in der Jugendhilfe ist anstrengend und oft frustrierend. Sie zu bewältigen verdient Hochachtung. Im Gespräch mit Erziehern, Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen höre ich immer wieder Berichte über ihre Belastungen. Geklagt wird über Ermüdung und Erschöpfung, über abnehmende Motivation immer wieder Neues zu erproben, über Jugendliche, mit denen „schon alles versucht“ wurde und „nichts“ Erfolg hat, über Kollegen, die sich nicht kollegial verhalten, über Vorgesetzte und Ämter, die sich nicht verständig zeigen, usw. Die Beschreibung der verschiedenen Probleme von Helfern hat schon unzählige Seiten Literatur gefüllt. Schlagworte wie „Helfersyndrom“ und „burning out“ sind dadurch bekannt geworden.
Sicherlich sind die meisten PädagogInnen mit viel Engagement an ihren Beruf herangegangen, denn zu dieser Berufswahl gehört einfach ein Ideal. Enttäuschung oder gar Resignation stellt sich dann ein, wenn die Bemühungen immer wieder von den jungen Menschen nicht angenommen und zurückgewiesen werden. Ich kann die Enttäuschung gut verstehen, weil ich in gleiche Erfahrungen gemacht habe. Und der Zurückweisung durch die jungen Menschen kann man im Grunde nicht entgehen oder ausweichen. Diese jungen Menschen haben ja fast ausnahmslos schmerzhafte Erfahrungen in früheren Beziehungen gehabt und projizieren jetzt negative Erwartungen auf ihre Betreuer, aus Angst erneut verletzt zu werden. Sie testen immer wieder misstrauisch die Bereitschaft, sie zu akzeptieren, sind dabei in ihrer Einschätzung unrealistisch und ungerecht, im Verhalten verletzend und treffen auch immer wieder schwache Stellen der Pädagogen.
Verliert die Pädagogin in solchen Situationen aus dem Auge, dass das Misstrauen und die Ablehnung nicht ihm persönlich gilt, sondern eine generelle Reaktion ist, verliert sie die Geduld und lässt sich auf eine Konfrontation ein, dann wird sie auf Dauer resignieren, denn die jungen Menschen sind in der Überzahl und mit jeder Aufnahme in ihre Wohngruppe folgt immer wieder ein neuer junger Mensch mit frischen Energien nach. Und wählt der Pädagoge die Zielsetzung, die negative Haltung der jungen Menschen schnell abzubauen, dann wird er seine Kräfte vergeuden, denn das Misstrauen, das dem Verhalten zugrunde liegt, lässt sich nur allmählich überwinden.
Durch die tagtäglichen Anforderungen gerät Helfern sehr leicht aus den Augen, dass sie für sich selbst auch sorgen müssen, wenn sie ihre Freude an der Arbeit und damit ihre Arbeitsfähigkeit erhalten oder zurückgewinnen wollen. Ich möchte es einmal so beschreiben: Der Pädagoge hat kein anderes „Werkzeug“ zur Verfügung als sich selbst, mit seiner Kompetenz und Persönlichkeit. So wie bei jedem Handwerker die Pflege des Werkzeuges selbstverständlich ist, sollte dies beim Pädagogen ebenfalls selbstverständlich sein. Es gibt aber Einstellungen, die dem eindeutig entgegenwirken. Pädagogen betrachten sich nicht als Helfer, sondern als verantwortlich für die Entwicklung der jungen Menschen in ihrer Obhut, selbst wenn diese schon fast im Erwachsenenalter sind. Damit überschätzen sie ihre Möglichkeiten. Sie messen ihre Zufriedenheit an einem viel zu hoch gestecktem pädagogischen Erfolg und lassen sich in der Zielsetzung oft fremdbestimmten und überfordern. Eine Fortbildung muss diese Tendenz zur Selbstüberforderung berücksichtigen. Sie muss dem Teilnehmer Rüstzeug mitgeben, mit dem er pädagogische Möglichkeiten realistischer einschätzen, seine Möglichkeiten selbstbewusster darstellen und sich selbst „im Augen behalten“ kann, in dem Bewusstsein, dass selbst die beste Aus- und Fortbildung bei der „Selbstpflege“ eine gute Grundlage ist, aber eine permanente Unterstützung durch Beratung und Supervision des Betreuerteams natürlich nicht ersetzen kann.
Der Veränderungsprozess in der stationären Jugendhilfe ist so intensiv, dass für PädagogInnen die Fortbildung und die ständige Entwicklung der eigenen Fähigkeiten zum Berufsbild gehören müssen. In einer Befragung im Auftrage des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit im Jahre 1984 wurden Erzieher gefragt, welche Maßnahmen ihnen geeignet erschienen, die Belastungen in ihrem Heim zu verringern. Sie nannten mit fast 60% pädagogische und psychologische Fortbildungsmaßnahmen an zweiter Stelle. Nur die Reduzierung der Gruppengröße wurde noch häufiger genannt.
Die Veränderungen und Entwicklungen in der Jugendhilfe haben teils Erleichterungen gebracht, aber auch verstärkte fachliche Anforderungen. Zum Beispiel muss mit dem Anspruch zu fördern statt zu formen, der moralische Standpunkt des Urteilens beziehungsweise Verurteilens zugunsten des Verstehens aufgegeben werden. Es ist nicht ausreichend, das Verhalten der Betreuten zu bewerten, in Recht und Unrecht zu unterscheiden, es zu sanktionieren, sondern es muss erklärt und verstanden werden. Die Bedingungen zur Realisierung der neuen Pädagogik sind in vielen Einrichtungen aber noch nicht optimal. Für die Umsetzung dieses Anspruchs ist - wie gesagt - einerseits eine entsprechende Aus- oder Weiterbildung der pädagogischen Mitarbeiter erforderlich. Andererseits muss die Einrichtung Strukturen schaffen und bereithalten, die die Verwirklichung dieser neuen Pädagogik erlaubt und nicht verhindert. Aus diesem Grunde kommen Leitungsfunktionsträger nicht umhin in ihrer Einrichtung für die Klärung des hier vertretenen Menschenbildes und insbesondere des pädagogischen Konzeptes menschlicher Entwicklung zu sorgen und systemische Störungen bei dessen Umsetzung in pädagogisches Handeln konsequent zu unterbinden beziehungsweise zu beheben suchen, auch wenn sich hierbei die Struktur einer Einrichtung von Grund auf ändern müssen.
Solange die Reinigungskraft in einem Hause die Pädagogik bestimmt, solange der Mangel an Fachlichkeit dadurch deutlich wird, dass Bezeichnungen mit Erklärungen verwechselt werden, indem psychiatrische Krankheitsbegriffe, wie Depression oder Schizophrenie, herhalten müssen, um die Niedergeschlagenheit oder Stimmungslabilität eines jungen Menschen zu erläutern, gerade so, als sei damit die Ursache genannt und solange fachfremde Leitungsfunktionsträger den Pädagogen des eigenen Hauses kein Vertrauen in deren Kompetenz entgegenbringen, solange kann ein Optimum an pädagogischer Leistung nicht erreicht werden.
2.5. Integration therapeutischer Methoden in den pädagogischen Alltag
Methoden, die ursprünglich in der Psychotherapie verwendet wurden, in die Jugendhilfe oder andere Bereiche zu übertragen, ist schon oft versucht worden und teils recht erfolgreich. Der motivationalen Ursprung für diese Integration ist meines Erachtens einmal in der Vorstellung zu suchen, dass die jungen Menschen im Vergleich zu früher viel schwieriger geworden sind und zum anderen im gestiegenen Anspruch an die Jugendhilfe. Ich will die Vorstellung, der sich verschlechternden Jugend hier nicht auf ihre Richtigkeit untersuchen. Tatsache ist, dass ihr Verhalten schon immer beklagt wurde. Bereits SOKRATES sagte vor ca. 2500 Jahren: „Die Jugend liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor den älteren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten soll“.
Bis vor einigen Jahren war in der Folge des gestiegenen Anspruchs der Ruf nach intensiverer Betreuung ständig gewachsen, was unter anderem auch hieß, psychotherapeutische Maßnahmen in die Arbeit in der Jugendhilfe Heim einzubinden. Es wurden zunehmend Psychologen und Vertreter anderer Berufsgruppen eingestellt, die therapeutische Qualifikationen unterschiedlichster Art hatten. Diese Entwicklung hat sich derzeit allerdings wieder abgeschwächt und sogar einer gegenläufigen Entwicklung Platz einräumen müssen. Unter dem Eindruck leerer Kassen tauchen in der Diskussion immer öfter Gegenargumente gegen die Psychotherapie in der Jugendhilfe auf, die sich in solchen Bemerkungen, wie „Vertherapeutisierung des pädagogischen Alltags“ niederschlagen. Ohne ehrliche Darstellung des eigentlich motivierenden Hintergrundes wird meines Erachtens diese Diskussion leider oft konfus geführt, mit einseitigem Therapieverständnis und ungenügender Kenntnis. Doch zu dieser Diskussion möchte ich später kommen und zunächst einmal die Entwicklung bis heute etwas anschauen.
Die Entwicklung therapeutischer Arbeit in der Jugendhilfe
Ausgehend von der kritischen Auseinandersetzung mit der „Heimerziehung“ setzte sich eine Veränderung in Gang, die immer mehr den Grundsatz verwirklicht, den jungen Menschen und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellt. Bei der Beachtung des Problems, dass zur Unterbringung eines jungen Menschen führt, tritt seither immer mehr die Beurteilung des Verhaltens in den Hintergrund und das Verstehen von Ursache und Zielrichtung des Verhaltens in den Vordergrund. Zunächst wurde der Ruf nach psychologischer Diagnostik laut und mehr und mehr Psychologen wurden in den Einrichtungen beschäftigt. „Mehr Wissen heißt“ aber noch nicht „mehr können“. Die diagnostischen Daten allein waren natürlich ungenügend, um die Probleme zu lösen, waren teils durch den Sprachgebrauch vielmehr geeignet, Verwirrung zu stiften. Sie mussten ergänzt oder ersetzt werden durch die psychologische Beratung der Teams und durch einrichtungsinterne Psychotherapie. Gemäß dieser Erkenntnis wurde in den Einrichtungen die Psychotherapie von den Psychologen und verwandten Berufsgruppen durchgeführt, zunächst als flankierende Maßnahme. Der Therapeut war in der Regel abseits von der Gruppe untergebracht und erhielt auf mehr oder weniger geplante Weise junge Menschen der Einrichtung zur Therapie überwiesen.
Das medizinische Modell
Diese Arbeitsweise erinnert an das medizinische Behandlungsmodell. Kurz dargestellt lässt sich dies etwa so charakterisieren:
Der Behandelnde führt die Behandlung außerhalb der alltäglichen Umgebung des Patienten durch und ist allein verantwortlich für den Heilungsprozess. Er ist kompetent für die Erkennung und Beschreibung des Problems. Seine Vorgehensweise ist klar trennbar in Diagnose und Therapie.
Für körperlich erkrankte oder schwer psychisch Kranke kann diese Orientierung sehr wichtig sein. Für die therapeutische Arbeit im Heim halte ich sie aus mehreren Gründen, von denen ich nur einige exemplarisch aufzählen möchte, für unangemessen:
Grund 1.: Der Therapeut legt den Menschen nach seinen Wertmaßstäben auf das Ziel der Therapie fest und etikettiert ihn mit seiner Diagnose.
Bei psychisch kranken Menschen, die sich selbst oder andere gefährden, ergibt die Festlegung des Therapieziels einen Sinn. Denn wenn ein drogenabhängiger Mensch nicht die Drogenfreiheit, oder ein suizidaler Mensch nicht den Lebenswillen als Zielsetzung der Therapie erführe, wäre sie überflüssig. Einem jungen Menschen aber die Lust an der beruflichen Ausbildung oder den Verzicht auf aggressive Durchsetzung zum Therapieziel zu machen, hieße den sozialpädagogischen Lernprozess aufzugeben und im Extremen sogar emanzipatorische Prozesse zu unterbinden.
Nebenbei möchte ich eins nicht unerwähnt lassen: Die Rolle des Diagnostikers und die des Zielfestlegers in der Therapie vermittelt eine Macht, die Versuchung mit sich bringt. Nicht umsonst wird der psychodiagnostische Sprachgebrauch so gerne von Nicht-Therapeuten übernommen.
Grund 2.: Der junge Mensch in der Therapie innerhalb einer Einrichtung ist in einer auffälligen Position. Die Behandlung ist nicht anonym.
Es ist für einen Menschen kein leichter Schritt, sich einzugestehen, dass er mit seiner Problemlösung versagt. Für verunsicherte junge Menschen ist dies sogar ein noch größerer Schritt, als für „vernünftige“ Erwachsene. Und dann wirken in der Jugendhilfe noch Gruppen- und Subgruppenphänomene, denen sich der einzelne nur bedingt widersetzen kann. Mit seiner Therapie ist ein junger Mensch geradezu prädestiniert für die Rolle eines Sündenbocks. Er läuft Gefahr, verlacht und ausgegliedert zu werden.
Grund 3.: Therapie wird als Sanktion missbraucht.
Wer braucht die Einzelbehandlung? Diese Frage wird nur allzu oft damit beantwortet, dass es der schwierige, also laute und aggressive junge Mensch ist, der zur Behandlung geschickt wird. Dies hat Konsequenzen sowohl in der Wahrnehmung der Therapie durch junge Menschen, als auch in der Motivation zur Behandlung überhaupt. Ein Mensch, der zwangsweise therapiert werden soll, verweigert offen oder verdeckt die Zusammenarbeit. Hinzu kommt, dass in einer Einrichtung, die wie hier beschrieben vorgeht, auch die aggressionsgehemmten bedürftigen jungen Menschen nicht mehr bereit sind, sich auf den Besuch des Therapeuten einzulassen.
Grund 4.: Klassische Therapie nach dem medizinischen Modell ist nicht ökonomisch.
Heime können sich nicht eine solche Anzahl von Therapeuten leisten, dass jeder bedürftige junge Mensch Einzeltherapie erhält. Kann sich eine Einrichtung einen Therapeuten leisten, dann halte ich es für sinnvoller, dass er seine Fähigkeiten zum Beispiel in Fortbildungen für Pädagogen multipliziert.
Ist therapeutisches Vorgehen eigentlich nötig?
Die jungen Menschen in unseren Einrichtungen haben durchweg schlimme negative soziale Erfahrungen gemacht. Das Verhalten, dass sie uns zeigen, ist eine konsequente Folge der Verletzungen und Enttäuschungen die sie erlebt haben. Diese Erlebnisse müssen von ihnen verarbeitet werden. Pädagogik ist zwar geeignet, neue und bessere soziale Erfahrungen anzubieten, eine tiefgehende seelische Verarbeitung ist aber erst in therapeutischen Prozessen möglich.
Die Integration therapeutischer Methoden
Was haben wir bis jetzt gefunden?
1. Die jungen Menschen in den Heimen können Therapie gut gebrauchen.
2. Die Therapie oder therapeutische Methode, die sich an das medizinische Modell anlehnt, ist in der Jugendhilfe ungeeignet.
Eigentlich wäre es vorteilhaft, wenn ein pädagogisches Verfahren eine ganzheitliche, umfassende Verarbeitungsmöglichkeit für die Probleme der jungen Menschen anböte, denn dann wäre der Konflikt zwischen Therapie und Pädagogik vermieden. Mir ist aber kein solches Verfahren bekannt. Aus diesem Grunde ist eine Integration von therapeutischen Aspekten in die pädagogische Arbeit angebracht. Ganz so neu ist dieser Gedanke nicht, denn immerhin hat er dazu geführt, dass therapeutisch-pädagogische Konzepte entstanden sind, wie z.B. die Heilpädagogik, die diese Integration schon mit ihrem Namen deutlich macht.
Meinen Ansprüchen genügt eine heilpädagogische Ausbildung noch nicht und es wäre auch viel zu schade um den Erfahrungsschatz der therapeutischen Arbeit, wenn sich Pädagogen ihn nicht zunutze machten. Zugegeben kann das Thema „Therapiemethoden im pädagogischen Alltag“ zu Witzeleien anregen, wenn man sich etwa vorstellt, dass der therapeutisch gebildete Pädagoge den deprimiert dreinschauenden Jugendlichen für ein vertrauliches Gespräch erst einmal auf ein Sofa legen muss. In diesem witzigen Aspekt steckt aber natürlich auch Wahrheit: Therapie kann der Pädagogik nicht einfach aufgepfropft werden, wie ein fremder Zweig einem Obstbaum. Vielmehr muss sich die therapeutische Methode in den Rahmen der Pädagogik einpassen. Immerhin sind wir ja pädagogische Einrichtungen und keine Psychiatrien. Therapeutische Methoden müssen also folglich daran gemessen werden, ob sie sich einpassen lassen oder ob sie sich zumindest modifizieren lassen, damit sie dem pädagogischen Rahmen nicht widersprechen. Dies ist eine meiner Hauptforderung die sich zerlegen lässt in konkrete Teilforderungen, von denen ich wiederum nur einige aufzeigen möchte:
1. Forderung: Die Therapie oder therapeutische Methode muss gemäß den wechselnden pädagogischen Anforderungen der Arbeit in der Gruppe flexibel sein.
Im pädagogischen Alltag kann der Betreuer keine Einzeltherapie durchführen. Er muss seine Aufmerksamkeit vielmehr schweifen lassen von den Bedürfnissen des Einzelnen zu denen der Gruppe und spontan auf das reagieren, was seine größte Aufmerksamkeit verlangt. Die Gruppenprozesse treten somit als Störung von Einzelgesprächen auf. Wichtiger ist, dass die zu integrierende Methode die spontane Handlungsfähigkeit des Betreuers verbessert, indem sie ihm z.B. einen einfachen Orientierungsrahmen anbietet.
2. Forderung: Die Therapie oder therapeutische Methode darf keine Verfremdung des pädagogischen Alltags bewirken.
Fachlichkeit darf nicht zu Fachjargon im Umgang mit den jungen Menschen führen. Ein junger Mensch, der aufgefordert wird, seine Übertragungen aufzugeben, wird den Betreuer nicht verstehen und es sieht für mich auch nicht sehr sinnvoll aus, zunächst eine sprachliche Einführung anzubieten, bis ich einem jungen Menschen zu helfen vermag. Therapie muss also bei einer Integration in den pädagogischen Alltag befreibar von Fachjargon sein, ohne an Wirksamkeit einzubüßen.
Sicher muss ein Pädagoge seine Handlungen reflektieren, aber eine langwierige Diagnostik ist für ihn nicht möglich, denn er muss dem jungen Menschen vom Augenblick seiner Aufnahme in der Gruppe an begegnen und kann nicht als Neutrum gelten, bis der diagnostische Vorgang abgeschlossen ist. Angemessen ist darum ein therapeutischer Ansatz, der die zeitliche Trennung von Diagnostik und Behandlung aufgibt, zugunsten eines Prozesses, der in der stetigen Interaktion der Beteiligten eine Modifikation von Hypothese und Handlung erlaubt. Anders ausgedrückt: Der Pädagoge bildet sich eine Hypothese über den jungen Menschen, agiert ihr entsprechend und verändert seine Vorstellung gemäß den dabei gemachten Erfahrungen. Da dies der sowieso permanent ablaufende Vorgang zwischen Menschen ist, geht es jetzt nur noch darum, diesen Vorgang zu präzisieren. Dies erreicht man mit der Umsetzung der ...
3. Forderung: Die Therapie oder therapeutische Methode muss dem Pädagogen bei der Entwicklung seiner ureigensten Fähigkeiten helfen.
Der Pädagoge ist sein eigenes Werkzeug. Wenn er etwas bewirken will, dann muss er sich selbst einsetzen. Um sich selbst einsetzen zu können, muss er sich kennen lernen, seine Wahrnehmungsfähigkeit schulen und seine Handlungen realistisch gestalten. Meines Erachtens können diese Fähigkeiten nur von einer so genannten ganzheitlichen Therapieform gefördert werden, die davon ausgeht, dass therapeutisches Handeln ein Interaktionsprozess ist, in der der Therapeut sich bewusst ist, dass er und sein Klient sich gegenseitig beeinflussen und voneinander lernen, in der die Beachtung von allen Aspekten menschlichen Seins wichtig genommen wird, wie Verhalten, Emotionen und Gedanken.
3. Erziehungshaltung
Die Motive und Interessen, die ein Pädagoge für seine Tätigkeit hat, beeinflussen die Art und Weise wesentlich, wie er seine Berufsrolle ausfüllt. Motive und Interessen legen ihn in seiner pädagogischen Zielsetzung ebenso fest, ebenso wie in seiner Wahrnehmung und Handlung. Für jeden Pädagogen und auch für jeden anderen Menschen in sozialer Verantwortung ist darum die Auseinandersetzung mit den Beweggründen für seine Berufswahl und für sein aktuelles Erleben in seinem Beruf eine grundlegende Voraussetzung, will er nicht auf Klarheit über die eigenen Anteile am Geschehen verzichten. Wer sich entscheidet, auf diese Klarheit zu verzichten, ist selbstverständlich nicht ohne Einfluss, aber sein Einfluss ist unbewusst und unkontrolliert. Der Schulpädagogik ist dieser unbewusste und unkontrollierte Einfluss bekannt und sie hat für ihn, wenn er systematisch erfolgt, den Begriff "geheimes Curriculum" geprägt.
Im Folgenden beschreibe ich grundlegende Erziehungshaltungen, wie sie durch humanistische Ansätze in der Pädagogik und Psychologie vertreten werden. Sie sind die Haltungen, die auch für die Gestaltpädagogik gelten. Auch an diesem Punkt ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass Haltungen nicht theoretisch erworben werden, sondern im Erleben. Diese theoretische Betrachtung wird darum in der Fortbildung des Gestalttherapeuten oder -pädagogen noch durch die Erforschung seiner individuellen Motive zum Beispiel in Selbsterfahrung und Supervision ergänzen.
3.1. Humanismus in der Erziehung
Wenn ich mit Psychologen spreche, dann höre ich als Motiv für ihre Berufswahl häufig, dass sie an anderen Menschen interessiert sind und ihnen helfen wollen. Diese Motive, die ich als Aspekte von Menschlichkeit verstehe, sind die Eigenschaften, die landläufig der Psychologie als zentrale Grundhaltung zugeschrieben werden. Wenn dann der Begriff „humanistische Psychologie“ genannt wird, klingt er wie eine Tautologie, wie „kaltes Eis“ oder „spitze Nadel“. Aber was Menschlichkeit oder Humanismus ist, wird nicht von allen Menschen und wurde nicht zu allen Zeiten gleich gesehen. Für die Darstellung der Gestaltpädagogik, die fest in der humanistischen Psychologie verwurzelt ist, muss darum der Humanismusbegriff erläutert werden.
Der Gedanke des Humanismus hat eine lange Tradition, auch wenn das Begriffswort „Humanismus“ erst im 19. Jahrhundert geprägt wurde. Der Ursprung des Wortes ist im griechischen „humanitas“ zu finden, das übersetzt soviel wie „Menschlichkeit“ bedeutet. Die griechischen Philosophen der Antike forderten, dass der Mensch zu seiner wahrhaften Bestimmung erzogen werden solle und gingen davon aus, dass sie selbst hierfür zuständig seien. Ihre Schüler sollten durch rhetorische Einflüsse geformt und von Vernunft bestimmt werden. Was unter der wahrhaften Bestimmung zu verstehen sei, wurde dabei von ihnen gleich mit vorgegeben. In ihrer Entwicklung waren ihre Schüler somit fremdbestimmt, auch wenn sie dies durch die geschickte rhetorische Manipulation nicht unbedingt bemerkten. Mich selbst hat die Lehr- und Denkweise von Sokrates, so wie sie in den Werken von Plato beschrieben wird, sehr fasziniert.
Seit der griechischen Antike hat die Vorstellung, was das „wahre Mensch-Sein“ ist, mehrfach Veränderungen erlebt. Der Begriff „humanitas“ wurde zum Beispiel zeitweilig verurteilend gebraucht, wenn die „wahre menschliche Natur“ als dämonisch oder triebhaft angesehen wurde und die Ratio, der Verstand, oder der Glaube für das menschliche Verhalten die Oberhand bekommen sollte. Bei dieser Betrachtungsweise stand der Begriff für menschliche Schwäche und Sündhaftigkeit. Er wurde aber auch zu anderen Zeiten in der Abwandlung „humaniora“ verwendet, um sich als herausragend aus der Masse zu bezeichnen, wenn das eigene „wahre Mensch-Sein“ von „höheren Werten“ bestimmt sein sollte. Selbstverständlich wird auch bei dieser Philosophie dem Verstand und dem Glauben der wesentliche Einfluss auf das Verhalten zugestanden.
Unter Wilhelm v. Humboldt nahm „Humanismus“ eine gesellschaftskritische Bedeutung an. Humboldt forderte, sich selbst als „Neuhumanisten“ sehend, dass Erziehung in kritischer Distanz zu Ökonomie, Staat und Gesellschaft erfolgen müsse. Für ihn war die Erziehung nach humanistischem Ideal eine Erziehung zur Gleichheit, die gesellschaftliche Schranken überwinden sollte. Hätte er seine Ideen umsetzen und entsprechende Erziehungseinrichtungen schaffen können, dann hätte er zumindest die Fremdbestimmung der Entwicklung des Menschen durch die Herrschaftsverhältnisse vermindert.
Die griechischen Philosophen mit ihrem „rationalen Humanismus“ waren auch zu ihrer Zeit nicht unumstritten. Und parallel zu der langen Geschichte der Vernunft betonenden Linie der humanistischen Schulen, gab es immer Denker, die sich hiervon distanzierten. Das, was als „ganzheitlicher Humanismus“[4] aufgefasst wird, entstand durch die kritische Auseinandersetzung von Rousseau, Pestalozzi etc. mit den gesellschaftlichen und schulischen Bedingungen ihrer Zeit. Für sie war der ganzheitliche Humanismus also Kontrapunkt zu gesellschaftlichen Verhältnissen und somit keineswegs von ihnen unabhängig. Das Abhängigkeitsverhältnis lässt sich als reziprok bezeichnen, ähnlich wie ein junger Mensch seine ersten Schritte in die Selbständigkeit über die Opposition gegenüber den Eltern erprobt. Die heutige ganzheitliche humanistische Psychologie und Pädagogik hat sich von einem vorrangig gesellschaftskritischen Ansatz emanzipiert, hin zu einer selbstbewussten eigenständigen Orientierung. Sie definiert ihre grundlegenden Prinzipien nicht als Alternative zu vorherrschenden Normen und Werten, auch wenn sich diese eindeutig voneinander abheben, sondern sieht sich vielmehr als Teil der konsequenten Umsetzung eines globalen Paradigmenwechsels in den Wissenschaften. Diese faszinierende Entwicklung beschreibt Friedjoff[5] Capra in seinem Buch "Wendezeit", dass ich zur Lektüre empfehlen möchte.
Ganzheitlicher Humanismus in Psychologie und Pädagogik bedeutet, sich über den Primat des Geistes hinwegzusetzen, Intuitionen und Emotionen als natürlichen Bestandteil menschlichen Seins anzuerkennen und einzubeziehen und die Selbstbestimmung des Menschen zu betonen:
Der Mensch ist eine Einheit von Körper, Verstand und Gefühlen. Der Zwang, einem fremdbestimmten Normen- und Wertesystem entsprechen zu müssen, kann aufgegeben werden. Mit der Sicherheit, den eigenen Gefühlen vertrauen zu können, wird einem positivistischem Denken Platz gemacht, mit dem Carl Rogers[6] (S.99) den Menschen wie folgt beschreibt: „... der innerste Kern der unmenschlichen Natur, die am tiefsten liegenden Schichten seiner Persönlichkeit, die Grundlage seiner tierischen Natur ist von Natur aus positiv - von Grund auf sozial, vorwärtsgerichtet, rational und realistisch.“ In konsequenter Umsetzung dieses Ideals haben Pädagogen, Psychologen schon früher ihre Arbeit gestaltet und sind somit Wegbereiter für pädagogische und therapeutische Entwicklung geworden.
3.2. Antiautoritäre Erziehung
Im Jahre 1960 veröffentlichte A.S. Neill[7] sein Buch mit dem Titel „Summerhill“, in dem er seine Arbeit und seine Ideale beschrieb. Dieses Buch wurde in den folgenden Jahren zum Kultbuch alternativer Pädagogen und die darin beschriebene antiautoritäre Erziehung zu einem festen Begriff. Die Kritik an unmenschlicher repressiver Pädagogik wurde durch diesen Ansatz lauter und es wurde immer mehr die Forderung nach „offenen Schulen“ und „Alternativen Erziehungssystemen“ gestellt. Man kann bedauern, dass auch Vertreter einer globalen Gesellschaftskritik diesen Ansatz für sich entdeckten, denn mit ihrer Erfolglosigkeit in der gesellschaftlichen Neugestaltung verloren auch die Ideale von Neill an Überzeugungskraft und Möglichkeit in der Pädagogik durchschlagende Veränderungen herbeizuführen. Der gesellschaftskritische Standpunkt beherrschte die weitere Entwicklung und die antiautoritäre Erziehung wurde mehr und mehr mit gesellschaftlicher Utopie, ja sogar Spinnerei gleichgesetzt und nicht als realistische Alternative in der Pädagogik akzeptiert.
Welche Grundideen hat die antiautoritäre Erziehung?
- Ein Mensch lernt nur, was er wissen muss und wissen will, was er zum Überleben und Leben benötigt und/oder was sein Interesse weckt.
- Es ist wesentlich wichtiger, dass er lernt, wie man lernt, als faktisches Wissen anzusammeln. Nur so kann er den sich wechseln Anforderungen im Leben gewachsen sein und sich jeweils das Wissen aneignen, das er benötigt.
- Es ist ebenso wichtig zu lernen, wie man fühlt, wie zu lernen, wie man denkt.
Vertreter der antiautoritären Erziehung werfen autoritären und auch „charitativen“ Pädagogen vor, dass sie mit ihrer Haltung den jungen Menschen die Freude am Leben nehmen und ihnen vermitteln - beabsichtigt oder nicht - dass sie minderwertig und von Hilfe abhängig seien. Antiautoritäre Pädagogen setzen dem Zwang und auch dem Motivieren und Anleiten zu fremdbestimmten Verhalten, die natürliche Neugier, eine jedem Menschen innewohnende Motivation, entgegen. Junge Menschen sollen das Recht haben, ihre Aktivitäten selbst zu wählen und ihre Lehrer oder Erzieher sollen lediglich nötige Informationen bereitstellen. Sie vertrauen auf einen Prozess, in dem das Lerninteresse entsteht und die Konfrontation mit der Realität selbst für die Zielrichtung des Lernens sorgt. Eine vergleichbare Idee hatte die dänische Tvint-Schule ihrem Konzept zugrunde gelegt und umgesetzt.
3.3. Demokratische Erziehung
Carl Rogers[8] hat die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie entwickelt. Rogers betont in den Grundsätzen dieser Therapieform, dass jeder Mensch grundsätzlich die Fähigkeiten besitzt, konstruktiv mit seiner Lebenssituation fertig zu werden. Wird er zum Klienten, dann hat er eine Störung, beziehungsweise ein Problem, weil er diese Fähigkeiten zurzeit nicht nutzt. Der Therapeut braucht somit nicht das Problem stellvertretend für den Klienten zu lösen, sondern sein Ziel muss es vielmehr sein, die Fähigkeiten des Klienten (wieder) freizusetzen. Und Rogers zieht die Schlussfolgerung: Wenn dies in der Therapie möglich ist, dann müssen sich Hypothese und Methode auf Unterricht und Erziehung übertragen lassen.
Rogers Ansatz ist, auch nach seiner eigenen Auffassung, politisch bedeutsam. Er hat für eine autoritäre Kultur keine Relevanz, denn er ist ein demokratisches Erziehungssystem: Er fördert selbstinitiierte Handlungen und Verantwortungsgefühl, befähigt zu Selbstlenkung und Kreativität, zu wirkungsvoller Kooperation mit anderen. Menschen, die eine solche Erziehung genossen haben, werden eine repressive Struktur nicht anerkennen und immer eine Veränderung anstreben.
Grundlegende Ideen des personenzentrierten Ansatzes sind:
- Kein Mensch kann einem anderen etwas lehren, sondern nur dessen Lernen fördern. Die Wahrnehmung des Lehrenden oder Erziehenden muss darum auf den Betreuten gerichtet werden, da seine Interessen und seine Förderungsmöglichkeiten ausschlaggebend sind.
- Jeder Mensch nimmt nur die Dinge auf, die er für die Erhaltung oder Erhöhung der Struktur seines Selbst als wichtig erachtet. D.h.: Interesse entsteht nur für etwas, dass der eigenen Orientierung dient. Biete ich einem Menschen etwas an, das sein Selbst stört, dann wird er die Annahme in irgendeiner offenen oder verdeckten Form zu verweigern versuchen.
Aus diesen Erkenntnissen heraus schlägt Rogers vor, für die Erziehung im Unterricht eine Atmosphäre des Akzeptierens zu schaffen und den Schüler darin zu fördern, eigene Absichten oder gemeinsame Absichten in der Gruppe zu entwickeln. Der Pädagoge muss nach seiner Vorstellung in der Lage sein, die Rolle zu wechseln, vom Leiter der Gruppe, der auf geäußerte emotionale Einstellungen und Gefühle reagiert, zum Leiter, der dem Gruppenprozess eine Struktur geben kann.
Anne-Marie und Reinhard Tausch[9] haben sich auf dem Hintergrund ihres personenzentrierten Arbeitens intensiv mit der Haltung zwischen Lehrenden und Lernenden, zwischen Erziehern und Erzogenen auseinandersetzen. Dabei lassen sie eine inhaltliche Nähe zu Carl Rogers und eine vergleichbare menschliche Haltung erkennen, die auffällig, aber nicht zufällig ist, denn sie sind beide selbst Gesprächspsychotherapeuten. Ihr vorrangiges Ziel, dass sie in ihrer „Erziehungspsychologie“ formulierten, ist Lehrern, Erziehern und Eltern dazu zu verhelfen, dass sie „... in der alltäglichen Beziehung von Person zu Person bedeutungsvolle seelische Vorgänge und die konstruktive Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern“. Sie schlagen für die BetreuerInnen vor, sich psychosoziale Grundwerte anzueignen, die für jedes humane Zusammenleben von Menschen wichtig sind: Selbstbestimmung, Achtung der Person, Förderung der seelischen und körperlichen Funktionsfähigkeit, sowie Anerkennung einer sozialen Ordnung. Wesentlich für sie war, dass der Erwachsene für den Heranwachsenden ein Modell darstellen soll: Lehrer und Erzieher sollen beispielhaft die Eigenschaften zeigen, die sie vermitteln möchten. Wenn sie als Modell attraktiv und erfolgreich sind, haben sie die besten Chancen, dass ihr Verhalten übernommen wird.
Der Ansatz des Ehepaares Tausch unterscheidet sich von Neills Vorstellungen insbesondere durch die Gewichtung der sozialen Ordnung. Selbstbestimmung bedeutet bei ihnen darum auch nicht jede Freiheit für eine Person, sondern sie betonen, dass für eine Gemeinschaft eine gewisse Ordnung und Regelung des Zusammenlebens erforderlich ist, damit zum Beispiel die Grundwerte der Selbstbestimmung jedes einzelnen gewährt sind und eine verantwortungsvolle soziale Kooperation gefördert wird. Somit stellen sie die Forderung auf, dass eine nicht-autoritäre Haltung auch unter den Lernenden erforderlich ist und angestrebt werden soll.
3.4. Konfluente Erziehung
Lernen besteht nicht nur aus einer Wissensansammlung, sondern auch aus der Bewertung des Erfahrenen, aus dem Herstellen einer Beziehung zwischen der Information oder der Erfahrung die ich mache und dem Entdecken, was diese für mich bedeutet. Anders ausgedrückt: Wenn wirklich gelernt werden soll, dann müssen Lehrer und Erzieher den Menschen ganzheitlich sehen, müssen begreifen, dass der junge Mensch denkt und fühlt. Sie müssen dem jungen Menschen gestatten, dass er das Wissen, dass an ihn heran getragen wird, nicht einfach schluckt, ohne es zu verdauen, sondern dass er es kritisch beleuchtet, analysiert, aus seinem subjektiven Blickwinkel intellektuell und emotional bewertet, in eine Beziehung zu seinem eigenen Leben setzt.
Aus diesen Überlegungen heraus hat George Brown[10] die „konfluente Erziehung“ aus der Gestalttherapie entwickelt. Gemäß seiner Vorstellung soll in jedem Unterricht, egal ob es sich um naturwissenschaftliche oder musische Fächer handelt, der Ausdruck von Emotionen gefördert werden, da sich so Interesse und Beteiligung erhöhen. Insbesondere in den Weiterentwicklungen dieses Ansatzes, die die Förderung von verhaltensgestörten und behinderten jungen Menschen zielen, ist das Konzept erfolgreich. Hilarion Petzold und Ulrike Mathias[11] berichten über solche Versuche und betonen dabei, dass den Pädagogen eine Bürde genommen wird, indem der „Zwang zur Normalität“ aufgegeben wird. Den Pädagogen würden Frustrationen erspart und dem Kind würde die Chance gegeben, sich selbst zu mögen, wenn es trotz seiner Störungen oder Behinderungen sein dürfe, wie es ist und dennoch angenommen würde.
Die konfluente Erziehung ist von ihrer grundsätzlichen Orientierung her ein Erziehungsmodell für die Schule: Ihre Methoden zielen auf einen humaneren Unterricht und sie hat nicht die Förderung des ganzheitlichen Erlebens unmittelbar zum Ziel. Sondern sie ist ein Konzept, das auf dem Hintergrund von Ganzheitlichkeit den Erwerb von Wissen in menschenfreundlicherer Form ermöglicht.
3.5. Die Erziehungshaltung des Gestaltpädagogen
Der gestaltpädagogische Ansatz setzt die Entwicklung der humanistischen Pädagogik fort. Er stellt dabei die bestehenden Ansätze humanistischer Pädagogik nicht in Frage und will sie auch nicht in ihrer Bedeutung schmälern. Vielmehr will er auf ihnen aufbauen und sie mit seinen, aus der Gestalttherapie resultierenden Möglichkeiten ergänzen und mit der Gestalttheorie einen Bezugsrahmen schaffen.
Für die Gestaltpädagogik ist wesentlich, dass die Entwicklung von Selbststeuerungs- und Erlebnisfähigkeit ihr unmittelbares und eigentliches Ziel ist. Auf diesem Hintergrund fügt sie den humanistischen pädagogischen Ansätzen Prinzipien, Erfahrungen und Methoden der Gestalttherapie hinzu und entwickelt eigene Verfahren für ihren speziellen Bedarf. In der Gestaltpädagogik wird die Trennung überwunden, die häufig zwischen Therapie und Pädagogik in übertriebener Weise wahrgenommen oder postuliert wird. Gestalttherapie und -pädagogik arbeiten am gleichen Wachstumsprozess des Menschen, kennen keine unterschiedliche Wertigkeit ihrer Aufgaben und können sich ohne Konkurrenz in der Praxis ergänzen.
Die antiautoritäre Erziehung von Neill hat viele Diskussionen und auch negative Reaktionen ausgelöst. Ein Teil dieser negativen Reaktionen beruhte sicherlich darauf, dass Erzieher und Eltern den antiautoritären Aspekt mit einer Laissez-faire-Haltung verwechselt haben. Entweder haben sie angenommen, dass sich in der antiautoritären Haltung ein Desinteresse an den Kindern und Jugendlichen zeige, oder sie haben gar selbst mit der Maske einer alternativen Erziehung eine solche Einstellung verdeckt (siehe untenstehende Darstellung). Es mag auch sein, dass Neill selbst einiges nicht deutlich genug hervorgehoben hat: Wer sein Buch sorgfältig liest und Schilderungen über Summerhill berücksichtigt wird erfahren, dass er für die Kinder und Jugendlichen in seiner Betreuung ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit hatte, zugewendet und warmherzig war, für sie Ansprechpartner und Ratgeber war, den Kontakt zu ihnen gesucht hat.
Erziehungsstile:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Der Begriff „anti-autoritär“ ist also irreführend, solange er nicht klar abgetrennt wird von der Autorität durch Persönlichkeit. Neill hatte sicherlich Persönlichkeit und darum auch Autorität, ohne autoritär aufzutreten. Bezieht sich „anti-autoritär“ auf die Beschreibung der Alternative zur anmaßenden repressiven Haltung, ist er zutreffend. Wird er aber verwendet, um jede Einflussnahme abzulehnen, dann wird übersehen, dass jedes menschliche Leben ein Leben in Gemeinschaften und damit sozialer Beziehung ist. Rogers und das Ehepaar Tausch haben betont: Pädagogen nehmen Einfluss, ob sie wollen oder nicht. Und Kommunikationsforscher haben herausgefunden, dass es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren[12].
Pädagogen haben in der sozialen Gemeinschaft mit ihren Kollegen und mit den jungen Menschen nicht nur ein Recht auf einen eigenen Standpunkt, sondern die Äußerung ihres Standpunktes ist sogar pädagogisch notwendig. Ohne die Darstellung ihrer eigenen Persönlichkeit können sie für die jungen Menschen kein signifikantes Modell für das Vertreten eigener Bedürfnisse in Gemeinschaften und für das Auftreten in Konflikten sein. Einrichtungen, in denen es gelang einen anti-autoritären Stil (im Sinne von ausagieren lassen und Grenzsetzung vermeiden) zu realisieren, schufen ein soziales Umfeld, dass mit der Realität außerhalb wenig Gemeinsamkeit hatte. Kinder und Jugendliche, die in ihnen aufwuchsen, hatten außerhalb erhebliche Orientierungsprobleme haben waren in anderer Umgebung nicht gemeinschaftsfähig.
Ausschlaggebend für eine gesunde Erziehungshaltung ist nicht der Verzicht auf jede Autorität, sondern die Realisierung einer partnerschaftlichen Grundeinstellung gegenüber Kindern und Jugendlichen, in der Form, wie sie z.B. das Ehepaar Tausch und Carl Rogers fordern. Eine solche partnerschaftliche Grundeinstellung ist daran erkennbar, dass in der Kommunikation auf die Darstellung von Machtverhältnissen verzichtet wird und dass die Umgangsweise umkehrbar ist, das heißt: So wie der Pädagoge dem jungen Menschen begegnet, muss dieser auch dem Pädagogen begegnen können und dürfen. Bei einer solchen Einstellung besteht die Bereitschaft des Pädagogen, eigene Erfahrungen und Ansichten als Information und nicht als unveränderliche Norm anzubieten, sie auch in Frage stellen zu lassen.
Kinder und Jugendliche müssen die Möglichkeit haben, eigene Standpunkte zu entwickeln und in der Auseinandersetzung zu erproben, wenn sie selbstverantwortliche Erwachsene werden sollen. Dies setzt voraus, dass Erwachsene den Konflikten mit ihnen nicht ausweichen, dass sie im Konflikt keine Unterdrückung erfahren und dass sie Freiraum für Experimente zugestanden bekommen, in dem sie nicht unter Erfolgszwang stehen. Eine solche Haltung ist nicht-autoritär und sozial-integrativ, sie ist die Haltung, die sich in der humanistischen Pädagogik und damit auch in der Gestaltpädagogik in den Umgangsweisen und Zielen niederschlägt. Im Folgenden möchte ich diese Ziele zusammenfassend darstellen: Der Gestaltpädagoge...
- akzeptiert die Bedürfnisse des jungen Menschen und stellt Erfahrungsmöglichkeiten bereit, die dessen Potential berücksichtigen,
- nimmt die eigenen inneren Prozesse und Bedürfnisse wahr, erkennt die wichtige Rolle von Gefühlen an und berücksichtigt persönliche Werte und Wahrnehmungen im Erziehungsprozess,
- versucht, ein Bewusstsein persönlicher Wertschätzung zu entwickeln, für sich selbst und für den anderen,
- versucht, den jungen Menschen in den Prozess seiner Erziehung einzubeziehen,
- entwickelt ein Lebensklima, das persönliches Wachstum fördert und das vom jungen Menschen als interessant, verstehend, unterstützend uns angstfrei empfunden wird,
- entwickelt einen echten Respekt für den Mitmenschen und vermittelt die Fähigkeit, Konflikte zu lösen.
Die Berufsrolle (Ü)
Die Übung "Berufsrolle" biete ich gerne in der Anfangszeit einer länger dauernden Fortbildung an. Einerseits verhilft sie, Material für die Diskussion der Inhalte der Berufsrolle des Pädagogen zu verschaffen und zum anderen ist ihr Ziel, zu mehr Bewusstheit darüber zu verhelfen, wie die Teilnehmer der Fortbildung ihre Tätigkeit bewerten, welche Fantasien sie mit ihr verbinden, welche Ideale sie mit ihr verknüpfen. Voraussetzung für diese Übung ist die Bereitschaft, sich auf Fantasien einzulassen, eine gute Entspannung und eine ungestörte Atmosphäre. Hilfreich ist ein autogenes Training als Einleitung. Ich halte es grundsätzlich für sehr hilfreich vor Übungen oder Experimenten, die auf Fantasie zurückgreifen, eine Phase der Entspannung einzufügen. Die Entspannung hat zur Folge, dass die Teilnehmer Hemmungen abbauen und mehr Zugang zu sich selbst finden. Wenn ich diese Übung in einem Seminar anleite, dann bitte ich die Teilnehmer zu wählen, ob sie entspannt sitzen oder liegen wollen. Für einige ist das Sitzen angenehmer, weil sie im Liegen einschlafen würden und für andere ist das Liegen angenehmer, weil ihnen längeres Sitzen anstrengend ist. Erproben Sie für sich die vorteilhafteste Ausgangsposition. Da sie während der Übung die Augen schließen sollten, müssen Sie sich die Anleitung entweder (sinngemäß) merken oder aber auf eine Tonkassette sprechen und dann abhören. Es ist auch möglich, sie von einem guten Freund vorlesen zu lassen. Zwischen den Anweisungen sollten sie immer einige Augenblicke vergehen lassen, damit Zeit zur Verarbeitung vorhanden ist.
Machen Sie es sich im Liegen oder Sitzen bequem. Schließen Sie nun ihre Augen und entspannen Sie sich, zum Beispiel, indem Sie autogen trainieren. Nach einiger Zeit der Entspannung lenken Sie ihre Aufmerksamkeit auf ihren Beruf, indem Sie sich sagen: Ich bin Erzieher, Sozialarbeiter oder was immer zutrifft. Was für Assoziationen haben Sie bei diesem Gedanken... Machen Sie sich bewusst, was Ihnen ihr Beruf in diesem Augenblick bedeutet. Was ist Ihnen wichtig daran?... Was macht Ihnen Spaß und was belastet Sie?... Ist ihr Beruf so, wie Sie ihn sich vorgestellt haben, bevor Sie ihn ergriffen? Hat er sich im Laufe der Jahre gewandelt?...
Stellen Sie sich nun einen konkreten Jugendlichen oder ein Kind in ihrer Betreuung vor Wen haben Sie gewählt?... Wie sieht dieser junge Mensch in ihrer Fantasie zurzeit aus?... Was hat er für Probleme? Womit belastet er Sie?... Was hat er für Stärken? Womit erfreut er Sie?... Was hat er vermutlich für Hoffnungen und Wünsche für seine Zukunft?... Wie wird er sich wohl entwickeln?... Wird er seine Wünsche realisieren können?... Was soll er nach ihren Vorstellungen erreichen? Haben Sie Ziele für ihn?... Wird er sich ohne ihre Hilfe in seinem Leben zurechtfinden?...
Da in der Fantasie alles möglich ist, stellen Sie sich nun vor, dass Sie auf eine Zeitreise gehen. Langsam verblasst das Bild des Jugendlichen und es wird für einen kurzen Augenblick völlig dunkel Stellen Sie sich vor, dass in diesem Augenblick eine lange Zeit vergeht. Sie reisen in ihrer Fantasie 10 Jahre durch die Zeit... Jetzt wird es langsam wieder hell und die 10 Jahre sind vergangen. Der junge Mensch von damals steht nun als Erwachsener vor Ihnen... Stellen Sie sich vor, alle ihre pädagogischen Bemühungen haben bei diesem Menschen Erfolg gehabt. Er ist genau so geworden, wie Sie es sich gewünscht haben.
Betrachten Sie ihn unter diesen Gesichtspunkten... Wie sieht er jetzt aus?... Wie verhält er sich?... Welchen Beruf wird er haben?... Wird er verheiratet sein?... Wird er mit seinem Leben zufrieden sein?... Stellen Sie ihm in der Fantasie Fragen und hören Sie ihm zu, was er über sein derzeitiges Leben zu berichten hat... Fragen Sie ihn, was ihm auf seinem Weg geholfen hat... Fragen Sie ihn, wie Sie hilfreich für ihn waren... Und fragen Sie ihn auch, wie er für sich selbst gesorgt hat...
Beenden Sie die Übung, wann Sie möchten, indem Sie sich von dem Menschen verabschieden und in ihrer Fantasie in die Gegenwart zurückreisen. Bevor Sie aufstehen, beleben Sie aber erst einmal durch Strecken und Räkeln ihren Körper und werten Sie erst nach einer Weile die Übung für sich aus. Lassen Sie zur Auswertung der Übung noch einmal an sich vorüberziehen, was Sie in der Fantasie erlebt haben. Betrachten Sie dann folgende Fragen und beantworten jene, die Sie beantworten möchten, ergänzen Sie diese Fragen um jene, die Ihnen selbst wichtig sind:
- Was ist für Sie wichtig in ihrem Beruf?
- Welche Kriterien sind Ihnen bei der Betrachtung und Bewertung
- der jungen Menschen in ihrer Betreuung wichtig?
- Welche Ziele haben Sie für die jungen Menschen?
- Was sind ihre Kriterien für ihren beruflichen Erfolg?
- Wie haben Sie den jungen Menschen bisher geholfen und wie
- wollen Sie ihnen in Zukunft helfen?
- Welche erzieherischen Ideale haben Sie?
Es kann für Sie eine wichtige Erfahrung sein, mit den Erlebnissen aus ihrer Fantasie den jungen Menschen zu betrachten. Versuchen Sie doch herauszufinden, ob sich ihre Haltung ihm gegenüber verändert hat oder ob Sie Neues an ihm entdecken.
4. Prinzipien der Gestaltpädagogik
4.1. Bezug zur Gestalttherapie
Die Gestalttherapie hat ihre Wurzeln in der humanistischen Psychologie. Auf die gleichen humanistischen Grundlagen bauen noch eine ganze Reihe weiterer psychotherapeutischer Verfahren und Methoden auf. Ihnen gemeinsam sind eine am Menschen orientierte Denk- und Erlebensweise, was unter anderem bedeutet, dass der Mensch als eine Einheit von Denken, Fühlen und Verhalten verstanden wird und jeder Organismus als Bestandteil eines Feldes oder Systems mit komplexem Bedingungsgefüge verstanden wird.
Der Begriff „Gestalt“ stammt aus der experimentellen Wahrnehmungs- und Erkenntnispsychologie von Koffka, Lewin und Goldstein, die verschiedene Wahrnehmungsphänomene erforschten und formulierten. Hierzu gehört unter anderem die Beobachtung, die der Gestalttherapie ihren Namen gab, das Gestaltphänomen: Menschen neigen dazu, visuelle Eindrücke so zu organisieren, dass sie eine sinnvolle Einheit, eine Gestalt bilden. Der deutsche Arzt und Psychotherapeut Fritz Perls[13] erkannte, dass diese Ergebnisse und Schlussfolgerungen nicht nur für die Wahrnehmung, sondern für das menschliche Erleben an sich Relevanz haben. Er übertrug sie darum auf seine psychotherapeutische Arbeit und legte so den Grundstein für die Gestalttherapie. Perls hat zumeist in den USA gearbeitet, nachdem er wegen seiner jüdischen Abstammung aus dem nationalsozialistischen Deutschland flüchten musste. Hier hat er zusammen mit anderen Therapeuten humanistischer Orientierung in Esalen eine Stätte kreativen Schaffens ins Leben gerufen, von der über viele Jahre hinweg die Entwicklung von Therapie- und sozialen Arbeitsformen ausging. Mit dieser Entwicklung verbinden sich Namen wie Ruth Cohen[14], Ida Rolf (Rolfing), Laura Perls, Paul Goodman, Jacob Moreno (Psychodrama) und viele mehr. Sie haben zusammen mit Perls erheblich zur so genannten New-Age-Bewegung beigetragen.
Perls und auch alle anderen mir bekannten Gestalttherapeuten haben die Gestalttherapie nie als isolierte Technik oder Therapieform betrachtet. Vielmehr haben sie gerade auf das Wachstum des Ansatzes gesetzt, der hierfür auch aus anderen Konzepten Erfahrungen und Inhalte schöpft. Sie haben - teils sehr pragmatisch - verschiedene Therapieformen und -methoden integriert, gemäß dem Gestaltprinzip, dass das Ganze mehr ist, als die Summe seiner Teile. Wegen dieser Integration wird heute auch vielfach von integrativer Gestalttherapie gesprochen. Des Weiteren wurde die Entwicklung auch durch Ansätze phänomenologischen und existentialistischen Denkens befruchtet, wie sie sich in fernöstlichen Philosophien finden. Beim Transfer von Gestalttheorie und -erleben in andere als sozialwissenschaftliche Bereiche entstand ebenfalls ein gegenseitig fruchtbarer Austausch, wie durch die Berücksichtigung anderer Wissenschaften, wie zum Beispiel astrophysikalischer Theorien durch Stemmler und Bock[15]. Dieser gegenseitige Austausch beeinflusst unter anderem auch den Prozess des Paradigmenwechsels in den Wissenschaften. Nach meiner Auffassung hat sich der österreichische Physiker Fridjof Capra[16] hervorgetan, diese Entwicklung umfassend zu beschreiben.
Schon im Laufe seiner frühen therapeutischen Arbeit erkannte der Psychoanalytiker Perls, dass ein Mensch Kraft und Motivation zu seiner Entwicklung oder zur Heilung seiner Persönlichkeit aus der bewussten Wahrnehmung der Gegenwart schöpft. Er setzte sich damit von der klassischen Psychoanalyse ab und postulierte das Grundprinzip, dass die Therapie permanent auf das Erleben im Hier-und-Jetzt zurückgreifen müsse.
Der Gestalttherapeut oder -pädagoge arbeitet mit diesem Prinzip, indem er seine eigene Wahrnehmung und die Wahrnehmung des Menschen, dem er hilft, immer wieder auf die Gegenwart lenkt. Nicht immer ist der Mensch mit dieser Hilfe einverstanden oder möchte die damit verbundenen Konsequenzen ertragen, denn dabei werden verdrängte leidvolle Erlebnisse gegenwärtig erlebbar, mit all ihren seelischen Verletzungen und dem damit verbundenen Schmerz. Um sich vor diesem Leid zu schützen, bringt ein Mensch der Wahrnehmung in der Gegenwart Widerstand entgegen, versucht den Kontakt mit seinen Sinneserlebnissen zu vermeiden. Wenn sich ein Mensch so gegen verändernde Einflüsse wehrt, dann ist diese Vermeidung nicht negativ zu bewerten, sondern als wichtige Äußerung seines Selbst anzuerkennen, als der aktuelle Versuch, seine psychische Balance aufrecht zu erhalten. Durch die Vermeidung ist zwar der gesunde Ablauf des Erlebens gestört, der Kontakt mit Teilen des Selbst und mit Teilen der Umgebung findet nicht oder reduziert statt, aber dennoch bedeutet Heilung nicht, den Widerstand zu ignorieren oder zu durchbrechen, sondern in zu akzeptieren, bis er im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung seine Notwendigkeit verliert und von selbst aufgegeben wird.
Aus den eben aufgezählten und im Folgenden noch ausführlicher dargestellten Prinzipien haben Gestalttherapeuten Vorgehensweisen für die Therapie abgeleitet. Mit diesen Vorgehensweisen zielen sie auf die Verbesserung der Wahrnehmung in der Gegenwart, die Überwindung der Trennung von Leib und Seele, die Stärkung der Selbst-Funktionen, sowie auf die Wiederherstellung eines guten Kontaktes zwischen Organismus und Umgebung. Die Ziele lassen sich zusammenfassen in dem Bestreben, die Fähigkeit des Menschen zu verbessern, seine Gestalten des Erlebens zu schließen.
Da die Ziele, die Haltungen des Helfers und die Methoden übereinstimmen, vermag ich derzeit die Frage, was Gestalttherapie und Gestaltpädagogik voneinander unterscheidet, nur so zu beantworten, dass ich feststelle: Es ergeben sich aufgrund der verschiedenen Arbeitsbedingungen verschiedene Schwerpunkte der Aufmerksamkeit und der Handlungsfelder, so dass Pädagoge und Therapeut aus einem gemeinsamen Pool von Möglichkeiten lediglich nach diesen unterschiedlichen Schwerpunkten wählen: Der Therapeut hat sein intensivstes Wirkungsfeld bei intrapsychischen Prozessen und arbeitet zumeist in Einzelgesprächen. Der Pädagoge im Gruppendienst wird sein Handeln vornehmlich auf interpersonelle und Gruppenprozesse lenken und so eher indirekt Einfluss auf intrapsychische Vorgänge haben, den Austausch zwischen Personen und die Entwicklung in der Gruppe fördern.
4.2. Die Gestaltbildung und Figurbildung
Als ich ein etwa 8 Jahre alter Schüler war, passierte mir Folgendes: Ich saß im Unterricht vor einem Zeichenblock und meine Lehrerin wollte, dass ich eine Blume male. Um mich herum waren alle meine Mitschüler emsig am Farbe mischen und klecksen. Mir war aber langweilig, weil ich hier stillsitzen sollte und viel lieber auf dem Schulhof hinter einem Ball her gerannt wäre. Und weil ich „zappelig“ und mit den Gedanken bei ganz anderen Dingen war, stieß ich gegen meine Palette, in der Farbe angerührt war. Sie schwappte über und auf meinem Blatt entstand eine kleine dunkelrote Pfütze. Viel Farbe war es nicht und ich faltete das Blatt einfach zusammen, damit es niemand sehen sollte. Später bekam meine Lehrerin dann durch einen Zufall meine „Zeichnung“ doch noch zu sehen und lobte sie, weil meine Blume so schön war. Sie war dem Wahrnehmungsphänomen der Figurbildung „zum Opfer gefallen“[17].
Ein für die Gestaltarbeit wesentliches Ergebnis der Wahrnehmungsexperimente ist die Entdeckung des Prozesses der Gestaltbildung, zu dem als wichtigster Bestandteil die Figurbildung gehört: Menschen strukturieren in diesem Vorgang ihre Wahrnehmung und ihr gesamtes Erleben: Fakten, Sinneswahrnehmungen, Verhaltensweisen und Phänomene werden von Menschen erst durch ihre Organisation definiert und nicht schon durch ihre Bestandteile. Erst durch die Organisation und durch ihre Differenzierung in Vordergrund und Hintergrund erhalten sie ihre eigenständige und besondere Bedeutung. Die Gestalt ist hierbei die organisierte Gesamtheit unseres aktuellen Erlebens und die Figur ist der Teil dieser Gestalt, der im Zentrum unserer Aufmerksamkeit ist. Der Prozess, der als Gestaltbildung bezeichnet wird, ist für die Gestalttherapie und Gestaltpädagogik namengebend gewesen. Er erklärt, dass Menschen zum Beispiel Gegenstände, auf die sie ihre Aufmerksamkeit richten, nicht als Unzusammenhängende Bruchstöcke wahrnehmen, sondern sie im Wahrnehmungsprozess zu einem sinnvollen Ganzen, zu einer Figur organisieren und sie vom Rest der Gegenwart als Hintergrund abheben. Dinge, Gedanken, Gefühle, Personen: Alles das, was in unserer Wahrnehmung in den Vordergrund tritt und von uns als ein Ganzes erlebt wird, ist Figur. Dieses Wahrnehmungsphänomen ist in einem Satz zusammengefasst, der lautet:
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Betrachtet man den Wahrnehmungsvorgang einmal differenzierter, dann wird man feststellen, dass unsere Sinnesorgane nicht in der Lage sind, die Umwelt schon sinnhaft, also mit ihren Strukturen und Gefügen aufzunehmen. Alle unsere Sinne fangen vielmehr physikalische Reize auf, die zunächst noch bearbeitet und in einen Zusammenhang gebracht werden müssen, damit sie vom Organismus verwertet werden können. Dieser Vorgang ist abhängig von unserer Erfahrung und von unseren Fähigkeiten zur Analyse und Synthese. Wir vergleichen unsere aktuellen Eindrücke mit unseren Erinnerungen, erkennen dabei wieder oder erleben Neues, dass wir erst verwertbar einordnen können, wenn wir es auf verschiedene Weise erfahren haben:
- Meine Lehrerin war bereit, meinen Klecks als Blume zu sehen, denn gemäß ihrer Erfahrung können manche 8-jährige Jungen Blumen noch nicht so besonders gut malen, sie sehen dann eher wie Kleckse aus. Bei mir hatte der Zufall noch etwas nachgeholfen und durch das Falten des Blattes waren symmetrische Konturen entstanden, die bei ihr den Eindruck einer Blume noch verstärkten.
- Ein Baum wird nicht als ein Sammelsurium von Holz und Blättern oder gar als eine Vermengung von Klecksen und Bewegungsfetzen wahrgenommen, sondern als eine Einheit, die in einem gewissen Rahmen auch Veränderungen standhält. Ein Baum bleibt für uns der gleiche Baum, auch wenn der Sturm in bewegt, wenn er im Winter seine Blätter verloren hat oder wenn er im Frühling in voller Blüte steht. Zudem sondern wir ihn als hervortretendes Element von seinem Hintergrund, von Landschaft, Häusern und Wegen ab.
Der Vorgang der Figurbildung gilt nicht nur für Dinge, sondern für alle Wahrnehmungen schlechthin - also auch für Ereignisse in sozialen Situationen. Fritz Perls[18] (1976) beschrieb ihn an Hand des Geschehens bei einer Cocktailparty:
„Ein Neuankömmling betritt den Raum. Er ist chronischer Alkoholiker und braucht dringend etwas zu trinken. Für ihn wird alles, die anderen Gäste, die Bilder an den Wänden, unwichtig sein und im Hintergrund bleiben. Er wird sich schnurstracks an die Bar begeben; sie wird von allen Objekten im Raum als einziges in den Vordergrund treten.“
Andere Gäste bringen andere Interessen mit sich, z.B. die Absicht eine Freundin zu treffen oder ein Bild zu sehen, dass sie für die Gastgeber gemalt haben. In Abhängigkeit von ihrem Interesse werden sie ihre Figur (die zu einem sinnvollen Ganzen organisierte Einheit) bilden. Sie werden ihren Blick auf der Suche nach der Freundin oder dem Bild durch den Raum schweifen lassen und alles andere in den Hintergrund drängen. Ohne Interessen wird die Szene für sie ungegliedert und bedeutungslos bleiben.
Für die Orientierung in unserer Umwelt, aber auch in unserer Innenwelt ist die Bildung von Figuren ein (über-)lebenswichtiger Vorgang. Immer wenn ich ein Bedürfnis entwickele oder ein Interesse erlebe, bin ich mir nicht sofort über dessen Zielrichtung im Klaren. Bedürfnis und Interesse sind noch eine Weile diffus und damit auch ihr Ziel. Manchmal ist der Augenblick des diffusen Zustandes allerdings von so geringer Dauer, dass wir ihn kaum oder gar nicht bemerken und den Eindruck einer spontanen Zielfestlegung. So wird uns das Bedürfnis nach Ruhe in Gegenwart einer kreischenden Kreissäge nahezu augenblicklich deutlich werden, aber die Wahl einer Berufsausbildung wird bei einem jungen Menschen wohl eine längere Zeit des Nachdenkens, der Gespräche und Beratungen beanspruchen. Alle diese Prozesse laufen aber nach dem gleichen Prinzip ab: Ich beginne mich, während ich meine diffusen Empfindungen verspüre, zu orientieren und nach einem geeigneten Objekt zu suchen, dass hierzu passt und meinen diffusen Zustand mindert. Wenn dies geschieht, dann tritt es mehr und mehr in den Vordergrund und wird zu meiner aktuellen Figur. Mit der Entdeckung eines geeigneten Objektes, mit der Bildung einer Figur bekommt meine Aktivität ein Ziel auf das ich meine folgenden Handlungen beziehen kann. Ohne die Eingrenzung auf eine Figur, ohne die Fähigkeit „Dinge“ in den Vordergrund zu stellen und andere in den Hintergrund zu verbannen, wäre mein Verhalten ungerichtet und uneffektiv.
Dinge, die ich in den Hintergrund dränge sind dennoch weiterhin gegenwärtig. Sie sind zwar nicht im Zentrum meiner Aufmerksamkeit, bestimmen aber meine Wahrnehmung und darum auch meine Handlung mit. Nehmen wir beispielsweise meinen Farbklecks: Trotz eventuell gleicher Form und Intensität hätte er meine Lehrerin nicht zu der Vorstellung gebracht, dass es sich um eine Blume handelt, wenn er auf dem Fußboden gewesen wäre. Und nehmen wir den Alkoholkranken auf der Party: Wenn sein Vorgesetzter anwesend ist, erscheint ihm unter Umständen die Bar gar nicht so verlockend. Er erlebt sie eventuell sogar als Verführung und als Gefahr bei dem Versuch, seinen Arbeitsplatz zu erhalten. Vermutlich wird er sich nur vorsichtig in ihre Nähe wagen und dann auch nicht zu „harten Sachen“ greifen, um seinen Alkoholspiegel auf das Maß seiner Bedürfnisse zu bringen, sondern vielmehr des Öfteren mit Sekt anstoßen und dabei seinen Chef einbeziehen.
[...]
[1] Ich gebrauche im Folgenden im spontanen Wechsel die männliche, die weiblich und die androgynisierte Schreibweise. Manchmal erscheint mir der Wechsel etwas verunsichernd für einen Leser oder eine Leserin, aber ich habe dennoch nicht darauf verzichten wollen und bitte um Ihre engagierte Nachsicht.
[2] Brezinka, W.: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft. München 1977.
[3] Gruen, Arno: Der Kampf um die Demokratie. Stuttgart, 2002
[4] Fatzer, G.: Ganzheitliches Lernen. Humanistische Pädagogik und Organisationsentwicklung. Paderborn 1998.
[5] Capra, F.: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. Bern, München, Wien 2004.
[6] Rogers, C.: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. München 1978.
[7] Neill, A.S.: Erziehung in Summerhill. München 1965.
[8] Rogers, C.: Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie. München 1978.
[9] Tausch, R. und Tausch, A.-M.: Erziehungspsychologie. Göttingen-Toronto-Zürich 1998.
[10] Brown, G.I. (Hg.) et al.: Gefühl und Aktion. Gestaltmethoden im Unterricht. Frankfurt a.M. 1978.
[11] in Brown 1978
[12] Watzlawick, P. (Hg.) et al.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern 1969.
[13] Perls, F.: Grundlagen der Gestalttherapie -Einführung und Sitzungsprotokolle. München 1999.
[14] Cohen, R.: Von der Psychoanalyse zur Themenzentrierten Interaktion. Stuttgart 1975.
[15] Stemmler, F.-M. und Bock, W.: Neuentwurf der Gestalttherapie. München 1987.
[16] Capra, F.: Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild. Bern, München, Wien 2004.
[17] Um einem möglichen Mißverständnis vorzubeugen: Mit meiner Unachtsamkeit und dem folgenden Irrtum meiner Lehrerin wurde keineswegs der Grundstein für ein bekanntes psychodiagnostisches Verfahren gelegt.
[18] Perls, F.: Grundlagen der Gestalttherapie -Einführung und Sitzungsprotokolle. München 1999.
- Arbeit zitieren
- Klaus Walter (Autor:in), 2004, Erziehen ist eine Kunst. Gestaltpädagogik in der Jugendhilfe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20475
Kostenlos Autor werden

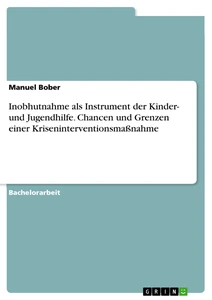








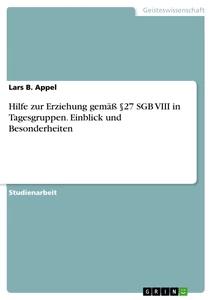






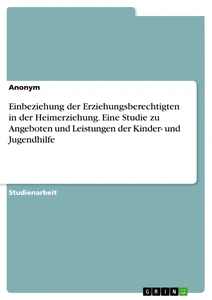


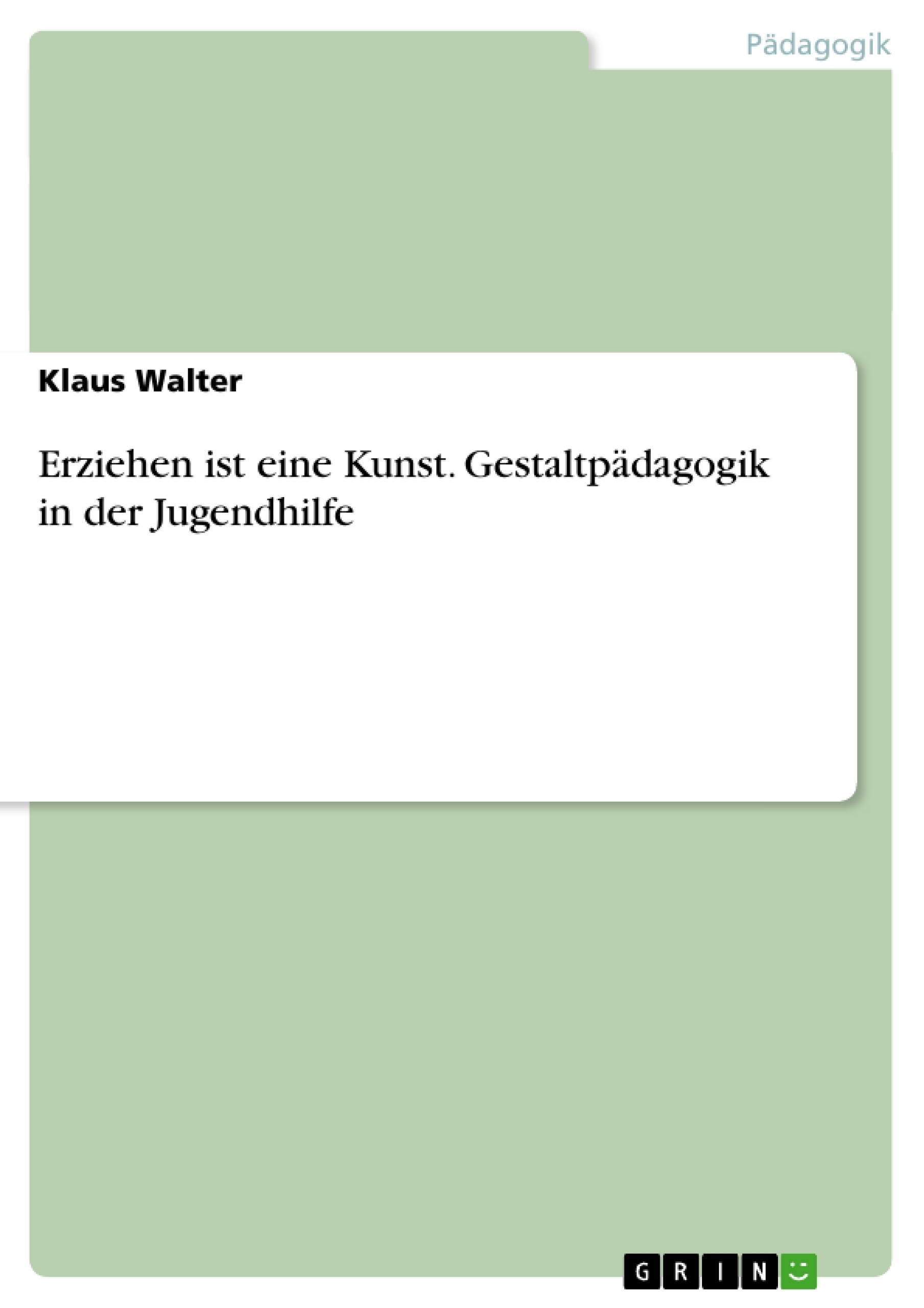

Kommentare