Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Die Chancenungleichheit im Sozialgefüge – Zur Theorie Bourdieus
1.1 Die Anfänge sozialer Ungleichheit
1.2 Die Verortung des Individuums im sozialen Raum
1.2.1 Das Zusammenspiel des kulturellen, ökonomischen und sozialen Kapitals
2 Der bildungspolitische Diskurs der 60er Jahre
2.1 Bildung ist Bürgerrecht – Analyse und Forderungen Dahrendorfs
2.1.1 Bildung als Bürgerrecht
2.1.2 Faktoren der Chancenungleichheit
2.1.3 Die Notwendigkeit einer Bildungsreform
2.2 Die Struktur sozialer Ungleichheit - Analyse und Forderungen Popitz’
2.2.1 Phasen des Selektionsprozesses
2.3 Bilanz und Ausblick zum bildungspolitischen Diskurs der 60er Jahre
3 Sozialbedingte Ungleichheit in den 80er und 90er Jahren
4 Sozialbedingte Ungleichheit im 21. Jahrhundert
Fazit
Literaturverzeichnis
Einleitung
Chancenungleichheit bzw. soziale Ungleichheit ist in Deutschland immer wieder Gegenstand der bildungspolitischen Debatte. Der Diskurs um eine gerechte Verteilung der Bildungschancen gewann zuletzt im Jahr 2000, nach der Veröffentlichung der PISA-Studie, wieder an medialer Aufmerksamkeit und gesellschaftlicher Brisanz. Doch bereits in den 1960er Jahren war die Bildungsungerechtigkeit, die zwischen den sozialen Schichten herrschte, ein wichtiges Thema in der Öffentlichkeit. Das Ziel dieser Arbeit soll eine Auseinandersetzung mit den Aspekten sozialer Ungleichheit seit den 60er Jahren, ihrer Veränderung in den 80er und 90er Jahren bis zur PISA-Studie von 2000 sein.
Der erste Schwerpunkt der Arbeit erklärt die Relevanz der sozialen Herkunft für den Bildungserfolg durch die Theorien Pierre Bourdieus. Der zweite Schwerpunkt setzt sich mit den Analysen und Forderungen Dahrendorfs und Popitz’ in den 60ern auseinander, die richtungweisend für die Bundesrepublik Deutschland waren. Dahrendorf fordert ein Bürgerrecht auf Bildung und setzt sich mit den sozialen Ungleichheiten in den 60er Jahren auseinander. Popitz Analysen erklären das Entstehen und die Entwicklung von Chancenungleichheit durch soziale Vererbung. Anschließend wird die sozialbedingte Ungleichheit seit den 80ern bis zum Jahr 2000 betrachtet und auf Verbesserungen der Gewährleistung einer allgemeinen Chancengleichheit aufmerksam gemacht.
1 Die Chancenungleichheit im Sozialgefüge – Zur Theorie Bourdieus
1.1 Die Anfänge sozialer Ungleichheit
Soziale Ungleichheit ist eine gesellschaftliche Konstruktion, deren Bedeutung sich im Verlauf der geschichtlichen Entwicklung stetig verändert hat. Der Begriff richtet seine Aufmerksamkeit auf Unterschiede, die Menschen im Vergleich miteinander nicht nur als verschiedenartig charakterisieren, sondern sie gleichzeitig als besser- oder schlechter ,- höher oder tiefergestellt erscheinen lassen[1] : Es findet eine qualitative Wertung statt. Soziale Ungleichheit entsteht in der Gesellschaft, wenn einzelne Mitglieder oder Gruppen die gesellschaftlich relevanten Ressourcen im Übermaß nutzen können, während andere benachteiligt sind.[2]
Der Ursprung sozialer Ungleichheit wird bereits in der Philosophie des 18. Jahrhunderts diskutiert: „Welches ist der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen?“[3] , fragt Jean- Jacques Rousseau und antwortet, es sei die Erfindung des Eigentums, denn ohne den Wunsch und der Möglichkeit, etwas für sich alleine zu besitzen, wäre der Mensch dem Menschen gleich. Diese von Rousseau erkannte Form einer an sich rein ökonomischen Ungleichheit erweitert sich innerhalb einer komplexen Gesellschaft zu einer sozialen (und kulturellen) Ungleichheit der Mitglieder.
1.2 Die Verortung des Individuums im sozialen Raum
Um die Ursachen und Entwicklungen von Chancenungleichheit einzelner sozialer Schichten in einer komplexen Gesellschaft besser verstehen zu können, eignen sich Bordieus bildungssoziologische Betrachtungen, und insbesondere sein Ansatz des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals. Auch die PISA-Studie orientiert sich an Bourdieus Ansatz des kulturellen und sozialen Kapitals.[4]
Bourdieu betrachtet den Sozialisationsprozess als Habitualisierung. Die zentrale These Bourdieus besagt, dass das Handeln der Einzelnen und ihr gesamter Lebensstil durch die Position im sozialen Raum determiniert sind.[5]
Das Aufwachsen innerhalb bestimmter Schichten ruft zwangsläufig bestimmte Habitusformen hervor. Diese Formen zeigen sich in bestimmten Denk-, Verhaltens- und Wahrnehmungsmustern, die einerseits die alltäglichen Möglichkeiten begrenzen und andererseits eine Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten erst hervorrufen, die durch den sozialen Raum bestimmt sind. Im Laufe des Habitualisierungsprozesses werden also klassenspezifische Zwänge und Freiheiten, sowie kennzeichnende Unterschiede zu anderen Klassen erworben.[6]
Durch soziale Konditionierungen verhält sich das Individuum den von der Gesellschaft erwarteten Werten und Normen konform. „Der Habitus fungiert als Vermittlungsglied zwischen der Stellung im sozialen Raum und dem für die jeweilige Position typischen Lebensstil, den Praktiken und Vorlieben, die von einer Person in dieser Stellung erwartet werden.“[7]
Für Bourdieu ist gesellschaftliches Handeln ein ständiges Distinktionsgeschehen, d.h. jede soziale Gruppe ist darin bestrebt, ihre Position im sozialen Raum zu ver-bessern. Die Oberschicht ist dabei bestrebt, den Abstand zu den anderen Gruppen zu wahren, die Mittelschicht hingegen darum bemüht, sich der Oberschicht kulturell anzupassen und die untere Schicht durch die „Notwendigkeit“ gekennzeichnet; es ist der Kampf um Existenz, der ihren gesamten Lebensstil prägt.[8]
1.2.1 Das Zusammenspiel des kulturellen, ökonomischen und sozialen Kapitals
Die Position im sozialen Raum, die Klassen- bzw. Schichtzugehörigkeit und entsprechende Lebensstile, sind laut Bourdieu maßgeblich vom ökonomischen Kapital abhängig. Die Zugehörigkeit zur Ober-, Mittel- oder unteren Schicht ist jedoch nicht allein durch das ökonomische Kapital bestimmt, auch wenn das, was man verdient und an Vermögen besitzt von entscheidender Bedeutung für die Position im sozialen Raum ist. Daneben sind jedoch auch das so genannte kulturelle und soziale Kapital von entscheidender Bedeutung für die Position im sozialen Gefüge.
Kulturelles Kapital umfasst die kulturelle Disposition einer Familie, ihre jeweiligen Umgangsweisen und Zugang zu Kulturgütern, wie Büchern, Musik und Bildern, die in einer Familie vorhanden sind. Bildungstitel, die im Bildungssystem erarbeitet wurden, sind ebenfalls kulturelles Kapital.
Als soziales Kapital bezeichnet Bourdieu die sozialen Beziehungen, die im Kampf um bessere Positionen nützlich sind. In bestimmten Grenzen sieht Bourdieu die Kapitalformen als konvertierbar an. So bedeutet beispielsweise eine mäßige wirtschaftliche Lage nicht unbedingt, dass man im sozialen Raum ganz unten steht und ein Lottogewinn garantiert nicht die Zugehörigkeit zur oberen Schicht, da nicht das ökonomische Kapital alleine, sondern auch die sichere Beherrschung bestimmter Verhaltensweisen und deren „Spielregeln“ nötig sind, um in dieser Schicht Akzeptanz zu finden.[9]
Das ökonomische Kapital „ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutionalisierung in der Form des Eigentumsrechts.“[10] Auch das soziale Kapital ist unter bestimmten Bedingungen in ökonomisches Kapital umwandelbar und dient zur Institutionalisierung von beispielsweise Adelstiteln.[11] Bezüglich des kulturellen Kapitals , das unter bestimmten Bedingungen in ökonomisches Kapital konvertierbar ist und zur Institutionalisierung von Bildungstiteln genutzt werden kann, muss man dessen verschiedenen Erscheinungsformen differenzierter betrachten.
Bourdieu unterscheidet drei Arten von kulturellem Kapital. Es kann in verinnerlichtem/inkorporiertem, in objektiviertem und in institutionalisiertem Zustand existieren. Das inkorporierte, verinnerlichte Kulturkapital zeigt sich in Form von „dauerhaften Dispositionen des Organismus“[12] . Die erworbene Bildung, die Akkumulation von Kultur durch die familiäre Primärerziehung und spätere Sekundärerziehung durch die Bildungseinrichtungen bilden das inkorporierte Kapital, welches zum Bestandteil der Person wird. Dieses verinnerlichte Kapital ist zum Habitus geworden und es kann nicht durch Schenkung, Verkauf oder Vererbung kurzfristig weitergegeben werden.
„Verkörpertes Kulturkapital bleibt immer von den Umständen seiner ersten Aneignung geprägt. Sie hinterlassen mehr oder weniger sichtbare Spuren, z. B. die typische Sprechweise einer Klasse oder Region.“[13]
Das kulturelle, inkorporierte Kapital ist also mit der biologischen Einzigartigkeit des Individuums verknüpft, es wird durch soziale Vererbung weitergegeben. Nicht alle Familien können in die Bildung ihrer Kinder gleichviel an Kapital investieren. Daher ist diese Form des kulturellen Kapitals an der Entstehung von Chancenungleichheit maßgeblich beteiligt.
Das objektivierte Kulturkapital existiert laut Bourdieu in Form von kulturellen Trägern, wie z. B. Büchern oder Gemälden, die materiell übertragbar sind. Ein Gemälde kann gekauft werden, was ökonomisches Kapital voraussetzt, doch damit wird lediglich der juristische Eigentumstitel übertragen. Aber um den eigentlichen Wert des Bildes schätzen zu können bedarf es des inkorporierten kulturellen Kapitals.
Institutionalisiertes Kulturkapital existiert in Form von formellen Titeln wie z. B. Schul- oder Universitätsabschlüssen. Titel haben die Eigenschaft, eine Grenze zwischen „Autodidakten“, deren kulturelles Kapital unter permanentem Beweiszwang steht und dem kulturellen Kapital der formal Gebildeten, die über Zeugnisse und andere Abschlüsse sowie kulturelle Kompetenz verfügen, zu ziehen.[14] Der schulische oder akademische Titel verleiht dem Träger institutionelle Anerkennung. Bourdieu ermittelt einen Wechselkurs zwischen diesem kulturellerem und dem ökonomischem Kapital: Die Umwandlung von ökonomischen in kulturelles Kapital setzt einen Aufwand an Zeit voraus, der durch die Verfügung über ökonomisches Kapital ermöglicht wird. Später zahlt sich diese Strategie durch Privilegien wie höheres Einkommen aus. Es findet somit eine Rückwandlung des institutionalisierten kulturellen Kapitals in ökonomisches Kapital in der Form eines Profits statt. Bourdieu weist allerdings darauf hin, dass die materiellen und symbolischen Profite auch von dessen Seltenheitswert abhängen, ansonsten kann die investierte Zeit und Anstrengung weniger einbringen als erwartet. Er weist in diesem Kontext auf die Bildungsexpansion und die damit verbundene Titelinflation hin[15] , die sich seit den 1960er Jahren entwickelt hat.
Das soziale Kapital „ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen“[16] verbunden sind. Das Sozialkapital basiert also auf den Ressourcen, die die Zugehörigkeit zu einer Gruppe hervorbringen und es beruht auf Austauschbeziehungen materieller und symbolischer Art.
Bourdieu belegt mit seiner Theorie vom ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapital die Relevanz der sozialen Herkunft für den zukünftigen Bildungserfolg. Seine Thesen sind auch in späteren bildungspolitischen Diskursen, von den 60er Jahren bis ins neue Jahrtausend, von Bedeutung.
2 Der bildungspolitische Diskurs der 60er Jahre
Der bildungspolitische Diskurs der 60er Jahre wird insbesondere durch die richtungweisenden Schriften Dahrendorfs und Popitz’ geprägt.
Dahrendorf thematisiert Ursachen und Dimensionen von Chancenungleichheiten in seinem Buch „Bildung ist Bürgerrecht“, das 1965 erschienen ist. Darüber hinaus stellt er Forderungen zur Veränderung sozialer Ungleichheiten und einer gerechten Verteilung von Bildungschancen durch eine aktive Bildungspolitik. Nach seiner Ansicht kann diese aktive Bildungspolitik aber nur in Anlehnung eines vorausgehenden Bürgerrechts auf Bildung erfolgreich wirken. Dahrendorf analysiert zunächst einmal den Stand der Dinge in den 1960er Jahren und stellt dann die Forderung nach einer aktiven Bildungspolitik, die (radikale) Reformen hervorbringen soll.
Popitz untersucht in seinem Aufsatz „Die Ungleichheit der Chancen im Zugang zu höheren Schulbildung“ aus dem Jahre 1965 die Strukturen sozialer Ungleichheit und erforscht die Mechanismen ihrer Reproduktion, indem er Phasen des Selektionsprozesses herausstellt. Innerhalb dieser Phasen analysiert er, welche Faktoren dazu beitragen, den Kindern aus sozial benachteiligten Schichten den Zugang zu weiterführenden Schulen erschweren.
[...]
[1] Hradil 2001, S.27
[2] ebd., S.30
[3] Rousseau, zitiert nach Burzan 2005, S. 9
[4] PISA-Konsortium 2001, S.326ff
[5] vgl. Baumgart 1997, S.199
[6] vgl. ebd., S.202
[7] Baumgart 1997, S.201
[8] vgl. Baumgart 1997, S.200
[9] vgl. Baumgart 1997, S.201
[10] Baumgart 1997, S.218
[11] vgl. Baumgart 1997, S.218
[12] Baumgart 1997, S.218
[13] Baumgart 1997, S.220
[14] vgl. Baumgart 1997, S.222
[15] vgl. ebd., S.223
[16] Baumgart 1997, S.224
- Arbeit zitieren
- Claudia Schacht (Autor:in), 2008, Aspekte der Chancenungleichheit von den 1960er Jahren bis zur PISA-Studie 2000, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/202703
Kostenlos Autor werden







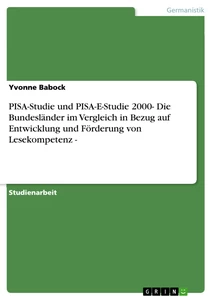






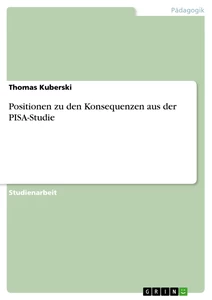



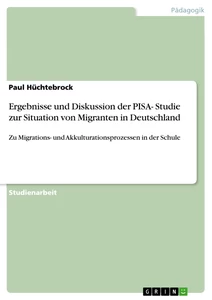

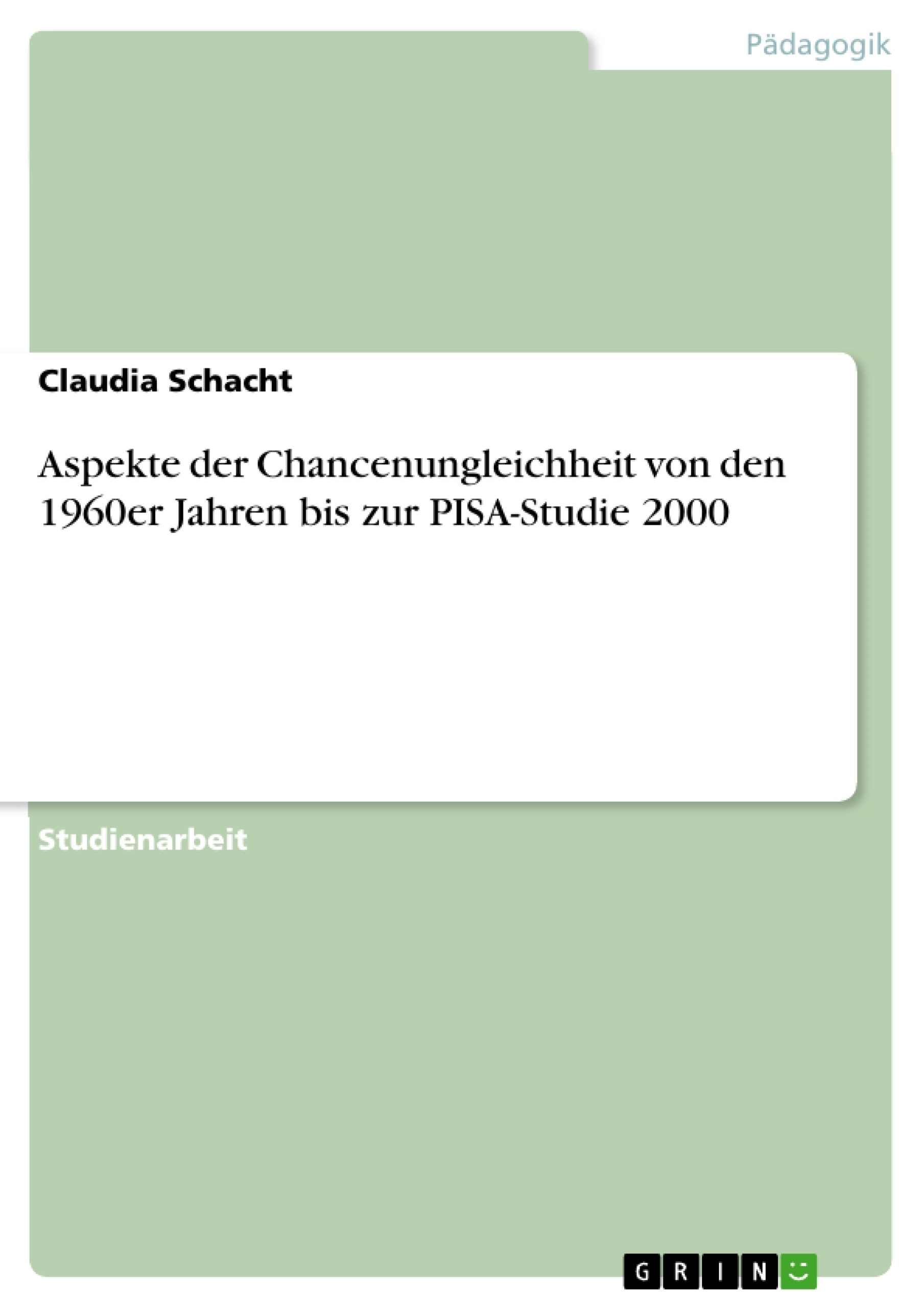

Kommentare