Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Aspekte zum ungestörten Schriftspracherwerb
2.1 Die psychologische Leseforschung
2.2 Die entwicklungspsychologische Leseforschung
2.3 Kritische Betrachtung der logographemischen Stufe
2.4 Zusammenfassung
3 Aspekte zum gestörten Schriftspracherwerb
3.1 Die klassische Legasthenieforschung
3.2 Kritik am klassischen Legastheniekonzept
3.3 Neuere Ansätze und Konzepte der Lese- Rechtschreibforschung
3.4 Zusammenfassung
4 Phonologische Bewusstheit
4.1 Zum Begriff der „Metalinguistischen Bewusstheit“
4.2 Phonologische Informationsverarbeitung
4.3 Zum Begriff der „Phonologischen Bewusstheit“
4.4 Aufgabentypen zur Erfassung der phonologischen Bewussheit
4.5 Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Vorschulalter
4.6 Zusammenfassung
5 Zur Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für Lese- und Rechtschreibleistungen im deutschsprachigen Raum
5.1 Phonologische Bewusstheit: Voraussetzung oder Konsequenz des Schriftspracherwerbs?
5.2 Englischsprachige Studien zur Phonologischen Bewusstheit
5.2.1 Längsschnittstudie von Bradley und Bryant 1985
5.2.2 Experimentelle Trainingsstudie von Bradley und Bryant 1985
5.3 Längsschnittstudien zur Vorhersage von Lese- Rechtschreibfähigkeiten im deutschsprachigen Raum
5.3.1 Längsschnittstudien von Landerl, Linorter und Wimmer 1992
5.3.2 Münchener Längsschnittstudie LOGIK 1984
5.4 Trainingsstudien zur Förderung der phonologischen Bewusstheit
5.4.1 Trainingsstudie von Lundberg, Frost und Petersen 1988
5.4.2 Würzburger Trainingsstudie 1991
5.5 Zusammenfassung
6 Diagnostische Verfahren zur Erhebung der phonologischen Bewusstheit
6.1 Die Bielefelder-Längsschnittstudie 1986/1987
6.1.1 Zielsetzung und Konzeption
6.1.2 Durchführung und Verlauf
6.1.3 Korrelative und klassifikatorische Ergebnisse
6.2 Bielefelder Screening (BISC)
6.2.1 Aufgaben des Verfahrens
6.2.2 Zielgruppe
6.2.3 Hinweise zur Testdurchführung
6.2.4 Auswertung
6.2.5 Praktische Durchführung des Erhebungsverfahrens
6.3 Das Nürnberger Forschungsprojekt 1997
6.3.1 Problemstellung und Zielsetzung
6.3.2 Durchführung und Verlauf
6.3.3 Korrelative und klassifikatorische Ergebnisse
6.4 "Rundgang durch Hörhausen"
6.4.1 Zielgruppe
6.4.2 Aufgaben des Verfahrens
6.4.3 Hinweise zur Testdurchführung
6.4.4 Auswertung
6.4.5 Praktische Durchführung des Erhebungsverfahrens
6.5 Zusammenfassung und vergleichende Darstellung der Testverfahren
7 Ausblick auf therapeutische Möglichkeiten
7.1 Würzburger Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit
7.2 Nürnberger Förderprogramm zur phonologischen Bewusstheit
8 Resümee
9 Literatur
10 Anhang
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Die Fertigkeiten des Lesens und Schreibens werden in unserer Gesellschaft als grundlegende Kulturtechniken angesehen. Sie haben eine zentrale Bedeutung für die Bewältigung der beruflichen und alltäglichen Anforderungen, die das moderne Leben an den Menschen stellt. Dennoch geht man in Deutschland von einer hohen Anzahl von Analphabeten aus.[1] Analphabetismus ist also nicht nur ein Problem der Entwicklungsländer, sondern auch in Industrieländern mit allgemeiner Schulpflicht und umfangreichen schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten weit verbreitet. Man spricht in diesem Fall von funktionalem Analphabetismus[2].
Die OECD führte zwischen 1994 und 1998 eine Studie durch, die ergab, dass in Deutschland 14,4 Prozent der Erwachsenen über 15 Jahre lediglich das niedrigste Niveau der Lesekompetenz erreichen (Pressemitteilung UNESCO, 2003). Die Ergebnisse der Pisa-Studie bestätigten diese Ergebnisse. Dieser Untersuchung zufolge verfügen etwa ein Viertel der 15-jährigen in Deutschland über unzureichende Lesefähigkeiten (Landesbildungsserver Baden-Württemberg).
Kinder mit Lese- Rechtschreibschwächen gelten zwar noch nicht als Analphabeten, zählen aber zu einer Risikogruppe, die von gesellschaftlichem Ausschluss bedroht ist. Füssenich formuliert so ohne Umschweife: „Wer in der Schule lese- und rechtschreibschwach ist und bleibt, wird nach der Schulentlassung zu den funktionalen Analphabeten/innen gehören“ (1999, 183). Das Ziel sollte demzufolge darin liegen, Kinder mit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen frühzeitig zu erkennen, um durch gezielte Präventionsmaßnahmen Spätfolgen, wie im schlimmsten Fall Analphabetismus zu vermeiden.
Das Phänomen des gestörten Schriftspracherwerbs beschäftigt die Wissenschaftler[3] schon seit mehr als einhundert Jahren. So wurde bereits 1886 die Störung des Schriftspracherwerbs durch den englischen Mediziner Morgan als eigenständiges klinisches Syndrom beschrieben. Seitdem wurden viele Theorien für ausgeprägte Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben entworfen und teilweise auch wieder verworfen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Erkenntnissen der neuesten Studien auf diesem Forschungsgebiet. Die phonologische Bewusstheit steht im Mittelpunkt der Betrachtungen, da die Bedeutsamkeit dieser für Lese- und Rechtschreibleistungen durch verschiedene Studien herausgestellt wurde. Fähigkeiten zur Analyse und Synthese von sprachlichen Einheiten wie zum Beispiel Silben oder Lauten gelten demzufolge als Vorläufermerkmale für den Schriftspracherwerb. Das bedeutet, dass frühe Fertigkeiten der phonologischen Bewusstheit spätere Leistungen im Lesen und Rechtschreiben voraussagen können. Diese Erkenntnis ermöglicht eine frühe Identifikation von risikobehafteten Kindern und rechtzeitige Prävention durch spezielle Förderprogramme. Das Ziel der Arbeit liegt im Wesentlichen in der Herausarbeitung und Betrachtung der Forschungsergebnisse zum Zusammenhang der phonologischen Bewusstheit mit Lese- und Rechtschreibleistungen und dem Aufzeigen diagnostischer Möglichkeiten sowohl für den Vorschul- als auch den Schulbereich.
1.2 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel, von denen die Kapitel vier bis sieben die Kernpunkte der Thematik, das heißt die phonologische Bewusstheit im Zusammenhang mit Lese- und Rechtschreibleistungen und entsprechende diagnostische Erhebungsverfahren behandeln.
Der Einstieg in die Thematik erfolgt im zweiten Kapitel über ausgewählte Aspekte zum ungestörten Schriftspracherwerb. Es werden historische und neuere Forschungsergebnisse zum Lesen und Rechtschreiben beschrieben, die für das Verständnis von gestörten Abläufen dieser Prozesse notwendig sind. Im Mittelpunkt steht das „Zwei-Wege-Modell“ des Worterkennens von Coltheart (1978) und das „Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien“ von Günther (1995).
Daran anknüpfend wird im dritten Kapitel auf Aspekte des gestörten Schriftspracherwerbs eingegangen. Die Grundzüge der klassischen Legasthenieforschung werden in groben Zügen beschrieben, um die in den 70er Jahren einsetzende Kritik verständlich zu machen. Die kritische Auseinandersetzung der Wissenschaftler mit dem Legastheniekonzept ermöglichte die Hinwendung zu neueren Ansätzen und Konzepten der Lese- und Rechtschreibforschung, welche im dritten Teil des Kapitels dargelegt werden.
Im vierten Kapitel richtet sich das Hauptaugenmerk auf die „phonologische Bewusstheit“. Nach Einordnung des Begriffs unter die übergeordneten Forschungsbereiche der „metalinguistischen Bewusstheit“ und der „phonologischen Informationsverarbeitung“ werden verschiedene Positionen zur Terminologie bzw. Definition aufgezeigt. Die nachfolgend dargestellten Aufgabentypen zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit geben einen Überblick über die im Einzelnen geforderten Fähigkeiten. Abschließend wird diskutiert, zu welchem Zeitpunkt der kindlichen Entwicklung diese Fähigkeiten ausgebildet werden.
Das fünfte Kapitel soll die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für Lese- und Rechtschreibleistungen anhand wissenschaftlicher Studien der letzten Jahre aufzeigen. Aus Gründen des Vergleichs mit deutschsprachigen Verhältnissen werden auch englischsprachige Studien und Untersuchungen aus Österreich und Dänemark in die Darstellung miteinbezogen.
Nachdem die phonologische Bewusstheit als ein bedeutsames Vorläufermerkmal für spätere Lese- und Rechtschreibleistungen herausgearbeitet wurde, folgt im sechsten Kapitel die Darstellung diagnostischer Möglichkeiten. Beispielhaft werden das Bielefelder Screening (BISC) und das Erhebungsverfahren zur phonologischen Bewusstheit „Rundgang durch Hörhausen“ vorgestellt. Die theoretische Darstellung wird durch einen praktischen Teil untermauert. Die Verfasserin führte dazu beide Testverfahren mit insgesamt zehn Vorschul- bzw. Schulkindern durch.
Das siebte Kapitel gibt einen Ausblick auf therapeutische Möglichkeiten. Es werden beispielhaft zwei Trainingsprogramme zur phonologischen Bewusstheit, zum einen für den Einsatz im Vorschulalter und zum anderen für die Anwendung im ersten Schuljahr vorgestellt.
2 Aspekte zum ungestörten Schriftspracherwerb
In diesem Kapitel werden historische und neuere Forschungsergebnisse zum Schriftspracherwerb aufgegriffen. Diese sind einerseits im Hinblick auf die Thematik „Phonologische Bewusstheit und Lese- Rechtschreibleistungen“ von Bedeutung, sollen andererseits aber auch einen Gesamtüberblick über die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Erwerb des Lesens und Schreibens im deutschen Sprachraum geben.
Die Rechtschreibforschung nimmt im Vergleich zur Leseforschung sowohl national als auch international einen geringeren Stellenwert ein. Schneider (1997) sieht darin eine „Diskrepanz zwischen der wissenschaftlichen Relevanz und der praktischen Bedeutsamkeit“ (vgl. 1997, 327). Eine mögliche Ursache kann darin gesehen werden, dass man in der Forschung zunächst von einer Verschränkung der Lese- und Schreibvorgänge ausging. Studien zeigten aber, dass nicht eine einfache Reziprozität zwischen den Lese- und Schreibvorgängen vorliegt, sondern dass jeweils unterschiedliche Prozesse ablaufen. (vgl. Schneider et al. 1990, 222 f.; Schneider 1997, 332 f.) Die dargestellten Erkenntnisse zum Schriftspracherwerb beziehen sich zunächst also vorrangig auf den Leseerwerb und erst mit Darlegung der neueren Forschungsergebnisse auch auf den Erwerb der Rechtschreibung.
2.1 Die psychologische Leseforschung
Mitte der 60er Jahre begann für die psychologische Leseforschung der Aufschwung im anglo-amerikanischen Sprachraum (Marx 1997, 88). Die kognitive Psychologie ermöglichte nun die Untersuchung und Analyse von Teilprozessen des Lesevorganges (Scheerer-Neumann 1997a, 282).
Charakteristisch für die psychologische Leseforschung seit dem Ende der 60er Jahre sind die zahlreichen Modelle zur Worterkennung bzw. Wortwahrnehmung. Es werden hauptsächlich zwei Modelltypen unterschieden. Ein großer Anteil der Modelle wird als „bottom-up-Modell“ bezeichnet. Die Identifikation eines Wortes wird dabei als systematischer Aufbau von der Buchstaben- zur Wortebene verstanden (Scheerer-Neumann 1997a, 283). Das heißt, die Worterkennung bzw. Wortwahrnehmung erfolgt durch das Rekodieren und Dekodieren der Graphem-Phonem-Korrespondenzen sowie durch direkte visuelle Erkennungsroutinen (Marx 1997, 89). Im Gegensatz dazu stehen die „top-down-Modelle“, welche vor allem den Aspekt der linguistischen Spracherfahrung, der Worterwartung und der Kontextnutzung betonen (Marx 1997, 89). Aus der Diskussion heraus, welches der beiden Modelle die Worterkennung hinreichend erklärt, entstanden des Weiteren interaktive Modelle und Zwei-Wege-Modelle. Befürworter der interaktiven Modelle nehmen an, dass sich die verschiedenen Informationen im Leseprozess gegenseitig beeinflussen (Scheerer-Neumann 1997a, 283).
Das für die Leseforschung bedeutendste Zwei-Wege-Modell ist das „Dual-Route-Modell“ von Coltheart (1978). In seinem Modell zur Worterkennung von 1978 unterscheidet er zwischen dem direkten, lexikalischen Weg der Worterkennung und dem indirekten, phonologischen Weg. Beim direkten Weg erfolgt nach der visuellen Analyse der direkte Zugriff auf das orthographische Lexikon, ein „Gedächtnissystem für Schriftwörter“ (Landerl/Wimmer 1994, 154). Dieser Weg erfordert im Gegensatz zum indirekten Weg keine phonologische Analyse und kommt bei bekannten und oft verwendeten Wörtern zum Einsatz (Schulte-Körne 2001, 11).
Coltheart nahm an, dass die Wege parallel zueinander verlaufen, also unabhängig voneinander bestehen (vgl. Scheerer-Neumann 1987, 226; 1997a, 284). Daraus würde folgen, dass beim Lesen eines Wortes immer beide Prozesse in Gang gesetzt werden und die Lesereaktion dem Ergebnis des schnelleren Weges entspricht („horse-race-modell“) (vgl. Scheerer-Neumann 1997a, 284). Parallel zu dieser „Wettlauf-Theorie“ bestand die „Konflikt-Theorie“. Diese besagt, dass beim Lesen immer die Ergebnisse beider Prozesse abgewartet werden. Besteht eine Übereinstimmung zwischen beiden, wird das Wort ausgesprochen, kommt es jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen, muss eine neue Bearbeitung erfolgen. (vgl. Scheerer-Neumann 1987, 226 f.)
In beiden Theorien wird davon ausgegangen, dass die Wege des Worterkennens unabhängig voneinander verlaufen. Untersuchungen zeigten aber, dass durchaus Wechselwirkungen zwischen den Prozessen bestehen. Die Interaktion zwischen den zwei Wegen des Worterkennens verdeutlicht Coltheart in einer überarbeiteten Variante des Modells (vgl. Scheerer-Neumann 1987, 225). Da das Modell im Rahmen der Lesepsychologie Erwachsener entstand, hat Scheerer-Neumann (1990) dieses modifiziert und auf den Leseerwerb zugeschnitten (vgl. 1990, 261 f.) Eine bedeutende Funktion kommt dabei dem inneren Lexikon zu, in welchem nach Coltheart die phonologischen, orthographischen und semantischen Informationen der bekannten Wörter gespeichert sind (nach Scheerer-Neumann 1987, 226). Scheerer-Neumann fügt ergänzend die visuellen, graphomotorischen und emotionalen Merkmale hinzu (1990, 261).
„direkter Weg“ „indirekter Weg“
(lexikalisch) (lautorientiert)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: „Zwei-Wege-Modell“ des Worterkennens in Anlehnung an Humphreys und Evett
(1985) (nach Scheerer-Neumann 1995, 262)
Beim direkten Weg wird das Wort visuell anhand seiner graphischen Merkmale erkannt, und es erfolgt die Zuordnung der entsprechenden phonologischen und semantischen Komponente. Steht das zu lesende Wort in einem Kontext, kann es schnell abgerufen werden, da es schon voraktiviert ist. Der indirekte Weg verläuft über die Graphem-Phonem-Zuordnung und die Synthese der Phoneme, also unabhängig vom inneren Lexikon. In der Regel, aber nicht zwangsläufig, wird in einem weiteren Schritt die Bedeutung mit Hilfe des Lexikons entschlüsselt. Während beide Wege des Worterkennens beim geübten Leser ineinander greifen und schwer zu trennen sind, lassen sie sich beim Leseanfänger noch deutlich unterscheiden. (vgl. Scheerer-Neumann 1990, 261 f.)
Aus der neueren Sichtweise geht hervor, dass das orthographische Lexikon phonologisch strukturiert ist, und es sich nicht, wie zuvor angenommen, um ein „System abstrakter visueller Gedächtnisrepräsentationen“ handelt (Landerl/ Wimmer 1994, 154 f.). Das hat Konsequenzen für die Vorhersage von Lese- und Schreibfertigkeiten, da nun nicht mehr die visuellen Gedächtnisleistungen sondern die phonologischen Fähigkeiten im Vordergrund stehen (vgl. Landerl/ Wimmer 1994, 155). Die genauen Zusammenhänge werden in den folgenden Kapiteln zur phonologischen Bewusstheit näher erläutert.
2.2 Die entwicklungspsychologische Leseforschung
Der Beginn der 80er Jahre gilt als Wendepunkt in der Erforschung des Schriftspracherwerbs (vgl. Marx 1997, 93; Scheerer-Neumann 1997a, 286). Einen wichtigen Schritt stellte dabei die Abwendung von additiven oder statischen Komponentenmodellen dar, welche die Annahme einer strikten Hierarchie von Teilleistungen innerhalb des Leselernprozesses unterstützten (vgl. Richter/ Brügelmann 1992, 254; Schneider 1989, 159; Küspert 1998, 51).
Man orientierte sich zunehmend an kognitiven Modellen der Informatiosverarbeitung aus der Psychologie und untersuchte das Lesen und Schreiben in Form von Prozessanalysen (Schneider/Brügelmann/Kochan 1990, 220). Aufgrund dieser Analysen entstanden Prozessmodelle, die den Schriftspracherwerb mittels „qualitativer Entwicklungsstufen“ beschreiben (Küspert 1998, 51). Man geht davon aus, dass der aktive Umgang mit der Schrift über mehrere Zwischenstadien zum perfekten Lesen bzw. Rechtschreiben führt. Die Strategien des Lese- und Schreiberwerbs werden in Phasen- oder Stufenmodellen dargestellt (z.B. Frith 1986, Günther 1995; Scheerer-Neumann 1997c; Valtin 1993). Im Gegensatz zu vorherigen Modellen haben sie rein deskriptiven Charakter und weisen lediglich auf die jeweils dominierende Verarbeitungsstrategie hin (vgl. Küspert 1997, 61; Marx 1997, 93).
Als wichtige Erkenntnis der neueren Forschungsansätze gilt, dass der Schulbeginn nicht die „Stunde Null“ des Schriftspracherwerbs darstellt, sondern schon den Vorerfahrungen der Kinder eine wichtige Funktion innerhalb des Erwerbsprozesses zukommt. (Schneider 1989, 159; vgl. auch Marx 1997, 93; Scheerer-Neumann 1997a, 286; Schneider/Brügelmann/Kochan 1990, 225)
Lange Zeit ging man davon aus, dass Lesen und Schreiben ähnliche Prozesse darstellen. Anhand der kognitiven Modelle der Informationsverarbeitung ließ sich aber nach Schneider et al. (1990) zeigen, dass die Graphem-Phonem-Zuordnung beim Lesen und die Phonem-Graphem-Zuordnung beim Schreiben nicht symmetrisch ablaufen. Die Anzahl der Graphem-Möglichkeiten für ein Phonem ist größer als die Anzahl der Phonem-Möglichkeiten für ein Graphem. Des Weiteren genügen beim Lesen oft einfache Wiedererkennungsprozesse, beispielsweise einiger markante Buchstabengruppen, um das Wort vollständig zu erlesen. Das Schreiben hingegen erfordert die genaue Reproduktion aller Buchstaben. (vgl. Schneider et al. 1990, 222 f.)
Es entstand eine Reihe von Entwicklungsmodellen zum Schriftspracherwerb. Diese bezogen sich entweder nur auf das Lesen oder das Schreiben oder versuchten, beide Prozesse nachzuvollziehen. Das Modell von Frith (1986) und seine Erweiterung durch Günther (1995) beziehen sich auf die Lese- und die Schreibentwicklung und gehen somit davon aus, dass sich Lesen und Rechtschreiben gegenseitig beeinflussen. Das Modell von Günther wird in dieser Arbeit beispielhaft beschrieben, da es für den Schriftspracherwerb im deutschen Sprachraum bedeutsam geworden ist und auf die Unterschiede der Lese- und Schreibprozesse eingeht (vgl. Küspert 1997, 52; Marx 1997, 93).
Günther (1995) orientiert sich in seinem „Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien“ stark am Erwerbsmodell von Uta Frith (1986). Das von Frith entwickelte Modell ist der kognitiven Psychologie zuzuordnen und gilt im englischsprachigen Raum als einflussreichstes Prozessmodell der Entwicklung des Lesens und Schreibens (vgl. Küspert 1998, 61; Marx 1994, 93; Scheerer-Neumann 1997a, 287). Die Zwei-Wege-Modelle des Lesens dienen dabei als allgemeinpsychologische Prozessbeschreibungen (Mannhaupt 1994, 124).
Frith geht für den Bereich des Lesens zunächst von drei Entwicklungsphasen aus und beschreibt sie anhand der darin erworbenen Strategien. Die kindlichen Strategien des Schriftsprachzugangs kennzeichnet sie mit den Begriffen „logographisch“, „alphabetisch“ und „orthographisch“. Wesentlich ist, dass die Strategien aufeinander aufbauen, aber keine klare Trennung möglich ist, da es zu Verschmelzungen zwischen der vorherigen und der neu erworbenen Strategie kommt (vgl. Küspert 1997, 52 f.; Mannhaupt 1994, 124; Scheerer-Neumann 1997a, 286f.; Schneider 1994, 119). Frith entwickelte aus diesem Dreiphasenmodell ein Sechsstufenmodell, um den Unterschieden des Lesens und Schreibens gerecht zu werden. Das Modell enthält ein dynamisches Element, da die Strategien des Lesens und Schreibens jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten zum Einsatz kommen. (Küspert 1997, 52)
Günther (1986) erweitert das Dreiphasenmodell von Frith um die präliteral-symbolische Phase, die den Beginn des Erwerbs darstellt und die integrativ-automatisierte Phase, die den Abschluss des Schriftspracherwerbs kennzeichnet. Das Modell besteht insgesamt aus fünf Phasen mit jeweils zwei Stufen und berücksichtigt die Modalitäten des Lesens (Rezeption) und des Schreibens (Produktion). Indem in jeder Phase abwechselnd zwischen den beiden Modalitäten eine neue Strategie angewandt wird, erreicht der Erwerbsprozess ein qualitativ höheres Niveau. Der Übergang von einer Strategie zur nächsten ist dabei fließend, das heißt, es kommt durchaus zu Überschneidungen und Verschiebungen. In jeder Phase gibt es jedoch nur eine dominante Strategie. (vgl. Günther 1995, 100 ff.)
In der präliteral-symbolischen Phase kommt der Bildwahrnehmung, dem graphischen Gestalten, der Spielsymbolik, dem konstruktiven Bauen und dem Nachahmen von Schreibbewegungen eine besondere Bedeutung zu. Diese Aktivitäten gelten als wichtige Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen. Es folgt darauf die logographemische Phase für die Modalität Lesen. Die Strategie ist rein visuell, das heißt, das Kind erkennt Wörter und Sätze anhand charakteristischer bzw. markanter Details. Die logographemische Strategie wird schließlich auch auf das Schreiben angewandt. Die Unzulänglichkeiten dieser Strategie für das Schreiben bedingen schließlich die Anwendung der alphabetischen Strategie. Während für die Modalität Lesen zunächst die logographemische Strategie beibehalten wird, kommt für das Schreiben schon die alphabetische Strategie zum Tragen. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Erfassung der Graphem-Phonem-Korrespondenzregeln. In dieser Phase kommt es zu stark phonetischen Schreibweisen. Nach einiger Zeit wird die alphabetische Strategie auch auf das Lesen übertragen. Hierbei stützen sich die visuelle und die phonologische Strategie gegenseitig. Durch die starke Konzentration auf nicht bedeutungstragende Einzelelemente wird das inhaltliche Verständnis erschwert. Diese Probleme werden mit Hilfe der orthographischen Strategie überwunden. In dieser Phase steht die Anwendung intuitiver, linguistischer Wortbildungsregeln im Vordergrund. Die zu verarbeitenden Grundeinheiten sind Morpheme, häufige Buchstabensequenzen und Silben. Mit der orthographischen Strategie ist nach Günther (1995) der „integrierende Abschluß des Schriftspracherwerbs erreicht, der gleichermaßen die Rezeption wie die Produktion steuert und sich weder visuell noch phonemisch begründet“ (1995, 108). Die integrativ-automatisierte Phase stellt keine neue Strategie mehr dar. Sie kennzeichnet lediglich den Schriftsprachgebrauch des kompetenten Lesers und Schreibers nach erfolgreichem Durchlaufen der vorangegangenen Phasen. (vgl. Günther 1995)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Modell der Aneignung der schriftlichen Sprache als mehrphasiger, strategiebestimmter
Entwicklungsprozess (nach Günther 1995, 98)
2.3 Kritische Betrachtung der logographemischen Stufe
Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs sind nach wie vor sehr aktuell, und besonders das Modell von Frith findet international großen Zuspruch (Mannhaupt 1994, 124). Kritiker bezweifeln allerdings die vollständige Übertragbarkeit des Ansatzes auf den deutschsprachigen Raum (vgl. Marx 1997, 96; Schneider 1994, 119: Schneider 2001a, 436; Wimmer/Klampfer/Frith 1993, 324 ff.).
Wimmer et al. (1990) fanden mittels einer Studie heraus, „dass sich weder bei unauffälligen Kindern der 1. Klasse noch bei Kindern mit Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreibenlernen Hinweise auf eine logographische Stufe finden“ (Wimmer/Hartl/Moser 1990, 150). Als mögliche Ursache wird der Unterschied zwischen den Schriftsystemen angenommen. Die deutsche Orthographie ist wesentlich regulärer als die englische und erleichtert somit den Zugang zur alphabetischen Stufe. (Schneider 1994, 119) Andererseits könnte aber auch der Altersunterschied zwischen den englischen und deutschsprachigen Leseanfängern ursächlich sein. So könnte man zum Beispiel annehmen, dass deutsche Kinder schon vor Schuleintritt logographisch gelesen haben. (Wimmer et al. 1990, 151 f.) Tatsächlich konnte nachgewiesen werden, dass auch deutschsprachige Kinder teilweise logographisch lesen. Dies spielt aber keine so bedeutende Rolle für den Schriftspracherwerb, wie dies für den englischen Sprachraum nachgewiesen wurde. (vgl. Wimmer/Klampfer/Frith 1993, 328; Roth 1998, 38) Günther (1995) sieht für den Erwerb alphabetischer Schriftsysteme in der logographemischen Strategie kompensatorische Möglichkeiten für Kinder, die mit der alphabetischen oder orthographischen Strategie Probleme haben (1995, 104; vgl. auch Schulte-Körne 2001, 13).
2.4 Zusammenfassung
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Lesen- und Schreibenlernen hat sich erst in den letzten 20 Jahren zu einem beachteten entwicklungs- und pädagogisch-psychologischen Forschungsfeld herausgebildet (vgl. Marx 1997, 85). Mitte der 60er Jahre erlebte zunächst die psychologische Leseforschung ihren Aufschwung im anglo-amerikanischen Sprachraum. Diese brachte zahlreiche Modelle zur Worterkennung bzw. Wortwahrnehmung hervor, die Aufschluss über die inneren Vorgänge beim Leseprozess gaben. Das „Zwei-Wege-Modell“ von Coltheart (1978) wurde in diesem Kapitel näher beschrieben, da die Annahme eines phonologisch strukturierten Lexikons interessant für die Vorhersage von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ist. In Bezug auf den Leseanfänger konnten jedoch durch die ältere Leseforschung keine hinreichenden Theorien des Lesenlernens entwickelt werden (vgl. Marx 1997, 85).
Zu einem Aufschwung kam es diesbezüglich Anfang der 80er Jahre. Durch die neue kognitionspsychologisch orientierte Erforschung des Schriftspracherwerbs entstand nun eine Reihe von Stufenmodellen zur Beschreibung der Lese- und Rechtschreibentwicklung. Das von Günther (1995) entwickelte „Stufenmodell der Entwicklung kindlicher Lese- und Schreibstrategien“ erlangte besondere Bedeutung für den deutschen Sprachraum. Es bezieht sich gleichzeitig auf beide Prozesse der Lese- und Schreibentwicklung. Uneinigkeiten bestehen in Bezug auf die logographemische Stufe beim Lesen und Schreiben im deutschen Schriftspracherwerb. Als wissenschaftlich erwiesen gilt, dass diese keine so bedeutende Rolle für den Erwerb des Lesens und Schreibens spielt wie im englischsprachigen Raum.
3 Aspekte zum gestörten Schriftspracherwerb
Das vorherige Kapitel beschäftigte sich mit der Lehrmethoden - und der Leseforschung. Neben diesen beiden Forschungsbereichen, die sich mit den Prozessen des Lesens und Schreibens auseinandersetzten, entwickelte sich parallel die Legasthenieforschung, welche das Phänomen des gestörten Schriftspracherwerbs untersuchte. Nicht zuletzt aus der kritischen Betrachtung des klassischen Legastheniekonzeptes heraus entwickelten sich neue Ansätze und Konzepte der Lese- und Rechtschreibforschung vor entwicklungs- und pädagogisch-psychologischem Hintergrund, die heute für die wissenschaftliche Diskussion maßgeblich sind.
3.1 Die klassische Legasthenieforschung
Die Erforschung von Störungen beim Erwerb des Lesens und Schreibens begann schon vor mehr als einem Jahrhundert. Um 1900 machten sich zunächst die Mediziner das Phänomen der Lese-Rechtschreibschwäche zum Untersuchungsgegenstand (Roth 1999, 19; vgl. auch Scheerer-Neumann 1997, 293; Küspert 1998, 21). Nach Küspert (1998) beschrieb der englische Augenchirurg Morgan bereits 1886 die Störung des Schriftspracherwerbs als eigenständiges klinisches Syndrom und prägte dafür den Begriff „congential wordblindness“. Morgan und sein Kollege Hinshelwood gingen bei der „kongentialen Wortblindheit“ von einem Defekt im Lesezentrum des Gehirns aus, da die beobachtbaren Ausfälle auf den Schriftspracherwerb beschränkt blieben. (Küspert 1998, 21)
Auch im deutschen Sprachraum begann die Erforschung der Legasthenie um die Jahrhundertwende. Der Begriff wurde 1916 von Prof. Dr. Paul Ranschburg, einem Budapester Arzt, eingeführt (Küspert 1998, 21). In seiner Veröffentlichung „Die Lese- und Schreibstörungen des Kindesalters“ von 1928 differenziert er zwischen der „eigentlichen Lese- und Schreibschwäche“ und der „eigentlichen infantilen Leseblindheit“. Unter infantiler Leseblindheit versteht Ranschburg „einen im ganzen recht seltenen, mehr oder minder isolierten, geistigen Defektzustand, die chronische Leseblindheit, Leseunfähigkeit oder Wortblindheit (Alexie)“ (1928, 90). Diese ist bei „intellektuell dem Wesen nach normal entwickelten, wenn auch wohl stets neuro- bzw. psychopathischen Kindern...“ zu finden (1928, 90). Im Gegensatz dazu definiert er Leseschwäche wie folgt:
„Leseschwäche bedeutet eine nachhaltige Rückständigkeit höheren Grades in der geistigen Entwicklung des Kindes, sich äußernd in der Unfähigkeit, im Alter von 6 bis 8 Jahren oder auch noch darüber hinaus sich eine derart genügende Geläufigkeit des mechanischen Lesens anzueignen, welche die Vorbedingung eines erträglichen Verständnisses des Gelesenen wäre“ (1928, 88).
Ranschburgs Annahme einer geistigen Rückständigkeit leseschwacher Kinder führte dazu, dass Kinder mit Lese- und Schreibschwierigkeiten bis in die 60er Jahre hinein an Hilfsschulen verwiesen wurden (Roth 1999, 19; vgl. auch Sommer-Stumpenhorst 1993, 11). Küspert (1998) nimmt an, dass diese Klassifizierung die Diskussion um die Problematik des gestörten Schriftspracherwerbs im deutschsprachigen Raum bis nach dem 2. Weltkrieg verstummen ließ (1998, 21). Sommer-Stumpenhorst (1993) macht dafür weiterhin den Faktor der Isolierung Deutschlands zwischen 1930 und 1945 verantwortlich (1993, 11).
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zum Aufschwung der Legasthenieforschung im deutschen Sprachraum (Küspert 1998, 21). Nun beschäftigten sich auch Psychologen und Pädagogen mit der Thematik. Die von der Schweizer Kinderpsychiaterin Maria Linder 1951 veröffentlichte Definition hatte großen Einfluss auf die nachfolgende Forschung:
Legasthenie ist „eine spezielle, aus dem Rahmen der übrigen Leistungen fallende Schwäche im Erlernen des Lesens (und indirekt auch des selbständigen fehlerfreien Schreibens) bei sonst intakter – oder im Verhältnis zur Lesefertigkeit relativ guter – Intelligenz. Von Legasthenikern sprechen wir also nur, wenn ein Kind ungefähr normaler Intelligenz unter normalen Schulverhältnissen und trotz aller Bemühungen der Erwachsenen das Lesen (oder Schreiben) nicht oder nur mit größter Anstrengung erlernen kann, während in den übrigen Fächern keine auffallenden Probleme vorhanden sind“ (Linder 1962; nach Küspert 1998, 21 f.).
Im Mittelpunkt dieser Definition steht die Diskrepanz zwischen durchschnittlicher Intelligenz und schwacher Lese-Rechtschreibleistung, da von Linder durchgeführte Untersuchungen ergaben, dass Kinder mit Leseschwächen in der Regel durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent sind (Sommer-Stumpen-horst 1993, 11). Linder grenzt also auf diese Weise Legasthenie von allgemeiner Lernschwäche ab. Kinder mit Störungen der Sinnesorgane und körperlichen Behinderungen, Kinder mit Problemen in anderen Schulfächern und Kinder, bei denen das Versagen durch negative Umwelteinflüsse bedingt ist, zählen ihrer Meinung nicht zur Gruppe der Legastheniker (vgl. Scheerer-Neumann 1997, 294 f. 1997b, 18).
In der Folgezeit gingen Wissenschaftler verschiedenen ätiologischen Konzepten nach, woraus sich eine Vielzahl von Begrifflichkeiten für Schwierigkeiten des Lesens und Schreibens ergaben (Roth 1999, 22). Einige Autoren verwendeten zum Beispiel die Termini Legasthenie und Lese- Rechtschreibschwäche zur Abgrenzung unterschiedlicher Schweregrade der Störung, andere nutzten sie hingegen synonym (Küspert 1998, 22). Die inhomogene Verwendung von Begriffen wie Leseschwäche, Leseversagen, Legasthenie oder Leselernstörungen deutet auf den fehlenden Konsens hinsichtlich Definition und Terminologie hin (vgl. Roth 1999, 22; Küspert 1998, 22).
Ende der 60er Jahre wurden im Rahmen der psychologisch-pädagogischen Legasthenieforschung vermehrt empirische Untersuchungen durchgeführt. Hierfür wurden Intelligenztests und standardisierte Rechtschreibtests verwendet, da es zu dieser Zeit noch keine geeigneten Lesetestverfahren gab. (vgl. Küspert 1998, 22; Hasselhorn et al. 2000, 1) Die Legasthenieforschung ging davon aus, dass sich die Schwierigkeiten legasthener Kinder beim Schriftspracherwerb qualitativ von denen lernschwacher Kinder unterscheiden. Auf diese wissenschaftlich nicht erwiesene Annahme aufbauend, versuchte man, die Fähigkeitsdefizite zu bestimmen, die ursächlich für die Leseschwierigkeiten sein könnten. (Schneider 1994, 117 f.) Die dafür angewendete Methodik des Extremgruppendesigns sah zunächst die Parallelisierung der Gruppen nach ihrer Intelligenz vor, um sie auf diese Weise vergleichbar zu machen. Daraufhin verglich man spezifische Fähigkeiten schlechter Leser bzw. Rechtschreiber mit denen durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher Schüler. (Schneider 1989, 157; vgl. auch 1994, 117) Das Ziel bestand in der Ermittlung der kognitiven Funktionen oder Teilleistungen, die bei lese-rechtschreibschwachen Kindern unzureichend ausgebildet sind und das Versagen auf der kognitiven Ebene bedingen (Scheerer-Neumann 1997a, 303).
Die in dieser Zeit durchgeführten Untersuchungen bildeten die Basis für die Entwicklung spezieller Funktionstrainings, einer bestimmten Art von Interventionsverfahren, in denen die unzureichenden Funktionen trainiert und verbessert werden sollten. Die Schwerpunkte lagen dabei auf der visuellen und akustischen Wahrnehmung, den Gedächtnisleistungen und sprachlichen Bereichen (Schee-rer-Neumann 1997a, 303).
3.2 Kritik am klassischen Legastheniekonzept
Die Kritik am klassischen Legastheniekonzept setzte etwa Mitte der 70er Jahre ein (vgl. Schlee 1976; Weinert 1977). Ein bedeutender Kritikpunkt wurde in der Diskrepanzdefinition gesehen, welche allgemein lese-rechtschreibschwachen Kindern das Recht auf schulische Fördermaßnahmen versagte (vgl. Scheerer-Neumann 1997a, 295). Zum einen wurde kritisiert, dass durch die Verwendung unterschiedlicher Intelligenz- und Rechtschreibtests unterschiedliche Kinder als „Legastheniker“ eingestuft wurden (Schneider 1994, 118; vgl. auch Zielinski 1980, 78). Zum anderen sahen viele das Intelligenzkriterium als problematisch an, da Intelligenz und Lese- und Rechtschreibleistungen nur mittelhoch miteinander korrelieren (Schneider 1994, 118; vgl. auch Scheerer-Neumann 1997a, 296). Ein bekannter Anhänger dieses Kritikpunktes war Schlee, der dazu 1976 das Buch mit dem bezeichnenden Titel „Legasthenieforschung am Ende?“ veröffentlichte (vgl. dazu Roth 1999, 30 f.).
Des Weiteren wurde das methodische Vorgehen, speziell die Methode des Paarvergleichs bzw. des Extremgruppendesigns kritisiert (vgl. Roth 1999, 28 f.; Küspert 1998, 45 f.). Nach Schneider (1989) wies dieses Verfahren massive methodische Schwächen auf (1989, 159; vgl. auch Zielinski 1980, 79). Mittels des Extremgruppenvergleichs ließen sich zwar Unterschiede in den Merkmalsausprägungen guter und schwacher Leser feststellen, aber die Frage nach Ursache oder Konsequenz konnte nicht geklärt werden. Selbst Valtin (1975) als Vertreterin der Legasthenieforschung äußerte sich zu diesem Kritikpunkt wie folgt:
„bestürzendes Fazit: Da alle deutschen Legasthenie-Untersuchungen auf der Methode des Paarvergleichs beruhen, wissen wir so gut wie nichts über die wahren Zusammenhänge der untersuchten Variablen mit der Legasthenie bzw. dem Lese-Rechtschreibprozeß“ (1975, 411; nach Küspert 1998, 45).
Einer kritischen Betrachtung wurden auch die ätiologischen Konzepte der traditionellen Legasthenieforschung unterzogen. Nach sorgfältigen Untersuchungen erwiesen sich die angeblich legasthenieverursachenden Faktoren Erblichkeit der Störung, Raumlagelabilität, spezifische Fehler wie zum Beispiel das Verwechseln von Buchstaben und der Linksfaktor als unhaltbar (Küspert 1998, 23 f.; vgl. auch Roth 1999, 22 ff.; Schneider 1997, 349).
Vor dem Hintergrund der zahlreichen ätiologischen Konzepte wurden Trainingsprogramme zur Intervention von Legasthenie entwickelt. Eine ausführliche Übersicht findet sich dazu bei Küspert (1998, 30 ff.). Tatsächlich erzielten einige der Interventionsmethoden statistisch signifikante Trainingseffekte, diese waren aber in den meisten Fällen nicht von praktischer Bedeutsamkeit (vgl. Schneider 1989, 158).
Ein weiteres Problem der klassischen Legasthenieforschung liegt in der unzureichenden Erfassung der gestörten Teilprozesse des Lesens und Schreibens, ohne deren Kenntnis sich keine effektiven Fördermaßnahmen entwickeln lassen (vgl. Schneider 1989, 158). Schneider (1994) bezeichnet das Vorgehen der klassischen Legasthenieforschung als „produktorientiert“, da man Determinanten der Lese-Rechtschreibschwäche zu bestimmen versuchte, ohne jedoch Vorstellungen von der Entwicklung der Lese- und Rechtschreibprozesse zu haben (1994, 118). Weinert (1977) zieht die Konsequenz aus diesem Kritikpunkt und schlägt als Forschungsperspektive die „Entwicklung von Modellen des Lesens, Lesenlernens und des Lesenlehrens“ vor (1977, 171).
Auch Weinert (1977) gehört zu den Kritikern der klassischen Legasthenieforschung. In seinem Aufsatz „Legasthenieforschung – defizitäre Erforschung defizienter Lernprozesse?“ plädiert er aber nicht für die „Abschaffung dieser Forschungstradition, sondern für eine theoretische Neuorientierung, bei der die bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse benutzt werden sollten“ (1977, 170). Er schlägt vor, „Legasthenie“ künftig als „Sammelbegriff für alle Defizite beim Lesen und Lesenlernen (Rechtschreiben und Rechtschreibenlernen), die deutlich von einer definierten Norm abweichen“ zu verwenden (1977, 170).
Die Kultusministerkonferenz (KMK) von 1978 empfiehlt allerdings die Ersetzung des Begriffs Legasthenie durch die Bezeichnung „besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ (nach Valtin 2000, 32). Auch Valtin (2000) hält eine Änderung des Begriffs für sinnvoll, da sie die Bezeichnung Legasthenie für zu belastet hält (2000, 32). Sie wählt entsprechend dem Vorschlag der KMK den Begriff Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS), der auch im folgenden Verlauf dieser Arbeit verwendet wird.
3.3 Neuere Ansätze und Konzepte der Lese- Rechtschreibforschung
Die kritische Betrachtung der klassischen Legasthenieforschung Mitte der 70er Jahre führte zur Abwendung von der Analyse spezifischer Fähigkeiten lese-rechtschreibschwacher Kinder hin zur Exploration von Lese- und Rechtschreibprozessen (Schneider 2001b, 70; vgl. auch Marx 1997, 92).[4] Die neueren Untersuchungen beziehen sich sowohl auf den Grundschul- als auch auf den Vorschulbereich. Schon die klassische Legasthenieforschung ging davon aus, dass die mit der Einschulung vermittelten Fertigkeiten des Lesens und Schreibens an bereits vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten anknüpfen. Diese Annahme wurde auch nach kritischer Betrachtung beibehalten. In der neueren Forschung nimmt man an, dass vorschulische Kompetenzen der sprachlichen Informationsverarbeitung den Schriftspracherwerb positiv oder negativ beeinflussen können (Marx/Jansen 1999, 7; vgl. auch Marx 1997, 92; Schneider 1994, 119).
[...]
[1] Die Schätzungen liegen bei ca. 4 Millionen sekundären und/oder funktionalen Analphabeten bei einer Einwohnerzahl von 80 Millionen (Landesbildungsserver Baden-Württemberg).
[2] „Analphabeten im engeren Sinn sind Menschen, die keinerlei Lese- und Schreibfertigkeit haben, d.h. die nicht einmal ihren Namen schreiben können. Analphabeten im weiteren Sinn können zwar einzelne Worte lesen und/oder ihre eigene Unterschrift leisten. Sie sind aber im Sinne der UNESCO-Definition des funktionalen Analphabetismus nicht gleichberechtigt in der Lage, an den gesellschaftlichen Aktivitäten ihres Kulturkreises teilnehmen zu können“ (Bonfadelli 1999).
[3] Die Verfasserin der Arbeit entschied sich für die männliche Sprachform. Die Aussagen gelten gleichermaßen für weibliche Personen.
[4] vgl. Pkt. 2.2 Die entwicklungspsychologische Leseforschung
- Arbeit zitieren
- Katja Raßbach (Autor:in), 2003, Die phonologische Bewusstheit für Lese- und Rechtschreibleistungen. Möglichkeiten der Erhebung mittels diagnostischer Verfahren, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/20220
Kostenlos Autor werden








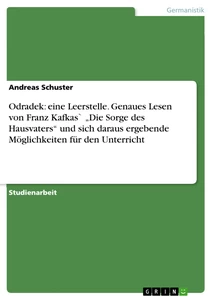



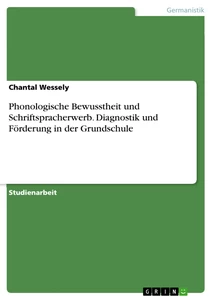





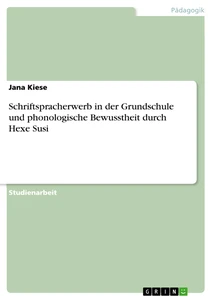

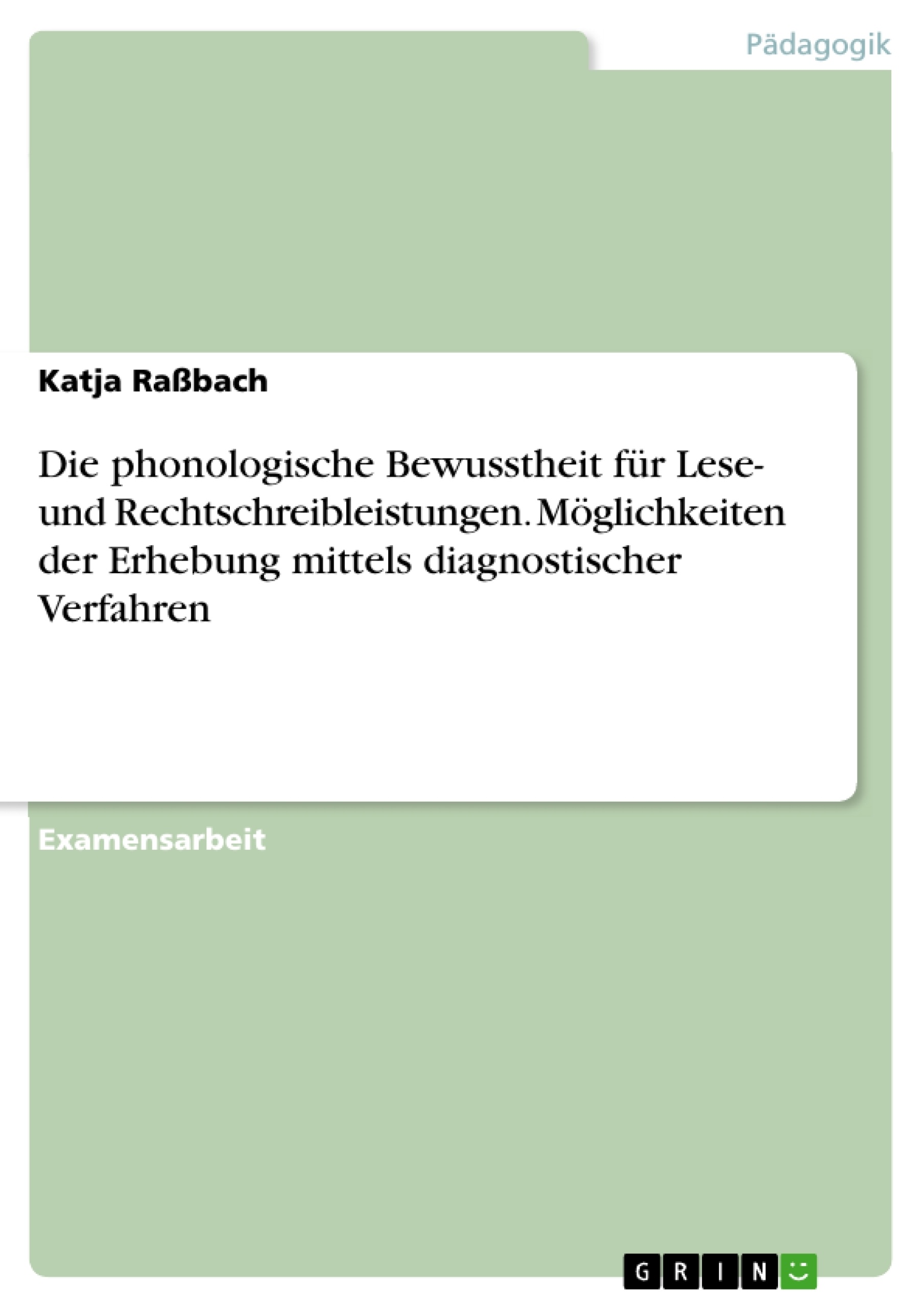

Kommentare