Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: Einleitung
Kapitel 2: Das traditionelle Modell des Journalismus
2.1 Funktionen und Selbstverständnis
2.2 Journalistische Qualität und deren Sicherung
Kapitel 3: Das Internetzeitalter
3.1 Umbrüche in der Ära des Web 2.0
3.2 Das Phänomen Weblog
Kapitel 4: Journalismus im Internetzeitalter
4.1 Abkehr vom traditionellen Verständnis
4.2 Finanzierung
4.3 Watchblogs und Qualitätssicherung
4.4 Internetauftritte: Oberhessische Presse und Zeitungsgruppe Lahn-Dill
4.5 Gesellschaftliche Bedeutung
4.6 Einschätzungen aus der journalistischen Praxis
Kapitel 5: Schlussbetrachtung
Literaturverzeichnis
Anhang
Kapitel 1: Einleitung
Über Jahrzehnte hinweg galt die Zeitung als zentrale Instanz bei der öffentlichen Meinungsbildung, ehe sie in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung verlor. Zugespitzt hat sich die Lage insbesondere in den USA, wo bereits zahlreiche Zeitungen eingestellt wurden und selbst die renommierte New York Times ins Straucheln geriet. In den Schlagzeilen stand das hochverschuldete Blatt insbesondere im Jahr 2009, als es vom Milliardär Carlos Slim finanzielle Unterstützung in Höhe von 250 Millionen Dollar erhielt. Waren es zunächst vorwiegend Auflagenrückgänge, die den Verlegern Sorgen bereiteten, so befinden sich - wie Weichert u.a. (2009: 8) anmerken - „Vertriebserlöse, Werbeumsätze und Aktienwerte spätestens seit 2008 im freien Fall“. Dagegen geht es dem deutschen Verlagswesen noch gut - Qualitätsblätter wie die Süddeutsche Zeitung vermeldeten jüngst sogar einen Anstieg bei den verkauften Exemplaren. Dies kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass Zeitungen auch hierzulande in eine Notlage geraten sind. Zwar genießen sie nach wie vor hohes Ansehen, doch deren Gesamtauflage nahm im vergangenen Jahrzehnt kontinuierlich ab. Betrug sie im Jahr 2001 noch 30,2 Millionen (vgl. Pasquay 2001), so lag der Wert zehn Jahre später bei nur noch 23,8 Millionen (vgl. Pasquay 2011).
In Anbetracht dessen setzen sich Experten kritisch mit der Zukunft der gedruckten Zeitungen auseinander. So ist Jarvis (2009 a: 118) der Ansicht, dass sich Verleger einen festen Termin setzten sollten, „an dem sie ihre Druckerpressen anhalten werden“, während Eumann (2011: 83) das Zeitungswesen zwar nicht am Abgrund sieht, aber anmerkt: „Statt montags bis samstags [...] gibt es möglicherweise ein- oder zweimal pro Woche eine auf Papier gedruckte Ausgabe“. Ausgehend von diesen Einschätzungen dürfte sich entweder das komplette journalistische Angebot oder zumindest ein Großteil davon ins Internet verlagern, schließlich kann dieses angesichts seiner rasanten Expansion als ideales Medium zur öffentlichen Meinungsbildung angesehen werden. So ergab die ARD/ZDF-Onlinestudie 2011 (vgl. ZDF- Pressestelle 2011), dass mittlerweile mehr als 73 Prozent der deutschen Bevölkerung Internetzugang haben. Eine andere Studie aus dem gleichen Jahr (vgl. BITKOM 2011 b) erbrachte, dass 55 Prozent der befragten Personen das Internet speziell zur Informationsbeschaffung nutzt. Unter den 14- bis 29-Jährigen betrug der Wert sogar 80 Prozent, was ein weiteres Argument für die Verlagerung des journalistischen Angebots ins Internet ist. Dort muss der Journalismus jedoch von seinem über Jahrzehnte hinweg an den Paradigmen der traditionellen Massenkommunikation orientierten Produktionsmodell Abstand nehmen. Während sich in der Frühphase des Internets noch eine Einteilung in wenige Sender und viele Empfänger legitimieren ließ, so hat sich mittlerweile ein neues Selbstverständnis bei der Internetnutzung etabliert, das ein zentraler Bestandteil der Auseinandersetzung mit dem heutigen Internetzeitalter (auch Web 2.0 genannt) ist. Simons (2011: 142) spricht in diesem Kontext von „einer zweiten Medienrevolution nach der Erfindung des Buchdrucks“, womit er keineswegs übertreibt. So haben Internetnutzer zunehmend die Erwartung, sich am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung beteiligen zu dürfen, was in der traditionellen Massenkommunikation nur rudimentär vorgesehen ist. Diese neue Art der Partizipation macht sich beispielsweise in Weblogs und auf Plattformen wie Wikinews bemerkbar, auf der jeder eigens erstellte Nachrichten veröffentlichen kann. Hierdurch ist letztlich eine Vision des Schriftstellers Berthold Brecht Realität geworden, der Ende der 1920er Jahre interaktive Strukturen in der Massenkommunikation forderte: „Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens [...] wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen“ (Brecht 1967: 134). Brecht sah hierin idealisierend die Chance auf eine vitalere Gesellschaft mit ausgewogenerer Diskussionskultur. Diesen Gedanken weiterführend wäre partizipatives Publizieren bedeutsam und herausfordernd für die gesellschaftliche Weiterentwicklung, sodass das Produktionsmodell des Journalismus angezweifelt werden müsste.
Braucht die Gesellschaft heutzutage noch (traditionellen) Journalismus oder nimmt dessen Bedeutung ab? Inwiefern muss er sich neu definieren? Und welche Chancen und Gefahren ergeben sich für ihn im Internetzeitalter? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. Zunächst beschäftige ich mich mit dem traditionellen Modell des Journalismus, wobei sowohl auf dessen Funktionen und Selbstverständnis als auch auf Dimensionen journalistischer Qualität und deren Sicherung eingegangen wird. Danach werden die Umbrüche im Web 2.0- Zeitalter erläutert, ehe mit der Weblog-Kommunikation eine zentrale Erscheinungsform dieser Ära vorgestellt wird. Hierbei stelle ich auch dar, in welchem Verhältnis Weblogs zum Journalismus stehen und welche Konsequenzen deren Präsenz für ihn haben. Im Hauptteil geht es zunächst um die veränderten Anforderungen an den Journalismus, ehe auf dessen Finanzierung eingegangen wird. In einem weiteren Schritt wird der Stellenwert von Watchblogs bei der journalistischen Qualitätssicherung erörtert; danach betrachte ich die Internetauftritte von zwei regionalen Tageszeitungen im Hinblick auf Partizipationsangebote für Rezipienten. Schließlich geht es um die gesellschaftliche Bedeutung des Journalismus im Internetzeitalter, wobei Denkansätze des Philosophen Michel Foucault als Hauptgrundlage dienen. Abgerundet wird der Hauptteil mit empirisch gewonnenen Einschätzungen aus der journalistischen Praxis. In einer Schlussbetrachtung werte ich die Ergebnisse aus.
Kapitel 2: Das traditionelle Modell des Journalismus
2.1 Funktionen und Selbstverständnis
Die Funktionen des Journalismus können - in Anlehnung an Armborst (2006: 88-91) - von einem systemtheoretisch orientierten und einem normativen Ansatz her bestimmt werden. Während bei ersterem überprüft wird, welchen Stellenwert Journalismus für das Funktionieren verschiedener gesellschaftlicher Subsysteme haben kann und davon ausgehend spezifische Funktionen definiert werden, geht der normative Ansatz von einem anderen Blickwinkel aus: „Bei normativen Funktionen, die Journalismus [...] zugeschrieben werden, handelt es sich vor allem um Ableitungen aus Gesetzen und Gerichtsurteilen“ (Armborst 2006: 90). Journalistische Funktionen werden also hierbei von außen definiert. Als zentrale Aufgabe des Journalismus stuft Rühl (in Armborst 2006: 89) die „Bereitstellung von Themen zur öffentlichen Kommunikation“ ein. Diese Funktion wird auch von Weischenberg/Malik (2006: 346) hervorgehoben, aber um die Dimension der gesellschaftlichen Relevanz ergänzt. Dem adäquat nachzukommen ist äußerst wichtig, da Journalismus aufgrund seiner Reichweite zwangsläufig „ein Netz an Themen strickt, durch welches sich gesellschaftliche Identität konstruiert“ (Müller 2008: 6). Des Weiteren obliegt dem Journalismus gemeinhin die Aufgabe der Komplexitätsreduktion. Wie Pöttker (2000: 377, 378) es darstellt, fungiere er dabei als Vermittler zwischen „voneinander geschiedenen Lebenswirklichkeiten“ und hat die Zielvorgabe, „die Übertragung des jeweils isolierten Erfahrungswissens in eine jedermann zugängliche [...] 'offene' Sphäre“ zu gewährleisten. Demnach ist Journalismus eine Orientierungsinstanz und hat die Aufgabe, zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung und Kohäsion beizutragen. Etabliert hat sich auch die Kompensationsfunktion, wobei es um die Repräsentation der Interessen von Randgruppen sowie um das Aufgreifen von relevanten Themen geht, denen gesellschaftliche Instanzen wie die Politik aber nur bedingt Wertschätzung schenken. Ebenso Einigkeit herrscht dahingehend, dass Journalismus einer Kritik- und Kontrollfunktion nachkommen müsse, also als „professionelle Fremdbeobachtung“ (Weischenberg/Malik 2006: 346) verschiedenster Gesellschaftsbereiche zu fungieren habe. Unter anderem in Form von Leitartikeln, Kommentaren und Glossen kann dieser Funktion nachgekommen werden, der Pürer (2008: 13) eine hohe Rolle bei der individuellen politischen Meinungs- und Willensbildung bemisst:
„Ihr besonderer Wert besteht nicht nur darin, dass der von politischen Entscheidungen betroffene Bürger in die Lage versetzt werden soll, sich über gesellschaftliche Vorgänge ein umfassendes, kritisches Bild zu verschaffen. Er [...] findet vor allem in meinungsbildenden Beiträgen auch die Möglichkeit, bereits vorhandene persönliche Wert- und Moralvorstellungen, Meinungen und Verhaltensweisen zu überprüfen und so in seinem Bedürfnis nach persönlicher Identität befriedigt zu werden.“
Eng verbunden mit der Kritik- und Kontrollfunktion ist der Begriff der 'Vierten Gewalt'. Der Journalismus positioniert sich hierbei neben Exekutive, Legislative und Judikative und soll ihnen gegenüber „wichtige Kontrollaufgaben wahrnehmen“ (Pürer 2008: 10). In Bezug auf Deutschland beschreibt Stöber (2008: 135) ein Zusammenspiel zwischen den vier Gewalten, wobei der Journalismus „dem Schutz der Demokratie“ diene. Dessen Aufgabe liege darin, durch Berichterstattung beispielsweise Missstände in der Politik aufzudecken, während etwaige rechtliche Schritte dann von der Judikative in die Wege geleitet werden.
Bei der Inhaltsverbreitung orientierte sich der Journalismus jahrzehntelang an den Paradigmen der traditionellen Massenkommunikation, bei der wenigen Sendern ein „disperses Publikum“ (Maletzke 1963: 32) gegenübersteht, dem nur durch einen Medienwechsel Rückkanäle zur Verfügung stehen. Folglich war zur Kontaktaufnahme ein gewisser Aufwand erforderlich, was die Kommunikationswahrscheinlichkeit zwischen Sender und Empfänger minimierte. In Anbetracht dessen hatten Informationsanbieter „keine genaue Vorstellung von ihren Adressaten“ (Stöber 2008: 41), die zwangsläufig „in der Anonymität einer größeren Masse“ verschwanden. Somit wurde der Journalismus regelrecht dazu gezwungen, massentaugliche Produkte zu erstellen. Dabei orientierte er sich am Prinzip des Gatekeeping, das Bruns (2009: 107) als „Regime der Kontrolle“ bezeichnet. Hierbei entscheiden Redaktionen darüber, welche Informationen veröffentlicht werden, sodass sie mächtige Instanzen bei der Herstellung von gesellschaftlicher Wirklichkeit sind. Der Auswahl zugrunde liegt nicht nur die Leitmaxime der gesellschaftlichen Relevanz und die zur Verfügung stehenden Seiten. So unterliegen Redaktionen mitunter zusätzlichen Imperativen, damit beispielsweise negativen Konsequenzen „für die politischen oder kommerziellen Interessen“ (Bruns 2009: 108) des jeweiligen Verlags vorgebeugt werden kann. Der Gatekeeping-Prozess setzt sich aus den Stufen Eingang, Ausgang und Antwort zusammen. An der Eingangsstufe wird Informationen Einlass in den Produktionsprozess gewährt, an der Ausgangsstufe werden die aufbereiteten Informationen „in die Medien entlassen“ (Bruns 2009: 108). In Form von Rückkanälen wird den Rezipienten an der Antwortstufe zwar die Möglichkeit zur Teilhabe gegeben, allerdings üben Redaktionen auch hier Kontrolle aus: Sie allein entscheiden nämlich, welche Leserbriefe „zur Veröffentlichung ausgewählt oder zurückgewiesen werden“ (Bruns 2009: 109). Dies impliziert, dass es sich beim Gatekeeping um einen linear verlaufenden Prozess mit wenig Rückkoppelung handeln kann, was von Gans (1980: 80, 81) thematisiert wird: „[...] in reality the process is circular, complicated further by a large number of feedback loops. [...] sourcesjournalists, and audiences coexist in a system, although it is closer to being a tug of war than a functionally interrelated organism.“
2.2 Journalistische Qualität und deren Sicherung
Seit Anfang der 1990er Jahre wird in der Wissenschaft über journalistische Qualität diskutiert. Die Etablierung von verbindlichen Standards erwies sich aber von Beginn an als schwierig, was Ruß-Mohl (1992: 85) einst zu folgender Aussage veranlasste: „Qualität im Journalismus definieren zu wollen, gleicht dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln.“ Diese Problematik hängt damit zusammen, dass die Diskussionen aus verschiedenen Blickwinkeln geführt werden. So lässt sich die normative von der funktionalen Dimension abgrenzen, wovon ausgehend Meckel (1999: 35-40) journalistische Qualität in funktionaler Hinsicht kritisch diskutiert. Bei Ersterer wird Qualität daran gemessen, inwiefern journalistische Produkte festgelegte Kriterien erfüllen. Demgegenüber steht die funktionale Dimension, bei der Qualität als Zielvorgabe angesehen wird und die Frage im Mittelpunkt steht, inwiefern Journalismus Leistungen für gesellschaftliche Subsysteme erbringt.
Wyss (2002: 114-116) unterscheidet sogar vier Perspektiven, aus denen Qualitätsdiskussionen geführt werden können: die professionelle, die utilitaristischökonomische, die ideologisch-normative und die normativ-pragmatische. Während Betrachtungen ausgehend von der professionellen Perspektive eine Randerscheinung seien, nehme die utilitaristisch-ökonomische Perspektive einen weitaus höheren Stellenwert ein. Wie Wyss (2002: 115, 116) betont, bestimmen hierbei „ökonomische Imperative den Qualitätsbegriff“, weswegen journalistische Qualität „zu einer kalkulierbaren Größe von Marktadäquanz und Publikumsakzeptanz“ werde. Demgegenüber steht die ideologischnormative und die normativ-pragmatische Perspektive: Erstere rückt die für eine funktionierende Demokratie notwendigen Erfordernisse in den Vordergrund, während bei aus der normativ-pragmatischen Perspektive geführten Diskussionen die Anforderungen an journalistische Produkte aus rechtlichen Grundlagen abgeleitet werden. Demnach müsste man Rechtmäßigkeit als Qualitätsmaßstab ansehen, was jedoch Rager (1994: 194) ablehnt und Aktualität - unterteilt in Tagesaktualität und latente Aktualität - als elementare Dimension hervorhebt. Während bei der Tagesaktualität Qualität an der Reaktionsgeschwindigkeit von Redaktionen auf Tagesereignisse erkennbar wird, äußert sich Qualität in Bezug auf die latente Aktualität darin, inwieweit es gelingt, den Gegenwartsbezug von Themen, die die Gesellschaft durchgängig beschäftigt, nachvollziehbar zu machen (vgl. Rager 1994: 197). Als weitere wichtige Qualitätsdimension wird Relevanz angesehen, wobei die Maxime besteht, alle wichtigen Positionen und Akteure in diejeweilige Berichterstattung zu integrieren. Dies ist allerdings ein schwieriges Unterfangen, sind doch journalistische Produkte - wie Rager (1994: 198) anmerkt - stets „Interpretationen der Realität“. In Anbetracht dessen erwies sich das Anfang des 20. Jahrhunderts ausgehend von der angenommenen „Möglichkeit einer realitätsadäquaten Berichterstattung“ (Wyss 2002: 117) formulierte Ideal absoluter Objektivität als nicht erfüllbar. Dies hatte eine Ausdifferenzierung des Objektivitätsbegriffes zur Folge, mit dem in den vergangenen Jahrzehnten unterschiedlichste Dimensionen wie Vollständigkeit, Neutralität und Richtigkeit verknüpft wurden. Letztere stuft Rager (1994: 200) als eigenständigen Qualitätsstandard ein: Hierbei gehe es darum, „möglichst fehlerfrei und frei von logischen Widersprüchen zu berichten und unterschiedliche Meinungen möglichst unverfälscht wiederzugeben.“ Ein hoher Stellenwert wird auch der Dimension Vielfalt beigemessen, die in Themen-, Interessen- und Quellenvielfalt untergliedert werden kann (vgl. Wyss 2002: 125, 126) und mitunter als Nonplusultra von journalistischer Arbeit erachtet wird. So meint Rager (1994: 194), dass Vielfalt nicht als Qualitätsdimension, sondern als Zielvorgabe anzusehen ist, „an der Qualitätsmaßstäbe zu entwickeln sind.“
Eine wichtige Voraussetzung für die Erfüllung dieser Qualitätsstandards sind adäquat besetzte Redaktionen mit entsprechend ausgebildeten Journalisten. Dieser präventiven Form von Qualitätssicherung misst Ruß-Mohl (1992: 92) einen hohen Stellenwert bei: „In komplexen Systemen ist Qualitätssicherung ohnehin kaum durch [...] rigide Kontrollen zu erreichen, sondern primär durch Professionalisierung. Diese wiederum fußt auf einer geregelten Aus- und Weiterbildung“. Zur Qualitätssicherung trug letztlich auch ein stabiles Finanzierungsmodell - bestehend aus Vertriebs- und Anzeigenerlösen - bei. Wie Pasquay (2010) in Bezug auf den deutschen Zeitungsmarkt anmerkt, galt bis ins Jahr 2000 die Maxime, dass rund ein Drittel der Einnahmen aus dem Vertrieb stammen und der Rest über Anzeigen generiert wird. Aufgrund von Einbrüchen auf dem Anzeigenmarkt gewannen aber seitdem die Vertriebserlöse zunehmend an Bedeutung. Deren Generierung ist jedoch seit jeher keine triviale Angelegenheit, schließlich neigen Informationsmärkte dazu, „instabil zu sein“ (Picot 2009: 643). So kann eine Zahlungsbereitschaft gewöhnlicherweise nur erzeugt werden, wenn die Rezipienten dem jeweiligen Informationsangebot einen besonderen Wert beimessen. Um sich dessen sicher zu sein, müssen sie dieses aber vorher begutachtet haben, wodurch die Zahlungsbereitschaft zwangsläufig auf ein Minimum reduziert wird. In Anbetracht dessen haben Verlage über Jahrzehnte hinweg zwei Strategien verfolgt: Neben dem Anbieten von kostenlosen Versuchseinheiten war der Aufbau einer hohen gesellschaftlichen Akzeptanz von Bedeutung, „sodass im Vertrauen darauf Kaufbereitschaft ohne vorherige Inspektion [...] der Inhalte entsteht“ (Picot 2009: 643). Damit Qualitätsstandards eingehalten werden, haben sich verschiedene korrektive Sicherungsinstanzen etabliert. Hervorzuheben sind die in die journalistische Praxis integrierten Redaktionskonferenzen, die sich in Tages-, Wochen- und Grundsatzkonferenzen einteilen lassen (vgl. Meckel 1999: 121). Während bei täglichen Konferenzen die Inhalte bereits veröffentlichter Produkte kritisiert werden, stehen bei Wochenkonferenzen und den in der Regel einmal jährlich stattfindenden Grundsatzkonferenzen grundsätzliche Aspekte (beispielsweise die publizistische Ausrichtung) im Mittelpunkt. Wyss (2002: 205) ist der Ansicht, dass die Redaktionskonferenz „eines der wichtigsten Steuerungsinstrumente der journalistischen Qualitätssicherung“ sei, während Meckel (1999: 120) festhält, dass Konferenzen oft unter „fehlender Stringenz [...] sowie Kommunikationsbarrieren leiden“ und Chefredakteure diese als Bühne zur eigenen Profilierung nutzen. Während hiermit lediglich implizit auf deren Unzulänglichkeiten bei der Sicherung journalistischer Qualität hingewiesen wird, stuft Schlüter (in Wyss 2002: 208) die in Redaktionskonferenzen stattfindenden Blattkritiken als unwirksam bei der Qualitätssicherung ein. Aufgrund des latenten Zeitdrucks im journalistischen Alltag würden diese zwangsläufig als lästige Notwendigkeit angesehen werden. Als korrektive Instanzen fungieren auch Presseräte, diejedoch oft als 'zahnlose Tiger' bezeichnet werden, da sie fragwürdige Berichterstattungen lediglich rügen, aber keine Veränderungen im Hinblick auf redaktionelle Arbeitsweisen bewirken können. Zudem haben Presseräte nicht die Möglichkeit, Verlage zur Veröffentlichung von Rügen zu zwingen und sie damit einem öffentlichen Druck auszusetzen. In Anbetracht dessen stuft Zulauf (2000: 90) den Stellenwert der Presseräte als Qualitätssicherungsinstanz als gering ein: „Trotz hoher Beachtung, die dem Presserat in Fachkreisen gezollt wird, ist nicht zu übersehen, dass seine Urteile in der Praxis von den Medienschaffenden konstant missachtet werden.“ Ein weitaus höheres Potenzial bei der Qualitätssicherung wird hingegen dem insbesondere in spezifischen Ressorts von Tageszeitungen betriebenen Medienjournalismus zugeschrieben, dessen Aufgaben im Anprangern von Missständen im Journalismus, aber auch in der angemessenen Würdigung von dessen Leistungen liegen. Wie Ruß-Mohl (1997: 224) betont, sei es der Medienjournalismus, „der den Diskurs über Journalismus in Gang hält.“ Allerdings unterliegt er auch Beschränkungen, die in Kapitel 4.3, in dem erörtert wird, inwiefern Watchblogs zu einer besseren Qualitätssicherung beitragen können, thematisiert werden.
Kapitel 3: Das Internetzeitalter
3.1 Umbrüche in der Ära des Web 2.0
Seit rund acht Jahren kursiert in der Wissenschaft der Begriff des Web 2.0, doch eine genaue Definition erscheint aufgrund seiner zahlreichen Facetten nicht möglich. Festzuhalten ist jedoch, dass Web 2.0 eine neue Ära in der Massenkommunikation beschreibt, in der über Jahrzehnte hinweg unangefochtene Strukturen ins Wanken geraten. Während für die traditionelle Massenkommunikation und ebenfalls für die Frühphase des Internets (auch Web 1.0 genannt) nämlich eine Einteilung in wenige Produzenten und viele Konsumenten charakteristisch war, so verfestigt sich in der Web 2.0-Ära - wie Stanoevska-Slabeva (2008: 4) betont - „eine neue Philosophie der Internetnutzung sowie eine neue Umgangsform mit Inhalten“. Hiermit ist gemeint, dass der Rezipient das Internet nicht mehr vorwiegend als Informationsmedium betrachtet und demnach die Rolle des passiven Konsumenten ablegen möchte. Er entwickelt sich zu einem Mischwesen aus Produzent und Konsument - in diesem Zusammenhang hat sich die Bezeichnung 'Prosument' etabliert - und erhebt den Anspruch, sich mit eigenständig erstellten Inhalten sowie der auf bidirektionalem Weg möglichen Bewertung fremder Inhalte am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung zu beteiligen. Insofern ist davon auszugehen, dass das jahrzehntelang unangefochtene unternehmerische Top-Down-Prinzip kontinuierlich an Akzeptanz verliert - Simons (2011: 102) hält sogar dessen Verdrängung für wahrscheinlich: Internetseitenbetreiber beschränken sich gemäß des Bottom-Up-Prinzips vorwiegend auf das Bereitstellen der Infrastruktur und übernehmen vereinzelt moderierende Aufgaben: „Die Bühne bespielen [...] aber die Nutzer.“
Außerdem kann das Web 2.0 aus einem technologischen Blickwinkel betrachtet werden, wovon ausgehend es als „eine inkrementale Innovation sowie eine konsequente Nutzung von teilweise schon verfügbaren Technologien“ (Stanoevska-Slabeva 2008: 3) anzusehen ist. Hierbei ist neben dem Hervorbringen leicht bedienbarer Werkzeuge zur Inhaltserstellung die Entwicklung von neuen Programmiersprachen wie Ajax, durch die Internetangebote benutzerfreundlicher gestaltet werden konnten, und von Informationsaustauschprotokollen wie RSS, hervorzuheben. Durch diesen Entwicklungsschub wurde maßgeblich zum Entstehen von innovativen Plattformen wie YouTube, auf der das neue Selbstverständnis in der Internetnutzung prägnant zum Ausdruck kommt, beigetragen. Wie Stanoevska-Slabeva (2008: 4) anmerkt, seien diese und andere Plattformen wie Wikipedia durch „unterschiedliche Kombination der technologischen Entwicklungen“ entstanden. Des Öfteren wird der Terminus Web 2.0 fälschlicherweise mit dem des Social Web gleichgesetzt: Während nämlich das Social Web als Partialstruktur des Web 2.0 den Interessensschwerpunkt aufjene Bereiche legt, bei denen es „um die Unterstützung sozialer Strukturen und Interaktionen“ (Ebersbach u.a. 2011: 32) geht, so ist der Terminus Web 2.0 auch in ökonomischer, rechtlicher und technischer Hinsicht definierbar. Die Unklarheit darüber, was unter Web 2.0 zu subsumieren ist und welche Veränderungen sich ergeben, veranlasste Tim O'Reilly zu einer ersten systematischen Auseinandersetzung: Zum Einen beschreibt er die durch innovative Anwendungen entstandene Omnipräsenz des Internets, zum Anderen hebt er die Aufwertung der Dimension der kollektiven Intelligenz hervor: „The central principle behind the success of the giants born in the Web 1.0 era who survived to lead the Web 2.0 era appears to be this, that they have embraced the power of the web to harness collective intelligence“ (O'Reilly 2005: 3). Hierdurch kann eine hohe inhaltliche Qualität erzielt werden - als Paradebeispiel gilt die Enzyklopädie Wikipedia1- „wenn starke individuelle und auch kontroverse Meinungen in der Gruppe existieren“ (Ebersbach u.a. 2011: 211). Bei entsprechenden Plattformen wird die Arbeit an räumlich getrennte Nutzer delegiert, deren Zusammenwirken im Sinne einer Kollaboration organisiert ist: Aufgaben werden - anders als bei der Kooperation - „nicht im Vorhinein arbeitsteilig aufgetrennt, sondern jeder trägt gleichermaßen mit seinen individuellen Kenntnissen [...] zur Lösung der Gesamt-Aufgabe bei, ohne dass von einander unterschiedene Aufgabenbereiche [...] definiert würden“ (Schmalz in Ebersbach u.a. 2011: 207). Als Ergebnis entstehen unabgeschlossene Produkte - die Nutzer wirken an einem Prozess der ständigen Verbesserung mit, den Simons (2011: 101) als ein elementares Paradigma des neuen Massenkommunikationszeitalters erachtet. Zu den bekanntesten Web 2.0-Anwendungen gehören Wikis, Weblogs und soziale Netzwerke, die nach Ebersbach u.a. (2011: 38, 39) in einem Dreiecksmodell - bestehend aus den Dimensionen Kollaboration, Information und Beziehungspflege - positioniert werden können: Während sich Weblogs im Spannungsfeld zwischen Kollaboration und Information bewegen, ist bei Wikis die Kollaboration stark ausgeprägt. Vorwiegend der Beziehungspflege dienen indes soziale Netzwerke, deren Etablierung dazu beitrug, dass Internetnutzer direkter angesprochen werden können. Diese Adressierungsform bezeichnet man als Narrowcasting und hat beispielsweise zum Ziel, bestimmte Bevölkerungsgruppen mit den für sie wichtigen, spezifisch aufbereiteten Informationen zu versorgen. Angesichts der Fragmentierung gesellschaftlicher Interessen im Internet scheint dies - wie auch Novy/Schwickert (2009: 18) meinen - eine Notwendigkeit zu sein: Auf die Ära der Massenkommunikation folge die des Narrowcasting, bei der die Ansprache von Rezipienten „sehr viel direkter, individueller und dialogorientierter ausgestaltet werden muss.“ Infolge der Umbrüche in der Web 2.0-Ära etablierten sich neue Geschäftsmodelle wie Long Tail: Diesem liegt die Prämisse zugrunde, dass sich im Internet die Nachfrage nach beispielsweise Informationen „in unzählige Sparten“ (Simons 2011: 120) verästeln und Unternehmen somit mit vielen Nischenprodukten höhere Gewinne als mit wenigen Massenprodukten generieren können.
3.2 Das Phänomen Weblog
Der Begriff Weblog geht auf John Barger zurück, der ab 1997 auf seiner Homepage Links zu verschiedenen Themen zusammentrug und Weblogs sehr allgemein als Internetseiten definierte, „where a Web logger logs all the other Web pages she finds interesting“ (Barger in Seeber 2008: 13). Zwei Jahre später veröffentlichte Cameron Barett seinen Essay Anatomy of a Weblog, der gemeinhin als Gründungsmanifest der Weblog-Kommunikation angesehen wird. Üblicherweise stehen sich hierbei ein oder wenige Beitragsersteller und eine prinzipiell unbegrenzte Anzahl an Beitragskommentatoren gegenüber. Ein Charakteristikum dieser Beiträge ist die subjektive Darstellung von Ereignissen und die dadurch vermittelte Authentizität (vgl. Ebersbach 2011: 62). Die Intention der Betreiber besteht weniger in der Bindung von Nutzern, sehen sie sich doch „als Teilnehmer einer großen umfassenden Diskussion“ (Simons 2011: 16). Diese findet in der Blogosphäre statt, worunter man die Gesamtheit aller Weblogs und ihre Vernetzung versteht. Hierzu tragen Trackbacks bei, die Betreiber automatisch benachrichtigen, wenn in anderen Weblogs auf ihre Beiträge Bezug genommen wird. Vereinzelt wird die Ansicht vertreten, dass die Ursprünge der WeblogKommunikation bereits Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre liege, als Pioniere wie Tim Berners-Lee ihre Erkundungen im damals neuen Internet publik machten: „Whatever their reasons, for these folks it seemed the most natural thing in the world to put the record of their travels around the web on the web“ (Blood 2002: 2). Solche Seiten wurden überwiegend von Informatikern bereitgestellt, war doch deren Erstellung kompliziert, weswegen eine breite gesellschaftliche Partizipation ausgeschlossen war. Diese frühen Blogger-Aktivitäten werden der Kategorie der Filter-Style-Weblogs zugeordnet, die von der der Free-Style-Weblogs zu unterscheiden ist. Während Erstere aus kommentierten Links bestehen, zeichnen sich FreeStyle-Weblogs durch größere Textmengen und weniger Links aus (vgl. Armborst 2006: 42, 43). Dieses Format, bei dem der Fokus auf der Reflexion persönlicher Erlebnisse liegt, etablierte sich Ende der 1990er Jahre, als durch innovative Plattformen wie Blogger.com eine breite gesellschaftliche Teilhabe an der Weblog-Kommunikation möglich wurde:
„While weblogs had always included a mix of links, commentary, and personal notes, in the postBlogger explosion increasing numbers of weblogs eschewed this focus on the web-at-large in favor of a sort of short-form journal. These blogs [...] were instead a record of the blogger's thoughts: [...] notes about the weekend, a quick reflection on some subject or another“ (Blood in Seeber 2008: 14).
Die Frage, inwiefern Weblog-Kommunikation Einfluss auf die Herstellung von Öffentlichkeit nehmen kann, wird in der Wissenschaft seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Zum Einen lässt sie sich als bloße Übertragung von einfachen Öffentlichkeiten (beispielsweise Face-to- Face-Kommunikationen) ins Internet einstufen. Wie Katzenbach (2008: 107) anmerkt, adressieren die in Weblogs dominierenden Inhalte - im Gegensatz zu jenen, die von den Massenmedien bereitgestellt werden - nämlich in der Regel nur ein sehr kleines Publikum, sind für die meisten Internetnutzer „vollkommen irrelevant“ und haben somit eine eher geringe Wirkkraft. Zum Anderen besteht durch die Vernetzung von Weblog-Beiträgen aber eine hohe Wahrscheinlichkeit auf Anschlusskommunikation, was im Rahmen von Face-to- Face-Kommunikationen aufgrund der Abgeschiedenheit einzelner Interaktionen für gewöhnlich nicht der Fall ist. Somit können über Weblog-Kommunikation äußerst dynamische Öffentlichkeiten entstehen. Wie Simons (2011: 135) betont, ermögliche die Viralität in der Blogosphäre, dass auch unbekannte Weblogs eine große Anzahl an Internetnutzern über Ereignisse informieren können, ehe beispielsweise Tageszeitungen „auch nur eine einzige Zeile“ darüber abdrucken können. Da es sich bei dieser Dynamisierung nicht nur um eine theoretische Möglichkeit handelt, sondern die Blogosphäre sogar bereits gesellschaftliche Debatten angestoßen hat2, verliert der Journalismus einen Teil seiner Interpretationshoheit. In Anbetracht dessen, dass sich durch Weblog-Kommunikation „alternative Wirklichkeitsdeutungen“ (Katzenbach 2008: 116) heraus kristallisieren, ist der Journalismus nur noch bedingt in der Lage, verbindliche Themen zur öffentlichen Kommunikation zu setzen und gesellschaftliches Bewusstsein zu konstruieren.
Angesichts dieser Machtverschiebung drängt sich die Frage auf, inwiefern Weblogs als eine Art Journalismus eingestuft werden können. In diesem Kontext sind zunächstjene Positionen hervorzuheben, die mit der Weblog-Kommunikation die Geburt eines alternativen Journalismus verbinden. So existiert beispielsweise die Annahme, dass in Weblogs Do-it- yourself Journalism betrieben werde, womit - wie Armborst (2006: 101) anmerkt - die Unterstellung verknüpft ist, „dass Blogger elementarejournalistische Regeln [...] fortwährend missachten.“ Demgegenüber stehen Positionen, die Weblogs in einen Zusammenhang mit professionellem Journalismus stellen. So stufen Bucher/Büffel (2005: 85) sie als funktionale Äquivalente ein, da aufgrund ihrer zunehmenden Reichweite „Themen für die öffentliche Kommunikation“ bereitgestellt werden können. Dieser Blickwinkel istjedoch problematisch, da Weblogs lediglich aufgrund der Erfüllung einer zentralen journalistischen Funktion dem Journalismus zugeordnet werden und außer acht gelassen wird, inwiefern sie den anderen Dimensionen journalistischen Arbeitern gerecht werden. In Anbetracht dessen, dass in Weblogs häufig eine sehr subjektive, mit demjournalistischen Selbstverständnis nur bedingt vereinbare Darstellungsweise vorherrscht, ist eine differenziertere Betrachtung unabdingbar. Über die Frage, inwiefern Weblogs mit dem Journalismus in Konkurrenz treten können, wurde in den vergangenen Jahren immer wieder debattiert. Während Alphonso (2004: 26) sie als den „Sargnagel“ des Journalismus einstuft, sieht Müller (2008: 35) professionelle Informationsanbieter dauerhaft in einer besseren Position: „Quellen und Selektion bleiben [...] zum überwiegenden Teil in der Hand der Journalisten.“ Eine von Neuberger u.a. (2007: 106) erwähnte Inhaltsanalyse von renommierten US-amerikanischen Weblogs verleiht dieser Einschätzung Nachdruck: Lediglich fünf Prozent der Beiträge basierten auf Eigenrecherchen; fast 80 Prozent beschränkten sich auf das Kommentieren fremder Inhalte. Angesichts des Mangels an Eigenmaterial wehrten sich auch renommierte Blogger bereits dagegen, als Journalisten bezeichnet zu werden: „Im not practicing journalism when I link to a news reported by someone else and state what I think [...]. Credible journalists make a point of speaking directly to witnesses and experts, an activity so rare among bloggers“ (Blood 2003). Dass Weblogs zudem nur bedingt journalistischen Standards gerecht werden, verdeutlicht eine von Neuberger u.a. (2007: 105) aufgeführte Studie unter US-amerikanischen Bloggern. Diese ergab, dass lediglich fünf Prozent Nachrichten und aktuelle Ereignisse thematisieren möchten, während fast 40 Prozent eine Präferenz für die Darstellung von persönlichen Erfahrungen haben. Eine andere Studie (vgl. Neuberger u.a. 2007: 102) zeigte indes, dass rund drei Viertel der befragten deutschsprachigen Blogger Dinge aus dem eigenen Privatleben preisgeben möchten, während nur 41 Prozent das Kommentieren von aktuellen politischen Themen intendiert. Somit scheint es naheliegend, dass Weblogs keine ernsthafte Konkurrenz für professionelle Informationsanbieter darstellen und vorwiegend als Instrument zur Anschlusskommunikation über journalistische Inhalte einzustufen sind. Diese Quintessenz ziehen auch Neuberger u.a. (2007: 110) auf der Grundlage von empirischen Untersuchungen aus Deutschland, dem europäischen Ausland und den USA: „Insgesamt lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass zwischen Weblogs und professionellem Journalismus primär eine komplementäre [.] Beziehung besteht.“
Kapitel 4: Journalismus im Internetzeitalter
4.1 Abkehr vom traditionellen Verständnis
Die skizzierten Umbrüche im Web 2.0-Zeitalter dürften mittelfristig gravierende Veränderungen hinsichtlich der Leitmaximen im journalistischen Arbeitsprozess zur Folge haben. Bereits vor mehr als zehn Jahren hatte Neuberger (2000: 39) daraufhingewiesen, dass der Journalismus in Zukunft immer weniger „autoritär selektieren und die dem Publikum verfügbare Informationsmenge begrenzen“ könne. Diese Auffassung muss heutzutage mehr denn je im journalistischen Selbstverständnis verankert werden, können doch gesellschaftliche Organisationen, aber auch einzelne Rezipienten durch die neuen Möglichkeiten der Inhaltserstellung ohne die Zwischenschaltung von Mittelsmännern Botschaften publizieren. Dies hat zur Folge, dass zumindest ein Großteil der relevanten Nachrichten als Rohinformationen einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden können. Infolgedessen besteht die Gefahr, dass sich der Journalismus durch eine interne Informationsselektion unglaubwürdig macht. Schließlich haben Rezipienten die Möglichkeit, durch Vergleiche mit den im Internet expandierenden Informationsangeboten Ursachen für die Selektion (beispielsweise kommerzielle Überlegungen) zu entlarven.
Letztlich erweist sich das Gatekeeping-Prinzip zumindest an der Eingangsstufe als nicht mehr zeitgemäß, weswegen in der Wissenschaft seit einigen Jahren über eine Neuausrichtung diskutiert wird. So erachtet Bruns (2009: 113) das Konzept des Gatewatching, bei dem nicht das strikte Bewachen der eigenen Eingangs- und Ausgangsstufen, als vielmehr „die Beobachtung der Ausgangstore von externen Nachrichten- und anderen Quellen“ im Vordergrund steht, als richtungsweisend. Hierbei fungieren journalistische Akteure (in Zusammenarbeit mit Internetnutzern) als Kontrolleure über bereits publiziertes Material - mit dem Ziel, in beispielsweise Weblogs nach interessantem Rohmaterial zu suchen, das als Grundlage für Berichterstattungen dienen könnte. Hiermit verbunden ist ein sich veränderndes Selbstverständnis bei der Beschaffung von Themen, schließlich werden diese nicht mehr ausschließlich redaktionsintern festgelegt. Davon, dass ein solches Umdenken dem Journalismus dienlich sein kann, sind Skibicki/Mühlenbeck (2010: 5) überzeugt: „Die Plätze im Internet, auf denen ganz normale Menschen ihre Erlebnisse, Meinungen und Leidenschaften anderen darstellen, liefern eine nicht versiegende Quelle an Themen und Stories.“ Implizit zum Ausdruck gebracht wird hierdurch die Annahme, dass der Journalismus durch eine zunehmende Themenbeschaffung über Web 2.0-Plattformen in ausgeprägterem Maße seiner zentralen Funktion - nämlich Themen aufzubereiten, die für die Gesellschaft von Relevanz sind - nachkommen kann. Des Weiteren steht zur Diskussion, inwiefern der Journalismus an der konventionellen Produktion von massentauglicher Ware festhalten kann. In diesem Zusammenhang weist Simons (2011: 127) darauf hin, dass aufgrund des sich ausdifferenzierenden Gesamtangebots im Internet „das Interesse an medialer Konfektionsware“ kontinuierlich sinke. Insofern wirft Müller (2008: 41)zu recht die Frage auf, ob Massenjournalismus in der bisherigen Ausprägung überhaupt noch eine Daseinsberechtigung habe und stellt provokativ in den Raum, inwieweit die Dimension der Objektivität eine Maxime journalistischer Arbeit sein müsse oder ob das jahrzehntelange Festhalten daran nicht eher mit „gewissen kommerziellen Imperativen“ einer Zeitepoche zusammenhing, in der es angesichts der Strukturen in der Kommunikation zwangsläufig notwendig gewesen war, „die breite Masse, den Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen“. Angesichts der zunehmenden Fragmentierung gesellschaftlicher Interessen und der vorhandenen Möglichkeit der zielgruppenspezifischen Ansprache im Internet dürfte die Bedeutung von Nischenjournalismus zunehmen, womit Müller (2008: 41) Veränderungen hinsichtlich der journalistischen Qualitätsmaßstäbe verbindet: „Die Ideale des
Informationsjournalismus, Präzision und Neutralität, werden [...] durch Authentizität [...] und eine Vielfalt der Perspektiven ersetzt werden. Gerade die auf Subjektivität fundierte Authentizität dürfte eine faktisch basierte Glaubwürdigkeit ablösen.“
Zudem wird darüber diskutiert, inwiefern sich Veränderungen bezüglich der Darstellungsformen vollziehen werden. Dem traditionellen Produktjournalismus zuwiderlaufend kursiert mittlerweile der innovative Ansatz des Prozessjournalismus, dem die Prämisse zugrunde liegt, dass journalistische Inhalte keine abgeschlossenen Produkte sind und Fehler somit nachträglich beseitigt werden können. Diesem Ansatz misst Jarvis (2009 b) hohes Potenzial bei: „These changes in [...] practice of journalism will not just bolster journalism's reputation but expand its reach and impact in society.“ Dieser Überzeugung folgend dürften die über Jahrzehnte hinweg unangefochtenen statischen Darstellungsformen wie Bericht und Kommentar zwangsläufig an Bedeutung verlieren, was von Simons (2011: 154) betont wird: Aufgrund der bidirektionalen Kommunikationsstrukturen im Internet und der damit verbundenen ständigen Ansprechbarkeit von Redaktionen entwickeln sich journalistische Produkte „zur Momentaufnahme eines nie endenden Prozesses.“ Infolgedessen ändern sich zwangsläufig die Funktionen von Redakteuren, die nicht mehr vorwiegend Produktersteller sind, sondern sich zu Moderatoren entwickeln, die ihre Inhalte über das Veröffentlichungsdatum hinaus betreuen, zu angeprangerten Fehlern Stellung beziehen, diese in ihren Inhalten beseitigen und in Foren Prozesse der Wahrheitsfindung
[...]
1Ausgehend von Studien wurde Wikipedia bereits eine höhere inhaltliche Qualität als dem renommierten, aber hegemonialen Produktionsstrukturen unterworfenen Brockhaus attestiert (vgl. http://www.sueddeutsche.de/digital/wikipedia-besser-als-der-brockhaus-1.324954. Stand 25.4.2012)
2Häufig verwiesen wird hierbei auf den Fall Trent Lott. Der ehemalige US-amerikanische Senator hatte 2002 öffentlich die 1948 gescheiterte Präsidentschaftskandidatur von Strom Thurmond bedauert, der sich für eine strikte Rassentrennung ausgesprochen hatte. Während die Massenmedien diesem Vorfall zunächst kaum Beachtung geschenkt hatten, entfachten sich in der Blogosphäre heftige Diskussionen. Dies führte zu einer öffentlichen Debatte, sodass auch die Massenmedien darüber berichteten und Lott schließlich zurücktrat.
- Arbeit zitieren
- Daniel Seehuber (Autor:in), 2012, Ein Tod auf Raten? Perspektiven und Bedeutung des Journalismus im Internetzeitalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/201972
Kostenlos Autor werden



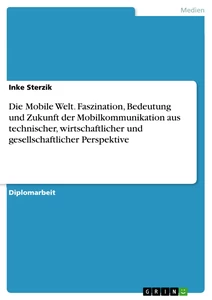

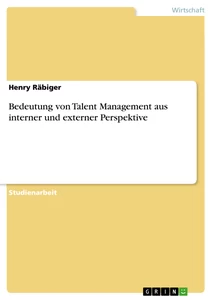











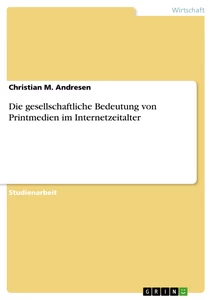




Kommentare