Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I Methoden und Konzepte
1 Methoden und Datengrundlage
1.1 Vorgehensweise
1.2 Gesprächspartner
2 Identität und Ethnizität
2.1 In der Identitätskrise
2.1.1 Kritik am Konzept Identität
2.1.2 Die Lösung?
2.1.3 Ein wertvolles Konzept
2.2 Ethnizitätskriterien
2.2.1 Von objektiven Merkmalen zur Selbstzuschreibung
2.2.2 Zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung
2.2.3 Ethnische Identität als Grenzziehungsprozess
3 Diaspora
3.1 Vom „boomenden" zum umstrittenen Konzept
3.2 Auf der Suche nach Kriterien
3.3 Klassifikationsversuche
3.4 Ethnizität und Diaspora
3.5 Entstehung der kurdischen Diaspora
II Einflussfaktoren auf die kurdische Ethnizität
1 Heimat und Herkunftsland
1.1 Das kurdische Siedlungsgebiet
1.2 Das Leben in einem repressiven Staat
1.2.1 Assimilationsbestrebungen der Türkischen Republik
1.2.2 Rolle des Militärs
1.2.3 Demokratische Aussichten?
1.3 Fremdwahrnehmung
1.4 Heimat-Orientierung und Rückkehrwunsch
1.5 Staatslosigkeit und Heimatlosigkeit
1.6 Gemeinschaft stiftende Symbole
1.7 Kurdischer Nationalismus
2 Migration und Aufnahmeland Deutschland
2.1 Kurdische Migration nach Deutschland
2.1.1 Diaspora-Kriterium der erzwungenen Migration
2.1.2 Migration vor 1960
2.1.3 Arbeitsmigration
2.1.4 Fluchtwanderung
2.1.5 Zusammensetzung der kurdischen Bevölkerung in Europa
2.1.6 Ängste und Unsicherheiten
2.2 Das Leben in der Aufnahmegesellschaft
2.2.1 Integration, Akkulturation, Assimilation
2.2.2 Struktureller Zugang zur deutschen Gesellschaft
2.2.3 Identifikatorischer Zugang zur deutschen Gesellschaft
2.2.4 Fremdwahrnehmung
2.2.5 Folgen der Fremdwahrnehmung: Diskriminierung und Konflikte
2.2.6 Effekte der Fremdwahrnehmung auf die Selbstwahrnehmung
2.2.7 Chancen und Vorteile des Lebens in Deutschland
2.2.8 Einsatz für Rechte und Anerkennung
3 Der transnationale Diaspora-Raum
3.1 Transnationalismus und Diaspora
3.2 Kurdische transnationale Netzwerke
3.3 Die vorgestellte kurdische Gemeinschaft
3.3.1 Die Erfindung der Gemeinschaft?
3.3.2 Ethnische Selbstdefinition: Wer gehört zur kurdischen Gemeinschaft?
3.3.3 Das „Kollektive Gedächtnis“
3.3.4 Beschwörung einer Schicksalsgemeinschaft
3.4 Kurdische transnationale Akteure
3.4.1 Organisationen und Parteien
3.4.2 Kurdische Medien
3.5 Fallstrick: Innerkurdische Konflikte
Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Herkunftsprovinzen der Gesprächspartner und andere im Rahmen der Arbeit wichtige Provinzen der Türkischen Republik.
Abb. 2: Das kurdische Siedlungsgebiet im Mittleren Osten.
Abb. 3: Das kurdische Sprachgebiet.
Abb. 4: Die kurdsche Flagge.
Abb. 5: PKK-Mitglieder unter Führung von Cemil Bayik (Mitte) in einem Trainingscamp im Irak 1991.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Zahl der kurdischen Einwanderer in einzelnen europäischen Ländern nach Angaben Ammanns (2000: 138)
Einleitung
Zu Beginn der Masseneinwanderung von Kurdinnen und Kurden aus der Türkei nach Deutschland – als angeworbene Arbeitsmigranten – verfügten diese kaum über ein distinktives kurdisches Bewusstsein. Viele hatten das Stigma als „Bergtürken“, das ihnen in der Türkei vermittelt wurde, verinnerlicht. Bei anderen zeigten die jahrzehntelangen und bis heute andauernden Assimilationsbestrebungen des türkischen Staates Wirkung, so dass sie sich im Aufnahmeland Deutschland häufig selbst als Türken bezeichneten.
Aufgrund des mangelnden Bewusstseins und damit einhergehender geringer organisatorischer Aktivität in Europa konnte man zu diesem Zeitpunkt nicht von einer kurdischen Diaspora sprechen, da diese sich vor allem durch ein gemeinschaftliches Streben nach einer anerkannten distinktiven Identität auszeichnet. Die ethnische Selbstwahrnehmung wandelte sich jedoch mit dem verstärkten Zuzug politischer Flüchtlinge, die sich bereits in ihrer Heimat stark für die kurdische Identität eingesetzt hatten. Die Arbeit von transnationalen Akteuren macht es seither möglich, die Vorstellung von einer geteilten Identität zu verbreiten, welche die Entstehung der kurdischen Diaspora markiert und unter anderem Forderungen nach Anerkennung dieser distinktiven Identität ermöglicht.
In der vorliegenden Arbeit zum Thema „Ethnizität in der Diaspora“ widme ich mich der Fragestellung, welche Faktoren auf die ethnische Identität von Kurdinnen und Kurden in Deutschland Einfluss nehmen, die ich im weiteren Verlauf als Diaspora-Gemeinschaft bezeichne. Damit konzipiere ich Diaspora als Sammelbegriff für die in den einzelnen (überwiegend europäischen) Immigrationsländern ansässigen kurdischen Gemeinschaften.
Um mich der Beantwortung dieser Fragestellung zu nähern, führte ich Gespräche mit sieben Kurden in Deutschland, die ich im ersten Kapitel dieser Arbeit vorstellen werde. Sechs von ihnen stammen aus der Türkei, einer aus dem Irak. Der Fokus auf Kurden aus der Türkei hat sich zufällig ergeben, dennoch habe ich ihn bei der Bearbeitung des Themas beibehalten. Hinsichtlich ihrer Herkunft ziehen meine Respondenten die Bezeichnung als „Kurde aus der Türkei“ derjenigen als „türkischer Kurde“ vor, da letztere einen Widerspruch zu ihrem ethnischen Empfinden darstellt. Dies wird in meinen Ausführungen berücksichtigt.
Im ersten Hauptteil werde ich neben den von mir angewandten Methoden die für das Thema grundlegenden Konzepte Identität, Ethnizität und Diaspora erläutern. Sie sind in der Ethnologie und anderen Sozialwissenschaften nicht unumstritten. Es gibt vielerlei Vorschläge zum modifizierten Gebrauch, und manche Wissenschaftler sähen einige Begriffe unter Umständen gern aus dem ethnologischen Diskurs verschwunden. Dennoch werde ich sie in meiner Arbeit beibehalten, da die Konzepte gerade durch ihren außerwissenschaftlichen Gebrauch zu einer sozialen Realität geworden sind, die von der Ethnologie nicht unberücksichtigt bleiben darf.[1]
Im zweiten Hauptteil der Arbeit vertrete ich die These, dass sich die Einflussfaktoren auf die kurdische Identität vornehmlich aus der Tripolaren Beziehungsstruktur zwischen Herkunftsland, Aufnahmeland und Diaspora-Gemeinschaft speisen.[2] Das traditionelle kurdische Siedlungsgebiet erstreckt sich über die vier Nationalstaaten Türkei, Iran, Irak und Syrien. Da keine staatlich-politische Einheit namens Kurdistan existiert und die Türkei eine äußerst restriktive Kurdenpolitik verfolgte und immer noch verfolgt, spielt das Streben nach Anerkennung der kurdischen Identität für die meisten Diaspora-Mitglieder eine große Rolle. Zwar engagierten sich viele kurdische Einwanderer bereits in der Türkei, doch die Migration nach Deutschland, deren Hintergründe ich in Kapitel II.2.1 erläutern werde, bot erstmals die Möglichkeit, sich offen zur eigenen ethnischen Identität zu bekennen. Dadurch bildeten sich politische und kulturelle Organisationen, die großes Mobilisierungspotenzial besitzen, indem sie die Vorstellung einer gemeinsamen kurdischen Identität verbreiten. Somit ermöglichten ihre Diskurse erst die Entstehung der Diaspora und sichern ihren Fortbestand. Dennoch bedeutet die Migration nach Deutschland nicht nur identifikatorische[3] Freiheiten und Rechte: Kurdinnen und Kurden werden hierzulande oft aus einer Defizitperspektive[4] wahrgenommen, die mit diversen Formen der Fremdwahrnehmung verbunden ist. Die verschiedenen Arten der Fremdwahrnehmung können Ethnizitätsprozesse innerhalb der kurdischen Diaspora ebenfalls beeinflussen. Auf diesen Sachverhalt werde ich in Kapitel II.2.2 ausführlich eingehen.
Die Erfahrungen im Herkunftsland, in der Migration und im Aufnahmeland werden von vielen Kurdinnen und Kurden geteilt. Dennoch ist die kurdische Diaspora alles andere als homogen. Die Sozialisation in den verschiedenen Nationalstaaten, die unterschiedliche Stärke der Repressalien sowie verschiedene Migrationsverläufe und strukturelle Chancen in den einzelnen europäischen Aufnahmeländern lassen ein komplexes Bild entstehen.
Trotzdem berufen sich die meisten Kurden auf vorgestellte Gemeinsamkeiten, die sie zu einer Gemeinschaft mit gruppenspezifischen Interessen werden lassen. Mangels eines eigenen Nationalstaates haben transnationale Akteure in der Diaspora eine zentrale Bedeutung, da sie die Hauptproduzenten von Gemeinschaft stiftenden Diskursen sind. Diese Diskurse, die zudem auf persönlichen Erfahrungen der Diaspora-Mitglieder aufbauen, sind daher ein Instrument, um die Heterogenität der kurdischen Gemeinschaft zu überbrücken. Dieser Sachverhalt wird abschließend in Kapitel II.3 behandelt.
Die Einteilung des zweiten Hauptteils in drei Bereiche von Einflussfaktoren für die kurdische Identität, die ich in Anlehnung an das diasporische Tripolare Beziehungsgeflecht getroffen habe, ist selbstverständlich nicht „naturgegeben“. Sie stellt vielmehr eine vereinfachende Maßnahme zur Strukturierung dar. Nicht immer können bestimmte Faktoren daher einem der drei Bereiche eindeutig zugeordnet werden. Darauf weise ich an gegebener Stelle hin.
I Methoden und Konzepte
1 Methoden und Datengrundlage
1.1 Vorgehensweise
Der erste Teil meiner Arbeit basiert ausschließlich auf Quellenkritik bezüglich der Themenkomplexe Identität, Ethnizität und Diaspora. Im zweiten Teil beziehe ich mich ebenfalls zu einem großen Teil auf bereits existierende Literatur zum Thema „kurdische Ethnizität“ sowie „Kurdinnen und Kurden in Deutschland“. Darüber hinaus leite ich jedoch einen nicht unwesentlichen Teil der dargelegten Erkenntnisse aus von mir geführten Gesprächen mit in Deutschland lebenden Kurden ab. Mit Zitaten aus diesen Gesprächen (fünf offene Interviews, ein Gespräch während einer Veranstaltung und ein Schriftkontakt per Internet) möchte ich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Dies ist innerhalb der Ethnologie im Allgemeinen eine schwierige Angelegenheit und in meinem speziellen Fall unmöglich:
Zum einen etablierte ich den Kontakt zu meinen Interviewpartnern, indem ich Anfragen per Email an verschiedene kurdische Vereine in Deutschland verschickt habe, welche diese an potentielle Interessenten weiterleiteten. Somit sind oder waren alle Interviewpartner in einem kurdischen Verein tätig und engagieren sich somit in einer bestimmten Weise für Kurdistan und die Anerkennung der kurdischen Identität. Ein großer Teil der in Deutschland lebenden Kurden ist jedoch nicht in Organisationen tätig, wird aber durchaus zur kurdischen Diaspora gezählt.
Darüber hinaus stammen alle meiner Respondenten (bis auf F. Mawaty) aus der Türkei. Ich werde diesen Fokus, der sich in der Rückmeldung auf mein Anschreiben rein zufällig ergeben hat, in meiner Arbeit beibehalten. Dennoch werde ich die Ansichten F. Mawatys in den Zusammenhängen einbringen, die nicht direkt das Herkunftsland Türkei betreffen.
Schließlich sind alle meine Gesprächspartner männlich und mehrheitlich politische Flüchtlinge (außer Ibrahim). Das war von mir nicht forciert, sondern hat sich aus der Rückmeldung auf meine Anfrage ergeben.[5]
Aus diesen Gründen können die aus den Gesprächen eingebrachten Zitate nur auf einen kleinen Ausschnitt der diasporischen Wirklichkeit verweisen. Dennoch werde ich die Antworten meiner Gesprächspartner mit den in der Literatur postulierten Ansichten über die ethnische Selbstzuschreibung von Kurden in Deutschland vergleichen. Außerdem werde ich etwaige Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Aussagen meiner Gesprächspartner beleuchten.
Mit den Respondenten, mit denen ich über kurdische Vereine in ganz Deutschland in Kontakt kam, führte ich offene Interviews per Telefon oder bei einem persönlichen Treffen. Darüber hinaus führte ich ein Gespräch mit Cemal, das sich auf einer kurdischen Veranstaltung[6] ereignete und ohne Aufzeichnung erfolgte. Hinzu kommt ein Schriftverkehr mit Ibrahim, den in einem sozialen Netzwerk im Internet kontaktierte. Auf alle Personen, die ich befragt habe, beziehe ich mich mit Gesprächspartner oder Respondent. Mit Interviewpartner bezeichne ich lediglich diejenigen, die ich per Telefon oder im persönlichen Gespräch ausführlich befragen konnte und deren Aussagen ich mit einem Diktiergerät aufgezeichnet habe. Von ihnen stammen die meisten Zitate in meiner Arbeit, da ich mit Cemal und Ibrahim nur sehr begrenzten Kontakt hatte und deswegen wenig Material von ihnen zur Verfügung steht.
Als Anliegen und Hintergrund für das Gespräch gab ich meinen Respondenten gegenüber an, eine Magisterarbeit zum Thema „Kurdinnen und Kurden in Deutschland“ schreiben zu wollen und dafür Informationen aus erster Hand zu benötigen. Meines Erachtens hätte die Erwähnung von Konzepten wie Ethnizität und Diaspora ein zu hohes Maß an Erklärung bedurft. Nach Abschluss der Gespräche erscheint mir dies umso sinnvoller, da keines der beiden Konzepte in der Selbstbeschreibung seitens der Respondenten benannt wurde. Dagegen wurden auch außerwissenschaftlich populäre Begriffe wie Identität, Nationalität, Ethnie, Integration und Kultur in den Gesprächen gelegentlich verwendet, oft mit den bekannten essentialistischen Konnotationen.
Die Verwendung der Daten erfolgt unter größtmöglicher Anonymität, weshalb die Namen der Respondenten geändert wurden[7] und die Geburtsstädte sowie frühere und derzeitige Wohnorte nicht namentlich genannt werden. Lediglich die Herkunftsprovinzen werden zur ungefähren Verortung angegeben. Die Zitate wurden nach den aktuellen Regeln der Grammatik von mir geringfügig modifiziert.
1.2 Gesprächspartner
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Herkunftsprovinzen der Gesprächspartner und andere im Rahmen der Arbeit wichtige Provinzen der Türkischen Republik.[8]
Serxwebun:
Der 25-jährige Student kam mit 15 Jahren in Begleitung seiner Schwester als politischer Flüchtling nach Deutschland. Einer seiner Brüder lebte bereits hier, seine Eltern (beide Landwirte) und sechs seiner acht Geschwister wohnen bis heute in der Türkei. Serxwebun stellte einen Asylantrag, der nach Jahren genehmigt wurde. Mittlerweile ist Serxwebun eingebürgert.
Sein Heimatdorf liegt in der Provinz Mardin im überwiegend von Kurden bewohnten Südosten der Türkei. Kurz nachdem Serxwebun es verlassen hatte, wurde es vom Militär zerstört. Serxwebun wuchs mit der kurdischen Sprache (Dialekt: Kurmandschi) auf. Da er in der Türkei nur ein Jahr lang die Schule besuchte, lernte er die türkische Sprache erst in Deutschland, hauptsächlich um mit türkeistämmigen Kurden kommunizieren zu können, die kein Kurdisch sprechen.
Serxwebun engagiert sich neben Tätigkeiten im studentischen Bereich auch in einem kurdischen Verein, dessen Fokus auf der Integration von und Migrantinnen und Migranten (verschiedener Herkunft und Ethnie), der Hilfestellung für Neuankömmlinge und der Vermittlung der kurdischen Kultur liegt.
Cemal:
Den Studenten Cemal traf ich bei der öffentlichen Vorführung eines kurdischen Films, die von einem kurdischen Studentenverein organisiert wurde. Ich fragte Cemal, der ebenfalls in diesem Verein tätig ist, ob ich ihn interviewen dürfe. Aus Mangel an Zeit lehnte er ab. Zu einem Telefoninterview war er grundsätzlich nicht bereit, da dies seiner Ansicht nach ein Risiko darstellte.[9] Da es sich um ein kurzes Gespräch handelte, verfüge ich nicht über Hintergrunddaten wie Alter, Herkunftsprovinz oder Migrationsverlauf.
Cemal trat seinem Verein vor etwa zwei Jahren bei. Er gab an, zuvor egoistisch und hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt gewesen zu sein. Doch seit seinem Beitritt sei er ein neuer Mensch geworden, „ein besserer Mensch“, könne er sogar behaupten. Er bezeichnete den Verein als „internationalistisch“ orientiert und zeigte sich solidarisch mit der baskischen Freiheitsbewegung.
Cemal besitzt die türkische Staatsbürgerschaft. Er würde gerne nach Kurdistan ziehen. Da es mir nicht möglich war, während unseres Gesprächs Notizen zu machen, können in dieser Arbeit keine wörtlichen Zitate von Cemal wiedergegeben werden.
Azad:
Der 22-jährige Student Azad (Bruder von Baran[10] ; siehe unten) wurde in der kurdischen Provinz Bayburt im Nordosten Anatoliens geboren. Da sein Vater, ein Grundschullehrer, bekennender Kurde war, wurde er oft durch den türkischen Staat zwangsversetzt. So wohnte Azad mit seiner Familie auch in der Provinz Muş und danach in der Provinz Mersin. Mit zehn Jahren kamen seine Familie und er als politische Flüchtlinge nach Deutschland, wo sein Vater zu diesem Zeitpunkt bereits ein oder zwei Jahre gelebt hatte. Seit ein paar Monaten besitzt Azad die deutsche Staatsbürgerschaft. Die kurdische Sprache (Kurmandschi) wurde ihm in der Familie vermittelt. Azad ist Mitbegründer eines kurdischen Studentenvereins mit wissenschaftlichem und kulturellem Fokus.
Baran:
Der 24-jährige Student Baran (Bruder von Azad; siehe oben) wurde in der kurdischen Provinz Muş geboren. Seit 1998 lebt er in Deutschland, nachdem er die Türkei als politischer Flüchtling verlassen hatte. Sein Vater war in der Türkei des Öfteren zwangsversetzt und sogar mehrmals verhaftet worden, da er sich für die Anerkennung der kurdischen Identität einsetzte. Baran ist Asylberechtigter und will demnächst die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Er spricht Kurmandschi, aber auch Türkisch. Azad und Baran sind zwei von insgesamt elf Geschwistern. Beide sind in einem von ihnen gegründeten kurdischen Studentenverein tätig.
Rodi:
Rodi ist 45 Jahre alt und wurde in der Provinz Konya in Mittelanatolien geboren. Im Jahr 1979, also kurz vor dem Militärputsch 1980, kam er mit etwa 16 Jahren als politischer Flüchtling nach Deutschland. Sein Vater war zu diesem Zeitpunkt als so genannter Gastarbeiter in Deutschland beschäftigt, kehrte jedoch 1982 in die Türkei zurück. Zuvor war Rodis Vater Bauer gewesen, mittlerweile ist er selbstständig. Rodi hat eine Schwester und fünf Brüder, die in aller Welt zerstreut leben. Aufgrund seiner Schulsozialisation in der Türkei spricht Rodi besser Türkisch, obwohl er Kurdisch ebenfalls beherrscht. Seit knapp 30 Jahren ist er nicht mehr in der Türkei gewesen. Die deutsche Staatsbürgerschaft blieb ihm bis heute verwehrt. Früher war er in einem Dachverband kurdischer Vereine tätig. Heute ist er in keinem Verein mehr aktiv, schreibt jedoch gelegentlich Artikel, um das Bewusstsein für die Probleme der Kurden zu erhöhen.
F. Mawaty:
F. Mawaty wurde 1957 in einem kurdischen Dorf geboren, das in der Nähe einer Großstadt im Nordosten des Iraks liegt. Die Schule besuchte er in dieser Großstadt. Er flüchtete Ende 1979 nach Deutschland, nachdem aufgrund seiner politischen, pro-kurdischen Tätigkeit ein Hinrichtungsbefehl gegen ihn ausgesprochen wurde, aber auch, um keine Bedrohung für seine Familie darzustellen. Ein oder zwei Jahre, nachdem er sein Heimatdorf verlassen hatte, wurde es durch Bombenangriffe zerstört, seine Eltern und Geschwister wurden zwangsumgesiedelt. Seit etwa 15 Jahren besitzt er die deutsche Staatsbürgerschaft. Er hat eine deutsche Ehefrau und zwei Kinder, denen er nach eigenen Worten „nicht unbedingt“ die kurdischen Wurzeln nahelegen möchte, da sie sich „eher als deutsch“ betrachten. Er wuchs mit dem kurdischen Dialekt Sorani auf, erlernte in Deutschland jedoch auch Kurmandschi, Persisch und Türkisch. F. Mawaty ist in einem Verein tätig, der sich hauptsächlich an Kurden aus dem Irak richtet, sich für Integration einsetzt und Sozialberatung und Hilfestellung für Neuankömmlinge anbietet. Darüber hinaus ist F. Mawaty Mitglied in einer deutschen Partei. Seit 15 Jahren ist er Angestellter bei einer großen Firma. Den Irak möchte er gerne wieder besuchen, doch er kann sich nicht mehr vorstellen, dort zu leben.
Ibrahim:
Dem 26-jährigen Ibrahim habe ich mein Anliegen durch schriftlichen Kontakt in einer Internet-Gemeinschaft unterbreitet, da er sich dort als Kurde zu erkennen gab. Zu einem Telefoninterview war er nicht bereit. Seine Eltern stammen aus der überwiegend von Kurden bewohnten Provinz Tunceli (kurdisch: Dersim) in der Türkei. Sein Vater kam nach Deutschland, um zu studieren, woraufhin seine Mutter nachzog. Ibrahim wurde in Deutschland geboren und besitzt seit zehn Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Er ist Student und in keinem kurdischen Verein tätig. Früher hat er mit seinem Vater zwar viele Demonstrationen und Veranstaltungen besucht, doch mittlerweile engagiert er sich nach eigener Aussagen „eher weniger“ für die Kurden.
Bevor ich auf die Erkenntnisse, die ich mit Hilfe meiner Gesprächspartner gewonnen habe, eingehe, werde ich im ersten Teil meiner Arbeit zunächst die zugrunde gelegten Konzepte vorstellen.
2 Identität und Ethnizität
Ethnizität und ethnische Identität entstammen zwar verschiedenen Disziplinen, sind jedoch laut Marco Heinz „im Laufe ihrer steilen Karriere […] zu einer Einheit verschmolzen“ (1993: 12). Auch ich werde sie daher – aus einer historischen Perspektive also stark vereinfachend - in meiner Arbeit synonym verwenden. Zwar stellen die Konzepte Ethnizität und Identität zentrale Bezugspunkte meiner Arbeit dar, dennoch kann ich nur am Rande auf deren Festigung in den Sozialwissenschaften und den sich über die Jahrzehnte verändernden Gebrauch eingehen.[11] Mein Augenmerk liegt vor allem auf der Rolle von ethnischer Identität für die interkulturelle Interaktion sowie auf ihrer gegenwärtigen Position innerhalb der Ethnologie. Hier stellt Identität eines der Konzepte dar, die den größten Aufschwung erlebten und immer noch erleben. Sie zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie nicht mehr nur „hinter den Mauern“ der Wissenschaft Verwendung finden, sondern Einzug halten in den nicht-wissenschaftlichen Diskurs. Dieser Prozess kann nur schwer aufgehalten werden, das Konzept entzieht sich fortan der akademischen Kontrolle: Bedeutungen vermischen sich, die Konzepte werden unspezifisch und anfällig für Essentialisierung.[12] Extreme Gegner sind daher für ihre Abschaffung. Andere wiederum nehmen als Reaktion auf die Kritik eine Verteidigungshaltung ein. Wie Martin Sökefeld bemerkt, verfügt die Wissenschaft eben nicht „über das Monopol der Macht, Konzepte zu definieren und über die Berechtigung, ihren Gebrauch zu kontrollieren“ (2001: 533; meine Übersetzung).
2.1 In der Identitätskrise
2.1.1 Kritik am Konzept Identität
Frederick Cooper und Rogers Brubaker stellen fest, dass sich die Sozialwissenschaften in den letzten Jahrzehnten dem Terminus „Identität“ ausgeliefert haben. Ab 1980 kam es durch dessen überbordende Verwendung und durch die damit verbundene konsequente Abwertung der Bedeutung regelrecht zur „Identitätskrise“ (2000: 3). Identität eigne sich daher nicht mehr für die soziale Analyse, die unzweideutige analytische Kategorien erfordere (2000: 1). Der vom wissenschaftlichen Diskurs abweichende populäre Gebrauch veranlasst die beiden Wissenschaftler zur Unterscheidung von Kategorien der Praxis und Kategorien der Analyse (2000: 4). Erstere finden Verwendung im Alltag, werden also im außerwissenschaftlichen Diskurs benutzt. Letztere werden von Wissenschaftlern für die Analyse sozialer Phänomene benutzt und stellen somit „erfahrungs-distante“ Kategorien dar. Kategorien der Praxis entziehen sich dem wissenschaftlichen Diktum und fallen Reifizierungen und Essentialisierungen anheim. So wird Identität in dieser Auffassung bezogen auf Kollektive, deren Mitgliedern eine fundamentale Gleichheit unterstellt wird (2000: 7).
Dieser außerwissenschaftliche Essentialisierung wird vor allem dann zum Problem, wenn Kategorien der Praxis als analytische Kategorien übernommen werden. Dadurch können nach Ansicht Brubakers und Coopers die unerwünschten Reifizierungen reproduziert und sogar verstärkt werden (2000: 5). Zwar beziehe sich die wissenschaftliche Beschäftigung mit Identität durchaus auf reale und wichtige Phänomene. Doch sei es für deren Analyse nicht erforderlich, die gleichen Konzepte zu verwenden, die auch als praktische Kategorien existierten. Der essentialistische Gebrauch von wissenschaftlichen Konzepten wird nicht nur von Brubaker und Cooper kritisiert. Auch andere Kulturwissenschaftler versuchen seit Jahrzehnten, derartige problematische Konnotationen zu dekonstruieren. In ihrer Auffassung kann Identität daher beschrieben werden als multipel, fragmentarisch und fließend. Dies führt laut Brubaker und Cooper dazu, dass sich mittlerweile starke von schwachen Konzeptionen unterscheiden lassen: Die starke Konzeption (meist als Kategorie der Praxis) bezieht sich auf die zugrunde gelegte fundamentale Gleichheit von Gruppenangehörigen durch Identität. Die schwache, konstruktivistische Auffassung benennt die strikte Zurückweisung von grundlegender Gleichheit. Derselbe Begriff wird also auf völlig unterschiedliche, gar kontradiktorische Weise verstanden (2000: 10). Für Brubaker und Cooper besteht keine Notwendigkeit, ein solch unstetes Phänomen überhaupt als Identität zu konzeptualisieren (2000: 6).
2.1.2 Die Lösung?
Die konstruktivistische Widerlegung der essentialistischen Alltagsbedeutungen von Identität im wissenschaftlichen Diskurs ist nach Brubaker und Cooper nicht ausreichend. Es kommt zum „klischeehaften Konstruktivismus“, bei dem umstrittenen Konzepten Standardattribute (heterogen, fließend, fragmentarisch, konstruiert) zugeschrieben werden, die bei ihrer Benutzung immer berücksichtigt werden sollen. Das kann dazu führen, dass der Benutzer oder Rezipient die gewünschten Konnotationen im Grunde nicht mehr wahrnimmt und sie daher eher Platzhalterfunktion innehaben (2000: 11). Überdies sehen Cooper und Brubaker keinen Sinn darin, ein Konzept überhaupt zu verwenden, wenn ohnehin große Teile seiner Charakteristika verworfen werden müssen. Ist die Konzeption nicht eventuell zu schwach, um noch eine nützliche theoretische Arbeit leisten zu können? Bleibt lediglich ein Begriff übrig, der unendlich dehnbar ist und somit alles und nichts auszudrücken vermag? Um dem Abhilfe zu schaffen, schlagen Brubaker und Cooper vor, den „Bedeutungsstrick“ Identität nicht durch einen anderen Begriff, ein anderes Konzept zu ersetzen, sondern ihn zu „entbündeln“ und seine einzelnen Bedeutungselemente auf andere Weise zu beschreiben (2000: 14). Dazu geeignet sind je nach Phänomen, auf das man Bezug nehmen möchte:
Identifikation
Beim direkt vom Verb abgeleiteten Nomen fehlen die reifizierenden Konnotationen und es wird sowohl die Selbst- als auch die Fremd-Identifizierung (Identifizierung durch Andere) ins Sichtfeld gerückt. Sie sind in den Kulturwissenschaften gleichermaßen wichtig und können beträchtlich voneinander abweichen. „Identifizierung“ wirft also immer auch die Frage nach dem Agenten auf, das heißt: Wer ist es, der identifiziert? Dadurch erweitert sich das Gesamtbild.
Selbst-Verständnis und soziale Verortung
Das Selbst-Verständnis entspricht laut Brubaker und Cooper der situierten Subjektivität, also der persönlichen Vorstellung, wer man ist und wo man sozial verortet ist (2000: 17). Diese Vorstellung kann über einen längeren Zeitraum stabil bleiben, aber auch Veränderungen unterliegen, während der Begriff „Identität“ eine konstante Gleichheit suggeriert. Selbst-Verständnis bezieht sich aber nur auf das subjektive Empfinden des Individuums. Um „von außen“ an die Selbst-Vorstellung zu gelangen, muss die betreffende Person ein hohes Maß an kognitiver Bewusstheit mitbringen (2000: 18).
Groupness
Identität wird oft dazu benutzt, Gruppen zu postulieren, die dadurch unberechtigterweise homogenisiert werden (groupism[13] ). Um Vorstellungen von einer einheitlichen, begrenzten, zeitlosen Gruppe mit klaren Zugehörigkeiten zu vermeiden, legen Brubaker und Cooper den Fokus auf die groupness. Sie beschreibt Prozesse, die sich auf ein nicht zwangsläufig dauerhaftes solidarisches Zusammengehörigkeitsgefühl und Phasen ungewöhnlicher Kohäsion gründen (2000: 19ff).
Mit diesen drei Aufschlüsselungen des Konzeptes Identität lassen sich nach Cooper und Brubaker alle Felder abdecken, die für einen Ethnologen in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Die Unterscheidung zwischen Selbst-Identifizierung und Selbst-Verständnis erscheint mir jedoch unnötig, da sich die beiden Punkte meines Erachtens zusammenfassen lassen: Selbst-Identifikation und soziale Selbst-Verortung bedingen sich gegenseitig und sind nicht voneinander zu trennen, denn beide basieren auf dem subjektiven Empfinden des Individuums. Des Weiteren gründen meiner Ansicht nach sowohl die Selbst- als auch die Fremd-Identifizierung durch Stereotypisierungen in hohem Maße auf der Selbst- beziehungsweise Fremdzuschreibung zu einer bestimmten Gemeinschaft.[14] Daher erachte ich auch den letzten Punkt als untrennbar mit der Identifikation verwoben. Bei meiner Auffassung von Identität kommen somit alle drei Aspekte zum Tragen: Selbst- und Fremd-Identifizierung, soziale Verortung sowie Gemeinschaft stiftende Prozesse, die sich in der groupness niederschlagen. Was von Coopers und Brubakers Unterteilung demnach bleibt, ist entgegen ihrem Vorhaben meines Erachtens also doch die bloße Umbenennung des Begriffes „Identität“ in „Identifikation“. Eine solche Umbenennung kann durchaus Sinn machen, da die gewollten Konnotationen in einem direkt vom Verb abgeleiteten Nomen besser transportiert werden können. Jedoch muss man auch beachten, dass sie lediglich eine Position, die Ethnologen mittlerweile ohnehin vertreten, sprachlich ausdrückt: Dass Identität kein Zustand ist, sondern ein Prozess, der nie abgeschlossen und fixiert, sondern fließend und dynamisch ist. Ich finde es daher unnötig, den Begriff „Identität“ stringent durch „Identifikation“ abzulösen.
2.1.3 Ein wertvolles Konzept
Dem Konzept Identität gänzlich abzuschwören, weil es in außerwissenschaftlichen Sphären verwendet wird, ist auch für Sökefeld keine Lösung:
„[A] diversity of readings of a concept based on diverse and even contradictory theoretical approaches is in my understanding a quite normal state of affairs in the social and cultural sciences and not a reason to abandon such concepts“ (2001: 538).
Dass Identität im nicht-wissenschaftlichen Diskurs oft auf essentialisierende Weise, die im wissenschaftlichen, konstruktivistischen Diskurs dagegen nicht vertreten wird, gedacht und kommuniziert wird, nimmt er als Chance wahr:
„The concept identity enables us to point to certain constructions in social reality while simultaneously conveying the essentialist implications of actors and the (de-) constructivist stance of social scientists. […] It reminds us strongly that identities, although posed by actors as singular, continuous, and bounded can be shown to be subject to the condition of plurality, intersectionality, and difference” (2001: 538; Hervorhebung im Original).
Somit kann Identität als analytische Kategorie die Dualität zwischen essentialistischen und konstruktivistischen Auffassungen durchaus miteinander in Einklang bringen (2001: 542).
Überdies darf Identität als globalisierte und allgegenwärtige Vorstellung nicht ignoriert werden. Zwar räumt auch Sökefeld ein, dass Identität ein stark strapaziertes Konzept ist, das mit einem höheren Maß an Vorsicht verwendet werden sollte. Dennoch sind Konzepte Werkzeuge, mit denen die Welt beschrieben und analysiert werden soll. Dass sie von verschiedenen Menschen auf ganz unterschiedliche Weise verwendet werden, lässt sie generell schwer definieren, die Beschreibung wird notgedrungen unspezifisch. Die Lösung besteht laut Sökefeld darin, diese Verschwommenheit in das Konzept einzubauen. Eine solche Definition gründet sich dann nicht auf Universalien, die immer schwerer zu postulieren sind, sondern wird nur in Bezug auf Prototypen angewendet (2001: 528). So muss zwar auf eine allgemeine Definition verzichtet werden, aber das Konzept behält eine präzise Bedeutung für ein spezifisches Phänomen. Auch Stuart Hall sieht diesbezüglich Chancen, da „Identitäten als an spezifischen historischen und institutionellen Orten, innerhalb spezifischer diskursiver Formationen und Praktiken wie auch durch spezifische Strategien hergestellt“ verstanden werden müssen (2004: 171).
Bevor die Einflüsse auf die ethnische Identität von Kurdinnen und Kurden im zweiten Hauptteil beleuchtet werden, gehe ich näher auf das Konzept Ethnizität ein, welches in enger Verbindung mit Identität steht.
2.2 Ethnizitätskriterien
2.2.1 Von objektiven Merkmalen zur Selbstzuschreibung
Die wissenschaftlichen Versuche, Ethnizität zu fassen, lassen sich laut Georg Elwert grob einteilen in essentialistische (primordiale, substantiale) und formalistische Ansätze. Erstere stellen eine „Essenz von gemeinsamer Abstammung, Kultur, Sprache etc. in den Vordergrund“, während letztere „den formalen Akt der sozialen Handlung des Grenzziehens als solchen“ fokussieren (1989: 18f). Der substantiale Ansatz stellt Ethnizität als eine unverrückbare Eigenschaft und feste Substanz dar, die durch kulturelle, religiöse, territoriale, historische und genetische Faktoren bestimmt wird (Ammann, Birgit 2000: 46). Diese Ansicht war wissenschaftlich höchstens tragbar, als das Studium fremder Kulturen sich noch auf weitgehend isolierte, relativ homogene und überschaubare Gruppen beschränkte. Heute jedoch sieht man in der Ethnologie davon ab, Menschen aufgrund „objektiver“ kultureller Kriterien wie Sprache, Abstammung oder territorialer Herkunft als Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft zu deklarieren ohne Rücksicht auf deren Selbstverortung. Zudem ist die individuelle Abstammung meistens „unwissbar“ (Alba, Richard 1990: 58) und kann daher schlecht als objektives Zugehörigkeitskriterium postuliert werden. Vielmehr zählen laut Alba die Vorstellungen über Familienvergangenheit (1990: 42), also subjektive Faktoren. Daher herrscht in der Ethnologie mittlerweile eine formalistische Auffassung vor. Einer ihrer berühmtesten Vertreter ist Frederik Barth. Für ihn steht fest: „[e]thnic groups are categories of ascription and idenitification by actors themselves “ (1969: 10; meine Hervorhebung).
Eine gemeinsame Kultur – oft genanntes Merkmal für ethnische Gemeinschaften – sieht Barth eher als Ergebnis der gefühlten Gruppenzugehörigkeit, denn als primäres Definitionskriterium (1969: 11). Die Mitgliedschaft zu einer ethnischen Gemeinschaft zeichnet sich demnach vor allem durch für die Akteure bedeutsame Unterschiede zu anderen Gruppen aus, nicht durch objektive Verschiedenheit. Diese Unterschiede werden aber wiederum oft an kulturellen Inhalten festgemacht und können betont, aber auch heruntergespielt werden (1969: 14). Eine ethnische Gruppe setzt sich also aus Menschen zusammen, die sich durch die Zuschreibung bestimmter Kriterien selbst definieren.
2.2.2 Zwischen Selbst- und Fremdzuschreibung
Für Ammann ist Ethnizität keine feststehende Eigenschaft, sondern ein „Zustand hybrider und kontextabhängiger Art“ (2000: 16). Ethnizität kann sich demnach verändern oder je nach Situation stärker oder schwächer betont werden. Hierbei wird deutlich, dass sich Ethnizität einerseits über subjektive Faktoren konstituiert (siehe oben). Es kommen laut Ammann dennoch substantiale Kriterien zum Tragen, die wiederum meist bei der Selbstzuschreibung durch Individuen eine Rolle spielen: Es werden Merkmale wie Heimat, Abstammung oder kulturelle Eigenschaften genannt, die es ermöglichen, die Grenzen der ethnischen Gruppe für deren Mitglieder abzustecken. Daher spielen für die Selbstzuschreibung ethnischer Identität in der sozialen Realität substantiale Kriterien weiterhin eine große Rolle. Aus diesem Grund bedingen sich primordialistische und formalistische Auffassungen gegenseitig: Während der wissenschaftliche Fokus auf dem Akt der Zuschreibung liegt, erfolgt sie im Alltagsverständnis der zu untersuchenden Gemeinschaften weitgehend über die Vorstellung von Gemeinsamkeiten wie kulturelle Eigenschaften, Geschichte oder Schicksal.
Gruppenzugehörigkeit wird jedoch nicht nur über Selbstzuschreibung postuliert. Auch Fremdzuschreibungen spielen eine entscheidende Rolle in der sozialen Realität: Nach Waldtraud Kokot ist ethnische Identität ein „kontextabhängiger, sich ständig fortentwickelnder Prozeß [sic] der Selbst- und Fremddefinition“ (2002a: 32; meine Hervorhebung). Elwert bezeichnet die Selbstzuschreibung von Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gemeinschaft als „entscheidende[s] Definitionskriterium“. Er räumt jedoch ein, dass diese „in einem komplexen Wechselverhältnis zur Fremdzuschreibung“ (1989: 23) steht, da letztere für die Anerkennung als Ethnie mit distinktiver Identität angestrebt werden muss.
Die Bemühungen von Ethnien, Anerkennung ihrer distinktiven Identität zu erreichen, sind überdies ein Hinweis, dass die Vorstellung einer Gemeinschaft vornehmlich über die Differenz zu anderen Gemeinschaften konstruiert wird. Hierbei dient der Bezug auf vermeintlich unterschiedliche kulturelle Eigenschaften als Legitimation.
2.2.3 Ethnische Identität als Grenzziehungsprozess
Nach Ansicht Halls „sind Identitäten vor allem auf der Grundlage von Differenz konstruiert und nicht jenseits von ihr“ (2004: 171). Das bedeutet, dass die „Beziehung zum Anderen“ für Identität konstitutiv ist. Eine ethnische Gemeinschaft braucht vorgestellte Grenzen und kann daher nicht existieren, ohne sich in Unterschied zu Mitgliedern anderer ethnischer Gruppen zu setzen (Barth 1969: 15).
Auch Thomas H. Eriksen betont, dass ethnische Gemeinschaften durch Interaktion gewissermaßen erst geschaffen werden: „Group identities must always be defined in relation to that which they are not – in other words, in relation to non-members of the group“ (2002: 10). Daher definiert Eriksen Ethnizität als Aspekt einer Beziehung, statt als Eigenschaft einer Gruppe - also als etwas, das zwischen Gruppen ist, nicht innerhalb von Gruppen (2002: 12).
Solche Beziehungen zwischen Gemeinschaften sind nicht festgeschrieben, sondern „fließend und verhandelbar“ (2002: 21; meine Übersetzung). Die ethnische Zugehörigkeit wird je nach Kontext und Wichtigkeit betont. In der Konsequenz können sich kulturelle Verhaltensweisen oder Einstellungen auch verstärken, wenn die Anerkennung der distinktiven ethnischen Identität in Gefahr ist. Dabei werden nicht selten die vorgestellten kulturellen Eigenschaften der eigenen, aber auch die der anderen Gruppe stereotypisiert (2002: 22). Dadurch werden einfache Klassifikationskriterien bereitgestellt und mitunter Privilegien oder Unterdrückung gerechtfertigt. Vor allem bieten sie die Möglichkeit, die eigene Gruppe klar abzugrenzen (2002: 23-25).
Gemeinschaften werden laut Eriksen aber nicht nur in „Us“ und „Them“ eingeteilt. Vielmehr existieren Grade der Gruppeninklusion und -exklusion (2002: 26), die sich nach der Wahrnehmung der sozialen Distanz richten. Ethnische Gemeinschaften weisen also auch in der Vorstellung keine geschlossenen Grenzen auf.
Daher sind laut Sökefeld eine Vielzahl an Unterschieden für die Konstitution von Identität entscheidend, die sich wiederum gegenseitig beeinflussen:
„What was taken as constant, consistent, and singular identities before emerges now a temporary subject positions made of three conditions: difference, plurality, and intersectionality” (2001: 535).
Demnach gibt es eine Vielfalt an Unterschieden (plurality), hinsichtlich derer sich jeder Mensch positioniert. Diese Unterschiede sind wiederum nicht klar voneinander abgegrenzt, sondern durchdringen sich (intersectionality) und können sich wechselseitig verstärken oder abschwächen (2001: 535). Es gibt eine unendliche Vielfalt von Kategorien durch die sich Menschen in Unterschied zu anderen setzen. Sie alle zu identifizieren, ist meines Erachtens unmöglich. Zwar sind Alter, Geschlecht, Beruf, Ideale, Musikgeschmack, Schulbildung dabei durch soziale Konventionen meist relativ leicht auszumachende Kategorien. Es spielen jedoch auch weitaus weniger offenkundige Einflüsse eine Rolle für die eigene Positionierung. Sie werden unter anderem bedingt durch spezifische Erfahrungen, den persönlichen Charakter, das soziale Umfeld und vieles mehr. All diese Faktoren stehen wiederum nicht in einem festen und konstanten Verhältnis zueinander, sondern vermischen sich auf unterschiedlichste Weise. Durch welche von ihnen sich eine Person in Unterschied zu anderen setzt, hängt mitunter von der spezifischen intersectionality ab: Ein bestimmter Faktor kann die Betonung eines anderen wichtig erscheinen lassen und hat somit verstärkende Wirkung, bei anderen Einflüssen kann wiederum das Gegenteil der Fall sein. Wird eine Gruppenidentität postuliert, unterscheiden sich die Individuen natürlich weiterhin stark voneinander. Doch bestimmte Faktoren verstärken sich hier in einer Weise, dass die Gemeinsamkeiten der Mitglieder sowie die Unterschiede zu Nicht-Mitgliedern besonders hervorgehoben werden. „Kollektive Identität“ und Differenz zu anderen bedingen sich dabei gegenseitig (Sökefeld 2001: 536). Dadurch kann Identität laut Sökefeld statt als selfsameness vorwiegend als sameness bezüglich der geteilten Differenz zu „Außenstehenden“ konzeptualisiert werden.
Auch Diasporas entsprechen ethnischen Gemeinschaften, die durch Vorstellungen einer distinktiven Identität geschaffen und aufrechterhalten werden. Um die Einflüsse auf die Ethnizität in der kurdischen Diaspora im zweiten Hauptteil zu beleuchten, werde ich im folgenden Kapitel auf das Konzept Diaspora, diesbezügliche Kritik sowie die Entstehung der kurdischen Diaspora eingehen.
3 Diaspora
Der Begriff „Diaspora“ (gr. διασπορα[15] ) stammt vom griechischen Nomen diaspeirein ab und beschreibt den „Prozess der Zerstreuung von Samen von der Elternpflanze weg, wodurch sich der Organismus reproduzierte“ (Moosmüller, Alois 2002: 11). Er fand Ende der 1980er Jahre Einzug in den allgemeinen kulturwissenschaftlichen Diskurs und war zunächst fast ausschließlich auf die über den gesamten Globus zerstreuten jüdischen Gemeinschaften bezogen. Später wurde er auf im Exil lebende armenische und griechische Populationen ausgedehnt. Im Laufe der Zeit bekam der Begriff jedoch eine immer umfassendere Bedeutung (Kokot 2002a: 30).
Seither wird eine wachsende Anzahl migratorischer Gemeinschaften mit diesem Terminus bezeichnet. Viele dieser Gemeinschaften nutzen ihn zudem als Selbstbeschreibung, unter anderem, um sich von der inferiorisierenden Fremdzuschreibung als Immigrant oder „Ausländer“ durch die Aufnahmegesellschaft zu distanzieren.
Der überbordende Gebrauch führte, ähnlich wie bei dem Konzept Identität, zur heftigen Debatten über seinen wissenschaftlichen Nutzen. Vorschläge zum modifizierten Gebrauch oder konkrete Definitionsmerkmale sollten den analytischen Wert wieder schärfen, boten aber wiederum einigen Wissenschaftlern Anlass zur Kritik. Im Folgenden werde ich derlei Kritikpunkte beleuchten, auf verschiedene Verwendungsweisen genauer eingehen und abschließend die Entstehung der kurdischen Diaspora skizzieren.
3.1 Vom „boomenden" zum umstrittenen Konzept
Wegen der inflationären Verwendung des Diaspora-Konzeptes ist es laut Robert Hettlage offensichtlich, dass von einer einheitlichen und einzigen Theorie von Diaspora keine Rede sein kann, „höchstens [von] Theoriebruchstücken, eben Ansätzen“ (1993: 76). Diese Theoriebruchstücke entstammen überwiegend der Migrations-, Ethnizitäts- und Identitätsforschung (1993: 79). Ähnlich dem Konzept Identität wurde und wird auch Diaspora unter den Gesichtspunkten des überbordenden Gebrauchs und daraus resultierender analytischer Unschärfe heftig kritisiert. Der Begriff wird oft in enger, manchmal sogar synonymer Verbindung mit Konzepten wie Transnationalismus, Ethnizität, Nationalismus oder ethnische Minderheit gebraucht (Alinia, Minoo 2004: 27) und verliert dadurch an deskriptivem Wert. Dies bewegte einige Wissenschaftler dazu, sich bewusst vom Diaspora-Konzept abzuwenden oder zumindest Modifizierungen beziehungsweise konkrete Definitionsmerkmale anzubieten.
Auch Brubaker will den Gebrauch des Konzeptes eindämmen, dessen Boom seiner Ansicht nach zur „Diaspora Diaspora“ führte. Damit meint er – analog zur Zerstreuung von ethnischen Gemeinschaften über den Globus – die Zerstreuung der Bedeutungen von Diaspora im semantischen, konzeptuellen und disziplinären Raum (2005: 1). Diaspora werde demnach für alle möglichen Gemeinschaften benutzt, das einzige Kriterium scheine Zerstreuung oder Sehnsucht nach der Heimat zu sein (2005: 3). Im Extremfall reiche für die Etablierung einer Diaspora sogar eine ähnliche Lebensweise (queer -Diaspora, Schwulen-Diaspora) oder gleiche politische Ideologien (liberale/konservative/fundamentalistische/terroristische Diaspora). Um den Begriff in die verschiedensten intellektuellen, politischen oder kulturellen Kontexte einzupassen, müsse er zwangsläufig gedehnt werden. Dadurch verliere der Begriff seine Kraft, Phänomene hervorzuheben und sie in Unterschied zu anderen Phänomenen zu setzen: „If everyone is diasporic, then no one is distinctively so“ (2005: 3). Somit führe die Universalisierung von Diaspora zum Verschwinden von Diaspora.
Steven Vertovec (1997: 1) spricht in diesem Zusammenhang von „over-use“ und gleichzeitiger „under-theorisation“ des Konzeptes. Damit kritisiert auch er die nur mehr lose Referenz und die Abflachung einer Kategorie, die eigentlich dazu dienen sollte, bestimmte Sachverhalte hervorzuheben, anstatt sie einzuebnen in eine Menge ähnlicher Begrifflichkeiten und Konzepte.
Um einen Überblick über die gängigen wissenschaftlichen Verwendungsweisen zu geben, identifiziert er die drei geläufigsten und in der Literatur am häufigsten vorkommenden Bedeutungen von Diaspora. Obwohl sie sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden, schreibt er jeder dieser Kategorien das Potenzial zu, einen konzeptuellen Nutzen zu besitzen (1997: 2).
Diaspora als soziale Form („social form“)
Diese Art der Verwendung ist sowohl in den Sozialwissenschaften als auch im öffentlichen Diskurs am weitesten verbreitet. Die über den Globus zerstreuten jüdischen Gemeinschaften gelten hier meist als Prototyp der Diaspora. Sie ist gekennzeichnet durch die Triadische Beziehung zwischen a) global verstreuten ethnischen Gemeinschaften, die sich selbst als solche identifizieren, b) den territorialen Staaten und Kontexten, in denen sie sich aufhalten, also der Aufnahmegesellschaft und der damit verbundenen Zuschreibung eines inferioren Status und c) den Heimatländern und Kontexten, aus denen Einwanderer stammen (1997: 5). Die Diaspora als soziale Form zeichnet sich vor allem aus durch die sozialen und transnationalen Netzwerke zwischen den zerstreuten Gruppen, durch das gefühlte Anders-Sein in der Aufnahmegesellschaft und durch die Sehnsucht nach der Heimat, die mitunter mit dem Wunsch verbunden ist, eines Tages zurückzukehren.
Diaspora als Bewusstseinsart („type of consciousness“)
Diese Konzeption von Diaspora bezieht sich auf die Selbstwahrnehmung der Individuen innerhalb einer transnationalen Gemeinschaft. Dabei wird oft betont, dass Diaspora-Angehörige sich ihrer Multilokalität bewusst sind oder sich hin- und hergerissen fühlen zwischen der Kultur der Aufnahmegesellschaft, an die sie sich zu einem gewissen Grad anpassen möchten, und der Kultur des Heimatlandes. Dabei unterliegt das Entstehen dieses Bewusstseins einem Prozess dualer Natur: Die eigene Identität wird zuerst in Frage gestellt durch Erfahrungen wie Rassismus, Diskriminierung und Ausgeschlossenheit durch die umgebende Gesellschaft (1997: 8). In einem weiteren Schritt der Selbstverortung wendet man sich verstärkt den eigenen Wurzeln zu und rekonstruiert dadurch eine positive Identität (Alinia: 2004: 250). Oft wird in diesem Prozess die Vorstellung der „eigenen Kultur“ und einer ethnischen (Schicksals-) Gemeinschaft homogenisiert und idealisiert (Vertovec 1997: 12).
[...]
[1] Vgl. Sökefeld, Martin 2001.
[2] Vgl. Vertovec, Steven (1997: 5) sowie Kapitel I.3.1.
[3] Hiermit beziehe ich mich auf Freiheiten und Rechte bezüglich des Ausdrucks der ethnischen Identität und des Einsatzes für ihre Anerkennung.
[4] Begriff: Wippermann, Carsten/Flaig, Berthold Bodo 2009: 5.
[5] Alle Personen, die sich für ein Interview zur Verfügung stellen wollten, wurden in mein Sample aufgenommen.
[6] Vorführung eines kurdischen Films organisiert durch einen kurdischen Studentenverein.
[7] Die Respondenten haben selbst einen Namen gewählt, der in der Arbeit verwendet wird.
[8] Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Bayburt_Turkey_Provinces_locator.jpg; aufgerufen am 18.09.09 um 17:33. Colorierung und Beschriftung durch mich, S.S.
Es ist laut Urheber per GNU-Lizenz für freie Dokumentation erlaubt, die Datei zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren.
[9] Auf Nachfrage meinerseits bestätigte er mir jedoch, seine Aussagen während unseres Gesprächs in meiner Arbeit verwenden zu dürfen.
[10] Azad und Baran wurden getrennt voneinander befragt.
[11] Für eine umfassende Begriffsgeschichte der beiden Konzepte verweise ich auf Marco Heinz’ „Ethnizität und ethnische Identität“ (1993).
[12] Die Termini „Essentialisierung“ sowie „Reifizierung“ sind von den englischen Begriffen „essentialism“ und „reification“ abgeleitet und bedeuten die „Verdinglichung“ von abstrakten Sachverhalten. In einer essentialisierenden/ reifizierenden Verwendung der Konzepte Identität und Ethnizität wird suggeriert, sie könnten an objektiven und konkreten Merkmalen festgemacht werden, seien unveränderlich und würden von allen Mitgliedern einer postulierten Gruppe geteilt. Von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus ist eine derartige Konzeption nicht mehr tragbar.
[13] Die leichtfertige Postulierung von Gruppen in den Sozialwissenschaften bezeichnet Brubaker als groupism. Es werden dabei kollektive Entitäten herausgestellt, denen Interessen und Handlungsmacht zugeschrieben wird. Dadurch entsteht der Eindruck, diese Entitäten bestünden aus einheitlichen kollektiven Akteuren mit gemeinsamen Zielen (2002: 164). Die Lösung sieht Brubaker in der groupness, die keine Entität postuliert, sondern sich auf das Ereignis des Zusammenschlusses in Phasen tief gefühlter Solidarität konzentriert (2002: 168).
[14] Siehe Kapitel I.2.2.
[15] Nach Kokot 2002b: 97.
- Arbeit zitieren
- Silke Stadler (Autor:in), 2009, Ethnizität in der Diaspora, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/200356
Kostenlos Autor werden



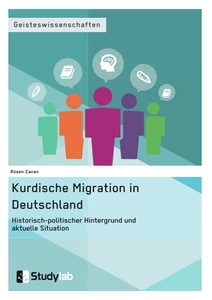



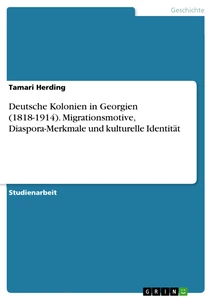













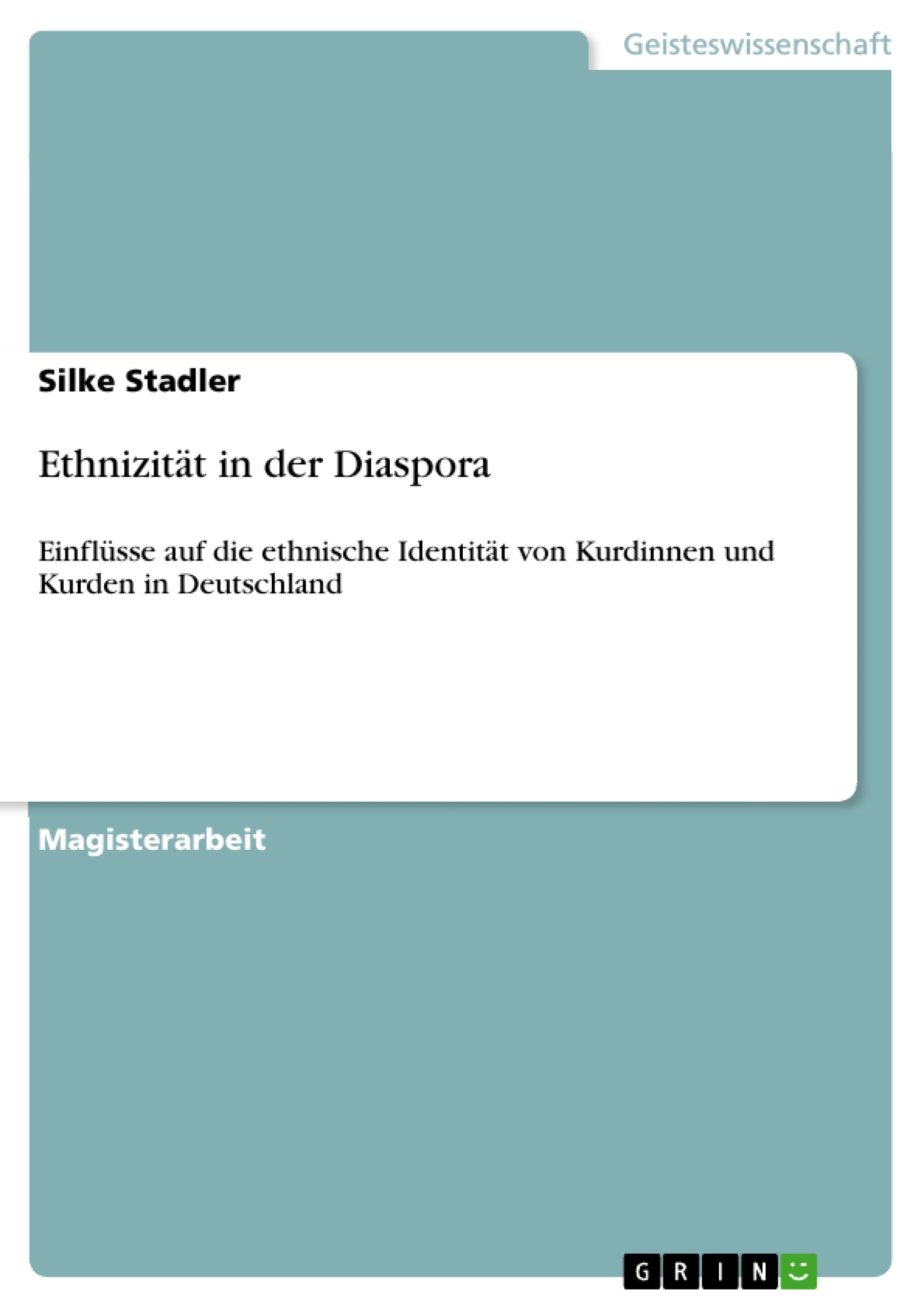

Kommentare