Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
TEIL A Die Bindungstheorie
1 Der Mensch als Bindungswesen
1.1 Bindung als evolutionäre Errungenschaft
1.2 Neurobiologische Erkenntnisse
1.3 Bindung als Voraussetzung zur Umweltexploration
2 Konzeption der Bindungstheorie
2.1 Einflüsse
2.2 Bindung und Bindungspersonen
2.3 Entstehung einer Bindung
2.4 Bindungsforschung
2.4.1 Ursprünge
2.4.2 Die ,Fremde Situation’
2.5 Bindungsstile
2.5.1 Die sichere Bindung
2.5.2 Die unsicheren Bindungen
2.5.2.1 Die unsicher-vermeidende Bindung
2.5.2.2 Die unsicher-ambivalente Bindung
2.5.3 Die desorganisierte Bindung
2.5.4 Verteilung
2.6 Sensitivität der Bindungsperson
2.6.1 Feinfühlig keit und Kooperation
2.6.1 Kommunikation
2.6.2 Bedeutung der Sensitivitätskonzepte
2.7 Internale Arbeitsmodelle - Repräsentanzen der Bindungsmuster
TEIL B Einflussfaktoren auf die Genese einer Bindungsstörung
3 Die Bindungsrepräsentanzen drogenabhängiger Eltern - eine eigene Untersuchung
3.1 Forschungskontext
3.2 Die Probanden
3.3 Der Fragebogen
3.4 Durchführung der Befragung
3.5 Ergebnisse
3.6 Interpretation
3.7 Bedeutung der Ergebnisse für die Bindung zum eigenen Kind
4 Das suchtbelastete Familiensystem
4.1 Die Eltern
4.1.1 Zur Psychopathologie drogenabhängiger Eltern
4.1.1.1 Der Begriff der Komorbidität im Kontext der Drogenabhängigkeit
4.1.1.2 Die Posttraumatische Belastungsstörung
4.1.1.3 Persönlichkeitsstörungen
4.1.1.4 Suchtstörungen
4.1.1.5 Depression
4.1.2 Junge Mütter
4.2 Das Kind
4.2.1 Schwangerschaft und Geburt
4.2.1.1 Auswirkungen des Drogenkonsums auf den Fötus
4.2.1.2 Die pränatale (Ver-)Bindung zwischen Mutter und Kind
4.2.2 Frühgeburt
4.2.3 Das neonatale Entzugssyndrom
4.3 Die Bedingungen des Familiensystems
4.3.1a Die sozio-ökonomische Situation
4.3.1b Veränderungen durch das Methadon-Programm
4.3.2 Interaktion und Erziehung in der Familie
4.3.2.1 Die elterliche Partnerschaft
4.3.2.2 Der Einfluss elterlicher Psychopathologie
4.3.2.3 Erziehung
4.3.2.4 Vernachlässigung und Missbrauch
4.3.2.5 Elternverhalten und Bindungsmuster
TEIL C Die kindliche Psychopathologie
5 Das psychiatrisch auffällige Kind
5.1 Persönlichkeitsentwicklung und Bindungsmuster
5.2 Entwicklungspsychopathologie und Bindungsmuster
5.3 Die Entstehung von Aggression und dissozialem Verhalten
5.4 Störungen des Sozialverhaltens und antisoziale Persönlichkeitsstörung
5.5 Bindungsstörungen
TEIL D Die Aufgabenstellung professioneller Hilfen
6 Unterstützung des Familiensystems
6.1 Die Tagesgruppe
6.2 Erziehungsberatung und Sozialpädagogische Familienhilfe
6.3 Psychotherapie der Eltern
6.4 Die Therapeutische Gemeinschaft
6.5 Das STEEP-Programm
7 F remdunterbringung
7.1 Die Trennung von Bindungspersonen
7.2 Vollzeitpflege und Adoption
7.3 Heimunterbringung
8 Auf der Suche nach der gelingenden Bindung
Resümee: Bindungstheorie und professionelle Intervention
Quellenverzeichnis
Einleitung: Eine Pflegefamilie für Kevin?
Kevin ist das Kind drogenabhängiger Eltern. Er kommt als Frühchen auf die Welt und macht nach der Geburt eine monatelange Entgiftung durch. Mit seinen Eltern wohnt er danach in einem ,sozialen Brennpunkt’, wo viele Menschen große Probleme mit der Lebensbewältigung haben. Seine Eltern streiten sich oft und sind vor allem unter Drogeneinfluss aggressiv. Kevins Vater ist auch schon mehrfach wegen Körperverletzung vorbestraft. Ein halbes Jahr nach seiner Geburt gibt es erste Hinweise dafür, dass der Junge misshandelt wird. In einer Kinderklinik stellen die Ärzte fest, dass seine Knochen an mehreren Stellen gebrochen sind. Mit zehn Monaten kommt er das erste Mal für sechs Wochen in ein Kinderheim. Doch ein Familienkrisen-Dienst ist der Auffassung, dass Mutter und Vaterüber die notwendigen Erziehungskompetenzen verfügen, und so wird er an seine leiblichen Eltern zurückgegeben. Ein weiteres Vierteljahr später diagnostiziert ein Kinderarzt, dass Kevin stark an Gewicht verloren hat. Parallel hierzu berichtet die Polizei den Behörden von Auffälligkeiten die Familie betreffend. Ein halbes Jahr darauf macht Kevins Mutter eine erneute Entgiftung, der Vater schließt sich an. Daraufhin folgt eine Eltern-Kind-Therapie, in deren Rahmen Kevin eine frühfördernde Kindergruppe besucht und die Mutter eine Elternschule absolviert.
Im anschließenden Winter kommt die Mutter plötzlich ums Leben. Der Vater wird in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen und macht eine Methadon-Therapie. Während dieser Zeit kommt Kevin, jetzt fast zwei Jahre alt, erneut in das Kinderheim. Das Jugendamtübernimmt die Vormundschaft und damit die volle Verantwortung für ihn. Kevin ist zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich von seinem schweren Entwicklungsweg gezeichnet. Er ist schwächer und kleiner als Gleichaltrige, weist Spuren schwerer Misshandlungen auf und ist auffällig in der motorischen und sprachlichen Entwicklung. Dem Vater wird eine günstige Sozialprognose gestellt und das Amt für Soziale Dienste entscheidet, den Jungen erneut in seine Obhut zu geben, sobald dieser aus der Psychiatrie entlassen wird. In der Folge wird die Erziehungsfähigkeit des Vaters im professionellen Umfeld kontrovers diskutiert. Schließlich plädiert eine Mehrheit mit dem Hinweis auf die ,Familienorientierung’ für ein Zusammenleben von Vater und Kind. Allerdings soll der Vater unterstützende Hilfen annehmen. Auf Anweisung des Sozialzentrums bekommt Kevin eine Tagesmutter, bei der er aber nur unregelmäßig erscheint. Die Hilfe wird kurz nach Beginn wieder abgebrochen. Auch an dem anschließend für ihn bereitgestellten Platz in einer Frühförderstelle erscheint er nicht.
Kevin ist gut zweieinhalb Jahre alt, als die Entscheidung fällt, dass er aufgrund von Kindeswohlgefährdung durch den Vater in einer Pflegefamilie unterzubringen ist. Als Mitarbeiter des Jugendamtes fast einen Monat später im Beisein der Polizei das Kind aus der väterlichen Wohnung abholen wollen,öffnet niemand. Die Wohnungstür wird aufgebrochen: „Im Kühlschrank entdecken sie Kevins Leiche. Sie weist Brüche des linken Oberschenkels, des rechten Schienbeins und des linken Unterarms auf. Auch sein Kopf muss malträtiert worden sein, an ihm wurden Blutungen entdeckt. Der Vater stammelt etwas von Unfall, macht aber zügig von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch“ (Jüttner, 2006, @).
Die kurze Lebensgeschichte des Jungen, der 2006 starb und welcher als Kevin aus Bremen bekannt wurde, ist aufgrund des angeblichen Fehlverhaltens der professionellen Stellen eine dramatische Spitze im sensationsheischenden Medienalltag geworden. Darüber hinaus zeigt sie in der Kumulation negativer Entwicklungsfaktoren aber ein durchaus typisches Bild der Situation von Kindern Drogenabhängiger. Hierin liegt eine verstörende Botschaft, denn circa 40-60.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland haben einen Elternteil, bei dem ein Missbrauch oder eine Abhängigkeit von illegalen Drogen vorliegt oder der mit Methadon substituiert wird (vgl. Homeier & Schrappe, 2009, S. 120). Dabei stellen die betroffenen Kinder nach Klein (2003) eine selbst unter Suchtexperten vernachlässigte und kaum bekannte Gruppe dar (vgl. S. 358).
Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Werdegang dieser Klientel aus bindungstheoretischer Perspektive. Die diesem Ansatz zugrunde liegende Frage ist, welche Auswirkungen der Entzug von (mütterlicher) Zuwendung auf die betroffenen Kinder hat (vgl. Steele, 2009, S. 335). John BOWLBY, der Begründer der Bindungstheorie, war Kliniker und betrieb verhaltensorientierte Ursachenforschung, um eine fundierte Therapieform für (schwere) psychiatrische Störungen zu finden. Seine Konzepte werden durch neuere Erkenntnisse aus dem Bereich der Psychobiologie ständig untermauert (Schore, 2000; vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 67) und finden mittlerweile auf breiter Ebene Eingang in moderne Therapiekonzepte. Bei der Bindung handelt es sich um eine Grundmotivation und einen lebenslangen Prozess, weshalb es ,,[i]m Prinzip ... keine Symptomatik, kein Störungsbild und keinen Therapieansatz [gibt], bei dem nicht bindungstheoretische Überlegungen angestellt werden können“ (Brisch, 1999, S. 276).
Ein Kind hat nicht die Entscheidungsgewalt darüber, an wen es sich bindet, weshalb es ein „Unglück“ ist, wenn „weder seine Mutter noch sein Vater Interesse an seinem Wohlbefinden haben“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 555). Kinder, deren Eltern unfähig sind, für sie zu sorgen, haben, wie Kevin, oft mehrfache Trennungen und Verlusterfahrungen erlitten (vgl. Steele, 2009, S. 335). Dabei ist nach Spitz die Verwundbarkeit zwischen dem ersten Lebensmonat und dem zweiten Lebensjahr am größten, bis zum fünften Lebensjahr besteht eine erhöhte Sensibilität für einen Mutterverlust beziehungsweise „Störungen in den Liebeszuwendungen“ (Lindner & Reiners-Kröncke, 1993, S. 39f). Mit Schleiffer (2007) hat die Bindungsorganisation des Kindes einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die psychische Entwicklung (vgl. S. 59), obwohl es sich bei dem Zusammenhang zwischen frühen Beziehungserfahrungen und späterer (psychischer) Gesundheit um einen probabilistischen und nicht deterministischen Zusammenhang handelt (vgl. Dornes, 1999, S. 38). Über den Anteil von Beziehungsaspekten an dem Entstehen psychisch auffälligen Verhaltens gibt es nach KRAUSZ & Degkwitz (1996) jedoch „bis heute keinen Konsens in der Psychologie und Psychiatrie“ (S. 39).
Bowlby (2001) beschreibt, dass der menschliche Geist „von der Biologie zwar vorgesehen [ist], verwirklicht aber wird er durch Bindungen mit besonderen, fürsorglichen Menschen, die stärker und weiser sind“ (zit. n. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 64). Dem lässt sich der Gedanke Schleiffers (2007) anschließen, nach dem Erziehung ohne Bindungsbeziehung „kaum denkbar“ ist (S. 235). Mit der Grundüberzeugung, dass „Beziehung vor Erziehung“ kommt, liegen die Kernfragen der Jugendhilfe im Beziehungsbereich (Scheuerer-Englisch, 2004, S. 27). Dies wirft erstens die Frage auf, inwieweit ein professionelles Angebot die familiäre Erziehung kompensieren oder ersetzen kann. Zweitens ist zu analysieren, welche Voraussetzungen in der Herkunftsfamilie gegeben sein müssen, um ein Fremdunterbringen des Kindes zu rechtfertigen. Am Beispiel Kevins ist der empfohlene Weg von ambulanten zu stationären Hilfen gut ablesbar. Die Entscheidung einer Herausnahme des Kindes aus den Verhältnissen kam jedoch zu spät. Selten ist es aber der extreme Umstand des Todes eines Kindes, der die Tatsache beweist, dass ein Kind gefährdet gewesen ist. insbesondere die psychischen Verfassungen und die Lebensumstände Drogenabhängiger, die sich qualitativ noch einmal deutlich von denen (nur) Alkoholabhängiger unterscheiden[1] (vgl. Klein, 2003, S. 365), führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mannigfaltigen Entwicklungsbeeinträchtigungen des Kindes. Gemäß der Wirkung, dem Entzug und der Beschaffung der Substanzen haben Erickson & Egeland (2006) „mit Familien gearbeitet, deren Leben so chaotisch und krisengeschüttelt war, dass sie kaum vorhersagen konnten, wie die nächsten 24 Stunden verlaufen würden“ (S. 84). Dazu kommt, dass die Suchtkrankheit nicht das alleinige Problem der Eltern darstellt, sondern vielmehr ein Ausdruck objektiv fehlgeleiteter Bearbeitung tiefgehender psychischer Probleme ist. So fasst Horney (1975) die Gründe für die negativen Bindungserfahrungen eines Kindes in der Tatsache zusammen, dass „die Menschen in der Umgebung ... zu sehr in ihren eigenen Neurosen befangen sind, um das Kind lieben oder sogar als das besondere Individuum, das es doch ist, begreifen zu können“ (zit. n. Bowlby, 2008, S. 61). Das daraus gegenüber dem Kind folgende Verhalten bedeutet letztlich, dass „die häufig beschworene generationsübergreifende Vererbung von psychischen Krankheiten nicht unbedingt genetische Ursprünge hat, sondern auf frühen Beziehungserfahrungen beruht, die unbewusst wieder und wieder inszeniert werden“ (Schore, 2009, S. 28). Wurden die Mütter als Kinder selbst abgelehnt, so lehnen sie auch ihre Kinder ab. Die Störung der Mutter-Kind-Beziehung ist „ein Teil ihrer Erkrankung, die ,Wiederholung’ der eigenen Kindheit“ (Feldmann-Vogel, 1987, S. 65). Beim Kind ergibt sich nach STEELE (2009) die Internalisierung von erratischem, chaotischem und irrationalem Verhalten aus eben solchem, häufig aggressionsgefärbtem, elterlichen Erziehung s verhalten (vgl. S. 337). Die Suchtfamilie wird bei Arenz-Greiving (1993) als „extremstes Beispiel eines gestörten Familiensystems“ betrachtet (S. 267), und ohne Hilfe von außen scheint sie sich selbst zu reproduzieren.
Über die Zusammenhänge der Entstehung von Entwicklungsstörungen aus dem Bindungskontext heraus will die vorliegende Arbeit informieren. Sie beleuchtet nach einer Einführung in die Bindungstheorie die maßgeblichen Einflussfaktoren für eine gestörte Bindungsbeziehung zwischen Kind und Bezugsperson, analysiert daraufhin entscheidende Faktoren der Entwicklungspsychopathologie des Kindes und gleicht die gefundenen Umstände mit dem Angebot der professionellen Hilfen ab. Schließlich stellt sie die Frage nach der Notwendigkeit von Fremdunterbringungsmaßnahmen bei Kindern drogenabhängiger Eltern und bewertet diese aus der Bindungsperspektive. So traurig der Ausgang des ,Falles Kevin’ ist, so viel kann der Sozialpädagoge, der eine Kindeswohlgefährdung einschätzt und die daraufhin folgende intervention ableitet, daraus lernen - vorausgesetzt, er verfügtüber eine geeignete theoretische Schablone. Die folgenden Ausführungen arbeiten mit der These, dass die Bindungstheorie dafür infrage kommt.
TEIL A Die Bindungstheorie
1 Der Mensch als Bindungswesen
1.1 Bindung als evolutionäre Errungenschaft
1946 veröffentlichten Spitz & Wolf ihre Erkenntnisse, dass Neugeborene ohne den „liebevollen Kontakt zu einer Bezugsperson trotz ausreichender Versorgung mit Nahrungsmitteln und Körperpflege [verkümmern]“ oder sogar sterben (Ruppert, 2008, S. 33) und prägten hierüber den Begriff des ,Hospitalismus‘. Diese Beobachtungen können als ein Grundpfeiler für die Entstehung des bindungstheoretischen Denkens angesehen werden. Dessen Hauptvertreter, insbesondere John Bowlby und Mary D. Ainsworth, arbeiteten mit der Grundannahme, dass eine Tendenz zur Bindung biologisch vorgegeben ist (vgl. Hopf, 2005, S. 243). Grossmann & Grossmann (2008) beschreiben die Erfahrung der physiologischen Stressreduktion durch Nähe sowie das negative Äquivalent als emotionale Beweggründe des Verhaltens bei Tier und Mensch (S. 42). Bei den Rhesus-Affen als zum Vergleich herangezogene Primaten zeigen sich bei Trennung eines Äffchens von seinem Muttertier physiologische Begleiterscheinungen wie Herzrhythmusstörungen, veränderte Gehirnstrommuster im EEG, eine Veränderung des Schlaf-/Wachrhythmus sowie vorübergehendes Fieber mit anschließender Untertemperatur (ebd., S. 44).
Dieser biologische Umstand lässt sich mit Bowlby dahin gehend erklären, dass es sich bei der Bindungsbeziehung um ein eigenständiges Bedürfnis handelt, welches nicht aus dem „Drang zur Nahrungsaufnahme oder sexuellen Wünschen“ ableitbar ist, vielmehr ist dessen Funktion, Schutz zu gewähren (Hopf, 2005, S. 30) . Das Angebot von Schutz und Fürsorge, als auch der komplementäre Umstand, dass bei Angst eine Flucht zur Bindungsperson stattfindet, ist interkulturell vertreten (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 30). „Verbundenheit, Nähe, Zärtlichkeit, Fürsorge, Schutz und Anhänglichkeit“ sind aus dieser Perspektive mit positiven Gefühlen verbunden, da sie dem Überleben des Einzelnen dienen (ebd., S. 65). Somit handelt es sich bei dazu gehörigen Verhaltensweisen nicht um Zeichen von Schwäche, sondern um einen[2] evolutionären Vorteil. Der als unreif geborene Säugling kann allein nichtüberleben und ist insofern „von Natur aus ein soziales Wesen“ (ebd., S. 38). Mit Verweis auf die vergleichende Verhaltensforschung postulieren Grossmann & Grossmann (2008) daher nicht die Unabhängigkeit als idealtypischen Zustand des Individuums, sie beschreiben das bindungstheoretische Menschenbild hingegen als „Autonomie in Verbundenheit“ (ebd., S. 38).
Der Ausdruck von Emotionen findet beim Menschenkind zunächst ohne Intentionen statt. Er ist ein Produkt der „phylogenetischen Selektion“, das Kind ist auf Erwachsene, die es versorgen, „biologisch vorprogrammiert“ (ebd., S. 55). Zu dieser ,Erwartung’ des Kindes gehört die Versicherung, dass es sich bei den Eltern um stärkere und klügere Menschen handelt, und es daher in einer asymmetrischen Beziehung lebt (vgl. Schleiffer, 2007, S. 173). Kindlicher Gehorsam wird auf diesem Hintergrund als „Präadaption“ in Form einer inneren Bereitschaft gesehen (Ainsworth et al., 2003, S. 260). Studienergebnisse lassen den Schluss zu, dass „ein Kind von Anfang an dazu neigt, sozial zu sein, und (etwas später) bereit ist, denjenigen Personen zu gehorchen, die in seiner sozialen Umgebung am bedeutsamsten sind“ (ebd., S. 264). Um in einen Dialog zu treten, weist das Kind schon bei Geburt einen passenden geistigen Reifezustand auf. So sind nach Grossmann & Grossmann (2008) seine fünf Sinne speziell auf Reize gerichtet, die von Menschen ausgehen (vgl. S. 101). Zur „natürlichen Ausstattung“ gehört auch, dass es Zusammenhänge zwischen seinem eigenen Verhalten und den Konsequenzen schon früh erkennen kann (ebd., S. 102). Schließlich zeigt es sich aktiv, indem es einerseits mithilfe seine Neugier Impulse sendet, die die Bezugsperson zum Antwortverhalten bewegen sollen (vgl. Bowlby, 2008, S. 7) und andererseits „darauf ausgerichtet ist, seine Mutter zu verlassen, um die Welt zu erkunden, sobald es dazu in der Lage ist“ (Ainsworth et al., 2003, S. 271).
Die biologische Antwort der Eltern ist das Pflegeverhaltenssystem, welches vor allem bei der Mutter durch hormonelle Prozesse aktiviert wird und ein Repertoire an Verhaltensweisen enthält, die es ermöglichen, die Signale des Kindes zu beantworten (Becker-Stoll, 2007, S. 17). Papousek (1987) benutzt diesbezüglich den Begriff der „intuitiven Elternschaft“ - ein Beispiel dafür ist das Halten des Säuglings in einem Abstand, der seiner optimalen Sehentfernung angepasst ist (Bindt, 2003, S. 74). Es handelt sich letztlich um ein wechselseitiges System, bei dem „die auf Bindung[3] gerichteten Verhaltensweisen des Säuglings auf reziproke mütterliche Verhaltensweisen adaptiert sind“ (Ainsworth et al., 2003, S. 244).
Das menschliche Bindungsverhalten zeigt sich in der Kindheit am deutlichsten, ist jedoch charakteristisch für die gesamte Lebensspanne (vgl. Bowlby, 2003, S. 59). Nach der allmählichen Entwicklung einer Bindung in der Säuglingszeit, die viele Erfahrungen mit der Bindungsperson erfordert (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 41), bildet sie die wichtigste Grundlage, um „verschiedene Ebenen des menschlichen Gehirns mit den Komplexitäten seiner zwischenmenschlichen Beziehungen, seines Verhaltens und seiner Bedeutungen in Einklang“ zu bringen (ebd., S. 48). Die einmal aufgebauten Bindungen beziehungsweise bestehenden Bindungspersonen können nicht einfach ausgetauscht werden. Längere Trennungen oder der Verlust führen zu „schweren Trauerreaktionen und großem seelischen Leid“ (Becker-Stoll, 2007, S. 19).
1.2 Neurobiologische Erkenntnisse
Das Gehirn des Säuglings ist ebenso „hungrig“ nach Interaktion wie der Körper nach Nahrung (vgl. Grossmann & Grossmann, S. 103). In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, dass das Gehirn des Menschen vor allem nach der Geburt reift und Bindungsbeziehungen auf diese Weise auch den Aufbau seiner Schaltkreise prägen (vgl. Schore, 2009, S. 27). Die Muster dieser Verbindungen als auch hormonelle Reaktionen sind dabei „im weitesten Sinne ein Spiegelbild der mütterlichen Gefühlsregulation“ (ebd.). So ist die beruhigende Wirkung von Körperkontakt nach Untersuchungen von Panksepp (1985) „primär in hormonellen Mechanismen im Gehirn des Kindes und der Mutter angelegt“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 43). Im Guten wie im Schlechten von diesem Einfluss besonders betroffen sind beim Kind „das für emotionale Verhaltenssteuerung und Lernprozesse essentielle limbische System und präfrontale kortikale Areale“ (Braun et al., 2009, S. 53f). Auch die Menge der neuronalen Verknüpfungen hängt von der Qualität interpersonaler Erfahrungen ab. So zeigen Tierversuche nach Huether et al. (1999), dass sich derartige Verbindungen ohne Bindungsbeziehungen nur schwach ausbilden (vgl. ebd., S. 59).
Die von der Mutter beim Kind zu regulierenden Hormone haben einen direkten Einfluss auf die Gentranskription. Nach Siegel (1999) werden Neurone aktiviert, „die wiederum Gene aktivieren, welche dann proteine für neuronales Wachstum und neue Synapsen hersteilen“ (ebd., S. 63). Erfahrungsbedingte Anregungen sind demnach „eingeplant“. Auch wenn das Genom selbst nicht verändert wird, so nehmen Bindungserfahrungen doch Einfluss darauf, was „das Genom unter bestimmten Gegebenheiten herstellen kann“ (ebd.). Aus dieser Beobachtung ergibt sich, dass Neurotransmitterstörungen nicht angeboren sein müssen, sondern durch psychologische Variablen der frühen Entwicklung entstehen können. Geprüfte Analogien im Tierreich finden sich bei den Weißbüschelaffen (vgl. Stollorz, 2009, S. 65), die auf Trennungen wesentlich empfindlicher reagieren als Menschen, evolutionär gesehen als Primaten jedoch auch zu den Traglingen gehören. Bei einem Experiment, in dem ein Junges kurz von der Mutter getrennt wird, zeigt sich in der Folge ein erhöhter Noradrenalinspiegel auch bei Tieren, die seit Monaten keine Trennung mehr erlebt hatten. Zudem kam es im Gehirn zu dauerhaften morphologischen Veränderungen. Im Hippocampus standen circa 20% weniger Rezeptoren für die Botenstoffe Serotonin und Cortison zur Verfügung. Dies entspricht einem Zustand beim Menschen nach schweren Depressionen oder „mit schwieriger Kindheit“ (ebd.).
In einer Untersuchung an jungen Mäusen (vgl. ebd.), die in den ersten zehn Tagen täglich drei Stunden von Mutter und Geschwistern getrennt wurden, zeigte sich eine erhöhte Aktivierung des Vasopressin-Gens, einem Stressregulator im Hippothalamus. Hier konnte gezeigt werden, dass auch Gene lernen: „Bei Stress werden dort dauerhaft chemische Signalflaggen errichtet. Solche epigenetischen Markierungen können dazu führen, dass bestimmte Gene dann ein Leben lang fehlerhaft abgelesen werden“ (ebd.) Grossmann & Grossmann (2008) resümieren, dass ein adäquates Funktionieren des Gehirns, definiert als „ein kohärentes Zusammenspiel von neuronalen Aktivitäten, das zu zielgerichteter Aktivität führt“ (S. 46), und damit das Bestehen des Einzelnen wie auch der Erhalt der Kultur, von der sozialen Bindung abhängt. Ähnlich wie vielen Tierarten scheint den Menschenkindern kooperatives Verhalten angeboren, seine „individuelle Ausformung“ erfahrt es jedoch erst durch den Umgang mit den Eltern (Bowlby, 2008, s. 8).
1.3 Bindung als Voraussetzung zur Umweltexploration
Das Bindungsverhalten ist direkt gekoppelt mit dem Explorationsverhalten eines Kindes. Das Zusammenspiel beider Verhaltenssysteme lässt sich am besten mit dem Bild einer Wippe verdeutlichen: je aktiver das eine System, um so weniger aktiv das andere (vgl. Suess, 2003, S. 94). Ohne eine sichere Bindung zu einer Person ist dabei keine „offene uneingeschränkte Exploration“ möglich (Brisch, 1999, S. 222). So gehen die Kinder mit Erreichung des Krabbelalters „auf Entdeckung“, kehren aber vorjeder neuen Erkundung zu ihrer Mutter zurück, wohingegen eine abwesende Mutter eine weit seltenere oder gar unterbleibende Exploration evoziert (Bowlby, 2008, S. 35). Zur Gewährleistung von Unbekümmertheit gegenüber einer fremden Umwelt aufseiten des Kindes muss die Bindungsperson als „sicherer Hafen oder kundiger Begleiter“ fungieren (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 187).
Besteht keine Gefahr für den Erhalt der Bindung, gibt es auch keinen Grund, Bindungsverhalten zu zeigen, und das Kind kann explorativ aktiv sein (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 70). Kommt es aber zum Beispiel durch Verlust der Mutter aus dem Blickfeld zur beängstigenden Trennung, wie von ANDERSON (1972) in einem Londoner Park mit zwei bis drei Jahre alten Kindern erprobt (vgl. Bowlby, 2003a, S. 44), so besteht die eindeutige Priorität in der Zurückgewinnung der Sicherheit in Form der Bindungsperson. Diesbezügliche Verhaltensweisen umfassen das Weinen und Rufen, Nachlaufen, Berühren und Anklammern, als auch den heftigen Protest beim Zurücklassen (vgl. Bowlby, 2003, S. 59). Becker-Stoll (2007) beschreibt darüber hinaus jede Annäherung durch Hinbewegen, wie gerichtetes Anlächeln, die Arme heben oder in die Hände klatschen und freudige Laute äußern, als Bindungsverhalten (S. 18). Aufgrund der beschriebenen biologischen Disposition sollte ein Kind Bindungsverhalten zeigen, wenn es sich müde, krank oder hungrig fühlt. Des Weiteren sollte es zur Bindungsperson flüchten, wenn es in fremder Umgebung allein gelassen wird oder wenn ihm fremde Menschen zu nahe kommen. Ist dies nicht der Fall, so ist nach Grossmann & Grossmann (2008) die betreffende Person entweder keine Bindungsperson für das Kind oder „es hat zu oft leidvoll erfahren, daß seine Bindungsperson es nicht beruhigen wird, d. h. daß sie ihre Schutzfunktion zu selten oder gar nicht ausübt“ (S. 71).
Die kindliche Neugier und das damit verbundene Explorationsverhalten erhielt vor allem durch Mary Ainsworth ein stärkeres Gewicht, die zentrale bindungstheoretische Ideen Bowlbys aufnahm und modifizierte (vgl. Hopf, 2005, S. 45). Hiernach sind auch die Tendenzen zur Umweltexploration im Kind vorgegeben. Zum Explorationsverhalten zählen „Verhaltensweisen, die den Erwerb von Wissenüber die Umwelt und die Anpassung an Umweltveränderungen fördern“, wie „Fortbewegung, manuelle Exploration, visuelle Exploration und entdeckendes Spielen“ (Ainsworth, 2003/1971, zit. n. ebd., S. 46). Auch ein Zugehen auf die Mutter kann im Dienst dieses Systems stehen, wenn das Kind gut gelaunt und neugierig eine Aufforderung zum Spielen oder ein Verlangen nach Erklärung ausdrückt (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 78). Schließlich ist die Prädisposition des Kindes zum Gehorsam dem Schutz durch die Bindungsperson auf Distanz dienlich.
Da die Abwesenheit einer stabilen Bindungsfigur eine angemessene Exploration behindert und damit „eine gesunde Entwicklung emotionaler, kognitiver und sozialer Fähigkeiten“ (Gahleitner, 2005, S. 50f), bekommt die sichere emotionale Bindung den Charakter einer der zentralsten Schutzfaktoren für die „seelische Gesundheit und die Charakterentwicklung“ (Bowlby 1953/2001, zit. n. ebd., S. 51).
2 Konzeption der Bindungstheorie
2.1 Einflüsse
Die von Bowlby entwickelte Bindungstheorie bedient sich einer Vielzahl von Konzepten, die von ihm aus der ursprünglich eklektischen Ansammlung heraus in eine kohärente Form gebracht wurden, welche „dennoch offen ist und der Revision und oder Erweiterung durch die Forschung bedarf, für die sie eine nützlich Leitlinie darstellt“ (Ainsworth, 2003a, S. 384f).
Eine intensive Auseinandersetzung führt Bowlby bezüglich der Thesen der Psychoanalyse, deren Inhalte er insbesondere in seinem Werk ,Bindung’ (1975) mit wissenschaftlich exakt definierten Begrifflichkeiten untersucht (vgl. auch Grossmann, 2004, S. 45). Hierbei löst er sich - und dies traf zur damaligen Zeit auf Vorwürfe und Kritik aus den Reihen der Psychoanalytiker - von den klassischen Termini der vorherrschenden Triebtheorie und wählt zudem einen anderen Ansatz der Erkenntnisgewinnung (vgl. Kißgen, 2000, S. 19). Statt die Auseinandersetzungüber das Innere des Menschen, anhand der „seelischen Repräsentanzen des Verhaltens“, zu führen (ebd.), befasst er sich mit konkret Beobachtbarem. Zur Überprüfung seiner Theorie führt er, angeregt durch die Methoden von Spitz & Robertson (1946), statt derüblichen retrospektiven Analysen mithilfe der Erinnerungen erwachsener Patienten, prospektive Untersuchungen durch.
Auf diese Weise gelingt ihm beispielsweise die Widerlegung des damalig bestehenden Konzeptes des sekundären Abhängigkeitstriebes’, nachdem eine Bindung entsteht, weil das Kind von der jeweiligen Person gefüttert wird. Seine Ergebnisse sagen aus, dass ein ein- oder zweijähriges Kind nicht anfängt, jeden zu mögen, der es lediglich füttert (vgl. Bowlby, 2003a, S. 41), genau so wenig, wie der Wechsel von einer Ernährungsperson zu einer anderen für das Kind mühelos verkraftbar ist (vgl. Bowlby, 2003, S. 57). Dennoch treffen sich die Vorstellungen der Psychoanalyse und die Erkenntnisse Bowlbys in der Annahme, „daß die Umwelt, in der ein Kind aufwächst, einen entscheidenden Einfluss auf seine zukünftige psychische Gesundheit haben wird“, wobei speziell der Mutter-Kind-Beziehung eine große Bedeutung beigemessen wird (Kißgen, 2000, S. 18). In Verbindung mit dem Konzept der ,Internalen Arbeitsmodelle‘ (s. 2.7), die innerpsychische Repräsentationen vom Selbst und den Bezugspersonen konzeptualisieren, darf nach Bowlby (2008) die Bindungstheorie „den Rang einer von den behavioristischen Ansätzen deutlich unterscheidbaren psychoanalytischen Strukturtheorie beanspruchen“ (S. 221). In diesem Zusammenhang versteht sie sich historisch als „Abkömmling der Objektbeziehungstheorie“ (ebd., S. 23).
Der entscheidende Anstoß für die Überzeugung, mit dem Bindungssystem ein autonomes Bedürfnis gefunden zu haben, geht nichtsdestoweniger auf die Arbeiten Konrad Lorenz’, und damit auf die Verhaltensforschung zurück. Lorenz’ Versuche, in denen Gänse- und Entenküken an Mutterattrappen gebunden werden, obwohl diese kein Futter geben, sind ausschlaggebend für die ethologische Verankerung der Bindungstheorie (vgl. Bowlby, 2008, S. 28). Erwähnenswert scheint in diesem Zusammenhang auch Harlow (1961), derüber Deprivationsstudien an Rhesus-Affen nachweisen konnte, dass die Äffchen in Gefahrensituationen stets eher bei einer weichen Mutterattrappe Schutz suchen, als eine nahrungsspendende Drahtattrappe zu bevorzugen (vgl. Kißgen, 2000, S. 19). Diese Verhaltensweisen dienen, gemäß den Vorstellungen der Ethologie,über das Erfahren von Sicherheit, dem Überleben des Einzelnen und damit der ganzen Art (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 76). In Verbindung mit dem elterlichen Fürsorgesystem bestehen somit „zwei aufeinander bezogene Verhaltensstrategien“ (Suess & Röhl, 1999, S. 167).
Die Konzentration auf das Zusammenspiel zweier Bindungspartner zeigt des Weiteren eine systemtheoretische Komponente (ebd.). Von KIßGEN (2000) ebenfalls erwähnt wird der Einfluss der ,Kontroll-System-Theorie‘ nach Miller et al. (1960) auf Bowlbys Denken. Hierin findet sich ein dem Kind eigenes unbewusstes Konzept, nach dem es „kontinuierliche Vergleiche des wahrgenommenen Bedürfnisses nach Nähe und der aktuellen Situation (Entfernung von der Bezugsperson) durchführt“ (S. 21). Dieser Abgleich funktioniere im Sinne eines Warnsystems.
Schließlich ergibt sich eine „anthropologische Orientierung“ in Kombination mit einer „biologisch-naturwissenschaftlichen Fundierung“, die die „psychoanalytischen Überlegungen Sigmund Freuds, wo immer möglich, kohärent einbezieht“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 181). Der große Vorteil dieses menschenwissenschaftlichen Konglomerats gegenüber dem rein psychoanalytischen Denken liegt in der Möglichkeit der Bindungsforschung, eine gewissenhafte methodische Sorgfalt walten zu lassen (vgl. ebd.; s. 2.4). Die Theorie hat sich auf diese Weise in den letzten vierzig Jahren stetig weiter entwickeln und schulenübergreifendüberzeugen können, sodass heute fast alle Therapierichtungen von ihr geprägt sind (vgl. Schore, 2009, S. 27; s. 6.3).
2.2 Bindung und Bindungspersonen
Grossmann & Grossmann (2008) definieren die Bindungstheorie als ein „umfassendes Konzept für die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen als Folge seiner sozialen Erfahrungen“ (S. 65). Demgegenüber werden Fehlentwicklungen „als Folge von Mängeln in angemessenem Schutz und ausreichender Fürsorge“ gesehen (ebd.). Ziel des Bindungssystems ist das Gefühl von Sicherheit, womit es sich in erster Linie um einen „Regulator des emotionalen Erlebens“ handelt (Fonagy et al., 2004, S. 45). Nach Schore dient der zwischen Mutter (Bezugsperson) und Kind dyadisch regulierte Prozess einer - mehr oder weniger effektiven - Stressbewältigung, woraufhin allmählich Coping(Bewältigungs)-Strategien ausgebildet werden, die eine Kontrolleüber Affekte und Emotionen erlauben (vgl. Bindt, 2003, S. 69). So verstanden, „liegen Bindungsprobleme vielen Formen mentaler Störungen zugrunde“ (Fonagy et al., 2004, S. 45), woraus sich die zentrale Bedeutung der Bindungstheorie in der Therapie ergibt. Die Funktion des Bindungssystems nach Bowlby ist es, das „Fühlen, die Wahrnehmung, das Verhalten und das Denken im Hinblick auf dasübergeordnete Ziel, Schutz und Fürsorge zu erhalten“, zu organisieren (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 78). Hierbei herrscht das Grundprinzip, dass ein Kind in jedem Fall eine Bindung eingeht, „auch zu einem noch so pathologischen Objekt“ (Köhler, 1999, S. 128). Definiert wird Bindung als „imaginäres Band zwischen zwei Personen ..., das in den
Gefühlen verankert ist und das sieüber Raum und Zeit hinweg miteinander verbindet“, wobei sie selektiv und spezifisch ist (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 68). Eine schwächere Person bindet sich an eine stärkere, mit der häufige Interaktionen stattfinden (ebd.). Von Bowlby (2003) wird der Aufbau eines derartigen Bandes gleichgesetzt mit ,sich verlieben’, das „Aufrechterhalten eines Bandes als jemanden lieben’ und einen Partner zu verlieren als ,über jemanden trauern’“ (S. 61). Wut und Angst bei Gefährdung der Bindung erhöhen ihrerseits Aufmerksamkeit und Kampfbereitschaft, die die Voraussetzungen dafür bilden, für den Erhalt einer Bindung zu kämpfen. Nach Grossmann & Grossmann (2008) lassen sich so „Eifersucht und einzelne Formen der Gewalt“ erklären (S. 69). Ein weiteres typisches Merkmal der engen Beziehung zeigt sich in der zunächst nur psychomotorisch und emotional möglichen Kommunikation zwischen Mutter und Kind, welche „unabhängig von den wachsenden sprachlichen Verständigungsmöglichkeiten“ typischerweise erhalten bleibt (Bowlby, 2008, S. 98). Innerhalb der dem Kind zugehörigen Bindungspersonen besteht eine eindeutige Hierarchie, an deren oberster Stelle die primäre Bezugsperson steht. Diese wird von Grossmann & Grossmann (2008) beschrieben als „Person, mit der das Kind die häufigsten sozialen Interaktionen hat“ (S. 71) - es muss sich dabei keinesfalls um die Mutter des Kindes handeln. Je schlechter es einem Kind geht, um so mehr möchte es bei dieser primären Bezugsperson sein, während die „nachrangigen Bezugspersonen“ es einstweilen beschwichtigen können, insbesondere dann, wenn die primäre Bezugsperson nicht verfügbar ist (ebd., S. 68). Wichtige Erkennungsmerkmale einer bestehenden Bindung sind sowohl Trennungsschmerz als auch Entspannung beim Wiedersehen (ebd., S. 71).
2.3 Entstehung einer Bindung
Ein Kind kommt nicht gebunden auf die Welt. Für die Entstehung einer Bindung sind Erfahrungen mit der zukünftigen Bindungsperson nötig. Ein Bindungsmuster kristallisiert sich beim Säugling etwa zwischen dem siebten und zwölften Lebensmonat heraus (vgl. Bowlby, 2008, S. 99). Dies passt zu der Aussage von Scheuerer- Englisch (2004), dass der Bindungsaufbau zwischen sechs Monaten und drei Jahren braucht, wobei bereits nach einem Jahr klare Bindungen zu erkennen sind (S. 24).
Die Entstehung einer Bindung beim Säugling erfolgt nach AINSWORTH (1973) typischerweise in vier Phasen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 73). Während der ersten Phase, die etwa die zwei Monate nach der Geburt umfasst, bringt das Neugeborene kein Interesse für andere Menschen auf, „solange seine körperlichen Bedürfnisse zu seiner Zufriedenheit gestillt werden“ (Moog & Moog, 1979, S. 37). In dieser ,Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen’ sind soziale Reaktionsweisen „fast reflexartig“ und werden nicht spezifisch an eine Person gerichtet, obwohl sie vonseiten der oder des Erwachsenen, die zu schaffende Bindung begünstigend, durchaus anders interpretiert werden (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 73). Ab dem dritten Monat ist die Gesellschaft anderer ein bewusstes Umweltmerkmal für den Säugling und er wird „nach längerer Isolation“ unzufrieden (Moog & Moog, 1979, S. 37). Er befindet sich, bis etwa zum sechsten Monat, in der ,Phase der unterschiedlichen sozialen Reaktionsbereitschaft’, in der er seine sozialen Äußerungen bevorzugt an seine Mutter[4] richtet. Sie kann ihn daher eher zum Lachen bringen und besser trösten (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 73). Die dritte Phase ist gekennzeichnet durch die enormen Entwicklungsfortschritte des zweiten Lebenshalbjahres. In dieser ,Phase des aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens’ kann das Kind durch selbständige Fortbewegung, „das gezielte Greifen und eine wachsende geistige Vorstellung von seiner Mutter“ das Repertoire seines Sozialverhaltens erweitern (ebd.). Die Bindungsperson kann in verschiedenen Intonationen gerufen werden, wodurch die Nähe zur Bindungsperson besser und autonom bestimmt werden kann und das Kind lernt zudem, „die Reaktionen seiner Bindungsperson auf sein Verhalten hin vorherzusagen“ (ebd.).
Bowlby (2008) beschreibt das ,intentionale Handeln’, gelenkt von dem Bedürfnis, bestimmte Ziele zu erreichen, welches sich mit knapp einem Jahr im Bewusstsein des Kindes manifestiert. Es steht im Zusammenhang mit Zufriedenheit und Glücksgefühlen, die sich nach Erfolgen einstellen, beziehungsweise mit „Enttäuschung, Angst oder Wut nach Misserfolgen“ (S. 49). Das evolutionär gesetzte Ziel einer „Orientierung aller Signale auf die Bindungsperson“ wird allmählich abgelöst durch die „Beachtung der jeweiligen Interessen und Motive der Bindungsperson in der Kommunikation mit ihr“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 419). Das Verhalten des Kindes wird mehr und mehr ,zielkorrigiert’. Diese vierte Phase, die der ,zielkorrigierten Partnerschaft’, beginnt, wenn das Kind sprechen kann und versteht, was die Bindungsperson beabsichtigt. Frühere Konzepte des Säuglings können die Bezugsperson locken, er kann jedoch noch nicht begreifen, warum diese nicht immer darauf eingeht (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 75). Nun hat das Kind ein ,gesetztes Ziel’ bezüglich der Nähe zu seiner Bindungsperson. Zeigt sich eine Abweichung, zum Beispiel durch Erhöhung der Distanz, aktiviert das sein Bindungsverhalten. Hierzu findet nach bindungstheoretischer Vorstellung ein Vergleich der Bedürfnislage des Organismus mit der gegenwärtigen Situation in Form eines Soll-/Ist-Wertes statt. Der Organismus erhält Informationenüber die Wirksamkeit seiner Aktionen auf die Umwelt und die rückläufige Reaktion. Auf Grundlage dieser Mitteilungen wird die weitere Steuerung der Verhaltenssysteme vorgenommen. Die speziellen Verhaltensweisen sind dabei, geprägt durch subjektive Wahrnehmungen und individuelle Erfahrungen, sehr unterschiedlich (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 76f). Sie werden „in iterativen Folgen so lange rückgekoppelt“, bis der Soll-Zustand erreicht ist (Ahnert, 2004, S. 71). Die Bindungsbeziehung lässt sich durch diese Wechselwirkungen als dynamischer Prozess verstehen, der sich auf Umweltveränderungen immer wieder einstellt (ebd.). Mit zunehmendem Alter verstärkt sich die einflussnehmende Rolle des Kindes. So nutzt es im Vorschulalter seine Argumentationsfähigkeiten, um die Vorhaben der Mutter in Richtung der eigenen Vorstellungen zu verändern (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 75). Über die Lebensspanne bleibt das Bindungsverhalten als „universales, regelhaft aktivierbares Verhalten“ bestehen. Es zeigt sich lediglich weniger spontan und vornehmlich in Angst- und Stressreaktionen (Bowlby, 2008, S. 4).
Hat sich eine Bindung aufgebaut, kann eine Trennung nur unter einem Trauerprozess vollzogen werden. Kommt es zu einer solchen, oder gar einem endgültigen Verlust, folgt bei allen Kindern und den meisten Erwachsenen eine typische Sequenz aus (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 75):
1. Betäubt sein
2. Protest und Sehnsucht (Trennungsangst, starkes Bemühen um das Wiedererlangen der Person)
3. Verzweiflung und Desorganisation (Kummer, Trauer, evtl. Realitätsverlust).
Die begleitenden Gefühle umfassen verzweifelte Hoffnung (auf das Wunder des Wiedererscheinens), Wut, im Stich gelassen worden zu sein, zornige Vorwürfe gegen alle, die mit dem Verlust in Verbindung gebracht werden, sowie Schuldgefühle, selbst für den Verlust verantwortlich zu sein. In einer vierten Phase entfremden sich Kinder
von der Bindungsperson und lösen sich somit ab, während Erwachsene sich reorganisieren (ebd.)
2.4 Bindungsforschung
2.4.1 Ursprünge
Bowlby gründet sein Gedankengerüst auf psychoanalytischen Überzeugungen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 30), erkennt zudem jedoch die „unbedingte Notwendigkeit von empirischer Forschung“ (ebd., S. 33). Die Psychoanalyse selbst entwickelte keine Prüfmethoden und führte keine systematischen Untersuchungen durch[5] (ebd., S31). Die Grundlagen einer objektiven Erforschung der „Ursprünge des Selbstwertgefühls in frühen und andauernden Bindungsbeziehungen von Personen“ (ebd., S. 33) liefert Bowlby darum die Ethologie beziehungsweise Verhaltensbiologie (s. 2.1). Es geht im Besonderen um die „Beobachtung des Ausdrucks von Gefühlen“ (ebd., S. 35). Hierbei erweist es sich von Vorteil, dass vor allem in der frühen Kindheit Parallelen zwischen inneren Vorgängen und dem Verhalten gezogen werden können, sodass eine Analyse von Verhaltensweisen den Zugang zu geistigen Prozessen erlaubt (vgl. ebd., S. 36). Suess & Hantel-Quitmann (2004) sehen einen Verdienst der Bindungstheorie darin, dass sie die Verhaltens- und Repräsentationsebene miteinander verbunden hat (s. 2.7).
Hopf (2005) betont die besonderen Leistungen und Errungenschaften der Bindungsforschung, da „man sich mit großem methodischem Aufwand um die Beobachtung von Interaktionen in unterschiedlichen Kontexten gekümmert hat - im häuslichen Kontext, im Kindergarten, in der Schule oder auch unter Laborbedingungen“ (S. 44). Auf diese Weise sei Ärger, Wut und Aggression von Kindern „trotz vieler methodischer Schwierigkeiten“ glaubwürdiger als in vielen anderen Untersuchungen beschrieben und analysiert worden (ebd.).
Die seelischen Folgen einer Trennung des kleinen Kindes von der Mutter wurden 1952 zum ersten Mal von Robertson & Bowlby beschrieben (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 66). Diese sorgfältigen Beobachtungen wurden von Robertson in Filmen dokumentiert. Es gelang den Forschern, die damals gängige Meinung zu wider legen, dass die „Apathie und die Ruhe von Kleinkindern in Krankenhäusern und Kinderheimen ein Zeichen von Eingewöhnung und Akzeptanz sei“ (ebd.). Vielmehr handele es sich um Passivität, eine „negative, depressive, leidvolle Fügung in Trennung und Umstände“, die von den Kindern nicht änderbar waren (ebd.). Zur etwa gleichen Zeit beobachtete Ainsworth Säuglinge bis ins zweite Lebensjahr im Stil der biologischen Verhaltensforschung in Uganda. Ihre erkenntnisleitenden Fragen hierbei waren: „Auf welche Verhaltensweisen oder Signale reagierten ihre Mütter oder andere Familienmitglieder? Wie reagierten sie und welchen Effekt hatten die mütterlichen Reaktionen auf ihren Säugling?“ (ebd., S. 81). Die Ergebnisse ließen sie an der biologischen Fundierung des Bindungssystems, wie Bowlby sie formuliert hat, festhalten. In Baltimore, wo sie ab 1958 einen Lehrstuhl besetzte, wollte sie die Beobachtungen theoretisch untermauern und entwickelte einen Forschungsplan, dessen labormethodischer Teil unter dem Namen ,Fremde Situation’ tausendfach wiederholt werden sollte (vgl. Hopf, 2005, S. 51; s. 2.4.1). Nach Hopf (2005) ist die BaltimoreStudie trotzdem eine der wenigen, die die frühe Mutter-Kind-Interaktion im Verlauf des ersten Lebensjahres des Kindes so umfangreich und ausführlich dokumentiert (vgl. S. 66). Leider ist eine Generalisierung der Ergebnisse nicht möglich, da es sich um eine sehr kleine und sozial wie kulturell selektive Stichprobe handelt (ebd., S. 67).
2.4.2 Die ,Fremde Situation ’
Die ,Fremde Situation’ (im Folgenden ,FS’) ist eine experimentelle Untersuchung, in der das Bindungsverhalten des Kindes aktiviert und analysiert werden soll. Zu diesem Zweck werden zwei Größen im Raum, in dem sich auch das Kind sowie zu explorie- rendes Spielzeug befinden, verändert: die An- und Abwesenheit der Mutter sowie die An- und Abwesenheit einer fremden Person (vgl. Ruppert, 2008, S. 40). Validiert ist die Erfassungüber diesen Aufbau bisher nur für Kinder in einem Alter von elf bis höchstens 20 Monaten. Danach ist es im Einzelfall oft unklar, ob das Bindungsverhalten noch aktiviert wird, da „geistig weiter entwickelte Kinder mithilfe der Sprache und ihres Wissens kurze Trennungen schon kompetentüberbrücken können“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 137). Aufseiten des Kindes werden folgende Merkmale untersucht (Ruppert, 2008, S. 40):
- sein Spiel- und Erkundungsverhalten
- seine Reaktionen auf die Trennung von seiner Mutter
- seine Reaktionen auf das Trösten und Ablenken durch eine fremde Person
- seine Reaktionen beim Zurückkommen der Mutter
- die nicht sprachlich ausgedrückten Stress-Symptome des Kindes
Bowlby (2008) weist darauf hin, dass an Beobachtungen von Kleinkindern deutlich wird, wie früh positive als auch negative soziale Verhaltensmuster entstehen und familiäre Erfahrungen die Entwicklung prägen, „weil es nunmal in unserer Natur liegt, andere Menschen genauso zu behandeln, wie wir selbst behandelt worden sind, was in den ersten Lebensjahren am eindrücklichsten zu beobachten ist“ (S. 71).
Die FS soll eine mögliche Situation im Alltag einer Mittelschichtsfamilie spiegeln (vgl. Ainsworth, 2003a, S. 396), wobei das Verhalten des Kindes nur verständlich wird, wenn es in Verbindung mit den ebenfalls zu beobachtenden Interaktionen zwischen Mutter und Kind im häuslichen Setting betrachtet wird (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 138). Der dem Ablauf inhärente Stresslevel ist beabsichtigt, mitjeder Episode wird „die Verunsicherung und damit die Schutzbedürftigkeit des Kindes gesteigert“ (ebd., S. 134). Wegen der Folge einer möglichen Instabilität des Verhaltens sollte darauf geachtet werden, dass das Kind nicht zu erschöpft, nicht hungrig, nicht krank und nicht vor Kurzem für längere Zeit von der Bindungsperson getrennt worden ist (vgl. Ainsworth, 2003a, S. 395).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1 Ablaufder ,Fremden Situation’
Kamen in Baltimore noch Diktiergeräte mit ausführlichen verbalen Beobachtungsprotokollen zum Einsatz, bedienen sich die Forscher heute der Videotechnik. Tabelle 1 zeigt den Ablauf der FS für Einjährige nach Ainsworth et al. (1978; vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 134). Jede Episode hat eine Dauer von maximal drei Minuten, wobei bei zu großem Kummer des Kindes die Zeit immer verkürzt wird. Wie der Tabelle zu entnehmen ist, findet die Beurteilung des beobachteten Verhaltens mit Hilfe von Skalen statt. Diese müssen „unter allen Umständen genaue und unmißverständliche Angaben enthalten und durch beobachtbare Verhaltensweisen definiert sein“ (Grossmann, 2003, S. 412). Ist dies der Fall, so gibt es nach Grossmann (2003) derzeit keine bessere Methode zur Auswertung derartig gewonnener Daten (vgl. ebd.).
2.5 Bindungsstile
Aus den Resultaten der Beobachtungen in der FS erstellte Ainsworth Bindungskategorien (1973; vgl. Ruppert, 2008, S. 41). Die Kinder verhielten sich in den verschiedenen Episoden so charakteristisch, dass die Übereinstimmungen folgende Einteilung rechtfertigten (wobei die Restkategorie ,nicht klassifizierbar’ notwendig blieb):
- Kinder mit sicherem Bindungsmuster (Kategorie B)
- Kinder mit unsicher-vermeidendem Bindungsmuster (A)
- Kinder mit unsicher-ambivalentem Bindungsmuster (C)
Zudem bestehen heute zu jeder Kategorie vier Subgruppen (wie ,A1’ bis ,A4’), mit denen einzelne Verhaltensausprägungen (sich zum Beispiel mehr oder weniger von der fremden Person trösten lassen) näher bestimmt werden können (vgl. Hopf, 2005, S. 52). Bei den unsicheren Formen handelt es sich nicht einfach um weniger sicher gebundene Varianten, vielmehr werden komplexe Muster der Bindung beschrieben, die einen Unterschied in der inhaltlichen Qualität und der Art des Umgangs, nicht aber in der Intensität der Bindung beschreiben (vgl. Hopf, 2005, S. 47). Des Weiteren beziehen sich die Klassifikationen lediglich auf die Bindung zu einer Person und sind nicht als Persönlichkeitsmerkmale zu verstehen (vgl. Ahnert, 2004, S. 70). Nach Grossmann & Grossmann (2008) kann das Kind „zu jeder seiner Bindungspersonen eine andere Bindungsqualität haben“ (S. 170). Sprachlich korrekt dargestellt ist daher ein ,unsicher gebundenes Kind’ ein ,Kind mit einer unsicheren Bindungsbeziehung zu einer bestimmten Person’ (vgl. Suess & Röhl, 1999, S. 168).
Darüber hinaus entwickelt sichüber die Konstante des jeweiligen Bindungsmusters eine Bindungsstrategie mit der stärksten Prägung innerhalb der ersten sechs Lebensmonate, wobeijedoch „im Verlauf der weiteren Verhaltensentwicklung eine deutliche Plastizität zu beobachten ist“ (Braun et al., 2009, S. 53). In Verbindung mit multiplen Lempro- zessen bis ins Erwachsenenalter lässt sich das Bindungsverhalten schließlich doch als „individuelles Wesensmerkmal“ beschreiben (ebd.). In diesem Zusammenhang steht die Beobachtung, dass Bindungserfahrungen einen ,carry over’-Effekt zeigen, das heißt, sie unterliegen einer Generalisierung auf alle Bindungspartner (ebd.; s. 2.7).
Obwohl an dieser Stelle die klassische Kategorisierung vorgestellt wird, soll auch auf kritische Stimmen aufmerksam gemacht werden. So findet Schindler (2001) als Nachteil des kategorialen Systems, dass alle „Zwischentöne“ verloren gehen (S. 29). Er arbeitet in seiner Untersuchung mit dem zweidimensionalen Modell der Bindungsstile nach Griffin & Bartholomew (vgl. ebd., S. 31). Zentner (2004) führt neuere „taxo- metrische Analysen“ an, die das ABC-Schema infrage stelle und das Konzept eines Kontinuums nahe legen (S. 196). Hierdurch soll vor allem der nicht klassifizierbare Teil vermindert werden. Da die folgenden Ausführungen aber Ergebnisse der FS mit kategorialen Bewertungen sind, als auch mit insgesamt zwölf Kategorien bereits eine Form des Kontinuums besteht (vgl. Julius, 2009, S. 16), soll auf diese bisher vereinzelten - wenn auch fortschrittlichen - Überlegungen nicht näher eingegangen werden.
2.5.1 Die sichere Bindung
Die sichere Bindung ist in der FS durch einen flexiblen Wechsel beziehungsweise eine ausgewogene Balance von Bindungs- und Explorationsverhalten je nach Trennungsgrad gekennzeichnet (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 140). Es ist eine offene Kommunikation besonders der negativen Gefühle, ein unbekümmertes Spielen bei Trennung sowie ein erfolgreiches Trösten erkennbar (vgl. ebd., S. 145). Dabei ist die Verhaltensstrategie der Kinder, „ihre Belastung durch Körperkontakt mit der Mutter abzubauen, und die Beruhigung, die sie durch diesen Kontakt erhalten“ so effektiv, dass ein Nachweis des Stresshormons Cortisol beim Versuch nicht möglich war, obwohl die Kinder während der Trennung „intensiv riefen, weinten und aufgeregt die Mutter ein- forderten“ (ebd., S. 144). Nach erfolgter Trennung blieben sie misstrauisch und spielten näher bei der Mutter, wurden jedoch nicht ärgerlich (ebd.).
Bei den sicher gebundenen Kindern wird davon ausgegangen, dass sie aufgrund einer empathischen Mutter-Kind-Beziehung eine Vorstellung verinnerlicht haben, nach der sie in Not- und Stresssituationen getröstet werden (vgl. Hopf, 2005, S. 137). Zum einen erwarben sie durch ihre Erfahrungen das Vertrauen, „dass sie selbst im im Kontakt zu ihren Bezugspersonen erreichen können, dass ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden“ (ebd., S. 135). Zum anderen erfuhren sie Sicherheit, welche als „die wichtigste Voraussetzung für die uneingeschränkte Entwicklung explorativer Bedürfnisse“ gilt (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 55). Ein sicherer Bindungskontext bedeutet das Erlernen von „zielorientierten, rationalen Handlungsprozeduren ..., die zur Regulierung aversiver Erregungszustände dienen“ (Fonagy et al., 2004, S. 50) und darf als optimal verstanden werden.
2.5.2 Die unsicheren Bindungen
Die als unsicher definierten Kategorien der vermeidenden oder ambivalenten Bindung stellen Variationen im Rahmen normativer Bindungsentwicklungen dar, nichtsdestoweniger reflektieren sie aber eine weniger optimale Qualität der Beziehung (vgl. Ahnert, 2004, S. 69). Festzustellen ist dies daran, dass diese nicht das Ziel des Bindungssystems erreichen, „die psychische Sicherheit des Kindes nach dem Trennungsstreß“ wiederherzustellen (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 143).
Wichtig ist der Hinweis, dass die unterschiedlichen Formen der unsicheren Bindung kulturell nicht generalisierbar sind. Eine besondere Betonung der körperlichen Beziehung etwa bedeutet einen enorm hohen Stresslevel in der FS (vgl. Hopf, 2005, S. 69). Für die USA und Westeuropa findet sich aber eine hohe Übereinstimmung, die auch in internationalen Forschungskooperationen analysiert und geprüft wurde (vgl. ebd., S. 70).
2.5.2.1 Die unsicher-vermeidende Bindung
Unsicher-vermeidende Kinderüberbetonen in der FS die Exploration auf Kosten von Bindungsgefühlen und -verhaltensweisen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 140). Sie zeigen kaum Trennungsleid, weinen nichtüber das Fortgehen der Mutter, solange noch die fremde Person bei ihnen ist, und vermeiden es bei Rückkehr der Bindungsperson, Bindungsverhalten zu zeigen. Vielmehr wenden sie sich vermehrt dem Spielzeug zu, tun dies jedoch weniger konzentriert und mit geringerer Hand-AugeKoordination (vgl. ebd., S. 149).
Das unbeeindruckt wirkende Verhalten unsicher-vermeidend gebundener Kinder ist trügerisch. Messungen ergaben Stressreaktionen in der FS in Form von erhöhter Cortisolausschüttung und einem Anstieg der Herzfrequenz (vgl. Hopf, 2005, S. 57). Schon bei zwölf Monate alten Säuglingen ist zu beobachten, dass sie umso weniger Bindungsverhalten zeigen, je höher der Distress wird (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 150). Während nahezu alle sicher gebundenen Kinder nach den beiden Trennungen von der Mutter direkt und unmittelbar mit ihr kommunizieren, tun dies nur wenige Kinder mit vermeidendem Hintergrund (vgl. Grossmann, 2004, S. 36). Wird die Stimmung schlechter, treten die sicheren Kinder häufiger in Kontakt zur Bindungsperson, während bei den unsicher-vermeidenden das Gegenteil geschieht: Nach der zweiten Trennung richteten bei einer Untersuchung 70% von ihnen keine Signale mehr an ihre Mütter (vgl. ebd.). In der Subgruppe A1 (stark vermeidend) sind die Kinder selbst in einer Situation, die für sie gefährlich werden könnte, nicht bereit, Bindungsverhalten zu zeigen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 150). Der bewussten Ablenkung der Aufmerksamkeit weg von der Bindungsfigur steht ein viel umbeküm- merterer Umgang mit der fremden Person gegenüber, deren Gesellschaft Kommunikation und Freude beim Kind erregt (vgl. ebd.).
Die Beobachtungen bei diesen Kindern zu Hause zeigen zurückweisende Mütter, durch deren Verhalten das Kind die Erwartung verinnerlicht, dass jedes stärkere Bitten um engeren Kontakt abgewiesen werden wird (vgl. Ainsworth et al., 2003, S. 325). Die Vermeidung, beziehungsweise das Verdrängen der Bindungsbedürfnisse, ist eine daraufhin zustande gekommene Bewältigungsstrategie. Der Konflikt wird nach AINSWORTH gelöst, indem das Kind sich durch Verzicht weitere Zurückweisungserfahrungen erspart und seine Angst vor Bestrafungen, die durch das Zeigen von Wut oder Ärger provoziert werden könnten, reduziert (vgl. Hopf, 2005, S. 64). Main (1981) nennt diese Form der Bindung „avoidance in the service of attachment“ (Hopf, 2005, S. 82) und beschreibt sie als „zweitbeste Strategie“, da die Bindungsperson zwar verfügbar bleibt, der Preis dafür aber eine belastende Selbstbeherrschung ist (1982; vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 164).
2.5.2.2 Die unsicher-ambivalente Bindung
Ambivalent gebundene Kinder zeigen in der FS auf Kosten der Exploration eine Überbetonung der Bindungsgefühle und des -verhaltens. Sie haben eine große Angst vor dem Verlust und mischen diese auch mit Ärger (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 140). Die betroffenen Kinder weisen ebenfalls eine eingeschränkte Aufmerksamkeitsstruktur auf, nur ist diese im Vergleich zu den vermeidend gebundenen Kindern stark auf die Bindungsperson gerichtet, was sich vor allem nach der ersten Trennung von der Mutter und dem Kontakt mit der Fremden bemerkbar macht (vgl. ebd., S. 151). Auch bei kleinen emotionalen Verunsicherungen wird das Bindungssystem unangemessen stark aktiviert, trotz Anwesenheit der Bindungsperson bleibt das Explorationsverhalten daraufhin stark eingeschränkt (vgl. ebd.). Eine Beruhigung durch die Bindungsperson gelingt nur sehr langsam, die Kinder scheinen sich einer solchen auch „trotzig-wütend aber auch verzweifelt“ zu widersetzen (ebd.). Aufgrund des lauten, schnell einsetzenden Bindungsverhaltens sprechen klinische Bindungsforscher von einer „Angstbindung“ (ebd., S. 153), bei der auf der einen Seite der Kontakt mit der Mutter gesucht wird, auf der anderen aber gleichzeitig eine Frustrationserwartung besteht, sodass ein von Ärger durchdrungenes, widersprüchliches Bindungsverhalten entsteht (vgl. Ainsworth et al., 2003, S. 325). Als Erklärung führt Becker-Stoll (2007) eine inkonsistente Feinfühligkeit (s. 2.6.1) aufseiten der Mutter an.
2.5.3 Die desorganisierte Bindung
Bei den nicht-klassifizierbaren Kindern der FS traf damals entweder keine der Klassifikationen zu oder bei Kindern, die sich augenscheinlich sicher verhielten, wurden derartig starke Auffälligkeiten offenbar, dass von einer Bindungssicherheit nicht mehr auszugehen war (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 153). Der Nachweis eines desorganisierten Bindungsmusters (D)’ gelang Main & Soloman 1990 (vgl. Scheuerer-Englisch, 1999, S. 146). Dies geschah ganz im Sinne Ainsworths, war doch das Klassifikationssystem der FS „immer als offen gedacht“, da es unvernünftig schien, dass „zwei kleine Stichproben von Kindern aus anglo-amerikanischen Mittelschichtfamilien aus Baltimore alle Verhaltensmuster umfassen konnten“ (Ainsworth, 2003a, S. 389).
Die vierte Form des Bindungsverhaltens ist insofern von den beschriebenen unsicheren Bindungsmustem abzugrenzen, als dass diese „zur normalen Variabilität von Bindungsbeziehungen zählen“ (Ziegenhain et al., 2004, S. 65), wohingegen das desorganisierte Muster neben einer sicheren oder unsicheren Bindung bestehen kann (vgl. Gahleitner, 2005, S. 54) und keine kategorisch nachvollziehbaren Strukturen aufzeigt. Des Weiteren ist hier eine Stabilität der Verhaltensweisenüber verschiedene Bindungspersonen hinweg beobachtbar, während sich die anderen Muster in der FS - und in diesem Alter des Kindes allgemein - personenspezifisch zeigen (vgl. Grossmann, 2004, S. 37).
In der FS zeigt sich die Desorganisation durch eine Unterbrechung oder Überlagerung der bestehenden Bindungsstrategien mittels bizarrer Verhaltensweisen, wie zum Beispiel (Becker-Stoll, 2007, S. 27):
- Widersprüchliche Verhaltensweisen (Nähe suchen und gleichzeitig vermeiden)
- Anzeichen von Angst vor der Bindungsperson
- Erstarren, Einfrieren von Bewegungen
- Anzeichen von Desorganisation (zielloses Umherwandern)
- Stereotypien (Hin- und Herschaukeln).
Dem desorganisierten Kind gelingt weder die Vermeidung der Bindungsperson, noch das Trostsuchen, teilweise zeigen sich auch Aggressionen gegen die einzig schützende Person in der FS (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 154). Auch kann das Kind anfangen zu weinen, wenn die Fremde den Raum verlässt, während es dies nicht tut, wenn die Mutter verschwindet. Unter Umständen flieht es sogar zur fremden Person (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 157).
Die widersprüchlichen Bewegungsmuster machen nach Köhler (1999) den Eindruck, dass „miteinander nicht vereinbare Verhaltenssysteme“ gleichzeitig aktiviert sind, Ethologen sprechen diesbezüglich von einem „Konfliktverhalten“ (S. 126). Die mitunter tranceartigen Zustände des Kindes werden als „dissoziative Abwehr starker Furcht“ beschrieben (ebd.). Da es sich bei diesen Verhaltensweisen um „Einsprengsel“ mit zehn bis 30 Sekunden Dauer handelt, wird die Kategorie D immer mit demüberwiegenden Verhalten zusammen klassifiziert (ebd., S. 127)
2.5.4 Verteilung
Brisch (1999) zeigt in einer Metaanalyse, dass etwa 50-60% der Kinder der Normalpopulation unseres Kulturkreises ein sicheres Bindungs verhalten zeigen, 30-40% ein unsicher-ambivalentes und 10-20% ein unsicher-vermeidendes (vgl. S. 48). Ein desorganisiertes Bindungsmuster findet sich in Mittelschichtsstichproben bei etwa 1025% der Kleinkinder (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 159). Main (1996) präsentiert eine Häufigkeitsverteilung in der Erwachsenenbevölkerung, die mithilfe des AAi (,Adult Attachment Interview’) erstellt werden konnte, wonach 55% sicher-autonom gebunden sind, 16% unsicher-distanziert, 9% unsicher-verstrickt und 19% unsicherunverarbeitet (vgl. Schleiffer, 2007, S. 49)[6].
Auffällig ist die Verteilung von Bindungsmustern in sogenannten Risikogruppen, wo die Verbreitung desorganisierten Verhaltens bis zu 80% beträgt (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 159). Zulauf-Logoz (2004) gibt einen Überblicküber die Häufigkeit der Desorganisation nach besonderen Merkmalen der jeweiligen Stichprobe (Tabelle 2; vgl. S. 302):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.2 Häufigkeit des desorganisierten Musters nach Risikovariablen
Die Tabelle deutet an, was in Teil B der vorliegenden Arbeit analysiert wird: Die Abhängigkeitsproblematik der Mutter/Eltern kumuliert mehrere Risikofaktoren und schafft so eine bindungstherotisch gesehen besonders ungünstige Umgebung für die Entwicklung des Kindes.
2.6 Sensitivität der Bindungsperson
Für die Entwicklung spezifischer Bindungen an erwachsene Bezugspersonen ist nach Hopf (2005) vor allem die „Qualität der Interaktionen“ mit diesen Personen ausschlaggebend (S. 85). Ainsworth fand in ihren Uganda-Studien, dass sicher gebundene Kinderüber Mütter verfügten, die sensibler und interessierterüber ihre Kinder sprachen, sich insgesamt mehr kümmerten und mehr Freude an der Interaktion sowie am Stillen hatten (vgl. ebd., S. 48).
Besonders in der ersten Phase des Lebens hängen die psychischen Zustände des Nachwuchses von der oder den Bezugspersonen ab. Die „Interaktionen als Reaktionen auf die Bedürfnisse des Kindes beenden oder begrenzen den Mangelzustand“, die Verfassung des Säuglings wird „extern geregelt“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 114). Um dies zu gewährleisten, ist bei der Pflegeperson die Wichtigkeit bestimmter Persönlichkeitsmerkmale zu vermuten, insbesondere die „generelle Fähigkeit und Bereitschaft zum Verstehen anderer Menschen“ (Hopf, 2005, S. 59). Steele (2009) beschreibt diese Eigenschaft mit „mind-mindedness“ (S. 351). Die „Gefühle, Absichten, Handlungs- und Interaktionsabsichten des Säuglings“ müssen ,gelesen’ werden können, wobei die eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungsabsichten gut von denen des Säuglings abgegrenzt und unterschieden werden müssen (ebd.). Das Merkmal einer „hochgradig nicht-sensitive[n]“ Mutter ist es demnach, dass sie sich fast ausschließlich nach ihren eigenen Wünschen, Stimmungen und Aktivitäten richtet (Hopf, 2005, S. 60). Die feinfühligen Mütter nach Ainsworth können durch ihr Verständnis in der Interaktion verständnisvoller reagieren (ebd., S. 48). Die Umsetzung dieses Prinzips verlangt nach Grossmann (2004) „eine hohe geistige Flexibilität und Kompromissbereitschaft der Bindungspersonen“ (S. 32). Entsprechende Verhaltensmuster sind zudem „nicht gleich voll verfügbar“, vielmehr werden sie erlernt, „indem wir mit anderen Babys und Kindern verkehren und von klein auf beobachten, wie sich andere Eltern verhalten und wie unterschiedlich wir und unsere Geschwister von den eigenen Eltern behandelt werden“ (Bowlby, 2008, S. 65).
Um den Umgang von Bindungspersonen mit ihren Kindern messen zu können, entwickelte Ainsworth drei Skalen, die in allen Untersuchungen hohe statistische Zusammenhänge zeigen beziehungsweise eng miteinander verknüpft sind (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 121). Diese sind (vgl. ebd., S. 117):
- Sensitivity versus insensitivity to the baby’s signals and communications
- Cooperation versus interference with her baby’s autonomy
- Acceptance versus rejection of the baby
Im Folgenden sollen die daran angelehnten, bis in die aktuelle Literatur hinein besprochenen Konzepte vorgestellt werden.
2.6.1 Feinfühligkeit und Kooperation
Die Phase der nonverbalen Kommunikation zwischen Mutter und Kind, lange bevor „im Verlauf der Ontogenese beim Kleinkind Intentionen in Form von Motiven, Empathie, bewußtem Erkennen, Wissen und sprachlicher Kommunikation dazukommen“, war und ist in ihrer Bedeutung für die weitere Entwicklung des Individuums bis ins Erwachsenenalter „in der psychologischen Literatur bis in die Gegenwart“ umstritten (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 52). Innerhalb der Bindungstheorie nimmt die mütterliche „Feinfühligkeit gegenüber den Signalen des Kindes“ demgegenüber für die gesamte Ontogenese eine zentrale Stellung ein (ebd.). Angesichts des ^hilflosen’ Säuglings hält Ainsworth bei der Reaktion der Mutter auf die Bedürfnisse des Babys vier Merkmale der Feinfühligkeit für relevant (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 119; vgl. Ruppert, 2008, S. 36):
1. Ein durch große Aufmerksamkeit geprägtes Wahrnehmen des Befindens des Kindes
2. Die richtige Interpretation der Äußerungen des Säuglings, indem seine Perspektive eingenommen wird und nicht die eigenen Bedürfnisse im Vordergrund stehen
3. Eine ,prompte’ Reaktion, die die kurze Frustrationsschwelle des Kindes nichtübersteigt[7]
4. Eine angemessene Reaktion, durch die der Säugling erhält, was er benötigt
Als Beweis für die Angemessenheit dieser Anforderungen an die Bindungsperson zeigte Ainsworth, dass Babys im Laufe des ersten Lebensjahres, entgegen der damals landläufigen Vorstellung, zunehmend weniger weinten, wenn „eine Mutter besonders prompt und einfühlsam auf das Weinen und alle seine Vorstufen reagierte“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 83). Vielmehr entwickelte das Kind „mehr oder weniger differenzierte Laute, mit denen es seine Bedürfnisse verständlich machte, ohne erst schreien zu müssen“ (ebd.). Das Baby wird auf diese Weise nicht verwöhnt, statt dessen unterscheidet sich nach Grossmann & Grossmann (2008) Feinfühligkeit kategorisch von Überbehütung, indem „auf kindliche Bedürfnisse erst dann reagiert wird, wenn das Kind sie äußert“ (S. 121). Eine prompte Reaktion hilft dem Kind, sich als Verursacher der Reaktion erleben zu können. Die Gedächtnisspanne eines Säuglings ist noch sehr kurz und typischerweise zeigen Eltern eine „Reaktionslatenz unterhalb einer Sekunde (200-600 Millisekunden) auf Verhaltenssignale des Säuglings“ (Lohaus et al., 2004, S. 149). Das vom Säugling begreifbare ,Handeln auf ausdrücklichen Wunsch’ der Bezugsperson lässt nicht nur eine sichere Bindung entwickeln, es verhindert zudem eine interpersonale Abhängigkeit. Die Selbständigkeit des Kindes steigt, weil es Nähe und Distanz selbst bestimmen kann (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 83).
Um dem Kind die Möglichkeit der Individuation zu geben, für welche die sichere Bindung letztlich Voraussetzung sein soll, stellt sich feinfühliges Verhalten als eine Balance der Befriedigung der „drei psychischen Grundbedürfnisse nach Bindung, Kompetenz und Autonomie“ dar (Becker-Stoll, 2007, S. 21). Zum einen spielt in diesem Zusammenhang die „Qualität der Beantwortung kindlicher Orientierungen auf Aspekte der Außenwelt“ eine Rolle, da sie das Interesse und die Motivation des Kindes beeinflusst (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 54). Zum anderen sollte das Kind bei dem Wunsch, etwas ,allein zu schaffen’ unterstützt werden, indem ihm Hilfe zuteilwird, ohne, dass ihm alles abgenommen wird (vgl. Schleiffer, 2007, S. 51). In diese Richtung weist auch das ,Konzept der feinfühligen Herausforderung im Spiel’ bei Becker-Stoll (2009), nach dem der erwachsene Spielpartner nicht nur auf die Bindungsbedürfnisse eingeht, sondern ebenso „die Neugier, die Exploration und die Tüchtigkeit des Kindes unterstützt und fördert“, sodass das Kind schließlich deutlich zu erkennen gibt, dass es „das Werk selbst gemacht und so gewollt hat“ (S. 155) .
Die Interessen des Nachwuchses sind auf dialogischer Basis zu achten und in einem kooperativen Modus mit einzubeziehen. Das Kind, welches nach den anthropologischen Vorstellungen auf die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gemeinschaft vorbereitet ist (s. 1.1), muss nicht besonderen Erziehungsmethoden unterworfen werden, um integrationsfähig zu werden (vgl. Grossmann & Grossmann, 2008, S. 125). Kooperative Mütter handeln „eher werbend als eingreifend“ (ebd., S. 122) und haben Kinder, die bezüglich bestimmter Ver- oder Gebote in mehr als 50% der Fälle so handeln, wie die[8]
Mutter es möchte (ebd., S. 124). Dies entspringt einem Modelllerneffekt, der durch den Umgang mit dem Kind erzeugt wird. Anders herum scheint vieles von der Unsicherheit eines eigensinnigen, ambivalenten oder fordernden Babys „mit der Tatsache zusammenzuhängen, daß das Verhalten seiner Mutter unvorhersehbar ist“ (Ainsworth et al., 2003, S. 274).
Unterbricht eine Mutter ihr „aktives, erregtes oder waches Kind“, weil es ,Zeit fürs Bett’ ist, handelt sie beeinträchtigend (Ainsworth, 2003e, S. 426f). Leitet sie hingegen sanfte Spiele ein oder hält und wiegt das Kind, damit es in eine Stimmung kommt, in der es das Schlafengehen akzeptieren kann, verhält sie sich kooperativ (ebd. S. 427). Zu einem besonders hohen Skalenwert auf der entsprechenden Skala gehört es auch, die Umwelt des Kindes und den eigenen Arbeitsablauf so einzurichten, dass ein Eingreifen oder ein Ausüben direkter Kontrolleüber das Kind selten notwendig werden (ebd.)[9].
2.6.2 Kommunikation
Niemand kommt mit der Fähigkeit auf die Welt, emotionale Reaktionen selbständig zu regulieren. Wenn die Bezugsperson jedoch Signale versteht und beantwortet, geschieht diesüber das sich entwickelnde dyadische Regulationssystem (Fonagy et al., 2004, S. 45). Das Kind kann dabei nur wahrnehmen, was die Mutter fähig ist, in ihm zu sehen. Sie vollzieht demnach eine unter Umständen folgenschwere Selektion, indem im negativen Fall „noch gar nicht richtig ausgebildete Anteile der weiteren Kommunikation entzogen und damit abgespalten“ oder dem Kind „fälschlich von der Mutter projizierte Persönlichkeitsmerkmale attribuiert“ werden (Bowlby, 2008, S. 108). Unbelastete Eltern hingegen „vereinfachen und verdeutlichen ihre Mimik, Gestik und Sprachweise im Zwiegespräch mit ihrem Säugling, ahmen die Mimik ihres Kindesübertrieben nach, sie beruhigen mit sanfter Stimme ihr aufgeregtes Kind, erkennen an der Handhaltung ihres Säuglings, ob er wach oder müde ist, und sie unterstützen den Blickkontakt“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 118). Um Systeme in Harmonie zusammenarbeiten zu lassen, muss zwischen ihnen „effektive Kommunikation“ bestehen, und dies gilt nach Bowlby (1991) für nichts mehr als die „Dyade von Kind und Eltemteil“ (S. 403).
Ein Prozess, der innerhalb dieses Austausches zum Tragen kommt, ist das ,social referencing’. Hierbei erkennt das Kleinkind, etwa mit Beginn des zweiten Lebensjahres, am Ausdruck und an der Reaktion einer Bindungsperson, wie sein eigenes Verhalten beurteilt wird, und ist darüber in der Lage, es einzuschätzen (vgl. Grossmann & Grossmann, 2007, S. 158) und sich darüber normativ lenken zu lassen (vgl. Hopf, 2005, S. 129). Eine weitere Elternaktivität ist das Spiegeln des kindlichen Affektes im sogenannten ,affect attunement’. Ziel ist jedoch keine perfekte Übereinstimmung (,perfect attunement’; vgl. Schore, 2009, S. 27), vielmehr wird der Affekt in einer „etwas veränderten Form“ widergegeben, um ihn erträglicher für das Kind zu machen (Schleiffer, 2007, S. 181). Sinn ist es, das Baby aus einer negativen Stimmung heraus zu holen und sich darüber hinaus gegenseitig wieder in Einklang zu bringen (,interactive repair’; vgl. Schore, 2009, S. 27). Eine exakte Wiedergabe des aufgenommenen Affektes durch die Bindungsperson kann demgegenüber ihrerseits zur Angstquelle werden und damit den nützlichen Symbolcharakter verlieren (vgl. Fonagy et al., 2004, S. 43). Die sich entwickelnde Fähigkeit zur Affektregulation ergibt sich aus dem ,Hinweis’ für das Kind, wie es „bei nächster Gelegenheit selbständig diese negativen Affekte erfolgreich verarbeiten kann“ (Schleiffer, 2007, S. 182). Fonagy et al. (2004) empfehlen, Affekte einfließen zu lassen, die mit der aktuellen Situation des Säuglings unvereinbar sind, zum Beispiel ein „foppendes Mienenspiel“ (S. 44).
Des Weiteren entwickelt das Kind in der Auseinandersetzung mit den Bezugspersonen eine ,Theory of Mind’, eine Vorstellung vom eigenen Geist, die es später auf das Innenleben anderer Personenübertragen kann. Es bekommt mit, wie die Eltern ihm „die Existenz eines eigenen, separat funktionierenden psychischen Systems“ unterstellen und lässt sich mit der Zeit von der Angemessenheit einer solchen Unterstellungüberzeugen“ (Schleiffer, 2007, S. 182). Das Bild, welches seine Eltern von ihm haben,übernimmt es als Kern seines Selbstkonzeptes (ebd.).
Die Möglichkeit der sprachlichen Verständigung erlangt ebenfalls bereits während der Säuglingszeit Bedeutung. Wie ein Elternteil zum Kind spricht, und damit sind die Inhalte, nicht die Intonation gemeint, ist „prädiktiv wichtig für die weitere Entwicklung“ (Downing, 2003, S. 56). Bei einer Analyse der sprachlichen Interaktion konnte festgestellt werden, dass eine sichere Bindung vorhersagbar war, wenn die Mutter die affektiven Zustände ihres Säuglings angemessen verbalisieren konnte (vgl. Brisch, 1999, S. 224). Die Gelegenheit,über mentale Zustände zu sprechen, scheint nach FONAGY ET AL. (2004) die Mentalisierungsfähigkeit des Kindes in Experimental-
[...]
[1] Der Unterschied, der hier zwischen ,Alkohol’ und ,Drogen’ gemacht wird, bezieht sich auf die Illegalität der letzteren Suchtstoffe. Es besteht kein Grund dafür, an der enormen Schädlichkeit der ersteren Substanz zu zweifeln.
[2] Ursprünglich dachte Bowlby (1969) an den Schutz vor Raubtieren, die heutige Soziobiologie betont eher „den Schutz vor anderen Mitgliedern derselben Spezies, die aus Konkurrenzgründen am Überleben fremden Erbguts nicht interessiert sind, weil der fremde Nachwuchs das Überleben des eigenen Nachwuchses erschwert oder gefährdet“ (Grossmann & Grossmann, 2008, S. 68).
[3] Ab dem dritten bis vierten Lebensmonat (vgl. Ziegenhain et al., 2004, S. 109)
[4] Oder an die entsprechende primäre Bezugsperson
[5] Ein Zustand, der durch die Ideologie auch in der Neo-Analyse stabil zu bleiben scheint.
[6] Die Begriffe für die Bindungsrepräsentationen des AAI lassen sich zu den Bindungsmustern der FS wie folgtübersetzen: sicher-autonom = sicher, unsicher-distanziert = unsicher-vermeidend, unsicher-verstrickt = unsicher-ambivalent, unverarbeitet = desorganisiert.
[7] Es sei denn, „no response is the most appropriate under the circumstances” (Ainsworth et al., 1978; zit.n. Hopf, 2005, S. 58).
[8] Explorative Herausforderungen zu unterstützen obliegt nach der Bindungstheorie im Allgemeinen der Rolle des Vaters.
[9] Vgl. die hierzu passenden ,antipädagogischen’ Ausführungen in Ekkehard von Braunmühls „Zeit für Kinder“ (1978).
- Arbeit zitieren
- Christian Pönsch (Autor:in), 2010, Suchtkranke Eltern und Bindungsentwicklung der Kinder: Vom Durchbrechen transgenerationaler Verflechtungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/199760
Kostenlos Autor werden













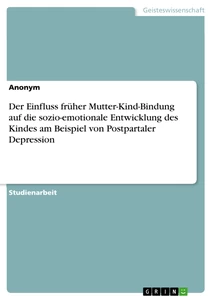






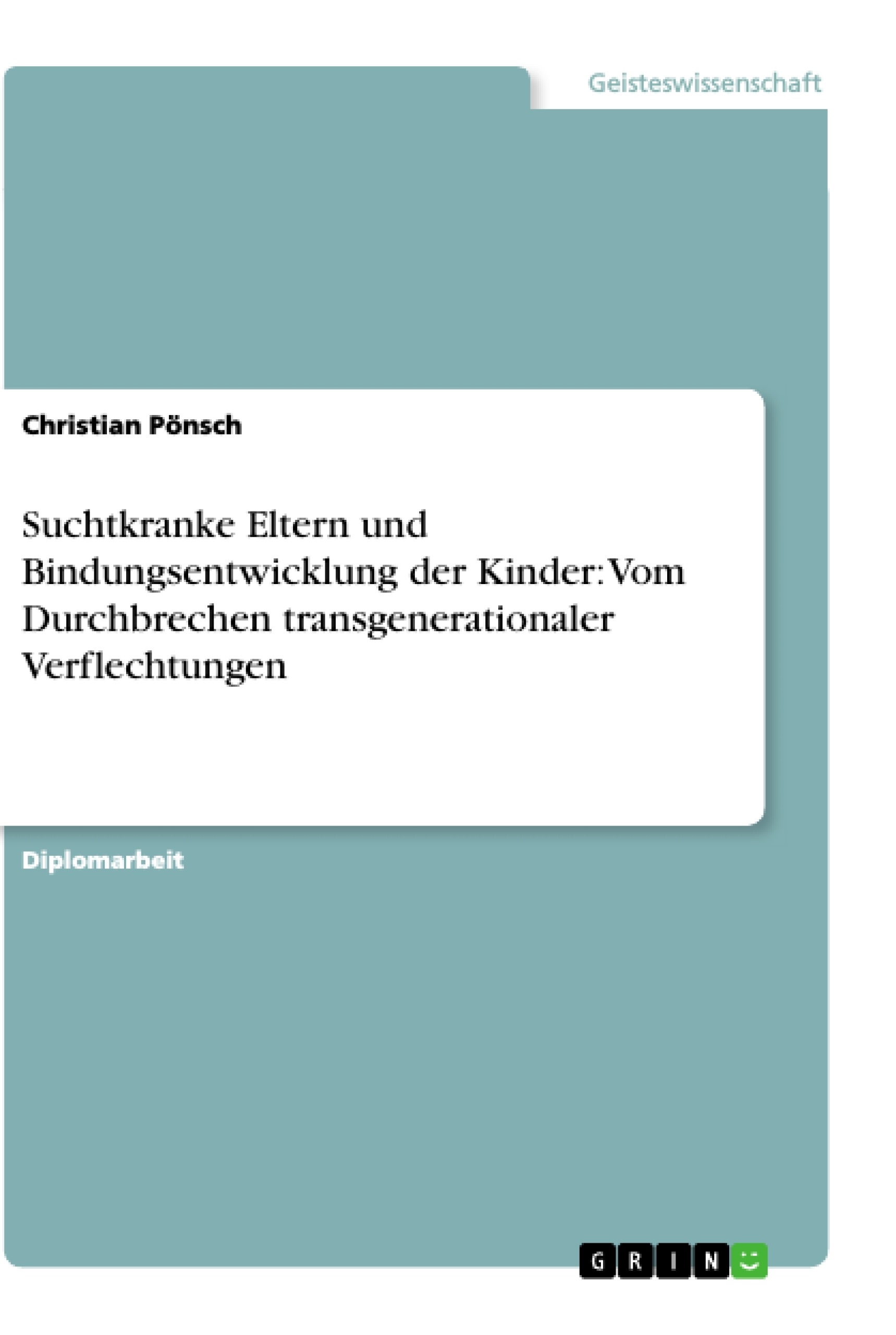

Kommentare