Leseprobe
Inhalt
1 Einleitung
2 Wann ist der Mann ein Mann? – Definitionen von Männlichkeit
2.1 Soziologische Ansätze
2.2 Klaus Theweleit: Männerphantasien
2.3 Geschichtswissenschaftliche Annäherungen
3 Erster Weltkrieg
3.1 Walter Flex: Der Wanderer zwischen beiden Welten
3.1.1 Der Führer Ernst Wurche – eine synthetisierte Trinität des Wanderns
3.1.2 Gebetsmühlen: Unschuldige Reinheit und homoerotische Freundschaft
3.1.3 Grablege und Wiederkehr des Flammenengels
3.2 Ernst Jüngers Frühwerk
3.2.1 Vater Krieg und die männliche Form der Zeugung
3.2.2 Anleihen bei Nietzsche
3.2.3 Konflikt des Kämpfers mit dem Schriftsteller: Schreiben vom Krieg
3.2.4 Eros als Kontrast
3.2.5 Sturm als Revision?
3.3 Erich Maria Remarque: Im Westen nichts Neues und Der Weg zurück
3.3.1 Die Ich- und Wir-Erzähler der verlorenen Generation: Bäumer und Birkholz
3.3.2 Küchendragoner zur Triebabfuhr
3.3.3 Kameradschaft als Solidaritäts- und Totengemeinschaft
4 Zweiter Weltkrieg
4.1 Heinrich Böll: Wo warst du, Adam?
4.1.1 Orden für einen Scheißkrieg
4.1.2 Liebe für Augenblicke unter Wölfen
4.1.3 Sinnlos, dachte er, wie vollkommen sinnlos
4.2 Alfred Andersch: Die Kirschen der Freiheit
4.2.1 Ein Vater-Sohn-Konflikt durch Zeit und Raum
4.2.2 Außenseitertum in NS-Staat und Wehrmacht
4.2.3 Der Deserteur in der Wüste und unter dem früchtetragenden Baum
4.3 Franz Fühmann: Kameraden
4.3.1 Anmerkungen zu Inhalt, Genese und Rezeption von Kameraden
4.3.2 Das Triumvirat der Kameraden
4.3.3 Richtende Väter und Übertretungen des Rechts
4.3.4 Verletzungen und Tod als unentrinnbarer Ausgang
5 Schlussbetrachtung
Bibliographie
1. Quellen
1.1 Untersuchte Primärtexte
1.2 Weitere herangezogene Texte
2. Darstellungen
2.1 Motivgeschichtliche, literatur- und kulturwissenschaftliche Studien
2.2 Geschichtswissenschaftliche, soziologische und philosophische Abhand-lungen
Anhang
Siglenverzeichnis
1 Einleitung
Diese motivgeschichtliche Analyse vergleicht Männlichkeitsentwürfe in der Literatur zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die Hauptthese lautet, dass zentrale literarische Motive, die Männlichkeit in Werken zum Ersten Weltkrieg konstruieren, auch in der Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg aufgegriffen werden.
Die ausgewählten Texte aus der Zeitperiode Erster Weltkrieg können entweder als Kriegs- oder als Antikriegsliteratur interpretiert werden. Die Texte aus der Zeit nach 1945 gelten durchweg als Antikriegsliteratur, da sie eine unterstützende Position des vergangenen Angriffs- und Vernichtungskrieges nicht mehr zulassen. Welchem Wandel sind die literarischen Motive unterworfen, so dass sie auch nach diesem Bewertungswechsel wieder Eingang in die Literatur finden? Handelt es sich dabei um eine innovative Strategie der Autoren?
Ein ganzer Komplex von Motiven dient der Inszenierung männlicher Identitäten. Der einsame Soldat auf Wacht, der charismatische (An)Führer oder der sich aufopfernde Held zählen dazu. Die sozialen Beziehungen des Mannes lassen sich in unterschiedlichen Varianten thematisieren: Wird Sexualität exzessiv praktiziert oder verdrängt in anderer Form ausgelebt? Wie fügt sich der Mann in eine Gemeinschaft, hier besonders die Kameradschaft und Hierarchie unter Soldaten, ein?
Im ersten theoretischen Großkapitel dieser Arbeit werden die für die Themenstellung wichtigsten Ansätze aus der Soziologie, der Geschichtswissenschaft und Klaus Theweleits zweibändige Arbeit „Männerphantasien“ in ihren Grundzügen vorgestellt. Die grundlegenden Gemeinsamkeiten dieser diversen Perspektiven auf die Konstruktion von Männlichkeit liegen in ihrer Fokussierung auf den Gegensatz vom Mann zur Frau und die „Medien“ der Männlichkeit, von der Gewalt oder Sexualität im weiteren Verständnis bis zur Literatur im eingeengten Sinne des Begriffs.
Alle für den empirischen Teil ausgewählten Texte zählen zur epischen Prosa, bieten aber als Novelle, Roman, Bericht, Erzählung oder Essay eine gewisse Bandbreite der Gattungen. Eine uneinheitliche Benennung in der Sekundärliteratur kommt in einigen Fällen noch dazu. Für den ersten Weltkrieg wird als erster Vertreter der affirmativen Kriegliteratur die novellenhafte Erzählung „Der Wanderer zwischen beiden Welten“ von Walter Flex betrachtet. Aus dem Frühwerk von Ernst Jünger werden sein aus den Kriegstagebüchern entstandener Erstling „In Stahlgewittern“ und der eher abstrahierende Essay „Der Kampf als inneres Erlebnis“ untersucht. In seiner kurzen, aber pointierteren Erzählung „Sturm“ reflektiert Jünger das Kriegsgeschehen, indem er die letzten beiden Lebenstage eines ihm nachempfundenen Zugführers präsentiert.
Gewissermaßen einen Wendepunkt mit einer pazifistischen, kriegskritischen Literatur markieren Erich Maria Remarques bekanntester Roman „Im Westen nichts Neues“ und dessen weniger bekannte Fortsetzung „Der Weg zurück“. Aus der Zeitperiode zum Zweiten Weltkrieg werden Heinrich Bölls Roman „Wo warst du, Adam?“, Alfred Anderschs „Bericht“ „Die Kirschen der Freiheit“ und als Vertreter für die DDR Franz Fühmanns Novelle „Kameraden“ analysiert.
Bis auf Flex’ „Der Wanderer zwischen beiden Welten“ entstammen alle Texte aus Nachkriegszeiten – entweder der Weimarer Republik oder aus der Zeit nach der Gründung des west- und des ostdeutschen Staates. Auf Texte aus der Zeit des Nationalsozialismus nach 1933 oder dem Kriegsbeginn von 1939 wird verzichtet. In einem Längsschnitt soll den Kontinuitäten oder Widersprüchen dieser beiden Zeiträume nachgegangen werden, so wie Thorsten Bartz in seinem Vergleich eines Querschnitts nationalistischer und sozialistischer Romane zu dem Befund kam, dass „zwischen den – sich zu politisch unterschiedlichen Lagern bekennenden – Autoren und ihren Werken vielmehr motivische und thematische Überschneidungen und auch gemeinsame Beurteilungen hinsichtlich Wesen und Wirkung des Krieges[ existieren], was in der Literaturwissenschaft im Rahmen einer Kategorisierung in Anti- und Prokriegsliteratur kaum berücksichtigt worden ist.“[1]
Die Motivanalyse der ausgewählten Primärtexte soll anhand von folgenden thematischen Kategorien durchgeführt werden:
1. Führer-, Helden- und Vaterfiguren
2. Kameradschaft als Hierarchie oder Unterstützungsgemeinschaft
3. Kampf gegen menschliche Gegner oder übermenschliche Gewalten
4. Gelebte oder unterdrückte Sexualität
5. Passive oder aktive Beschäftigung mit Kunst, besonders der Literatur
6. Bewertung vom (Un)Sinn des Krieges – Vom Kriegsfreiwilligen zum Deserteur
7. Schuld und Verbrechen
8. Sterben und Tod
Diese Kategorien sind weder trennscharf noch universell. Einerseits sind die Grenzen zwischen ihnen fließend. Für einen Soldaten bedeutet ein Kampf auch immer eine Konfrontation mit dem Tod. Andererseits lassen die Primärtexte nur eine unterschiedliche Anwendung der Kategorien auf literarische Motive zu. In Remarques „Im Westen nichts Neues“ ist die Vaterfigur Katczinsky ein grundlegender Bestandteil der Kameradschaft als Überlebenschance. Bei Andersch verbindet sich der Tod des im Ersten Weltkrieg versehrten Vaters mit der Emanzipation von dessen bürgerlichen Werten des lutherischen Glaubens und nationalen Patriotismus.
Die männliche Vorherrschaft lässt sich an der Gleichsetzung von Mann und Mensch in verschiedenen Kulturen und Sprachen ablesen. Sven Glawion und Andere stellen die These auf, dass mittels literarischer Inszenierungen „über Erlöserfiguren hegemoniale männliche Identität diskursiv her[ge]stellt“[2] wird. Gemäß diesem performativen Ansatz erkennen die westlichen Kulturen vorrangig Jesus Christus als Erlöser an, der eine vorbildhafte Funktion ausübt und damit auch zu seiner Nachahmung (imitatio christi) einlädt.
Zu den Folgen der Französischen Revolution gehörte auch ein international durchdringender Wandel des Soldatentums. Söldnerarmeen wandelten sich in Volksheere, die ihre Nation verteidigten. Das Militär verstand sich als die Institution („Schule der Nation“) schlechthin, in der die männlichen Tugenden erlernt und unter Beweis gestellt wurden. Die Kameradschaft schweißt die Truppe zusammen, in der der Einzelne als ein Teil der ganzen Maschinerie zu funktionieren hat. So muss er Gehorsam leisten nach oben, aber auch als ein Erwählter die Befehlsgewalt nach unten ausüben.
Als männlich gilt somit nicht nur das Erdulden von Leid in Opferposition, sondern der Mann steht auch vor der Aufgabe, sich öffentlich zu bewähren – häufig entgegen dem Gebot christlicher Friedfertigkeit im Kampf. Klaus Theweleits „Männerphantasien“, eine psychoanalytisch angelegte Untersuchung der Selbstzeugnisse deutscher Freikorpskämpfer, gilt als ein Startpunkt der deutschen Männlichkeitsforschung. Theweleit wagte einen Blick auf die Identität des „soldatischen Manns“ unter Berücksichtigung von Sexualität, Geschlechterverhältnis und Gewalt.
George Mosse spricht in seinem Beitrag zur „Konstruktion der modernen Männlichkeit“ von einem „normativen Stereotyp“, der sich parallel zur bürgerlichen Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts ausbildete. Dessen verinnerlichten Tugenden wie Willenskraft, Ehre oder Mut gehen einher mit der äußeren Gestalt eines starken Körpers und bilden als „perfektes Konstrukt“ eine Einheit. Das Konzept der Maskulinität formiert sich ebenso durch seine Abgrenzungen von unmännlichen „Antitypen“ und dem anderen Geschlecht.[3] Männlichkeit lässt sich demnach sowohl im positiven als auch im negativen Sinn definieren.
Walter Erharts neuerer Ansatz kritisiert die Vorgehensweise von Theweleit und Mosse und fordert „Abstand zu nehmen von der immer noch sehr verbreiteten Auffassung, das Phänomen der Männlichkeit ließe sich mit der Aufzählung und historischen Analyse von sattsam bekannten Stereotypen des ,Männlichen’ hinreichend erfassen.“[4] Für Erhart erhebt sich der „soldatische Mann“ bei Theweleit als monolithischer, feldgrauer Block – wie eine Breker-Statue, die so statisch ist, dass an ihr nur wissenschaftliche Zirkelschlüsse gelingen können.
Bei seiner Untersuchung von Familienromanen des 19. Jahrhunderts will Erhart „verborgenen narrativen Strukturen folgen“, um „ein narratives und literarisches Grundmuster, mit dem moderne Männlichkeit buchstäblich in Szene gesetzt wird und dabei stets zur kulturellen Nachahmung auffordert“, zu Tage fördern.[5] Wenn Erhart statt Männerbildern also männliche Erzählungen im Sinne performativer Akte als geeigneter ansieht, erscheint der „normative Stereotyp“ damit nur dynamisch aufgehübscht. Trotz dieser differierenden Begrifflichkeit kann das nicht bedeuten, dass literarische Motive, die Männlichkeit konstruieren, für den vorgesehenen Untersuchungszeitraum als nicht mehr wissenschaftlich beachtungsfähig abgestempelt werden. Besonders dann nicht, wenn sie einem vorausgesetzten Wandel unterliegen.
2 Wann ist der Mann ein Mann? – Definitionen von Männlichkeit
Wann ist der Mann ein Mann? Der Refrain aus dem von Herbert Grönemeyer interpretierten „Männersong“ wird nicht von ungefähr in der deutschsprachigen Männerforschung – egal ob von literaturwissenschaftlicher, psychologischer, soziologischer oder anderer Provenienz – gerne in einer Einleitung zitiert. Dahinter steht der Versuch, für die Gleichung „Mann ist gleich x“ den möglichen Inhalt der Variable zu erfassen. So klingt gleichzeitig die Reihung der männlichen Stereotypen und Inszenierungen (führen Kriege, sind schon als Baby blau, rauchen Pfeife) dieses populären Songs an.
2.1 Soziologische Ansätze
„Die männliche Herrschaft“, wie sie im kultursoziologischen Ansatz von Pierre Bourdieu interpretiert wird, konstruiere sich aus den Schemata des Habitus, in dem das bipolare Verhältnis von Mann und Frau im Patriarchat eingeschrieben ist. Bourdieu versteht unter dem soziologischen Begriff des Habitus ein im Individuum angesiedeltes „System von Dispositionen, unbewussten Denk-, Wahrnehmungs- u[nd] Handlungsmustern“[6]. Diese Vorstellung eines männlichen Primats, das sich selbst reproduziert, ist wegen seiner Selbstreferenz („Es ist, weil es so ist.“) zu hinterfragen, weil bei Bourdieu die Entstehung der Geschlechterdifferenz in den gesellschaftlichen Strukturen als vorhistorisch gegeben erscheint und auch Formen eines Matriarchats in seiner Theorie ausgeblendet werden. Dennoch fußt die Theorie Bourdieus auf der historisch allgemein anerkannten Annahme, die den Mann vor allem dem Menschen gleichsetzt: „Der Mann (vir) ist ein besonders Wesen, das sich als allgemeines Wesen (homo) erlebt, das faktisch und rechtlich das Monopol auf das Menschliche, d.h. das Allgemeine, hat; das gesellschaftlich autorisiert ist, sich als Träger des menschlichen Daseins schlechthin zu fühlen.“[7]
Diese „herrschende Sichtweise der Geschlechtertrennung“[8] ist für Bourdieu in allem greifbar, was den Menschen materiell oder immateriell umgibt, seien es „technische Gegenstände oder Praktiken“, beispielsweise die innere Gestaltung des Hauses, sowie Diskurse, Redensarten oder Lieder. Da auch die Beherrschten, in diesem Fall die Frauen, auf alle Sachverhalte der Welt diese „nicht reflektierte[n] Denkschemata“[9], in die die Machtbeziehungen „inkorporiert“ seien, anwenden, würden diese unbewusst den Herrschaftsstrukturen ihre Zustimmung geben. Selbst die Körper von Mann oder Frau werden von der Gemeinschaft „als vergeschlechtlichte Wirklichkeit“ und „Speicher von vergeschlechtlichenden Wahrnehmungs- und Bewertungskategorien“ betrachtet, die „auf den Körper in seiner biologischen Realität angewendet werden.“[10] Was für den Körper als Ganzes gelte, gelte auch ganz besonders für die Geschlechtsteile, die dafür prädestiniert seien, die beiden Geschlechter und ihren gegenseitigen Verweis aufeinander symbolisch zu repräsentieren. Die Vormachtstellung des Mannes sei dabei willkürlich auf eine „androzentrische[…] Vorstellung von der biologischen und sozialen Reproduktion“[11] gegründet. Bourdieu stützt sich in seinem Aufsatz zwar auf eigene Beobachtungen von einer ethnologischen Expedition zu dem Berbervolk der Kabylen, allerdings werde auch der Geschlechtsakt als der einprägsamste Vorgang, an dem der Geschlechtsunterschied aufgezeigt werden kann, in zahlreichen Kulturen als männlich dominiert konstruiert.[12] Als Beispiele nennt er Bilder von „Pflugschar und Furche“ oder „Himmel und Erde“, die negative Bewertung der weiblichen Vagina als umgekehrter Phallus oder das weit verbreitete Verbot von Geschlechtsverkehr, bei dem die Frau die obere Position einnimmt.
Der Anspruch auf die männliche Vorherrschaft sei aber nicht nur ein Privileg, sondern auch eine aufgezwungene Last, die nicht nur Gewaltanwendung legitimiere, sondern auch einfordere:[13] „Die Männlichkeit […] als Bereitschaft zum Kampf und zur Ausübung von Gewalt (namentlich bei der Rache), ist vor allem eine Bürde.“[14] Frauen könnten ihre Ehre in Form jungfräulicher Keuschheit und ehelicher Treue nur verlieren. Männer müssen sich öffentlich vor ihren Geschlechtsgenossen beweisen und ihre Ehre erst erwerben – oder in der Angst leben, als Versager ausgeschlossen zu werden. Was im Jugendalter bei Dumme-Jungen-Streichen als Mutprobe beginnt, kann sich über den gemeinsamen Bordellbesuch, wie er bei Soldaten durchaus üblich war und ist, bis zu Vergewaltigungs- und Tötungsorgien radikal steigern.
Der Versuch, Männlichkeit über eine Variable x zu definieren, ist gemäß der Theorie des Soziologen Robert W. Connell zum Scheitern verurteilt, weil man Männlichkeit nicht als ein „isoliertes Objekt“[15] betrachten könne. Sigmund Freud habe eingestanden, dass die Zuschreibung von Aktivität für das männliche Geschlecht und die weibliche Passivität als ihr Gegenstück das Gesamtbild zu sehr vereinfachen. Normative Definitionen von der männlichen Härte, die Schauspieler wie Humphrey Bogart oder John Wayne gezeigt hätten, führen zu dem Eingeständnis, dass viele Männer des realen, täglichen Lebens als unmännlich durchfallen würden. Die Relationalität der Geschlechter ist für Connell der Schlüssel, wenn er fordert, „unsere Aufmerksamkeit auf die Prozesse und Beziehungen [zu] richten, die Männer und Frauen ein vergeschlechtliches Leben führen lassen.“[16] Was das jeweilige soziale Geschlecht ausmache, lasse sich in einem mindestens dreistufigen Modell erklären, das die Macht- und Produktionsbeziehungen sowie die emotionale Bindungsstruktur zwischen Mann und Frau darstelle.[17] Für die westlichen Gesellschaften dominiere der Mann diese Beziehungen, obwohl seit dem Zweiten Weltkrieg das Patriarchat in eine Krise geraten sei, wenn Frauen rechtlich und ökonomisch unabhängiger geworden sind oder über ihren Körper sexuell selbst bestimmen können. Gegen die von Connell postulierte Notwendigkeit der drei Stufen in diesem Modell lässt sich sicherlich einwenden, dass diese Dimensionen immer noch reduzierbar sind. Dass Männer die Produktionsbeziehungen beherrschen, wenn sie die besser bezahlten, prestige- und einflussreicheren Positionen in Unternehmenshierarchien einnehmen, lässt sich pointierter betrachtet auch auf die männliche Dominanz in den Machtbeziehungen zurückführen. Connells Theorie bietet allerdings mehr als die intersexuelle Relationalität der Geschlechter. Verschiedene Formen von Männlichkeit stehen auch in einem intrasexuellen Beziehungsgeflecht zueinander: Hegemonie, Unterordnung, Komplizenschaft und Marginalisierung.[18]
„Hegemoniale Männlichkeit“ sei eine historisch bewegliche Relation und könne „man als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis definieren, welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder gewährleisten soll).“[19] Drei korporative Führungsebenen – Wirtschaft, Politik und eben auch das Militär – inszenierten in überzeugender Form dieses Konzept von Männlichkeit durch einen Anspruch auf Autorität.
Bestimmte Gruppen von Männern sähen sich einem Zwang zur „Unterordnung“ ausgesetzt. Für die westliche Welt seien das homosexuelle Männer, die von heterosexuellen Männern dominiert werden. Aber auch Andere, die eher eine „symbolische Nähe zum Weiblichen“ offenbaren, fallen darunter. Connell nennt eine ganze Liste von passenden Schimpfwörtern wie „Schwächling, Schlappschwanz, Muttersöhnchen, Waschlappen, Feigling, Hosenscheißer […].“[20] Unter die dritte Kategorie „Komplizenschaft“ fallen die Teilhaber an der „patriarchalen Dividende“, die nicht dem Ideal der Hegemonie entsprechen, diese in der Demokratie aber mit ihrer Zustimmung legitimieren. Als Beispiel gilt ein Footballfan, der die Spiele am heimischen Fernseher betrachtet, aber nicht selbst auf das Feld zieht, seine Frau achtet und sich sogar an der Hausarbeit beteiligt. Die vierte Beziehungsvariante „Marginalisierung“ betrifft untergeordnete Klassen oder ethnische Gruppen. Vorbild ist die Lage der schwarzen Bevölkerung in den USA. Ein erfolgreicher Sportler mit dunkler Hautfarbe kann, sofern eine „Ermächtigung“ von oben vorliegt, zwar als Muster für hegemoniale Männlichkeit gelten. Allerdings bedeutet das nicht, dass die Gesamtheit aller Schwarzen in den USA dadurch aufgewertet würde.
Die grundlegenden Parallelen bei Bourdieu und Connell liegen auf der Hand. Männlichkeit lässt sich nur in Relation zur Weiblichkeit erfassen und bedarf einer öffentlichen Zurschaustellung vor anderen Männern. Für unsere motivgeschichtliche Untersuchung des Mannes als Soldat ist es darüber hinaus wichtig, welche Funktion der Gewalt zugeschrieben wird. Es ist nicht zwingend notwendig, dass ein Mann sich der Gewalt im Kampf oder der Sexualität bedient, um seine Ziele durchzusetzen und eine männliche Identität zu inszenieren. Dennoch bringt es Vorteile mit sich, auf die eindrucksvollsten Handlungsskripte und Requisiten zuzugreifen, um in Rangordnungen höhere Positionen einzunehmen und als ganzer Kerl anerkannt zu werden.
2.2 Klaus Theweleit: Männerphantasien
Der Gegensatz von Mann und Frau ist in ausnehmendem Maß das Thema im ersten Band „Frauen, Fluten, Körper, Geschichte“ von Klaus Theweleits Klassiker der Männlichkeitsforschung „Männerphantasien“. Die psychoanalytische Deutung der Erinnerungsliteratur deutscher Freikorpskämpfer nimmt damit politisch-militärische Akteure in den Blick, die – wie wir noch an weiteren Stellen sehen werden – das ideologische Erbe des Ersten Weltkriegs für sich in Anspruch nahmen sowie als Väter eines neuen Deutschlands im Dritten Reich entweder gelten wollten oder als solche von der NS-Bewegung dargestellt wurden. Theweleits vielzitierte Hauptthese besagt, dass diese im Grunde schwache Männlichkeit sich einen stark abgegrenzten „Körperpanzer“ als psychische Abwehrreaktion gegen die fließende, bedrohliche Weiblichkeit angelegt hätte.
Die Art und Weise, wie diese Männer geschrieben hätten, charakterisiert Theweleit als imperialistische „Besatzungssprache“ gegen „jede Art selbstständiger lebendiger Bewegung“ und somit auch in „Abwehr/Angriffstellung“ gegen die Frau: „Die Emotionalität, die sexuelle Intensität, die von Frauen ausgeht, scheint prinzipiell unerträglich und in ihrem Wesen dieser Sprache nicht zugänglich zu sein.“[21] Die Existenz und geschweige denn die Bedürfnisse der weiblichen Partnerin als Verlobte oder Ehefrau sind daher in den Biographien der soldatischen Männer nicht von Belang. Anders als die Orte, an denen sie stationiert waren, oder die Kommandanten, denen sie unterstellt waren. Sprache und Umgangsformen der Militärs sind kongruent in ihrer Beschränktheit, die gemäß Freud als Auswüchse der Kastrationsangst interpretiert werden: „Dies ewig gestelzte, unterkühlte, formelle Gehabe, die Umständlichkeit, die steife Distanz auch der ,guten’ Frau gegenüber könnte man als Ausdruck des Versuchs der Kastrationsabwehr ansehen.“[22]
Den Dualismus Frau-Mann formuliert Theweleit bereits in den Männerphantasien, aber auch in späteren Arbeiten, als die Dichotomie von Mutterschaft als „einzige partiell weibliche Institution“[23] und männlicher Zerstörungswut in Folge des Gebärneids. Da es dem Mann physiologisch unmöglich ist, lebendige Nachkommen auf die Welt zu bringen, kompensiere er dies mit Werken, die wie die Atombombe die Vernichtung bringen, oder mit der direkten Zerstörung wie der Folter. Der Mannkörper nimmt die Energie dazu „aus anderen Körpern. Im Kern besteht seine Geburt in der Tötung anderer.“[24] Theweleit bezeichnet dies auch als zur Frau gegenteilige „Anti-Produktion“, als „Abbau von Leben“.[25]
Der Akt der Tötung führe zur „Auflösung der Personengrenzen“ beim „Objekt“ als „blutiger Masse“ und beim Subjekt, das in einen „Trancezustand“ gerät.[26] So sei das Ergebnis des physischen Angriffs nicht nur dem zu Tode Gefolterten naturgemäß nicht mehr begreiflich, sondern auch dem Folterknecht, der aufgehe in seinem Wachstum zu einem „Körper einer männlichen Gewaltinstitution“.[27] Der Männerbund als Institution schafft wiederum erst die Grundlage zu diesem Vorgehen, oder besser Vergehen, als einer „ erlaubten Übertretung “,[28] die meist in der Gruppe gegen Unterlegene (auch Theweleit nennt als Beispiele Massenvergewaltigungen und schwere Verstümmelungen in Verbindung mit sexuellen Übergriffen) durchgeführt werden.
Die Vernichtung von Leben als strukturelles Merkmal des Faschismus beeinflusst für Theweleit das Verhältnis von Mann und Frau und ihre jeweilige Sexualität. Sexualität ließe sich nicht so einfach, wie Freud es getan hätte, in eine spezifisch männliche und eine spezifisch weibliche Form unterscheiden. Theweleit entgegnet Freud mit Anklängen des Pansexualismusvorwurfs: „Das Verhältnis der Geschlechter zueinander ist gesellschaftlich organisiert, kontrolliert, Gegenstand von Gesetzen. Es ist nicht einfach ,sexuell’.“[29] Der Geschlechtsunterschied ist für Theweleit stärker von den sozialen Strukturen seit Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft geprägt, analog zu den oben genannten „Macht- und Produktionsbeziehungen“ bei Connell: „Wenn aber das mann/weibliche Produktionsverhältnis im Patriarchat ein Unterdrückungsverhältnis ist, dann ist es angebracht, die in ihm wirkende und erzeugte Sexualität als die Sexualität des Unterdrückers und der Unterdrückten zu begreifen.“[30]
Wie der „Körperpanzer“ des „soldatischen Mannes“ in der Kadettenanstalt oder der militärischen Grundausbildung zu Ende geschmiedet wird, behandelt Theweleit im zweiten Band „Männerkörper – zur Psychoanalyse des Weißen Terrors“. Der Mann wird durch den ausgeübten Drill zum Teil der sich selbst reproduzierenden „Maschine Truppe“. Der Drill sei eine „riesige Verwandlungs-, eine Wiedergeburtsmaschine.“[31] Sie produziere einen „Ausdruck; den von Geschlossenheit, Stärke, Exaktheit, den einer strengen Ordnung der Geraden und Rechtecke; den Ausdruck von Kampf und den einer bestimmten Männlichkeit.“[32]
Für die Kadettenanstalt gelte eine strenge Hierarchie, vorrangig orientiert an der Ordnung des Alters.[33] Ältere dürften Strafen gegen den Körper verhängen und Befehle erteilen, die Jüngeren schuldeten ihnen Gehorsam. Das „Prinzip der Gerechtigkeit“ bestehe darin, dass jeder, der tritt, auch schon vorher getreten wurde. Der physische Schmerz werde so lange erlitten, bis er genossen wird. Das „Schmerzprinzip“ ersetze das „Lustprinzip“. Das sexuelle Begehren nach Frauen erstürbe ganz und verliert damit seine Priorität, wenn der Schmerz dem Zögling seine Befriedigung verschaffe. Wie in einer Spirale werde das Niveau des Schmerzes, auf dem der Auszubildende in einer orgastischen Ohnmacht zusammenbricht, nach oben gedreht.[34]
2.3 Geschichtswissenschaftliche Annäherungen
Bereits in der Einleitung begegneten wir der grundlegenden Aussage von Georg Mosse, dass sich moderne Männlichkeit in einem „normativen Stereotyp“ – in Abgrenzung zu Frauen und unmännlichen „Anti-Typen“ – konstruiere. Diese Norm verbindet Erwartungen an das Verhalten mit vielen, eher oberflächlichen Qualitäten, so dass das Eine nicht mehr ohne das Andere denkbar wäre: „Körper und Seele, äußeres Erscheinungsbild und innere Tugendhaftigkeit sollten eine Einheit bilden, eine perfektes Konstrukt, bei dem jedes Teil an seinem Platz saß.“[35]
Dem männlichen Körper sei bereits in der bürgerlichen Gesellschaft um 1800 die Aufgabe zugekommen, zukunftsgewandte Hoffnungen der Gesellschaft auf Fortschritt und Bedürfnisse nach Ordnung zu repräsentieren. Der Erste Weltkrieg habe den Männlichkeitsstereotyp um wichtige Elemente erweitert und gestärkt.[36] Der Krieger als das Sinnbild für die perfekte Männlichkeit sei sogar ohne Widerspruch von der pazifistischen Kritik gegen den Krieg, Mosse nennt die Romane „Krieg“ von Ludwig Renn und Remarques „Im Westen nichts Neues“, als selbstverständlich aufgegriffen worden. Wenn der Wille zur Pflichterfüllung und Mäßigung in den Gefühlen bereits in der Schule verlangt wurden, so wurde der Kriegseinsatz für jugendliche Freiwillige zum „Prüfstein für ihre Männlichkeit“.[37] Das Kriegserlebnis gebar in den Schützengräben oder im Sitz eines Jagdflugzeuges eine neue Rasse von Mann, der mit seinen freigelegten Urinstinkten die neuen technischen Herausforderungen des modernen Kampfes meisterte. Diese „Kriegserfahrung“ mit ihrer virilen Prägung wurde nach dem Krieg die Legitimationsbasis und das Inszenierungsrepertoire für die rechten Bewegungen in Italien und Deutschland: „Der Kult um die Kriegstoten, die ,Märtyrer’, war das Herzstück der faschistischen und nationalsozialistischen Polit-Liturgie. Diese Verherrlichung von Tod und Opfer war ein Resultat des Krieges selbst, des apokalyptischen Rufes nach Zerstörung und Erneuerung: der Zerstörung der alten Welt und der Erneuerung der Nation.“[38] Mosse sieht die Ablehnung und Bekämpfung der Anti-Typen wie „Juden, Schwarze und Zigeuner“ ebenso als unverzichtbare Rechtfertigung für den Faschismus und seine Methoden an.[39] Selbst im Fall eines Sieges und einer vollständigen Judenvernichtung hätte Hitler wieder einen neuen Opponenten im Fernen Osten gefunden.
Aus sozialhistorischer Perspektive betrachtet Ute Frevert, Bezug nehmend auf Bourdieus Habitusbegriff, in ihren Arbeiten zu Männern und Männlichkeit das Militär als Institution und Uniformen als kommunikativ wirksame Zeichen. Für Frevert nahm das Militär „einen zentralen Platz in der Gesellschaft“[40] des Deutschen Kaiserreichs ein, das seine Gründung schließlich diesem Zentralsektor verdankte und es ihm im Gegenzug durch Zuschreibung eines hohen Prestiges durch alle Schichten dankte: „Viele Bürger waren Reserveoffiziere und suchten den gesellschaftlichen Verkehr mit ihren hauptberuflichen Offizieren. Ihre Töchter freuten sich auf jeden Ball, auf dem Offiziere zugegen waren, denn das bürgte für gute und willige Tänzer. Ihre Dienstmädchen träumten von Unteroffizieren, die nicht nur eine schmucke Uniform, sondern auch den Zivilversorgungsschein in der Tasche trugen.“[41] Gesellschaftliche, sexuelle und ökonomische Attraktivität gingen also Hand in Hand, wenn Soldaten – egal ob Offiziere oder Mannschaften – gemäß ihrer Tauglichkeitsanforderungen als gesund und schön betrachtet wurden sowie eine gute Partie für heiratswillige Frauen darstellten. Der bunte Rock war zum einen eine schöne Hülle, die aber auch für Inhalte stand.
Laut Frevert erfüllt die Uniformierung der Institutionsmitglieder drei Interessen der Institution.[42] Erstens grenze sie die Uniformierten von Nichtmitgliedern ab und hebe sie aus der zivilen Masse heraus. Zweitens führe sie zur „Homogenisierung“ der Mitglieder, Unterschiede würden aufhoben und es entstehe ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Zum dritten fühlten sich die Uniformträger der Institution an sich verpflichtet und identifizierten sich mit ihr.
Die militärische Uniform diente einerseits als Maskierung des männlichen Körpers. Aufgrund ihres Sozialprestiges versuchten Politiker oder Akademiker, sofern es ihr Status erlaubte, die von ihnen erworbene Militär-Uniform auch vor den Augen der Öffentlichkeit zu tragen.[43] In abgestufter Form partizipierten auch andere Uniformierte des öffentlichen Dienstes an dem symbolischen Kapital einheitlicher Kleidung, wenn ein Polizist unter dem Militär, aber über Post- oder Bahnbeamten stand. Darüber hinaus verlieh sie dem Träger auch eine dominierende, „einzige Identität“; sie „griff vielmehr auf den Körper selber aus, formte ihn um und prägte damit die Identität ihres Trägers weit massiver, als äußere Anpassungsprozesse dies nahe legen.“[44]
Die inneren Anpassungsprozesse des Mannes lagen begründet in dem Bildungsauftrag, den Heer und Marine für sich in Anspruch nahmen. Frevert bezieht sich auf die Formulierung des Berliner Philosophieprofessors Friedrich Paulsen, der im Jahr 1902 noch im Singular das Militär als die „Schule der Männlichkeit“ bezeichnete.[45] Gymnasien und Universitäten hätten in einem Konkurrenzverhältnis zum Militär gestanden, allerdings nicht einen solchen Einfluss bei der Setzung von Normen ausüben können, sondern sich eher an ihrem Vorbild orientiert. Ebenso verfügten genuin zivile Rollenbilder wie „sozialdemokratische Arbeiterführer, der Missionar im Urwald, der Arzt im Labor“ über „militärisch grundiert[e]“ Eigenschaften: „Im Mittelpunkt stand die Figur des Helden, der über sich hinauswuchs und sein Leben für ein hohes Gut in die Schanze schlug. […] Mut und Opferwille waren nötig, um dieses Heldentum zu praktizieren, außerdem Disziplin, Selbstbeherrschung, Zuverlässigkeit und Gehorsam.“[46]
Wie die Helden in ihrer Zeit gesehen wurden, hat René Schilling untersucht. Für die „Kriegshelden“[47], repräsentiert in drei Idealtypen in der Zeit von 1813 bis 1945, hat er deutliche Verschiebungen im Verhältnis des männlichen Individuums zur Gesellschaft festgestellt. Der patriotisch-wehrhafte Bürgerheld der Befreiungskriege strebte nach individuellen Rechten einer egalitär verfassten Gemeinschaft und befand sich somit noch in der Opposition zu der restaurierten adligen Obrigkeit nach 1815.[48] Schilling betont, dass dieser den humanitären Idealen der Aufklärung verpflichtete Typ nicht nur dem Mann vorbehalten war, sondern die Beziehung der beiden Geschlechter noch offen war.
Nach der Gründung des Deutschen Reiches sei das Verhältnis des „reichsnationalen Kriegshelden“ und des „charismatisch-kriegerischen Volkshelden“ zum weiblichen Geschlecht von klarer Abgrenzung bestimmt gewesen. Diese beiden „Deutungsmuster heroischer Männlichkeit“ hätten auch nicht mehr in Opposition zur politischen Gesellschaftsordnung gestanden, sondern diese gestützt. Der reichsnationale Kriegsheld legitimierte die Gesellschaft des Kaiserreichs und verwirklichte sich selbst im Militär.[49] Der charismatisch-kriegerische Volksheld bekräftigte den Führermythos der NS-Zeit und „stellte individuelle Belange zurück und sah von Kindheit an seine Bestimmung im Soldatentum, dessen Erfüllung der Tod für die Volksgemeinschaft war.“[50] Der Frau war in beiden Fällen die Domäne des Hauses zugewiesen, um ihren Mann oder Sohn in seinem Kampf für das Vaterland zu unterstützen und alltägliche Probleme von ihm fernzuhalten. Die Einforderung von geschlechtsspezifischen Pflichten bedeutete aber für beide Geschlechter, sich konform zu verhalten.
Der Erste Weltkrieg stellt bei Schilling eine Periode des Übergangs zwischen dem Kriegshelden des Kaiserreichs und dem völkischen Idealtyp der politischen Rechten, der bis 1945 fortgelten wird, dar. Die Beispiele des Fliegerstaffelführers Manfred von Richthofen und dem U-Boot-Kommandanten Otto Weddingen stehen für die „neuen Helden“, die als „Ritter der Lüfte und der Meere“ alte männliche Tugenden im Verein mit hochtechnologischer Waffenkunst repräsentieren, auch wenn diese verklärten Idealbilder nichts mit der brutalen Realität gemeinsam gehabt hätten.[51] Der ritterliche geführte „Zweikampf“ zwischen zwei Piloten oder Feindschiff und U-Boot sei mehr den rückwärtsgewandten Sehnsüchten der zeitgenössischen Publizistik und Propaganda entsprungen.
Thomas Kühne hat sich in einem seinem Forschungsprojekt zur „Kameradschaft“ mit der Frage beschäftigt, aus welcher Quelle die deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg die Kraft schöpfen konnten, noch über Jahre einen aussichtslosen Kampf zu führen, und wie sie überhaupt einen derart „verbrecherischen Krieg“ damit unterstützen konnten. So wie die Männlichkeitsforschung nicht mehr von der einen Männlichkeit, sondern von Männlichkeiten im Plural spricht, so unterstreicht auch Kühne, dass es nicht nur eine Form von Kameradschaft gibt und es sich nicht nur um ein spezifisches Phänomen in Deutschland, sondern in allen westlichen Armeen des 20. Jahrhunderts handelt.[52]
Die zahlreichen Varianten der Kameradschaft, von der normativ propagierten bis zur tatsächlich sozial praktizierten, unterliegen auch unterschiedlichen Wertungen:
Teils gilt Kameradschaft als Inbegriff praktischer Solidarität, mitunter sogar als Keimzelle der Erneuerung christlich-humanitärer Traditionen der Nächstenliebe; in der Erfahrung der Kameradschaft wird dann geradezu der Sinn des Krieges gesehen. Teils wird Kameradschaft aber auch als „Zwangsjacke“, als allgegenwärtiger Motor des militärischen Konformitätsdruckes perhorresziert, ihre Existenz ganz bestritten oder zumindest der Verfall des Kameradschaftsgedankens postuliert.[53]
Die nationalsozialistische Volksgemeinschaft habe sich das Frontkameradschaftsideal des Ersten Weltkriegs zum Vorbild genommen, um es auf alle Domänen des sozialen Lebens von der Hitlerjugend über den Arbeitsplatz bis in die Familie hinein als „Organisationsprinzip“ zu übertragen.[54] Damit wollte man nicht die Vergangenheit des wilhelminischen Reiches verklären, sondern den Aufbruch in eine neue Zeit einer Nation, in der soziale Unterschiede eingeebnet wurden, markieren. Dem egalitären Status, sofern man als Mitglied der Kameradschaft anerkannt war, stand aber auch die autoritäre Leitung in der Gestalt des „Führers“ entgegen. Seinen Führungsanspruch hätte dieser Erster unter Gleichen aber auch erarbeiten müssen: „In der Kameradengemeinschaft konnte sich der Führer nicht auf Geburt, Bildung oder andere soziale Privilegien berufen, sondern musste seine Qualifikation immer aufs Neue beweisen.“[55] Kühne hätte an die Stelle von „Qualifikation“ auch das Wort „Männlichkeit“ setzen können.
Den Ansprüchen an das stilisierte Heldenbild genügten die realen Verhältnisse nicht unbedingt: „Die durch die NS-Propaganda beschworene Gleichung ,Kameradschaft = heroisches Soldatentum = Inbegriff von Härte und Stärke = exklusive Männlichkeit’ war nicht deckungsgleich mit der Wahrnehmungsebene der einfachen Soldaten.“[56] In der Wehrmacht diente die Kameradschaft als Familienersatz, der Drill und Repressionen kompensierte, aber auch Anpassungsleistungen verlangte. Da die Gruppe für Vergehen oder Versagen Einzelner im Kollektiv haftete, hätten die stärkeren Kameraden die schwächeren Mitglieder in ihrer Gruppe zwar unterstützt, aber gleichzeitig ihre Unterordnung und ein „Erziehungsrecht“, nicht zu verwechseln mit dem Gehorsam gegenüber ranghöheren Vorgesetzten, eingefordert.[57] Individuelle Verstöße gegen die Disziplin, die zum Problem für die Gruppe werden konnten, wurden durch Ächtung oder handfeste Prügel bestraft. Um innerhalb der Metapher von der militärischen Familie zu bleiben, sahen „Vater“ Kommandeur oder der „Spieß als Mutter der Kompanie“ schon mal bei Streitigkeiten unter den Kindern weg, wenn damit die Ordnung aufrechterhalten wurde.
Die Zuneigung der Soldaten konnte aber auch eine weibliche Form annehmen, die Kühne als „mütterliche Männlichkeit“ oder das „Frauenhafte des Kameraden“ bezeichnet.[58] „Die ,weiche’ Deutung der Kameradschaft“ habe sich gerade in den Kriegserinnerungen niedergeschlagen, wenn Soldaten des Zweiten Weltkrieges das Positive hervorhoben, aber das Töten verschwiegen und Verbrechen zum Teil leugneten. Gerade in diesem Verhalten sieht Kühne eine fortlaufende Wirksamkeit des Kameradschaftsehrenkodex, die Verfehlungen der Gruppe vor den Augen Außenstehender zu „vertuschen“.[59]
Bevor das heldische Soldatentum nach 1945 seinen privilegierten Status als Hochburg der „Manneszucht“ einbüsste, ließ es bereits im begrenzten Rahmen eine feminine Zärtlichkeit zu. Sofern sich der Soldat nicht von diesen Gefühlen überwältigen ließ, sondern immer wieder in die männliche Beherrschheit zurückkehrte, war es ihm sogar möglich, körperliche Kontakte zuzulassen. Die Überschreitung der Grenze zur Homoerotik sei aber nur dann gestattet, wenn der Kamerad, dem diese Zuwendung galt, schwer oder tödlich verwundet gewesen wäre.[60]
Halten wir allgemein fest: Männlichkeit ist an bestimmte tugendhafte Eigenschaften im historischen Kontext gebunden. Einen Anspruch, als männlich zu gelten, darf ein Mann dennoch nur formulieren, wenn diese Männlichkeit nach vorgegebenen Regeln auch wiederkehrend erworben wird.
[...]
[1] Thorsten Bartz: ,Allgegenwärtige Fronten’ – Sozialistische und linke Kriegsromane in der Weimarer Republik 1918-1933. Motive, Funktionen und Positionen im Vergleich mit nationalistischen Romanen und Aufzeichnungen im Kontext einer kriegsliterarischen Debatte, Frankfurt a. M. u.a. 1997, S. 16.
[2] Sven Glawion, Elahe Haschemi Yekani, Jana Husmann-Kastein (Hgg.): Erlöser. Figurationen männlicher Hegemonie, Bielefeld 2007, S.14.
[3] Vgl. George L. Mosse: Das Bild des Mannes. Zur Konstruktion der modernen Männlichkeit, Frankfurt a.M. 1997, S. 9, 11-13, 18.
[4] Walter Erhart: Familienmänner. Über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit, München 2001, S. 8.
[5] Ebd.: S. 10f.
[6] Karl-Heinz Hillmann (Hg.): Wörterbuch der Soziologie, 4., überarbeitete und ergänzte Auflage, Stuttgart 1994, S. 114.
[7] Pierre Bourdieu: Die männliche Herrschaft, in: Irene Dölling, Beate Krais (Hgg.): Ein alltägliches Spiel. Geschlechterkonstruktion in der sozialen Praxis. Gender Studies, Frankfurt a.M. 1997, S. 160. Hervorhebungen wie Kursiv-, Fett- oder gesperrter Druck immer im Original, falls nicht anders angegeben.
[8] Vgl. ebd.: S. 158f.
[9] Ebd.: S. 165.
[10] Ebd.: S. 167.
[11] Ebd.: S. 175.
[12] Vgl. ebd.: S. 181f.
[13] Vgl. Pierre Bourdieu: Die männliche Herrschaft, Frankfurt a.M. 2005, S. 90-96.
[14] Ebd.: S. 92f.
[15] Robert W. Connell: Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten. Übersetzt von Christian Stahl, Opladen 1999, S. 87. Vgl. ebd.: S. 87-91.
[16] Ebd.: S. 91.
[17] Vgl. ebd.: S. 94f, 106f.
[18] Vgl. ebd.: S. 98-102.
[19] Ebd.: S. 98.
[20] Ebd.: S. 100.
[21] Klaus Theweleit: Männerphantasien. 2 Bände, Frankfurt a.M. 1977-1978, hier Band I, S. 269. Vgl. ebd.: S. 43.
[22] Ebd.: S. 246.
[23] Klaus Theweleit: Männliche Geburtsweisen, in: Therese Steffen (Hg.): Masculinities – Maskulinitäten. Mythos – Realität – Repräsentation – Rollendruck, Stuttgart/Weimar 2002, S. 2-27, hier S. 3.
[24] Ebd.: S. 7.
[25] Theweleit: Männerphantasien I, S. 270.
[26] Ebd.: S. 252f.
[27] Theweleit: Geburtsweisen, S. 11f.
[28] Ebd.: S. 13.
[29] Theweleit: Männerphantasien I, S. 277.
[30] Ebd.: S. 277.
[31] Theweleit: Männerphantasien II, S. 201.
[32] Ebd.: S. 182.
[33] Vgl. ebd.: S. 167-178. Theweleit untersucht hier besonders die Erinnerungen des Offiziers und Schriftstellers Ernst von Salomon.
[34] Vgl. ebd.: S. 193.
[35] Mosse: Bild des Mannes, S. 11.
[36] Vgl. ebd.: S. 143-157.
[37] Ebd.: S. 145.
[38] Ebd.: S. 209.
[39] Vgl. ebd.: S. 230f.
[40] Ute Frevert: Das Militär als Schule der Männlichkeiten, in: Ulrike Brunotte, Rainer Herrn (Hgg.): Männlichkeiten und Moderne. Geschlecht in den Wissenskulturen um 1900, Bielefeld 2008, S. 57-75, hier S. 58.
[41] Ebd.: S. 61.
[42] Vgl. Ute Frevert: Männer in Uniform. Habitus und Signalzeichen im 19. und 20. Jahrhundert, in: Claudia Benthien, Inge Stephan (Hgg.): Männlichkeit als Maskerade. Kulturelle Inszenierungen vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 277-295, hier S. 279f.
[43] Frevert: Schule, S. 61.
[44] Frevert: Uniform, S. 284.
[45] Vgl. Frevert: Schule, S. 68-70.
[46] Ebd.: S. 70.
[47] René Schilling: „Kriegshelden“. Deutungsmuster heroischer Männlichkeit in Deutschland 1813-1945, Paderborn/München/Wien/Zürich 2002.
[48] Ebd.: S. 117-119, 375f.
[49] Vgl. ebd.: S. 377.
[50] Ebd.: S. 372.
[51] Vgl. ebd.: S. 252-288.
[52] Vgl. Thomas Kühne: Kameradschaft – „das Beste im Leben des Mannes“. Die deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges in erfahrungs- und geschlechtergeschichtlicher Perspektive, in: Geschichte und Gesellschaft 22 (1996), S. 504-529, hier S. 509.
[53] Ebd.: S. 506.
[54] Vgl. ebd.: S. 511.
[55] Thomas Kühne: Kameradschaft. Die Soldaten des nationalsozialistischen Krieges und das 20. Jahrhundert, Göttingen 2006, S. 54.
[56] Kühne: Kameradschaft 1996, S. 521.
[57] Vgl. ebd.: S. 515.
[58] Vgl. Kühne: Kameradschaft 1996, S. 523-528; vgl. Kühne: Kameradschaft 2006, S. 72-78.
[59] Kühne: Kameradschaft 1996, S. 524.
[60] Vgl. Kühne: Kameradschaft 2006, S. 73.
- Arbeit zitieren
- Michael Offizier (Autor:in), 2011, Vom heldenhaften Führer zum einsamen Deserteur: Zum Wandel der Motive von Männlichkeit in der deutschen Kriegsliteratur, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/197248
Kostenlos Autor werden









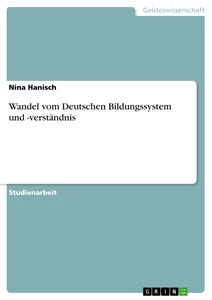
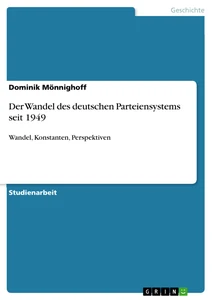









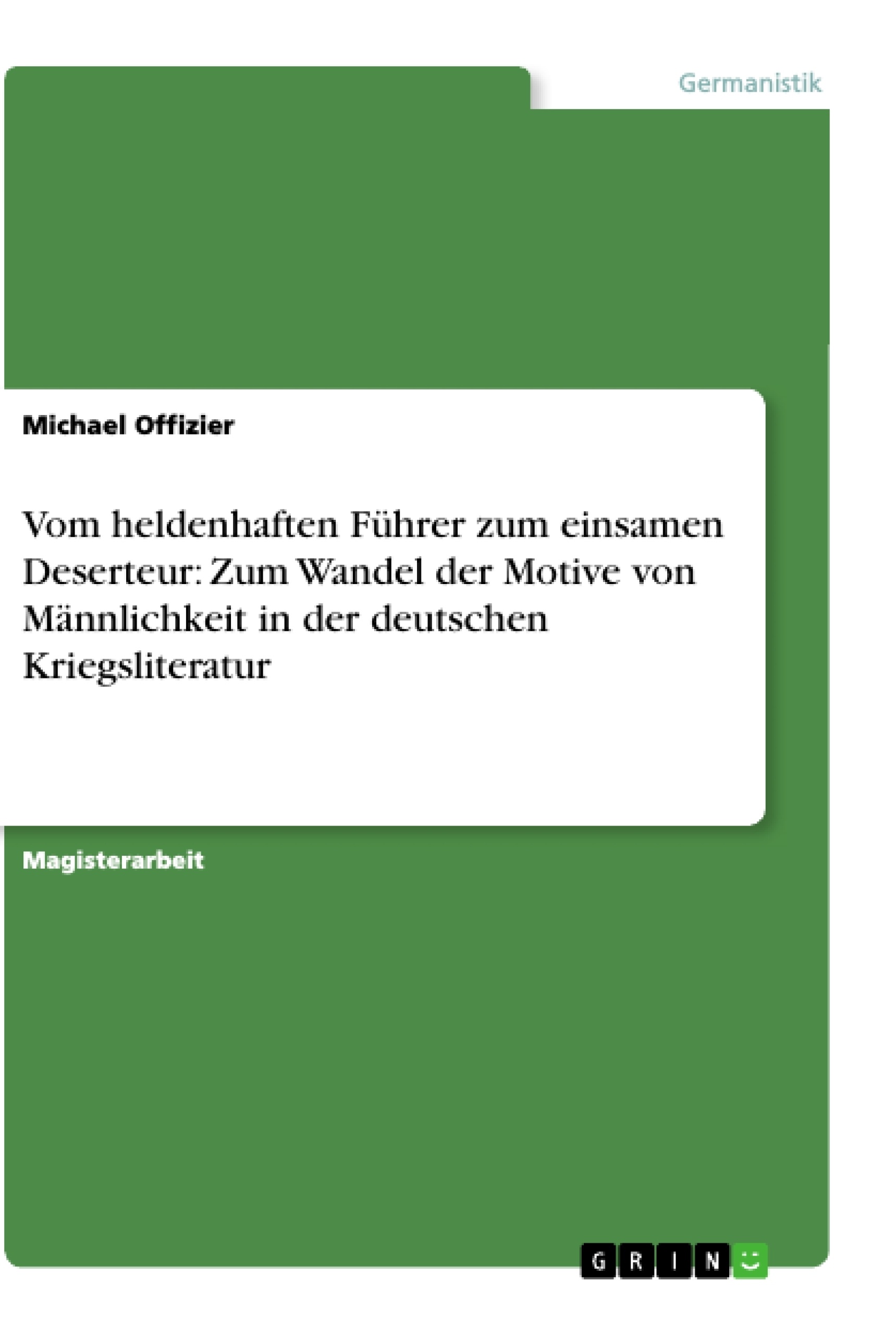

Kommentare