Leseprobe
Inhalt
Die Ausgangslage
Bildungsbrüche
Bild und Sprachverhalten
Sprachkolonialismus
Ähnlichkeit als Bildkriterium
Bildlogik und Ikonoklasmusvorwurf
Wahrnehmung
Das Sichtbare und das Berührbare
Verortung und Logik des Bildes
Ort des Bildes
Bildlogik
LITERATUR
Die Ausgangslage
Wir stehen in unserer beruflichen Tätigkeit (Kunsterzieher, Kunstvermittler) an einer Schnittstelle zwischen Bildthe- orie und Bildpraxis. Im Zusammenspiel von gestalterischer Produktion, verbaler Reflektion und Vermittlung sind wir herausgefordert zu überprüfen und anzuwenden, was sonst in isolierten Disziplinen entworfen wird. Sobald die gedankliche Auseinandersetzung über den konkreten Fall einer einzelnen Aufgabestellung im Unterricht hinausgeht und z.B. unser Selbstverständnis in der Bildung oder die Rolle der Bilder in der Gesellschaft berührt, geraten wir in ein unüberschaubares Feld von theoretischen Auseinandersetzungen. Einen Transfer herzustellen zwischen dieser Forschung, den dahinter stehenden Weltbildern sowie dem einzelnen, konkreten Bild und dessen Bewertung bedeutet, innerhalb der Disziplinen und Zugangsweisen gezielt Kanäle zu öffnen. So verstehe ich die folgenden Beobachtungen als eine gedankliche Exkursion und eine Rückmeldung aus der Position der Praxis und Vermittlung.
Meine Beobachtungen gründen einerseits in alltäglichen und fachlichen Erfahrungen. Andererseits beziehen sie sich auf fachfremdes Wissen. Ich zitiere aus dem Basiswissen einzelner Fachbereiche wie der Biologie (Evolution des Auges) und Physik (Optik) sowie der Wahrnehmungsforschung. In unserem Fach sind die Schnittstellen zu diesen Disziplinen naheliegend. Meine aus den Beobachtungen naheliegende Schlussfolgerung ist, dass die traditionelle Bildwissenschaft in eine Falle gerät, die Bildfalle.
Einige der hier zitierten Aussagen stehen in einem Zusammenhang mit der Behauptung beinahe apokalyptischer Szenarien oder «Turns». Sie beziehen sich auf eine diagnostizierte Bilderflut und den inflationären Umgang der Ge- sellschaft mit visuellen und elektronischen Medien, die wachsende Rolle der Bilder als Argumente der Wissenschaften sowie auf die Gewichtung des Bildes in einem Vergleich mit der Sprache im philosophischen und erkenntnistheo- retischen Diskurs. Die Sprache als Gegenstand und traditionelles Mittel der Philosophie scheint unter Druck geraten zu sein. Es wird gesprochen vom «Iconic Turn» bei Gottfried Boehm, vom «Pictorial Turn» bei W. J. T Mitchell und von «Visualistic Turn» bei Klaus Sachs-Hombach, um einige der aktuellen Autoren im Bereich der Bildwissenschaft zu nennen. Die Autoren beziehen sich häufig gegenseitig auf die jeweiligen Aussagen sowie auf den vom Philosophen Richard Rorty beschriebenen «Linguistic Turn», in dem es um eine Differenzierung innerhalb der philosophischen Betrachtungsweisen und die sprachliche Bedingtheit der Erkenntnis geht, so auch um eine Befreiung vom Bildhaften (Metaphorischen) in der Sprache.
« Nicht Sätze, sondern Bilder, nicht Aussagen, sondern Metaphern dominieren den grössten Teil unserer philosophischen Ü berzeugungen. Das Bild, das die traditionelle Philosophie gefangen hält, ist das Bild vom Bewusstsein als einem grossen Spiegel, der verschiedene Darstellungen enthält - einige davon akkurat, andere nicht - und mittels reiner, nichtempirischer Meth oden erforscht werden kann. » (1, S. 22)
Drei aus dem Feld der Bildtheorien herausgegriffene und aus meiner Sicht problematische Behauptungen lauten:
> Das Bild hat eine Bildlogik, die nur für das Bild gilt (Ikonik, Imdahl, Boehm).
> Das Bild ist ein (konventionelles) Zeichen (Semiotik, Eco).
> Das Bild kann als technisches Bild bildzerstörende Wirkung entfalten (Ikonoklasmusvorwurf, Boehm, Belting).
Ich verstehe das Vorgehen des amerikanischen Kunstund Sprachdozenten W.J.T. Mitchell in seinem Werk Bildtheorie als vorbildlich unsentimental, alles in diesem Themenkomplex vorerst in Frage zu stellen um zu schauen, was dabei herauskommt, wenn man fragt, beobachtet und mit Vorbehalten Schlüsse zieht. Auch Mitchell spricht von einem «Turn». Er nennt ihn den «Pictorial Turn». Er lokalisiert diesen im Sinne einer Panikattacke der traditionellen Kunstwissenschaften. Eine seiner acht Gegenthesen zu den «Mythen über Visuelle Kultur» lautet:
« Wir leben nicht in einem ausschliesslich visuellen Zeitalter. Der « Visual » oder « Pictorial Turn » ist eine wiederkehrende
Trope, die eine moralische und politische Panik auf Bilder und sogenannte visuelle Medien ablenkt. Bilder sind bequeme Sündenböcke, und das verletzende Auge wird von der unbarmherzigen Kritik rituell ausgerissen. » (2, S. 323)
Bildungsbrüche
Als Kinder kritzeln wir, zeichnen und malen, wenn uns die Möglichkeit dazu geboten wird, oder wir gestaltet auch ganz autonom und ohne äusseren Antrieb. Wir entwickeln in den ersten Jahren eine souveräne Kompetenz in unseren spielerischen Bewegungen und Gesten, die unter anderem zu Spuren, Farben und Formen auf dem Format führen, das uns zur Verfügung steht. Ohne grössere Probleme sprengen wir auch dessen Beschränkungen und nutzen Boden, Wände und weitere Flächen unserer Umgebung für das zeichnerische und malerische Dokument. Gesten, Zeichen und Bilder werden selbstverständliche Folgen und Produkte unserer Artikulationslust.
Neben dem architektonischen Raum, in dem die spielerische Nutzung in Form von Kritzeleien und Graffitis selten willkommen ist, bietet der urbane Raum für spontanes Gestalten nur sehr bescheidene Parzellen in Form von Zeichenpapier, Sandkästen, Spielplätzen und Freizeitanlagen, und sind die verbleibenden Freiräume wie Bäche, Wälder, Strände und andere Zonen immer noch beliebte, aber kaum mehr alltägliche Gestaltungsräume.
Im ursprünglichen Drang nach Gestik, nach Bewegung, Selbstdarstellung und spielerischer Kommunikation
werden keine wesentlichen Unterscheidungen der Medien gemacht. Das Bauen einer Burg im Sand und das zeich- nerische Bilden einer Burg auf dem Papier wird höchstens graduell und nicht prinzipiell unterschieden. Im Erlebnis werden die begehbare Burg, die Plastikburg oder die gezeichnete Burg nicht als unterschiedliche Wirklichkeiten ver- standen, sondern als ein einziges Motiv. Gesten, Bewegungen, Klänge, Geräusche, erzeugte Spuren, Spielgegenstände, Zeichen und Bilder werden in nahtlosen Übergängen genutzt oder erzeugt. Die Zeichnung einer Burg ist nicht das Zeichen für eine bestimmte, realere Burg, sondern ist eine real erlebte Burg, die mit ein paar Strichen auch wieder zerstört werden kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Erst mit der schulischen Struktur und Alphabetisierung beginnt die Trennung der Handlungsund Artikulations- formen in Zeiten und Orte, in Unterrichtsgefässe, die von spezifischen Themen und Medien besetzt werden. Mit der schematischen Darstellung einer Burg im Unterricht wird diese nicht mehr primär belebt und erlebt, sondern verstan- den. Ziel des Unterrichtes scheint in erster Linie objektive Distanz und Vergleichbarkeit. Die Burg wird zersetzt in einzelne, bezeichnete und nummerierte Teile. Die Burg besteht nicht mehr aus Steinen und Rittern, sondern aus Be- griffen, die Elemente eines Verständnismusters sind, das sich über alles legen lassen sollte. Zeichen und Bezeichnetes beginnen sich voneinander zu lösen und das erlebte Motiv verblasst. Der Prozess kann als Bruch zwischen einer phän- omenologischen zu einer zeichentheoretischen Behandlung des gestalteten Objektes, so auch des Bildes betrachtet werden. Das Bild der Burg behält, da es aber immer einen Rest von Wirklichkeit erfahren lässt, in seiner Einmaligkeit und Präsenz gegenüber der beschriebenen Burg etwas leicht Suspektes. Auf der einen Seite entwickeln sich in einer deutlichen Dominanz Buchstabe, Wort und Zahl, auf der anderen Seite die im Vergleich unstrukturierten und unsys- tematisch genutzten weiteren Medien und Artikulationsmöglichkeiten. Es entwickelt sich in kürzester Zeit eine Un- terscheidung zwischen den «starken» Fächern mit klaren Regeln und Funktionen und den «schwachen» Gebieten, wo die Freiheiten oder die Unverbindlichkeit in den Lehrplänen Spiegel der Unsicherheiten über ihre Bedeutung für die Entwicklung und Bildung darstellen.
Gestalterisches Spiel und bildnerische Artikulation verblassen. Das Bild als ein zentrales Element für Information und Wissenserwerb wird einerseits in den Medien, in den schulischen Fächern und Themen immer präsenter, ander- erseits wird es im Bereich der produktiven Tätigkeit ausgeblendet. Mit der spontanen und spielerischen Bildproduk- tion hört das Kind in den meisten Fällen vor der Pubertät auf. Dem Gestalten genügt das alleinige Angebot eines Freiraumes nur noch selten, sondern Erfolgserlebnisse und Anteilnahme mit und an den Produkten begleiten, ermögli- chen und provozieren deren Fortbestand. Vorbilder, Anleitungen und Förderung werden gesucht um die nächsten Ent- wicklungsschritte zu machen. Die produktiven bildnerischen Fähigkeiten verkümmern und das bis zu diesem Moment Erarbeitete genügt dem mit Vergleichen beginnenden Jugendlichen sowie dem erziehenden und bildenden Umfeld nur noch schwer. Bilder werden mit anderen Bildern verglichen und bewertet. Techniken und Fertigkeiten werden als massgebende Werte erfasst und kommuniziert. Die gestalterische Produktion wird mit Lernen, handwerklichem Üben und formalem Können verbunden, mit der komplexen Beherrschung eines perspektivischen und illusionistischen Raumes. Ein Rest des gestischen Kritzelns des Kindes und des in sich versunkenen Zeichnens verbleibt in der Schrift als letzte Form von Spurenlegung, allenfalls in insgeheim entwickelten Tags und Graffitiversuchen. Die Möglichkeit des Bildes als eine Form der Reflektion und Artikulation wird aufgegeben. Diese Kompetenz wird nun an die wenigen Begabten delegiert, die sich mit schönen Zeichnungen oder krassen Graffitis profilieren können, die nun mit ihren professionellen Spuren die mediale oder architektonische Umgebung beliefern und prägen. Die Welt des Bildes besteht nicht in einem kommunikativen Gleichgewicht.
Bildnerisches Gestalten erhält mit diesem Bruch den mystifizierenden Nimbus der Kunst mit der Voraussetzung der Gabe, des Genies, oder bekommt den abwertenden Geschmack des Hobbys und der Freizeitbeschäftigung. Das Gewicht kommunikativer und forschender Kompetenz verlagert sich einseitig auf Schrift und Sprache und damit, wie sich zeigen wird, auf eine stärker von Konventionen und lernbaren Strukturen geprägten Kulturtechnik.
Eine Kulturtechnik im engen Sinn ist eine menschliche Artikulationsform, die sich selber, ihre Systematik und Wirkung zum Thema machen kann. Die zentralen Kulturtechniken in diesem Sinn sind Sprache (Wort), Visualistik (Bild), Akustik (Musik), Gestik (Mimik, Tanz) und die möglichen und etablierten Kombinationen. Neben allen an- deren gesellschaftlichen Klassen entwickelt sich hier ein Zweiklassensystem der Kulturtechniken, auf der einen Seite die mit dem Mythos umrankten Künstler und Gestalter, die die Gesellschaft mit den von ihr reflexartig rezipierten Artikulationen beliefern, auf der anderen Seite diejenigen, die sich zurücknehmen, das Interesse an der gestalterischen Artikulation und dem visuellen Ausdruck verlieren und von sich vorschnell behaupten, sie seien nicht begabt.
Im Gegensatz zu der gebräuchlichsten Kulturtechnik, dem Lesen und Schreiben, dem Reden und Zuhören, also der sprachlichen Kommunikation, die nicht so präsente visuelle Spuren erzeugt, ist der Umgang mit Bildern einseitig. Er entwickelt sich zu einer rein rezeptiven Kompetenz und es stellt sich die Frage, ob dies als Kulturtechnik im engen Sinn zu bezeichnen ist, da der Laie nicht die Möglichkeit hat, vergleichbar mit Sätzen, nach Bedarf Bilder in einem bewusst gesteuerten Prozess zu erzeugen. Bilder und bildhafte Elemente im Kontext der Kommunikation, der Medien und Werbung scheinen einfach lesbar, da sie nichts anderes als das zeigen, was wir auch aus der natürlichen visuellen Erfahrung kennen. Bildung, Wissenschaften und Wirtschaft gehen davon aus, dass Bilder einfach und reflexartig lesbar sind, warum sollte man also die Menschen ausbilden, Bilder zu lesen und zu produzieren? Ist dieser bildnerische Analphabetismus, den man analog zum Analphabetismus Anikonismus nennen kann, eine logische und notwendige Folge der Arbeitsteilung und Spezialisierung oder ein Bruch und Fehler im Bildungskonzept?
Bild und Sprachverhalten
Der beobachtete Bruch innerhalb der Erziehung und Bildung bezüglich des Umgangs mit dem Bild, der in den ersten Schuljahren geschieht, führt konsequent zu weiteren Brüchen innerhalb der Spezialisierung und Berufsaus- bildung. In den aussergewöhnlichen Rollen, die die Kunst und das Bild als Studiengebiete und als gesellschaftliche Themen einnehmen, entwickelt sich ein Mythos, der sich unter anderem im unkoordinierten Nebeneinander eines produktiven und eines theoriebildenden Teils des Gegenstandes äussert. In den Bildtheorien und philosophischen Texten, die ihrem Erstaunen über die menschliche Fähigkeit der Bildwahrnehmung Ausdruck geben, wird die men- schliche Fähigkeit und Praxis der Bildproduktion kaum differenziert beschrieben und damit ausgeblendet.
Ein zwingender Austausch zwischen den Institutionen, die Theoriebildung und Forschung betreiben sowie der Praxis Bildnerischer Gestaltung, Kunst und Vermittlung hat keine Tradition. Eine Überprüfung entstehender und vorhan- dener Theorien in der Praxis oder die Vermittlung von Erkenntnissen aus Forschungsvorhaben für die Praxis ist nicht institutionalisiert und es bleiben, falls sie vorkommen, freiwillige und partielle Ereignisse. Die Heterogenität der Anforderungen einerseits an praktischer Bildkompetenz und andererseits an theoretischem Wissen erlaubt es den verschiedenen Institutionen und Personen, eigene und möglicherweise ganz eigenwillige Bildtheorien zu entwerfen, in denen sich der oben beschriebene Bruch in Form von Kategoriefehlern und mystifizierenden Übertreibungen äussert. Das Gestalten von Bildern scheint weitgehend ohne theoretische Grundlagen und das Entwickeln von Bildtheorien scheint ohne bildnerische Praxis auskommen zu können. Die Arbeit am und der Weg zum Bild bleibt der Kunst- wissenschaft ein Mysterium, das mit der rätselhaften Umschreibung «auf irgendeine Weise» von Gottfried Boehm treffend bezeichnet wird:
« Was uns als Bild begegnet, beruht auf einem einzigen Grundkontrast, dem zwischen einer überschaubaren Gesamtfläche und allem was sie an Binnenereignissen einschliesst. Das Verhältnis zwischen dem anschaulichen Ganzen und dem, was es an Einzelbestimmungen (der Farbe, der Form, der Figur etc.) beinhaltet, wurde vom Künstler auf irgendeine Weise optimiert. » (3, S. 30)
Lambert Wiesing (Professor für Vergleichende Bildtheorie in Jena) spricht in seinen «Studien zur Philosophie des Bildes» von einem ungelösten Menschheitsrätsel:
« Man muss es mit aller Deutlichkeit sagen: Wie ein Bildträger in der Lage ist, das Bewusstsein eines gegenwärtig sich präsentierenden Bildobjektes beim Betrachter zu erzeugen, ist zumindest derzeit unerklärlich - und das ist auch nicht sehr verwunderlich, denn hätte man eine Erklärung, so hätte man nichts Geringeres als eines der grossen Rätsel der Menschheit gelöst. » (11, S. 52)
Wer Sprache untersuchen wollte, ohne jemals richtig sprechen und schreiben zu können, würde diese auch als unfassbares Mysterium bezeichnen. In einzelnen Arbeiten wird das Fehlen einer eigentlichen Wissenschaft selber beschrieben. Hans Belting schreibt im Vorwort des Bandes «Der zweite Blick» (4):
« Es gibt noch keine Bildwissenschaft, die eine integrative Wirkung auf Disziplinen aus üben könnte, die heute die Bilder zu ihrem Thema machen. Es gibt ebenso wenig eine Bildergeschichte, so wie man von einer Kunstgeschichte reden kann. »
Auch Klaus Sachs-Hombach beschreibt die Situation einer Bildwissenschaft skeptisch:
« Nach wie vor ist es jedoch unklar, in welchem Masse wir in der Lage sein werden, die wesentlichen Eigenschaften und Funktionen der Bildverwendung nach wissenschaftlichen Standards zu erfassen. Es ist, mit anderen Worten gesagt, nach wie vor unklar, ob bzw. in welchem Sinn von Wissenschaft es eine (evtl. der Sprachwissenschaft vergleichbare) Bildwissenschaft überhaupt geben kann. » (5, S. 10)
Der Philosoph Hans-Georg Gadamer ist, was das Erklären von Kunstwerken betrifft, sehr vorsichtig.
« Die Dialektik von Frage und Antwort kommt hier nicht zum Stehen. Vielmehr zeichnet es das Kunstwerk geradezu aus, dass man es niemals ganz versteht. Das will sagen, dass man, wenn man an es fragend herantritt, nie eine in der Weise endgül- tige Antwort erhält, dass man nun <weiss>. » ( … ) « In Wahrheit kommt es darauf an, den Abstand der Zeit als eine positive und produktive Möglichkeit des Verstehens zu erkennen. Er ist ausgefüllt durch die Kontinuität und des Herkommens und der Tradition, in deren Lichte uns alle Ü berlieferung sich zeigt. Hier ist es nicht zu wenig, von einer echten Produktivität des Ge- schehens zu sprechen. » (6, S. 63)
Um das Wesen des Bildes zu beschreiben, wird in den kunstund bildtheoretischen Schriften das Bild oft in einen Vergleich mit der Sprache gebracht. Das Bild funktioniere nicht prädikativ und chronologisch wie die Sprache, sondern situativ und simultan (Boehm). Gleichzeitig wird es als Phänomen beschrieben, das von der Wahrnehmung der realen Welt prinzipiell zu unterscheiden ist. Das Bild liegt für viele der Theorien als Gegenstand einer eigenen Kulturtechnik ausserhalb der rational und zeichentheoretisch fassbaren Sprache sowie dem natürlichen Verhalten. Je nach Fakultät und Disziplin werden dem Bild unterschiedliche Muster zugeordnet. Einerseits wird der zeichenhafte und der mediale Charakter des Bildes hervorgehoben, also dass das Bild etwas mitteile und kommunikativ sei. Ander- erseits wird dem Bild Unhintergehbarkeit und eine innere, beschreibbare Logik zugesprochen.
Wer etwas vergleichen und einander gegenüber stellen will, muss das zu Vergleichende «in gleicher Distanz» zu sich halten können, was eine banale Voraussetzung für Objektivität ist. Für diese Tätigkeit braucht der Vergleichende ein neutrales Instrument, also etwas Drittes, mit dem gemessen und verglichen wird. Diese Bedingung ist im Fall einer analytischen Untersuchung nicht erfüllbar, denn als Vergleichende befinden wir uns mit der Frage nach den Ähnlich- keiten, Unterschieden und den Antworten darauf in einem diskursiven Sprachvorgang. Wir vergleichen etwas mit dem Instrument des Vergleichens selber, was kaum vernünftige, resp. einer wissenschaftlichen Fragestellung entsprech- ende Antworten erzeugen kann. Wer sich also mit Fragen an das Bild wagt, befindet sich immer in einer bestimmund darstellbaren sprachlichen Position und vergleicht aus dieser Warte. Die Sprache als Instrument des Denkens gerät hier an eine Grenze.
In einer philosophischen, sprachwissenschaftlichen oder ästhetischen Fragestellung richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Bild als Element einer Kulturtechnik. Es wird damit in der Kulturtechnik der Sprache die Kulturtechnik des Bildes behandelt. Da davon auszugehen ist, dass unsere Kulturtechniken nicht künstliche und unabhängige Zeichensysteme sind, sondern sich bedingen und überlagern, verlangen diese Abhängigkeiten, sich dieser Ausgangslage bewusst zu sein, damit man sich nicht von der eigenen Rhetorik überzeugen lässt und der Illusion erliegt, dass die entstehenden Muster mehr über die behandelte als die behandelnde Kulturtechnik sagen.
Da man nicht alle Fragen aufs Mal stellen kann und nicht in einer Aussage alles beantwortet, also eben nicht bildhaft arbeitet, wird in den Fragestellungen je nach Frageform ein anderer Aspekt des befragten Gegenstandes hervorg- erufen. Man ritzt sozusagen mit den Fragen durch die Frageform (was, wie, warum, womit?) jeweils an einen anderen «Ort» des Bildes und erhält dementsprechend andere «Klagelaute». Damit sich die ansammelnden Aussagen nicht im Kreis drehen, wiederholen oder widersprechen, werden die Fragen systematisch gestellt. Man drängt mit den Fragen und Aussagen in eine Richtung, denn man will eine Hypothese belegen und so den Leser zu denselben Schlüssen ver- führen. Die Systematik dieser Fragestellungen kann in Modellen abgebildet werden. Diese Modelle sagen damit aber mindestens so viel über die Sprache und Methode aus als über das Befragte. Sie sind eigentliche Modelle oder Bilder eines Sprachverhaltens.
Vergleich
Kann man sich vorstellen, das Denken zu erforschen ohne zu denken? Oder die Sprache zu untersuchen ohne Sprache anzu- wenden?
Man müsste sich also, um Bild und Sprache in einen Vergleich setzen zu können, ausserhalb von beidem befinden, in einem sprachlosen, meditativen Zustand, oder einer weiteren Kulturtechnik. Da dies nicht ein analytischer Zustand ist, also nicht zu irgendwelchen Aussagen führt, kann man höchstens davon ausgehen, dass man sich im Sprachlichen wie im Bildhaften in einem Gleichgewicht befindet, dann wäre ein Vergleichen ein akzeptables Vorgehen. Damit hätte man aber beide Kulturtechniken schon als Vorund Rückseite einer Münze, als unlösbar verknüpft akzeptiert. Man müsste damit das Metaphorische und Bildhafte als wesentlichen Aspekt der Sprache verstehen, das Sprachliche aber auch als wesentlich für das Bild.
Wenn die Sprache das Bild behandelt, zerreisst das Bild im chronologischen Vorgang des Sprachflusses. Es wird in der Analyse zersetzt in ein System von Aspekten und eine Folge von Schichten oder Elementen. Das Bild hat keine Chance, im Fokus des analytischen Sprachfluss bestehen zu bleiben. Es wird unwiderruflich in einem semiotischen Zeichenmodell zerstört, wie es die anschliessend zitierten Modelle von Panofsky oder dem Beispiel aus dem gestalter- ischen Unterricht darstellen.
Das Erstaunliche und für die Kunstund Bildwissenschaft dermassen Ätzende ist jedoch, dass wenn man das Bild in seinem Monolog zerfetzt und ihm die Augen ausgerissen hat (Mitchell), es einen immer noch unentwegt anstarrt. Es bleibt stoisch bestehen. Im äussersten Fall, wenn die Sprache vor dem Illusionismus des Bildes versagt, greift man wieder zum (zumindest verbalen) Ikonoklasmus, um die Zerstörung zu vollenden.
Sprachkolonialismus
Es wäre ignorant zu bestreiten, dass viele Texte der Kunstund Bildwissenschaft hoch spannend sind, wesentliche Erkenntnisse über die Kunst und die einzelnen Werke vermitteln. Diese Kunstwissenschaft kann über Kunstwerke wie über deren Rolle für den Menschen bemerkenswerte Aussagen machen. Die Autoren sagen aber oft auch viel aus über sich selber und die angewendeten Methoden. Viele von ihnen sind sich ihrer seltsamen Position bewusst und stellen sich und auch die Wissenschaftlichkeit ihres Fundamentes in Frage.
« Blickt man sich in der einschlägigen Forschung um, so fragt man sich, ob der Streit um die allein selig machende Bildwissenschaft nicht die Bilder aus den Augen verliert und statt dessen DAS BILD, das es in der Praxis gar nicht gibt (ebenso wenig wie DEN TEXT), zu einem Diskursfetisch macht. » (Hans Belting in « Bilderfragen » , 7, S. 11)
In anderen Aussagen kommt aber deutlich eine Form des innerkulturellen Kolonialismus zum Vorschein. Die Kunstwissen-schaftler sehen sich als eine Art Urwaldforscher ( Trapper, Iconic Trap), die sich in den Urwald der Bilder begeben wie einen letz-ten Teil einer unerforschten Welt, eines weissen Fleckens auf der Landkarte. Sie begeben sich mit ihren theoretischen Werkzeugen wie mit einer Taucherausrüstung in eine Unterwasserwelt, in der man sich aber auch ohne Taucherglocke gut zurechtfinden kann Dass es ohne theoretische Taucherglocke geht beweisen all die chaotisch agierenden und wilden Bildproduzenten, die Eingebo-renen, die seit langem die Hirnwindungen der Theo- retiker mit ihren Bildprodukten infiltriert und besetzt halten. Es ist witzigzuzusehen, aber auch tragisch. Im inszeni- erten Briefwechsel zwischen Gottfried Boehm und W.J.T. Mitchell nehmen beide diese Position hoffentlich nicht ganz so ernst.
« Als ich schliesslich Deine Arbeiten gelesen und Dich auch persönlich kennen gelernt habe, gewann ich den Eindruck, als hätten sich zwei Waldläufer ( Trapper) getroffen, die den gleichen, kaum bekannten Kontinent der bildlichen Phänomene und der Visualität durchstreift hatten, um da und dort Messpunkte anzulegen, ihn als wissenschaftliches Terrain neu zu erschlies sen, bevor sie dann, wie es sich in dieser Art von Erzählung des Typs « Lederstrumpf » gehört, ihre jeweiligen Wege weitergehen. » (Gottfried Boehm in « Bilderfragen » , 7, S. 28)
Es geht mir ein wenig wie einem Eingeborenen, der dem seltsamen Treiben der Safarijäger zusehen muss. Ich weiss nicht ob ich lachen oder heulen soll.
Innerhalb der Bildund Kunstwissenschaften erscheint Erwin Panofsky als eine Ausnahme, da er eine Systematik der Deutung von Werken der Kunst entworfen hat, die heute noch angewendet und oft zitiert wird. Die Zitate von Panofsky stammen aus den Werken « Sinn und Deutung in der bildenden Kunst» (8) und «Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaft» (9). Die folgende tabellarische Gliederung wurde von Panofsky im Laufe der Zeit in mehreren Schritten differenziert und spiegelt eine Systematik der Betrachtung von Werken der bildenden Kunst. Für die Betrach- tung profaner oder alltäglicher Bilder und die Bildbetrachtung im Unterricht kann die Systematik ebenfalls verwendet werden, sie müsste aber, wie ich es unten vornehme, begrifflich anders gewichtet werden. Im Schema von Panofsky ist von oben nach unten eine schrittweise Abstufung von einer phänomenologischen zu einer dokumentarischen Deu- tung zu erkennen. In einer älteren Fassung spricht er auch von den Schichten Phänomensinn, Bedeutungssinn und Dokumentsinn. In der ersten und obersten Stufe (I) werden die Formen und Farben innerhalb des Bildes, soweit das möglich ist, als dargestellte oder abgebildete Gegenstände identifiziert. Der Bedeutungssinn (II) kann anschliessend die erkannten Gegenstände, Personen oder Situationen z.B. einer historischen, religiösen oder literarischen Erzählung zuordnen.Mit dem Dokumentsinn (III) wird das Bild und die Art der Darstellung im historischen und kulturellen Kontext erläutert. Wie Felix Thürlemann im Band Bildtheorien (10, S. 214) ausführt, war es nicht Panofskys primäre Absicht, mit diesem Modell ein Interpretationsrezept zu liefern, sondern sozusagen eine Mechanik und damit die auch die Beschränktheit des Interpretationsvorganges zu beschreiben.
« Ich habe in einer synoptischen Tabelle zusammengefasst, was ich bis hierher deutlich zu machen versucht habe. Aber wir müssen in Erinnerung behalten, dass die säuberlich geschiedenen Kategorien, die in dieser synoptischen Tabelle drei unab- hängige Bedeutungssphären anzuzeigen scheinen, sich in Wirklichkeit auf Aspekte eines Phänomens beziehen, nämlich auf das Kunstwerk als Ganzes, so dass bei der eigentlichen Arbeit die Zugangsmethoden, die hier als drei unzusammenhängende Forschungsoperationen erscheinen, miteinander zu einem einzigen organischen und unteilbaren Prozess verschmelzen. » (8, S. 49)
- Arbeit zitieren
- dipl. Lehrer für Bildnerische Gestaltung Mario Leimbacher (Autor:in), 2010, Die Bildfalle: Das Problem der Bildtheorie mit der Ähnlichkeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196676
Kostenlos Autor werden









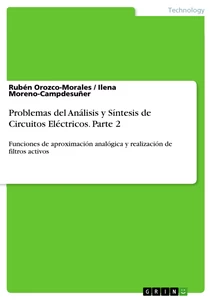



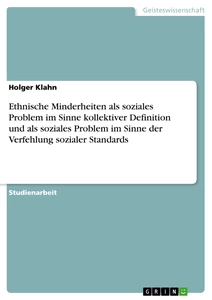






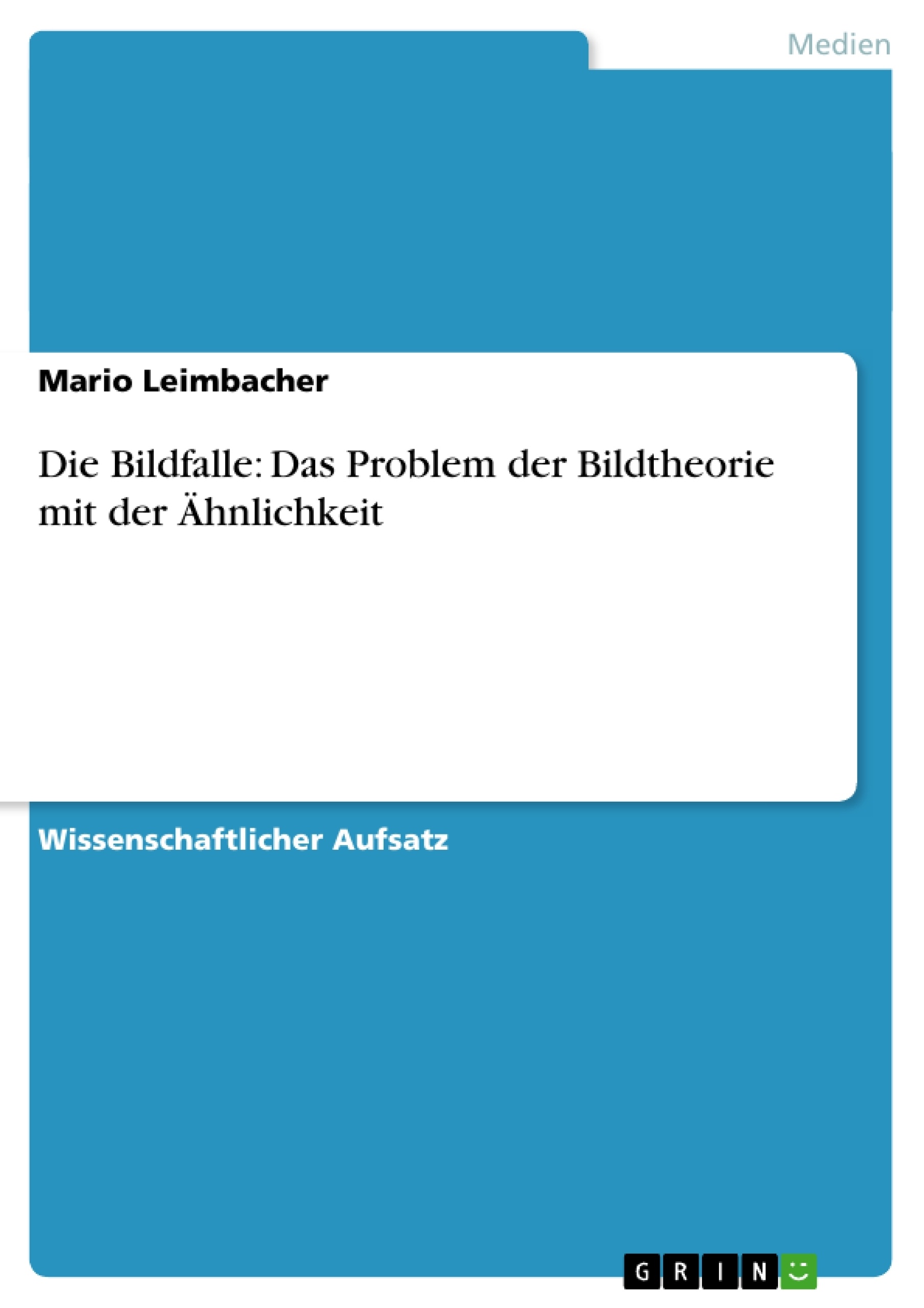

Kommentare