Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
1.2. Zielsetzung und Eingrenzung
1.3. Vorgehensweise
2. Marketingtheoretische Grundlagen
2.1. Kommunikationspolitik: Definition, Ziele und Instrumente
2.2. Kundenorientierung durch integrierte Kommunikation
2.3. Ökonomische Bedeutung des Beziehungsmarketing
2.4. Konsumentenverhalten
2.5. Involvementkonstrukt und Low Involvement-Märkte
3. Social Media
3.1. Definition und Relevanz von Social Media Marketing
3.2. Social Media-Känale - Charakteristik und Einsatzmöglichkeiten
3.2.1. SozialeNetzwerke
3.2.2. Blogs
3.2.3. Microblogs
3.2.4. Video-Sharing
3.3. Chancen und Risiken von Social Media Marketing
4. Erfolg
4.1. Erfolgsbegriff
4.2. Erfolgsfaktorenforschung
4.3. Erfolg von Social Media-Präsenzen
5. Kommunikation und Social Media in der Versicherungsbranche
5.1. Besonderheiten des Versicherungsprodukts als Rahmenbedingung für die Marketing-Kommunikation
5.2. Kommunikationspolitik und Kundenorientierung in der Versicherungs- branche
5.3. Involvement und Konsumentenverhalten im Versicherungsmarkt
5.4. Social Media-Präsenzen von Unternehmen der Versicherungsbranche - eine Bestandsaufnahme
5.5. Praktische Ansätze der Erfolgsmessung von Social Media-Präsenzen
6. Praktische Untersuchung
6.1. Aktueller Stand der Forschung zu Social Media in der Versicherungs- branche
6.2. Analyse von Social Media-Präsenzen der Versicherungsbranche im Hinblick auf Erfolgsindikatoren
6.2.1. Erfolgsanalyse von Twitter-Präsenzen deutscher Versicherer
6.2.2. Erfolgsanalyse von Facebook-Präsenzen deutscher Versicherer
6.2.3. Erfolgsanalyse von YouTube-Präsenzen deutscher Versicherer
6.2.4. Erfolgsanalyse von Unternehmens-Blogs deutscher Versicherer
6.2.5. Erfolgsanalyse von Xing-Präsenzen deutscher Versicherer
6.2.6. Zusammenfassung der Analyse von Social Media-Präsenzen deutscher Versicherer im Hinblick auf Erfolgsindikatoren
6.3. Hypothesenbildung
6.4. Hypothesentest: Erhebungsmethodik
6.4.1. Grundgesamtheit und Stichprobe
6.4.2. Erhebungsmethode und Erhebungsdurchführung
6.4.3. Beschreibung des Fragebogens
6.5. Auswertung der empirischen Ergebnisse und Hypothesenprüfung
6.6. Zusammenfassung der empirischen Befunde
7. Fazit und Ausblick
7.1. Zusammenfassung und Implikationen
7.2. Weiterer Forschungsbedarf
8. Literaturverzeichnis
8.1. Gedruckte Quellen
8.2. Internetquellen
Anhang
Anhang 1: Nutzerzahlen und Beiträge der Social Media-Präsenzen deutscher Versicherer
Anhang 2: Nutzerzuwachs der Social Media-Präsenzen deutscher Ver- sicherer
Anhang 3: Berechnung der Rangliste „Bekanntheit und Sichtbarkeit erhöhen“
Anhang 4: Berechnung der Rangliste „Kundenbeziehungsmanagement optimieren“
Anhang 5: Fragebogen „Versicherungen und Social Media“
Anhang 6: Erhebungsdaten „Versicherungen und Social Media“
Anhang 7: Erhebungsdaten „Involvement im Branchenvergleich“
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Der Marketing-Mix
Abbildung 2: Beispielhafte Nutzung mehrerer Kanäle im Kaufprozess
Abbildung 3: Integrierte Kommunikation und Kundenorientierung
Abbildung 4: Erfolgskette der Kundenorientierung
Abbildung 5: Nutzen langfristiger Kundenbeziehungen
Abbildung 6: Determinanten des Konsumentenverhaltens
Abbildung 7: Das komplexe Konstrukt des Involvements
Abbildung 8: Durchschnittliche Dauer von Online-Aktivitäten
Abbildung 9: Verwendung von Social Media-Taktiken zu Marketingzwecken
Abbildung 10: Die drei Leistungsebenen des Versicherungsproduktes
Abbildung 11: Anzahl und Aktivität von Followern auf Twitter
Abbildung 12: Nutzerzuwachs auf Twitter
Abbildung 13: Anzahl und Aktivität von Fans auf Facebook
Abbildung 14: Nutzerzuwachs auf Facebook
Abbildung 15: Aktivität von Versicherern und Nutzern in Unternehmens-Blogs
Abbildung 16: Anzahl und Aktivität von Abonnenten bei Xing
Abbildung 17: Antworten auf Frage 1
Abbildung 18: Antworten auf Frage 25
Abbildung 19: Inhaltliche Begeisterung und Sympathie für das Unternehmen
Abbildung 20: Aktivierung und Abschluss- bzw. Zahlungsverhalten
Abbildung 21: Aktivierung und Sympathie
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Beispiel für eine Social Media Balanced Scorecard
Tabelle 2: Ziele und Erfolgsindikatoren von Social Media-Präsenzen
Tabelle 3: Präsenz deutscher Versicherer auf ausgewählten SM-Plattformen
Tabelle 4: Gesamtrankings Erfolgsmessung
Tabelle 5: Antworten auf Frage 2
Tabelle 6: Kundenorientierung und Unternehmenserfolg
Tabelle 7: Aktivierung und Kundenbindung
1. Einleitung
1.1. Problemstellung
„Märkte sind Gespräche“, so lautet die erste These des Cluetrain Manifests.1 Diese bereits vor zwölf Jahren getroffene Aussage ist heute zutreffender denn je. Ein großer Teil des sozialen Lebens und der wirtschaftlichen Aktivitäten hat sich in das Internet verlagert. Das Social Web verändert Märkte und das Verhältnis zwischen Unternehmen und ihren Kunden. In Vergleichsportalen und Foren werden Marken und Produkte diskutiert, beurteilt und empfohlen oder abgelehnt. Über soziale Netzwerke und Microblogging versuchen Unternehmen, sich auf neuen Wegen zu präsentieren und mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Märkte werden transparenter, der Konsument spricht mit.
Ein Großteil der deutschen Bevölkerung nimmt an diesem Geschehen teil, mehr als 50 Millionen Deutsche sind online. Erste Unternehmen haben bereits erfolgreich unter Beweis gestellt, dass das Social Web Möglichkeiten bietet, sich vom Wett- bewerb zu differenzieren und Kunden zu gewinnen oder zu binden. Hierfür ist von grundlegender Bedeutung, dass Interesse und Aktivität seitens der Konsumenten geweckt werden. Nur über deren Beteiligung können Unternehmen im Social Web erfolgreich sein.
Die deutsche Versicherungsbranche steckt diesbezüglich in den Kinderschuhen. Von den über 15 Millionen aktiven Facebook-Nutzern in Deutschland nutzt nur ein verschwindend geringer Teil die Präsenzen von Versicherern. Das überrascht auf den ersten Blick kaum: „Versicherungen sind nicht sexy“ - diese Redewendung ist mittlerweile bis in die Vorstandsetagen der deutschen Assekuranz vorgedrungen. Von einem stärker wirtschaftswissenschaftlich geprägten Standpunkt aus kann konstatiert werden, dass der Versicherungsmarkt mit seinen Produkten für Kunden nur von geringem Interesse ist. Der innere Antrieb, sich mit dieser Branche aus- einanderzusetzen, hält sich bei den meisten Menschen in Grenzen - der Versiche- rungsmarkt gilt als Low Involvement-Markt.
Darüber hinaus haben bei klassischen Versicherern die Kunden meist keine Bezie- hung zum Unternehmen an sich, sondern zum Berater. Direktversicherer treten zwar mit den Kunden selbst in Kontakt, dies aber auf vergleichsweise anonymen
Wegen wie Internet und Telefon. Möglicherweise liegt auch hier ein Grund für die geringe Anteilnahme der Nutzer an Social Media-Angeboten der Versicherungsunternehmen: Sie haben keinen Bezug zur Marke.
Dennoch streben immer mehr Versicherungsunternehmen in das Social Web, eröffnen Präsenzen und versuchen diese zu etablieren. Wo eine Profilierung über das reine Produktangebot zunehmend schwieriger wird, versuchen Versicherer auf neuen Wegen Kunden zu erreichen. Und es gibt durchaus Nutzer, die diese Angebote in Anspruch nehmen - wenn auch ihre Anzahl im Vergleich zu anderen Branchen insgesamt gering erscheint.
1.2. Zielsetzung und Eingrenzung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu eruieren, was Kunden und Interessenten be- wegt, die Social Media-Präsenzen von Unternehmen der Versicherungsbranche zu nutzen. Da soziale Medien nutzerbestimmte Kanäle sind, impliziert dies die Suche nach potenziellen Erfolgsfaktoren. Welche Ziele verfolgen Versicherer mit einem Engagement im Social Web und können plattformübergreifende Determinanten bestimmt werden, die der Zielerreichung dienlich sind? Welche Auswirkungen hat Social Media Marketing auf die Wahrnehmung des Versicherers durch die Kunden und auf den ökonomischem Erfolg? Denn auch wenn Märkte Gespräche sind, be- wegt sich ein Vertreter der Assekuranz letztlich immer im Spannungsfeld aus so- zialem Nutzen und wirtschaftlicher Attraktivität.
Berücksichtigung finden dabei nur diejenigen Social Media-Angebote, die von den Versicherungsunternehmen selbst initiiert werden. Auf diese können die Unter- nehmen direkt Einfluss nehmen, Erfolgsfaktoren können wirksam abgeleitet und umgesetzt werden. Ausgeschlossen von der Betrachtung werden hingegen Be- wertungsportale und andere Plattformen, auf denen über Versicherungen diskutiert wird, da diese höchstens indirekt zu steuern sind. Im Mittelpunkt der Analyse sollen am deutschen Markt tätige Erstversicherer stehen, die Privatkunden direkt anspre- chen. Damit werden Zielgruppen wie Makler und Mitarbeiter ausgeschlossen. Dies betrifft auch die zahlreichen Recruiting-Präsenzen. Gleichzeitig sollen keine Ver- mittler- oder Makler-Präsenzen, sondern die offiziellen Unternehmens-Auftritte be- trachtet werden. Allerdings gibt es Grenzfälle, in denen diese nicht eindeutig abzu- grenzen sind, da teilweise Mitarbeiter Präsenzen im Social Web aufbauen und diese als Unternehmens-Präsenz darstellen. Es ist somit nicht vollständig auszu- schließen, dass ein solches Angebot in der Untersuchung berücksichtigt wird. Gesetzliche Krankenkassen bleiben außen vor. Diese bilden einen Zweig der Sozialversicherungen in Deutschland. Zwar stehen die gesetzlichen Krankenversicherer im Wettbewerb untereinander, bilden aber einen weitgehend eigenen Markt. Mit der Konzentration auf das Social Web werden andere Tools des Web 2.0 bewusst ausgeschlossen - etwa Online-Beratungstools oder Rich Media, d.h. optisch und akustisch unterstütze Inhalte auf Webseiten der Versicherer.
1.3. Vorgehensweise
Zunächst werden in Kapitel 2 die marketingtheoretischen Grundlagen dargestellt. Den Rahmen für die Social Media-Aktivitäten bildet die Kommunikationspolitik. Weiterhin wird das Konsumentenverhalten - insbesondere auf den ebenfalls zu definierenden Low Involvement-Märkten - näher beleuchtet, um eine Annäherung an mögliche Erklärungen für Aktionen und Reaktionen von Nutzern zu erreichen. Schließlich sollen die vor dem Hintergrund von Social Media Marketing zunehmend relevante integrierte Kommunikation als Basis für Kundenorientierung sowie deren ökonomische Wirkung dargestellt werden.
Kapitel 3 stellt Social Media detailliert vor. Ausgehend von einer Definition des Be- griffes sowie der Darstellung der Relevanz für das Marketing sollen häufig verwen- dete Kanäle und Plattformen charakterisiert werden. Die Darstellung folgt der ak- tuellen Schwerpunktsetzung der deutschen Assekuranz, es werden also vornehm- lich diejenigen Kanäle beschrieben, die von der Mehrzahl der Versicherer genutzt werden. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über Chancen und Risiken des Social Media Marketing ab.
In Kapitel 4 sollen der Begriff des Erfolgs sowie die Erfolgsfaktorenforschung näher beleuchtet werden. Auf dieser Basis wird abschließend theoretisch erläutert, wie Erfolg von Social Media-Präsenzen definiert werden kann.
Mit Kapitel 5 beginnt die praktische Untersuchung, indem die bisherigen theoreti- schen Erkenntnisse auf die Versicherungsbranche übertragen werden. Dafür müs- sen zunächst die Besonderheiten des Versicherungsprodukts dargestellt werden. Darauf aufbauend soll geklärt werden, welche Rolle Kommunikationspolitik, Kun- denorientierung und Social Media für die Assekuranz spielen. Das Konstrukt des Involvements wird in seiner praktischen Bedeutung für die Branche beleuchtet, wofür sowohl das Versicherungsprodukt als auch die Positionierung der Unterneh- men relevant sind. In einem letzten Schritt werden Indikatoren für die Erfolgsmessung von Social Media-Präsenzen abgeleitet.
Diese Indikatoren bilden die Grundlage für die Analyse in Kapitel 6. Bestehende Präsenzen von Unternehmen der Versicherungsbranche im Social Web werden anhand dieser Maßstäbe untersucht. Den zweiten Teil der praktischen Untersu- chung bildet die Befragung der Nutzer von Social Media-Präsenzen deutscher Ver- sicherungsunternehmen. Hierbei steht im Fokus, Verhalten und Motivation poten- zieller Kunden zu beleuchten und daraus Erfolgsfaktoren abzuleiten. Diese sollen schließlich mit den Ergebnissen des ersten Untersuchungsteils in Verbindung ge- setzt und interpretiert werden.
Kapitel 7 schließt die Arbeit mit einem Fazit und dem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf ab.
2. Marketingtheoretische Grundlagen
2.1. Kommunikationspolitik: Definition, Ziele und Instrumente
Die Kommunikationspolitik stellt einen Bereich operativer Maßnahmen im klassi- schen Marketing-Mix dar. „Der Begriff des Marketing-Mix geht zurück auf McCarthy’s klassische four P’s (product, price, place, promotion) und bezeichnet die von einem Unternehmen eingesetzte Kombination von marketingpolitischen Instrumenten.“2 Weitere Bereiche operativer Marketing-Maßnahmen sind Produkt-, Kontrahierungs- und Distributionspolitik. Die Marketinginstrumente werden zur Marktbearbeitung eingesetzt. Die Systematik ist in Abbildung 1 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Runia u.a. (2007), S. 126.
Abbildung 1: Der Marketing-Mix
Innerhalb der Kommunikationspolitik stehen wiederum verschiedene Instrumente zur Verfügung: Klassisch werden die Kommunikationsinstrumente in die Teilberei- che Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und persönlicher Verkauf unterteilt.3 Daneben gibt es moderne Instrumente, zu denen in der Regel das Direktmarketing, Sponsoring, Event-Marketing, Product Placement und Online- Marketing gezählt werden.4 Unter das Online-Marketing kann auch das Social Me- dia Marketing gefasst werden.5
Alle Maßnahmen der Kommunikationspolitik zielen darauf ab, dass relevante Marktteilnehmer vom Leistungsangebot in ausreichendem Umfang erfahren, Inte- resse dafür entwickeln, sich rational und emotional angesprochen fühlen und das Produkt oder die Dienstleistung kaufen. Der Kommunikationspolitik kommen somit die Aufgaben zu, potenzielle Nachfrager zu informieren, sie gezielt zu beeinflussen und Absatzwiderstände zu überwinden.6 Kommunikation kann in diesem Zusammenhang definiert werden als „die bewußte Beeinflussung marktwirksamer Meinungen mittels Instrumentaleinsatz mit der Absicht, die Meinungsrealität im Markt den eigenen Zielvorstellungen anzugleichen.“7 Damit wird deutlich, dass in der Marketing-Kommunikation nicht die Sach-Ebene entscheidend ist, sondern die Vorstellung der Zielpersonen darüber, d.h. eine emotionale Meta-Ebene, welche die rationale Sach-Ebene überlagert.8
Kommunikationspolitik kann genutzt werden, um Alleinstellungsmerkmale zu schaffen: In gesättigten, stark segmentierten und von vielen Anbietern mit aus- tauschbaren Produkten besetzten Märkten sind produktbezogene, einzigartige und für die Zielgruppe relevante Merkmale kaum zu finden. An die Stelle einer solchen Unique Selling Proposition (USP) tritt zunehmend eine kommunikationspolitisch orientierte Alleinstellung, die als Unique Advertising Proposition (UAP) bezeichnet wird. Diese konzentriert sich auf diejenige alleinstellende Positionierung, welche durch die Werbeleistung erzeugt wird.9 Ein austauschbares Produkt kann durch Instrumente der Kommunikationspolitik in der Wahrnehmung der Zielgruppe mit einem unverwechselbaren Erlebnisprofil verbunden werden. Voraussetzung ist, dass das Erlebnisprofil für die Zielgruppe relevant, langfristig gültig und nicht be- reits vom Wettbewerb besetzt ist.10
Eine maßgebliche emotionale Beeinflussung der Zielpersonen lässt sich über Bil- der erreichen. Mit einem Schlüsselbild, welches als konstantes Element über einen längeren Zeitraum die Kommunikation der Marke zentral prägt, wird versucht, „ein inneres Bild über die Marke in den Köpfen der Zielgruppe zu verankern“.11 Durch die emotionale Bindung an die Marke wird eine Erlebnisprofilierung unterstützt.12 Letztlich ist das Hauptziel der Kommunikationspolitik, das Angebot so zu positio- nieren, dass es für Abnehmer attraktiv wird und sich von der Konkurrenz abhebt.13 Für Produkte wie Versicherungen, bei denen Spontankäufe zumindest unwahr- scheinlich sind, ist eine langfristige Beeinflussung notwendig. Durch regelmäßige Wahrnehmung einer Marke steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese bei der Kauf- entscheidung berücksichtigt wird. Dies bedingt eine eindeutige Positionierung der Marke, welche wiederum durch eine klar fokussierte Kommunikationsstrategie er- reicht werden kann.14
2.2. Kundenorientierung durch integrierte Kommunikation
Um Kunden über Marketing-Kommunikation zu erreichen, muss ein Unternehmen sich dem Kundenverhalten anpassen. Dieses hat sich in den letzten Jahren verän- dert: Erstens gibt es einen Wandel von einseitiger Push-Kommunikation zur Pull- Kommunikation, in der Unternehmen und Kunde als gleichberechtigte Partner fun- gieren und es zum Dialog zwischen beiden kommt.15 Zweitens entscheidet der Kunde selbst, auf welchen Kanälen, wo und wann er sich welcher Kommunika- tionsbotschaft aussetzt. Selbst innerhalb der verschiedenen Phasen eines einzigen Kaufprozesses greift der Kunde unter Umständen auf mehrere Kanäle zur Kontakt- aufnahme zurück.16 Dabei kann jeder Kunde unterschiedliche Präferenzen haben, wie die Abbildung 2 beispielhaft zeigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an Rentzmann, R. u.a. (2011), S. 148.
Abbildung 2: Beispielhafte Nutzung mehrerer Kanäle im Kaufprozess
Der andauernde Dialog zwischen Anbieter und Kunden über verschiedenste Kon- taktpunkte muss darauf ausgerichtet sein, die Kundenbeziehung sicherzustellen und die Effektivität von Marketingmaßnahmen zu erhöhen.17 Dabei ist seitens der Unternehmen stets ein einheitliches Auftreten zu gewährleisten - ein Konzept, das sich im Begriff der integrierten Kommunikation manifestiert.18 Mittels integrierter Kommunikation soll eine durchgängige Betreuung der Kunden realisiert werden - unabhängig vom Kanal, über den die Interaktion erfolgt.19 Abbildung 3 zeigt den Zusammenhang zwischen integrierter Kommunikation und Kundenorientierung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Bruhn, M. (2007), S. 272.
Abbildung 3: Integrierte Kommunikation und Kundenorientierung
Neben dem Leistungsangebot wirkt die Interaktion als wesentlicher Faktor der Kundenorientierung. Bei Dienstleistungen stellt die Interaktion gar einen Teil der Leistung dar und ist relevanter Bestandteil der Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden.20 Gerade im Bereich geringen Involvements ist die integrierte Kommunikation von hoher Bedeutung, um durch Wiederholung die Lernprozesse im Hinblick auf die werbliche Botschaft zu initiieren.21
Der Begriff der Kundenorientierung kann wie folgt definiert werden: „Kundenorien- tierung ist die umfassende, kontinuierliche Ermittlung und Analyse der individuellen Kundenerwartungen sowie deren interne und externe Umsetzung in unternehmeri- sche Lösungen sowie Interaktionen … mit dem Ziel, langfristig stabile und ökono- misch vorteilhafte Kundenbeziehungen zu etablieren.“22 Attraktive Kundengruppen oder einzelne Kunden stehen im Mittelpunkt der Unternehmensaktivitäten und sind Ansatzpunkt für Marketingstrategien.23 Die konsequente Ausrichtung sämtlicher Unternehmensaktivitäten an den Bedürfnissen und Wünschen der Kunden soll den Beziehungsaufbau zwischen Anbieter und Konsument unterstützen, um schließlich eine Bindung der Kunden an das Unternehmen zu erreichen.24
2.3. Ökonomische Bedeutung des Beziehungsmarketing
Auch wenn es um Wissen über Kundenwünsche geht und Prozesse wie Leitungsangebote den spezifischen Kundenbedürfnissen angepasst werden sollen, so ist die Zielsetzung des Beziehungsmarketing ökonomischer Art: Durch bestmögliche Kenntnis des Kunden soll seine Profitabilität gesteigert, sein Share of Wallet erhöht werden.25 Die in Abbildung 4 dargestellte Erfolgskette bildet grundlegendes konzeptionelles Denken in diesem Sinne ab: Kundenorientierung ist die Basis für den ökonomischen Erfolg des Unternehmens.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Bruhn, M. (2007), S. 11.
Abbildung 4: Erfolgskette der Kundenorientierung
In der Erfolgskette sind Variablen inhaltlich verknüpft, stehen miteinander in Zu- sammenhang und wirken aufeinander ein. Allerdings sind die Zusammenhänge nicht zwangsläufig das Resultat der jeweils vorausgehenden Variablen, da sie von unternehmensexternen und -internen Faktoren beeinflusst werden. Unternehmen entwickeln Steuerungssysteme, die diese Faktoren kontrollieren sollen. Dazu ge- hören Instrumente der Interaktion wie das Beschwerde- und Kundenbindungs- management sowie das integrierte Kommunikationsmanagement und Instrumente des Leistungsangebots, etwa Qualitäts- und Servicemanagement.26 Kundenbindung verspricht ökonomischen Erfolg sowohl auf Erlös- als auch auf Kostenseite. Abbildung 5 zeigt exemplarisch auf, dass die Dauer der Geschäfts- beziehung direkte Auswirkungen auf den Gewinn pro Kunde haben kann.27
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Reichheld, F. F., Sasser, W. E. (1990), S. 108.
Abbildung 5: Nutzen langfristiger Kundenbeziehungen
Mit der Zeit nehmen Zahlungsbereitschaft des Kunden und Cross-Selling-Gewinne zu. Erfahrungseffekte führen zu geringeren Kosten, gleichzeitig profitiert das Unternehmen von zusätzlichen Erträgen aus Empfehlungen seiner Kunden an andere Marktteilnehmer.28 Zielführend ist somit nicht die Optimierung des einzelnen Verkaufsabschlusses, sondern das „Denken in langfristigen Geschäftsbeziehungen mit dem Ziel der wertorientierten Unternehmensführung“.29
2.4. Konsumentenverhalten
Die Kommunikationspolitik versucht mittels des Einsatzes ihrer Instrumente, Kon- sumenten in deren Verhalten zu beeinflussen. Konsumentenverhalten ist das Ver- halten von Menschen beim Kauf oder Konsum von wirtschaftlichen Gütern, also das individuelle Kaufverhalten privater Konsumenten.30 Es umschließt sowohl das beobachtbare Verhalten als auch die inneren Vorgänge.31 Der optimale Einsatz von Marketinginstrumenten hängt von Kenntnissen über die relevante Zielgruppe und deren Verhalten ab.32
Ursprünglich geht die Wirtschaftswissenschaft vom Homo Oeconomicus, dem ra- tionalen Käufer aus, der über vollständige Informationen verfügt und seinen Nutzen optimiert.33 Dieser Ansatz ist für verhaltenswissenschaftliche Betrachtungen wenig nutzbringend: Konsumentenverhalten unterliegt inneren Prozessen der Person, wird von externen Faktoren beeinflusst und kann situationsspezifisch unterschied- lich ausfallen.34
Behavioristische Ansätze erklären das Zustandekommen von Konsumentenverhalten innerhalb von Stimulus-Response- (SR-) oder Reiz-Reaktions-Modellen. Auf einen Reiz, z. B. eine Verkaufsförderungsaktion, folgt eine Reaktion, die durch den Reiz ausgelöst wurde, z. B. der Produktkauf. Bei diesen SR-Modellen wird der Konsument als „Black Box“ verstanden, innere Prozesse werden nicht durchleuchtet. Empirisch sind diese Ansätze nicht haltbar, da bei gleichem Reiz unterschiedliche Verhaltensreaktionen beobachtbar sind: Nicht jeder Konsument reagiert auf eine Verkaufsförderungsaktion mit einem Produktkauf.
Der Neo-Behaviorismus bezieht die nicht-beobachtbaren Vorgänge innerhalb des Organismus mit in die Betrachtung ein, weshalb von Stimulus-Organismus-Res- ponse-Modellen (SOR-Modellen) gesprochen wird. Innerhalb dieser Ansätze ver-
Dieser Wert kann aus Anbietersicht definiert werden als der über den gesamten Kundenlebenszyklus dem Unternehmen zugeführte Erfolgsbeitrag des Kunden. Er resultiert sowohl aus direkten geschäftlichen Transaktionen wie auch aus Aktivitäten wie der Weiterempfehlung. Vgl. Grabner-Kräuter, S., Schwarz-Musch, A. (2009), S. 188; vgl. Günter, B., Helm, S. (2011), S. 274; vgl. Winkelmann, P. (2008), S. 319.
suchen Partial- und Totalmodelle die Abläufe im Organismus zu erklären. Partialmodelle betrachten vornehmlich einen dominanten Aspekt, Totalmodelle versuchen, alle Variablen gleichzeitig einzubeziehen.35 Die Vielfalt der Einflüsse und möglichen Sichtweisen ist in Abbildung 6 dargestellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Swoboda, B., Foscht, T. (2011), o.S.
Abbildung 6: Determinanten des Konsumentenverhaltens
Für die vorliegende Arbeit von besonderer Bedeutung sind das Involvement des Konsumenten, die Emotion im Bereich der aktivierenden Prozesse, Meinungsführer als Umwelt-Determinante sowie die - bereits in Kapitel 2.2 und 2.3 behandelten - Bereiche der Kundenzufriedenheit und Kundenbindung. Das Involvement wird in Kapitel 2.5 ausführlicher behandelt.
Emotionen sind innere Erregungen, die als angenehm oder unangenehm empfun- den und mehr oder weniger bewusst erlebt werden.36 Sie gehören zu den aktivierenden Prozessen, d.h. zu inneren Vorgängen, die mit Erregungen und Spannungen verbunden sind und das Verhalten antreiben.37 Es gibt eine Reihe von Emotionen, die biologisch bedingt, also nicht aus der sozialen Umwelt erlernt sind. Dazu gehören Angst, Ärger, Ekel, Kummer, Freude, Überraschung, Verachtung, Interesse, Scham und Reue.38 Für das Marketing sind Emotionen und Gefühle von Bedeutung, weil durch sie aktivierte Konsumenten beispielsweise auf Werbung besser reagieren.39 Sie nehmen mehr Informationen auf und verarbeiten diese schneller und besser.40 Emotionen werden daher gezielt vermittelt, sei es durch Bilder, Worte, Musik oder andere Auslöser.41 Mittels Erlebnismarketing und emotionaler Differenzierung durch Werbung werden Emotionen eingesetzt, um Konsumentenverhalten zu beeinflussen: „Die Einstellung zu einer Marke lässt sich durch emotionale Werbung - auch ohne jede Produktinformation - ändern (verbessern).“42 Ohne emotionale Beziehungen des Konsumenten zum Anbieter oder Produkt ist ein dauerhafter Markterfolg kaum möglich.43
Je höher die emotionale Bindung eines Kunden an eine Marke ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich für diese als Meinungsführer engagiert.44 Mei- nungsführer werden im Marketing definiert als Personen, die im Kommunikations- prozess den Transfer zwischen Unternehmen und Konsument leisten. Es sind Mul- tiplikatoren, die besonders aktiv sind und oft großen Einfluss auf andere Gruppen- mitglieder haben. Durch Mund-Propaganda tragen sie zur Meinungsbildung in der Gruppe bei. Allerdings üben Meinungsführer nur dann Einfluss aus, wenn ihre Kontaktpartner an den Themen interessiert sind - oder zumindest die Möglichkeit besteht, ihr Interesse zu wecken. Das Internet bietet den Vorteil, dass Meinungs- führer einen größeren Teil von Konsumenten erreichen können.45 Beispielsweise erfahren Blogger oft besonders starke Akzeptanz, weil sie als unabhängig und ver- trauenswürdig angesehen werden.46
2.5. Involvementkonstrukt und Low Involvement-Märkte
Auf einem Markt setzen Anbieter Marketing-Instrumente ein, um Absatzwider- stände zu reduzieren, die Nachfrager vom eigenen Angebot zu überzeugen und die eigene Position gegenüber dem Wettbewerb zu stärken.47 Das Entscheidungsver- halten von Konsumenten ist in hohem Maße vom Involvement abhängig.48 Der Be- griff Involvement bezeichnet „die Ich-Beteiligung bzw. das gedankliche Engage- ment und die damit verbundene Aktivierung, mit der sich jemand einem Sachver- halt oder einer Aktivität zuwendet.“49 Er beschreibt die wahrgenommene Wichtigkeit für den Konsumenten.50 Das Involvement kann durch den Konsumenten selbst, sein Wissen oder einen starken Anreiz endogen begründet sein oder aber exogen z.B. durch aufmerksamkeitserregende Werbung. Es kann auch als Informations- motiv verstanden werden.51 Das Involvement-Modell als Werbewirkungsmodell be- schreibt das (Kauf-)Verhalten von Konsumenten.52 Involvement stellt insgesamt ein sehr komplexes Konstrukt verschiedener Determinanten dar.53 Zu unterscheiden ist dabei nach dem Bezugsobjekt des Involvements: Beispielsweise bezeichnet der Begriff Produktinvolvement die ausgelöste Involvierung durch die zu kaufende Pro- duktart, während das Botschaftsinvolvement bewirkt, dass eine Botschaft - unab- hängig vom darin beworbenen Produkt - mehr oder weniger interessant ist.54 Mar- keninvolvement kann unabhängig vom Produktinvolvement wirken, wenn bei- spielsweise bei einem Smartphone die Entscheidung für die Marke Apple wichtiger ist als das Produkt.55 Auch im Zeitablauf variiert das Interesse - vor oder nach dem Kauf ist das Produktinvolvement beispielsweise höher als in der restlichen Zeit.56 Verschiedene Involvement-Determinanten und deren Wirkung sind in Abbildung 7 dargestellt.57
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Esch, F.-R. (2001), S. 117.
Abbildung 7: Das komplexe Konstrukt des Involvements
Die häufig verwendeten Begriffe High und Low Involvement stellen keine direkt messbaren Größen dar, sondern graduelle Ausprägungen, die durch die verschie- denen Einflussgrößen des Involvements beeinflusst werden. Als Extremwerte kön- nen ihnen unterschiedliche Konsumentenverhalten zugeordnet werden: Bei hohem Involvement setzen sich die Konsumenten aktiv mit dem Bezugsobjekt auseinan- der, nehmen entsprechende Informationen auf und bilden sich darauf aufbauend ein Urteil zum Beispiel über ein Produkt oder eine Marke.58 Bei geringem Involve- ment ist der Konsument nicht genügend aktiviert, um sich genauere Gedanken über ein Produkt, eine Dienstleistung oder Aktivität zu machen. Er nimmt Informa- tionen nur beschränkt auf, seine Haltung hängt wesentlich von peripheren und emotionalen Eindrücken ab.59 Wenig involvierte Konsumenten benötigen bezogen auf die Marken-Kommunikation eindeutige und mit dem vorhandenen Schema kon- sistente Informationen.60 Voraussetzung ist allerdings, dass die Marke der Ziel- gruppe bekannt ist. Beim Aufbau eines Markenimages übernimmt Werbung eine Prägungsfunktion. Durch regelmäßige Konfrontation der Zielgruppe mit der Marke gilt es, eine positive Einstellung hervorzurufen, auf die der Konsument bei der Kaufentscheidung zurückgreifen kann. Ziel ist, dass zu diesem Zeitpunkt die Einstellung des Konsumenten so stark vorgeprägt ist, dass im Kern die Entscheidung für eine bestimmte Marke bereits vor der Entscheidungsphase zum Kauf gefallen ist.61 Dabei kann in der werblichen Kommunikation ausreichen, wenn diese dem Abnehmer gefällt. Der äußere Eindruck bestimmt den Werbeerfolg. Die daraus entstehende Akzeptanz wird auf die Marke übertragen.62
Low Involvement-Märkte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie von den Wettbe- werbern kaum unterscheidbare Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Rational vorhandene Vorteile können von Wettbewerbern schnell imitiert werden und sind aus Sicht der Zielgruppe nur schwierig zu beurteilen. Den in diesen Märkten tätigen Unternehmen ist es nicht möglich, Nachfrager über faszinierende und erlebbare Produkte an das Unternehmen zu binden. Die wirksamste Art der Bindung eines Kunden an das Unternehmen erfolgt in diesem Fall über Emotionen: Der Aufbau emotionaler Beziehungen benötigt zwar Zeit - gleiches gilt jedoch für die Nachah- mung durch den Wettbewerb. Zudem ist eine emotionale Bindung nur schwer zu imitieren.63 So wird ein überzeugter Apple-Käufer nicht - aufgrund rein technischer Vorteile - ein Gerät vom Wettbewerber kaufen.
3. Social Media
3.1. Definition und Relevanz von Social Media Marketing
„Der Begriff Social Media (soziale Medien) steht für den Austausch von Informa- tionen, Erfahrungen und Sichtweisen mithilfe von Community-Websites. Beispiele für Social Media sind Blogs, Internetforen, Message Boards, Bild- und Videopor- tale, nutzergenerierte Websites, Wikis und Podcasts.“64 Social Media sind inter- netbasierte Applikationen, die ihren ideologischen und technologischen Ursprung im Web 2.0 haben - also jener Weiterentwicklung des Internets, die sich durch die Architektur der Beteiligung der Nutzer auszeichnet.65 Das Social Web ist derjenige Teil des Web 2.0, bei dem es um soziale Strukturen und Interaktionen, nicht aber um die technischen Hintergründe und Programmarchitekturen geht.66 Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf Inhalte des Social Web.
Marketing mit Social Media - oder Social Media Marketing (SMM) - umfasst Stra- tegien und Maßnahmen, um Unternehmen im Social Web erfolgreich zu positionie- ren. Es geht darum, „das Soziale (die Gemeinschaft) durch seine Medien (Kommu- nikation und Tools) nutzbar zu machen, um bei einem Publikum Marketing zu be- treiben.“67 Die praktische Relevanz von SMM wird in Abbildung 8 deutlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Damm, A. (2010b), o.S.
Abbildung 8: Durchschnittliche Dauer von Online-Aktivitäten
Wenn Menschen ins Internet gehen, verbringen sie die meiste Zeit mit Aktivitäten in sozialen Medien. Damit bietet es sich auch für Unternehmen an, im Social Web aktiv zu werden und dort gegenüber potenziellen Kunden Präsenz zu zeigen.
3.2. Social Media-Känale - Charakteristik und Einsatzmöglichkeiten
Sollen Social Media für das Marketing genutzt werden, muss immer das Ziel sein, potenziell attraktive Kunden anzusprechen. Bei der Fülle an Möglichkeiten der deutschen Social Media-Landschaft kann schon die Auswahl des Kanals, auf der ein Profil erstellt werden soll, eine Herausforderung darstellen.68 Einige der populärsten Social Media-Angebote und ihre Einsatzmöglichkeiten als Marketing-Kanal für Unternehmen sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Der Fokus liegt hierbei auf denjenigen Kanälen, die auch in der Versicherungsbranche von erhöhter praktischer Relevanz sind.
3.2.1. Soziale Netzwerke
Soziale Netzwerke bieten Nutzern die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern zu verbinden und auszutauschen. Dies können einerseits Bekannte aus der OfflineWelt, andererseits Nutzer mit ähnlichen Interessen, Ansichten und Hobbys sein. Die Netzwerke basieren auf Profilen, welche individuell anpassbar und mit anderen Profilen verknüpfbar sind.69 Bekannte soziale Netzwerke sind Facebook, Xing, Lokalisten, MySpace, Stayfriends, die VZ-Netzwerke (schülerVZ, studiVZ und meinVZ), und wer-kennt-wen.de.70
Auch Unternehmen können soziale Netzwerke nutzen.71 In vielen Netzwerken gibt es gesonderte Seiten für kommerzielle Mitglieder, über die Neuigkeiten aus dem Unternehmen oder andere Informationen verbreitet werden können. Interessenten und Kunden können auf die Veröffentlichungen reagieren, zum Beispiel, indem sie sie als interessant einstufen oder direkt kommentieren. Allein die Anzahl der Per- sonen, die das Geschehen auf der Unternehmensseite verfolgt, kann Hinweise lie- fern, inwieweit der Anbieter mit seinem Auftritt den Nutzern zusagt.72
Bei Facebook, dem größten der sozialen Netzwerke, bezeugen Nutzer - auch Fans genannt - durch Klick auf einen „Gefällt mir“-Button, dass sie den Nachrichten ei- nes Unternehmens folgen wollen.73 Alle Beiträge, die das Unternehmen fortan auf Facebook veröffentlicht, werden auch auf der Willkommensseite des Nutzers ange- zeigt - zusammen mit Beiträgen seiner Freunde, Bekannten und anderer Unter- nehmen, deren Fan er ist. Die Nachrichten kann jeder Nutzer kommentieren, teilen (also an die eigenen Kontakte weitergeben) oder erneut mittels eines „Gefällt mir“- Links Zustimmung signalisieren. In Deutschland hat Facebook mit Stand Juni 2011 über 20 Millionen aktive Mitglieder, die Tendenz ist stetig steigend.74 Xing ist das in Deutschland am häufigsten im beruflichen Umfeld genutzte soziale Netzwerk.75 Auch dort können Unternehmensnachrichten auf der individuellen Startseite verfolgt, als „interessant“ gekennzeichnet und an die eigenen Kontakte weitergegeben werden.
Die VZ-Netzwerke haben ihre vormals sehr starke Stellung in Deutschland durch den Einfluss von Facebook verloren. Allein bei Schülern und Minderjährigen kann schülerVZ sich noch halten - das Netzwerk bietet einen hohen Jugend- und Datenschutzstandard, den Facebook nicht erfüllt.76 Sollen also systematisch junge Zielgruppen angesprochen werden, so bietet sich schülerVZ als Plattform an. Soziale Netzwerke sind nach einer Studie aus dem Jahr 2010 von MarketingSherpa die deutlichen Gewinner, wenn es um die Nutzung durch Unternehmen zu Marketingzwecken geht.77 Dies zeigt Abbildung 9.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In Anlehnung an: Damm, A. (2010a), o.S.
Abbildung 9: Verwendung von Social Media-Taktiken zu Marketingzwecken
Der häufige Einsatz zu Marketingzwecken hat seine Gründe: Soziale Netzwerke - insbesondere Facebook - erreichen im Internet eine sehr hohe Reichweite. Über die Angaben, welche die Nutzer in ihren Profilen von sich preisgeben, können rela- tiv einfach Erkenntnisse über die relevante Zielgruppe und deren soziales Umfeld gewonnen werden. Neue Kontakte mit relevanten Interessen sind einfach zu lokali- sieren und zu kontaktieren. Durch einen persönlichen und glaubwürdigen Auftritt in sozialen Netzwerken haben Unternehmen die Möglichkeit, das Vertrauen der Nut- zer zu gewinnen oder zu stärken. Auf diese Weise können neue Zielgruppen und Märkte erschlossen werden, die auf herkömmlichem Wege nicht oder nur schlecht erreichbar sind.78 Nachteilig kann sich eine solche Präsenz im Internet auswirken, wenn der Auftritt den Regeln des sozialen Miteinanders widerspricht, beispiels- weise wenn positive Nutzerkommentare seitens des Unternehmens gefälscht wer- den. Auch Präsenzen, die nicht gepflegt werden oder deren Inhalte stark werblich geprägt sind, führen zu negativen Reaktionen auf Nutzerseite und können Reputa- tionsverluste bewirken.79
Die Anbindung Sozialer Netzwerke an Online-Shops ist ebenso möglich wie die Integration von Facebook-Plugins in den eigenen Shop von Anbietern. Diese Art des Vertriebs (Social Commerce) spielt allerdings bisher eine untergeordnete Rolle.
3.2.2. Blogs
Blog ist eine Abkürzung für Weblog. Es handelt sich dabei um eine Art Tagebuch im Internet, welches in umgekehrter chronologischer Reihenfolge Beiträge eines Blog-Autors darstellt. Blogs können auch von Unternehmen ins Leben gerufen und gepflegt werden.80 Die Leser des Blogs können die Beiträge kommentieren. Blogger, blog.de, myblog.de, TypePad und WordPress gehören zu den meist genutzten Blogging-Diensten.81 Bei einigen davon kann das Layout des Blogs dem Corporate Design des Unternehmens angepasst werden.
Unternehmensblogs bzw. Corporate Blogs werden oft vom CEO selbst geführt, es können aber auch Mitarbeiter Beiträge schreiben. Wichtig ist, dass der Blogger un- abhängig berichtet, also das Blog nicht als reine Werbeveranstaltung oder für die Verbreitung von Pressemitteilungen genutzt wird.82 Empfehlungen im kommerziel- len Sinne sollten immer auch offen als solche gekennzeichnet werden.83 Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt, die Berichte können unternehmensnahe Themen ebenso wie allgemeine Gedanken behandeln. Ein Blog sollte als Kommunikations- medium dienen, also auch Interessenten und Kunden zur Diskussion ermutigen und hierbei kritische Kommentare zulassen. In diesem Fall kann das Blog unterstützend wirken, mit potenziellen Kunden Kontakt aufzunehmen und diese im Zweifel von den Qualitäten des Unternehmens zu überzeugen. Bei Fragen kann das Blog als Forum für eine Beratung genutzt werden, die im besten Falle ebenfalls zum Geschäftsabschluss führt.
3.2.3. Microblogs
Die ganze Welt in 140 Zeichen: Über Microblogging-Dienste können die Nutzer kurze, Short-Message-Service- bzw. SMS-ähnliche Textnachrichten veröffentlichen. Diese Kurznachrichten können wiederum von anderen Nutzern (sogenannten Followern) gelesen und kommentiert werden. Der mit Abstand bekannteste Microblogging-Dienst ist Twitter.84
Wie Abbildung 9 gezeigt hat, ist Microblogging eines der häufig genutzten Social Media Instrumente von Unternehmen. Auf Twitter besteht die Möglichkeit, Nachrichten - so genannte Tweets - zu versenden und bei Bedarf über Links beispielsweise auf die Unternehmenswebsite, Blogs oder soziale Netzwerke zu verweisen, wo umfangreichere Informationen zu finden sind. Die Nutzer, die den Informationen eines anderen bei Twitter folgen, werden Follower genannt. Sie haben die Möglichkeit, die Kurznachrichten anderer Nutzer weiter zu verbreiten. Eine solche Wiederholung eines Tweets nennt sich Retweet.
Unternehmen können sich in Microblogs in Gespräche mit Kunden einschalten, Hilfe anbieten und sich als kompetenter Ansprechpartner positionieren. Zudem ist es möglich, die Nachrichten potenzieller Interessenten zu verfolgen und damit ei- nen tiefen Einblick in die Zielgruppe zu erhalten: Was denken die Kunden, wo lie- gen ihre Probleme und welche Themen beschäftigen sie? Wissen, das zielgerichtet eingesetzt werden kann, etwa bei der Produktentwicklung oder der Neukundenak- quise.85 Auch ist es möglich, über Twitter sehr schnell Rückmeldungen zu erhalten. Wenn es darum geht, Entscheidungen im Sinne der Kunden zu treffen, kann auf diese Weise zumindest ein Teil der Kunden auch befragt werden.86
Schließlich kann Twitter sogar umsatzsteigernd wirken: Das populärste Beispiel ist der Computerhersteller Dell, der Angebote über Twitter verbreitet und innerhalb von zwei Jahren einen Umsatz von 6,5 Millionen Dollar über diesen Kanal erwirtschaftete.87
3.2.4. Video-Sharing
Während in anderen Formen des Social Media das geschriebene Wort regiert, können mit Video-Sharing-Diensten auch bewegte Bilder bewertet, kommentiert und weiterempfohlen werden. Zu den prominentesten Video-Sharing-Diensten gehören Clipfish, sevenload und YouTube.88
Auch Unternehmen stellen Videos auf solchen Plattformen ein. Bei YouTube etwa können hierfür eigens Kanäle eingerichtet werden. Diese entsprechen einer eige- nen Präsenz auf der Plattform, auf der allein vom Unternehmen eingestellte Videos gezeigt und kommentiert werden können. Diese Unternehmens-Kanäle können beispielsweise durch die Integration von Logo und Kontaktdaten individualisiert werden. Vermieden werden sollte - wie grundsätzlich im Social Web - ein rein werblicher Auftritt, welcher schnell zur Verärgerung der Nutzer führen kann. Es reicht meist nicht, die eigenen Werbefilme aus dem Fernsehen auch im Internet anzubieten. Um eine möglichst hohe Sichtbarkeit zu erreichen, sind kreative Filme und die weite Verbreitung im Internet notwendig, z.B. auch über Werbung auf an- deren Social Media Plattformen.89 Auf diese Weise können das eigene Unterneh- men bekannt gemacht und die Präsenz in der Zielgruppe erhöht werden.
Inhalte von Video-Sharing-Diensten können seitens der Nutzer bewertet und kommentiert werden. Dieses Feedback sollte beachtet, ernst genommen und beantwortet werden. So kann es gelingen, effizient Neukunden zu gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen zu intensivieren.
3.3. Chancen und Risiken von Social Media Marketing
Vorteile des Social Media Marketing liegen vor allem in der hohen Reichweite, kur- zen Reaktionszeiten und vergleichsweise geringen Kosten. Das Einstellen von In- halten in Plattformen wie Facebook, Twitter, Blogs oder YouTube ist kostenfrei, es fallen lediglich die Personalkosten für Entwicklung und Pflege der Präsenzen an.
Damit ist es grundsätzlich auch möglich, Interessenten mit geringerer Attraktivität bzw. Abschlusswahrscheinlichkeit profitabel zu bearbeiten.90 Ganz nebenbei sorgt die Aktivität in Social Media Plattformen durch die stärkere Verlinkung im Netz und die Nennung von Keywords für eine höhere Präsenz in Suchmaschinen.91 Hauptmerkmal des Social Media Marketing ist, dass die Interessenten und Kunden nicht nur als Empfänger einer Nachricht agieren, sondern aktiv in die Kommunika- tion eingeschaltet werden. Aus dieser Art der konsumentengetriebenen Kommu- nikation resultiert, dass das Unternehmen einen Kontrollverlust akzeptieren muss. Eine Werbebotschaft kann negativ ausgelegt werden, das Unternehmen hat keinen direkten Einfluss auf Inhalt, Anzahl und Intensität von Kommentaren, was zu einem Problem für die Marke führen kann. Die Einbeziehung des Konsumenten in das Hoheitsgebiet Markenkommunikation ist dabei grundsätzlich keine Entscheidung, die das Unternehmen trifft. Verbraucher haben sich seit jeher (in der Offline-Welt) über Produkte und Dienstleistungen ausgetauscht - und tun dies heute zusätzlich online. Der Unterschied ist, dass über Social Media individuelle Meinungen inner- halb von Sekunden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dies kann auf Anbieter bedrohlich wirken. In Social Media besteht aber auch für das Unternehmen die Möglichkeit, sich selbst in Gespräche einzuschalten und diese positiv zu beeinflussen. Der Markeninhaber hat die Chance, auf Bedenken zu ant- worten und Rückmeldung zu geben. Es ist nicht zu verhindern, dass eine Informa- tion im Internet verbreitet wird - es kann aber die Verbreitung der für das Unter- nehmen vorteilhaften Informationen gefördert werden.92 Über den Dialog mit Kun- den und Interessenten können so Beziehungen aufgebaut und die Anforderungen der Konsumenten kennen gelernt werden.93
Der Wandel von einer einseitigen Kommunikation aus Richtung des Unternehmens zum Konsumenten zu einem zweiseitigen Dialog zwischen beiden Partnern führt wie in Kapitel 2.2 dargestellt zur Notwendigkeit der integrierten Kommunikation. Alle Kontaktwege zum Kunden müssen für ein einheitliches Erscheinungsbild des Unternehmens gegenüber dem Kunden aufeinander abgestimmt sein.94 Darüber hinaus bedingt Social Media Marketing eine erhöhte Relevanz von Ehr- lichkeit und Transparenz. Rein werbliche Kommunikation stößt schnell an ihre Grenzen. Der Interessent selbst muss agieren, damit Social Media Marketing funk- tioniert. Dies wird er nur tun, wenn die Interaktion einen Vorteil bietet. Dies kann auch ein spannendes und attraktives Produktangebot sein - in der Regel wird dies allein aber nicht ausreichen. Die Nutzung des Sozialen für das Marketing impliziert eine menschlichere Kommunikation, die auf gemeinsamen Interessen aufbaut. Marken werden zu Freunden.95 Über eine starke Beziehung kann letztlich auch das Involvement des Nutzers erhöht werden. Je stärker die Bindung an das Unterneh- men, desto wahrscheinlicher, dass der Nutzer für höhere Umsätze, Cross-Selling- Werte und Weiterempfehlungsraten sorgt.96 Anders gesagt: Die Ziele des Marke- ting bleiben die gleichen wie außerhalb des Social Web, der Weg sie zu erreichen, ist ein anderer.97
Es dreht sich beim Social Media Marketing alles um Beziehungspflege. Damit wird auch deutlich, dass es sich um ein langfristiges Investment handelt. SMM arbeitet nicht über Nacht, sondern braucht Zeit.98 Wird die Beziehung nicht gepflegt, führt der Auftritt in sozialen Plattformen schnell zu negativen Kommentaren seitens der potenziellen Kunden. Nutzt das Unternehmen hingegen eine Plattform aktiv und geht auf die Nutzer ein, so kann das Verhalten von Interessenten und Kunden deutlich intensiver beobachtet und kennen gelernt werden als dies im Internet zu- vor möglich war - und die Intensität der Beziehung zwischen Kunde und Unter- nehmen kann auch über die der Offline-Welt hinausgehen. Bedürfnisse von Kun- den können ermittelt, Anregungen von Kunden für die Produktentwicklung genutzt werden.99 In der Folge können die Erkenntnisse aus dem Web auch für das erfolgreiche Interessentenmanagement in anderen Kanälen genutzt werden.
Damit liefert Social Media Marketing relevante Informationen für den ökonomischen Erfolg des Unternehmens. „Es gilt also bei solchen Web 2.0-Angeboten das richtige Maß an sozialem Nutzen (für User) und ökonomischer Attraktivität (für Unterneh- men) zu finden.“100
4. Erfolg
4.1. Erfolgsbegriff
Bereits im 17. Jahrhundert entstanden, leitet sich der Begriff „Erfolg“ von „erfolgen“ im Sinne von „erreichen, erlangen“ ab.101 Im heutigen allgemeinen Sprachgebrauch lässt sich Erfolg als positive Wirkung oder Folge von Entscheidungen oder Handlungen definieren.102
Die wissenschaftliche Forschung liefert keine eindeutige Begriffsdefinition, Erfolg stellt sich als komplexes, mehrdimensionales Konstrukt dar.103 Oftmals wird zwi- schen ökonomischem Erfolg und nichtökonomischem Erfolg unterschieden, wobei letzterer beispielsweise als „sozial“ oder „psychologisch“ beschrieben wird.104 Einen Maßstab zur Beurteilung des Erfolgs von Unternehmen liefern in der Regel ökonomische Kriterien, auch wenn Unternehmen nicht allein ökonomische Ziele verfolgen.105 Klassisch wird der Unternehmenserfolg etwa durch den Return on In- vestment, den Cash Flow oder die Umsatzrentabilität beschrieben.106 Ein bekann- ter Ansatz zur Vernetzung finanzieller und nicht-finanzieller Indikatoren ist die Balanced Scorecard. Die in diesem Konzept von Kaplan und Norton verwendeten Kennzahlen beziehen die Interessen verschiedener Anspruchsgruppen mit ein. Durch die Berücksichtigung von vier unterschiedlichen Perspektiven - Finanzen, Kunden, Prozesse, Mitarbeiter - werden die Interessen der Anteilseigner ebenso repräsentiert wie die von Management, Beschäftigten und Kunden.107 Dabei wird deutlich, dass Erfolg immer aus einer subjektiven Sicht bewertet wird und für unter- schiedliche Interessengruppen nicht zwangsläufig einheitlich zu interpretieren ist. Zielkonflikte zwischen solchen Gruppen sind deshalb nicht auszuschließen.108
Wenn Ziele als zukünftige erstrebte Zustände verstanden werden, kann Erfolg als das Erreichen von Zielen angesehen werden.109 In der vorliegenden Arbeit soll Erfolg als „Ergebnis eines zielorientiert gesteuerten .. Handelns zur Erreichung eines angestrebten Zustandes“ definiert werden.110
4.2. Erfolgsfaktorenforschung
Dem Ziel, zentrale Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg zu ergründen, widmet sich eine eigene Forschungsrichtung der Betriebswirtschaftslehre: Die Er- folgsfaktorenforschung.111 Trotz der Komplexität des Erfolges geht die Erfolgsfakto- renforschung grundsätzlich davon aus, dass bestimmte „kritische“ oder „strategi- sche“ Faktoren bestehen - also Schlüssel-Erfolgsfaktoren, die allein für die Errei- chung oder Sicherung des Erfolges bestimmend sind.112 Erfolgsfaktoren sind „Einzelelemente bzw. Voraussetzungen, die in ihrem strategischen Zusammenspiel diesen Unternehmenserfolg bestimmen“.113 Es gilt einerseits, die Erfolgsfaktoren zu erkennen und zu steuern und andererseits Misserfolgsfaktoren zu kennen, zu ver- meiden oder zu beseitigen.114 Dabei sollen Zufälle ausgeschlossen werden. Nach Rudolph wird in der Realität neben der bewussten Steuerung hingegen immer das Zufallswirken möglich und weder auszuschließen, noch im Wirkungsgrad hinläng- lich zu bestimmen sein.115
Die Ergebnisse der Erfolgsfaktorenforschung sind sehr heterogen und teils wider- sprüchlich.116 Dennoch wurden in verschiedenen Untersuchungen übereinstim- mend häufig nachweisbare Schlüsselfaktoren ermittelt. Darunter fallen beispiels- weise die Qualität von Mitarbeitern und Management, die Qualität der angebotenen Leistungen, Innovationsfähigkeit, Kundennähe sowie die Marktorientierung.117
Schließlich besteht weitgehende Einigkeit, dass Erfolgsfaktoren dann vorliegen, wenn sich durch Beachtung bzw. Anwendung dieser Faktoren der Unternehmens- erfolg steigern lässt.118 Dabei bleiben zufällige Einflüsse ebenso wie Wechselwirkungen im multikausalen Gefüge eines Unternehmens unberücksichtigt und die tatsächliche Bedeutung einzelner Faktoren kann letztlich nie in einer iso- lierten Betrachtungsweise gemessen werden.119 So kommen verschiedene For- scher zu dem Schluss, dass Kritik an der Erfolgsfaktorenforschung grundsätzlich berechtigt ist, jedoch zweifelsfrei Faktoren zu identifizieren seien, die erfolgreiche Unternehmen von erfolglosen unterscheiden. Damit sei der Ansatz nicht gänzlich zu verwerfen, sondern für die Ableitung entscheidungsrelevanter Informationen durchaus relevant.120
4.3. Erfolg von Social Media-Präsenzen
Wenn Erfolg dadurch definiert ist, Ziele zu erreichen, muss zunächst gefragt wer- den, welche Ziele ein Unternehmen mit einer Social Media-Präsenz verfolgen kann. Den Unternehmenszielen untergeordnet sind die Marketingziele. Marketingziele lassen sich in marktökonomische und marktpsychologische Ziele unterteilen. Zu den marktökonomischen Zielen gehören etwa Absatz, Umsatz, Rentabilität und Marktanteil, während Bekanntheitsgrad, Imagefaktoren, Kundenzufriedenheit sowie Kundenbindung zu den marktpsychologischen Zielen gezählt werden. Die Marke- tingziele wiederum werden auf Instrumentenebene heruntergebrochen und be- schreiben eine konkrete Mittel-Zweck-Beziehung.121 Ziele von Social Media sind demzufolge dem Bereich der kommunikationspolitischen Ziele zuzuordnen.
Mögliche Ziele, die durch den Einsatz von Social Media-Präsenzen erreicht werden sollen, können sein:122
- Verbesserung der Reputation
- Höhere Sichtbarkeit
- Virales Marketing und Mundpropaganda
- Ideenentwicklung und Innovation
- Positive Effekte auf das Suchmaschinenmarketing (SEM)
- Krisenkommunikation
- Kundengewinnung, Kundendienst und Kundenbindung
Um den Erfolg beeinflussende Faktoren zu definieren, muss also zunächst das konkrete Ziel definiert werden. Auf dieser Basis ist zu eruieren, mit welchen Kenn- zahlen die Zielerreichung gemessen werden kann. Grundsätzlich zielt ein Unter- nehmen darauf ab, Gewinne zu erwirtschaften. Insofern ist der Return on Invest- ment (ROI) eine aussagekräftige Kennziffer dafür, ob das Unternehmen Erfolg hat, indem der Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital gesetzt wird.123 Aktuell herrscht im Internet und in der Forschung eine im Ergebnis noch offene Diskussion, ob die Ermittlung eines ROI für Social Media Marketing möglich ist: Einer der gro- ßen Vorteile des Internets ist es, dass nahezu jede Bewegung und jede Interaktion gemessen werden können. Gleichzeitig sind beispielsweise cross-mediale Vor- gänge nicht nachvollziehbar. Es ist nicht möglich zu eruieren, ob ein Versiche- rungsabschluss in einer Agentur vor Ort durch den Besuch einer Facebook-Seite beeinflusst oder hervorgerufen wurde. Zudem zählt im Social Web eher die Qualität als die Quantität. Ein aktiver Fan, der als Meinungsbilder auf viele andere wirkt, kann viel wertvoller sein als hunderte inaktiver Fans.124 Es gilt also, Kennzahlen zu finden, die SMM mess- und steuerbar machen, um Investitionen zu rechtfertigen und zu optimieren.
Schlüsselkennzahlen zur Messung von Erfolgstreibern im Unternehmen werden als Key Performance Indicators (KPIs) bezeichnet. Anhand von KPIs kann der Fortschritt hinsichtlich wichtiger Zielsetzungen oder kritischer Erfolgsfaktoren ermittelt werden.125 Für Social Media Marketing gibt es bisher kaum Standard-KPIs. Oftmals scheint es im Social Web agierenden Unternehmen auch noch an einer auf Zielerreichung basierenden Strategie zu mangeln.126
Bezeichnenderweise nehmen in der Forschungsliteratur die Inhalte zu Monitoring und Reporting von Social Media-Präsenzen einen relativ geringen Raum ein.127
[...]
1 Levine, R. u.a. (1999), o.S.
2 Runia, P. u.a. (2007), S. 125, Kursivschrift im Original. Im Dienstleistungsmarketing wird das traditionelle Konzept vereinzelt um drei zusätzliche Instrumente (Personalpolitik, Prozesspolitik, Ausstattungspolitik) ergänzt. Vgl. Zentes, J. u.a. (2006), S. 531. Diese Erweiterung hat sich in der Literatur zum Versicherungsmarketing nicht durchgesetzt. Vgl. etwa Görgen, F. (2007), Kühlmann, K. u.a. (2002) und Puschmann, K.-H. (2003).
3 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 127; vgl. Wöhe, G., Döring, U. (2008), S. 477. Für Erläuterungen der einzelnen Instrumente vgl. ebd. In der Forschung zum Versicherungsmarketing stehen regelmäßig fünf Instrumente im Fokus: Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit, das Direktmarketing und Sponsoring. Vgl. Görgen, F. (2007), S. 172-183; vgl. Kurtenbach, W. W. u.a. (1995), S. 216; vgl. Rohbock, U., Jagoda, M. (2010), S. 400-403. Diese können alle auch der Einteilung in klassische Kommunikationsinstrumente (Werbung, Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und persönlicher Verkauf) und moderne Kommunikationsinstrumente (Direktmarketing, Sponsoring, Event-Marketing, Product Placement und Online-Marketing) zugeordnet werden.
4 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 265-274.
5 Vgl. Esch, F.-R., Schewe, G. (2011); vgl. Schweiger, G., Schrattenecker, G. (2009), S. 135- 137.
6 Vgl. Wöhe, G., Döring, U. (2008), S. 477.
7 Pepels, W. (1997), S. 14.
8 Vgl. Pepels, W. (1997), S. 6.
9 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 223.
10 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 225.
11 Runia, P. u.a. (2007), S. 230.
12 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 230.
13 Vgl. Esch, F.-R., Schewe, G. (2011), o.S.
14 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 227 und 229.
15 Beim Pull-Konzept richtet das Unternehmen die Kommunikationspolitik direkt auf die Mobilisierung der Endverbraucher aus, während beim Push-Konzept der Handel zur Förderung des Absatzes motiviert werden soll. Vgl. ebd., S. 234f.
16 Vgl. Rentzmann, R. u.a. (2011), S. 147f.; vgl. Schögel, M. u.a. (2011), S. 565.
17 Vgl. Schögel, M. u.a. (2011), S. 562.
18 Vgl. Bruhn, M. (2007), S. 271-274.
19 Vgl. Grabner-Kräuter, S., Schwarz-Musch, A. (2009), S. 184. Auch das Unternehmen muss eine einheitliche Sicht auf den Kunden bekommen, d.h. dass in der Praxis etwa der Außendienst über zentral gesteuerte telefonische Kontakte zum Kunden informiert sein muss. Vgl. Rentzmann, R. u.a. (2011), S. 148.
20 Vgl. Bruhn, M. (2009), S. 10.
21 Vgl. Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2004), S. 113.
22 Bruhn, M. (2007), S. 17. Die Fokussierung auf die Beziehungsperspektive stellt eine Erweiterung der Marketinginstrumente im Rahmen des Customer Relationship Management (CRM) dar. CRM bedeutet eine Unternehmensphilosophie der konsequenten Kundenorientierung, welche computergestützt dafür sorgt, die Beziehung eines Unternehmens zu seinen Kunden profitabel auszugestalten, den gesamten Kundenlebenszyklus gewinnbringender Kunden zu begleiten und abzuschöpfen. Vgl. Hippner, H. (2007), S. 18. CRM geht demnach über eine reine Unterstützung der Verkaufsprozesse hinaus. Vgl. Winkelmann,
P. (2008), S. 232.
23 Vgl. Grabner-Kräuter, S., Schwarz-Musch, A. (2009), S. 181; vgl. Bruhn, M. (2007), S. 17.
24 Vgl. Bruhn, M. (2007), S. 6f.
25 „Share of Wallet“ bezeichnet den Anteil der Kaufkraft eines Kunden, der bei einem bestimmten Unternehmen verbleibt. Vgl. Grabner-Kräuter, S., Schwarz-Musch, A. (2009), S. 182.
26 Vgl. Bruhn, M. (2007), S. 11-14.
27 Die Bewertung als potenzielle, nicht zwingende Folge wird hier bewusst gewählt. Nicht immer muss zwangsläufig eine längerfristige Kundenbeziehung auch mit ökonomischem Erfolg einhergehen, wenn dies auch in der Regel zutreffen wird. Vgl. Diller, H. (2011), S. 263.
28 Vgl. Bruhn, M. (2009), S. 3f; vgl. Diller, H. (2011), S. 260-262.
29 Götz, O. (2008), S. 377. Der Aufbau eines profitablen Kundenstammes bedeutet in letzter Konsequenz auch, dass Kunden gemäß ihres Ertragspotenzials zu betreuen sind - und dass auch die Beendigung der Kundenbeziehung durch das Unternehmen sinnvolle Folge sein kann: „Not all customers are worth attracting and keeping.” Rust, R. T. u.a. (2000), S. 187. Zur Identifikation ertragsstarker Kunden wird der Kundenwert als Steuerungsgröße herangezogen.
30 Vgl. Swoboda, B., Foscht, T. (2011), o.S. Weiter gefasst als das Konsumentenverhalten ist das Käuferverhalten. Es umfasst das Verhalten von Nachfragern (Organisationen oder private Personen) beim Kauf, Ge- und Verbrauch von wirtschaftlichen Gütern. Organisationales Kaufverhalten unterscheidet sich maßgeblich von dem privater Nachfrager. Vgl. ebd. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf Erstversicherer, die Privatkunden ansprechen und behandelt aufgrund dieser Eingrenzung nur das Konsumentenverhalten.
31 Vgl. Kroeber-Riel u.a. (2009), S. 3.
32 Vgl. Kuss, A., Tomczak, T. (2007), S. 16.
33 Vgl. Kuss, A., Tomczak, T. (2007), S. 1.
34 Vgl. Kuss, A., Tomczak, T. (2007), S. 14.
35 Vgl. Swoboda, B., Foscht, T. (2011), o.S.
36 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 100.
37 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 51.
38 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 111; Trommsdorff, V. (2009), S. 62.
39 Nach Trommsdorff, V. (2009), S. 59, unterscheiden sich Gefühle von Emotionen dadurch, dass Gefühle immer bewusst erlebt werden, Emotionen jedoch nicht zwingend.
40 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 138.
41 Vgl. Trommsdorff, V. (2009), S. 63.
42 Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 156.
43 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 143.
44 SMM Kompass, S. 114.
45 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 553f.
46 Vgl. Trommsdorff, V. (2009), S. 221.
47 Vgl. Wöhe, G., Döring, U. (2008), S. 417f. Unter einem Markt versteht man - abstrakt - das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Vgl. Mecke, I., Piepenbrock, D. (2011), o.S. Praktisch relevant ist für einen Anbieter der Markt, auf dem er im Wettbewerb mit seinen Konkurrenten um die Gunst potentieller Abnehmer wirbt.“ Wöhe, G., Döring, U. (2008), S. 414 (andere Hervorhebung im Original, d. Verf.). Aus dieser angebotsseitigen Sicht, der Perspektive des Anbieters, spricht man bei Unternehmen, die weitgehend substituierbare Produkte oder
48 Vgl. Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 412.
49 Kroeber-Riel, W. u.a. (2009), S. 386.
50 Vgl. Kuß, A., Tomczak, T. (2007), S. 20.
51 Vgl. Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2004), S. 143; vgl. Trommsdorff, V. (2009), S. 41f.
52 Vgl. Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2004), S. 140; vgl. Sutor, T. (2010), S. 96.
53 Vgl. Esch, F.-R. (2001), S. 118f.
54 Vgl. Sutor, T. (2010), S. 97; vgl. Trommsdorff, V. (2009), S. 53.
55 Vgl. Esch, F.-R. (2001), S. 117. Gleichzeitig ist das Produktinvolvement nicht zwingend konstant. Der wöchentliche Gewohnheitskauf von Chips für den Eigenbedarf wird in der Regel von geringem Involvement gekennzeichnet sein. Sollen die Chips aber für den neuen Chef sein, wird der gleiche Kaufprozess vermutlich mit einem deutlich höheren Involvement einhergehen.
56 Vgl. Esch, F.-R. (2001), S. 118.
57 Trommsdorff unterscheidet ähnlich zwischen den fünf Involvement-Determinanten Person, Produkt, Medium, Botschaft und Situation, vgl. Trommsdorff (2004), S. 58.
58 Vgl. Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2004), S.147.
59 Vgl. Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2004), S.148.
60 Vgl. Esch, F.-R. (2001), S. 125f.
61 Vgl. Esch, F.-R. (2008), S. 278f.
62 Vgl. Kroeber-Riel, W., Esch, F.-R. (2004), S. 238.
63 Vgl. Schwaiger, M. (2008), S. 116.
64 Weinberg, T. (2010), S. 1.
65 Vgl. Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010), S. 61; vgl. Koch, M., Richter, A. (2007), S. 3. Im Jahr 2004 versuchte der Verleger Tim O’Reilly die Prinzipien zu identifizieren, die Unternehmen ausmachen, welche nach dem Platzen der Internetblase im März 2000 noch erfolgreich waren. Dabei prägte er den Begriff „Web 2.0“, der sich aus der Abkürzung „Web“ für „World Wide Web“, also dem Internet, und der in der IT-Branche üblichen Verwendung von Versionsnummern, in diesem Fall „2.0“, zusammensetzt. Vgl. Alby, T. (2008), S. 15-17.
66 Vgl. Ebersbach, A. u.a. (2011), S. 32.
67 Weinberg, T. (2010), S. XV.
68 Vgl. Scott, D. M. (2009), S. 308.
69 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 167.
70 Vgl. Ratzke, J. (2010), S. 8. Darüber hinaus gibt es sogenannte Social-Network- Aggregatoren, die Online-Aktivitäten der verschiedenen Netzwerke bündeln und empfangene Nachrichten zentral anzeigen.
71 Auch das Schalten von Werbeanzeigen ist beispielsweise auf Facebook möglich. Dieses Vorgehen ist allerdings weniger dem Social Media Marketing als der klassischen Online- Werbung zuzuordnen und wird daher im Folgenden nicht behandelt. Vgl. auch Weinberg, T. (2010), S. 176f.
72 Vgl. Nicolai, A. T., Vinke, D. (2009), S. 26.
73 Vgl. Schmitt, C. (2010), o.S.
74 Vgl. Kolokythas, P. (2011), o.S.
75 Vgl. Schmitt, C. (2010), o.S.
76 Vgl. Seeber, T. (2011), o.S.
77 Für die Versicherungsbranche gilt nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit eine andere Reihenfolge, vgl. Kapitel 6.2 der vorliegenden Arbeit.
78 Vgl. Koch, M., Richter, A. (2007), S. 55f.
79 Vgl. Heymann-Reder, D. (2011), S. 27.
80 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 97.
81 Vgl. Ratzke, J. (2010), S. 8.
82 Vgl. Alby, T. (2008), S. 41f.
83 Vgl. Schmidt, J. (2010), S. 102.
84 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 141-145.
85 Vgl. Berns, S., Henningsen, D. (2010), S. 47-50.
86 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 153-156.
87 Vgl. Beiersmann, S. (2009), o.S.
88 Vgl. Ratzke, J. (2010), S. 10; vgl. Weinberg, T. (2010), S. 297.
89 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 323.
90 Vgl. Haas, A. (2007), S. 467.
91 Vgl. Schumacher, U. (2010), S. 392; vgl. Weinberg, T. (2010), S. 6f.
92 Vgl. Holzapfel, F., Holzapfel, K. (2010), S. 37.
93 Vgl. Bender, G. (2010), S. 153.
94 Vgl. Schmidt, J. (2010), S. 106; vgl. Winkelmann, P. (2008), S. 237.
95 Vgl. Heymann-Reder, D. (2011), S. 26; vgl. Holzapfel, F., Holzapfel, K. (2010), S. 27.
96 Vgl. Hippner, H. (2007), S. 23.
97 Zu den Zielen des Marketing siehe Kapitel 4.3 der vorliegenden Arbeit.
98 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 9.
99 Vgl. Weinberg, T. (2010), S. 5f.
100 Walsh, G. u.a. (2010), S. 15.
101 Kluge, F. (1989), S. 185.
102 Vgl. Rudolph, H. (1996), S. 32.
103 Vgl. Werries, A. (2009), S. 102.
104 Vgl. Degener, M. (2006), S. 9.
105 Vgl. ebd.; vgl. Werries, A. (2009), S. 102.
106 Vgl. Fritz, W. (1995), Sp. 595; vgl. Steinle, C. (1996), S. 15. Der Return on Investment (ROI) beschreibt den Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Gesamtkapital, vgl. Steinle, C. (1996),
S. 15; vgl. Wöhe, G., Döring, U. (2008), S. 910. Bei der Umsatzrentabilität bildet der Umsatz die Bezugsgröße für den Bruttogewinn, vgl. ebd., S. 908. Der Cash Flow beschreibt den Zahlungsstrom einer Periode, ein positiver „Cash Flow ist gleichbedeutend mit einem Einzahlungsüberschuss“, ebd., S. 698.
107 Vgl. Degener, M. (2006), S. 10. Vgl. dazu ausführlich Kaplan, R. S., Norton, D. P. (1992), S. 71ff.
108 Vgl. Degener, M. (2006), S. 13.
109 Vgl. Degener, M. (2006), S. 13.
110 Degener, M. (2006), S. 14. Nach Rudolph, H. (1996) bleibt offen, „ob das Ergebnis
angestrebt worden ist oder nicht“ (S. 32). Andere Forschungsmeinungen hingegen
widersprechen dem und setzen zielgesteuertes Vorgehen voraus, vgl. etwa Werries, A. (2009),
S. 102f. und Preis, A. (1994), S. 15f. Diesem Ansatz wird in der vorliegenden Arbeit grundsätzlich gefolgt, wenn auch zufälliges Wirken auf das erzielte Ergebnis - gerade in einer weitgehend neuen Disziplin wie Social Media - durchaus als wahrscheinlich angesehen wird.
111 Vgl. Steinle, C. (1996), S. 14.
112 Vgl. Fritz, W. (1995), Sp. 594; vgl. Werries, A. (2009), S. 40.
113 Degener, M. (2006), S. 15.
114 Vgl. Degener, M. (2006), S. 14.
115 Vgl. Rudolph, H. (1996), S. 32-34.
116 Vgl. Fritz, W. (1995), Sp. 596; vgl. Werries, A. (2009), S. 45f.
117 Vgl. Fritz, W. (1995), Sp. 596. In der Forschung besteht laut Rudolph immer die Gefahr, dass die Auswahl von Faktoren nur einen Ausschnitt der Realität darstellt, da die Begriffe durch die jeweilige wissenschaftliche Disziplin geprägt sind. Vgl. Rudolph, H. (1996), S. 35.
118 Vgl. Degener, M. (2006), S. 14; vgl. Werries, A. (2009), S. 50.
119 Vgl. Rudolph, H. (1996), S. 38; vgl. ausführlich Werries, A. (2009), S. 45-50.
120 Vgl. Degener, M. (2003), S. 19; vgl. Werries, A. (2009), S. 50.
121 Vgl. Runia, P. u.a. (2007), S. 67f.
122 Vgl. Heymann-Reder, D. (2011), S. 21f.
123 Vgl. Wöhe, G., Döring, U. (2008), S. 908.
124 Vgl. Heymann-Reder, D. (2011), S. 93; vgl. Holzapfel, F., Holzapfel, K. (2010), S. 147-151; vgl. Rose, C. (2011), o.S.; vgl. Warren, C. (2009), o.S. Sofern zur Messung des ROI von SMM zumindest näherungsweise nachvollziehbare und anerkannte Methoden entwickelt werden, wird dies die Akzeptanz des Kanals sicherlich fördern. Vgl. Holzapfel, F., Holzapfel, K. (2010), S. 151.
125 Vgl. Woratschek, H. u.a. (2006), S. 270f.
126 Vgl. Meerman Scott (2009), S. 79f.; vgl. Rose, C. (2011), o.S.
127 Das 193 Seiten umfassende Werk von Raake, S., Hilker, C. (2010) widmet diesem Thema eine dreiviertel Seite (vgl. ebd., S. 189) mit dem allgemeinen Hinweis, dass Analyse wichtig sei. Hünnekens, W. (2010) benennt zwar das 23 Seiten lange, letzte Kapitel „Erfolgskontrolle“, fasst jedoch darunter u.a. eine Aufzählung von Social Media Marketing Tools angefangen bei LinkedIn, Facebook und Twitter (vgl. ebd., S. 148-155). Bei Ebersbach, A. u.a. (2011) sind dem
- Arbeit zitieren
- Christina Wagner-Emden (Autor:in), 2011, Social Media in Low Involvement-Märkten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/196605
Kostenlos Autor werden


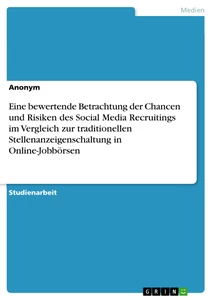


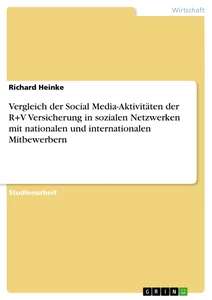











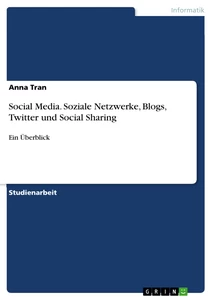


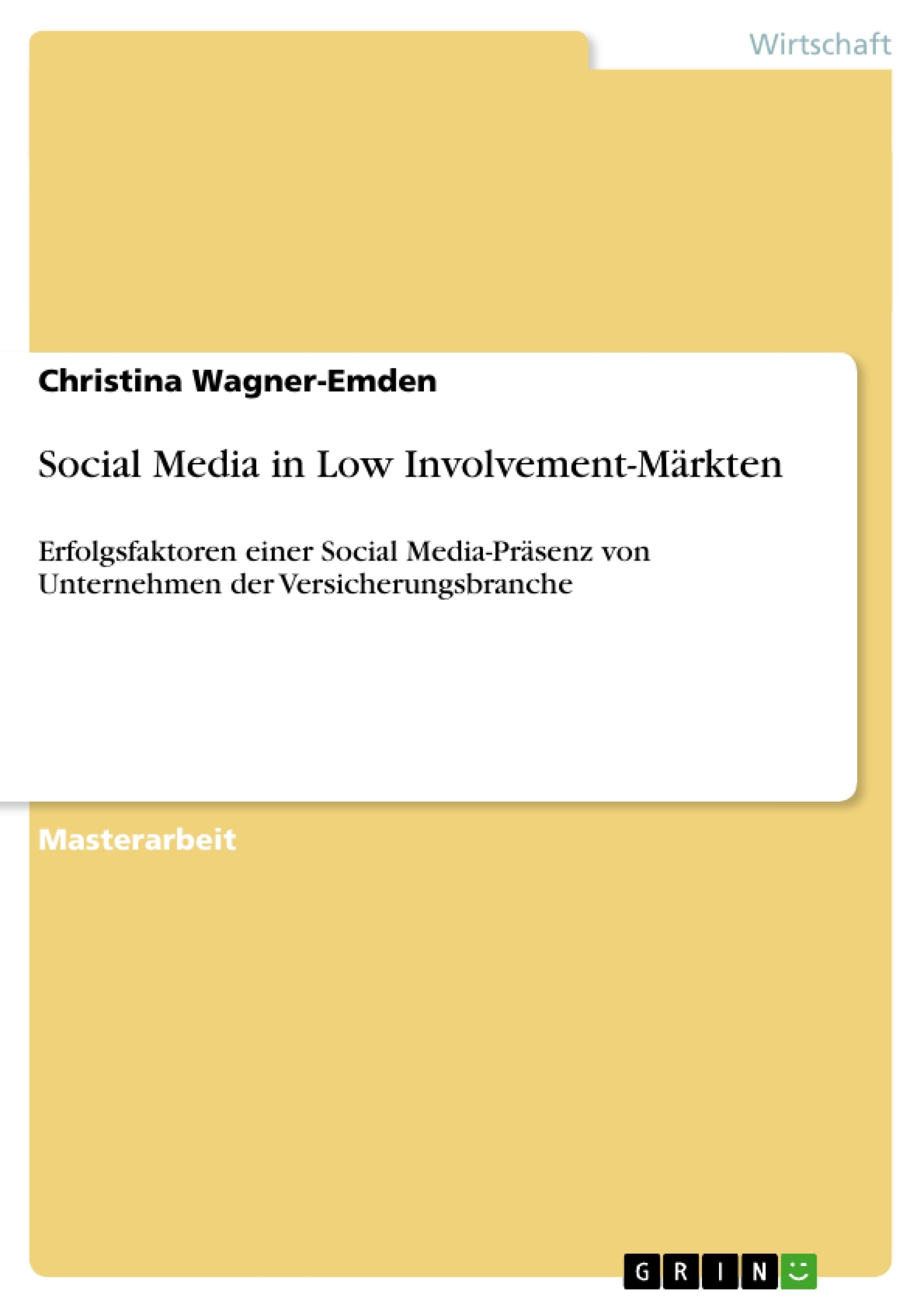

Kommentare