Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
II. Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
III. Abkürzungsverzeichnis
IV. Zusammenfassung
1. Einleitung
2. Demografischer Wandel
3. Cantous und Hausgemeinschaften
3.1. Der Entwicklungsprozess von Versorgungseinrichtungen
3.2. Begriffe: Cantou und Hausgemeinschaft
3.3. Prinzipien
3.4. Struktur
3.5. Zielgruppen
3.6. Personal
3.6.1. Präsenzkräfte: Die Alltagsmanager
3.6.2. Pflegekräfte
3.6.3. Angehörige
3.7. Abgrenzung der Hausgemeinschaften zu anderen Wohnformen
3.8. Chancen und Risiken von Hausgemeinschaften
3.9. Fazit: Hausgemeinschaften und Cantous
4. Umgang mit Demenz und Ernährung
4.1. Demenz und Alzheimer
4.1.1. Symptome und psychosoziale Auswirkung auf die Ernährung
4.1.2. Behandlung von Demenz
4.2. Ernährung älterer Menschen mit Demenz
4.2.1. Veränderte Bedürfnisse und Empfehlungen für die Ernährung Demenzkranker
4.2.2. Unterschiedliche kulturelle Essgewohnheiten und ihre Auswirkung auf die Ernährung im Alter
4.3. Fazit: Demenz und Ernährung
5. Biografiearbeit bei der Ernährung von Menschen mit Demenz
5.1. Erinnerungsarbeit als Aufarbeitung
5.2. Inhalt und Formen der Biografiearbeit
5.3. Herausforderung Biografiearbeit
5.4. Essbiografie
5.5. Fazit: Biografiearbeit bei der Ernährung von Menschen mit Demenz
6. Ein kultureller Vergleich der biografieorientierten Speisenversorgung von Menschen mit Demenz in Cantous und Hausgemeinschaften
6.1. Praxiserfahrungen: Biografiearbeit in der Pflege
6.2. Theoretische Unterschiede bei der biografieorientierten Speisenversorgung in Hausgemeinschaften und Cantous
7. Methodisches Vorgehen
7.1. Festlegung der Stichprobe
7.2. Leitfaden
7.3. Durchführung
7.4. Gültigkeit der Befragung
8. Ergebnisse der Untersuchung
8.1. Struktur der untersuchten Einrichtungen
8.2. Ernährung und Speisenversorgung in der Hausgemeinschaft / im Cantou ...
8.2.1. Essen
8.2.2. Kultur, Religion, Regionalität
8.2.3. Dauer des Essens
8.3. Fortbildungen
8.3.1. Qualitätsstandards
8.4. Mitarbeit der Angehörigen
8.5. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse
8.6. Diskussion der Ergebnisse
9. Fazit
V. Literaturverzeichnis
VI. Anhang
Anhang 1: Fragebogen Hausgemeinschaften (deutsch)
Anhang 2: Fragebogen Cantous (französisch)
II. Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Abbildung 1: Pflegebedürftige 2009 nach Versorgungsart
Abbildung 2: Modernisierung in der Pflege
Abbildung 3: Wohnformen als Sorgesetting
Abbildung 4: Schätzung der Prävalenz von Demenzkranken zum Ende des Jahres 2002
Abbildung 5: Kreislauf der Mangelernährung
Abbildung 6: Integrative Validation nach RICHARD
Abbildung 7: Veränderungen bei Demenz und Auswirkungen auf die Ernährungsgewohnheiten
Abbildung 8: Textured Soft Diets
Abbildung 9: Fingerfood
Abbildung 10: Durchschnittliche Zusammensetzung der täglichen Tagesration nach dem Alter bei Erwachsenen von 18-79 Jahren, 2006/07, n = 1918 36 Abbildung 11: Häufigkeit in % der Nahrungsaufnahme innerhalb der Woche nach Mahlzeitentypen bei Erwachsenen von 18-79 Jahren, 2006/07; n = 1918
Abbildung 12: Prävalenz (%) der Einnahme von Mahlzeiten innerhalb der Woche in Abhängigkeit vom Alter bei Erwachsenen von 18-79 Jahren, 2006/07; n = 1918
Tabelle 1: Paradigmenwechsel der stationären Altenpflege
Tabelle 2: Therapiemöglichkeiten der psychologischen Intervention
Tabelle 3: Landestypische Speisen in ausgewählten Regionen Frankreichs und Deutschlands
Tabelle 4: Strichprobenauswahl (Struktur der Einrichtungen und Expertenprofile)
Tabelle 5: Mahlzeitenvergleich Frankreich - Deutschland
Tabelle 6: Experteninterview, Themenblock: Ernährung und Speisenversorgung in der Hausgemeinschaft / im Cantou
Tabelle 7: Experteninterview, Themenblock: Fortbildungen
III. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
IV. Zusammenfassung
Deutsch
Der demografische Wandel erfordert zur bedarfsgerechten Versorgung demenzkranker Menschen eine Umstrukturierung stationärer Einrichtungen. Hierbei haben sich vor allem Hausgemeinschaften in Deutschland etablieren können, deren Konzept, ursprünglich aus Frankreich und Holland stammend, an die besonderen Bedürfnisse Demenzkranker angepasst wurde. Im Mittelpunkt des Konzeptes stehen die Dezentralisierung von Versorgungsstrukturen sowie die weitestgehende Normalisierung des Alltags.
Durch den an der Biografie der Bewohner orientierten Tagesrhythmus werden die betroffenen Personen akzeptiert und wertgeschätzt. Die Eigenständigkeit der Bewohner kann dadurch weitestgehend erhalten werden.
Der Ansatz kann zudem die Nahrungsaufnahme demenzkranker Personen fördern, welche oft von Mangelernährung betroffen sind. Bereits beim Einzug der Demenzkranken in die stationäre Einrichtung werden biografische Daten wie z.B. besondere Ernährungsvorlieben oder Abneigungen schriftlich festgehalten und ständig aktualisiert. So kann, durch gezielte Stimulation mit Hilfe von bekannten Gerüchen und einer gezielten Essensauswahl der Appetit gefördert werden. Doch nicht nur das Lieblingsessen, sondern auch der kulturelle Hintergrund und die Herkunft der Bewohner spielen eine große Rolle bei der Biografiearbeit. Auswirkungen haben diese vor allem auf Dauer und Ausgiebigkeit von Mahlzeiten sowie auf bevorzugte Nahrungsmittel.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden kulturelle Unterschiede bei der Umsetzung biografieorientierter Speisenversorgung in französischen und deutschen Hausgemeinschaften untersucht.
Hierzu wurde eine Hausgemeinschaft in Deutschland und zwei in Frankreich mittels leitfadenorientierter Experteninterviews über die Speisenversorgung innerhalb der Einrichtung befragt. Neben den kulturellen Unterschieden bei der Speisenversorgung wurde während der Befragung auch deutlich, dass die Konzepte sehr unterschiedlich umgesetzt wurden. In Deutschland wird die ursprünglich als Modellprojekt aufgebaute Hausgemeinschaft sehr erfolgreich geführt. Sie setzt alle Faktoren, die für den Erfolg als notwendig beschrieben werden, wirksam um. Das Verhalten und der Gesundheitszustand der in der Gemeinschaft lebenden Bewohner ist im Vergleich zu demenzkranken Bewohnern in klassischen Altenpflegeheimen aussichtsreich: keine Aggressionen, kaum Mangelernährung und auch die Beziehung zwischen dem Personal und den Bewohnern besteht auf einer sehr persönlichen Basis.
In Frankreich wurde das Hausgemeinschaftskonzept ursprünglich entwickelt und ist daher weit verbreitet. In fast jedem Altenpflegeheim gibt es eine separate Einheit für demenzkranke Personen. Doch, trotz langjähriger Erfahrung mit Hausgemeinschaften, ist in Frankreich ein Rückschritt zu erkennen. Das Hausgemeinschaftskonzept wird mangelhaft umgesetzt, wodurch auch die biografieorientierte Speisenversorgung in den Hintergrund tritt.
Die Demenzkranken werden von anderen Heimbewohnern separiert, um möglichen Gefahren, beispielsweise durch aggressives Verhalten, aus dem Weg zu gehen. Das eigentliche Ziel, den Bewohnern eine gewohnte, familiäre Umgebung zu bieten, rückt dabei in den Hintergrund.
Das Konzept der Wohngemeinschaften wird insbesondere im Bereich der Personalstruktur, des Tagesrhythmus’ und der Beziehung zwischen Bewohnern und Mitarbeitern sehr unterschiedlich umgesetzt.
Die positiven Ergebnisse in der deutschen Hausgemeinschaft bestätigen die Chancen dieses Konzeptes und zeigen, dass eine an der Biografie orientierte Speiseversorgung positive Auswirkungen auf die Nahrungsaufnahme demenzkranker Bewohner hat.
Français
Le changement démographique implique une restructuration des institutions résidentielles pour garantir une alimentation des personnes atteintes de démence en fonction de leurs besoins. Pour cette raison, les Cantous se sont établis en Allemagne. Le concept, originaire de France et des Pays Bas, s’adapte aux besoins spécifiques des personnes démentes. Les éléments centraux sont la décentralisation des structures d’approvisionnement ainsi que le retour à la normale du quotidien.
En adaptant le rythme journalier à la biographie des personnes atteintes de démence, ces dernières sont acceptées et appréciées. L’autonomie des résidents peut ainsi être préservée au maximum.
Cette approche permet en outre d’améliorer l’alimentation des personnes démentes qui sont souvent prédisposées à la malnutrition. À leur entrée dans l’établissement les données biographiques ainsi que les préférences ou aversions alimentaires sont déjà consignées par écrit pour ensuite être actualisées en permanence. Par une stimulation olfactive et gustative ciblée selon les préférences, l’appétit peut revenir. Cependant, non seulement les préférences alimentaires, mais aussi la culture et l’origine des résidents jouent un rôle important dans le travail biographique. Celles-ci ont des répercussions sur la durée et la dimension des repas ainsi que sur les aliments préférés.
L’objectif de ce mémoire est d’analyser les différences culturelles entre l’Allemagne et la France concernant l’application de l’alimentation biographique dans les Cantous. Pour cela un Cantou en Allemagne et deux en France ont été interrogés lors d’entretiens avec des experts au sein de chaque établissement.
Outre les différences culturelles, il s’est également avéré que les concepts sont perçus et mis en œuvre de maniqres très différentes. Le Cantou allemand, initialement construit comme projet pilote, est géré avec succès. Tous les critères qui sont définis comme nécessaires pour le succqs d’un Cantou y sont appliqués efficacement. Le comportement et l’état de santé des résidents déments sont trqs prometteurs. La vie dans ce Cantou est caractérisée par des relations très intimes entre le personnel et les résidents sans agressions et à peine sous-alimentés.
Le concept est originaire de France. C’est la raison pour laquelle il y est plus répandu. Dans presque chaque maison de retraite médicalisée se trouve une unité séparée pour les personnes atteintes de démence. Mais, malgré l’expérience française concernant les Cantous, on peut percevoir une régression. En effet, le concept est réalisé défectueusement, l’alimentation biographique étant reléguée au second plan. Les malades sont séparés des autres résidents de l’institution pour éviter tous dangers possibles provoqués par exemple par un comportement agressif. Le but d’origine, créer un environnement ‘normal’ et familial, est lui aussi relégué à l’arriqre-plan.
Les différences entre les Cantous concernent par conséquent principalement la mise en œuvre du concept, de par la structuration du personnel, le rythme quotidien adapté à la biographie ainsi que par la relation des résidents avec le personnel.
Les résultats positifs du Cantou allemand confirment les chances de ce concept et démontrent qu’une alimentation orientée par la biographie peut conduire à une meilleure alimentation des personnes démentes.
1. Einleitung
Der Pflegeskandal 20121 verdeutlich die aktuelle Problemlage: Um Geld und Personal einzusparen, werden unzählige Demenzkranke mit Medikamenten ruhig gestellt. Experten sprechen in diesem Zusammenhang sogar von Ächemischer Gewalt“.2 Die Krankheit Demenz ist ein gesellschaftliches Phänomen, welches auf Grund des demografischen Wandels immer präsenter wird. Bereits der Gedanke an einen Lebensabend im Altersheim ist für viele Menschen und deren Angehörige ein Alptraum. Dennoch ist der Umzug in eine stationäre Einrichtung oft unumgänglich. Zurzeit werden mehr als 2/3 der Pflegebedürftigen in Deutschland zu Hause versorgt3, doch sind die Angehörigen mit der Pflege häufig überfordert.
ÄAuf dem Weg zur Seniorengesellschaft“4 sind daher neue Lösungen gefragt ± Alternativen zu Altersheimen und neue Umgangsformen mit Demenz.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine alternative Wohnform zum Altersheim für Menschen mit Demenz, die sog. Hausgemeinschaften, vorzustellen.
Im Konzept der Hausgemeinschaften ist eine Methode zum Umgang mit Demenzkranken besonders wichtig: die Biografiearbeit. Deswegen soll auch diese Methode im Zusammenhang mit den Wohngemeinschaften thematisiert werden.
Eine spezielle Problematik ist die Situation der Senioren: Der DAK-Statistik5 zufolge hat in den letzten zwei Jahren die Zahl der mangelernährten Senioren um 52 Prozent zugenommen.6 Um der Mangelernährung entgegenzuwirken gibt es unterschiedliche Methoden. Die vorliegende Arbeit untersucht, ob Biografiearbeit auf die Speisenversorgung übertragen und so Mangelernährung verhindert und die Nahrungsaufnahme demenzkranker Personen in Hausgemeinschaften sichergestellt bzw. verbessert werden kann. In diesem Rahmen sollen vor allem die mit der Biografiearbeit einhergehenden kulturellen Unterschiede Beachtung finden und deren Einfluss auf die Nahrungsaufnahme untersucht werden.
2. Demografischer Wandel
oder: Von der Notwendigkeit neuer Wohnformen
In Deutschland steigt die Lebenserwartung bei gleichzeitigem Rückgang der Geburtenrate. Im Jahr 2010 waren 20,7 % der deutschen Bevölkerung 65 Jahre oder älter, in Frankreich waren es 16,8 %.7 Auch bei der Bevölkerungsvorausberechnung nach dem statistischem Bundesamt sind deutliche Unterschiede in der Demografie Frankreichs und Deutschlands zu erkennen: Während in Deutschland eine Abnahme der Bevölkerung von ca. 82 Mio. Menschen (2011) auf ca. 75 Mio. (2050) geschätzt wird, ist in Frankreich mit einem Anstieg von 63 Mio. auf 72 Mio. Bewohner zu rechnen.8 Von 2005 bis 2010 konnte Frankreich ein jährliches Bevölkerungswachstum von 0,6 % verzeichnen, in Deutschland kam es hingegen zu einem gegensätzlichen Trend: ein jährlicher Rückgang von 0,1 %.
Der demografische Vergleich Frankreich ± Deutschland zeigt eindeutig, dass zwar beide Industrieländer von einem demografischen Wandel betroffen sind, Deutschland allerdings in Zukunft vor noch größeren Herausforderungen steht: Es ist nicht nur gegenüber Frankreich, sondern in der gesamten Europäischen Union das Land mit der geringsten Anzahl von Jugendlichen zwischen 0-19 Jahren. Gleichzeitig steht Deutschland an der Spitze des EU-Ländervergleichs der Personen ab 65 Jahren.9 Durch diese Entwicklung müssen immer weniger junge Menschen die Lasten vieler älterer Menschen tragen. Und, auch wenn Senioren oft länger fit sind, werden sie auch älter als früher. Dadurch wachsen zusätzlich Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit.
Einen besonderen Stellenwert nimmt in diesem Zusammenhang der Umgang mit Demenz ein. Die Krankheit setzt vor allem im hohen Alter ein und ist daher ein immer häufiger auftretendes Krankheitsbild in der Bevölkerung.
Familien sind mit der Pflege dementer Angehöriger oft überfordert, wollen sie aber auch nicht ‚ins Heim abschieben‘. Traditionelle Altenpflegeheime werden den Ansprüchen demenzkranker Personen häufig nicht gerecht: durch unzureichende Personalausstattung, schlechte Arbeitsbedingungen und steigenden Patientenzahlen sind die Pflegekräfte oft überfordert und Patienten werden vernachlässigt.10 Die Umgebung wird den besonderen Ansprüchen der Demenzkranken oft nicht gerecht: Lange Flure, häufig wechselnde Bezugspersonen durch hohe Mitarbeiterfluktuation sowie Mehrbettzimmer geben den dementen Personen ein Gefühl von Unsicherheit, wodurch sie schnell und leicht Fähigkeiten abbauen und dadurch ihre Selbstständigkeit verlieren.11
Nach der DBfK12 -Meinungsumfrage mit mehr als 3000 befragten Pflegekräften erwägen 33,1 % den Beruf zu wechseln und 46,8 % „[...] würden die eigenen Angehörigen, Freunde oder Bekannte nicht im eigenen Arbeitsbereich versorgen lassen“.13
Noch werden EU-weit 70% der Alzheimerpatienten zu Hause versorgt14, um so diesem Pflegenotstand zu entgehen. Doch ist dies zukünftig kaum noch von der Gesellschaft tragbar. Ebenfalls geprägt vom demografischen Wandel gibt es immer mehr Einpersonenhaushalte. Von 1970 bis 2006 konnte ein Anstieg von 25% auf 40% verzeichnet werden. Auch der Wandel der Rollenstrukturen beeinflusst den Pflegesektor stark: Während sich zuvor meist erwerbslose Frauen um die pflegebedürftigen Angehörigen gekümmert haben, ist heutzutage eine ansteigende Erwerbstätigkeit von Frauen festzustellen. Zudem gibt es immer häufiger Einzelkinder und geschiedene Ehepaare, wodurch die Bereitschaft, einen Angehörigen zu pflegen, oft sinkt.15
Die Nachfrage nach neuen Angeboten zur Betreuung und Verpflegung älterer Menschen ist demnach sehr hoch. Daher ist es notwendig, Alternativen zum Altenpflegeheim anzubieten.
Zur ‚guten’ Pflege gehört heutzutage auch die Biografiearbeit. Vor allem für den Umgang und der Kommunikation mit Menschen mit Demenz wird sie als essenziell angesehen. Trotzdem wenden viele Pflegeheime die Biografiearbeit nicht korrekt an, die Aufnahme biografischer Daten und die ständige Aktualisierung sind häufig unzureichend.16
„Aus all diesen genannten Gründen entsteht ein bedeutender Bedarf an öffentlichen Einrichtungen zur Betreuung und Pflege von Demenzkranken“.17
Um eine optimale Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung sicherzustellen, ist es notwendig, klassische Heimstrukturen aufzubrechen und neue, dementen- und altersgerechte Wohnformen zu schaffen, in denen eine intensive Auseinandersetzung mit den Bewohnern ermöglicht wird. Eine Wohnalternative für demenziell erkrankte Menschen, welche im Folgenden vorgestellt wird, sind betreute Hausgemeinschaften.
3. Cantous und Hausgemeinschaften
2009 gab es, dem Statistischen Bundesamt zufolge, in Deutschland insgesamt 2,34 Millionen Pflegebedürftige.18 Über ein Drittel davon sind 85 Jahre oder älter. Der Anstieg alter Menschen bedeutet auch einen Anstieg von Krankheiten, vor allem von Demenz ± und damit eine Zunahme der Pflegebedürftigkeit. 717000 Pflegebedürftige (31%) werden in Heimen vollstationär und 1,62 Mio. (69%) zu Hause versorgt. 34,26% der zu Hause Versorgten werden zudem von ambulanten Pflegediensten betreut.19 Im Vergleich zum Jahr 2007 entspricht dies einem Anstieg der ambulanten Pflege von 10%. Dies verdeutlicht die Überforderung der Angehörigen, wenn der Umzug ins Heim so weit wie möglich hinausgezögert werden soll. Ist allerdings der Moment gekommen, an dem eine permanente Betreuung der betroffenen Person notwendig ist, so reicht auch kein Pflegedienst mehr aus.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Pflegebedürftige 2009 nach Versorgungsart (Quelle: Statistisches Bundesamt 2011 a, S.4)
Durch die steigende Anzahl an älteren, pflegebedürftigen Menschen und den damit verbundenen steigenden Anforderungen befindet sich die Politik in einer Umstrukturierungsphase. Neue, alternative Wohnformen für ältere Menschen sollen zukünftig stärker subventioniert werden. ÄDie Wohnungspolitik der Bundesregierung sowie der deutschen Länder orientiert sich in zunehmendem Maße an den Bedürfnissen älterer und pflegebedürftiger Menschen.“20 Dies lässt sich auch in der Pflegereform erkennen. Durch das Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG)21 soll vor allem der Bereich der häuslichen Pflege unterstützt werden. So sollen mehr Leistungen für Demenzkranke angeboten und unterstützt werden, ganz nach dem Leitsatz ‚ambulant vor stationär’. Problematisch ist hierbei allerdings, dass für Pflegeheime kein zusätzliches Geld für die Betreuung Demenzkranker zur Verfügung gestellt wird, wobei dies dringend erforderlich wäre. Aus diesem Grund werden zunehmend alternative Wohnformen gesucht, die den Pflegeheimen entsprechende konstante Betreuung bieten und gleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit ambulanten Diensten von dem Gesetz profitieren können. Dieser Wandel führte unter anderem zur Entwicklung von Hausgemeinschaften.22
In diesem Kapitel soll die Entwicklung von Heimen zu Hausgemeinschaften dargestellt und die damit einhergehenden veränderten Denkansätze vorgestellt werden. Zudem werden die Hausgemeinschaften von anderen Wohnformen abgegrenzt und deren Prinzipien und Strukturen charakterisiert.
3.1. Der Entwicklungsprozess von Versorgungseinrichtungen
Waren bis zum 12. Jahrhundert noch Sammelanstalten für Menschen mit Krankheiten aller Art üblich, haben sich heutzutage die unterschiedlichsten Formen von Pflegeeinrichtungen herausgebildet. Vor allem durch den Prozess der Modernisierung, welcher etwa ab dem 18. Jahrhundert23 einsetzte, erlebten Pflegeeinrichtungen eine starke Umstrukturierung. In Abbildung 2 sind die vier Ausprägungen Differenzierung, Rationalisierung, Individualisierung und Domestizierung in Bezug auf
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Modernisierung in der Pflege
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an VAN DER LOO; VAN REIJEN 1982)
Pflegeeinrichtungen für ältere Menschen dargestellt. Diese Prozesse und das damit verbundene Umdenken beeinflusste die weitere Entwicklung von Einrichtungen sehr stark: Neben der immer wichtiger werdenden Prozessoptimierung und effizienten Steuerung großer Altenpflegeheime, gewannen auch die Individualisierung und Differenzierung neuer Wohnformen immer mehr an Bedeutung.
Es wurde zunehmend wichtiger, altersgerecht zu versorgen und nicht nur zu ‚verwahren’ ± der Mensch als Individuum rückte damit stärker in den Vordergrund. So auch bei den Hausgemeinschaften: Es handelt sich hierbei um ein Konzept, welches vor allem für demenziell erkrankte Personen entwickelt wurde. Dabei wird versucht, zentrale Versorgungsstrukturen weitestgehend abzuschaffen, kleinere Bewohnereinheiten zu schaffen und sich damit am Familienleben und einer ‚normalen‘ Lebensführung zu orientieren. Autonomie und damit ein möglichst selbstbestimmtes Leben sollen gewährleistet und ausgebaut werden.
Das Konzept der Hausgemeinschaft wird auch als Ävierte Generation“ nach den KDA- Pflegeheimgenerationen bezeichnet. In folgender Tabelle sind diese zusammenfassend dargestellt.24
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Paradigmenwechsel der stationären Altenpflege (Quelle: AREND 2005, S.17)
Nachdem ab 1940 ein Wandel der ÄVerwahrung von Insassen“ über die ÄAktivierung des Bewohners“ in den 1980er und 1990er Jahren stattgefunden hatte, ist derzeit das Ziel der vierten Generation zur Normalität zurückzukehren und Geborgenheit zu vermitteln. Die pflegebedürftige Person wird hierbei als Mitglied der Hausgemeinschaft angesehen. Sie wird in das Leben mit den Mitbewohnern eingegliedert und soll, je nach Fähigkeiten, bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten mitwirken und mitentscheiden.25 Der Ursprung dieses Konzeptes liegt in Frankreich: bereits 1977 gestaltete Georges Caussanel ein Altenheim derart um, dass desorientierte Menschen mit anderen in kleinen Wohneinheiten von ca. 15 Personen zusammen lebten um damit an Autonomie zu gewinnen. Die Unterbringung verwirrter, älterer Menschen in einer humanen und familiären Umgebung, in der nicht Quantität und Rationalität sondern Individualität und Menschlichkeit im Mittelpunkt standen, konnte sich erfolgreich durchsetzen.26 Mittlerweile hat sich dieses Konzept über die französischen Ländergrenzen hinweg in den Niederlanden und der Schweiz etablieren können. Seit Mitte der 90er Jahre haben sich die Hausgemeinschaften auch in Deutschland verbreitet und bieten für immer mehr Menschen eine Alternative zum Pflegeheim. Noch heute befinden sich die Bundesländer in einer Umstrukturierungsphase. 1988 begann ein erstes Altenpflegeheim in Nordrhein-Westfalen nach französischem und niederländischem Vorbild die Heimstrukturen aufzubrechen und kleinere Wohneinheiten aufzubauen.27
In den folgenden Abschnitten werden die Konzepte von Cantous und Hausgemeinschaften näher vorgestellt und anschließend zu anderen Wohnformen abgegrenzt.
3.2. Begriffe: Cantou und Hausgemeinschaft
Der Begriff Cantou stammt aus dem Provenzalischen und bedeutet Feuerstelle. Damit ist die Ess-Ecke bzw. der Kamin gemeint, an welchem die Familienmitglieder im Südwesten Frankreichs in ihren Häusern zusammenkamen. Der Großteil des Familienlebens spielte sich vor dieser Feuerstelle ab und war damit ein Ort der Kommunikation und Begegnung.28
Neben diesem Wortursprung existiert auch die vor allem durch die Association Belge des Cantous weit verbreitete Definition ÄCentre d’Activités Naturelles Tirées d’Occupation Utiles“ (ÄWohnbereich mit Animationen, die sich am natürlichen, Biographie gestützten Tagesablauf des Bewohners orientieren“).29 Diese Definition kommt dem noch häufiger verwendeten Ausdruck Unité de vie oder Unité Alzheimer etwas näher. Bei diesen Begriffsverwendungen für die französischen Hausgemeinschaften stehen vor allem die ‚Einheit‘ und der Zusammenhalt im Vordergrund und sind, im Gegensatz zu ‚Cantou‘, für jeden sofort verständlich und daher weiter verbreitet.
Unter diesen Begriffen ist demzufolge eine Wohngemeinschaft zu verstehen, welche vor allem für demente Bewohner und Bewohnerinnen geschaffen wurde, um für diese Personengruppe eine familienähnliche Lebenssituation und sichere Umgebung zu schaffen. Als ‚Feuerstelle‘ ist hierbei die Ä[...] an der Biografie der Bewohner orientierte, [ ], für die Bewältigung des gesamten Haushaltsführung voll funktionsfähige
Wohnküche“30 zu verstehen, welche als zentraler Aufenthalts- und Kommunikationsort für jeden Bewohner fungiert.
Der deutsche Begriff ‚Hausgemeinschaft‘ inkludiert, wie auch die Unités de vie, die im Vordergrund stehende Gemeinschaft. Anders als in einer Wohngemeinschaft hat in einer Hausgemeinschaft jeder seinen eigenen privaten Bereich sowie meist auch ein eigenes Badezimmer. Man teilt sich demnach ein Haus oder eine Wohnung und hat ± daher auch das Wort ‚Gemeinschaft‘ ± untereinander Kontakt. Dadurch gibt sie den Menschen zum einen die soziale Sicherheit des Kollektivs und damit Geborgenheit, zum anderen schafft sie auch die vor allem für ältere Menschen wichtige Privatsphäre und Distanzmöglichkeiten.
3.3. Prinzipien
Das Konzept der Cantous stützt sich auf die Grundprinzipien Subsidiarität und Gemeinschaft. Durch Ersteres soll im Besonderen die Autonomie der Bewohner gewahrt werden. Eigenständigkeit und vor allem der Erhalt bzw. die Reaktivierung der Fähigkeiten sind Ziele dieses Grundsatzes. Gleichzeitig soll den Bewohnern Sicherheit durch feste Bezugspersonen und Mitbewohner sowie einer konstanten Umgebung gegeben werden.
Unter dem Subsidiaritätsprinzip versteht man in diesem Kontext die Hilfe zur Selbsthilfe - jeder Bewohner erhält so viel Unterstützung wie nötig um die individuellen Fähigkeiten aufrecht zu erhalten und sich zu versorgen.
Der Grundsatz der Gemeinschaft beinhaltet zum einem den familiären Zusammenhalt und zum anderen die Zusammenarbeit in der Gruppe. Das Miteinander zwischen allen im Cantou mitwirkenden Parteien ± den dementen Personen, ihren Angehörigen und den Mitarbeitern ± ist dabei von elementarer Bedeutung und soll ebenfalls die Selbstständigkeit unterstützen. Dabei wird jeder Bewohner in die Gruppe und damit in alle anfallenden täglichen Aufgaben integriert und zur Teilhabe aktiviert.31,32
Dem Menschenbild der Cantou-Philosophie liegt damit nicht ein kranker, ‚unbrauchbarer‘ Mensch, sondern die Wertschätzung jedes Einzelnen und die Nutzung seiner Potenziale zu Grunde. Es wird versucht, den dementen Personen ein Leben zu bieten, welches sich an den normalen Abläufen ihres vorherigen Lebensinhalts orientiert. ‚Künstliche’ Beschäftigungen werden möglichst vermieden, denn den Bewohnern soll das Gefühl vermittelt werden, dass sie gebraucht werden, weshalb sie nützliche, ihnen bekannte Tätigkeiten ausführen sollten.33 Auch bei der Kommunikation stützt man sich nicht auf Gedächtnisleistungen, sondern auf Erfahrbares. Besonders im Vordergrund stehen dabei Tätigkeiten im Haushalt. Die gemeinsame Mahlzeitenzubereitung oder das Aufhängen von Wäsche sind Beschäftigungen, welche die Bewohner häufig durch eigene Erfahrungen problemlos ausführen können. Die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten sollen nicht wie Beschäftigungsangebote zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden, sondern in den Alltag integriert werden.
Dieser partizipative Ansatz setzt damit die Schwerpunkte auf Teilhabe, Selbstständigkeit und hauswirtschaftliche Betreuung.34
Bei all diesen Tätigkeiten ist jedoch grundsätzlich die individuelle Pflegebedürftigkeit der einzelnen Personen zu berücksichtigen. Jeder soll gefordert, aber nicht überfordert werden, um eine Selbstwertsteigerung zu erzielen.
Dem Prinzip des ersten Cantou Frankreichs Foyer Emilie de Rodat zufolge spielen auch Krankheiten eine eher untergeordnete Rolle. Diese schränken nur ein, weshalb auch für die Aufnahme in das Cantou keine ärztlichen Diagnosen notwendig sind. Es reiche die Aussage der Angehörigen, welche Überforderung und Unmöglichkeit weiterer Betreuung der betroffenen Person ausdrücke. Auch in Deutschland seien nicht die ärztliche Diagnose, sondern Beobachtungen durch die Betreuung und Einrichtungsleitung ausschlaggebend.35
3.4. Struktur
Eine deutsche Hausgemeinschaft setzt sich aus 6-12 Bewohnern zusammen. Dabei liegt das Optimum dem Kuratorium deutscher Altershilfe (KDA) zufolge bei 6-8 Personen für Hausgemeinschaften, in französischen Cantous leben hingegen bis zu 18 Personen zusammen.36 Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer inklusive Nasszelle, zusätzlich existiert ein Gemeinschaftsraum bzw. eine offene Küche, welcher als Hauptaufenthaltsort der Bewohner dient.
Hausgemeinschaften sind meist eigenständig und unabhängig organisiert, können aber mitunter an ein Altenheim angegliedert oder als Verbundsystem mit mehreren Hausgemeinschaften existieren.
Heimstrukturen werden weitestgehend abgeschafft, d.h. es wird versucht, die Trennung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten vom Alltagsleben zu überwinden und dadurch eine größere Normalität zu schaffen. Dabei soll nicht der Alltag an die Pflege und Betreuung angepasst werden, sondern die Pflege soll sich nach dem Alltag richten. ÄIn der Hausgemeinschaft dominiert die individuelle Wohn- und Lebensgestaltung. Das Leben […] ist ressourcenorientiert, also darauf ausgerichtet, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten und zu stärken und Selbstständigkeit zu fördern.“37
Im Fokus stehen nach diesem Konzept die demente Person und ihr Zustand. Es wird nicht im Voraus vom Heim entschieden, welche Leistungen geboten werden, sondern erst nach Prüfung der Notwendigkeit. Je nach Cantou oder Hausgemeinschaft werden für die pflegerischen Dienstleistungen auch externe Kooperationspartner wie ambulante Dienste hinzugezogen.
Hausgemeinschaften können nach Arend in Anlehnung an Winter38 in drei verschiedene Formen untergliedert werden: solitäre Hausgemeinschaften, Hausgemeinschaften als Teil von vollstationären Pflegeeinrichtungen sowie Hausgemeinschaftskomplexe. Wie bereits beschrieben, ist davon auch die Struktur abhängig: Eine völlig autarke Organisation findet nur bei den eigenständigen, solitären Einrichtungen statt. Bei Hausgemeinschaftskomplexen, wo also mehrere Hausgemeinschaften gemeinsam organisiert werden, können Synergieeffekte genutzt werden ± es braucht nachts z.B. weniger Personal und der Einkauf kann gemeinsam ausgeführt werden.39
3.5. Zielgruppen
Wie in den vorangehenden Abschnitten bereits erwähnt, sind Cantous und Hausgemeinschaften vor allem auf demente Personen spezialisiert. Es können aber auch ältere, nicht demente Personen durchaus in Hausgemeinschaften leben. Dies ist abhängig vom jeweiligen Konzept der Hausgemeinschaft. Unterschieden werden die Prinzipien der Segregation und der Integration.
Bei der Segregation leben ausschließlich Bewohner mit der gleichen Krankheit zusammen, sie werden also von anderen Menschen getrennt, segregiert. Bei dem integrativen Konzept hingegen leben Menschen mit unterschiedlichsten Beschwerden zusammen. Welche Form des Zusammenlebens die bessere ist, ist noch ungeklärt. Einigen Meinungen zu Folge seien homogene Zielgruppen vorteilhafter, da den Demenzkranken in dieser Art des Zusammenlebens weniger ihre Defizite bewusst gemacht werden. Andererseits sei jeder Mensch so individuell, dass homogene Zielgruppen gar nicht möglich seien. Vor allem bei unterschiedlichen Krankheitsverläufen würden die vorher homogenen Zielgruppen wieder heterogen werden. Zudem sollten Hausgemeinschaften für alle Menschen offen sein, um so eine echte Alternative zu Heimen zu schaffen.40 In einer Hausgemeinschaft kann man z.T. dieselbe Personenkonstellation finden, die sich auch in einem Heim finden ließe. Ursprünglich üblich, und daher immer noch weit verbreitet, ist aber der Zusammenschluss homogener Zielgruppen. Im Fall der Hausgemeinschaften, wohnen demnach nur demente Personen zusammen, was dem segregativem Ansatz entspricht.
Da Demenz vor allem im hohen Lebensalter eintritt, leben in Cantous fast ausschließlich Personen ab 85 Jahren. Über 2/3 aller Demenzkranken sind Frauen. Dies lässt sich zum einen durch die höhere Lebenserwartung sowie durch ein höheres Erkrankungsrisiko begründen.41 Aus diesen Gründen wohnen überwiegend Frauen in Hausgemeinschaften.
3.6. Personal
Die Personalstruktur spielt bei den Hausgemeinschaften eine besondere Rolle, da sie sich sehr von traditionellen Altenpflegeheimen abhebt. Hauswirtschafter/innen und Pflegekräfte arbeiten nicht mehr nebeneinander, sondern miteinander: Beide Parteien sind für das Wohlergehen der Bewohner verantwortlich.
Allerdings spielt auch die Organisationsform beim Personal eine Rolle. Dabei sind vor allem Differenzen in der Trennung von Pflege und Hauswirtschaft zu erkennen. Während in einigen Cantous und Hausgemeinschaften jeder für alles verantwortlich ist, gibt es bei anderen eine strikte Trennung zwischen den beiden Tätigkeitsbereichen. Oftmals werden externe Dienstleister für die fachpflegerischen Aufgaben hinzugezogen.
Eine große Gemeinsamkeit ist jedoch, dass überall ein relativ niedriger Personalschlüssel vorhanden ist und die Hauptversorgung der Bewohner und Bewohnerinnen in den Händen von sog. Präsenzkräften liegt.
3.6.1. Präsenzkräfte: Die Alltagsmanager
Möglichst ohne pflegerischen Hintergrund, da sonst voreingenommen, sollen sich Präsenzkräfte in die Gruppe integrieren und mit den Bewohnern gemeinsam den Tag strukturieren. In Frankreich auch als Maîtresses de maison42 (Hausherrin/Dame des Hauses) bezeichnet, haben sie vor allem die Aufgabe der Alltagsbegleitung und sind dabei die Bezugspersonen und Hauptansprechpartner für die Bewohner und deren Angehörigen. Zudem gelten sie nicht als Experten, sondern vielmehr als Assistenten, welche die Bewohner begleiten und ihnen ein an ihrer Biografie orientiertes Leben bieten.
Die Biografiearbeit nimmt im Hausgemeinschaftskonzept eine besondere Rolle ein und ist ausschlaggebend für den Umgang mit den einzelnen Bewohnern.43 Der Einsatz von Präsenzkräften spart zusätzlich Kosten für teures Fachpersonal ein. Kritisch wird jedoch teilweise die Qualifikation gesehen: Know-How und Kompetenz in medizinischer, therapeutischer und fachpflegerischer Hinsicht dürften auch in Hausgemeinschaften nicht vernachlässigt werden.44 Aufgaben, welche in den Bereich der Pflege fallen, werden daher weiterhin von Pflegefachpersonal ausgeführt, sollen jedoch nur zweitrangig sein. Im Vordergrund stehen immer der normale Tagesablauf und damit das Erledigen täglich anfallender Aufgaben. ÄZiel muss es sein, die fachpflegerischen Leistungen sehr bedarfsgerecht und „dezent“ anzubieten, so dass die wohnliche Atmosphäre und nicht die Pflegeaktionen den Gesamtcharakter der Einrichtung bestimmen“45 Um diese wohnliche Atmosphäre herzustellen, sollten Präsenzkräfte über bestimmte Schlüsselqualifikationen wie Einfühlungsvermögen, menschliche Wärme sowie andere soziale Kompetenzen verfügen. Verglichen mit den Aufgaben von Hauswirtschaftern in großen Heimen findet in den Hausgemeinschaften eine wesentliche Erweiterung des Tätigkeitsbereiches statt, womit auch eine Erweiterung der Kompetenzen einhergeht. Daher werden zusätzlich für Hauswirtschafter und Hauswirtschafterinnen in Hausgemeinschaften die Begriffe Präsenzkraft oder Milieugestalter verwendet.46 Hierzu zählen alle Mitarbeiter, welche keine fachpflegerischen Qualifikationen besitzen. Dabei hat jeder Beschäftigte einen eindeutig definierten Verantwortungsbereich und steht in direkter Kommunikation mit den Bewohnern und Angehörigen. Die Aufgaben von Präsenzkräften sind interdisziplinär und reichen vom Einkauf von Lebensmitteln, Reinigung der Zimmer über das Wäsche-Waschen bis hin zur Mahlzeitenzubereitung. Da Präsenzkräfte nicht zwingend ausgebildet sein müssen, ist es notwendig, sie über interne Fortbildungen gezielt zu schulen, um professionell mit unvorhergesehenen Situationen umgehen zu können.47
Nicht in den Aufgabenbereich von Präsenzkräften fallen pflegerische Aufgaben. Um jedoch trotzdem die korrekte Pflege der dementen Personen sicherzustellen, wird neben den Präsenzkräften qualifiziertes Pflegepersonal beschäftigt.
3.6.2. Pflegekräfte
Ausgebildete Pflegekräfte sind in den Hausgemeinschaften für die fachpflegerischen Tätigkeiten zuständig. Auch wenn Präsenzkräfte demgegenüber eine geringere Qualifikation besitzen, werden sie als gleichrangig angesehen „[...] und verfolgen gemeinsam das Ziel des Erhalts und der Verbesserung der Lebensqualität der Pflegebedürftigen.“48 Häufig wird dieses Pflegepersonal von einem ambulanten Pflegedienst gestellt.
Das Pflegepersonal ist damit für die pflegerisch-fachliche Milieugestaltung und der diskreten Durchführung von Pflegeleistungen zuständig. Neben diesen Betreuungsleistungen fallen auch übergeordnete Aufgaben in den Verantwortungsbereich der Pflegefachkräfte wie z.B. die Ermittlung des Pflege- und Betreuungsbedarfs, Planung und Dokumentation sowie die Überprüfung der erbrachten Pflege.49
3.6.3. Angehörige
Neben Präsenz- und Pflegekräften nehmen auch die Angehörigen eine tragende Rolle bei der Arbeit in Hausgemeinschaften ein. Das Konzept sieht eine hohe Einbeziehung der Angehörigen bei der alltäglichen Tagesgestaltung, Veranstaltungen, der Speisenzubereitung u.ä. vor.50 Die Mitarbeit ist jedoch nicht verpflichtend. Die Familienmitglieder können das Ausmaß ihrer Mitwirkung selbst entscheiden. Während es in traditionellen Pflegeheimen kaum möglich ist, den Tagesablauf mitzugestalten, ist in Hausgemeinschaften das Engagement der Beteiligten sehr gewünscht. Gleichzeitig bekommen die Familienmitglieder das Gefühl, der betreuten Person näher zu sein, sie nicht abzuschieben und werden damit vom Schuldgefühl befreit.51
Hinzu kommen meist monatliche Versammlungen mit Mitarbeitern und Angehörigen, die dem Informationsaustausch dienen, Anregungen und Hilfestellungen geben sowie über aktuelle Veränderungen aufklären sollen.
3.7. Abgrenzung der Hausgemeinschaften zu anderen Wohnformen
Hausgemeinschaften, betreutes Wohnen, Wohnen mit Service, SeniorenWohngemeinschaften ± es gibt sehr viele unterschiedle wohngruppenorientierte Betreuungsformen und Begrifflichkeiten.
In diesem Abschnitt sollen daher Cantous und Hausgemeinschaften von sonstigen
Wohnformen weitestgehend
abgegrenzt werden.
Im Modell Wohnformen als
Sorgesettings52 (s. Abbildung 3)
werden verschiedene
Wohnvarianten veranschaulicht. Das private, das gemeinschaftliche und das institutionelle Wohnen stellen die Grundformen des Wohnens dar. Aus diesen drei Basiswohnformen heraus haben sich neue Varianten entwickelt. Die
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Wohnformen als Sorgesetting (Quelle: SENNLAUB 2010)
klassische Hausgemeinschaft wird unter dem gemeinschaftlichen Wohnen eingeordnet. Gleichzeitig werden betreute Wohngruppen und betreute Hausgemeinschaften zwischen gemeinschaftlichem und institutionellem Wohnen eingegliedert. Bei Cantous und Hausgemeinschaften im Sinne dieser Arbeit handelt es sich um betreute Hausgemeinschaften, da ständig Personal anwesend ist. Bei dieser Wohnvariante verbinden sich dementsprechend Kennzeichen beider Basiswohnformen: Es gibt zwei Menschengruppen ± Bewohner und Personal ± entsprechend dem institutionellem Wohnen. Zudem haben die Bewohner betreuter Hausgemeinschaften bzw. deren Angehörige einen größeren Handlungsspielraum als in einer institutionellen Einrichtung. Dies kombiniert die Vorteile beider Wohnformen gezielt miteinander. Betreute Hausgemeinschaften weisen eine große Versorgungssicherheit (institutionelles Wohnen) und gleichzeitig soziale Sicherheit (gemeinschaftliches Wohnen) auf.
Der Unterschied zum Pflegeheim stellt daher vor allem das familiäre Umfeld der Hausgemeinschaften dar, welches weitestgehend erhalten bleibt. Zudem spielt auch die Dezentralisierung von Küche und Wäscherei sowie die aktive Beteiligung der Bewohner bei hauswirtschaftlichen Aufgaben eine elementare Rolle beim Hausgemeinschaftsprinzip.
In Abgrenzung zum betreuten Wohnen, bei dem es sich um privates Wohnen mit zusätzlichen, ambulanten Dienstleistungen handelt, ist vor allem die Kontinuität des Personals und dessen ständige Anwesenheit der bedeutende Unterschied. Dies entspricht dem Wohnen mit Service, bei dem mehrere Menschen in einer Gemeinschaft, allerdings ohne zentralen Gemeinschaftsraum, in einer gemeinsamen Wohnanlage, zusammen leben. Sie beziehen Basisleistungen, können aber auch zusätzlich notwendige Dienstleistungen hinzukaufen.
Bei Senioren-Wohngemeinschaften wohnen drei bis vier Senioren gemeinsam in einer Wohnung. Dabei entscheiden die Bewohner selbst, mit wem sie zusammen wohnen möchten. Eine Pflegekraft ist nicht ständig anwesend und Dienstleistungen wie eine Haushaltshilfe können ggf. gemeinsam organisiert werden.
Das Ziel von Hausgemeinschaften ist nicht, wie beispielsweise bei Senioren- Wohngemeinschaften, kostengünstiger zu sein als Pflegeheime. Durch die Präsenzkräfte ist es aber teilweise möglich, Personalkosten einzusparen und gleichzeitig mehr Zeit für Bewohner und Bewohnerinnen zu haben. Während in Altenpflegeheimen zum Teil Checklisten in zehn Minuten pro Bewohner abgearbeitet werden, steht bei Hausgemeinschaften die gemeinsame Tagesgestaltung im Vordergrund.
3.8. Chancen und Risiken von Hausgemeinschaften
Das Hausgemeinschaftsprinzip entspricht dem Wunsch vieler, nicht in ein Pflegeheim gehen zu müssen, sondern in einer familiären Umgebung untergebracht zu werden. Die Bewohner und Bewohnerinnern von Cantous sind nicht zwingend an die Gemeinschaft gebunden, sondern haben ebenfalls die Möglichkeit sich in ihre eigenen Zimmer zurückzuziehen. Diese sind mit eigenen Möbeln und persönlichen Gegenständen ausgestattet, was die Akzeptanz und das Wohlergehen der Bewohner fördert. Auch die Integration der Bewohner in täglich anfallende Aufgaben stellt enorme Chancen dar, da Fähigkeiten und Fertigkeiten der dementen Personen gefördert und erhalten werden können.
Ebenfalls als besonders positiv wahrgenommen wird der Kontakt zu den Angehörigen, welche selbst entscheiden können, in welchem Maße sie intervenieren möchten. Gleichzeitig kann diese Zusammenarbeit jedoch zu Konflikten im Kontakt mit dem Personal führen. Um mögliche Meinungsverschiedenheiten zu verhindern und eine Einigung zwischen beiden Parteien zu erzielen, finden monatliche Versammlungen mit Personal und Angehörigen statt, in denen Einzelfälle diskutiert, bestimmte Handlungsempfehlungen gegeben und begründet werden. Der Austausch der Parteien steht dabei im Vordergrund.
Durch die persönliche Nähe erfahren die Mitarbeiter eine Äerfüllende“ und Äbeziehungsorientierte Tätigkeit“, welche die Motivation fördert.53 Trotzdem wird die Thematik ‚Personal’ auch als Risiko gesehen: Präsenzkräfte müssen keine fachpflegerische Ausbildung haben, womit die Frage der Qualitätssicherung in betreuten Hausgemeinschaften aufkommt. Sollten Qualitätsstandards gesetzt werden oder schränken sie nur ein? Das Setzen von Standards erscheint einerseits sehr wichtig, da es, anders als bei Altenheimen, keine Kontrollbehörde gibt. In Berlin wurde daher der Verein Selbstbestimmtes Wohnen im Alter e.V. zur Qualitätskontrolle von Wohngemeinschaften gegründet, welcher zur Überprüfung von Hausgemeinschaften „Qualitätskriterien für ambulant betreute Wohngemeinschaften mit demenziell erkrankten Menschen“54 erstellt hat. Ein Kriterium hierbei ist das Zusammenwohnen homogener Gruppen. Das bedeutet, dass nur demenziell erkrankte Personen zusammen leben, Ä[...] um zu verhindern, dass sie ständig auf ihre Defizite aufmerksam gemacht und verbessert werden. Alle bisher mit dieser Betreuungsform gesammelten Erfahrung haben gezeigt, dass sich der Tagesablauf in einer Gemeinschaft sowohl anregend als auch angstreduzierend auf die Menschen mit Demenz auswirkt.“55
Allgemein gültige Qualitätsstandards könnten vor allem den Angehörigen Sicherheit bzgl. des Personals und damit der Versorgung und Fürsorge der demenziell erkrankten Personen geben.
Andererseits kann eine zu starke Regulierung auch zu bedeutenden Einschränkungen hinsichtlich der individuellen Bewohnerbedürfnisse führen. Nach Gerecke56 sind Gesetze für Hausgemeinschaften eher unnötig, da Angehörige demenziell erkrankter Personen in Cantous meist stärker engagiert wären und dadurch eine größere soziale Kontrolle vorherrsche.57 Der Markt reguliert sich somit gewissermaßen selbst und unseriöse Hausgemeinschaften werden automatisch entdeckt. Um die Qualität in Hausgemeinschaften individuell sicherzustellen sind interne Fort- und Weiterbildungen zur Entwicklung der notwendigen Kompetenzen unabdingbar.
Da es sich bei den in Hausgemeinschaften lebenden Bewohnern um relativ kleine Gruppen handelt, stellt die Integration neuer Bewohner bzw. der Verlust von Gruppenmitgliedern ein zusätzliches Risiko dar. Es kann dadurch teilweise zu unerwünschten Veränderungen in der Gruppe kommen, da sich alle Bewohner auf einen neuen Mitbewohner einstellen müssen. Durch die Möglichkeit des Rückzugs auf das eigene Zimmer und das gegenseitige Halt geben innerhalb der Gruppe ist diese Gefahr jedoch eher als gering einzuschätzen.
Ein weiteres Problem, welches sich bei dem Aufbau von Hausgemeinschaften stellt, ist die Finanzierung. Die Wohnform wird nicht immer von Krankenkassen und Sozialhilfeträgern akzeptiert und dadurch häufig nicht subventioniert. So ist es vorteilhaft, mehrere Hausgemeinschaften zusammen zu führen um die daraus entstehenden Synergieeffekte nutzen zu können und vor Kostenexplosionen geschützt zu sein.58
[...]
1 DOWIDEIT 2012.
2 ebd.
3 STATISTISCHES BUNDESAMT 2011a : S.4.
4 STATISTISCHES BUNDESAMT 2011b: S.1.
5 HESKE 2011 .
6 ebd.
7 Euopean Commission 2011, S.63.
8 Statistisches Bundesamt 2011d; S. 678.
9 European Comission: Demographie report 2010; S. 62 f.
10 DBfK 2009: S.5.
11 BERNHARDT 2007.
12 Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe.
13 DMfK 2009, S.5.
14 CRAMER 2011, S.17.
15 ebd. S.18.
16 SCHNEEKLOTH; WAHL 2009, S. 313.
17 ebd. S.18.
18 Statistisches Bundesamt 2011 c, S.4.
19 ebd. S. 4.
20 BFW-Studie 2007, S.4.
21 Bundesministerium für Gesundheit 2012.
22 ebd.
23 SENNLAUB 2011/12.
24 Es gibt inzwischen auch eine 5. Generation (sog. KDA-Quartierskonzepte), welche für diese Arbeit aber nicht weiter betrachtet werden soll.
25 KAISER 2007.
26 ENMARCHE 2004.
27 WINTER et al. 2001, S. 10 ff.
28 THIESWALD 2007.
29 Marienheim, o.J.
30 Bundesministerium für Gesundheit und soziale Sicherung 2004, S.10.
31 Vgl. Marienheim, o.J.
32 Ebd.: THIESWALD, S 30 f.
33 Ebd.: S. 31.
34 Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft 2011, S.7.
35 RADZEY et al. 1999, S. 23 ff.
36 AREND 2005, S.51.
37 DEVAP 2001; S. 2.
38 AREND 2005; S.18.
39 AREND 2005 S. 18.
40 ebd. S. 47 f.
41 BICKEL 2005, S. 1-15.
42 THIESWALD 2007; S. 32.
43 Weitere Informationen: s. Kapitel 0.
44 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2004, S. 27.
45 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2004, S. 27.
46 Ebd. S. 27.
47 Ebd. S. 30.
48 Ebd. S. 28.
49 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung 2004, S. 32.
50 AREND 2005, S.76.
51 BOURGUIGNON 2004.
52 SENNLAUB 2010, S. 69 ± 75.
53 Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit 2004, S.37.
54 http://www.swa-berlin.de/fileadmin/user_upload/SWA-Brosch_reAusgabe2006.pdf .
55 SWA 2006, S. 8.
56 GERECKE in PRO ALTER 2003, S.22.
57 Ebd.: S. 22.
58 Ebd.: S.22.
- Arbeit zitieren
- Johanna Kiessig (Autor:in), 2012, Senioren-Hausgemeinschaften. Genussvolles Altern dank Biografiearbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195951
Kostenlos Autor werden


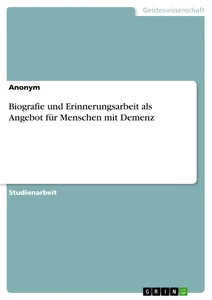











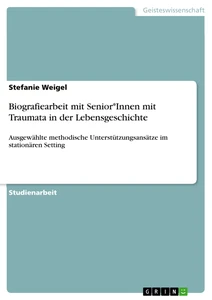

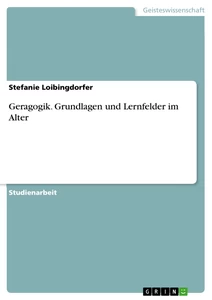
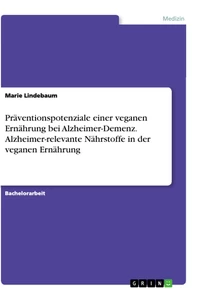




Kommentare