Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Sprache und Sprechen
2.1. Sprache als virtuelles System von Zeichen
2.2. Sprache als Gebrauch von Zeichen
3. Wie kann Sprache verletzen?
3.1. Der Mensch als sozial interagierendes Subjekt
3.2. Anrufung: Sprachliche Subjektivierung des Individuums
3.3. Der doppelte Körper von Personen
4. Wie wir mit Worten Dinge tun
5. Zwischenbilanz I
6. Gewalttätiges Sprechen als Illokution
6.1. Konventionalität und Iterabilität
6.2. Verbot von gewaltätigen Sprechakten
6.3. Resignifikation und Dekontextualisierung
6.4. Beispiele für Resignifikationen
7. Gewalttätiges Sprechen als Perlokution
7.1. Persönliche Integrität
7.2. Eigennamen
7.3. Individuelle Körpermerkmale
7.4. Moralische Verbundenheit
7.5. Verhältnis zum Sprecher: Erwartungshaltung
8. Zwischenbilanz II
9. Grenzfälle sprachlicher Gewalt
9.1. Schweigen
9.2. Drohung
10. Mensch - Sprache - Gewalt: Untrennbar verbunden?
11. Schlusswort
12. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Das Alltagsverständnis vom Verhältnis zwischen Gewalt und Sprache ist geprägt von zwei Intuitionen, die nur schwer miteinander vereinbar scheinen. Einerseits gelten Sprache und Gewalt als Gegensatz. Sie verhalten sich zueinander wie Zivilisation und Barbarei oder Kultur und Kulturverlust. Sigmund Freud beispielsweise wird das Bonmot zugeschrieben, dass „derjenige, der zum ersten Mal anstelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, [...] der Begründer der Zivilisation“ war (vgl. Schächtele 2009, 233). Sprache gilt gemeinhin als etwas, das der Gewalt entgegengesetzt ist, als ein Medium, den Streit dank des „eigentümlich zwanglosen Zwangs des besseren Arguments“ (Habermas 1984, 137) in Konsens zu verwandeln - ohne dass die Faust zum Einsatz kommen müsste. Andererseits finden wir uns im Alltag oft genug in Situationen wieder, in denen wir durch Sprache tatsächlich verletzt werden, sodass wir annehmen müssen, dass durchaus ein Zusammenhang zwischen Sprache und Gewalt besteht. Das Sprechen kann in bestimmten Situationen zu einem Feldzug verkommen, in dem die Zunge zum Schwert wird. Unter gewissen Umständen können mit der Sprache Gewaltakte ausgeübt werden, die mit der Zerstörungskraft von physischer Gewalt vergleichbar sind. In diesem Sinn beinhaltet das Sprechen nicht nur die Möglichkeit, Gewalt anzudrohen, sondern ist selbst eine Form von Gewalt. Die Gewalt ist also nicht stumm und die Sprache nicht gewaltlos, auch wenn sie manchmal die Dynamik der Gewalt zu unterbrechen vermag. Deswegen ist es wichtig, nicht zuletzt um des gewaltfreien Potenzials der Sprache willen, ihre Gewaltsamkeit zu verstehen. In der vorliegenden Arbeit soll darum die Frage im Zentrum stehen, wie mit Sprache Gewalt ausgeübt werden kann. An diesem Kern setzen folgende weiteren Fragen an: Woher kommt die verletzende Kraft im Sprechen? Wie kann Sprache verletzen? Wie kann mit sprachlicher Gewalt umgegangen werden? Um sich diesen Fragen annähern zu können, muss in einem ersten Schritt eine konzeptionelle Grundlage gefunden werden, die es überhaupt erst erlaubt, gewalttätiges Sprechen zu untersuchen. Denn im traditionellen systemlinguistischen Verständnis der Sprache als ein körperloses System von Zeichen, ist das von ihr ausgehende Gewaltpotenzial nicht beschreibbar. Darum wird, aufbauend auf Ludwig Wittgensteins Gebrauchstheorie, für eine pragmatische Sicht auf die Sprache argumentiert, die das aktuelle Sprechen zum Gegenstand hat und das Sprechen als einen Teil der sozialen Praxis bestimmt. Daneben soll im Rückgriff auf interaktionstheoretische Grundannahmen ein Bild des Menschen entworfen werden, der seine soziale Identität durch sprachliche Vorgänge erhält. Dies führt zu einer Argumentation für das Verständnis von Subjekten als Wesen, die neben ihrem physischen Körper über einen sozialen Körper verfügen, der sprachlich konstituiert ist. Dieses theoretische Fundament erlaubt es, in einem zweiten Schritt, die Frage nach der Wirkkraft von verletzenden Äusserungen zu stellen. Diese Frage soll sprechakttheoretisch angegangen werden. Dazu wird John L. Austins Entdeckung der Handlungsdimension im Sprechen rekonstruiert, um die sprechakttheoretischen Konzepte Illokution und Perlokution für die Analyse von gewalttätigem Sprechen fruchtbar zu machen. Der Blick auf die illokutionäre Dimension sprachlicher Gewalt soll das in der Konventionalität der Sprache begründete Gewaltpotenzial aufdecken und zur Frage nach dem Umgang mit illokutionären Gewaltakten überleiten. Anhand von Beispielen werden die Möglichkeiten und Grenzen der sprachlichen Gegenwehr, wie sie Judith Butler vorschlägt, aufgezeigt. Im folgenden Kapitel soll mit der Fokussierung der perlokutionären Dimension dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Wirkung sprachlicher Gewalt immer auch von der individuellen Interpretation einer Äusserung abhängt. Die Beschreibung der Wirkung von perlokutionären Akten wird deshalb auf dem Konzept der persönlichen Integrität abgestützt. Hier sollen ebenfalls Beispiele die verletzende Wirkung und die Möglichkeit zu deren Überwindung illustrieren. Im letzten Kapitel sollen die Resultate in einen grösseren Rahmen gestellt werden. Dabei rückt die Frage ins Zentrum, in welchem Zusammenhang die menschliche Existenz, die Sprache und die Gewalt zueinander stehen und inwiefern sie sich gegenseitig bedingen.
In den letzten zwanzig Jahren hat sich eine inzwischen weit verzweigte Forschung zum Thema Sprachliche Gewalt entwickelt. Das weitreichende Forschungsfeld erstreckt sich einerseits über viele verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, andererseits werden in den einzelnen Disziplinen verschiedene methodische Ansätze verfolgt. Dadurch ergibt sich ein interdisziplinärer Diskurs, in dem sich mittlerweile verschiedene theoretische Ansätze überschneiden. Vor allem im angelsächsischen Raum existiert seit den 1960er-Jahren eine wissenschaftliche Auseinandersetztung mit sprachlicher Gewalt, die vor allem durch die Political-Correctness-Debatte in den USA getrieben ist. Die Debatte reicht von juristischen Arbeiten über Arbeiten aus dem Bereich der politischen Philosophie bis hin zu soziologischen sowie diskurs- und gesprächsanalytischen Arbeiten.1 Im deutschsprachigen Raum wurde das Thema zuerst von der feministischen Linguistik aufgegriffen.2 Methodisch differenziertere Arbeiten entstanden in den 1990er Jahren am Deutschen Seminar der Universität Zürich.3 Erst in den letzen Jahren sind grössere Editionen zum Thema erschienen. Die treibende Kraft hinter der deutschsprachigen Forschung ist Frau Prof. Sybille Krämer von der Freien Universität in Berlin. Aus den Arbeiten von Krämer und ihren Kollegen sind seit dem Jahr 2007 die zwei einschlägigen interdisziplinären Sammelbände zum Thema im deutschsprachigen Raum hervorgegangen, auf die an verschiedenen Stellen in der vorliegenden Arbeit Bezug genommen wird.4
Auf Grund der äusserst facettenreichen Forschung zum Thema ist es schwierig, einen gemeinsamen Nenner der Arbeiten zu finden. Zumindest lassen sich im Feld der Sprachwissenschaft zwei grössere Bereiche identifizieren. Zum einen ist dies die empirische Linguistik, die sich konversationsanalytischer Methoden bedient. Zum anderen ist es ein Forschungsbereich, der sich im weiteren Sinne als Performativitätsforschung zusammenfassen lässt. Die vorliegende Arbeit lässt sich innerhalb des zweiten Paradigmas einordnen. Die bisherigen Arbeiten in diesem Feld gehen zwar allesamt auf Austins Entdeckung der performativen Äusserung zurück, doch wird das Konzept mittlerweile in so vielen verschiedenen Weisen verwendet, dass es oftmals schwierig ist, zu verstehen, was genau unter den Begriffen Performativität und Performanz verstanden wird. Die vorliegende Arbeit soll darum einen Versuch darstellen, in gewissem Mass hinter das Schlagwort performativ zurückzutreten. Dazu soll mit der Sprechakttheorie, wie sie Austin im zweiten Teil von how to do things with words (Austin 1979) entwirft, eine Basis gefunden werden, die begrifflich differenzierter ist, als es der Rückgriff auf das Konzept Performativität erlaubt. Der sprechakttheoretische Ansatz dieser Arbeit soll innerhalb eines gesamtheitlichen pragmatischen Sprachbild eingeordnet werden, in dem auch diskurs- und systemtheoretische Grundprinzipien relevant sind. Letzten Endes soll es um das Verständnis von sprachlichen Gewaltakten im Horizont der menschlichen Interaktion gehen.
Diese Arbeit ist keine empirische Arbeit. Sie hat darum auch nicht den Anspruch, Gewalt in einzelnen Äusserungen nachzuweisen. Die Arbeit kann in ihrem Umfang auch nicht das Ziel verfolgen, eine abschliessende Konzeptualisierung von sprachlicher Gewalt vorzulegen. Der Anspruch dieser Arbeit ist, mit sprechakttheoretischem Fokus allgemeine Muster in der Sprachverwendung zu finden, die als Ausübung von Gewalt bezeichnet werden können und eine verletzende Wirkungen haben können.
2. Sprache und Sprechen
2.1. Sprache als virtuelles System von Zeichen
Um sich dem Phänomen der Gewalt in der Sprache annähern zu können, müssen zuerst einige Fragen bezüglich des Wesens von Sprache und Sprechen geklärt werden. Dies sind die Grundfragen der Sprachwissenschaft. Sucht man in der linguistischen Tradition nach Antworten auf diese Fragen, dann landet man unweigerlich bei Ferdinand de Saussure. Keiner hat die moderne Sprachwissenschaft so nachhaltig beeinflusst wie der Genfer Professor. Es gilt jedoch festzuhalten, dass die Positionen der historischen Person de Saussure und die des Cours de linguistique gé né rale, seiner berühmten Vorlesungsreihe zur allgemeinen Linguistik, voneinander unterschieden werden müssen. So hat die neuere Saussure-Forschung gezeigt, dass die von Charles Bally und Albert Sechehaye publizierte Rekonstruktion der Vorlesung, welche die beiden Herausgeber selber nie gehört hatten, mit grosser Wahrscheinlichkeit von den eigentlichen Auffassungen de Saussures beträchtlich abweicht. Bereits die Herausgeber, wenn nicht sogar die Verfasser des Cours, waren sich bewusst, dass der offenbar von starken Zweifeln geplagte de Saussure der Veröffentlichung möglicherweise nicht zugestimmt hätte (vgl. Fehr 2003, 18f., 24f. und Krämer 2001, 19). So wichtig es auch ist, diesen Umstand zu beachten, ändert er nichts an der Tatsache, dass es der Cours war, der über Jahrzehnte die Sprachwissenschaft massgeblich beeinflusst hat. Dem historischen de Saussure nicht gerecht zu werden, ist unter diesem Gesichtspunkt nicht so gravierend, denn „die Bedeutung eines Textes entspringt im Allgemeinen weniger der Intention eines Autors als vielmehr seiner Wirksamkeit innerhalb eines Diskurses“ (Krämer 2001, 20).
Im Zentrum dieser kanonisch gewordenen Sprachkonzeption steht die Unterscheidung zwischen langue und parole, der Sprache und dem Sprechen (vgl. Saussure 2001, 11-13.), durch welche de Saussure „die Sprache als ein genuines Objekt der Sprachwissenschaft erst erschaffen hat“ (Krämer 2001, 20). De Saussure betrachtet die Sprache nicht als blosse Abstraktion von der Welt, sondern die sprachlichen Zeichen sind selber „Realitäten“, „deren Sitz im Gehirn ist“ (Saussure 2001, 18). Die langue und die parole sind zwei verschiedene Gegenstände, denen eine je eigene Realität zukommt, wobei sich der Unterschied zwischen ihnen nicht bloss auf methodologischer, sondern auch auf ontologischer Ebene manifestiert (vgl. Stetter 2002, 33). Das Verhältnis zwischen langue und parole vergleicht de Saussure mit dem Verhältnis zwischen einer Symphonie und ihrer Aufführung oder zwischen einer Norm und deren Anwendung. Er lässt dabei keinen Zweifel offen, dass es die Seite der langue ist, die er für das Wesentliche an der Sprache hält, während für ihn die parole sekundär, sprich, lediglich ein Epiphänomen der langue ist (vgl. Saussure 2001, 16f.). Folglich soll für de Saussure die langue der Untersuchungsgegenstand der Sprachwissenschaft sein, weil er in ihr das Prinzipielle der Sprache an und für sich verortet. Wieso diese Vorrangigkeit der langue ? Für die Beantwortung dieser Frage lohnt sich ein Blick auf die zeichntheoretische Basis von de Saussures Sprachverständnis. Sprachliche Zeichen sind nicht einfache Namen für einzelne Gegenstände. Sie zeichnen sich laut de Saussure dadurch aus, dass sie aus zwei verschiedenen, eng miteinander verbundenen, Bestandteilen bestehen: dem signifié (Signifikat) und dem signifiant (Signifikant) (vgl. Saussure 2001, 76f.). Während der Signifikant die sinnlich wahrnehmbare Komponente eines Zeichens ausmacht, ist das Signifikat immer etwas Innerliches, somit nicht wahrnehmbar und auch in gewissem Masse obskur. Es ist der Inhalt des Zeichens - der intensionale Anteil sprachlicher Bedeutung. Diese zeichentheoretische Zweiteilung ist die Grundlage für eine „Zwei-Welten-Ontologie“5, die sich auf verschiedenen Ebenen in de Saussures Theorie und in der Folge der gesamten Systemlinguistik niederschlägt. Es handelt sich um die Idee, dass Sprachlichkeit grundsätzlich in einen wahrnehmbaren, raum- zeitlich situierten und einen nicht-wahrnehmbaren, virtuellen Teil zerfällt. Auf der Stufe eines ganzen Zeichenvorkommnisses findet sich diese Dichotomie in der Abgrenzung eines tokens vom ihm zu Grunde liegenden type. Dieses von Charles Sanders Peirce in den Diskurs eingeführte Begriffspaar bezieht sich auf die Abgrenzung eines singulären Zeichenvorkommnisses vom universellen, nicht raum- zeitlich lokalisierbaren Zeichentypus. Das token ist eine spezifische Aktualisierung des entsprechenden types. Dehnt man dieses Denkmuster auf die Menge aller in der sprachlichen Praxis vorkommenden tokens aus, landet man bei de Saussures Begriff der parole. Analog dazu ist die langue als die Menge aller types bestimmt. Die einzelnen types stehen einer geordneten Art und Weise, einer Struktur, zu einander. Aus dieser Struktur ergibt sich ein System. Die langue ist also ein System von Zeichentypen (vgl. Saussure 2001, 12). Im Zusammenhang mit der Systemhaftigkeit der langue tritt ein weiterer Begriff hervor: Es ist der Begriff des valeur, des sprachlichen Wertes von Zeichen (vgl. Saussure 2001, 135-140). Die einzelnen Zeichentypen haben für sich allein keinen Wert. Es sind die strukturellen Verbindungen innerhalb des Systems, die den einzelnen Zeichen einen Wert zuordnen. Oder anders ausgedrückt: Erst in der Relation zu anderen Zeichen wird der Wert eines Zeichens bestimmt. Dies hat zwei gewichtige Implikationen: Erstens kann Bedeutung, die zwar methodisch vom Wert eines Zeichens zu unterscheiden ist, mit diesem aber untrennbar verknüpft ist, nicht im Zeichen selber lokalisiert werden, sondern entsteht zwischen den Zeichen. Zweitens sind Wert und Bedeutung von Zeichen aufgrund des Systemcharakters der Sprache nicht positiv zu fassen, sondern negativ - nämlich als Differenz. Der Wert des types,spazieren’ beispielsweise ist nur dadurch bestimmt, dass es noch ,gehen’, ,laufen’, ,rennen’ und genau genommen alle anderen Elemente des Systems gibt, die sich von ,spazieren’ unterscheiden. Damit zurück zur oben gestellten Frage nach dem Grund für die vorrangige Behandlung der langue gegenüber der parole: Die parole, die als wahrnehmbarer Bereich der Sprachlichkeit die Aktualisierung von Zeichen beinhaltet, spielt sich innerhalb von Raum und Zeit ab. Dies führt dazu, dass die einzelnen tokens zwangsläufig in einer syntagmatischen Reihe realisiert werden. Damit aber das Prinzip der Differentialität als Bestimmung von etwas durch das, was es nicht ist, überhaupt wirksam werden kann, muss das zeitliche Nebeneinander in die Gleichzeitigkeit überführt werden. Eine Gleichzeitigkeit jedoch, die nur virtuell sein kann, da sie das Verhältnis zwischen gebrauchtem Zeichen und durch diesen Gebrauch ausgeschlossenen Zeichen betrifft (vgl. Krämer 2001, 36). Die langue ist die Domäne, die das differentielle Netz zwischen anwesenden und abwesenden Elementen stiftet, weil ihre Elemente nicht syntagmatisch geordnet sind, sondern in vielerlei paradigmatischen Relationen das System bilden. Dadurch entsteht erst die Bedingung der Möglichkeit, überhaupt etwas Bestimmtes in der parole zu äussern. So gefasst, ist jedem sprachlichen Ausdruck, sei er nun schriftlich oder mündlich, die Sprache als virtuelles System zu Grunde gelegt. In ihr spielen sich gemäss de Saussure die Prozesse ab, deren Analyse die Fragen der Sprachwissenschaft beantworten soll.
Welche Folgen erwachsen aus der Priorisierung der langue gegenüber der parole ? Ganz allgemein steckt sie den Gegenstandsbereich der Sprachwissenschaften dahin gehend ab, dass die Frage ‚ Wozu brauchen wir Sprache? ’ hinter die Frage ‚ Was ist Sprache? ’ zurücktritt oder gar nicht gestellt wird. Das hat damit zu tun, dass sich de Saussure bewusst von der bis dato einflussreichen Referenztheorie der Bedeutung lösen wollte, gemäss welcher die Sprache den Zweck der Repräsentation von Gedanken erfüllt (vgl. Krämer 2001, 97). Laut der Referenztheorie ist Sprache durch die Repräsentation von Aussersprachlichem bestimmt und dient als Abbild, Medium oder Organ einer der Sprache vorgängigen Ordnung, nämlich der Ordnung der Gedanken. De Saussures Sprachkonzept hingegen plädiert dafür, dass Ordnung und Systematik nicht bloss durch die Sprache dargestellt werden, sondern in ihr selbst begründet sind. Die Sprache selbst ist die strukturgebende Instanz in der Welt. Jedoch ist der Preis für die Setzung dieses hohen Stellenwerts der Sprache (und damit der systematischen Sprachwissenschaft innerhalb der Wissenschaften) ein hoher: Wie oben ausgeführt, geht mit dem Beschreiben der Sprache als System eine Virtualisierung einher, die methodische Schwierigkeiten mit sich bringt. Denn wenn das Wesentliche an der Sprachlichkeit nicht in der Praxis des Sprechens zu finden ist, dann können keine empirischen Daten zu dessen Erforschung verwendet werden. Oder besser gesagt: Untersuchungen, die das aktuelle Sprechen untersuchen, liefern nicht die wesentlichen Einsichten, weil ein direkter Blick auf die langue immer verwehrt bleibt. Die Aufgabe des Saussure’schen Sprachforschers ist das Durchbrechen der Oberflächenstruktur der sinnlich wahrnehmbaren Sprachphänomene, um dadurch die nicht den Sinnen sondern allein dem Verstand zugänglichen Strukturen zu untersuchen. Nicht nur, dass diese Aufgabe keine leichte ist, sie ist auch eine theoretisch fragwürdige: Denn wenn für die Analyse der langue genau von denjenigen Aspekten eines natürlichen sprachlichen Ereignisses abgesehen wird, wenn die lebensweltliche Situiertheit und Faktizität von Sprachereignissen ausgeklammert wird, besteht dann nicht die Gefahr, dass der eigentliche Erklärungsgehalt der Analyse verloren geht? Ist die langue, die de Saussure hinter dem Sprechen lokalisiert, nicht vielmehr ein Postulat als eine Entdeckung ?
Pierre Bourdieu würde diese Frage bejahen, indem er solcher Sprachwissenschaft einen grundlegenden Fehlschluss unterstellt (Bourdieu 1993, 341-350). Bourdieu macht darauf aufmerksam, dass in den Sozial- und Geisteswissenschaften eine besonders grosse Gefahr besteht, den, wie er ihn nennt, „scholastischen Fehlschluss“6 zu begehen. Wenn Wissenschaftler soziale, kulturelle und sprachliche Phänomene untersuchen, tun sie das in einer Situation der scholé (griechisch ursprünglich für Musse, später auch Schule, Studium), deren Besonderheit darin besteht, dass von denjenigen Bedingungen und Zwecken abgesehen wird, welche den Untersuchungsgegenstand in seiner lebensweltlichen Einbettung und Faktizität ausmacht. Man sei versucht, so Bourdieu, die praktischen Aspekte zu Gunsten einer Lehre, die das Wesen der Dinge erfassen soll, auszuklammern. Dies führe zu einer Unverträglichkeit zwischen Gegenstand und Methode, die immer dann entsteht, „wenn auf eine Praxis eine Denkweise“ angewendet wird, „die die Suspendierung der praktischen Notwendigkeit voraussetzt und die Denkinstrumente einsetzt, die gegen die Praxis entwickelt wurden“ (ebd. 344). Der Fehlschluss besteht also darin, dass die Gelehrten, die „nicht untersucht haben, was es heisst ein Gelehrter zu sein“, und die nicht untersucht haben, was es bedeutet, in der Einstellung der scholé zu forschen, sondern diese Einstellung als ganz natürlich erachten, „in die Köpfe der Handelnden ihre dogmatische Ansicht“ einsetzen (ebd., 344). Auf die Sprachwissenschaft bezogen heisst das: Die scholé bewirkt einen Übergang von der primären Beherrschung der Sprache als Kommunikationsmittel zu einer sekundären Beherrschung als Objekt von Beobachtung und Analyse. Nicht Sprachen zu beherrschen, sondern die Sprache zu erkennen, ist das Ziel systematischer Sprachwissenschaft im Sinne de Saussures. Das wiederum heisst: Einerseits werden Attribute, die genau dadurch entstehen, dass die Sprache nicht praktisch gebraucht, sondern untersucht wird, als reale Eigenschaften auf natürliche Sprachen und das Sprechen projiziert (vgl. Krämer 2001, 104). Andererseits bleiben relevante Aspekte der natürlichen sprachlichen Praxis unentdeckt. Man kann auch einwenden, dass es für manche interessante linguistische Forschungsfrage gar nicht relevant ist, ob die langue eine adäquate Konzeptualisierung der Sprache sei, weil die für die Behandlung der Frage zu untersuchenden Prozesse offensichtlicherweise in der sprachlichen Praxis liegen. So verhält es sich auch mit dem Thema dieser Arbeit. Denn Gewalt durch Sprache ist etwas, das in der Welt passiert, das man am eigenen Leib erfahren kann und man darum auch die Sprache in der Welt untersuchen muss.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Trennung zwischen langue und parole ist Ausdruck einer Zwei-Welten-Ontologie, die das sprachwissenschaftliche Denken de Saussures bestimmt und die viele linguistische Theorien im Anschluss an de Saussure aufgegriffen haben. Die auf dieser Trennung aufbauende Priorisierung der langue als das Wesentliche an der Sprache ist, wie oben gezeigt, nicht unproblematisch. Jedoch sollen auch die positiven Aspekte des Cours festgehalten werden. Es sind vor allem die zeichentheoretischen Grundlagen, die er liefert und die Idee der Differentialität im Zusammenhang mit dem sprachlichen Wert. Sie spielen als Prinzipien auch eine Rolle bei der innersprachlichen Beschreibung der Wirkmächtigkeit von aktuellem Sprechen, wie im weiteren Verlauf dieser Arbeit gezeigt wird.
2.2. Sprache als Gebrauch von Zeichen
Wie muss eine Theorie der Sprache aussehen, die nicht Gefahr läuft, in den Sog des scholastischen Fehlschlusses zu geraten? Die Antwort ist relativ einfach: Sie soll sich an den realen Sprachvorkommnissen natürlicher Sprachen orientieren und somit die Phänomene als das betrachten, was sie sind - also nicht nach dem, was hinter ihnen verborgen sein könnte, suchen. Eine solche Herangehensweise ist durch diesen Anspruch allein schon weniger Theorie als vortheoretisches Betrachten. Bereits Goethe hat dafür plädiert, dass eine durch die Lehre voreingenommene Sicht auf den Untersuchungsgegenstand den Blick trübt, wie er in seinen Maximen und Reflexionen anführt: „Man suche nur nichts hinter den Phänomenen: sie selbst sind die Lehre.“7 Die späten Schriften Ludwig Wittgensteins nehmen dieses Credo zum Anlass einer Betrachtung der Sprache, die mit seinem früheren Projekt der Sprachanalyse insofern bricht, dass sie von vornherein nicht nach einer idealen Sprache sucht. Dazu Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen:
„Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen können. Wir wollen gehen; dann brauchen wir die Reibung. Zurück auf den rauhen Boden!“ (Wittgenstein 1984a, PU § 14).
Was Wittgenstein hier mit „Zurück auf den rauhen Boden!“ meint, ist die Aufforderung, die aktuelle Sprache in all ihrer Unvollkommenheit als Untersuchungsgegenstand zu nehmen. Seine Sprachbetrachtungen sollen quasi bei Null beginnen. Demzufolge geht es ihm um die Alltagssprache oder, um noch einen Schritt weiter zurück zu treten, um den menschlichen Alltag.8 Um zu zeigen, welche Funktion die Sprache hat, verweist Wittgenstein auf geradezu banale Alltagssituationen, mit welchen seine Philosophischen Untersuchungen einsetzen:
„Denken wir uns eine Sprache. [...]. Die Sprache soll der Verständigung eines Bauenden A mit einem Gehilfen B dienen. A führt einen Bau auf aus Bausteinen; es sind Würfel, Säulen, Platten und Balken vorhanden. B hat ihm die Bausteine zuzureichen, und zwar nach der Reihe, wie A sie braucht. Zu dem Zweck bedienen sie sich einer Sprache, bestehend aus den Wörtern: »Würfel«, »Säule«, »Platte«, »Balken«. A ruft sie aus; - B bringt den Stein, den er gelernt hat, auf diesen Ruf zu bringen. - Fasse dies als vollständige primitive Sprache auf.“ (Ebd. §2).
Was geschieht in dieser Situation? Zuerst macht Wittgenstein klar, was für einen Zweck die sprachlichen Äusserungen der beiden Bauenden erfüllen. Sie dienen der Verständigung. Man kann sich vorstellen, dass sich die beiden Bauleute auch ohne gesprochene Sprache verständigen könnten, beispielsweise mit Handzeichen. Daraus wird ersichtlich, dass die Sprache primär ein Mittel zur Kommunikation ist, und Kommunikation meint in diesem Sinne nichts anderes als eine Tätigkeit, die Hand in Hand mit dem übrigen menschlichen Handeln läuft. Die beiden Bauarbeiter haben ein praktisches Ziel - sie wollen ein Haus bauen. Dafür müssen sie Steine herbei schaffen. Um diesen Handlungsablauf zu gewährleisten, sprechen sie miteinander. Die Sprache hat aber nicht nur diese eine Funktion, sondern unzählig viele. Ein Gebet, ein Witz oder ein Ausruf der Empörung beziehen sich nicht auf Tatsachen in der Welt und Wörter wie rot, gegangen oder die Zahl drei stehen nicht für Gegenstände wie die oben genannten Bausteine. Vielmehr gibt es unzählige verschiedene Arten der Verwendung alles dessen, was wir Zeichen, Wörter und Sätze nennen. Darum erweist sich die Suche nach dem Wesen des Satzes, des Wortes, der Sprache als illusorisch (vgl. Kanterian 2004, 65).
Doch wie können wir die Sprache richtig beschreiben? Wie muss man sich die unzähligen Funktionsweisen der Sprache vorstellen? Wittgenstein schlägt vor, dass die Sprache in Analogie zu Spielen beschrieben werden soll. Denn der Blick auf die Vielfalt der Spiele lehrt uns, Abstand von einem Denkgestus zu nehmen, der nach dem Idealen sucht (vgl. Krämer 2001, 118f.). Es zeigt sich, dass es unmöglich ist, zu sagen, was etwas zum Spiel macht:
„Betrachte z.B. einmal die Vorgänge, die wir »Spiele« nennen. Ich meine Brettspiele, Kartenspiele, Ballspiel, Kampfspiele, usw. Was ist allen diesen gemeinsam? - Sag nicht: »Es muß ihnen etwas gemeinsam sein, sonst hießen sie nicht ›Spiele‹ « - sondern schau, ob ihnen allen etwas gemeinsam ist. - Denn wenn du sie anschaust, wirst du zwar nicht etwas sehen, was allen gemeinsam wäre, aber du wirst Ähnlichkeiten, Verwandtschaften, sehen, und zwar eine ganze Reihe. Wie gesagt: denk nicht, sondern schau! - Schau z.B. die Brettspiele an, mit ihren mannigfachen Verwandtschaften. Nun geh zu den Kartenspielen über: hier findest du viele Entsprechungen mit jener ersten Klasse, aber viele gemeinsame Züge verschwinden, andere treten auf. Wenn wir nun zu den Ballspielen übergehen, so bleibt manches Gemeinsame erhalten, aber vieles geht verloren. - Sind sie alle ›unterhaltend‹. Vergleiche Schach mit dem Mühlfahren. Oder gibt es überall ein Gewinnen und Verlieren, oder eine Konkurrenz der Spielenden? Denk an die Patiencen. In den Ballspielen gibt es Gewinnen und Verlieren; aber wenn ein Kind den Ball an die Wand wirft und wieder auffängt, so ist dieser Zug verschwunden. Schau, welche Rolle Geschick und Glück spielen. Und wie verschieden ist Geschick im Schachspiel und Geschick im Tennisspiel. Denk nun an die Reigenspiele: Hier ist das Element der Unterhaltung, aber wie viele der anderen Charakterzüge sind verschwunden! Und so können wir durch die vielen, vielen anderen Gruppen von Spielen gehen. Ähnlichkeiten auftauchen und verschwinden sehen. Und das Ergebnis dieser Betrachtung lautet nun: Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.“ (Wittgenstein 1984a, PU § 66).
Was die Spiele in all ihrer Verschiedenheit untereinander verbindet, charakterisiert Wittgenstein mit dem Begriff der Familienähnlichkeit. In einer Familie haben einige die gleiche Nase, einige die gleichen Augenbrauen, andere den gleichen Gang oder dieselben Haare. Jedoch teilen nicht alle miteinander dieselben Eigenschaften. Die Ähnlichkeiten greifen ineinander über und bilden ein Netzwerk. Wenn nun die Sprache in Analogie zu Spielen gesehen wird, welche wiederum durch das Charakteristikum der Familienähnlichkeit beschrieben werden, lautet die Konsequenz folgendermassen:
„Statt etwas anzugeben, was allem, was wir Sprache nennen, gemeinsam ist, sage ich, es ist diesen Erscheinungen gar nicht Eines gemeinsam, weswegen wir für alle das gleiche Wort verwenden - sondern sie sind mit einander in vielen verschiedenen Weisen verwandt. Und dieser Verwandtschaft, oder dieser Verwandtschaften wegen, nennen wir sie alle ›Sprachen‹.“ (Ebd. § 65).
Die Vergleichskraft von Sprache und Spiel besteht also in erster Linie in der Erkenntnis, dass nicht alle Elemente der entsprechenden Familie die gleichen Merkmale aufweisen. In diesem Sinn ist die Beschreibung von Sprache zuerst einmal eine negative: Wittgenstein gibt an, wodurch sich das, was zur Sprache gehört, gerade nicht auszeichnet. Es lassen sich aber auch positive Beschreibungen finden, welche klären können, inwiefern Sprachlichkeit als Sprachspiel aufzufassen sei. Die Wichtigste liegt im Handlungsaspekt von Sprachspielen. Damit zurück zum Beispiel der beiden Bauleute: Ihre Sprachbenützung ist als ein einfaches Sprachspiel aufzufassen. Und so wie von einem Spiel zu reden nur dann Sinn macht, wenn es die Tätigkeit des Spielens gibt, so ist auch für das Sprachspiel das Tun grundlegend:
„Das Wort »Sprach spiel « soll hier hervorheben, daß das Sprechen der Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit [...].“ (Ebd. § 23).
Am Beispiel der beiden Bauenden ist schön zu sehen, dass ihr Sprechen ein Teil ihres Handelns, dem Bauen eines Hauses, ist. Interessant ist nun nicht nur, dass Wittgenstein das Sprechen grundsätzlich mit einer Tätigkeit identifiziert, sondern dass er es als Teil einer Tätigkeit ansieht (vgl. Krämer 2001, 119). Genau darauf kommt es nämlich an: Der Sprachgebrauch ist nicht einfach ein Tun, sondern ist eingebettet in ein Tun. Sprachspiele sind mit nicht-sprachlichen Handlungen eng verwoben und kommen erst im Kontext der menschlichen Praxis zustande. Wittgenstein veranschaulicht das anhand eines Gedankenexperiments einer uns fremden Sprachgemeinschaft in einem fernen Land:
Denken wir uns, die Leute in jenem Land verrichteten gewöhnliche menschliche Tätigkeiten und bedienen sich dabei, wie es scheint, einer artikulierten Sprache. Sieht man ihrem Treiben zu, so ist es verständlich, erscheint uns ›logisch‹. Versuchen wir aber, ihre Sprache zu erlernen, so finden wir, daß es unmöglich ist. Es besteht nämlich bei ihnen kein regelmäßiger Zusammenhang des Gesprochenen, der Laute, mit den Handlungen; [...] Zu dem, was wir »Sprache« nennen, fehlt die Regelmäßigkeit. (Wittgenstein 1984a, PU § 207).
Wir könnten die Sprache dieser Leute nicht lernen, weil die Verbindung zwischen den Äusserungen und dem übrigen Handeln fehlt. Die Äusserungen blieben für uns bedeutungslos. Oder anders ausgedrückt: Wir würden sie gar nicht Sprache nennen. Die fehlende Verbindung nennt Wittgenstein den regelmässigen Zusammenhang. Das Wort regelmässig ist hier durchaus buchstäblich zu verstehen als gemäss einer Regel. Hier nähern wir uns dem Höhepunkt in Wittgensteins Argumentation: Innerhalb unserer Sprachspiele müssen gewisse Regeln herrschen. Nur wenn wir eine Äusserung regelgerecht innerhalb eines Handlungsakts tätigen, können wir mit ihr etwas tun. Diese Regeln sind die Spielregeln eines Sprachspiels und als solche sind sie konstitutiv für die Bedeutung. Wittgenstein exemplifiziert das Verhältnis zwischen den Verwendungsregeln eines Wortes und dessen Bedeutung anhand des Schachspiels:
Wörter und Schachfiguren sind einander ähnlich; zu wissen, wie ein Wort gebraucht wird, das ist so, wie zu wissen, welche Züge man mit einer Schachfigur ausführen kann. Wie kommen die Regeln nun ins Spiel? Was ist der Unterschied zwischen einem Spiel und dem ziellosen Hin- und Herrücken der Figuren? Ich bestreite zwar nicht, dass hier tatsächlich ein Unterschied besteht, möchte aber doch sagen, dass Wissen, wie eine Figur zu verwenden ist, kein spezieller Geisteszustand ist, der andauert, während das Spiel ausgetragen wird. Die Bedeutung eines Wortes ist nicht durch das ihm anhaftende Gefühl zu definieren, sondern durch die Regeln seiner Verwendung. (Wittgenstein 1984b, 147-148) .
So wie das Schachspiel gewissen Regeln folgt, die beispielsweise bestimmen, wie mit welcher Figur gezogen werden darf, sprich, wie man sie verwenden muss, so sind auch die Verwendungsweisen von Zeichen geregelt. Jedes Sprachspiel hat bestimmte Regeln: Jedes Wort und jeder Satz haben bestimmte Regeln für ihren Gebrauch. Ein Wort zu kennen, heisst demzufolge nicht primär dessen Bedeutung zu kennen, sondern zu wissen, in welchen Situationen man es regelkonform benützen kann. Das wiederum heisst nichts anderes, als ein kompetenter Sprecher innerhalb einer Sprachgemeinschaft zu sein. Die Regeln für den richtigen Gebrauch der Sprache sind Konventionen bzw. Gepflogenheiten, die Menschen innerhalb einer Lebensform teilen.9 Sprachspiele sind daher prinzipiell nur in sozialen Kontexten denkbar. Ein einzelner Mensch wäre gemäss Wittgenstein nicht in der Lage, ein Sprachspiel zu etablieren. Und weil Sinn und Bedeutung von Ausdrücken nur durch die in Sprachspielen geltenden Verwendungsregeln konstituiert werden, könnte dieser einzelne Mensch über gar nichts sinn- und bedeutungsvoll sprechen. Dies hat Wittgenstein in seinem berühmten Privatsprachenargument gezeigt. Wittgenstein stellt sich darin eine private Sprache vor, bei der nur der Sprecher selber um die Bedeutung der Wörter wissen könnte:
„Die Wörter dieser Sprache sollen sich auf das beziehen, wovon nur der Sprechende wissen kann; auf seine unmittelbaren, privaten Empfindungen.“ (Wittgenstein 1984a, PU § 243).
Wenn sich alle Wörter einer Sprache nur auf private Empfindungen beziehen, und das ist zwangsläufig der Fall bei einer Privatsprache, wie sie Wittgenstein sich vorstellt, dann ist die Verwendung dieser Wörter und somit die gesamte Sprache sinnlos. Denn die Bedeutung aller unserer Wörter ist nur dadurch stabilisiert, dass sie in intersubjektiven Sprachspielen verwendet werden. Rein private Erlebnisse lassen sich aber nicht intersubjektiv vermitteln. Man könnte beispielsweise einwenden, dass jemand nur selber wissen kann, dass er Kopfschmerzen hat. Der Umgang mit einem privaten Erlebnis, so Wittgenstein, lasse sich aber sehr wohl intersubjektiv vermitteln. Dass jemand Kopfschmerzen hat, können andere zwar nicht wissen, aber sie können es erkennen. Eine Schmerzäusserung wie ‚ Ich habe Kopfschmerzen ’ beschreibt nämlich keine (private) Tatsache, sondern ist Ausdruck des Schmerzes (vgl. Kanterian 2004, 72). Man könnte in der gleichen Situation stattdessen , Aua! ’ sagen und sich an den Kopf greifen. Ein solches Verhalten gilt in der Gemeinschaft als ein Kriterium, dass jemand Kopfschmerzen hat - es ist ein konventionelles Verhalten in einer Situation mit Kopfschmerzen. Der besagte Mensch könnte uns zwar auch täuschen und wir würden uns folglich irren. Er würde dann eine Regel des Sprachspiels verletzen. Auf jeden Fall aber bezieht sich seine Äusserung nicht auf eine private Tatsache, seinen Schmerz, vielmehr wird sie innerhalb des Sprachspiels und somit erst im Kontext einer sozialen Situation bedeutungsvoll. Dass Empfindungen nicht als private Gegenstände angesehen werden können, zeigt Wittgenstein anhand seines Käfer-Gleichnisses:
„Nun, ein Jeder sagt es mir von sich, er wisse nur von sich selbst, was Schmerzen seien! - Angenommen, es hätte Jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, was wir »Käfer« nennen. Niemand kann je in die Schachtel des Andern schaun; und Jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. - Da könnte es ja sein, daß Jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, daß sich ein solches Ding fortwährend veränderte. - Aber wenn nun das Wort »Käfer« dieser Leute doch einen Gebrauch hätte? - So wäre er nicht der der Bezeichnung eines Dings. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel; auch nicht einmal als ein Etwas: denn die Schachtel könnte auch leer sein. - Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann ›gekürzt werden‹; es hebt sich weg, was immer es ist.“ (Wittgenstein 1984a, PU § 293).
Wittgenstein nimmt den Käfer als Sinnbild für die Gefühle und Empfindungen eines Menschen, die in ihm drin sind wie in einer Schachtel. Da niemand ausser der Person selbst seine Empfindungen haben kann, kann auch niemand in die Schachtel eines anderen Menschen sehen. Das Gleichnis teilt bis hierhin die Ansicht, die wir intuitiv vertreten: Empfindungen sind das private Eigentum der jeweiligen Person. Wittgenstein argumentiert aber gleich gegen diese Ansicht: Wenn das stimmen würde, dann wäre es ja möglich, dass jeder ein anderes Tier in der Schachtel hätte, das er Käfer nennt. Diese Unterschiede zwischen den Käfern könnten wir nicht feststellen, da wir ja keine Möglichkeit haben, in die Schachtel einer anderen Person zu sehen, um die Käfer zu vergleichen. Es wäre also möglich, dass der eine das Schmerz nennt, was ein anderer Kitzeln nennt. Wittgenstein folgert aus dieser Unbestimmbarkeit, dass das Ding in der Schachtel, also die persönliche Empfindung, gar nicht nötig sei, um unsere Kommunikation über Schmerzen zu erklären - sie gehört gar nicht zum Sprachspiel dazu. Wie im Bruchrechnen kann durch sie gekürzt werden. Selbstverständlich heisst das nicht, dass es unwichtig ist, ob wir überhaupt Empfindungen haben, wenn wir über sie reden. Vielmehr will Wittgenstein zeigen, dass das Bild von Empfindungen als privaten Käfern in Schachteln falsch ist. Schmerzen, Freude, Hoffnung, Grauen - alle diese Empfindungen sind keine privaten Phänomene, von denen ich lediglich durch mich selbst etwas weiss (vgl. Schmitz 2004). Wittgenstein entwirft mit diesen Überlegungen ein Verständnis von Empfindungen als sozialen, kulturellen, gemeinschaftlichen Phänomenen. Das bedeutet, dass unsere Empfindungen, das, was wir bei Schmerz oder Freude fühlen, durch unsere Zugehörigkeit zu einer Kultur, einer Lebensform, wie er es nennt, geprägt ist. Wir sind in eine Lebensform mit ihren Gebräuchen und ihren Institutionen eingebettet. Hier kommt der Berührungspunkt zwischen unseren Empfindungen und der Sprache zum Ausdruck, denn beides sind Phänomene, die nur im Kontext sozialer Interaktion auftreten können. Sprachspiele und Lebensformen sind Teil des sozialen Alltags. Sie sind dasjenige, in das wir hineinwachsen, und durch das wir uns selbst und andere verstehen. Wir teilen unsere Praktiken mit anderen Menschen. Es gibt darum eine tiefe Verbundenheit zwischen den Menschen sowohl in ihren Handlungen wie auch in ihrem Denken, Sprechen und Fühlen. Diese Verbundenheit ist so tief, dass wir auch uns selbst nur über andere wahrnehmen können. Nur weil wir mit anderen Menschen zusammenleben, verstehen wir unser eigenes Inneres, unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Wittgenstein bringt es wie folgt auf den Punkt „So denken wir. So handeln wir. So reden wir“ (Wittgenstein 1984a, PU § 309). Dieses so, das in vielen Wendungen Wittgensteins vorkommt, ist äusserst aufschlussreich, um Wittgensteins Bestreben, das Naturhafte an Sprache und Kultur hervortreten zu lassen, nachzuvollziehen (vgl. Krämer 2001, 134). Das so fasst die Sprache als etwas, das sich zeigt. In dem, was sich zeigt, manifestiert sich nicht die Sprache als ein abstraktes System, sondern als unser praktisches Tun. Und zwar weniger, dass wir etwas tun, sondern wie wir etwas tun.
Ein kurzes Fazit zu diesem Kapitel: Die Perspektive Wittgensteins führt zu der Einsicht, dass Sprache nur in Verbindung mit unserer sozialen Realität beschrieben werden kann. Der für sein Spätwerk zentrale Begriff des Sprachspiels macht einerseits deutlich, dass der aktuelle Gebrauch in der Sprache die Bedeutung von Zeichen bestimmt. Andererseits führt die Vielfalt verschiedenartiger Sprachspiele, die in der Summe unsere Sprachlichkeit bestimmen, vor Augen, dass eine Grenzziehung zwischen dem, was zur Sprache und dem, was zu unserem übrigen Handeln gehört, keinen Sinn macht. Vielmehr ist unsere Sprache ein integraler Bestandteil unseres Handelns. Die Widerlegung der Möglichkeit einer Privatsprache und die damit verbundene Auffassung von Empfindungen als gesellschaftliche und kulturelle Phänomene, unterstreicht Wittgensteins pragmatisches und soziales Sprachverständnis.
Unter diesem Gesichtspunkt ist sprachliche Gewalt, wie auch immer sie im Detail wirkt, in Bezug auf die Mechanismen sozialer Interaktion zu beschreiben. Äusserungen sprachlicher Gewalt sind als Teil unserer sozialen Praxis nichts anderes als Wittgenstein’sche Sprachspiele und folgen gewissen Regeln. In den folgenden Kapiteln soll nun die Frage ins Zentrum rücken, wie sprachliche Gewalt unter diesen Präliminarien beschrieben werden kann.
[...]
1 Als einer der ersten Wissenschaftler hat sich der US-amerikanische Soziologe Erving Goffman mit den Bedingungen und Folgen von verletzendem Sprechen auseinander gesetzt (vgl. Goffman 1967a/ 1967b). Kernthema der neueren angelsächsischen Forschung ist das rassistische Sprechen. Prominente Vertreter aus dem politischen und juristischen Bereich zu dieser Thematik sind Matsuda (1993), Langton (1993), MacKinnon (1994) und Butler (2006). Teun A. van Dijk hat mit Communicating Racism eine umfassende diskursanalytische Arbeit zu rassistischem Sprechen vorgelegt (vgl. van Dijk 1987). Van Dijks Arbeit nimmt in der diskursanalytisch/ sprachwissenschaftlich geprägten Forschung einen zentralen Stellenwert ein und wird auch in neueren Publikationen als Grundlage verwendet (vgl. Reisigl/ Wodack 2001).
2 Vgl. zur feministischen Auseinandersetzung mit sprachlicher Gewalt in der deutschen Sprache die Arbeiten von Senta Trömel-Plötz (1984) und Luise F. Pusch (1984).
3 Vgl. die gesprächsanalytischen Arbeiten zur Gewalt in Fernsehdiskussionen von Harald Burger (1995) und Martin Luginbühl (1999).
4 Die beiden Sammelbände zum Thema Gewalt und Sprache entstammen dem Sonderforschungsbereich Kulturen des Performativen. (Vgl. Krämer et al. 2007 / Krämer; Koch 2010.
5 Vgl. Krämer 2006, S. 1. Krämer verwendet diesen Begriff, um das verbindende Glied innerhalb denjenigen Strömungen zu identifizieren, denen sie ein „intellektualistisches Sprachbild“ (vgl. ebd.) zuschreibt. Dieser Strang beginne bei Saussure und lasse sich zu Chomsky, Searle und Habermass weiterverfolgen. Dem gegenüber stellt sie diejenigen Theoretiker, die eine „flache Ontologie“ (vgl. ebd.) vertreten, sprich, die Unterscheidung zwischen Sprache und Sprechen nicht ins Zentrum ihrer Betrachtungen stellen. Diese Arbeit übernimmt nicht diese Teilung in zwei theoretische Lager. Vielmehr sollen einzelne Aspekte aus den aufgegriffenen Theorien zu einem sinnvollen Ganzen zusammengefügt werden, mit dem Ziel, Erklärungen für sprachliche Gewalt zu finden.
6 Ebd. S. 347. Bourdieu verwendet den englischen Begriff „scholastic fallacy“.
7 Goethe 1993, § 1.308. Ludwig Wittgenstein zitiert diesen Ausspruch Goethes in seinen Bemerkungen ü ber die Philosophie der Psychologie, § 889.
8 Wittgenstein bemerkt in § 109 der Philosophischen Untersuchungen (PU): „Alle Erklärung muss fort, und nur Beschreibung an ihre Stelle treten.“ Sein Ziel ist die „Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache“. Mit dem Begriff „Arbeit“ bringt er zum Ausdruck, dass es die aktuellen Funktionsweisen der Sprache sind, die er beschreiben möchte.
9 Wittgenstein verwendet den Begriff Lebensform in verschiedenen Kontexten (vgl. Wittgenstein 1984, PU §§19, 23, 241). Der gemeinsame Nenner sind die Verhaltensweisen innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft. Auf die Sprache bezogen verweist der Begriff auf eine Sprachgemeinschaft als den Zusammenschluss aller Sprecher derselben Sprache.
- Arbeit zitieren
- Mathias Haller (Autor:in), 2010, Verwundet durch Worte: Studie über Gewalt in der Sprache, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195858
Kostenlos Autor werden
















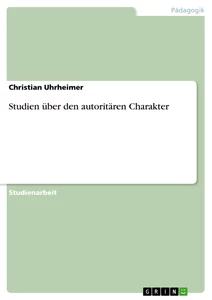
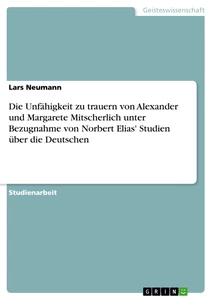


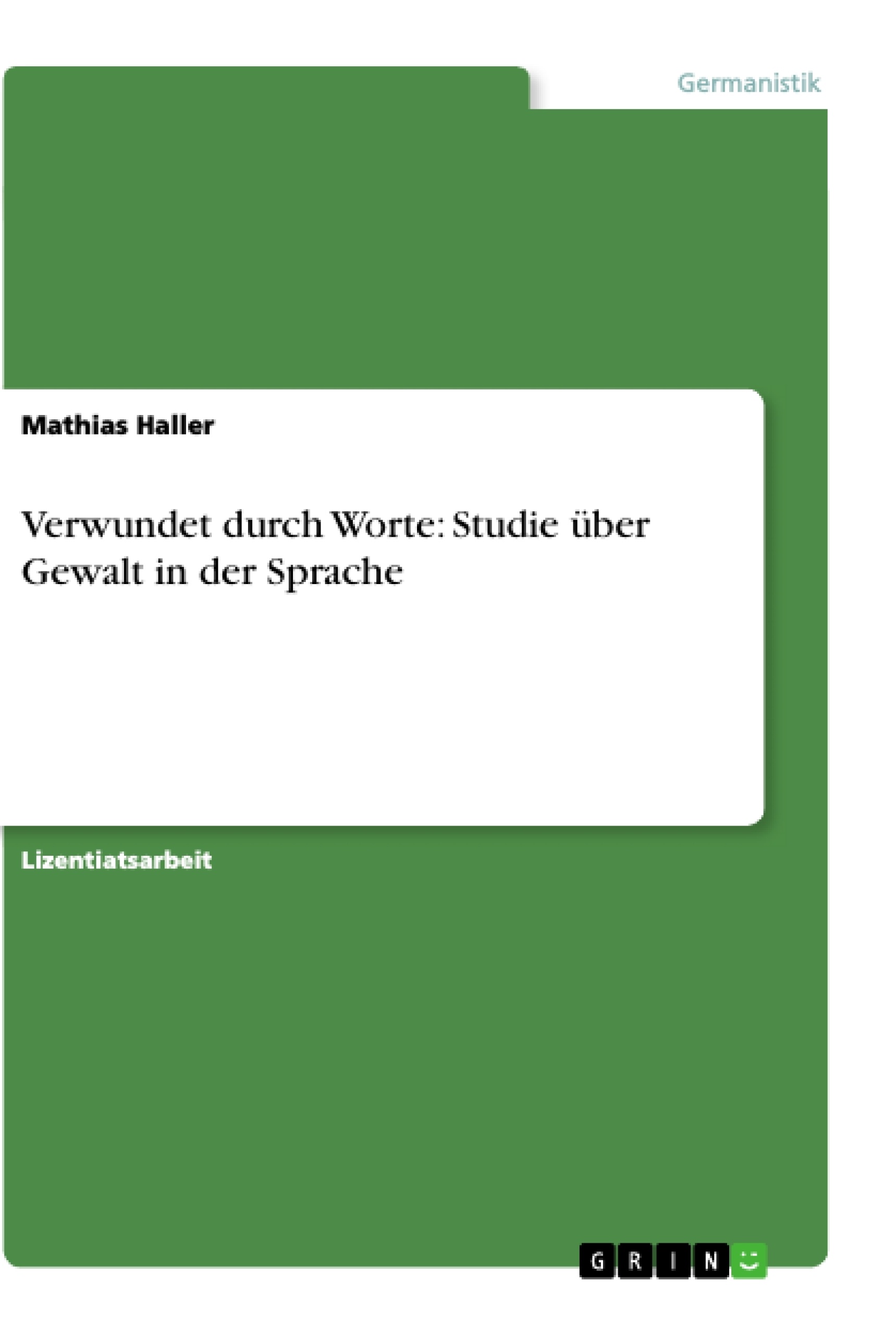

Kommentare