Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
1. Einleitung
2. Die Kulturtheorie des Risikos
2.1 Vorbemerkung
2.2 Prämisse: Risikoselektion und cultural bias
2.3 Grid-group-Schema und Naturmythen
2.4 Kulturelle Kategorien und ways of life
2.4.1 Hierarchie
2.4.2 Individualismus
2.4.3 Egalitarismus
2.4.4 Fatalismus
2.4.5 Autonomie
2.4.6 Abschließende Bemerkung
2.5 Weiterentwicklung der Theorie
2.5.1 Von ways of life zu political cultures
2.5.2 Cultural Theory ohne grid und group?
3. Politische Kulturen und Regulierungsstile
3.1 Vorbemerkung
3.2 Nationale politi sche Kulturen
3.2.1 Neudefinition
3.2.2 Typen politischer Kulturen
3.2.2.1 Hegemonie eines einzigen way of life
3.2.2.2 Allianzen von ways of life
3.2.2.3 Fatalistisch geprägte politische Kulturen
3.2.2 Einordnung von Staaten
3.3 Nationale Regulierungsstile
3.3.1 Politikwissenschaftliche Regulierungsforschung
3.3.2 Regulierungskulturen nach Jasanoff
3.3.3 Kulturtheoretische Rezeption durch Linnerooth- Bayer
4. Biotechnologiepolitik unter George W. Bush
4.1 Regulierungskontext, Abläufe und Zuständigkeiten
4.2 Grüne Gentechnik unter Bush
4.3 Rote Gentechnik unter Bush
5. Analyse und Beurteilung
5.1 Kulturtheoretische Einordnung
5.1.1 Politik und Ethik
5.1.2 Regulierung grüner Gentechnik
5.1.3 Regulierung roter Gentechnik
5.2 Neukonzeption der Kulturtheorie?
5.2.1 Eine erweiterte T ypologie?
5.2.2 Regulierungsstile und politische Kulturen
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
Abstract
In der Vergleichenden Politikwissenschaft ist seit der erstmaligen Veröffentlichung einer Reihe von Studien in den 80er Jahren zum Thema die These dominant, dass Staaten geprägt sind durch spezifische nationale Regulierungsstile, die ihre Politik weitreichend charakterisieren. Joanne Linnerooth-Bayer (1995) hat, unter Bezug auf Sheila Jasanoff (1995), diese These verbunden mit der Kulturtheorie des Risikos nach Douglas und Wildavsky (1982), indem sie darlegte, dass diese nationalen Regulierungsstile aus dem Wirken bestimmter politischer Kulturen und den damit einhergehenden spezifischen Risikowahrnehmungen resultieren. Diese Arbeit wendet sich gegen diese These insofern, als dass vertreten wird, dass Risikowahrnehmungen immer nur problemfeldorientiert beobachtbar sind und Regulierungsstile daher immer im Kontext des jeweiligen Politikfeldes gesehen werden müssen, was die Annahme eines jeweiligen umfassenden „nationalen Regulierungsstils“ negiert und zugleich Implikationen für die Cultural Theory selbst in sich birgt. Zur empirischen Untermauerung der Argumentation wird als Fallbeispiel die Ambivalenz der Gentechnologiepolitik der amerikanischen Bush-Administration herangeführt, welche speziell den Unterschied zwischen der Regulierung „grüner Gentechnik“ einerseits und „roter Gentechnik“ andererseits beleuchtet. Das Beispiel demonstriert, dass sich Regulierungsstile von Politikfeld zu Politikfeld deutlich unterscheiden können.
1. Einleitung
Mit der Kulturtheorie des Risikos, wie sie von Mary Douglas und Aaron Wildavsky (1982) entworfen wurde, wurde das theoretische Spektrum mit einem Modell bereichert, das mittels der These von „Risikokulturen“ und dem Grid-Group-Schema einen interessanten Vorschlag zu der Frage machte, auf welche Weise der Prozess der sozialen Konstruktion von Risiken - und damit auch des Umgangs mit diesen Risiken - beobachtet und erklärt werden kann. Der Ansatz ermöglichte zugleich eine neue empirische Perspektive auf ein oftmals eher theoretisch behandeltes Problem, was dazu beitrug, eine konstruktivistische Herangehensweise gewissermaßen „wettbewerbsfähiger“ zu machen und sie einer Methodik entgegen zu halten, die ihr Vorgehen traditionell eher aus Theorien der rationalen Wahl ableitete. Diese Qualitäten der Theorie wurden bald auch im Rahmen anderer Disziplinen wie der Politikwissenschaft zunehmend geschätzt, mit der Folge, dass mit der These politischer Kulturen auch eine spezifische Anwendung der Theorie auf die Policy-Analyse erfolgte (vgl. Schwarz / Thompson 1990).
Joanne Linnerooth-Bayer (1995) hat schließlich die von Sheila Jasanoff (1986; 1995) dargestellte These nationaler Regulierungskulturen mit dem kulturtheoretischen Modell verbunden: Demnach sind Regulierungsstile die Resultate des Zusammenwirkens der jeweiligen nationalen politischen Kulturen und damit der ihnen innewohnenden unterschiedlichen Risikoselektionen. Damit verband Linnerooth-Bayer zugleich kulturtheoretische Thesen mit der Perspektive der traditionellen Vergleichenden Politikwissenschaft, in deren Rahmen erstmals in den 80er Jahren vermehrt Studien veröffentlicht worden waren, die die Existenz charakteristischer nationaler Regulierungsstile postulierten (vgl. bspw. Vogel 1986).
Aus dieser Grundannahme ergibt sich die erste zentrale Problematik, mit der sich diese Arbeit auseinandersetzt. Denkt man die Thesen der Cultural Theory konsequent zu Ende, so wird deutlich, dass eine Risikowahrnehmung problemspezifisch erfolgt, d. h., dass Risiken immer bezogen auf ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Problemfeld, einen bestimmten Kontext hin konstruiert und beobachtet werden. Nun berührt nationale Regulierung bzw. nationale Politik grundsätzlich ein Konglomerat an Problemfeldern, wie etwa schon die schlichte organisationale Aufteilung einer Regierung in politikfeldspezifische Ministerien demonstriert. Hieraus ergibt sich die Zweifelhaftigkeit der Annahme eines einzigen national übergreifenden Regulierungsstils. Es soll somit die These vertreten werden, dass der Regulierungsstil innerhalb eines Nationalstaates nicht nur nicht länger auf politische Akteure innerhalb des Staates reduziert werden kann - hierbei handelt es sich um eine bereits laufende Debatte innerhalb der Regulierungsforschung (vgl. Wilson 2003; Jasanoff 2005: 68 ff.) - sondern dass vielmehr von der Existenz verschiedenster politikfeldabhängiger Regulierungsstile ausgegangen werden muss, die sich je nach Problemfeld bzw. Problemwahrnehmung (Risikokonstruktion) unterscheiden.
Ein empirisches Beispiel, anhand dessen die an dieser Stelle schon angedeutete Problematik vor Augen geführt werden kann, ist der Bereich der amerikanischen Gentechnologiepolitik, insbesondere in der Ära der Administration von George W. Bush, 2001 bis 2009. In der Analyse der Gentechnologie- oder Biopolitik Bushs soll über die kulturtheoretische Analyseperspektive gezeigt werden, wie stark sich die Regulierungsstile der US-Regierung in Hinblick auf die zwei wichtigen Bereiche dieses Politikfelds, „grüne Gentechnik“ und „rote Gentechnik“ (Humangenetik), voneinander unterschieden. Über die Erkenntnis, dass die Bush-Regierung im Bereich der grünen Gentechnik eine Politik betrieb, die im Kontext einer marktindividualistischen, neoliberalen politischen Kultur geprägt wurde, während sie hinsichtlich der roten Gentechnik, gerade im Bereich der Stammzellenforschung, geprägt war durch die Relevanz der evangelikalen Rechten für die Republikanische Partei zu jener Zeit, eine eher ablehnende Haltung vertrat, soll deutlich gemacht werden, wie Politik- und Regulierungsstile je nach Problemfeld differieren können.
Aus der Erörterung dieser Punkte ergibt sich die zweite in dieser Arbeit zu behandelnde Problematik, nämlich die Frage nach einer möglicherweise notwendigen Rekonzeptualisierung der Kulturtheorie. Mit der Feststellung eines evangelikalen Einflusses auf die Politik der Bush-Administration beispielsweise muss die Frage aufgeworfen werden, inwieweit die Kulturtheorie in ihrer bisherigen Konzeption imstande ist, eine Risikowahrnehmung jener Art, wie sie die US-„TheoCons“ (vgl. History News Network 2011) auszeichnet, analytisch zu erfassen und im Kontext einer politischen Kultur zu kategorisieren. Zugleich muss hinterfragt werden, inwieweit die besondere Fokussierung der Theorie auf das Risikoobjekt der „Natur“ für ihre analytische Breite vorteilhaft ist bzw. sie unter Umständen zu stark auf ökologische und umweltpolitische Fragen verengt. All diese Punkte sind Fragen, auf die diese Arbeit im Folgenden versuchen wird, eine Antwort zu finden.
Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich zunächst einer umfassenden Darstellung der risikosoziologischen Kulturtheorie, sowohl in ihrer ursprünglichen Konzeption nach Douglas und Wildavsky (vgl. Douglas / Wildavsky 1982; Douglas 1985; Douglas 1992), als auch in ihrer weiteren Ausarbeitung, in etwa durch Michael Thompson, Richard Ellis und andere (vgl.
Ellis 1993; Schwarz / Thompson 1990; Thompson / Ellis / Wildavsky 1990; Thompson / Grendstad / Selle 1999; Thompson 2008). Im zweiten Teil erfolgt eine Darstellung der Schlussfolgerungen, die Sheila Jasanoff hinsichtlich nationaler Regulierungsstile zieht, sowie der „kulturtheoretischen Übersetzung“ Linnerooth-Bayers (vgl. Jasanoff 1995; Linnerooth- Bayer 1995). Im Zuge dieses Abschnittes soll zudem auch eine kurze Zusammenfassung der betreffenden Diskussionen erfolgen, die dazu innerhalb der politikwissenschaftlichen Regulierungsforschung laufen. Der dritte Teil bietet die Darstellung des empirischen Beispiels der US-Gentechnologiepolitik der Bush-Ära, anhand dessen die oben genannte These dieser Arbeit begründet wird. Im vierten Teil der Arbeit schließlich erfolgt die kulturtheoretische Analyse der zuvor beschriebenen Beobachtungen, um darauf basierend meine These zu untermauern und zu Schlussfolgerungen über eine etwaige Rekonzeptualisierung der risikosoziologischen Kulturtheorie zu kommen. Im fünften und letzten Teil wird ein Fazit gezogen.
2. Die Kulturtheorie des Risikos
2.1 Vorbemerkung
Erstmals ausgearbeitet wurde die Cultural Theory im Rahmen des Buches „Risk and Culture - An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers“ durch die Anthropologin Mary Douglas und den Politikwissenschaftler Aaron Wildavsky (1982), welche darin ihre konstruktivistischen Prämissen mit dem Grid-Group-Schema erweiterten und daraus als Konsequenz die Existenz von vier maßgeblichen Risikokulturen postulierten. Dieses Modell wurde im Anschluss nicht nur mit zahlreichen empirischen Studien unterfüttert, sondern auch, insbesondere durch Theorievertreter wie Michael Thompson und Richard Ellis, erweitert. Im Folgenden sollen zunächst die konstruktivistischen Prämissen der Theorie beleuchtet werden, um danach zu einer Darstellung des Grid-Group-Schemas, der Kultur-Kategorien und schließlich der Theorieerweiterungen zu kommen.
2.2 Prämisse: Risikoselektion und cultural bias
Die risikosoziologische Kulturtheorie steht in der Tradition des Konstruktivismus. Ihre grundlegende Prämisse besteht in der Annahme, dass Risiken nicht objektiv existent sind, sondern auf der Basis einer Selektion konstruiert bzw. einem bestimmten Bereich zugerechnet werden. Risiko ist somit niemals etwas absolut Vermeidbares, sondern - wenn auch je nach Art der erfolgten Selektion - immer präsent. Die Konstruktion bestimmter Risiken richtet sich dabei auch danach, was als das jeweilige Risikoobjekt angesehen und worauf im Einzelfall die Priorität gelegt wird. Aufgabe einer kulturtheoretischen Forschung ist es demnach, zu untersuchen, wer unter welchen Umständen auf welche Weise was als gefährdet ansieht und auf dieser Basis welche Risiken zurechnet (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 8). Basierend auf diesen Bedingungen ergeben sich verschiedene Rationalitäten und damit zugleich auch, welche verschiedenen Lösungen und Risikomanagement-Strategien jeweils angestrebt werden: „Social accountability creates the main lines of cost-benefit payoffs and produces the different ways of categorizing the physical world“ (Douglas 1985: 39). Es ist das Ziel der Kulturtheoretiker, diese Kategorisierungen zu erfassen und als Kulturen zu beschreiben.
Wohl nicht zuletzt auch wegen des anthropologischen Hintergrunds von Mary Douglas verfolgt die Cultural Theory in ihrer und Wildavskys Konzeption eine Herangehensweise, die sich zunächst auf der Mikroebene bewegt und nicht, etwa wie die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns, versucht, die Gesellschaft über einen makrosoziologischen Ansatz zu beschreiben. Die Kriterien für Risikoselektionen und -konstruktionen werden nicht Systemen und ihren Codierungen zugeordnet, sondern an bestimmten, individuellen ways of life festgemacht: „The choice of risks and the choice of how to live are taken together. Each form of social life has its own typical risk portfolio” (Douglas / Wildavsky 1982: 8).
Essenziell für die Kriterien einer bestimmten Risikoselektion ist der cultural bias, der determiniert, was als Risiko angesehen wird - und was nicht. Das Negieren einer bestimmten Risikovorstellung ist dabei freilich nicht weniger relevant, da dies, sofern sie im Rahmen anderer „Lebensarten“ nicht negiert wird, zum Konflikt zwischen diesen verschiedenen ways of life führen kann. Dieser Punkt soll jedoch in den nächsten Abschnitten noch ausführlicher aufgegriffen werden.
Der cultural bias generiert mit verschiedenen Weltsichten und -interpretationen ausgestattete ways of life und ist konstitutiv für die Organisation sozialer Beziehungen (vgl. ebd.: 8). Der Begriff „bias“ erhält damit eine explizit nicht-normative Bedeutung, denn „when we say, therefore, that a certain kind of society is biased (...), we are not saying that other kinds of social organization are objective and unbiased but rather that they are biased toward finding different kinds of dangers” (ebd.: 8). Douglas sieht in dieser Erkenntnis nicht nur, wie die risikosoziologische und politikwissenschaftliche Rezeption der Cultural Theory zeigt, eine grundlegende Bedeutung für sozialwissenschaftliche Prämissen, sondern fordert auch von der Psychologie eine Anerkennung des Grundsatzes, dass es eine psychologische Untersuchung selektiver Wahrnehmung nicht geben kann, wenn damit nicht auch eine Erforschung der jeweiligen sozialen Faktoren einhergeht, die diese beeinflussen (vgl. Douglas 1985: 39). Douglas und Wildavsky wenden sich gegen die Vorstellung, dass die Abkehr von übernatürlichen und religiösen Erklärungen für Gefahren und Katastrophen, welche die Moderne kennzeichnet, zu einem vernunft-basierten, intellektuell „freien“ Blick auf Risiken geführt habe (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 29 ff.). Stattdessen werde über die Selektion von Risiken deren „Politisierung“, also deren Verknüpfung von zuvor erfolgten politischen Handlungen, weiterhin aufrecht erhalten, auch wenn dabei nicht mehr zwingend eine „Strafe Gottes“ befürchtet wird: „Anyone who claims to know the right priority among dangers to be avoided and who also pretends that the priority has no basis in moral judgements is making two backward steps toward premodernism“ (Douglas / Wildavsky 1982: 30). Soziale Strukturen, die die Kriterien für das Vergeben bestimmter Prioritäten von Risiken prägen, sind demnach immer auch Moralsysteme (vgl. Douglas 1985: 39), woraus sich wiederum der cultural bias ergibt, der die Art der jeweiligen Selektion determiniert.
Es sollte deutlich sein, dass diese Einschätzung ausdrücklich nicht nur für den jeweiligen Laien gilt - sowohl für den Laien, der sich beispielsweise an der Wahlurne in Form des Kreuzes bei einer bestimmten Partei für eine bestimmte Risiko-Prioritätensetzung entscheidet, als auch für den Laien, der etwa als Politiker an der Spitze eines Ministeriums die Expertise seiner Fachbeamten zu einem bestimmten Thema rezipieren muss. Die konstruktivistische Prämisse gilt nicht weniger auch für die besagten Experten selbst, die die Risiko-Abschätzung in einem spezifischen Feld hauptberuflich betreiben. Auch in diesen Bereichen erfolgt eine ständige, wenn auch aus Gründen der Selbstlegitimation der Profession der Risikoabschätzung verdeckte Selektion, sei es nur durch die Wahl bestimmter mathematischer Berechnungsmethoden oder das Ausmaß des Einkalkulierens von Nichtwissen: „Each method is biased (...) Since the risk analyst who feeds the machine its data is only human, he cannot focus on all prospects with an equally steady gaze. He is bound to select” (Douglas / Wildavsky 1982: 71). Trotz dieses cultural bias auch bei professionellen Risiko- Abschätzenden lebt deren Tätigkeit freilich vom Schein der absoluten Objektivität, welche auch für die letztendlichen Entscheider insbesondere in den Rationalität kommunizierenden Bürokratien der Exekutive eine Legitimationsfunktion erfüllt.
Die Cultural Theory kann hinsichtlich ihrer Tauglichkeit für empirische Forschung als außerordentlich praktikabler konstruktivistischer Ansatz angesehen werden (vgl. Plapp 2003:
22). Dies liegt u. a. in ihrem zugrundeliegenden Modell begründet, welches in den nächsten beiden Abschnitten dargestellt wird.
2.3 Grid-Group--Schema und Naturmythen
Die von Mary Douglas (1970) eingeführte Unterscheidung von grid und group - bzw. eines entweder positiven oder negativen group- und eines entweder positiven oder negativen grid- Grades - misst und benennt die Art des sozialen Einflusses auf eine bestimmte Kultur und, daraus hervorgehend, die Ursachen für einen wie auch immer gearteten cultural bias, der die Risikoselektion und -wahrnehmung regelt.
Group wird definiert als „the outside boundary that people have erected between themselves and the outside world” (Douglas / Wildavsky 1982: 138) und bezieht sich auf das “extent to which an individual is incorporated into bounded units” (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 5). Es geht bei der Messung der group-Dimension eines kulturell zuzuordnenden way of life also um die Frage des Grades der Integration in eine Gruppe und damit immer auch darum, wie stark die Abschottung von allem außerhalb dieser Gruppe oder sozialen Einheit ist (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 11; Plapp 2003: 34). Das Ausmaß der Integration des eigenen Lebens in die Strukturen einer Gruppe steht in einem engen Zusammenhang zum Ausmaß der Abkopplung von allem, was außerhalb der Gruppe steht. Es war der Psychologie Irving Janis, der in seiner Untersuchung des Groupthink-Phänomens in der Politik gezeigt hat, wie die Abkopplung nach außen die Integration in die Handlungs- und
Entscheidungsstrukturen der jeweiligen Gruppe gestärkt hat und eine sich stetig radikalisierende Selbstbestätigung und Anpassung der Gruppenmitglieder an die vermutete Gruppenmeinung die Folge war (vgl. Janis 1972). Erscheinungen wie diese sind auf vielerlei gesellschaftlichen Ebenen zu finden: In der Politik genauso wie etwa auch bei terroristischen Gruppen wie der RAF, der Donatella della Porta ähnliches attestiert hat (vgl. della Porta 2006: 50). Die starke Integration in eine Gruppe, also ein positiver group-Grad, bedeutet die freiwillige und / oder erzwungene Einschränkung der individuellen Entscheidungsmöglichkeiten auf die Vorgaben der Gruppe (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 5). Genauso gilt demnach freilich das Gegenteil: Wer eher schwach in eine Gruppe integriert ist oder dieses gar komplett ablehnt, der ist von der Außenwelt auch eher wenig abgeschottet und bleibt in seinem way of life von der Gruppe tendenziell eher unbeeinflusst, kann womöglich in mehreren, eher als offene Netzwerke konstituierten Gruppen (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 11 f.; Plapp 2003: 34) zugleich operieren, ohne sich, wie im gegenteiligen Fall, von allen anderen außer der stark integrierenden Gruppe abgrenzen zu müssen. Die Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der Person sind breiter und kontingent, sie wird zum „Einzelkämpfer“ (Plapp 2003: 34). Phänomene und Einflüsse wie diese sind es, die von einer kulturtheoretischen Perspektive via Einordnung des jeweiligen group-Grades erfasst werden können.
Grid wiederum wird definiert als „all the other social distinctions and delegations of authority that they use to limit how people behave to one another” (Douglas / Wildavsky 1982: 138) und bezeichnet “the degree to which an individual’s life is circumscribed by externally imposed prescriptions” (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 5). Hier geht es also um die Frage, inwieweit jemand institutionalisierter sozialer Regulierung ausgesetzt ist - ein Feld, das zuvor schon Durkheim in seiner Untersuchung zu Selbstmord (1951) betreten hat und auf dem das grid-Konzept basiert (vgl. Plapp 2003: 34; Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 6). Beispiele für einflussreiche Faktoren der grid-Dimension wären demnach “Hierarchien, verwandtschaftliche Organisation, Alter, ethnische Herkunft oder Geschlecht” (Plapp 2003: 34; vgl. auch Rayner 1992: 87). Ein positiver grid-Grad steht somit für eine starke Unterworfenheit unter soziale Regulierung - etwa durch Familienerwartungen, gesellschaftliche Institutionen oder auch Diskriminierung - und damit eine Einschränkung der individuellen Entscheidungsmöglichkeiten. Er bedeutet “an explicit set of institutionalized classifications [that] keeps [individuals] apart and regulates their interactions” (Douglas 1982; zitiert in Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 6; Hinzufügungen Thompson et al.). Demgegenüber steht ein negativer grid-Grad für die Erwartung, dass Personen ihre sozialen Verhältnisse selbst aushandeln (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 6), und somit eher für ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit.
Zusammengefasst geht es also bei einer am grid-group-Modell ausgerichteten Analyse um die Messung des Ausmaßes der sozialen Kontrolle, der die betreffende Person unterworfen ist - sei es durch Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem Netzwerk oder im Kontext ihrer sonstigen Lebenssituation und der damit einhergehenden, an sie gerichteten sozialen Umwelterwartungen (vgl. ebd.: 6). All diese starken oder schwachen Formen von Erwartungen, Kontrolle, Regulierung oder auch Macht wirken auf unterschiedlichste Weise auf eine Person ein, prägen ihren way of life und damit ihre individuelle Form der Risikoselektion: Was die eigenen Zielvorstellungen von der Welt, wie sie sein sollte, am ehesten gefährdet, das wird als Risiko angesehen und am meisten gefürchtet (vgl. Plapp 2003: 38).
Im Zuge eines besonderen Blicks der Kulturtheoretiker auf umweltpolitische und ökologische Fragen - den man auch im Kontext des Etablierungszeitraums des Ansatzes, also der 80er Jahre, sehen muss - verfügt die Theorie zudem über ein Modell der „Naturmythen“, welches jedem way of life eine besondere, charakteristische Sichtweise des Risikoobjektes Natur zuschreibt und aus diesen jeweiligen Sichtweisen konsequenterweise auch eine bestimmte Art des Umgangs mit der Natur ableitet. Der Naturmythus ist somit, neben grid und group, ein zusätzliches Element, das den cultural bias und damit die Risikoselektion prägt.
Das Modell entstammt Forschungen zum Management von Ökosystemen und ist in Mary Douglas ‘ Ansatz noch nicht enthalten, sondern von Thompson et al. in die Theorie aufgenommen worden (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 26 ff.; Plapp 2003: 41). Neben einer Beschreibung der Naturmythen werden diese in der Konzeption auch nochmals bildlich dargestellt: Das Ökosystem stellt dabei eine Kugel dar, die durch eine unter ihr verlaufende Linie, die je nach jeweiligem Naturmythus unterschiedlich verläuft, verschieden stark davor gesichert ist, herabzufallen. Aus Platzgründen möchte ich mich in dieser Arbeit jedoch auf eine schriftliche Beschreibung der einzelnen Naturmythen beschränken; die bildliche Darstellung kann Thompson et al. entnommen werden (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 27). Eine genauere Beschreibung der jeweiligen Naturmythen, welche in der Theorie den einzelnen Kulturen zugeordnet werden, ist in Abschnitt 2.4 zu finden.
Aus dem jeweils unterschiedlichen grid- und group-Grad sowie dem Naturmythus eines way of life ergibt sich also im Rahmen der Theorie somit letztlich die Möglichkeit, ihn einer bestimmten Kultur zuzuordnen. Die Kulturtheorie unterscheidet hier zwischen den Kulturen der Hierarchie, des Individualismus, des Egalitarismus, des Fatalismus und, nach einer jüngeren Konzeption, des Eremiten. Diese fünf Kulturen werden im folgenden Abschnitt vorgestellt.
2.4 Kulturelle Kategorien und ways of life
2.4.1 Hierarchie
Die Begriffsverwendung seitens der Vertreter der Kulturtheorie ist in Teilen inkonsistent, mit der Folge, dass in verschiedenen Publikationen verschiedene Kulturen und ways of life verschiedene Bezeichnungen erhalten haben. Die „konservative“ Kultur der Hierarchie etwa wird an einigen Stellen auch als „organisationaler“ Denk- und Handlungsstil oder auch als „bürokratisch“ bezeichnet (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 103; Douglas 1992: 71 ff.). An dieser Stelle wollen wir beim - gebräuchlichsten - Begriff der Hierarchie bleiben.
Die Kultur der Hierarchie wird dem gesellschaftlichen Zentrum zugeordnet (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 90; 174), da sie, wie bereits Weber (1980: 548) zu entnehmen ist, zu den wichtigsten Institutionen der modernen Gesellschaft zählt: Das Konzept der rationalen bürokratischen Organisation hat so gut wie alle gesellschaftlichen Bereiche geprägt und charakterisiert sowohl politische Organisationen und Verwaltung als auch etwa Wirtschaftsund Wissenschaftsorganisationen - womit zugleich auch eine große Menge an Personen in hierarchische Strukturen eingebunden wird. Die hierarchische Kultur zeichnet sich sowohl durch einen positiven group- als auch durch einen positiven grid-Grad aus (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 8). Wer dem hierarchischen way of life folgt, ist sowohl der Beobachtung und Kontrolle anderer Gruppenmitglieder unterworfen als auch institutionalisierten gesellschaftlichen Rollenerwartungen: „The exercise of authority (and inequality more generally) is justified on the grounds that different roles for different people enable people to live together more harmoniously than alternative arrangements“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 6). Hierarchie beinhaltet also immer auch Ungleichheit und betrachtet diese als natürlich. Sie erlaubt keinen Spielraum für die „Entfaltung des Individuums“, sondern weist dem Individuum seine Rolle zu und ordnet es in einem kollektivistischen Rahmen dem Gruppenziel unter (group-Dimension), bei gleichzeitiger starker Determinierung seiner sozialen Rolle (grid-Dimension). Dies kann zugleich das Erfolgsgeheimnis des hierarchischen way of life sein: „Its success depends on not allowing one member’s personal glory to be distinguished from the collective honor (...) Collectivizing responsibility is done by making roles anonymous. Decision making should ideally be so collectivized that no one is seen to decide“ (Douglas / Wildavsky 1982: 90 f.). Im hierarchisch-bürokratischen Kontext verlagert sich die Aufmerksamkeit auf die Organisation als Ganzes und führt zur Entpersonalisierung; Einzelpersonen in Organisationen, selbst die hohen Ranges, sind inner- organisationalen Dynamiken unterworfen, die diese nicht mehr allein beeinflussen können: “Everyone executes and no one decides policies“ (ebd.: 91). Hierarchie ist konservativ: Veränderung bedeutet für sie stets eine eher unwillkommene Irritation eines bis dato geordneten Systems (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 91). Hierarchie verfügt - und auch hierin spiegeln sich sowohl positiver group- als auch positiver grid-Grad wider - über eine breite Palette an Sanktions- und Disziplinierungsmöglichkeiten für den Fall eines Ausscherens aus der Gruppe bzw. einem Nicht-Nachkommen der Rollenerwartungen: Dazu gehören der „Auf- und Abstieg in der Gruppe, d. h. Neudefinition der Position in der Hierarchie, eine andere Aufgabe oder gar die Absonderung von der Gruppe“ (Plapp 2003: 36). Der hierarchische cultural bias lässt sich mit den Begriffen Ritualismus und Hingabe beschreiben (vgl. Schwarz / Thompson 1990: 75): Hierarchische Prozeduren entspringen der Zurechnung, dass diese sich über lange Zeit hinweg bewährt haben, bei gleichzeitiger Selbstaufopferung / Hingabe und Unterordnung unter das Gruppenziel.
Wie vollzieht sich innerhalb einer hierarchischen Kultur die Risikoselektion? Bürokratische Organisationen treffen Entscheidungen bekanntlich auf der Basis von Expertise und Fachbeamtentum, womit somit immer Risikokalkulation einher geht. Angesichts der Tatsache jedoch, dass Verwaltungsorganisationen, auch wenn sie, wie nun erkennbar sein sollte, sehr stark einem Idealtyp des hierarchischen way of life entsprechen, trotzdem eher selten in ihrer eigenen Existenz gefährdet sind, sobald sich eine Risikozurechnung bewahrheitet hat, empfiehlt es sich, nochmals den Blick auf andere hierarchische Organisationen zu richten. Und im Zuge eines Blickes auf Wirtschaftsorganisationen wie Industrieunternehmen stellt sich dabei heraus, dass diese Risikokalkulation oftmals mit bewusstem Nichtwissen stattfindet: „The operational rule of industrial firms that enables them to act is precisely to avoid attempting to know too much about future consequences. Limiting data, not expanding them, is their guide. Most possible alternatives and consequences are ignored” (Douglas / Wildavsky 1982: 93). Hierarchien tendieren also zu einer konservativen Risikoselektion insofern, als dass sie, um die, wie oben beschrieben, unangenehmen Irritationen zu vermeiden, die ihre ritualisierten Prozeduren aushebeln könnten, Risikowahrnehmung generell versuchen zu vermeiden (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 100) - wer keine Risiken sucht, der findet auch nicht so schnell welche. In diesem Zusammenhang wird abermals die Verbindung zwischen einem positiven group-Grad und dem von Janis beschriebenen Groupthink-Phänomen deutlich: Die starke Integration in eine Gruppe und damit ihre starke Abschottung nach außen führt zugleich zur Ausblendung von Risiken, die außerhalb des Vorstellungsvermögens der Gruppenmitglieder liegen. Risikoselektion beschränkt sich auf die Selektion, die innerhalb der Gruppe stattfindet - alles andere wird per Hierarchie unterbunden. Als Risiken, die innerhalb dieses way of life aufgegriffen werden, kann der Logik der hierarchischen Kultur zu Folge alles angesehen werden, was den Erhalt der Ordnung gefährden könnte: Kriminalität, Krieg, Terror, abweichendes Verhalten (vgl. Plapp 2003: 38).
Im Zuge der Frage nach dem Risikoobjekt wird die Art des Naturmythus relevant. Der Hierarchiker geht demnach von einer „toleranten Natur“ (Nature Perverse / Tolerant) aus, also von einem Ökosystem, das die meisten Eingriffe problemlos toleriert. Nichtsdestotrotz ist es durchaus empfindlich, so dass mit einem hierarchischen Ansatz die Aufgabe einher geht, einen stabilen Rahmen der Regulierung für etwaige Eingriffe in die Natur zu schaffen, der es verhindert, dass die Toleranz der Natur allzu sehr auf die Probe gestellt wird (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 26; Plapp 2003: 42).
2.4.2 Individualismus
Auch hinsichtlich des individualistischen way of life ist die Begriffsverwendung innerhalb der Theorie nicht konsistent - so wird die betreffende Kultur von Mary Douglas an anderer Stelle auch als „Markt“ bezeichnet (vgl. Douglas 1992). An dieser Stelle soll jedoch der geläufigere Begriff des Individualismus gebraucht werden.
Auch der Individualismus wird dem gesellschaftlichen Zentrum zugewiesen (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 174), da er - in Verbindung mit dem kapitalistischen Marktprinzip (vgl. Friedland / Alford 1991) - eine zentrale Institution der westlichen Hemisphäre darstellt, die die (Sozial-)Struktur seiner Gesellschaften erheblich geprägt hat (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 95): Die Zurechnung von Individualität bildet die verfassungsrechtliche Basis für Menschen- und Bürgerrechte und ist somit konstitutiv für die Struktur zahlreicher gesellschaftlicher Teilbereiche. Der politisch insbesondere im Liberalismus zu verortende individualistische way of life findet seine perfektionierte Form im Markt und somit in einem primär ökonomischen Prinzip, welches Erfolg und Misserfolg individueller Leistung und Eigenverantwortung bzw. dem Fehlen von beidem zurechnet. Sowohl group- als auch grid- Grad sind hier also als negativ einzustufen (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 8): Die allzu starke Integration in eine Gruppe ist dem Individualisten zuwider, da die erforderliche Unterordnung unter das Gruppenziel bzw. ein hierarchischer cultural bias für ihn die Aufgabe von Individualität bedeuten würde. Dadurch und durch die von ihm stets postulierte Individualität ist er sozialen Rollenerwartungen und Regeln weniger unterworfen. Seine sozialen Bindungen sind aushandelbar (vgl. Plapp 2003: 36), er ist fremden Autoritäten nur sehr bedingt ausgesetzt. Aber: „Although the individualist is, by definition, relatively free from control by others, that does not mean that the person is not engaged in exerting control over others. On the contrary, the individualist’s success is often measured by the size of the following the person can command“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 7). Der Individualist strebt nach einem Maximum an persönlicher Freiheit und Mobilität. Die Bindungen, die er eingeht, haben die Form von offenen Netzwerken, aus denen er sich jederzeit wieder zurückziehen kann und die die Funktion der individuellen Vorteilsmaximierung erfüllen: Seine Gruppe dient ihm - nicht er der Gruppe. Der cultural bias des Individualismus kann als pragmatischer Materialismus beschrieben werden (vgl. Schwarz / Thompson 1990: 75), der individualistische way of life basiert also auf der Präferenz dessen, was als individuell nützlich und materiell profitabel abgesehen wird. Erfolg wird an materiellen Maßstäben gemessen. Der Individualist ist ein Einzelkämpfer innerhalb einer für ihn letzten Endes anarchischen Gesellschaft, weswegen der eigene Vorteil zuerst kommt: „The world, he believes, is a tough place and if he doesn’t get there first, somebody else will“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 8).
Da der Individualist sich darauf ausgerichtet hat, ein Einzelkämpfer unter vielen in einer Wettbewerbs situation zu sein, verhält sich auch seine Form der Risikoselektion dementsprechend, dass Eingriffe von außen - sprich: staatliche Regulierung - als die größte Gefahr angesehen werden: Alles, was die individuelle Handlungs- und Entscheidungsfreiheit einschränken könnte, was die freie Wettbewerbssituation zugunsten einer Seite verschieben könnte, was also grid- und / oder group-Grad in die positive Richtung verschieben könnte, wird gefürchtet. Was Hierarchiker als Bedrohung ansieht, wird für den Individualisten erst dann zur Bedrohung, wenn es die Existenz des freien Marktes gefährden und Freiheiten einschränken könnte (vgl. Plapp 2003: 38 f.; Douglas / Wildavsky 1982: 96). Analog dazu gestaltet sich freilich auch das Aussortieren möglicher Risiken, die in anderen Kulturen wie etwa dem Egalitarismus als Bedrohung angesehen werden: Was den Markt nicht bedroht, in Folge einer Kosten-Nutzen-Analyse aber einen - zumeist materiellen - Vorteil verspricht, wird nicht als Risiko wahrgenommen. Furcht vor Umweltgefährdungen etwa wird vom Individualisten für gewöhnlich als Wirtschafts- und / oder Technologiefeindlichkeit rezipiert. Im Gegensatz zum Hierarchiker, der Risiken generell eher scheut, Wert auf Berechenbarkeit und Ordnung legt und dazu neigt, sich abzuschotten, sieht der Individualist Ungewissheit eher als Chance an denn als Bedrohung, weswegen er sich öffnet und immer auf neue Informationen aus ist (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 96; 100). Dabei ist er, im Gegensatz zum ritualistisch-konservativen Hierarchiker, konstant in „Eile“, weil er sich im beständigen Wettbewerb befindet und in diesem mit immer neuen Innovationen bestehen muss (vgl. ebd.: 97).
Aus diesen Eigenschaften ergibt sich auch der Naturmythus, der die individualistische Risikokultur prägt und beschrieben wird als „gutmütige Natur“ (Nature Benign). Demnach ist die Natur „grenzenlos belastbar und ausbeutbar“ (Plapp 2003: 42). Hierin zeigt sich das wirtschaftsliberale Element einer individualistischen Perspektive, die in der Natur eine Art Ressourcenlager für den menschlichen Fortschritt sieht und woraus sich ergibt, dass „the managing institution can therefore have a laissez-faire attitude“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 26), ohne die Notwendigkeit staatlicher Regulierung, etwa in Form von Umweltpolitik.
Der Individualist besitzt - und in diesem Falle gleicht er dem Hierarchiker - „imperialist tendencies, since both can solve their organizational problems by expanding the field of operations - bigger markets, larger collectives“ (Douglas / Wildavsky 1982: 97). Nicht zuletzt deswegen sind Hierarchiker und Individualisten gewissermaßen in einer strategischen Allianz im gesellschaftlichen Zentrum vereint, denn beide sind, jedenfalls in der westlichen Hemisphäre, an der Aufrechterhaltung des bestehenden Systems interessiert und bei dieser Zielsetzung aufeinander angewiesen (vgl. ebd.: 100). Dies kann sich jedoch ändern: „Should productivity decline or short-run risks arise from unemployment or inflation, their unity may fall apart” (ebd.: 100).
2.4.3 Egalitarismus
Der way of life des Egalitarismus wurde, wie auch die beiden zuvor beschriebenen Kulturen, im Laufe der Theorieentwicklung mit mehreren Synonymen beschrieben. So wird er in Kontexten anderer Publikationen u. a. als „sectarian“ (Douglas / Wildavsky 1982: 157) oder „voluntary commitment“ (Douglas 1992: 71 ff.) bezeichnet. Wir wollen uns an dieser Stelle jedoch auch an diesem Punkt auf den gebräuchlichsten Begriff „Egalitarismus“ begrenzen.
Die egalitäre Kultur, zu der beispielhaft vor allem soziale (Protest-)Bewegungen zählen, steht am Rand der Gesellschaft (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 102 ff.), denn sie ist gekennzeichnet durch flache bis gar keine Hierarchien, wenig Struktur und wenig Organisation. Dieser bewusst „alternative“ way of life verhindert eine Etablierung ins Zentrum der Gesellschaft: Zum Egalitarismus zählt gerade das, was nicht zum Mainstream gehört, er entsteht aus der gezielten Abgrenzung zum gesellschaftlichen Zentrum heraus und kann auch nur so lange seine kulturelle Identität bewahren, wie er diese Abgrenzung aufrecht erhält. Sobald egalitäre Akteure eine Bewegung politisch zu institutionalisieren versuchen, indem sie etwa eine Partei gründen, die daraufhin in Parlamente oder gar in Regierungen gewählt wird, begeben sie sich auf einen Weg, der aus der egalitären Kultur heraus ins Zentrum der Gesellschaft und die dort verankerten ways of life, Hierarchie und Individualismus, führt, von denen egalitäre Akteure zunehmend „aufgesogen“ würden. Damit ist letztlich ein Prozess beschrieben, den bereits der Soziologe Robert Michels in seinem ehernen Gesetz der Oligarchie ausgeführt hat (vgl. Michels 1970) und der sich auch in der Geschichte etwa der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung der 80er Jahre und deren Verknüpfung zur Partei Bündnis 90 / Die Grünen widerspiegelt.
Der Egalitarismus zeichnet sich durch einen positiven group- und einen negativen grid-Grad aus (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 8). Die Abgrenzung und Abschottung gegenüber dem Mainstream des gesellschaftlichen Zentrums bedarf einer starken Gruppenintegration, welche geeignet ist, die „alternative“, idealistische Weltsicht auch ideologisch zu festigen: All zu viel Kontakt zum Zentrum darf es nicht geben, da dies eine Etablierung bzw. eine Öffnung hin zum „Establishment“ bedeuten und die auf Authentizität ausgelegte Selbstbeschreibung der Gruppe stören könnte. Es braucht also eine starke Abschottung nach außen, und die eigene egalitäre politische Position ist nicht einfach nur eine Meinung, sondern manifestiert sich, begründet durch den starken tagtäglichen Gruppenzusammenhang, nicht selten in einem ganz bestimmten alternativen Lebensstil, sei es in Form des Wohnens in einer „Kommune“, durch spezielle Kleidung, bestimmte Art von Musik etc. Neben diesem positiven group-Grad ist das grid-Element jedoch negativ ausgeprägt, da die Gruppenmitglieder, aufgrund der auf Egalität ausgerichteten, kaum vorhandenen Rollendifferenzierung und dadurch auch fehlenden Einzelautoritäten, nur selten mit stabilen Verhaltenserwartungen konfrontiert werden und soziale Beziehungen immer wieder neu ausgehandelt werden müssen (vgl. Plapp 2003: 34 f.,; Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 6). Dies hat mitunter negative Folgen für die interne Konfliktlösungsfähigkeit: „Internal conflicts are difficult to resolve. Individuals can exercise control over one another only by claiming to speak in the name of the group in resolving intragroup differences. The drastic nature of these solutions, however, tends to drive disagreements underground, hence the presence of covert factions vying for control” (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 6).
Der cultural bias des Egalitarismus wird als fundamentalistisch und millenaristisch bezeichnet (vgl. Schwarz / Thompson 1990: 75 f.): Der egalitäre way of life sieht pragmatische Kompromisse nicht vor. Sein Grundsatz ist „ganz oder gar nicht“, alles, was die fundamentalen Ziele in irgendeiner Form einschränken könnte, würde Verwässerung und Etablierung bedeuten. Damit einher geht schließlich eine Art pseudoreligiöse Idealvorstellung von der Welt, wie sie sein sollte und die den Menschen nach der Erreichung all der fundamentalen Ziele erwartet. Die egalitäre Kultur fürchtet konsequenterweise somit jeweils die Prinzipien, die in den beiden Kulturen des Zentrums zum Ausdruck kommen. Hierarchie bedeutet organisierte Ungleichheit und steht somit egalitären Idealen fundamental entgegen, sie wird für Diskriminierung, Ausbeutung und Einschränkung demokratischer Rechte und Partizipationsmöglichkeiten verantwortlich gemacht (vgl. Plapp 2003: 39). Individualismus wiederum bedeutet zwar keine strikt organisierte, aber eine akzeptierte und bewusst geschätzte Ungleichheit, die den egalitären Idealen ebenso entgegensteht.
Zum anderen steht die individualistische Sichtweise der Natur als „Rohstoffquelle“ dem egalitären Naturmythus fundamental entgegen, der sich als „fragile Natur“ (Nature Ephemeral) beschreiben lässt (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 26 ff.). Demnach ist die Natur sowohl zerbrechlich und zutiefst empfindlich gegenüber äußeren Eingriffen, so dass die Menschen zu einem äußerst rücksichtsvollen und sorgfältigen Umgang mit ihr verpflichtet werden sollten: „Ein kleiner [Anstoß] kann den letzten bedeuten und den totalen Kollaps der Natur auslösen“ (Plapp 2003: 41). Neben der Bedrohung egalitärer Prinzipien durch Hierarchie und Ungleichheit bildet die individualistische Naturauffassung also für den way of life des Egalitarismus mit die größte Bedrohung, woraus sich insgesamt die Abgrenzung zum gesellschaftlichen Zentrum ergibt, welche gewissermaßen des politische Tagesgeschäft dieser Kultur bildet (vgl. Douglas / Wildavsky 1982: 121).
Eine egalitär geprägte Politik strebt somit nach der Vermeidung eines jeden Risikos. Daraus ergibt sich letzten Endes auch die kulturtypische „Kompromisslosigkeit“ (vgl. ebd.: 124): Jeder Schritt in Richtung auf Hierarchiker oder Individualisten, also jeder Schritt in Richtung Risikokalkulation in Form eines „Hantierens mit Wahrscheinlichkeiten“ würde ein Abrücken vom fundamentalen Nullrisiko-Prinzip bedeuten und ist somit aus egalitärer Sicht inakzeptabel.
Eine zentrale Differenz zwischen gesellschaftlichem Zentrum auf der einen und dem Egalitarismus als Rand-Kultur auf der anderen Seite liegt ferner in den Auffassungen von dem, was die Zukunft ausmacht. Hierarchiker und Individualisten sehen die Zeit als konsistent verlaufend an und rechnen nicht mit starken Veränderungen, für sie ist die Zukunft die Fortsetzung der Gegenwart, zumal sie wissen, dass sie - als Kulturen des Zentrums - ihre Bewahrung selbst in der Hand haben. Egalitäre gehen von einer Zukunft aus, die eine signifikante Veränderung zum Schlechten mit sich bringt (vgl. ebd.: 122), denn sie sehen sich selbst als oppositionell, wissen um ihre Ohnmacht. Diese düstere Zukunftsprognose müssen sie, unterstützt von öffentlichkeitswirksamen moralischen Unterscheidungen, konstant artikulieren, um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen, die demnach als einzige geeignet sind, die verhängnisvollen Entwicklungen noch umzukehren. Dafür müssen sie sich selbst als gelebtes Gegenmodell zum Establishment des Zentrums inszenieren: „They have a vested interest in bad news that shows the society outside is polluted and also shows that the sect inside is pure (...) Sectarians need the future to be different and worse to turn their criticism into warnings and so make them politically more weighty (...) The threat in the future is part of the sectarian’s present political armory against his rivals” (Douglas / Wildavsky 1982: 122). Diese Rivalen sind zugleich niemals nur politische Gegner (wie beispielsweise der Individualist für den Hierarchiker oder umgekehrt), sondern Feinde (vgl. ebd.: 124): Diejenigen, die außerhalb der Gruppe stehen, haben nicht lediglich eine andere Position, sondern sie sind - gewissermaßen verurteilt über die moralische Unterscheidung - „böse“, da durch sie die düstere Zukunft wahrscheinlicher wird.
Mit dieser - bewussten oder unbewussten - Grundhaltung einher geht immer auch die “Vision” einer Gesellschaft, eines utopischen Gegenentwurfs, der beinhaltet, wie diese sein sollte, sei sie nun kommunistisch, eine Rückkehr zu den “natürlichen” Grundlagen oder eine Art Gottesstaat, der einem religiösen Dogma entspringt (vgl. ebd.: 123). Sie ist es, die das „Gute“ beinhaltet, welches zudem stets universale Geltung besitzen muss: „Global issues, not local ones, will serve their purpose best (. ) Sects need to speak on behalf of the whole mankind, not for a few millions“ (ebd.: 125).
2.4.4 Fatalismus
Der way of life des Fatalismus ist wie auch der Egalitarismus dem Rand der Gesellschaft zuzuordnen, wobei diese Position in den meisten Fällen allerdings weitaus weniger das Ergebnis eines selbst gewählten Lebensstils ist als die Folge sozialen Abstiegs. Der Idealtypus des Fatalisten in negativem Sinne wäre der mittellose Obdachlose, der sich einem übermächtigen, über ihn kommenden Schicksal ausgesetzt sieht (vgl. Plapp 2003: 36), auf dass er sowieso keinerlei Einfluss (mehr) nehmen kann, so dass er es mit fatalistischer Grundhaltung hinnimmt und nur noch von einem Tag auf den nächsten lebt, nur noch interessiert an der Befriedigung der minimalsten Grundbedürfnisse und möglicherweise einer wie auch immer gearteten Drogensucht: „Coping is what this social context is all about, and in the absence of any association (. ), his strategy is inevitably one of personal survival“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 9). Der geringe soziale Status verhindert dabei konsequent jede weitergehende Partizipation (vgl. ebd.: 36) und damit das Erreichen des gesellschaftlichen Zentrums.
Der group-Grad der fatalistischen Kultur ist somit als negativ, der grid-Grad hingegen als positiv einzustufen (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 8): Die fatalistische Grundhaltung macht ein freiwilliges Engagement in (egalitären) Gruppen unmöglich, ebenso verhindert es eine Integration in Hierarchien. Desinteresse verhindert Idealismus ebenso wie eine disziplinierte Unterwerfung unter ein Gruppenziel. Zugleich ist der typische Fatalist aber aufgrund seiner Mittellosigkeit beständigen verbindlichen Rollenerwartungen unterworfen: Er hat es schwerer, eine Bleibe zu finden, aufgrund seiner Lebenssituation steht er womöglich in häufigem Kontakt zur Justiz und er ist Krankheiten und den damit einhergehenden weiteren Nachteilen und Stigmatisierungen schneller ausgesetzt als andere. Dies begrenzt seine individuelle Autonomie erheblich und macht es ihm so gut wie unmöglich, seine sozialen Beziehungen selbst auszuhandeln (vgl. Plapp 2003: 36): „Fatalists are controlled from without“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 7).
Der Fall das vollkommen mittellosen und ausgegrenzten Obdachlosen ist freilich, wie oben beschrieben, ein Beispiel für einen fatalistischen way of life in seiner reinen Form. In einem weiteren und im Falle einer politikwissenschaftlichen Perspektive meines Erachtens angemesseneren Verständnis fällt hierunter nicht nur der Obachlose, sondern etwa auch der von Thompson et al. beispielhaft beschriebene Fall des nicht-organisierten, ausgebeuteten Arbeiters, der seinem Schicksal vollkommen ausgeliefert ist und über diese Situation lethargisch geworden ist und jede Motivation verloren hat, Anstrengungen zu unternehmen, die daran etwas ändern könnten (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 8 f.). In einer explizit politikwissenschaftlichen Perspektive würde wohl also auch eine beträchtliche Anzahl von enttäuschten, politikverdrossenen Nichtwählern mit der Vorstellung einer ohnehin am Schicksal der Menschen nicht interessierten Politik unter diese Kategorie fallen (vgl. Schwarz / Thompson 1990: 76) - womit selbst die fatalistische Kultur letztlich zu einer politisch mitunter sehr relevanten Kraft wird, da ihr Erstarken immer auch ein Signal für eine politische Schieflage bedeutet, welches die Politik dann ihrerseits auf verschiedene Art und Weise aufgreifen kann.
Der cultural bias des Fatalismus zeichnet sich aus durch einen inkonsistenten Eklektizismus aus (vgl. ebd.: 76). Der bias dieser Kultur basiert also nicht, wie bei den drei vorangegangenen ways of life der Fall, auf gefestigten Idealen, ideologischen Grundlangen oder Einstellungen, sondern auf meist vollkommen unterschiedlichen Konglomeraten an (zumeist negativen) individuellen Einzelerfahrungen, die eine Art von weltanschaulicher Konsistenz unmöglich machen, welche jedoch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Fatalist sowieso nur von einem Tag auf den nächsten lebt, für ihn ohnehin überflüssig ist. Eine Vorstellung von der Welt, wie sie sein sollte, würde implizieren, dass man entweder Anstrengungen unternimmt, um darauf hinzuarbeiten, oder dass das Nicht-Erreichen dieser Zielvorstellung den Betreffenden zumindest enttäuscht und schmerzt und er schließlich resigniert. Der Fatalist ist über all diese Phasen längst hinaus, für ihn ist die Welt, wie sie ist, nicht zu ändern - und deshalb kann er auch nicht mehr enttäuscht werden. Er ergibt sich seinem Schicksal. Seine Form der Risikoselektion richtet sich somit nach dem Faktor „Glück“: Er kann sie nicht beeinflussen und versucht es deswegen auch gar nicht.
Der Naturmythus des Fatalisten geht dementsprechend von einer kapriziösen Natur (Nature Capricious) aus (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 26 ff.). Hierbei handelt es sich um eine Natur der Beliebigkeit, deren Verhalten durch Zufall geprägt ist und bei dem das Ausbleiben von Katastrophen nicht das Resultat irgendeiner Art von Politik oder Management, sondern lediglich die Folge von Glück ist. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass menschliches Handeln ohnehin nicht fähig ist, signifikanten Einfluss auf das Verhalten der Natur zu nehmen (vgl. Plapp 2003: 42). Vor diesem Hintergrund bedarf es dann freilich auch keiner politischen Ideologie mehr.
2.4.5 Autonomie
Die Autonomie ist die Kultur desjenigen, der den way of life des Eremiten verfolgt. Diese fünfte Kategorie ist in der ursprünglichen Konzeption nach Douglas noch nicht enthalten, sondern wurde der Theorie erst später von Thompson et al. hinzugefügt (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 7; 29 ff.).
Der way of life des Eremiten ist charakterisiert durch den Rückzug vom sozialen Leben, welches er als voll von Zwängen und Manipulationen ansieht, und damit zugleich sowohl durch die Ablehnung des Kontrolliert-Werdens durch andere als auch des Kontrollierens anderer (vgl. Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 7). Durch diesen kompletten sozialen Rückzug unterscheidet der Eremit sich von den anderen vier Kulturen, welche allesamt in soziale Beziehungen eingebunden sind, wenn auch - wie im Falle des Fatalisten - nicht unbedingt in jedem Fall freiwillig. Dieser Lebensstil kann sich manifestieren in Form eines Einsiedlerlebens in der freien Natur oder aber eines Rückzuges in andere Bereiche, die die vier anderen Kulturen nicht erreichen wollen oder können (vgl. ebd.: 10). Seine materiellen Grundbedürfnisse stillt er in einer Form, die auf so viel Autonomie wie möglich ausgelegt ist, „a relaxed and unbeholden self-sufficiency“ (Thompson / Ellis / Wildavsky 1990: 10). Er strebt nach Individualität, aber nicht, wie der Individualist, unter dem Primat des materiellen Profits und der Kontrolle über andere. In seiner Autonomie unterscheidet er sich auch vom Fatalisten, da er keiner Kontrolle von außen unterliegt.
Sowohl der grid- als auch der group-Grad dieses way of life sind somit am Nullpunkt anzusiedeln, beide sind weder positiv noch negativ (vgl. ebd.: 8). Der Idealtyp des Eremiten
[...]
- Arbeit zitieren
- Florian Sander (Autor:in), 2012, Political Culture(s) revisited, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/195353
Kostenlos Autor werden




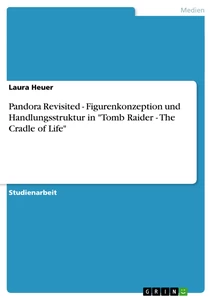




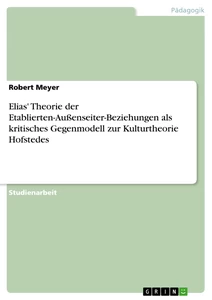










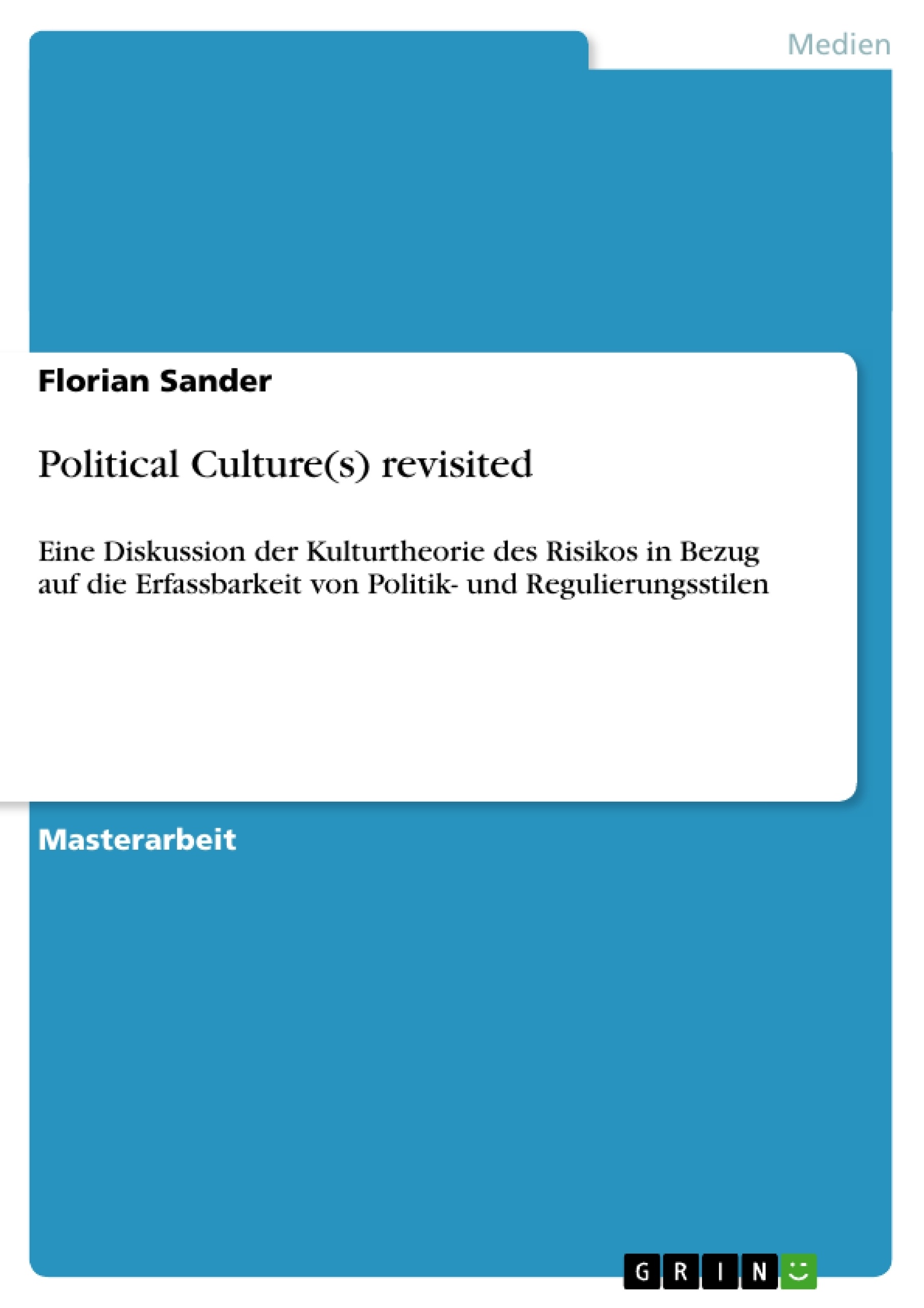

Kommentare