Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Aufbau der Arbeit
2. Zum Stand der Forschung
2.1 High-Risk-Forschung
2.2 Resilienzforschung
2.3 Vulnerabilitätsforschung
2.4 Genetische Studien
3 Psychische Störungsbilder
3.1 Schizophrene Störungen
3.1.1 Hauptformen der Schizophrenie
3.2 Affektive Störungen
3.2.1 Depression
3.2.2 Manie
3.2.3 Bipolare affektive Störung
3.3 Persönlichkeitsstörungen
3.3.1 Borderline-Störung
4. Zur Lebenssituation Kinder psychisch kranker Eltern
4.1 Typische Auffälligkeiten und Verhaltensweisen
4.2 Kinder als Angehörige psychisch kranker Eltern
4.2.1 Gefühle und Gedanken der Kinder
4.2.2 Gestaltung des Familienlebens für die Kinder
4.3 Die unterschiedlichen Rollen von Kindern psychisch kranker Eltern
5 Risiko- und Belastungsfaktoren betroffener Kinder
5.1 Objektiver Zugang zu den Belastungen der Kinder
5.1.2 Elterliche Erkrankung als Risikofaktor
5.1.3 Entwicklungsverlauf und psychische Störungen bei Kindern
5.2 Subjektiver Zugang zu den Belastungen der Kinder
5.2.1 Typische Probleme betroffener Kinder
5.2.2 Häufige Probleme betroffener Kinder in der Schule
5.2.3 Typische Belastungen erwachsener Kinder
5.3 Auswirkungen der Erkrankung auf die frühe Eltern-Kind-Beziehung
5.3.1 Wirkung mütterlicher Depression
5.3.2 Wirkung mütterlicher schizophrener Psychosen
5.3.3 Erziehungsfähigkeit und Elternfunktion
5.3.4 Exkurs: Bindungstheorie
5.4 Zusammenfassung
6. Was Kinder psychisch kranker Eltern stärkt
6.1 Ressourcen als Schutzfaktoren
6.1.1 Kindbezogene Faktoren
6.1.2 Resilienz und Resilienzfaktoren
6.1.3 Soziale Ressourcen
6.1.4 Spezielle Schutzfaktoren für Kinder psychisch kranker Eltern
6.2 Von Schutzfaktoren zu Bewältigungsprozessen
6.2.1 Copingstrategien der Kinder
7. Hilfen für die Kinder psychisch kranker Eltern
7.1 Jugendhilfe
7.2 Präventionsprojekt KIPKEL
7.3 Hindernisse in der Unterstützung und Verbesserungsvorschläge
Literaturverzeichnis
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
„Kinder sind die schutzlosesten Angehörigen.“ (Beeck 2010, S. 9)
Die psychische Erkrankung eines Elternteils stellt für Kinder ein kritisches Lebensereignis dar. Empfindliche Änderungen und Neuerungen im Familienalltag gehen in der Regel mit erheblichen Belastungen einher. Kinder psychisch kranker Eltern werden häufig als ,vergessene‘ Angehörige bezeichnet, da sie kaum die Möglichkeit besitzen ihre Bedürfnisse und Probleme zu äußern. Dies kann auch auf das durch die Eltern verhängte Kommunikationsverbot zurückzuführen sein. Die Kinder haben das Gefühl mit niemanden über ihre belastende Situation sprechen zu dürfen oder aber die dadurch Eltern zu verraten. (vgl. Pretis/Dimova 2010, S. 21f.). Wesentlicher Belastungsfaktor ist die häufige Übernahme der Erwachsenenrolle und die damit einhergehende Verantwortung für Geschwister und den kranken Elternteil. Aber auch Schuldgefühle des Kindes auf Grund fehlender Kenntnisse über die elterliche Erkrankung und die Isolierung vom sozialen Umfeld wirken sich negativ auf die Entwicklung des Kindes aus.
Das eingangs erwähnte Gedicht ,Dein anderes Ich‘ wurde von einem betroffenen Kind (Milena: Pseudonym) verfasst, das mit einer an schizo-affektiven Psychosen erkrankten Mutter aufwuchs. Das Gedicht entstand im Frühjahr 2003, als sich ein erneuter Krankheitsschub ankündigte und Milena eine Klinikeinweisung der Mutter veranlassen musste. Dieses Gedicht gibt einen realistischen Einblick in den Alltag und die Gedanken Kinder psychisch kranker Eltern. Es verdeutlicht vor allem den ständigen Wechsel zwischen Nähe und Distanz, Zuneigung und Ablehnung. Die unberechenbaren elterlichen Verhaltensweisen und die häufigen Beziehungsabbrüche prägen das Bindungsverhalten nachhaltig. Das Gedicht greift die schwerwiegenden Loyalitätskonflikte auf, die sich häufig aus dem auferlegten Sprechverbot ergründen und schildert darüber hinaus die Gefühle des Alleinseins, der Traurigkeit und der Ausweglosigkeit.
Kinder psychisch kranker Eltern haben etwa ein 2- bis 10-fach (je nach Krankheit) erhöhtes Risiko, selbst eine psychische Störung zu entwickeln, da sie häufig besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Psychische Störungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Remschmidt/Mattejat (1994, S. 5) schätzen die Anzahl minderjähriger Kinder psychisch kranker Eltern auf ca. 200.000 bis 500.000. Es ist erstaunlich, dass das Thema in der deutschsprachigen Fachöffentlichkeit lange Zeit kaum Beachtung fand war. Problematisch ist, dass der Fokus der Erwachsenenpsychiatrie immer noch auf den Patienten liegt und die Angehörigenarbeit in der Psychiatrie gewöhnlich die Arbeit mit erwachsenen Angehörigen betrifft (vgl. Schone/Wagenblass 2006, S. 9).
Die vorliegende Diplomarbeit widmet sich den schwierigen Lebenssituationen und Auswirkungen auf Kinder psychisch kranker Eltern anhand von bisherigen Studien. Der Schwerpunkt liegt zum einen auf den Risikofaktoren, die sich auf kindliche Entwicklung gefährdend auswirken können. Zum anderen ist der Aspekt, was Kinder psychisch kranker Eltern stärkt, von besonderem Interesse.
1.1 Aufbau der Arbeit
Kapitel 2 stellt den aktuellen Stand der High-Risk-Forschung, Resilienzforschung, Vulnerabilitätsforschung sowie genetischer Studien dar. Psychische Störungsbilder werden in Kapitel 3 erläutert, wobei diese sich auf schizophrene, affektive und Persönlichkeitsstörungen erstrecken. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den schwierigen Lebenssituationen Kinder psychisch kranker Eltern. Dabei werden typische Auffälligkeiten, Gefühle und Rollen der Kinder thematisiert. Risikofaktoren werden in Kapitel 5 von objektiver und subjektiver Seite beleuchtet. Weiterhin finden hier die Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung sowie ein Exkurs zur Bindungstheorie Beachtung. Kapitel 6 wendet sich den Schutzfaktoren und den Ressourcen zu. Zudem werden Copingstrategien aufgeführt. Hilfen und Unterstützungsmöglichkeiten stehen in Kapitel 7 im Vordergrund. Dabei werden auf der einen Seite Hilfen der Jugendhilfe, auf der anderen Seite das Präventionsprojekt ,KIPKEL‘ exemplifiziert. Hindernisse in den Unterstützungsmöglichkeiten sind ebenfalls Gegenstand dieses Kapitels. Den Abschluss der Arbeit (Kapitel 8) bilden das Fazit aus theoretischer Sicht sowie einen Ausblick über Verbesserungsmöglichkeiten in der Vernetzung von Hilfen.
Lesehinweis:
Es wird im Allgemeinen von einer Erkrankung der Eltern bzw. des Elternteils gesprochen. Wird von der Erkrankung der Mutter gesprochen, ist auch spezifisch die Erkrankung der Mutter gemeint.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die Bezeichnung der jeweils weiblichen Form verzichtet. Ich bitte die Leserinnen und Leser um Verständnis und Nachsicht.
2. Zum Stand der Forschung
Erste Untersuchungen zum Thema ,Kinder psychisch kranker Eltern‘ findet man in der Fachliteratur bereits 1930.[1] Sir Michael Rutter, Altmeister der europäischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, beschäftigte sich in seiner Dissertationsarbeit mit dem Thema ,Kinder von kranken Eltern‘ und veröffentlichte 1966 seine wichtigsten Ergebnisse in einer Monographie mit dem Titel ,Children of sick parents‘ (vgl. Mattejat/Lenz/Wiegand-Grefe 2010, S. 13f.).
Die wichtigsten Forschungsansätze, die Aspekte in Bezug auf Kinder von psychisch kranken Eltern berücksichtigen, sind im folgenden Kapitel dargestellt.
2.1 High-Risk-Forschung
Studien, die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen von Eltern auf ihre Kinder untersuchen, sind unter der so genannten High-Risk-Forschung bekannt.
Folgende Ziele bzw. Fragestellungen bildeten den Schwerpunkt des Interesses:
1. „Die Untersuchung des genetischen Risikos von Kindern psychotischer Eltern im Hinblick auf eine gleichsinnige Erkrankung;
2. psychogenetische Fragestellungen, die den unmittelbaren Auswirkungen der Erkrankung auf die Kinder nachgingen und den Umweltaspekt betonten;
3. Untersuchungen, die zum Ziel hatten, für die jeweilige Erkrankung typische und charakteristische Marker zu objektivieren und Vorläufersymptome festzustellen, und
4. Fragestellungen, die der Intervention und Prävention gewidmet waren. “ (Remschmidt/Mattejat 1994, S. 14).
Annahme der Risikoforschung ist, dass Kinder psychisch kranker Eltern in Bezug auf die Entwicklung einer psychischen Erkrankung zu einer Hochrisikogruppe zählen (vgl. Schone/Wagenblass 2006, S. 11f.). Daher sollen Gruppen mit hohem Erkrankungsrisiko herausgefiltert, Merkmale und Indikatoren der Risikogruppe identifiziert werden. (vgl. Lenz 2005, S. 13).
Die Monographie von Remschmidt und Mattejat gilt als eine klassische Studie. Die beiden Forscher suchten nach Ursachen und bestimmten Merkmalen für das erhöhte Risiko von Kindern Psychose erkrankter Eltern selbst an einer Psychose zu erkranken. Remschmidt und Mattejat fanden u.a. heraus, dass rund ein Drittel aller Kinder, die sich in stationärer kinder-und jugendpsychiatrischer Behandlung befanden, mindestens einen psychisch erkrankten Elternteil haben (vgl. Remschmidt/Mattejat 1994, S. 15).
Die psychische Erkrankung kann dabei als eine belastende psychosoziale Entwicklungsbedingung aufgefasst werden und in der sozial-emotionalen und im geringeren Maße in der kognitiven Entwicklung aufgefasst werden. Beispiel dafür sind depressive Störungen, aber auch aggressive, dissoziale und hyperkinetische Verhaltensstörungen (vgl. Lenz 2005, S. 13).
Einigkeit herrscht darüber, dass Kinder mit psychisch kranken Eltern(teilen) einem signifikant erhöhten Risiko ausgesetzt sind selbst psychisch krank zu werden als Kinder mit gesunden Eltern. Das Risiko für Kinder mit einem schizophren erkrankten Elternteil liegt bei 10 % bis 15 %. Bei zwei schizophren erkrankten Elternteilen steigt es beträchtlich auf 35 % bis 50% (vgl. Remschmidt/Mattejat 1994, S. 22). Bei Kindern depressiver Eltern liegt die Rate selbst psychisch zu erkranken bei 23 % bis 38 % (vgl. Remschmidt/Mattejat 1994, S. 70). Vergleichsweise dazu liegt die LebenszeitPrävalenzrate der Gesamtbevölkerung für die schizophrenen Erkrankungen bei 1 %.
Statistisch gesichert ist, dass Zweijährige mit einem psychisch erkrankten Elternteil in der Sprachentwicklung Defizite vorweisen und in ihrem Sozialverhalten auffälliger sind (Schone/Wagenblass 2006, S. 12). Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die elterliche Erkrankung nur ein Risikofaktor darstellt, wobei sich einzelne Risikofaktoren gegenseitig bedingen und verstärken. Mit Risikofaktoren beschäftigt sich Kapitel 5.
Remschmidt/Mattejat fordern „die Entwicklung von meßtheoretisch verbesserten und differenzierteren diagnostischen Methoden“ (Remschmidt/Mattejat 1994, S. 123) aber auch das Forschungsinteresse auf die natürlichen familiären Bewältigungs- und Kompensationsmöglichkeiten zu lenken (vgl. Schone/Wagenblass 2006, S. 12).
2.2 Resilienzforschung
Im Mittelpunkt der Resilienz- und Bewältigungsforschung steht die Frage, warum manche Personen trotz Belastungen und Risiken gegenüber psychischen Störungen usw. widerstandsfähiger sind, während andere unter vergleichbaren Bedingungen krankheitsanfälliger sind (vgl. Lenz 2005, S. 16). Nach Wustmann ist Kernstück der Resilienzforschung „die positive, gesunde Entwicklung trotz andauerndem, hohen Risikostatus (wie chronische Armut, psychische Erkrankungen der Eltern usw.). Die beständige Kompetenz unter akuten Stressbedingungen (wie z. B. Trennung / Scheidung der Eltern). Die positive bzw. schnelle Erholung von traumatischen Ereignissen (z. B. Trennung / Tod naher Bezugspersonen, sexueller Missbrauch)“ (2004, S. 19).
Die Resilienzforschung entstand aus der Entwicklungspsychopathologie, die in den 1970er Jahren hauptsächlich Risikoeinflüsse, die bei der kindlichen Entwicklung wirken können, untersuchte. Gleichwohl rückten Kinder, die sich trotz schwerer Bedingungen gut entwickeln konnten, in den Blickpunkt des Interesses. Resilienz wurde damals als angeboren, universell und allgemeingültig angesehen.
Gegen Ende der 1970er Jahre gab es zunächst in Großbritannien und Nordamerika, Ende der 1980er Jahre auch in Deutschland einen Paradigmenwechsel, der maßgeblich von den Studien Aaron Antonovsky zur Salutogenese beeinflusst wurde. Die Resilienzforschung konzentriert sich im Gegensatz zur Salutogenese, die nach Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit sucht, auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung (vgl. Fröhlich-Gildhoff/Rönnau-Böse, 2009, S. 13f.).
Nach Vorbild von O’Dougherty Wright und Masten (2006) untergliedert Bengel et al. (2009) die Entwicklung der Resilienzforschung in drei Phasen ein:
1. Phase: Identifikation der Schlüsselkonzepte und allgemeiner Schutzfaktoren
Anfang der 1970er Jahre wurden Kinder als , unverwundbar ‘ beschrieben. Empirische Grundlagen wurden entwickelt. Zentrale Untersuchungen gab es zu Schlüsselkonzepten der Resilienz, Vulnerabilität, Risiken und Schutzfaktoren. Diskussionen über Definitionen und Abgrenzungen dauern bis heute an (vgl. Bengel et al. 2009, S. 15f.). Der Fokus lag außerdem auf der Identifikation von „ Faktoren, die in Zusammenhang mit der Entwicklung und den Entwicklungsergebnissen stehen“ oder „ Faktoren, die Entwicklungsergebnisse vorhersagen“ (Bengel et al. 2009, S. 15).
2. Phase: Kontextfaktoren und Prozessorientierung
Die Forschung wandte sich nach der Frage des Was zu den komplexen Wechselwirkungen, Prozessen und Wirkmechanismen. Dabei wurde besonders der sozioökonomische Status der Familie und die Einbindung in soziale Netzwerke erfasst. Abgesehen davon erkannte man die Kontextspezifität der protektiven Prozesse (vgl. Bengel et al. 2009, S. 16).
3. Phase: Maßnahmen zur Förderung von Resilienz
Neben der sich fortsetzenden Untersuchung komplexer Prozesse wurden resilienzförderliche Interventionsmodelle entwickelt, die jedoch noch nicht in Gänze abgeschlossen ist (vgl. Bengel et al. 2009, S. 17).
Die bekannteste, größte und älteste Längsschnittstudie wurde von Werner und Smith auf der hawaiianischen Insel Kauai durchgeführt. Es wurden 698 Kinder aus asiatischen und polynesischen Familien von ihrer Geburt im Jahr 1955 an über 40 Jahre begleitet. Datenerhebungen fanden im Alter von 1, 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren statt. Sie wurden beobachtet, interviewt und es wurden Lebens- und Gesundheitssituation erhoben. Untersuchungsinteresse war der Einfluss der vielfältigen biologischen und psychosozialen Risikofaktoren, kritische Lebensereignisse und Schutzfaktoren auf die Entwicklung. Circa ein Drittel der Kinder wies ein erhöhtes Entwicklungsrisiko auf. Sie waren schon vor ihrem zweiten Lebensjahr mindestens vier risikoerhöhenden Bedingungen (multiple Risikobelastungen) ausgesetzt; dazu gehören u. a. chronische Armut, Geburtskomplikationen, ein geringes Bildungsniveau der Eltern, elterliche Psychopathologie und chronisch familiäre Disharmonie. Zwei Drittel dieser Kinder, die im Alter von zwei Jahren schon vier oder mehr Risikofaktoren ausgesetzt waren, entwickelten schwere Lern- und Verhaltensprobleme in der Schulzeit, wurden straffällig und hatten psychische Probleme im Jugendalter. Trotz erheblicher Risiken können sich wiederum ein Drittel der Kinder gut entwickeln und wurden zu leistungsfähigen, zuversichtlichen und fürsorglichen Erwachsenen. Im Alter von 40 Jahren konnten eine geringere Todesrate, weniger chronische Gesundheitsprobleme und weniger Scheidungen nachgewiesen werden. Protektive Faktoren waren dabei z. B. ein stabiler Familienzusammenhalt oder eine hohe Sozialkompetenz (vgl. Fröhlich-Gildhoff/ Rönnau-Böse 2009, S. 15ff.; Bengel et al. 2009, S. 33ff.).
In Deutschland gehören zu den bekanntesten Studien die MannheimerRisikokinderstudie von Laucht et al. und die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel et al.
Die Mannheimer-Risikokinderstudie befasst sich mit den Chancen und Risiken von Kindern, deren gesunde Entwicklung durch frühe, bei Geburt bestehenden organische und psychosoziale Belastungen gefährdet ist. Forschungsgegenstand waren 362 Kinder der Geburtsjahrgänge 1986 und 1988, die im Alter von drei Monaten, 2, 4, 5, 8 und 11 Jahren untersucht wurden. Die Ergebnisse der Kauai-Studie konnten bestätigt werden und Prozesse, die bei der gesunden Entwicklung von Kindern eine Rolle spielen, wurden hervorgehoben.
Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie wurde von Lösel et al. durchgeführt. Die Forschungsgruppe wählte ein Zweigruppendesign, indem sie eine auffällige Hochrisikogruppe Jugendlicher mit einer als resilient eingestuften Gruppe verglichen. Die Stichprobe bestand aus 146 Jugendlichen (Alter 14-17 Jahre) aus Institutionen der Heimbetreuung, die einem sehr belasteten und unterprivilegiertem Multi-Problem-Milieu mit unvollständigen Familien, Armut, Erziehungsdefiziten, Gewalttätigkeit und Alkoholmissbrauch entstammen. Die Gruppe ,resilienter‘ Jugendlicher bestand aus 66 und die Vergleichsgruppe aus 80 Probanden. Die Vergleichsgruppe bestand aus Jugendlichen aus denselben Heimen, deren Risikobelastungen gleich hoch eingeschätzt worden waren, wie die der ,resilienten‘ Jugendlichen, die aber ausgeprägte Erlebnis- und Verhaltensstörungen aufwiesen.
Nach zwei Jahren konnte eine Reihe von protektiven Effekten festgestellt werden wie z.B. ein flexibles, weniger impulsives Temperament, realistische Zukunftsperspektiven und ein aktiveres Bewältigungsverhalten.
Zwei Drittel der Jugendlichen blieben über den gesamten Untersuchungszeitraum stabil resilient oder deviant. Ein entwicklungsfördernder Effekt ging insbesondere von einem autoritativen Erziehungsklima aus, das sich durch Zuwendung und Empathie und gleichzeitig eine hohe Strukturiertheit und Normorientierung auszeichnet (vgl. Fröh- lich-Gildhoff/Rönnau-Böse 2009, S. 16f.; Bengel et al. 2009, S. 34ff.).
Auf die Definition und Merkmale von Resilienz sowie auf die Resilienzfaktoren wird in Kapitel 6.1.2 ausführlicher eingegangen.
2.3 Vulnerabilitätsforschung
Die Vulnerabilitätsforschung versucht Frühsymptome bzw. Vorläufersymptome psychischer Erkrankungen zu identifizieren, um Ansatzpunkte für präventive Maßnahmen zu finden. Sie wird als Gegenpol zur Resilienz verstanden und führt die Verletzlichkeit des Kindes gegenüber äußeren negativen Einflussfaktoren auf. Betroffenen Menschen fehlt es an Möglichkeiten zur Gegenregulation. Ciompi (1982) sieht die Ursache für die Vulnerabilität in einer Störung der Informationsverarbeitung des Gehirns. Dies wird besonders zum Problem, wenn Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen um auf von außen und von innen kommende Reize zu reagieren. Die Informationsverarbeitung ist weiterhin für die Ordnung, das Verständnis und die Bewertung von Reizen wichtig (vgl. Lenz 2005, S. 23f.).
Ein großer Teil der Vulnerabilitätsforschung setzt sich mit den Auswirkungen der psychischen Auffälligkeit von Mutter oder Vater auf die frühe Entwicklung des Kindes. Laucht et al. verdeutlichen, dass Kinder psychisch kranker Eltern über ungünstigere Entwicklungsprognosen verfügen als Kinder gesunder Eltern. Gesicherte Erkenntnisse gibt es in der kognitiven und sozial-emotionalen Entwicklung im Kleinkindalter, wonach Defizite in der sprachlichen Entwicklung und eine Zunahme expansiver Störungen identifiziert werden konnten (vgl. Laucht/Esser/Schmidt 1992, S. 22ff.).
Untersuchungen (z. B. von Cohn et al. 1990 oder Field et al. 1990) bestätigen die Annahme, dass sich mögliche Risiken in der psychischen Entwicklung des Kindes aus dem unmittelbaren Zusammenleben mit einem psychisch kranken Elternteil ableiten lassen. Wesentlicher Faktor ist die Eltern-Kind-Interaktion. Beispielsweise zeigen depressive Mütter unterschiedliche Verhaltensweisen im Vergleich zu unauffälligen Müttern indem sie u. a. weniger Interesse und emotionale Beteiligung zeigen, inkonsequentes Erziehungsverhalten aufweisen und meist mit der Kindererziehung überfordert sind. Diese Verhaltensmerkmale sowie eingeengte kommunikatives Repertoire können sich bereits in der frühen Kindheit zu dysfunktionalen Interaktionsmustern verfestigen, die sich auf die Entwicklung einer psychischen Störung auswirken können (vgl. Lenz 2005, S. 25f.).
2.4 Genetische Studien
Mit der Frage, welche Rolle die Vererbung bei der Entstehung von psychopathischen Erkrankungen spielt, beschäftigen sich genetische Studien (vgl. Mattejat/Lisofsky 2001, S. 79ff.). Die folgende Tabelle gibt einen Überblick also die Rate zu wie viel Prozent eine psychische Störung genetisch verursacht ist. Die Heritabilität (= Vererblichkeit) „ gibt an, wie viel Prozent der Gesamtvarianz des jeweiligen Merkmals durch den genetischen Faktor erklärbar ist“ (Mattejat/Lisofsky 2001, S. 80).
Tabelle 1: Vererblichkeit psychischer Störungen (nach Mattejat/Lisofsky 2001, S. 80)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Zahlenbereiche entstehen durch die Erkenntnisse verschiedener Studien. Auffällig ist, dass die Vererbung bei der Schizophrenie eine sehr große Rolle spielt, ähnlich bei bipolaren Störungen. Der genetische Faktor beeinflusst die Verletzlichkeit eines Menschen in Bezug auf Umweltbedingungen. In der Wissenschaft geht man von einem Zusammenwirken genetischer und Umweltfaktoren bei den meisten psychischen Störungen aus. Menschen, die zu einer genetisch verletzlichen Gruppe gehören, reagieren auf Stressfaktoren empfindlicher als Menschen mit einer anderen genetischen Ausstattung. Die Entwicklung einer psychischen Erkrankung ist von stark belastenden Umweltfaktoren abhängig. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Erbfaktoren und Umweltfaktoren auf die Entstehung der Erkrankung einen gleichen Einfluss ausüben. Nicht die psychische Krankheit an sich, sondern die Verletzlichkeit für eben diese wird vererbt (vgl. Mattejat/Lisofsky 2001, S. 80ff.)
3 Psychische Störungsbilder
Die Darstellung einzelner Störungsbilder soll einen Überblick über Merkmale und Symptome zentraler psychischer Störungen geben und erhebt dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Allen gemein ist, dass sie Einfluss auf den ganzen Menschen sowie sein Denken, Fühlen und Wahrnehmen nehmen. In der Regel haben sie Auswirkungen auf das soziale Umfeld und beeinträchtigen das alltägliche Leben.
3.1 Schizophrene Störungen
„ Ich fing an, darüber nachzudenken, ob ich die Bäume verletzte, und bemerkte, dass ich mich entschuldigte. Jeder Baum wurde zu einer Persönlichkeit. Ich fing an, mich zu fragen, ob einer von ihnen mich mochte. Ich ging völlig darin auf, jeden Baum zu betrachten und ich bemerkte, dass sie immer ein wenig leuchteten; sie schienen in einem sanften inneren Licht, das die Äste umspielte. Und aus dem Nichts erschien auf einmal ein unglaublich faltiges, schimmerndes Gesicht. Es begann als kleiner Punkt in der Ferne; es schnellte nach vorne und wurde ungeheuer groß. Ich konnte nichts anderes mehr sehen. Mein Herz hörte auf zu schlagen. Dieser Moment dauerte ewig. Ich versuchte, das Gesicht verschwinden zu lassen, aber es lachte mich aus ... Ich versuchte, dem Gesicht in die Augen zu schauen, und bemerkte, dass ich alles Bekannte hinter mich gelassen hatte.“ (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 580; zit. nach Vonnegut 1975, S. 96)
Mit dem Ausdruck ,das ist ja schizophren‘ bezeichnen wir gelegentlich absurdes, ungewöhnliches, von der Norm abweichendes Verhalten (vgl. Bondy 2008, S. 7). Keine anderen psychischen Störungen sind in der Bevölkerung mit so vielen Vorurteilen und Ängsten behaftet und über keine herrscht so viel Unkenntnis. Weltweit sind etwa 50 Millionen Menschen an der Schizophrenie erkrankt, es gibt dabei keinen geschlechtsspezifischen Unterschied. Weil die Erscheinungsformen so vielfältig sind, ist sie auch für Erfahrene oft nur schwer fassbar (vgl. Hoffmann-Richter/Finzen 1997, S. 13).
Das Wort Schizophrenie kommt aus dem griechischen skizo „spalten“ und phren „Verstand, Gemüt“ übersetzen. Der Schweizer Psychiater Eugen Bleuer verwendete 1911 zum ersten Mal den Begriff Schizophrenie (vgl. Bondy 2008, S.15).
„In der Welt der Schizophrenie wird das Denken unlogisch [...]“ (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 580).
Die Erkrankung ist eine schwerwiegende psychische Störung, bei der die Betroffenen unter Störungen des Denkens, Fühlens und Wahrnehmens leiden.
Die diagnostischen Hauptkriterien der Schizophrenie beinhalten Wahn, Halluzinationen, formale Denkstörungen bzw. desorganisierte Sprechweise (z.B. häufiges Entgleisen oder Inkohärenz/Zerfahrenheit), grob desorganisiertes oder katatones Verhalten und sog. negative Symptome. Zur Negativsymptomatik zählen flache oder abgestumpfte Affekte, Alogie, Anhedonie, Willensschwäche und Aufmerksamkeitsstörungen (vgl. Brochert 2005, S. 62).
Das wahnhafte Geschehen sowie die Halluzinationen werden in der Fachwelt als positive oder auch produktive Symptomatik bezeichnet. Der Betroffene produziert etwas, das er selbst für eine Tatsache hält - er fügt der Wirklichkeit etwas hinzu (vgl. Hilfe für psychisch Kranke e.V. Bonn/Rhein-Sieg 2008, S. 13f.).
Als diagnostische Kriterien für eine schizophrene Störung sind im ICD-10-GM[2] (F20- F29) folgende Symptome relevant:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Symptome für eine schizophrene Störung (Schone/Wagenblass 2010, S. 38)
Mindestens ein eindeutiges Symptom (zwei oder mehr, wenn weniger eindeutig) aus folgender Gruppe 1 - 4
1. Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung
2. Kontrollwahn, Beeinflussungswahn, Gefühl des Gemachten, deutlich bezogen auf Körper- und Gliederbewegungen oder bestimmte Gedanken, Tätigkeiten oder Empfindungen, Wahnwahrnehmungen
3. Kommentierende oder dialogische Stimmen, die über den Patienten sprechen, oder andere Stimmen, die aus einem Teil des Körpers kommen
4. anhaltender, kulturell unangemessener oder völlig unrealistischer Wahn (z. B. religiöse oder politische Persönlichkeit zu sein)
3.1.1 Hauptformen der Schizophrenie
Wissenschaftler gliedern die Schizophrenie aufgrund ihrer großen Bandbreite an Symptomen in verschiedene Subtypen: hebephrener, katatoner, paranoider, undifferenzierter und residualer Typus.
„Herr F. B. war ein Patient Ende 20 in stationärer Behandlung. Wenn man ihn nach seinem Namen fragte, antwortete er, er versuche ihn zu vergessen, da er jedes Mal anfinge zu weinen, wenn er ihn höre. Er weinte dann einige Minuten lang heftig. Dann, als man ihn nach etwas Ernstem oder Traurigem fragte, kicherte oder lachte er. Als man ihn nach der Bedeutung des Sprichwortes „ Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch“ fragte, antwortete er: „Braucht weniger Platz. Katze wusste nicht, was Maus tat, und Maus wusste nicht, was Katze tat. Katze ist auf Seiten der Verdächtigung repräsentativer als Maus. Dumbo war ein guter Kerl. Er sah, was die Katze machte, tat sich mit der Katze zusammen, so dass die Leute sie nicht ansehen würden wie Clowns. “ (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 581; zit. nach Zimbardo 1957)
Die Manierismen des Herrn F. B., seine desorganisierte Sprache sowie seine Wahnvorstellungen oder Halluzinationen sind für den hebephrenen oder desorganisierten Typus der Schizophrenie (F20.1) charakteristisch. Darüber hinaus kann die Sprache aus unvollständigen Sätzen sowie ungewöhnlichen Wörtern bestehen. Die Emotionen sind flach oder situativ unangemessen, bizarre Denkmuster und desorganisierte Verhaltensweisen sind typisch (vgl. Gerrig/Zimbardo 2008, S. 581).
Symptomatisch für den katatone Typus (F20.2) ist ein ,eingefTorenes‘, erstarrtes oder reizbares motorisches Verhalten. Zudem weisen Betroffene eine Negativität aus, da sie sich unmotiviert Anweisungen widersetzen.
Bei Betroffenen der paranoiden Schizophrenie (F20.0) drehen sich komplexe und systematische Wahnvorstellungen um folgende Themen: Verfolgungswahn, Größenwahn oder Eifersuchtswahn.
Wahnvorstellungen, Halluzinationen, unzusammenhängende Sprache oder desorganisierte Verhaltensweisen sind symptomatisch für den undifferenzierten Typus (F20.3).
Betroffene des residualen Typus (F20.5) zeigen keine positiven Hauptsymptome mehr, jedoch lassen geringfügige negative Symptome eine mögliche Remission der Krankheit erkennen (vgl. Gerrig/Zimbardo 2008, S. 581 f.).
3.2 Affektive Störungen
Affektive Störungen (ICD-10-GM 2012, F.30-39) werden oft als Störung der Stimmung und des subjektiven Gefühlszustandes begleitet von einem Wechsel des allgemeinen Aktivitätsniveaus, beschrieben. Unterschieden wird zwischen bipolaren, abwechselnden manischen bzw. depressiven Krankheitsphasen, und unipolaren Störungen, Krankheitsbilder mit ausschließlich depressiven oder manischen Phasen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Affektive Störungen (Schone/Wagenblass 2010, S. 34)
3.2.1 Depression
Die Depression (ICD-10-GM, F32.0-F32.9) zählt zu den unipolaren Störungen und charakterisiert sich durch depressive Verstimmung, Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Der depressive Gefühlszustand äußert sich in der Regel in der Verminderung des Antriebes, des Aktivitätsniveaus, der Konzentrationsfähigkeit und der Aufmerksamkeit. Häufig sind Rückzugs-, Flucht- und Vermeidungstendenzen auffällig. Während einer depressiven Episode ist kaum Selbstvertrauen erkennbar und Schuldgefühle, Gefühle von Wertlosigkeit sowie pessimistische Zukunftsperspektiven treten zu Tage.
Das ICD-10-GM gliedert typische Depressionen in leichte (F32.0), mittelgradige (F32.1) und schwere (F32.3 und F32.3) depressive Episode.
Die in der folgenden Abbildung aufgeführten Symptome des ICD-10-GM sind für die Diagnose einer schweren depressiven Störung entscheidend. Dabei müssen Symptome dauerhaft und mindestens zwei Wochen lang gegenwärtig sein. Depressionen verlaufen episodenhaft und können dabei Wochen bis Monate, in Extremfällen sogar Jahre, Bestand haben (vgl. Schone/Wagenblass 2010, S. 34ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Symptome für eine schwere depressive Störung (Schone/Wagenblass 2010, S. 35)
Ein Betroffener der ,Major Depression‘ (DSM-IV-TR[3] 296.2x; nach ICD-10-GM F.32) berichtet aus seinem Alltag:
„Die einfachsten Dinge scheinen einen ungeheuren Aufwand zu erfordern. Ich erinnere mich, wie ich in Tränen ausbrach, weil das Seifenstück in der Dusche aufgebraucht war. Ich weinte, weil eine der Tasten meines Computers kurz klemmte. Alles erschien mir wahnsinnig schwierig, und die Aussicht, den Telefonhörer von der Gabel heben zu müssen, war wie Bankdrücken mit einem Gewicht von 200 kg. Die grimmige Wahrheit, nicht einen, sondern zwei Socken anziehen zu müssen, und anschließend noch zwei Schuhe, überwältigte mich dermaßen, dass ich zurück ins Bett wollte“ (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 565; zit. nach Solomon 2001, S. 85-86).
3.2.2 Manie
Für eine Manie (ICD-10-GM, F30.0-F30.9) ist eine ungewöhnlich gehobene, manchmal aber auch gereizte Stimmung charakteristisch. Hinzu kommt eine gesteigerte körperliche und psychische Aktivität. Zu den Symptomen werden somit motorische Ruhelosigkeit, Rededrang, hohes Selbstbewusstsein, Größenwahn und übermäßiger Optimismus gezählt. Betroffene glauben häufig, dass sie über bestimmte Fähigkeiten und Kräfte verfügen. Um eine Manie zu diagnostizieren, muss eine gehobene Stimmung und mindestens drei weitere Symptome mit einer Dauer von mindestens einer Woche vorliegen. Diese Symptome müssen in ihrer Schwere so belastend sein, dass berufliche und soziale Aktivitäten nicht mehr aufrechtzuerhalten sind (vgl. Schone/Wagenblass 2010, S. 36; Gerrig/Zimbardo 2008, S. 566f.).
3.2.3 Bipolare affektive Störung
Bei einer bipolaren affektiven Störung (ICD-10-GM, F310-F31.9), die im Volksmund auch als ,himmelhochjauchzend - zu Tode betrübte‘ Stimmung bezeichnet wird, sind Stimmungsschwankungen prägnant. Auf der einen Seite weisen Betroffene eine gehobene Stimmung auf, die kennzeichnend für eine Manie ist, auf der anderen Seite sind sie depressiv verstimmt und antriebslos, was wiederum für eine Depression typisch ist. (vgl. Schone/Wagenblass 2010, S. 37).
„ Manische Depression ist, wenn man um vier Uhr morgens ein Dutzend Flaschen Heinz-Ketchup und alle acht vorrätigen Flaschen Windex-Glasreiniger im Food Emporium auf dem Broadway kauft; wenn man innerhalb von drei Tagen von Zürich auf die Bahamas und zurück fliegt, um das heiße und kalte Wetter auszubalancieren, [und] wenn man 20.000 Dollar in 100-Dollar-Scheinen in seinen Schuhen auf dem Rückflug aus Tokio ins Land schmuggelt... Es sind Ausbrüche und Anfälle von Wahnsinn, Augenblicke völliger Verwirrtheit, Seligkeit und unvernünftiger und gefährlicher Entscheidungen, die getroffen werden, um Vergnügen und Aufregung zu steigern und das Gefühl hervorzurufen, man habe alles unter Kontrolle“ (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 566; zit. nach Behrman 2002).
Lässt die manische Episode nach, müssen die während des ,Wahnsinns‘ entstandenen Schäden bzw. die missliche Lage bewerkstelligt werden. An die manische Episode schließt sich fast immer eine schwere Depression an. Manische Episoden treten plötzlich auf und haben eine Dauer von zwei Wochen bis fünf Monaten. Unbeständig sind Verlaufsmuster sowie Häufigkeit der Wechsel zwischen den manischen Episoden (vgl. Gerrig/Zimbardo 2008, S. 566f.; Schone/Wagenblass 2010, S. 37).
3.3 Persönlichkeitsstörungen
Bei einer Persönlichkeitsstörung ist das Muster der Wahrnehmung, das Denken oder das Verhalten unflexibel, fehlangepasst und verläuft meist chronisch. Das alltägliche Leben ist auf beruflicher und sozialer Ebene stark eingeschränkt und kaum zu bewältigen. Erste Störungen sind bereits im Jugendalter auffällig (vgl. Gerrig/Zimbardo 2008, S. 573).
Das DSM-IV-TR (301.xx) ordnet die zehn Arten von Persönlichkeitsstörungen in drei Cluster:
Abbildung 4: Persönlichkeitsstörungen (Gerrig/Zimbardo 2008, S. 574)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
3.3.1 Borderline-Störung
Dieses Störungsbild (DSM-IV 301.83 - nach ICD-10-GM F60.31) erhielt erst Ende der achtziger Jahre die Zuordnung zu den Persönlichkeitsstörungen. Davor wurde sie als Sonderform der schizophrenen Psychose, zwischen Neurose und Psychose einzuordnen - an der Grenzlinie (= Borderline), klassifiziert. Bei der Borderline Störung sind mehrere Bereiche der Persönlichkeit betroffen, es kommt zu Beeinträchtigungen und Störungen der inneren Ausgeglichenheit und der sozialen Beziehungen. Hauptmerkmal ist ein instabiles Selbstbild der zwischenmenschlichen Beziehungen und der Stimmung. Betroffene sehen die Welt schwarz und weiß - kennen nur gut und böse (vgl. Ger- rig/Zimbardo 2008, S. 573; Schone/Wagenblass 2010, S. 39f.).
Nach dem ICD 10 sind folgende Symptome für eine Borderline-Störung relevant:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Symptome für eine Borderline-Störung (Schone/Wagenblass 2010, S. 40)
Eine eindeutige Diagnose ist auch heute noch schwierig, da die Störung meist zusammen mit anderen psychischen Erkrankungen auftritt, z. B. Depressionen, Essstörungen oder Suchterkrankungen, und klare Diagnosekriterien unterschiedliche sind (vgl. Schone/Wagenblass 2010, S. 40).
4. Zur Lebenssituation Kinder psychisch kranker Eltern
Ein psychisch krankes Familienmitglied steht in der Regel im Mittelpunkt der Familie, bekommt von Angehörigen viel Aufmerksamkeit und kann zudem aus einer Vielzahl von professionellen Unterstützungsmöglichkeiten wählen. Häufig erwarten Fachleute, und oftmals der Erkrankte selbst, von Angehörigen, dass sie Verständnis für die Erkrankung aufbringen und ihn mit allen Mitteln unterstützen. Die Belastungen und eigenen Bedürfnisse der Angehörigen werden dabei oft übersehen und gerade Kinder sind die schutzlosesten Angehörigen (vgl. Beeck 2004b, S. 9).
Erst seit Ende des 1990er Jahre werden Kinder von Fachleuten explizit als Angehörige wahrgenommen. Das Interesse an der konkreten Betroffenheit, Problemen im Alltag und Belastungen verlagert sich nun auch auf die betroffenen Kinder (vgl. Lenz 2005, S. 73). Sie leiden besonders unter den Auswirkungen einer psychischen Erkrankung ihrer Eltern, da unmissverständlich sie die bedürftigsten Angehörigen mit den geringsten emotionalen und finanziellen Ressourcen sind (vgl. Beeck 2004b, S. 9). Studien bestätigen einen Zusammenhang zwischen psychischer Erkrankung der Eltern und Störungen der kindlichen Entwicklung (vgl. Lenz/Kuhn 2010, S. 269). Aufgrund ihrer Lebensumstände und ihrer genetischen Disposition zählen Kinder zu einer Hochrisikogruppe für psychische Krankheiten, psychovegetativen Störungen und andern stressbedingten Erkrankungen. „Eine determinierte Wirkung genetischer Faktoren kann aber ausgeschlossen werden “ (Lenz/Kuhn 2010, S. 269).
Festgehalten werden kann, dass die genetische Ausstattung die Umwelteinflüsse moderieren (vgl. ebd.). Laut der Gießener Angehörigenstudie ist die durchschnittliche Stressbelastung von Angehörigen psychisch kranker Menschen genauso hoch, wie bei einem Menschen der sich kurz vor seiner ersten Examensprüfung befindet (vgl. Franz/Meyer/Gallhofer 2003, S. 215ff.).
4.1 Typische Auffälligkeiten und Verhaltensweisen
Die Tabuisierung psychischer Erkrankungen in der Öffentlichkeit und in den Familien sowie die fehlende Krankheitseinsicht verhindern oftmals ein Erkennen der kindlichen Problemlage. Nicht selten verlaufen psychische Erkrankungen phasenweise, sodass in stabilen Zeiten der Elternteil unauffällig ist. Oftmals ist es ein Gefühl, dass mit dem Elternteil des Kindes ,irgendetwas nicht stimmt‘ und weiterhin ist problematisch, dass bestimmte Verhaltensweisen und Auffälligkeiten andere Ursachen haben können. Katja Beeck (2004b, S. 14) hat einige Hinweise, die auf eine psychische Erkrankung eines Elternteils hindeuten können, zusammengestellt. Diese dienen in erster Linie Fachkräften, die mit Kindern zusammenarbeiten (z.B. Schule/Kindergarten). Aber auch für Personen aus dem erweiterten Umfeld können diese Hinweise nützlich sein:
Anzeichen von Verwahrlosung, die durch schmutzige Kleindung oder fehlendes Pausenbrot erkennbar sind oder gar Konzentrationsschwierigkeiten, die in einer chronischen Müdigkeit gipfeln können, erweisen sich oft als äußerlich ersichtliche Anzeichen. Folge dessen ist ein Einbrechen der Schulleistungen. Auffällig ist, dass die betroffenen Kinder wenige Freundschaften haben und in einer Außenseiterposition verweilen. Sie können sich nur schwer aus dieser Rolle befreien, da selbst den Mitschülern der Kontakt zum Schüler durch ihre Eltern verboten wird und sie so nicht mehr nach Hause eingeladen werden. Als Gesprächspartner bevorzugen sie Erwachsene und verhalten sich auffällig erwachsen, sind selbständig, verantwortungsbewusst, vernünftig, ernst und übernehmen häufig Verantwortung und Aufgaben. Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil sind fürsorglich, wachsam und haben Schwierigkeiten, sich auf andere zu verlassen und einzulassen. Bei Nachfragen nach den Lebensumständen der Familie erfinden sie Ausreden oder weichen aus. Kinder psychisch kranker Eltern sind von der Bestätigung durch außen angewiesen, da sie ein geringes Selbstkonzept haben, das durch wenig Selbstwertgefühl, Selbstzweifeln, mangelnde Selbstwahrnehmung geprägt ist. Aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern (Jungen), Autoaggressionen (Mädchen) könnten auch Hinweise auf betroffene Kinder sein (vgl. Beeck 2004b, S. 15f.).
[...]
- Arbeit zitieren
- Jasmin Jasz (Autor:in), 2012, Dein anderes Ich. Kinder psychisch kranker Eltern, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194551
Kostenlos Autor werden

















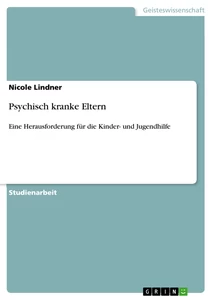


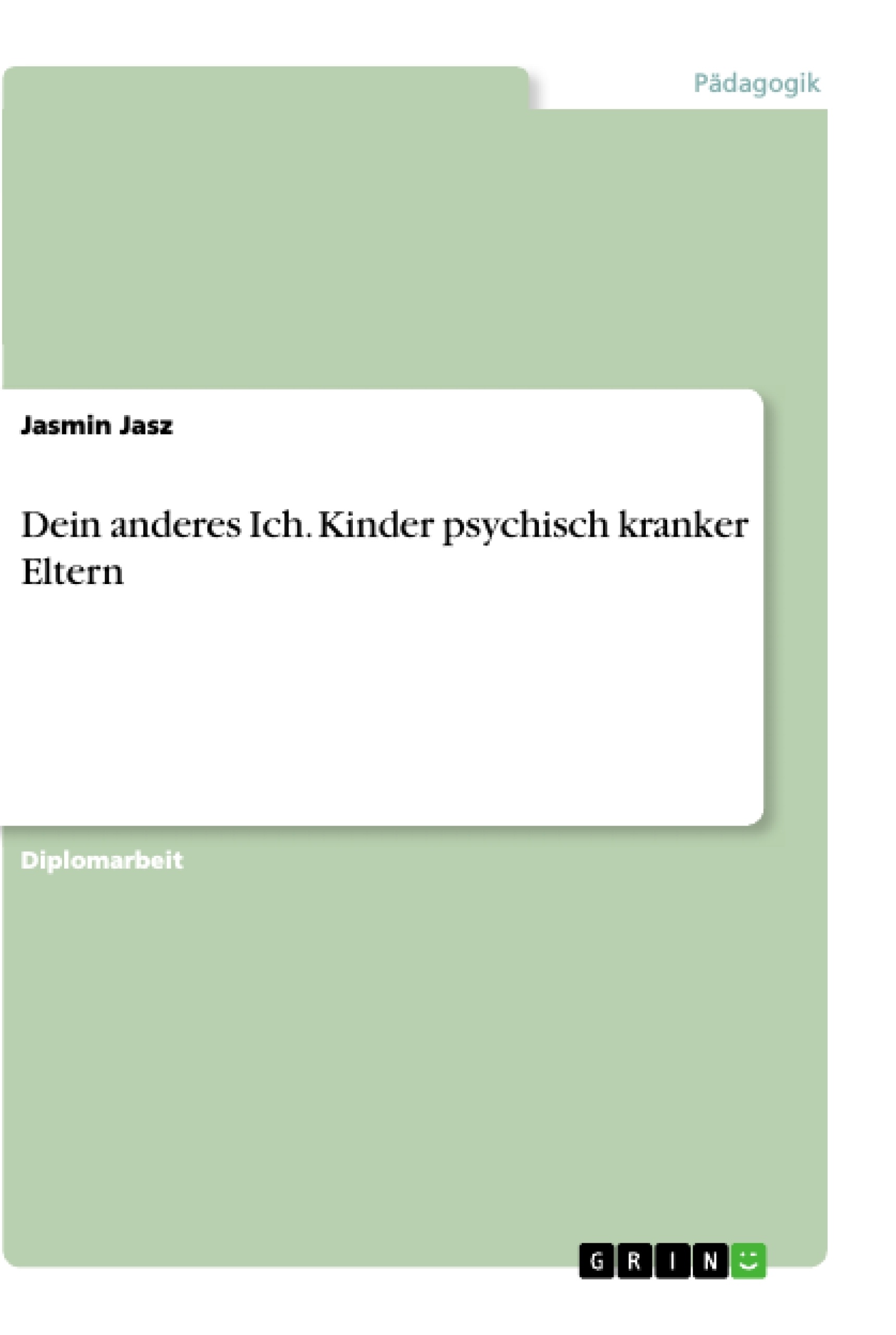

Kommentare