Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Dank
Eine Annäherung an das Thema
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Anamnese eines Syndroms
Ausgangspunkt einer Reise
Teil I
Die Suche
Aus heiterem Himmel
Ein grauer Novembertag
Der Schwung in der Schrift
Zur Säule erstarrt
Diagnose oder Urteil
Wegstecken
Lückenlose Kontrolle
Selbsterfahrung
Alltägliche Beobachtungen
Allein mit Dr. Parkinson
Bewegungsarmut
Der Dreh beim Parkieren
Die verflixte Kasse
Paradoxe Beweglichkeit
Die präklinische Phase
Eine unauffällige Kindheit
Einzelkämpfer
Festung
Das Muster
Romanze in Manhattan
Die tiefere Einsicht
Identität und Kontrolle
Erlernte Hilflosigkeit
Die Symptome, einmal anders
Am Ende stottern sie wohl alle
Blockadenbrecher
Die experimentelle Phase
Flucht mit der Wunderpille
Der erste Test: der Opiat-Antagonist
Der zweite Test: das homöopathische Opium
Sturm im Gehirn
Gegen die Gefühle schreiben
Und wieder Experimente
Die Neuauflage des Opiattests
Ermächtigung
Ohne Belohnung keine Motivation: das Antriebsmangel-Syndrom
Antriebsmangel-Syndrom
Teil II
Umdenken
Frustration
Selbst-Bewusstheit
Selbstverteidigung
Lebendigkeit
Berg- und Talfahrt
Hilflosigkeit und Ohnmacht
Die Hilflosigkeit des Kranken
Inselhüpfer
Liebe deinen Parkinson
Präsenz und Bewusstheit
Das innere Kind
Neue Wohnung, altes Muster
Der vermeintliche Tiefpunkt
Weitersuchen
Weiterleiden
Wer ist der Boss?
Hilflosigkeit und Urheberschaft
Peterli
Zurück zur Mutter
Annäherung
Konversionsneurose
Heilung des Traumas
Und doch auf dem Sofa
Fussverletzung
Das Erwachen des Tigers
Annäherungs-Schmerz
Teil III
Trauma
Null-Dopa
Scham
Scheibenwischer-Technik
Auf die Zehen getreten
Horror der Genesung
Verlassenheitsangst
Die Entscheidung
Es geht auch ohne
Schüttellähmung
Traumatherapie
Der Tiger in deinem Tank
Versprechen und Irrtum
Geschüttelt und nicht gerührt
Ausgezittert
Bestätigung
Zeichen aus Chile
Dr. Parkinson
Der vierte Musketier
Der normative Partner
Der Mord am Ehepartner
Carpe Diem
Verrückt werden oder der Irr-Sinn der Heilung
Quadratur des Kreises
Die „genügend gute“ Mutter
Struktur des emotionalen Traumas
Teil IV
Heilung
Achterbahn
Parkinson als künstlicher Schutz
Natürliche Schutzmechanismen
Komplexe Ursache
Körpersprache
Emotionale Heilung
Kuriositäten
Natürliche Energie
Immer wieder
Hilfe, ich werde gesund
(Kein) Ende
Die Ohnmacht des Neurologen
Leiden und Entdecken
Phantom der Krankheit
Neuronales Feuerwerk
Die verlorene Wut
Ärger
Stadt- oder Landneurotiker
Verloren und gefunden (Lost and found)
Abschluss ohne Ende
Nachwort
Und wieder ein Muster
Mit Mut in die Zukunft
Literaturhinweise
Anmerkungen des Neurologen
Widmung
Den Müttern
gewidmet. Ich widme ihnen dieses Buch insbesondere, um zu verhindern, dass es als Anklage missverstanden wird.
Sodann all jenen gewidmet, welche, nachdem ich es endlich zugelassen habe, mich in diesem (oft schmerzhaften) Prozess begleitet haben und mich auch weiterhin begleiten,
besonders aber jenen, welche sich in diesem Prozess befinden und hoffen, dass dieser nicht nur Schicksal, sondern vor allem eine Chance sei.
Dank
Mein unmittelbarer Dank geht an meine Freunde und Lehrer Rafael González Maldonado und Juan F. Godoy García, welche mich zur Publikation dieses Buches animiert und dazu nicht nur Text beigetragen haben.
Sodann geht mein Dank an alle, welche mich in den manchmal schwierigen Jahren begleitet haben und begleiten.
Eine Annäherung an das Thema
It is dangerous to suppress emotions[i]
People who continuously suppress their feelings will break
Sinéad O’Connor (Irische Sängerin und Liedermacherin, 1990)
Vorwort
Das Buch, welches Sie in den Händen halten, offenbart die klare, scharfe, subtile und oft gewagte Beschreibung von allen Entwicklungsaspekten (prämorbid, subklinisch und klinisch) des Erlebens einer Krankheit, der Parkinson-Krankheit, durch dessen Autor, Mark Hurni, welcher selber von dieser Krankheit betroffen ist.
Als Werk eröffnet sich dem Leser im Verlauf der Lektüre die mitreissende Beschreibung des gesamten äusserst komplexen Prozesses im Zusammenhang mit der Annahme und Bewältigung einer Krankheit, wie es die Parkinson-Krankheit ist, für welche bis heute noch keine Prävention oder Heilung bekannt ist und welche im Fall von Mark (und bedauerlicherweise in vielen anderen Fällen) im Leben einer jungen Person mit vielen vitalen Projekten auftritt und sich entwickelt, welche in dem Mass neu gestaltet werden müssen, in dem der Betroffene die Krankheit akzeptiert und sie lebt.
An diese Beschreibung – in vielen Kapiteln so mitreissend, dass man es nicht lassen kann weiter zu lesen – des Erlebnisses des Patienten mit einer neurologischen Krankheit schliesst sich das geglückte Zusammentreffen der Beiträge seines Neurologen, Dr. Rafael González Maldonado, in der Form von Anmerkungen an, welche als Ergänzung, Klarstellung oder Erläuterung der Darstellung des erwähnten Erlebnisses seines Patienten dienen. So wird der Leser durch dieses Werk aus allererster Hand die Gelegenheit haben zu verstehen, wie man eine Krankheit wie diejenige des Parkinson erlebt, gleichzeitig mit den äusserst interessanten Erläuterungen der Ausführungen seines Patienten durch einen Spezialisten derselben Krankheit. Wie gesagt, diese seltene und ungewöhnliche Verbindung der Protagonisten – Patient und Fachmann aus dem Gesundheitswesen – in einem Buch ist ein Privileg
Patient und Neurologe sind die am ehesten erwarteten und wichtigsten Pfeiler der Bewältigung der Parkinson-Krankheit. Das ist zumindest in unserer Kultur und Gesundheitspraxis das Übliche, Konventionelle. Die angemessene Behandlung der Krankheit erfordert die Mitverantwortung und das Zusammenwirken des Patienten und seines Arztes. Im Buch werden sie die Einzelheiten und die Komplizität der therapeutischen Allianz zwischen Mark und Rafael finden.
Ein dritter Pfeiler, welcher diese geglückte Verbindung ergänzen könnte, wäre der Bezug zu den psychologischen Aspekten dieser Krankheit. Diese unentbehrliche Ergänzung könnte darin bestehen, die Bedeutung hervorzuheben, welche die psychologischen Aspekte gemeinsam mit den biomedizinischen, im Besonderen neurologischen und neuromuskulären Aspekten (d.h. das Zittern, die Starrheit, die motorische Verlangsamung, Bradikinesie oder Akinesie, die Störungen in der Haltung, des Gleichgewichts oder des Ganges, Veränderungen im Muskeltonus etc.) bei der Parkinsonkrankheit haben.
Ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich mich sehr glücklich fühle, von Seiten der beiden Hauptprotagonisten die Gelegenheit zu haben – wenn auch nur im beschränkten Rahmen des Vorwortes dieses gehaltvollen Werkes – einen kleinen Einblick in die Beiträge zu geben, welche von Seiten der Psychologie bei dieser Krankheit geleistet werden könnten.
Gewiss, die mit der motorischen Kontrolle verbundenen Aspekte oder die Anomalien in der Bewegung besitzen bei Patienten, welche an der Parkinson-Krankheit leiden, grösste Bedeutung, angesichts der gewaltigen adaptiven Kraft der Bewegung und des Einflusses, den die motorischen Veränderungen oder Symptome auf das Leben und die täglichen Verrichtungen haben.
Mark berichtet mit peinlicher Genauigkeit über die reiche Vielfalt seiner motorischen Symptome und des damit verbundenen Unwohlseins und Leidens. Das Buch ist voll von Erlebnissen in Verbindung mit der Wirkung der Bewegungsanomalien, von der einfachen motorischen Blockade bis zu jenem Problem, zu welchem so gewohnheitsmässige Handlungen wie das Anziehen oder Essen im Kreis von Freunden werden können, oder einfach ein unerwünschtes Zittern der Hände beim Zahlen an der Kasse im Supermarkt. Die Beschreibung, wie diese Symptome auftauchen, sich verstärken oder vermindern, wie auch diejenige gewisser psychologischer oder psychosozialer Umstände, welche mit dieser komplexen Dynamik der motorischen Kontrolle verbunden sind, ist wirklich sehr präzis und subtil.
Die psychologischen Aspekte sind denn auch, wie in diesem Buch zutreffend ausgeführt wird, ebenfalls von grösster Bedeutung: kognitive, hauptsächlich die Aufmerksamkeit und die Informationsverarbeitung, das Denken, visuell-räumliche Fähigkeiten, exekutive Fähigkeiten und Gedächtnis; einstellungsmässig-motivationale, hauptsächlich Apathie, Desinteresse, Motivationsmangel; affektiv-emotionale, hauptsächlich Depression, Stress und Ängstlichkeit; verhaltensmässige, hauptsächlich Probleme im alltäglichen Funktionieren; und psychosoziale, zur Hauptsache familiäre und soziale.
In diesem Sinne zeigt uns Mark auch mit grosser Klarheit, Präzision und Schärfe, welche Wirkung die mit der Krankheit verbundene Angst, Hilflosigkeit, Scham und andere negative Emotionen hervorrufen und wie diese das Auftreten und die Verstärkung der motorischen Symptome beeinflussen. Das Buch ist in diesen Inhalten gewiss für jeden Leser mit einem Sinn für die psychologische Dimension dieser Krankheit von Interesse.
Mark bringt Inhalt und Unwohlsein, welche ihm die schwierigen Momente bescheren, ganz klar zum Ausdruck, das Leiden, die Einsamkeit, Liebe und Lieblosigkeit, Angst, Scham, die affektive Verflachung, Interesselosigkeit, die Bewältigung der Emotionen … Die Aufmerksamkeit des Lesers wird der bedeutende Umfang des Buches wecken, welcher der Angst, der Scham und vor allem der Hilflosigkeit gewidmet ist, genauso wie das andauernde Interesse von Mark, eine Erklärung für die Symptome zu geben und die feine Erfassung ihres Einflusses auf die motorischen Symptome.
Bei der Parkinson-Krankheit wie auch bei anderen Krankheiten werden die psychologischen Aspekte sowohl direkt durch die zerebrale Schädigung bestimmt, was wir als Krankheitsvariable bezeichnen (oder als Symptom oder durch die Krankheit bewirkte Veränderung), wie auch indirekt, was wir als Antwort auf die Krankheit kennen (persönliche Art mit der Krankheit umzugehen oder sie zu bewältigen, Nebenwirkungen der pharmakologischen Behandlung etc.).
Die Ersten, die Symptome und ihre Behandlung, sind in der Regel jene, welche die Praxis in der therapeutischen Bewältigung der Krankheit beschäftigen. Hier sind die Bedeutung der adäquaten Diagnose und Evaluation, die Anwendung der wirksamsten Therapien und die Befolgung derselben durch den Patienten die entscheidenden Aspekte.
Die Zweiten, die Nebenprodukte des Umstandes, an der Krankheit zu leiden, oder des Krankheitsverhaltens als Patient mit der Parkinson-Krankheit, sind nicht weniger wichtig. Wir wissen genau, dass es viele individuelle Unterschiede in der Aufnahme und der Bewältigung der Krankheit gibt und dass diese unterschiedlichen Verhaltensformen ebenfalls enorme Bedeutung in Akzeptanz, Erleben, Entwicklung und Prognose derselben haben.
Aus diesem Grund hat auch das Interesse, welches Mark diesem Komplex von Variablen schenkt, meine Aufmerksamkeit stark angezogen. Über die Bedeutung hinaus, welche er der Angst, der Ängstlichkeit, Stress oder Depression zuweist, befasst sich ein bedeutender Teil des Buches mit der erbitternden Auseinandersetzung von Mark mit dem Erleben der Krankheit. Vom anfänglichen Nicht-Annehmen geht der Autor durch das Erleben, welches mit deren Verstehen verbunden sind, die Hypothesen ihrer Entstehung, die Erprobung der Behandlungen, manchmal mit zweifelhaftem Nutzen, wie er selber berichtet und erleidet … Es gibt einen entscheidenden Moment in diesem Wechsel der Haltung gegenüber der Krankheit, als Mark erahnt und formuliert, dass die Heilung der Parkinson-Krankheit dort beginnt, wo sie angreift: im Kopf.
Wie wir erwähnt haben und Mark es in seinem Buch heraushebt, wie alle Welt weiss und ich als Psychologe herausstreichen muss (was selbstverständlich nicht heisst, dass die biomedizinischen Aspekte in den Hintergrund treten), haben die psychologischen Aspekte in der Parkinson-Krankheit eine zentrale Bedeutung. Von daher kommt die Zweckmässigkeit, sie zusätzlich zu den biomedizinischen Methoden, zur Unterstützung, für das Wohlbefinden und die Lebensqualität von Patienten, Familienmitgliedern und Betreuer zu behandeln, und dies, weil in vielen Fällen diese psychologischen Aspekte die dominierenden Symptome darstellen.
Die psychologische Auseinandersetzung mit der Krankheit erfolgt unter Berücksichtigung des Umstandes, dass vom Standpunkt der Interaktion Krankheit-Person der psychologische Status und die Antworten auf die Krankheit – wie wir bereits ausgeführt haben – von deren Wirkung (Symptome und deren Schwere) und den Fähigkeiten, sie zu bewältigen (emotionale Kontrolle, Fähigkeiten und Kompetenzen der Bewältigung von Stress und Schwierigkeiten oder Problemen des Alltags, Optimismus, Eigeneffizienz, soziale Unterstützung etc.) abhängen. Dabei ist zu berücksichtigen, was wir auch schon erwähnt haben, dass es viele individuelle Unterschiede in der Anpassung an und der Antwort auf die Krankheit gibt.
Aus diesem Grund werden die psychologischen Interventionen bei der Parkinson-Krankheit sehr vielfältig sein, wobei deren wichtigsten Ziele die neuropsychologische Rehabilitation (zur Wiederherstellung der kognitiven Funktionen), die Techniken der emotionalen Kontrolle (zur Prävention und Behandlung der affektiv-emotionalen Störungen), die Einübung in komplexen Fähigkeiten wie die sozialen Kompetenzen, die Fähigkeiten der Stressbewältigung, der Problemlösung etc. (zur Prävention und Behandlung von Alltagsproblemen, familiären und beruflichen Schwierigkeiten) sind. Wir haben sogar Techniken des Biofeedback zur Kontrolle gewisser neuromuskulärer Störungen wie Zittern oder Veränderungen in der Sprachbildung angewendet.
Bei der Lektüre des Buches ist mir, als Psychologe, das manchmal exzessive Interesse von Mark für die psychologischen Aspekte und die Kohärenz in der Suche nach Erklärungen psychologischer Natur seiner Krankheit stark aufgefallen. Als ich diese Ausführungen las, erinnerte ich mich daran, dass in der Geschichte der Erklärungen der Parkinsonkrankheit immer wieder Nachdruck auf die psychologischen Aspekte als Determinanten oder Prädispositionen für deren Erleiden gelegt wurde. Dabei wurde sogar ein prämorbider Persönlichkeitstyp postuliert oder die Prädisposition für die Parkinson-Krankheit mit beruflichem Fleiss, rigider Einstellung oder mangelnder Flexibilität, erhöhter Selbstkritik, Unterdrückung von Aggression, Feindseligkeit und Emotionen, sozialer Isolierung etc. charakterisiert.
In der anderen Dimension hat die klare Wahrnehmung des Umstandes seitens von Mark, meine Aufmerksamkeit geweckt, dass in der Entwicklung der Krankheit, was wir gut kennen, eine positive Antwort eintritt, wenn sich seitens des Patienten der Wille zeigt, die Krankheit zu akzeptieren, dagegen zu kämpfen und alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, dass diese nicht daran hindert, im Funktionieren und in den alltäglichen Interessen fortzufahren. Diese Haltung kontrastiert mit derjenigen von Enttäuschung, Verzweiflung und Aufgabe, Verlust von Illusion und Lust weiter zu funktionieren, von Unsicherheit und Angst vor der persönlichen, familiären und sozialen Verantwortung, Zweifel in Bezug auf die Entwicklung der Krankheit, Zorn und Frustration darüber, dass die Krankheit gerade mich getroffen hat … Mark stellt das Modell von berühmten Büchern über die Parkinsonkrankheit dar, welche die Ausdrücke wie „herausfordernd“ oder „lernend, damit zu leben …“ im Titel enthalten.
In sehr vielen Gelegenheiten bewältigt Mark diese schwierigen Momente grossen Leidens und erweist sich dabei als Beispiel andauernder Einschätzung, starker Wahrnehmung schmerzhaftester Verhältnisse, der Anpassungswille, des Durchhaltevermögens und des Widerstandes gegen diese Umstände. Die Lektüre von Abschnitten, welche auf viele von ihnen Bezug nehmen, bewirkt grosse emotionale Betroffenheit, Mitgefühl und menschliche Solidarität mit dem leidenden Gefährten, zum Beispiel in dem Erfordernis, sich selber im Zustand als Parkinsonkranker zu akzeptieren, der Überzeugung, dass das Leben ohne den Ausdruck von Gefühlen und Emotionen, in seinen Worten, „schattig“ ist und „nicht blüht“ oder der Ohnmacht und Hilflosigkeit der Anerkennung, dass „vor zwei Jahren eine Krise Stunden dauerte, vor einem halben Jahr einen halben Tag und jetzt mit Leichtigkeit Tage oder Wochen dauern kann“ und der Tatsache, dass er trotz dieser Umstände ohne Stillstand weiterkämpft, um Ressourcen zu finden, mit welchen er seine psychologischen Fähigkeiten und Kompetenzen des Widerstandes und der Bewältigung als Art und Weise üben kann, um „zum Leben zurückzukehren“, „wieder zu leben“… Nur zu, Mark! Das ist mit Sicherheit der richtige Weg, auch wenn er manchmal steinig und steil ist! Ziehe gute Schuhe an, pack die notwendige Energie und den erforderlichen Mut und mach dich auf den Weg!
Ich habe stets ausgeführt und in meinen wissenschaftlichen Beiträgen, einschliesslich in der Parkinson-Krankheit spezialisierter wissenschaftlicher Tagungen, verteidigt, dass Neurologie und Psychologie (oder Psychologie und Neurologie) die Schlüssel zur Behandlung dieser Krankheit sind. Ich weiss auch, dass Patienten und Spezialisten in dieser Krankheit die Bedeutung der globalen Betrachtung der neurologischen und psychologischen (oder psychologischen und neurologischen) Aspekte der Parkinson-Krankheit hervorheben. Dieses Buch ist voll von neurologischen und psychologischen (oder psychologischen und neurologischen) Aspekten und von der Bedeutung derselben. Da sind Paragraphen, welche die gewaltige Bedeutung der neurologischen Aspekte hervorheben und Abschnitte, welche die gewaltige Bedeutung der psychologischen Aspekte betonen. Und nichts ist fremd daran. Wir Menschen sind, in der Gesundheit wie in der Krankheit, eine funktionale Einheit, in welcher das, was sich von Moment zu Moment ausdrückt oder manifestiert, der aktuelle Zustand der dynamischen Interaktion zwischen biomedizinischen, psychologischen und sozioambientalen Dimensionen ist, welche gemeinsam die menschliche Natur bilden. Der Geschmack dieses Cocktails wird wie in allen diesen Getränkmischungen, durch seine Zutaten bestimmt. Der beste Zubereiter von Cocktails ist einer, der die passenden Zutaten kennt, kalkuliert, beifügt und mischt und dadurch den gewünschten Geschmack erzeugt.
Herzlichen Dank, Mark, herzlichen Dank, Rafael, für eure Beiträge zu diesem Kampf gegen ein menschliches Leiden. Ihr sagt uns darin viel, vermutlich mehr als ihr euch vorstellt. Ihr tut es auch in einer didaktischen und motivierenden Art und macht aus der Lektüre eine Leidenschaft, eine Andacht, eine immense Lust zu lesen und weiter zu lesen …
Zum Schluss erlauben Sie mir, lieber Leser und liebe Leserin dieses speziellen und geglückten Buches, dass ich diese Zeilen mit der Formulierung eines Wunsches abschliesse, welcher mit einer sehr persönlichen Überzeugung kohärent ist. Der Wunsch: Patienten, Neurologen und Psychologen, hoffentlich seid ihr fähig ein menschlicheres, positiveres und optimistischeres Panorama für diese Krankheit anzubieten, welches ein grösseres Wohlbefinden und mehr Lebensqualität für alle und jeden Einzelnen der durch die Parkinson-Krankheit Betroffenen ermöglicht. Die Überzeugung: Ich weiss, dass es immer und ganz speziell für die Person, welche leidet, gut ist zu verstehen, dass es unter allen menschlichen Bedingungen möglich ist, das Glück zu erlangen.
Juan F. Godoy García
Ordinarius in Psychologie
Einleitung
Anamnese eines Syndroms
Es begann ungefähr im einundvierzigsten Altersjahr. Akademische Schreibweise gewohnt, hatte ich den Eindruck, dass der Schwung in der Schrift verändert war. Es war eine subjektive Wahrnehmung, objektiv war es für den Hausarzt weder von Auge noch im Schriftbild nachvollziehbar. Ein halbes Jahr später, eine Bekannte war unerwartet an einem Gehirntumor verstorben, verlangte ich die Abklärung. Ein erster Neurologe fand nichts, sprach von Schreibkrampf[ii] und einer Ursache in der Hirnrinde. Der nächste, ein Jahr später, fand auch noch nichts Konkretes, verwies mich aber wiederum ein Jahr später aufgrund nun doch objektiv fassbarer motorischer Einschränkungen[iii] an einen auf Feinmotorik spezialisierten Kollegen. Dieser kam nun, im dritten Jahr der Störung, nach eingehender Untersuchung zu einer Annäherungs-Diagnose. Dabei blieb es vorerst für ein Jahr, in welchem die Schreibstörung nur leicht zunahm. Daraufhin kam der vierte Neurologe zusammen mit anderen Spezialisten zum Schluss, dass es sich um ein Parkinson-Syndrom handeln musste[iv]. In den folgenden zwei Jahren verschlechterte sich sodann nicht nur zunehmend die Motorik bis zur praktischen Unfähigkeit zu schreiben, sondern die Einschränkung war nun auf der ganzen rechten Seite ausgeprägt und nicht mehr zu verbergen.
Die familiären Verhältnisse sind auffällig, weil ich mich aus der Kindheit nur an wenig erinnere[v], die Erinnerung wohl verdrängt habe. Mein Vater starb, als ich gerade elf Jahre alt war. Ich verbrachte die folgenden acht Jahre in einem Internat, einem humanistischen Gymnasium, mit Ordensleuten, allein unter vielen, als Einzelgänger. Mit meiner Mutter verband mich nicht viel. Ich hatte ihr Kontrollsystem mit anderen Strukturen ohne Individualität vertauscht und war froh, sie auf Distanz zu haben. Genug Raum für mich hatte ich schon als Kind nicht und was ich auch tat, richtig machen konnte ich es sowieso nicht. Meine schulischen Glanznoten waren bereits in der Primarschule nicht gut genug und auch in der Mittelschule anerkannte niemand meine Leistungen. Die erste Liebe war eine Enttäuschung, weil ich zu spät merkte, was da entstand, und sie nicht bereit war zu warten. Der erste Sex, viel später, war eine Katastrophe, weil keine Liebe uns verband. Jahre vergingen ohne Bindung, mit flüchtigen Beziehungen, ohne Emotionen[vi], bis sie kam und zehn Jahre blieb. Liebe hielt uns zusammen, Angst[vii] liess uns nicht zu nahe kommen und trieb uns immer wieder auseinander. Das Ende kam, nicht weil wir uns nicht mehr mochten, sondern weil es uns nicht gelungen war, die richtige Distanz zu finden.
In diese Zeit fielen auch akademische Leistungen, die ich aber vorerst beruflich nicht umsetzen konnte. Ich brauchte sie nur, um mir – und anderen[viii] – zu beweisen, dass ich etwas konnte. Es kamen Jahre der Wissenschaft[ix], der Irrtümer und der Einsamkeit. Als ich dann beruflich losliess, ging es blitzartig bergauf, machte mich noch viel einsamer. Mit der Angst vor menschlichen Konflikten liess sich aber auch die berufliche Leistung nicht halten. Der Bruch kam inmitten des ersten Erfolges. Ich zog mich in eine monatelange Depression zurück. Doch dass es eine Depression war, realisierte ich erst viel später.
Die folgende Phase war stets begleitet von mehr oder weniger lange dauernden Partnerschaften, welche jedoch immer daran scheiterten, dass ich emotional[x] nicht das bieten konnte, was die Partnerinnen – zu Recht – von mir erwarteten. Beruflich ging es noch einmal aufgrund meiner professionellen Kompetenz bergauf. Am Ende standen aber die Unfähigkeit, mich den menschlichen Erfordernissen stellen zu können. Was vorher offenbar mit grösstem Erfolg verdrängt war, brach durch: Angst und Scham.
Ausgangspunkt einer Reise
Diese - etwas ungewöhnliche - Anamnese ist natürlich etwas später entstanden mit etwas mehr Einsicht in das Geschehen. Und so nüchtern, wie sich diese Darstellung präsentiert, ist die Erfahrungswirklichkeit auch nicht. Aber sie widerspiegelt den damaligen Zustand der Trennung von emotionaler und rationaler Wahrnehmung[xi]. Ich war vorerst nur Beobachter. Zeitlich stehen wir damit im Jahre 1995, am 4. Dezember 1995 ganz genau, am Anfang einer persönlichen Erfahrung sowie einer Auseinandersetzung mit einer Krankheit, welche nach wie vor als unheilbar gilt, ja von welcher letztlich nicht einmal die Ursache bekannt ist: die idiopathische Parkinson-Krankheit.
Ich war mit einem psychischen und vor allem physischen Zusammenbruch plötzlich arbeitsunfähig geworden. Innert kurzer Zeit verwandelte ich mich in einen hilflosen Menschen und war mit einer Krankheit konfrontiert, welche ich so nicht akzeptieren mochte. Mein Aufbäumen war rational, meine Ansätze weitgehend intuitiv, aber sie gaben mir damals die Kontrolle über ein Geschehen[xii], welches ich wohl nicht so leicht überstanden hätte, wenn ich den Schmerz hätte zulassen können.
Ich habe meine Geschichte unter dem Titel „Erlernter – verlernter Parkinson, Meine Heilung des Parkinson-Syndroms begann da, wo die Krankheit sitzt: im Kopf“ angefangen zu schreiben, was irgendwie den langsamen Prozess widerspiegelte, welcher auch wirklich dahinter stand und steht. Es war ein Lernprozess – und natürlich ein Suchprozess. Ich lernte, auf den Körper zu hören und ich lernte, seine Sprache zu sprechen und nicht nur jene verstandesmässige, welche so viel Distanz zur Umwelt schafft und vor allem zu sich selbst.
Auf den Titel mit der Emotion brachte mich am 24. April 2004 mein Freund und Neurologe Rafael González Maldonado, ein profunder Kenner der Parkinson-Krankheit, anlässlich eines Abendessens in Madrid.[xiii] Er schlug „A la recherche de mon dopamine perdue“[xiv] (und zwar in französischer Sprache) vor, was den Bezug der Emotionen zu den endokrinologischen Prozessen herstellen sollte. Wir haben über den „Kampf“ mit der Krankheit und von deren „Überwindung“ gesprochen, was uns aber als zu wenig ermutigende Begriffe erschienen. Man müsse den Blick von der Krankheit und deren Ursachen ab- und hin auf eine bessere Zukunft wenden, meinte Rafael González. Der Blick zurück blockiere, die Suche nach der Lösung führe weiter. Der Titel sei auch gleichzeitig eine Diagnose, meinte er schliesslich beiläufig auf dem Weg zum Hotel.
Die Reise, von welcher ich hier berichten will, führt den Leser oder die Leserin vorerst auf den Weg meiner Suche nach einer Erklärung für das, was mir zugestossen war. Das war zwar der Blick zurück, welcher aber nicht unbedingt nutzlos sein musste. Ich stellte dabei vor allem fest, dass nicht nur Angst eine Rolle spielte, sondern auch Scham[xv] und vor allem Hilflosigkeit involviert waren. Anschliessend kam eine Phase, in welcher ich versuchte, meine psychologischen Erkenntnisse in neurochemischen Prozessen zu erklären. Rafael González hat mich jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass nicht einmal die Spezialisten wirklich wissen, was da genau im Hirn endokrinologisch und physiologisch vor sich geht. Schliesslich geht daher die Reise über in die Suche nach einer Lösung, die Suche nach der „verlorenen Wut“ oder eben die Suche nach der Angst, welche das Erleben der Emotionen verdrängt hat[xvi].
Ich muss vorweg klar machen, dass ich die Parkinson-Krankheit nicht als psychische Krankheit betrachte. Ich denke, dass sich bei dieser Krankheit vorhandene Prozesse, ein biologischer oder genetischer und ein emotionaler sowie ein kognitiver, überlagern. Ich bin überzeugt, dass der psychologische Prozess emotionale, kognitive und allenfalls noch weitere Aspekte einschliesst und Ausmass sowie Progression der Symptome beeinflusst. Ich bin aber auch ziemlich sicher, dass ein biologischer oder genetischer Faktor die Prädisposition für eine Verletzlichkeit schafft, weshalb die Veränderung der emotionalen Parameter einen entscheidenden Einfluss auf die Krankheit haben müsste[xvii].
Ich lege mit diesem Buch einen sehr persönlichen Bericht vor. Ich habe mit dessen Publikation lange gezögert, habe ihn umgeschrieben, Kapitel gestrichen und neue hinzugefügt. Am Ende komme ich jedoch auf das zurück, was ich als meine Krankheit erlebt habe oder was von dieser geprägt war und immer noch ist. Und das ist im wesentlichen meine Biographie der letzten 20 Jahre.
Die Reise, welche ich hier beschreibe, begann aber nicht erst 1995 bei meinem Zusammenbruch, sondern hatte schon einige Jahre früher angefangen. Nämlich ganz genau an einem grauen Morgen im November 1990.
Teil I Die Suche
Aus heiterem Himmel
Ein grauer Novembertag
„Ich verstehe nicht, weshalb du mir davon nichts gesagt hast“, meinte sie ärgerlich und fügte hinzu, „Zu mir kannst du doch Vertrauen haben“.
Sandra war sauer. Ich hatte sie noch nie so aufgebracht erlebt. Sie war höchst verärgert und zur gleichen Zeit zutiefst besorgt. Ich konnte das nicht so recht nachempfinden, weil ich dem Umstand keine so grosse Bedeutung beimass. Das machte die Sache aber nur komplizierter, denn dafür hatte sie noch weniger Verständnis. Ein Prozess begann, welchen ich damals noch nicht so richtig verstand, und der darin bestand, dass ich mich in dem Masse verschloss, in welchem sich Sandra um mein Befinden Sorgen machte.
„Es war ja nichts Besonderes“, war meine ziemlich hilflose Antwort. „Der Arzt hat nichts gefunden, was Anlass zur Besorgnis geben könnte. Ich wollte ja nur die Gewissheit haben, dass nichts Schwerwiegendes vorliegt. Und es ist nichts.“
„Aber warum gehst du dann zum Neurologen? Du hast mir nie etwas gesagt. Also, weshalb gehst du zur Abklärung, ohne mir etwas zu sagen. Irgend etwas kann doch da nicht stimmen! Was verheimlichst du mir?“[xviii]
Da war grundsätzlich kein Geheimnis, aber ich realisierte, dass ich nie darüber sprach. Ja, ich hatte bisher – mit Ausnahme meines Hausarztes, welcher auch ein Freund war - zu niemandem irgend etwas über meine Wahrnehmung geäussert, auch nicht gegenüber Sandra. Und die machte sich nun Sorgen, weil ich beim Neurologen war. Sie war verärgert, weil ich ihr nichts gesagt hatte. Sie war der Meinung, dass ich ihr das hätte anvertrauen müssen und ich hatte einfach nicht daran gedacht.
„Ich bin stets davon ausgegangen, dass ich nichts Besonderes habe und auch mein Hausarzt hat nichts feststellen können. Ich wollte nur auf sicher gehen und deshalb bin ich zum Spezialisten gegangen. Aber auch der kann nichts finden. Ich sah dabei nichts, worüber ich hätte sprechen sollen.“
Aber ich tat mich auch sonst eher schwer damit, persönliche Dinge anderen Menschen mitzuteilen.[xix] Und das schloss auch die Freundin ein. Diese gab sich damit aber nicht zufrieden und wollte jetzt Genaueres wissen.
Der Schwung in der Schrift
Ich hatte etwa eineinhalb Jahre vorher eine leitende Position in einer weltweit tätigen Finanzberatungsfirma aufgegeben, weil ich vom Machtkampf, welcher in der Unternehmensleitung stattfand, schlicht überfordert war. Die zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen, welche mit dem Tagesgeschäft wenig oder nichts zu tun hatten[xx], hatten mich zermürbt und ich machte mich selbständig. Ich war dabei, neue Mandate zu akquirieren, als ich feststellte, dass beim Schreiben irgend etwas anders war. Der Schwung in meiner Schrift war nicht mehr derselbe. Das behinderte mich zwar keineswegs und ich war auch nicht besonders beunruhigt. Es war eher befremdend und bei nächster Gelegenheit erwähnte ich es deshalb bei einer Routineuntersuchung beim Hausarzt. Dieser konnte aber weder an meiner Schreibweise noch sonst in meinem Verhalten etwas Besonderes feststellen, worauf ich dem Umstand keine Aufmerksamkeit mehr schenkte. Als mir aber ein halbes Jahr später eine Kollegin erzählte[xxi], dass ihre Schwester kurze Zeit vorher auf einer Ferienreise plötzlich an einem Gehirntumor gestorben war, machte ich mir wieder Gedanken. Das war im Herbst 1990.
Diesmal war ich beunruhigt und es war mein Hausarzt, welcher mich zum Neurologen schickte. Dieser konnte aber nichts Beunruhigendes feststellen. Wenn ich seine Erklärungen richtig interpretierte, ging er davon aus, dass die Empfindung „psychosomatisch“ war. Im Klartext hiess das wohl „Einbildung“. Weitergehende Abklärungen fand er nicht als angezeigt[xxii] und ich fand es daher auch nicht notwendig, irgend jemandem und im Besonderen meiner Freundin etwas davon zu sagen.
Zur Säule erstarrt
Sandra hatte sich wieder beruhigt. Meine Entschuldigung tönte zwar ziemlich hilflos, aber sie verstand, dass ich nicht ihr misstraut hatte, sondern dass ich einfach nicht über meine Sorgen reden konnte. Die Tiefe ihrer Enttäuschung entsprach ihrem südländischen Temperament und kontrastierte so stark mit dem, was ich selber an Gefühlen wirklich zeigen konnte. Das machte mich irgendwie stutzig, aber als die Wogen wieder geglättet waren, beschäftigte mich das nicht mehr.
Auch die Geschichte mit dem Neurologen war kein Thema mehr und ich sagte auch nichts, als die Symptome für mich immer belastender wurden. Es war an einem Sonntagabend im Februar 1991, als Sandra auf mich zukam.
„Ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt schon über dreissig Jahre alt und ich möchte Kinder haben.“
„Was willst Du damit sagen?“, war meine ziemlich dämliche Reaktion auf ihre klare Aussage. Aber ich war auf diesem Ohr ziemlich taub und das hatte ihr Blut schon im Vorfeld angeheizt.
„Dass ich von dir eine klare Stellungnahme hören will, was du von dieser Beziehung erwartest. Ich will endlich von dir hören, dass du zu mir stehst. Und ich will wissen, wie es weitergeht.“ Sie war in jeder Beziehung bestimmt und ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Ich war ja auch nicht blöd und hatte schon lange damit gerechnet, dass Sandra heiraten und Kinder haben wollte. Wir mochten uns und hatten seit mehr als drei Jahren eine gute Beziehung. Wenn diese nicht gerade in emotionalen Höhen schwebte, lag das zweifellos nicht an ihr, sondern eher an meinem etwas spröden Charakter. Aber ich fand ja immer, dass wir uns gut ergänzten.[xxiii]
„I..., iiii..“, murmelte ich und brachte nichts Schlaues über die Lippen. Nicht, dass ich etwa nichts hätte sagen wollen oder nichts zu sagen gehabt hätte. Nein, aber ich brachte einfach nichts über die Lippen. Es war auch nicht nur der Mund. Das Sprechen war ein Würgen und ich war wie versteinert. Mein Verstand war blank, ich fühlte, wie meine Muskeln sich anspannten, wie der Nacken starr wurde, die Arme steif und der Hals eng. Ich hatte einen fürchterlichen Druck im Kopf und starrte Sandra nur an. Am liebsten hätte ich mich in Nichts aufgelöst.
„So sag doch etwas! Du kannst ja sagen, dass du mich nicht magst oder was auch immer. Aber sag wenigstens etwas.“ Je mehr sie auf mich einredete, desto stärker wurde meine Enge. Ich hielt es fast nicht mehr aus und war schon fast dankbar, als ihr der Kragen platzte und sie ihren ganzen Ärger losliess.
„Ich mache so nicht mehr weiter. Ich warte nicht bis in meine alten Tage, bis du dich für etwas entscheiden kannst.“
Ihr südländisches Temperament brach durch, sie packte ein paar Dinge und zog zu einer Freundin. Sie liess mir wenig Zeit zum Überlegen, aber ich hätte mich wohl auch nicht entscheiden können[xxiv], wenn ich mehr davon gehabt hätte. Sandra kam noch einmal zurück, um ihre Sachen zu holen. Und dann war ich allein.
Ich habe Sandra zwar nachgetrauert und ich habe sie vermisst. Es war hart, wieder allein zu sein, und es tat irgendwie weh. Aber ich war nicht fähig, den Schritt zu tun, den sie sich gewünscht hatte, und auf sie zuzugehen. Irgendwie fand ich mich damit ab, dass ich noch nicht reif dafür war, was sie wollte. Und damit war die Sache einmal mehr erledigt.
Dass meine Blockade eine Wiederholung war, nahm ich nicht wahr. Dabei hatte sich zwei Jahre vorher dasselbe schon mit meiner damaligen Freundin ereignet. Die Stimmung war schon ungut, als wir zum Windsurfen an den See fuhren. Auf die Bretter kamen wir nicht, weil das Thema bereits auf der Hinfahrt zur Sprache kam. Sie wollte heiraten und Kinder haben, eine Familie gründen, lieben und leben und ich antwortete mit totalem Erstarren. Sie machte auch kurzen Prozess und liess mich sitzen. Ich hatte das schon längst wieder vergessen, wie auch ähnliche Ereignisse, welche sich in früheren Jahren ereignet hatten [xxv].
Diagnose oder Urteil
Ich hatte unterdessen meine Selbständigkeit gesichert und nahm in der Folge ein grösseres Mandat zur Reorganisation einer Unternehmung an. Ein Jahr war seit dem ersten neurologischen Untersuch vergangen. In diesem Jahr expandierte aber nicht nur meine Beratungstätigkeit, sondern es verschlechterte sich auch die Motorik meiner rechten Hand derart, dass es für den Arzt sichtbar wurde. Ein weiteres Jahr verging und die Motorik verschlechterte sich weiter. Dazu kamen Schmerzen im Nacken und in der rechten Schulter. Eine erneute, weitergehende neurologische Untersuchung ergab nun eine Diagnose, welche das Krankheitsbild zwar noch nicht klar festlegte, den Ansatz aber im Zentralnervensystem eingrenzte und damit gegenüber anderen möglichen Erkrankungen abgrenzte. Der Neurologe sprach von einem extrapyramidal – parkinsonistischen – spastischen Syndrom[xxvi].
In der Berufsausübung war ich grundsätzlich nur unbedeutend eingeschränkt und ich liess mir auch nichts anmerken. Dass ich mehr Erholungszeit brauchte, konnte ich bei meiner flexiblen Arbeitsweise leicht verbergen. Und es gelang mir damit, die Krankheit nicht nur vor der Umwelt sondern auch vor mir selber zu verstecken, damit ich mich uneingeschränkt auf die beruflichen Verpflichtungen konzentrieren konnte.
Mit der Zeit merkte ich aber, dass ich immer schneller ermüdete[xxvii] und mein Erholungsbedarf immer grösser wurde. Von aussen liess ich mir immer noch nichts anmerken. Mich persönlich begann die Krankheit aber doch langsam zu belasten.
Ein Freund, selber Arzt am Universitätsspital, wusste von meiner gesundheitlichen Verfassung und wollte nicht akzeptieren, dass es für mein stilles Leiden keine klarere Diagnose gab. Er sorgte dafür, dass ich zur eingehenden Abklärung in die Universitätsklinik kam. Und nun war das Ergebnis nach längerer und eingehender Untersuchung eindeutig. Die Ärzte hatten keine Zweifel und die Diagnose lautete auf Parkinson-Syndrom. Das war im September 1993 und die klinische Phase hatte begonnen.
Wegstecken
Ich fand mich mit der Diagnose ab, auch wenn ich das nicht mit der Krankheit selber tat. Ich fühlte aber deren Tragweite nicht und steckte sie weg. Ich nahm sie zur Kenntnis, war ruhig, verstand, was mir da mitgeteilt wurde, aber es berührte mich nicht weiter.
Die Episode mit Sandra war zwei Jahre her und längst vergessen. Ich steckte die Diagnose ebenso weg, wie ich das Weggehen von Sandra hingenommen hatte. Ich merkte nicht, dass andere sich Sorgen über meine Gesundheit machten, während mich das offenbar nicht berührte, wenigstens emotional nicht. Es beschäftigte mich schon, aber auf andere Weise[xxviii].
Ich begann mit einer Psychotherapie, einer klassischen Gesprächstherapie, weil ich mich in sozialen Kontakten unwohl fühlte und das Gefühl hatte, dass meine Krankheit damit im Zusammenhang stand[xxix]. Ich hatte zwar Verständnis dafür, dass mir mein Neurologe in meinen psychologischen Überlegungen zur Ursache des Parkinson-Syndroms nicht folgen konnte. Ich war aber trotzdem – mild gesagt – etwas irritiert, dass meine Ärzte für Psychotherapie (zu diesem Zeitpunkt, 1996, noch) kein Gehör hatten und auch die Parkinson-Vereinigung nicht weiterhelfen konnte, als ich mich nach einer auf Parkinson spezialisierten Psychotherapie erkundigte. In Wirklichkeit war ich zutiefst frustriert, weil weder ich selber noch die Krankheit gesehen und zur Kenntnis genommen wurden. Also intensivierte ich meine Gesprächstherapie und hielt mich von Erfahrungsgruppen fern, welche ich zur klassischen Medizin zählte und als bedrohlich empfand. Ich war wirklich allein mit meiner Krankheit.
Lückenlose Kontrolle
Ich begann langsam beruflich etwas kürzer zu treten. Ich begann immer mehr meiner Zeit in Besuche von Ärzten und Therapeuten im In- und Ausland zu investieren. Mein Erholungsbedarf stieg dauernd. Ich ermüdete sehr schnell und musste meine beruflichen Einsätze weiter einschränken. Trotzdem gelang es mir immer noch, meine Krankheit nach aussen weitgehend zu verbergen. Beruflich erlaubte mir das nach wie vor meine Selbständigkeit und privat war nur mein engster Freundeskreis informiert. Die anderen sahen mich vielleicht etwas weniger, was aber bei einem Einzelgänger nicht besonders auffiel.
Dieser Zustand dauerte ungefähr ein Jahr, begann sich dann zu stabilisieren und ich fühlte mich wieder stark genug, eine neue Herausforderung anzunehmen. Die ergab sich auch Mitte 1995 im Aufbau einer neuen Beratungsfirma im Bereich internationaler Investitionstätigkeiten. Das war eines meiner Spezialgebiete. Ich griff dankbar nach der neuen Herausforderung und der Start war Erfolg versprechend. Nur die Zusammenarbeit mit dem Partner gestaltete sich schwierig. Er kontrollierte meine fachliche Tätigkeit bis zum letzten Komma. Die Spannung wuchs täglich und ich geriet immer mehr unter Druck. Nach zwei Monaten war mein neuer Einsatz beendet und ein psychischer und physischer Zusammenbruch setzte den Anfang einer neuen Entwicklung. Ich machte eine Erfahrung, welche an sich nicht neu war. Ich hatte sie bisher nur nicht so bewusst erlebt[xxx].
Ich war vollkommen erschöpft und die Symptome meiner Krankheit hatten sich schlagartig verstärkt. Ich zitterte am ganzen Körper und konnte kaum mehr sprechen. Zum ersten Mal war meine Krankheit unübersehbar nach aussen getreten und es war nicht daran zu denken, die Beratungstätigkeit weiterzuführen.
Äusserlich war eine Welt zusammengebrochen und ich nahm wahr, dass mit mir etwas Wichtiges geschehen war, aber ich wusste nicht, was wirklich vorgefallen war und schon gar nicht warum. Denn ein erstaunliches Phänomen bestand weiter. Ich war körperlich am Ende, emotional aber weit davon entfernt, davon Kenntnis zu nehmen. Ich stand fassungslos vor der Kollegin, welche haltlos weinte, als ich ihr den Sachverhalt eröffnete. Ich nahm rational ohne weiteres wahr, dass das mein Schmerz vor der schrecklichen Tatsache war und die Tränen auch meine hätten sein müssen. Ich hatte vielleicht auch noch die Ahnung eines Affekts, aber ich hatte keine Körper-Empfindung dazu. Ich war nicht als gefühlsloser Mensch bekannt und empfand mich auch selber nicht so. Ich musste meine Gefühle aber so abgeschottet haben[xxxi], dass ich trotz vollständigem Zusammenbruch weiterfunktionierte, wie wenn es sich dabei um ein neues Beratungsmandat handelte.
Selbsterfahrung
Die erste Massnahme, welche ich danach ergriff, war der Wechsel der Psychotherapie. Die Gesprächstherapie hatte zwar wertvolle Einsichten gebracht, aber ohne sichtbaren Erfolg, was meinen Zustand betraf, hatte ich sie schon ein paar Monate vorher abgebrochen. Ich hatte vor allem mehr über meine Beziehungsmuster gelernt. Es wurde mir klar, dass ich Angst vor emotionaler Nähe hatte[xxxii], aber ich fühlte nach wie vor nicht, was das war. Ich hatte zwar herausgefunden, dass es in meinem inneren Erleben etwas gab, was ich in Anlehnung an einen Film mit Al Pacino (Sea of love, 1989) „Meer der Liebe“ nannte, und ahnte, dass damit eine neue Erfahrungsdimension verbunden war. Aber den Zugang dazu fand ich in dieser Therapie nicht, geschweige denn, dass ich in diesen „Meer der Liebe“ hätte eintauchen können. Deshalb hörte ich mit der Therapie auf.
Das hatte aber meine Überzeugung nicht vermindert, dass ich die Arbeit an der Angst, weiterführen musste. Und nach dem Zusammenbruch verspürte ich auch das dringende Bedürfnis, die Unterstützung durch eine Therapie wieder in Anspruch zu nehmen. Ich hatte von einer Freundin, welche selber Psychologin war, von Körperpsychotherapie gehört und hatte intuitiv den Eindruck, dass damit mehr zu erreichen war.
Die Angst blieb nicht nur im Mittelpunkt meiner Therapie, wo sie neue Bezeichnungen und ein neues Verständnis erhielt. Sie stand auch im Zentrum meiner Nachforschungen über die Parkinson-Krankheit. Ich war überzeugt, dass Angst eine entscheidende Rolle in meiner Krankheit spielte und begann die medizinische Literatur nach Anhaltspunkten abzusuchen, welche diese Vermutung stützten. Ich wurde auch ziemlich schnell fündig und so entstand meine erste (unveröffentlichte) Arbeit mit dem Titel „Die verdrängte Angst[xxxiii] als Symptom, Ein Beitrag zur ursächlichen Analyse des Parkinson-Syndroms“. Im März 1996, also rund drei Monate nach dem entscheidenden Zusammenbruch lag die Beschreibung eines Phänomens vor, welche sich vor allem auf die in der medizinischen Literatur zu dieser Zeit (Mitte bis Ende des 20. Jahrhunderts) diskutierten Elemente des Krankheitsbildes von zwanghafter Primärpersönlichkeit, depressivem Charakter und ausgeprägtem Rückzugverhalten des Parkinsonpatienten sowie die klinisch erstellte Tatsache stützte, dass Patienten, welche an Parkinson leiden, öfter von (psychologischen) Traumata berichten als andere. Damit hatte ich die Krankheit weitgehend unter Kontrolle.
Alltägliche Beobachtungen
Allein mit Dr. Parkinson
„Ich staune, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt haben wir uns doch tatsächlich zwei Jahre nicht mehr gesehen.“
Das waren die zwei Jahre der Veränderung, das Jahr der Diagnose und des langsamen Rückzuges und anschliessend das Jahr des neuen Versuches mit Zusammenbruch und totalem Rückzug.
„Ich glaube es sind eher drei als nur zwei Jahre. Aber ein schlechtes Gewissen musst du deswegen nicht haben. Wir haben zwar ein paar Mal versucht, dich telefonisch zu erreichen. Aber jetzt wissen wir ja auch, weshalb du dich nicht gemeldet hast. Wie geht es dir?“
„Danke, gut“, war meine nicht gerade viel sagende Antwort. Ich weiss heute noch nicht so recht, wie solche Antworten angekommen sind, aber es musste offensichtlich sein, dass ich nicht über meine Krankheit sprechen wollte – oder vielleicht vielmehr, nicht sprechen konnte[xxxiv]. Aber ich war ja nicht mehr am Boden, hatte mich wieder aufgefangen und bemühte mich, einigermassen durch die Tage zu kommen. Das gelang mir für meine Begriffe auch nicht schlecht. Ich hatte einen grossen Bekanntenkreis und einige gute Freunde, was ich vor allem später noch intensiv erfahren sollte, als es mir wirklich nicht gut ging. Aber ich realisierte kaum, dass ich mein Wohlbefinden mit Isolation erkaufte, mit einem ausgeprägten Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben. An Kontakten fehlte es zwar trotz Vermeidungsverhalten nicht. Es war wohl mehr ein Problem der Qualität des Kontaktes.
„Wir würden dich gerne hin und wieder sehen. Ruf doch bitte mal an!“
„Ich melde mich“, war meine Standardantwort und ich gab mir keine Rechenschaft, dass ich das nicht tun würde. Ich hatte eine „Telefonblockade“[xxxv], wie ich das nannte, welche mich daran hinderte, zum Telefon zu greifen, wenn ich das nicht absolut musste. Solche Gründe konnten beruflicher Natur sein oder irgendeine Sache, die dringend erledigt werden musste. Meistens habe ich auch die Anrufe von Freunden und Bekannten, welche eine Nachricht hinterliessen, pflichtgemäss beantwortet. Aber einfach anrufen und etwas ausmachen, fürs Kino oder ein Abendessen, oder einfach um zu schwatzen, das konnte ich nicht. Aber wie „Beziehungsangst“ war auch „Telefonblockade“ ein Begriff, den ich zwar sehr wohl für mein Verhalten gebrauchte, welcher aber bei mir nichts auslöste, schon gar nicht bewusste Angst. Es war eine Worthülse für ein Verhalten, welches jedoch eine immense Tragweite hatte. Nur spürte ich das nicht. Es gab zwar Momente, in welchen mir die Gesellschaft einer Freundin fehlte und ich so etwas wie Sehnsucht verspürte, aber irgendwie ging auch das vorüber. Ich konzentrierte mich auf die Auseinandersetzung mit meiner Krankheit und suchte nach einem Weg, diese zu verstehen und unter Kontrolle zu bringen. Das gelang aber nicht so leicht.
Anders verhielt es sich mit der „Telefonangst“, welche dadurch entstand, dass mich Freunde oder Bekannte anriefen und längere Zeit sich mit mir unterhielten. Nach einer gewissen Dauer begann ich fürchterlich zu schwitzen, verlor die Stimme und hatte andere Symptome extremen Stresses. Dann bekam ich irgendeinmal Panik und musste das Gespräch notfallmässig beenden. Die Angst, welche zweifellos hinter dem Stress stand, habe ich nie bewusst wahrgenommen und damit auch keine Verbindung zu einer Ursache herstellen können.
Ich hatte die typischen Symptome der Krankheit, Muskelsteifigkeit, Bewegungsarmut, manchmal ein leichtes, in gewissen Situationen auch stärkeres Zittern und Schwierigkeiten zu sprechen[xxxvi]. Letzteres behinderte mich am meisten. Ich hatte einen Beruf als Berater, in welchem meine Hauptaufgabe darin bestand, zu sprechen. Keine Stimme zu haben, bedeutete soviel wie, das neben dem Gehirn wichtigste Arbeitswerkzeug nicht mehr benützen zu können. Ich war also arbeitsunfähig.
Aber ich war nicht nur arbeitsunfähig, sondern ich war absolut kommunikationsunfähig. Und das traf mich natürlich ganz besonders. Ich war also schon mit Stimme ein Einzelgänger und nicht sonderlich kommunikativ. Aber jetzt war es manchmal einfach unmöglich zu reden, auch wenn ich noch so wollte. Ich hatte schlicht keine Stimme mehr. Es war nicht die Isolation, unter der ich litt, weil ich diese ja (theoretisch) jederzeit durchbrechen konnte. Ich konnte aber nicht, weil ich nicht sprechen konnte. Ich konnte nicht. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meine Stimme. Dazu kam, dass ich durch die Verlangsamung der Bewegungen auch im Schreiben mit der Hand eingeschränkt war. Ich war also nicht nur in der verbalen Kommunikation eingeschränkt. Ich hatte die Kontrolle über meinen Körper weitgehend verloren.
Bewegungsarmut
Alles ging nun etwas langsamer. Auch wenn meine Parkinson-Symptome eher leicht waren, die Verlangsamung der Beweglichkeit machte sich überall bemerkbar. Schon das Anziehen war eine anstrengende Aufgabe. Das Hemd in der Hose zu verstauen, war die erste Hürde. Aber ganz langsam gelang es mir, auch wenn es mehrere Anläufe dazu brauchte, die Hemdstösse um die Hüfte am Körper zu halten und die Hose darüber hochzuziehen. Die Hemdknöpfe schloss ich mit der linken Hand. Nachdem vor allem meine rechte Seite von der Krankheit betroffen war, ging das noch recht gut. Auch die rechte Manschette liess sich noch leicht schliessen, das Schliessen der linken war schon Schwerstarbeit. Aber nach einer Weile und etwas Akrobatik war auch dieser Knopf im Loch. Die Krawatte zog ich langsam und etwas schwerfällig durch die Schlaufe und mit einigem an Verrenkung sass sie schliesslich dort, wo sie hingehörte[xxxvii].
Die Extremitäten machten einfach nicht mehr das, was der Kopf wollte, oder zumindest nicht in dem Tempo, in welchem ich das gewohnt war. Ich war an diesem Tag bei Freunden zum Abendessen eingeladen, zog Jacke und Mantel an, was auch nicht so schnell ging, wie ich das schreibe, und verliess das Haus. Eigentlich war ich heute recht beweglich und meine Schwierigkeit, zu sprechen, machte sich nicht besonders bemerkbar. Das änderte sich aber schon bald im Verlauf des Abends. Ich hatte zwar nichts zu befürchten und man hatte auch Verständnis für meine motorischen Einschränkungen[xxxviii]. Die Gastgeber waren wirklich gute Freunde. Aber trotzdem wurde ich immer unsicherer. Schon beim Aperitif fühlte ich mich angespannt, beengt und blockiert. Ich hatte immer mehr Mühe, mich auszudrücken und meine Stimme wurde immer leiser. Die Spannung stieg und der Stimmverlust wie auch die motorischen Schwierigkeiten wurde immer stärker. Beim anschliessenden Abendessen empfand ich schliesslich sogar das Halten des Bestecks als Anstrengung, nicht zu reden vom Schneiden der Speisen und das Zum-Mund-Führen der Gabel.
Ich erlebte diese Spannung subjektiv offenbar viel stärker, als sie von der Umwelt wahrgenommen wurde. Für mich war das manchmal fast unerträglich und liess erst wieder nach, wenn ich wieder allein war. Es war diese Spannung und die damit zusammenhängende Lähmung, welche ich als Reaktion auf die Angst empfand, auch wenn ich diese Angst nicht spürte. Ich empfand einfach Stress.
Die Bewegungsarmut ist eines von drei oder vier Hauptsymptomen der Parkinson-Krankheit. Damit war meine entscheidende Erfahrung der Krankheit verbunden. Ich erlebte die Einschränkung der Beweglichkeit im Alltag als direkt mit Stress korreliert[xxxix] und mit Angst verbunden, somit als von aussen beeinflusst. Ich erlebte mich viel beweglicher, wenn ich entspannt und gelöst war, was nicht nur beim Alleinsein vorkam. Ich konnte mich auch in Gesellschaft entspannen und mich wieder beweglicher fühlen. Das war aber stets ein längerer Prozess und in der Regel damit verbunden, dass ich mich irgendwie aus dem direkten Kontakt, welcher ein starker Symptomauslöser war, lösen konnte.
Der Dreh beim Parkieren
An diesem Abend konnte ich mich von der Spannung nicht lösen und ich litt unter dem Mangel an Beweglichkeit, welcher sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig auszudrücken schien. Ich war froh, als der Zeitpunkt gekommen war, den Abend zu beenden. Ich ging nach Hause und fühlte mich auch sogleich etwas besser. Die subjektive, manchmal fast panikartige Spannung war wieder weg. Was blieb war ein dumpfes Gefühl der Muskelspannung und ein Zustand der Empfindungslosigkeit oder Leere.
Zu Hause angekommen parkierte ich das Auto rückwärts, wobei ich den Kopf stark drehen musste. Bei dieser Gelegenheit wurde mir bewusst, wie starr ich war. Der Drehradius war stark eingeschränkt und es schmerzte in Nacken und Schulter, wenn ich den Kopf drehte, um durch das Heckfenster zu sehen. Die Starrheit befand sich aber nicht nur in Nacken und Schulter, die Unbeweglichkeit kam aus der Rumpfmuskulatur. Der ganze Körper war versteift und schränkte die Beweglichkeit zusätzlich wesentlich ein. Diese Muskelsteifigkeit ist ein weiteres Hauptmerkmal der Parkinson-Krankheit.
Ich spürte deutlich den Unterschied zwischen der dauernden Spannung in der Muskulatur und jener, welche sich in sozialen Situationen verstärkte[xl]. Im Masse, in welchem ich in den Bewegungen ungelenkiger und langsamer wurde, wenn ich irgendwie exponiert war, verspannte sich auch meine Muskulatur. Das führte zuweilen zu einer ausgeprägten Steifigkeit, welche ich manchmal weniger körperlich, sondern noch fast mehr als psychische Starrheit wahrnahm. Der Muskelkater, welchen ich im Anschluss an solche Momente jeweils hatte, zeugte nicht nur von der Stärke der Verkrampfung, sondern war auch ein direkter Beweis dafür, dass die Verspannung mit der sozialen Situation in Verbindung stand.
Die Steifigkeit der Muskulatur fühlte sich aber auch an, als ob damit ein Schutz entstehen würde. Ich hatte oft den Eindruck, dass die Muskeln sich spannten, um die Lähmung aufzuheben und eine gewisse Beweglichkeit zu erhalten. Die Muskelspannung schien eine indirekte Folge der Angst zu sein. Sie fühlte sich als Reaktion auf die motorische Schwäche an. Es war wie ein Haltemechanismus, welcher mich am Ort hielt, mich davon abhielt zusammenzubrechen, mich aufzulösen.
Die verflixte Kasse
Einkaufen für meine beschränkten Bedürfnisse war keine grosse Sache und ich machte das auch nicht ungern. In Zeiten des starken Rückzuges brachte es mich auch regelmässig unter die Leute, ohne dass ich gross Kontakt aufnehmen musste[xli]. Schwierig wurde es jeweils erst an der Kasse beim Einpacken der Ware, weil ich dabei etwas ungeschickt und daher langsam war. Und das konnte Stress erzeugen, vor allem, wenn andere Leute nachfolgten und der Raum am Ende des Rollbandes wieder gebraucht wurde. Meine Langsamkeit und Ungeschicklichkeit wurde da leicht zur Belastung. Und ich war anfänglich nicht in der Lage, andere Leute um Hilfe zu bitten. Das schaffte ich erst viel später in meinem Krankheitsprozess.
Doch da war vorher noch etwas, was mich wesentlich mehr störte und wofür ich zu diesem Zeitpunkt noch kaum Hilfe in Anspruch nehmen konnte, nämlich beim Bezahlen. In der rechten Hand hielt ich meine Brieftasche und nahm mit der linken Hand die Banknote heraus. Ich reichte sie der jungen Dame[xlii], wobei die rechte Hand, welche die Brieftasche hielt, und der rechte Unterarm zu zittern begannen. Wenn ich den Arm nicht streckte, mit der linken Hand hielt oder aufstützte, entstand ein Schütteln, welches meine Krankheit unübersehbar machte und welches mir sehr unangenehm war. Ich fühlte mich exponiert, begann zu schwitzen und empfand deutlich Stress. Kaum war ich aber aus der exponierten Stellung heraus, war das Zittern wieder weg. Das war eine alltägliche Erfahrung, welche sich in den verschiedensten Situationen wiederholte. Das Auffällige daran war der Umstand, dass das Zittern mit einer inneren Erregung verbunden war und in der Regel damit zu tun hatte, dass ich beobachtet wurde oder zumindest annahm, dass dies der Fall war. Auch wenn ich dabei keine Angst empfand, hatte ich den Eindruck, dass solche daran beteiligt war. Aber ich hatte keine Ahnung, wovor ich Angst hatte.
Obwohl das Zittern ein Hauptsymptom der Parkinson-Krankheit ist, kommt es nicht in allen Fällen vor. Ich war davon nicht stark betroffen und erlebte das Zittern nicht nur im Zusammenhang mit Stress, sondern in Verbindung mit sämtlichen Gegebenheiten, welche etwas mit Gefühl zu tun hatten. Dabei war auch hier ein Unterschied spürbar zwischen dem feinen Zittern im Ruhezustand und den Bewegungen, welche mit Emotionen in Verbindung standen und leicht zu einem Schütteln ausarteten[xliii]. Typischerweise kam das Zittern infolge von Erregung vor, welche in Stresssituationen entstand. Es waren Situationen, in denen ich exponiert oder zum Handeln gezwungen war, wie beim Auftreten vor einer Mehrzahl von Menschen, beim Vortragen, Bezahlen an der Kasse oder in ähnlichen Situationen, bei Überraschungen und Herausforderungen. Es waren Verhältnisse, welche ganz generell geeignet waren, Nervosität oder Lampenfieber, Schreck, Ärger oder Wut und ähnliche Gefühlsreaktionen hervorzurufen. Zittern schien der Ausdruck von Gefühlen zu sein, welche nicht erlebt und daher somatisiert wurden.
Dazu kam ein Schütteln, welches auftrat, wenn die Anspannung nachliess. Es schien in einem ersten Moment dem Zittern ähnlich zu sein, hatte jedoch eine ganz andere Frequenz und offenbar auch eine völlig verschiedene Funktion. Es begann wie bei einem Frösteln mit einem Vibrieren und entwickelte sich zu einem groben Schütteln der betroffenen Körperteile. Ich erlebte dieses Schütteln als äusserst befreiend. Es fühlte sich an, als ob dabei die angestaute Spannung entladen würde. Wenn ich es zulassen konnte und mich so richtig durchschütteln liess, fühlte ich mich anschliessend stets viel wohler, lebendiger – und schliesslich auch beweglicher.
Ich begann also meine Parkinson-Symptomatik als eine somatisierte Form von Angst, Scham und Hilflosigkeit sowie deren Abwehr oder Verarbeitung wahrzunehmen. Es war nicht so, dass mich (nur) die Krankheit hilflos machte. Da war mehr. Ich erlebte die Krankheit selber als Phänomen von Stress und Hilflosigkeit.
Paradoxe Beweglichkeit
Es gab auch Lichtblicke im Alltag der Krankheit, obwohl das nicht so häufig vorkam. Ich war durch die Krankheit und vor allem durch die Sprechproblematik zurückhaltend geworden, gewissermassen schüchtern. Ich ging selten unter die Leute und wenn ich mit anderen Personen zusammen war, sagte ich wenig. Ich ertappte mich aber öfter mal, wie ich in einer angeregten fachlichen Diskussion meine Beschränkungen ablegte, eine feste Stimme hatte, geistig und körperlich beweglich wurde und keine Spur von Blockade vorhanden war. Ich fühlte mich sicher. Ich nahm wahr, dass dies einen Zusammenhang mit meiner beruflichen Kompetenz hatte[xliv]. Auch wenn ich mir dabei vorstellen konnte, dass das Sicherheit verschaffte, reichte es nicht als Erklärung. Denn ich konnte im gleichen Zusammenhang vor vielen Menschen eine Rede halten und anschliessend im Einzelgespräch wieder stimmlos werden, total verstummen, erstarren.
Anderseits kam es aber auch bei Begegnungen mit gewissen Menschen vor, dass in deren Anwesenheit sich die Blockade einfach löste[xlv]. Diese Wirkung hatte eine Kollegin in überaus beeindruckender Weise. Wir standen uns nicht besonders nahe, aber in ihrer Gegenwart fühlte ich mich jeweils schlagartig locker, hatte meine feste Stimme und war ein ganz anderer Mensch. Und das war keineswegs ein Einzelfall. Das wiederholte sich bei jeder Begegnung mit dieser Person. Es musste also etwas mit ihr zu tun haben. Sie war Psychotherapeutin, hatte klare Grenzen und echte Empathie für mich. Ihre Zuwendung war natürlich und authentisch. Sie war daher in keiner Weise eine Gefahr, mir zu nahe zu kommen, was mir wohl den Raum gab, mich selber zu sein. Das wusste ich aber damals noch nicht.
Diese Erfahrung war auch nicht auf diese Kollegin beschränkt. Es gab andere Personen, auf welche ich in gleicher Weise reagierte, auch wenn es vielleicht nicht so häufig vorkam oder nicht so ausgeprägt war. Immerhin ist dabei eine andere Kollegin zu erwähnen, mit welcher ich hin und wieder tanzte, wobei ich mich frei bewegen konnte, solange ich nicht daran dachte, was ich tat. Sobald ich anfing, mich zu beobachten, war ich blockiert. Das war eine Erfahrung, welche mich einerseits verwirrte, anderseits aber die Hoffnung nährte, dass hier Kräfte am Werk waren, welche beeinflusst werden konnten[xlvi]. Es war aber äusserst irritierend, dass ich ja gerade die Beweglichkeit verlor, wenn ich begann, mein Handeln zu beobachten, zu kontrollieren [xlvii].
Ich hatte niemanden zur Hand, der mit dieses Phänomen erklären konnte. Aber ich suchte unentwegt weiter. IBP, die integrative Körperpsychotherapie von Jack Rosenberg, bot dabei viele Hilfsmittel, mein psychisches Funktionieren besser zu verstehen. Ich ging regelmässig jede Woche zur Therapie und besuchte zur Vertiefung von Grundwissen und Selbsterfahrung im Sommer 1996 einen Einführungskurs mit Jack Rosenberg. Bei dieser Gelegenheit setzte der erfahrene Psychologe den Finger direkt auf den wunden Punkt. Ich beschloss, einen Blick zurück zu werfen, um zu sehen, was der Grund dafür war.
Die präklinische Phase
Eine unauffällige Kindheit
Das Auffällige an meiner Kindheit ist das Unauffällige. Die Tatsache, dass ich mich in meiner Kindheit praktisch an nichts erinnere, ist mir früher schon aufgefallen. Nicht dass da keine Bilder wären, nein, die gibt es – wenn auch nicht besonders üppig – von der Familie, der Schule, Kameraden, Elternhaus und vielem mehr. Auffällig ist nur, dass das vereinzelte, in der Regel unbewegte Bilder oder allenfalls kurze Sequenzen sind, dass da kein zusammenhängender Film der Kindheit und Jugend vor dem geistigen Auge abläuft, oft kein Leben, keine Farbe in diesen Erinnerungen steckt[xlviii]. Auch fehlen ganze Sequenzen oder Personen. Irgend etwas musste da also geschehen sein, was mich veranlasst hatte, meine Wahrnehmung abzuschalten. Es war offenbar leichter zu ertragen, gar nicht anwesend zu sein, als die Kindheit und Jugend zu erleben [xlix].
Das ging so weit, dass nicht einmal beim Tod meines Vaters Gefühle und Tränen da waren. Offensichtliche Gründe dafür gab es aber nicht. Ich habe zwar wenige, aber gute Erinnerungen an meinen Vater. Es war der Höhepunkt einer Kindheit ohne bewusste Gefühle und ohne wesentliche Erinnerung. Was da geschehen war, musste viel früher geschehen sein, sehr früh.
Nach dem Tod des Vaters wurde ich in ein Internat gesteckt. Mein anfänglich etwas rebellischer Geist war rasch der herrschenden Ordnung angepasst.[l] Ich mied das Soziale und war an dessen Stelle ein ausgezeichneter Leichtathlet in Einzeldisziplinen[li] wie Hochsprung und Kugelstossen und auch sonst ein Einzelgänger. Und das fiel auch auf, aber keiner hat sich wesentlich darum gekümmert. Es konnte allenfalls noch Anlass für Neckereien sein, aber damit hatte es sich.
Einzelkämpfer
Dem Einzelgängersein Symptomcharakter zuschreiben zu wollen, mag auf den ersten Blick an den Haaren herbeigezogen zu sein. Dennoch, der Einzelgänger vermeidet die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und ist eine Form des Rückzuges. Ich selber empfand mein isoliertes Dasein zwar grundsätzlich nicht als krankhaft. Im Internat habe ich viel dafür getan, allein sein zu können. Neben der individuellen sportlichen Betätigung habe ich Musik gespielt, Sprachen gelernt und andere Spezialkurse besucht und selten die Gesellschaft anderer gesucht. An der Universität vermied ich die traditionellen gesellschaftlichen Anlässe und Einrichtungen, pflegte wenig Kontakt mit den Kommilitonen und ging meine eigenen Wege. Ich war kein Freund der Geselligkeit, suchte keinen Verein auf, machte bei keiner Verbindung mit, drückte mich um den Militärdienst, hielt mich von Politik fern und fühlte mich am wohlsten allein[lii]. Im Beruf schliesslich beschränkte ich die Kontakte auf das Professionelle und verbrachte das wenige an freier Zeit allein. Sogar in die Ferien ging ich in der Regel allein. Typisch war für mich, dass ich die Gesellschaft meiner Freunde auf Nachfrage oder Einladung schätzte, aber selten suchte. Ich kannte zwar viele Leute, hatte viele Kollegen und einen soliden Freundeskreis. Ich pflegte aber nur wenig engen Kontakt. Ich liess niemanden emotional an mich heran, auch Frauen nicht.
So richtig bewusst war mir diese Isoliertheit damals jedoch nicht. Ich litt vor allem keineswegs darunter oder wenigstens nur selten. Ich hätte als komischer Kauz, schräger Vogel, Sonderling oder sonst etwas Besonderes bekannt sein können, wenn da nicht etwas wäre, was mich auszeichnete. Ich war ein attraktiver junger Mann, intelligent und gebildet, beruflich erfolgreich und dauernd auf Achse. Ich hatte leitende Positionen inne, welche mir viel Unabhängigkeit und Freiheit liessen. Auch war ich im persönlichen Umgang ein angenehmer Kontakt, solange die Beziehung nicht tiefer ging. Ich war ein selbständiger Charakter, welcher mit ausgeprägter Intellektualität das Leben, von aussen gesehen brillant meisterte.
Festung
Ich galt als anspruchsvoll und in der Tat, keine schaffte es, das „Bollwerk“ zu überwinden. Eine Freundin blieb zwar zehn Jahre, und hatte trotzdem kein Glück. Im Kern blieb ich verschlossen, wusste aber nicht warum. Ich musste sie ziehen lassen, auch wenn ich darunter litt, dankbar für die geschenkten Jahre, aber unfähig zu erkennen, was der Grund war, nachdem wir uns liebten und auch grundsätzlich gut verstanden. In diesem Dilemma befand ich, dass es die berühmte „Chemie“ sein müsse, welche doch nicht stimmte[liii]. Dass diese Annahme falsch war und es auch nicht an den Frauen lag, ahnte ich zwar. Ich war aber nicht fähig zu erkennen, was nicht funktionierte und um so weniger, etwas zu verändern.
Böse Zungen behaupteten manchmal, dass ich stets nach einer „Besseren“ Ausschau hielt. Das ärgerte mich, weil ich intuitiv wusste, dass das nicht so war. Ich suchte unbewusst nicht nach einer Besseren, sondern nach einer Frau, welche nicht bedrohlich für mich war. Dass ich dabei immer nach einer Partnerin suchte, welche mir nicht zu nahe kam[liv], gleichzeitig aber die Nähe suchte und damit eine unlösbare Lage schuf, war mir damals nicht bewusst.
Nach dem Studium und den ersten Lehrjahren folgten rund zehn Jahre intensiver beruflicher Tätigkeit, aber ohne feste Beziehung. Ich war in der Lage festzustellen, dass ich an „Beziehungsunfähigkeit“ litt und „Angst vor Nähe“ hatte[lv]. Ich war aber nicht fähig, die Ursache zu erkennen oder daraus Konsequenzen zu ziehen. Vermutlich lag das daran, dass das Leben beruflich und auch privat spannend war und Abwechslung bot. Ich vermisste zwar oft eine feste Beziehung, um vor allem schöne Momente zu teilen. Es bestand aber kein äusserer Zwang, kein Leidensdruck, an meiner Lebensweise etwas zu verändern.
Das Muster
Das Phänomen war jedoch nicht auf Frauen beschränkt. Im ersten Studienjahr verband mich eine recht intensive Freundschaft mit einem Studien-Kollegen. Nach einer Weile machte ich aber eine eigenartige Erfahrung. Ich war ihm gegenüber blockiert und fühlte mich hilflos. Das irritierte mich und ich nahm die psychologische Studentenberatung in Anspruch, was aber weder eine Diagnose noch eine brauchbare Therapie brachte. Die Hilfe blieb aus und ich selber war nicht in der Lage zu erkennen, dass sich hier etwas entwickelte, was mit gefühlsmässiger Nähe verbunden war und das Problem löste sich schliesslich von selber, indem die Verbindung sich lockerte und ich wieder meinen eigenen Weg ging.
Ein paar Jahre später, ich hatte mittlerweile zwei Hochschulabschlüsse in der Tasche, war ich dabei, meine ersten Berufserfahrungen zu machen. Ich hatte bei einer Revisionsfirma angeheuert, konnte mich aber in diesem Berufsmilieu nicht entfalten und fühlte mich nicht wohl. Bücherrevision war Kontrolle und so war auch das Klima in der Firma. Ich verliess diese bereits wieder nach sechs Monaten. Ich widmete mich vorerst der Wissenschaft, schrieb eine Doktorarbeit und entzog mich damit vorderhand jeglicher Aufsicht oder eben der „Kontrolle“, was das auch immer bedeuten mochte.
[...]
[i] In diesem Zitat steckt der Kern dieses Buches. Mark ist überzeugt, dass die Unterdrückung (oder eine inadäquate Verarbeitung) der Emotionen die Entwicklung seines Parkinson beeinflusst hat. Von daher kommt seine Hypothese: die Symptome nehmen ab, wenn man die Emotionen zu gebrauchen oder bewältigen lernt. Auch wenn der Gedanke nicht neu ist, Mark hat die Umstände studiert und hat sie vor allem am eigenen Leib erlebt.
[ii] Der Schreibkrampf kann ein Frühsymptom der Parkinsonkrankheit sein. Jeder Neurologe weiss das. Wenn es aber eher unwahrscheinlich ist, macht er jedoch nicht jeden Patienten auf dieses Risiko aufmerksam. Der Neurologe machte also das Richtige: er behält diese seltene Möglichkeit für sich und beobachtet die weitere Entwicklung.
[iii] Der erste Neurologe beobachtete Mark ohne ihm seine Vermutung mitzuteilen. Erst ein Jahr später, als andere motorische Störungen klar in Erscheinung traten, stellte er seine Diagnose. Man vermeidet damit unnötige Angst vor Pathologien, welche schliesslich nicht eintreten.
[iv] Die Parkinsonsymptome sind wie ein Eisberg: in ihrer Mehrheit unter der Wasseroberfläche tauchen sie langsam auf. Erst wenn die Diagnose sicher ist, darf sie gestellt werden, denn – zur Zeit – gibt es keine vorsorgliche Behandlung und bei jungen Betroffenen, wie Mark, werden die Symptome nicht behandelt, wenn die Einschränkungen geringfügig sind.
[v] Das Vergessen ist eine Form des Schutzes und Mark erzählt später wichtige Vorfälle aus seiner Kindheit: der Tod seines Vaters (das Fehlen der Tränen bedeutet nicht, dass es nicht schmerzt), das Internat mit Mönchen (Einzelgänger in der Menge), hervorragende Schulnoten (¿akademische Kompensation seiner Isolierung?) etc.
[vi] Hier beginnt Mark’s Hypothese: Einzelgänger und ohne Emotionen.
[vii] Und hier geht seine Hypothese weiter: die lähmende Angst.
[viii] Er konkurriert mit andern und sich selber, und zeigt es nicht.
[ix] "Grau, teurer Freund, ist alle Theorie". Die Wissenschaft steht im Gegensatz zum Leben. Kultur gegen Natur. Faust entdeckte es etwas spät und versuchte Abhilfe zu schaffen.
[x] Niemand kann etwas anbieten, was er nicht entwickelt hat. Man müsste uns in der Schule emotionale Hygiene an Stelle von so viel Geografie und Mathematik beibringen.
[xi] Die klassische Metapher der Bildung: Der Wagenlenker zügelt die Leidenschaft der scheu gewordenen Pferde. Mark zieht den Zentauren vor, welcher auch noch über Emotion und Ratio verfügt.
[xii] Ich stelle mir lieber nicht vor, was er in diesem Moment gelitten haben muss. Mark verstand es aber, aus der Not eine Tugend zu machen: er hat gelernt zu kontrollieren und besass, obwohl dies seinen Parkinson verstärken konnte, einen Bildungsvorteil, Kontrolle, Kampf, Überwindung, welche ihm dazu diente, nicht geschlagen zu werden und sich dem Feind zu stellen. Sein Scharfblick erlaubte ihm zu erkennen, dass sein Gegner gleichzeitig ein Teil seines Selbst war, von welchem er sich trennen musste.
[xiii] Ein besonders angenehmes und fruchtbares Abendessen: Mark mischt weise Wissen und Intuition. Und er weiss es mitzuteilen.
[xiv] Ich umschreibe Proust. Aber Mark’s Vorschlag ist besser und ausdrucksvoller.
[xv] Die Scham ist in diesem Zusammenhang eine äusserst originelle Entdeckung von Mark. Sie schliesst die Angst vor der sozialen Reaktion auf das eigene Verhalten ein. Und es gibt nichts, was mehr einschränkt, als davon abhängig zu sein, was andere von uns denken.
[xvi] Die Wut ist ein anderer fundamentaler Schlüssel. Wut ist animalisch und unsozial. Es ist ein Instinkt, welcher auftaucht und über jedem Urteil oder jeglicher Verantwortung vor anderen steht. Das musste im Titel eingeschlossen werden.
[xvii] Mark’s Hypothese beinhaltet therapeutische Vorteile. Er erfuhr an der eigenen Haut, was ihm schadete und wie es besserte, indem er es veränderte. Das Gift meiden, ist die beste Medikation.
[xviii] Der Dialog erinnert mich an jenen zwischen einer Mutter, welche einem Kind mit schlechten Noten Schelte erteilt, weil es vor den Prüfungen verschwiegen hatte, dass es schon seit geraumer Zeit seine Aufgaben dürftig machte. Die ungenügende Note beunruhigt sie zwar auch, aber vor allem stört sie der Umstand, dass sie ihren Schüler nicht überwacht hat. Und Mark folgt ihr im Spiel: ihre Reaktion beunruhigt ihn derart, dass der Parkinson weniger wird und für die beiden Beteiligten die Krankheit in den Hintergrund tritt...
[xix] Hier nennt er einen Schlüssel zur Persönlichkeit, welchen ich bei vielen von Parkinson Betroffenen gesehen habe: eine ausserordentliche Schamhaftigkeit (Scham), sich affektiv überfluten zu lassen, seine Emotionen auszudrücken oder seinen Gemütszustand zu zeigen: man könnte das Kryptothymie nennen (Gemütsverschlüsselung, Stimmungsverheimlichung).
[xx] Ein offensichtlicher Widerspruch: die Parkinsonpersönlichkeiten pflegen die Konkurrenz nicht zurückzuweisen, sondern geniessen sie sogar und kommen daher beruflich vorwärts. Aber hier hatte sich die Rivalität von der beruflichen Plattform auf die zwischenmenschlichen Beziehungen verlagert, und da erlitt Mark Schiffbruch. Aus diesem Grund, in kluger Einsicht, wählte er die selbständige Berufsausübung.
[xxi] Die Meinung anderer Leute zählt weiterhin stark.
[xxii] Das machte der Neurologe gut. Er hat vielleicht bereits einen beginnenden Parkinsonismus gesehen, aber nachdem es keine Prävention gibt, ist es besser, die natürliche Entwicklung abzuwarten.
[xxiii] Was du jetzt schreibst, ist, was du mit Klarheit hättest sagen können: du hast sie auf andere Weise geliebt; ein gutes Team ist nicht dasselbe wie eine gute Partnerschaft. Die Wahrheit befreit uns..., von der emotionalen oder auch verbalen Blockade.
[xxiv] Die Entscheidungsblockade ist ein anderer Aspekt des parkinsonistischen “off”.
[xxv] Mark hat soeben geschrieben, was ich ihn fragen wollte: ob das “Einfrieren” der Entscheidungsfähigkeit den motorischen Blockaden vorausging.
[xxvi] Der Neurologe gab sich Rückendeckung, indem er eine beschreibende Diagnose gab: er sprach von Parkinsonismus, liess aber die Möglichkeit weitergehender Erkrankung offen (das Spastische ist eher piramidal als extrapiramidal).
[xxvii] Hier beginnt eigentlich, was wir die “wirkliche klinische Phase” nennen.
[xxviii] Die Diagnose wäre viel schwieriger zu ertragen gewesen, wenn er sie anderen hätte erläutern müssen.
[xxix] Du hattest völlig recht, psychotherapeutische Unterstützung zu suchen, auch wenn viele Wissenschafter damit nicht besonders einverstanden sind. Ich unterstütze diese Intuition (die Intuition ist eine Abkürzung des Bewusstseins), dass deine Symptome eine gewisse psychogene Basis haben.
[xxx] Dieses Mal hattest du die empirische Bestätigung deiner Arbeitshypothese.
[xxxi] Schön, wie Mark das beschreibt: er ist nicht eine Person ohne Gefühle (in Wirklichkeit hat er zu viele), aber sie sind blockiert: nach innen (ist es schwierig, an die emotionalen Schichten zu kommen) und nach aussen (kann er sie nicht ausdrücken; er spricht zwar mehrere Sprachen fliessend, kommt jedoch im emotionalen Ausdruck ins Stammeln).
[xxxii] Angst vor emotionaler Nähe: eine treffende Definition, für welche eine klingende Bezeichnung zu finden ist. Auf der gleichen Linie liegt die emotionale Unberührtheit (die dauerhafte Undurchdringlichkeit von vielen Parkinsonisten gegenüber Emotionen, mindestens teilweise geprägt durch die Erziehung und Pflege des Kleinkindes: die Parkinsonisten sind wenig gestreichelt worden und diese berühren die anderen nicht besonders häufig, weder physisch noch mental).
[xxxiii] Wie Mark es ausdrückt, ist es mehr als die Angst selber die Form, in welcher sie verarbeitet wird und sich anschliessend als gewöhnliches Verhalten in stressbeladenen Situationen wiederholt: sie wird unterdrückt, vermieden oder bleibt ohne Antwort (Blockade).
[xxxiv] Der “soziale Rückzug” und der Umstand, nicht über die Krankheit zu sprechen, ist nicht spezifisch für die Parkinsonkrankheit. Das machen viele Personen, bei welchen eine chronische Krankheit diagnostiziert wurde, und ziehen es vor, sich „die Wunden allein zu lecken“. Das scheint mir eine normale Reaktion auf das Ungemach zu sein, sogar viel würdiger als das Gegenteil: jene, welche krank werden und dies mehr oder weiniger bewusst mit der Absicht publik machen, Mitleid zu erwecken.
[xxxv] Die Begriffe Telefon- und Sozialblockade sind nützlich, jedoch auch nicht exklusiv bei der Parkinson-Krankheit. Sie sind eine Form der individuellen Antwort auf die Unbill. Die Einsamkeit ist gut, wenn sie als nährend genutzt werden kann. Schopenhauer sagte (¿oder war es Nietzsche?): Eine Person wird immer vulgärer, je mehr sie von anderen abhängig ist.
[xxxvi] Er beschreibt die klassische Triade: Muskelstarre, Beweglichkeitsmangel und Zittern. Die Schwierigkeit mit dem Sprechen, welche ihn (aufgrund des sozialen Echos) stark beschäftigt, pflegt später aufzutreten und ist eine hypokinetische Disarthrie von unterschiedlicher Erscheinung, weil sie Phonation, Prosodie, Artikulation und die Geschwindigkeit oder den Fluss der Worte beeinflusst.
[xxxvii] Jetzt verstehe ich, wie kühl wir Neurologen erscheinen müssen, wenn wir von Hypo- und Bradykinesie sprechen, ohne die Summe der kleinen Tragödien in Rechnung zu stellen, welche Mark so treffend und genau beschreibt, wenn er sich anzieht.
[xxxviii] Das Ambiente ist freundlich, doch das Problem liegt nicht bei den anderen, sondern bei Mark selber, in der übertriebenen Bedeutung, welche er dem Umstand zuschreibt, was sie über ihn denken. Diese „Blockade des sozialen Zusammenseins“ kann mit einer zusätzlichen halben oder ganzen Tablette Levodopa vor der Zusammenkunft beseitigt werden und/oder mit einem einfachen Anxiolytikum.
[xxxix] Stress zerstört Neuronen, das Wichtige aber ist die Art und Weise, wie er verarbeitet wird. Die Parkinsonpersönlichkeiten nehmen den Stress mit erhöhter Intensität wahr und verinnerlichen mehr negative Gefühle vitaler Ereignisse. Die Stressantwort hängt in grossem Mass von den frühen Lebensphasen ab (worauf wir später zurückkommen).
[xl] Die feine und treffende Selbstbeobachtung von Mark erlaubt ihm “normale“ Steifigkeit (mehr organisch) von “sozialer” Starrheit (eher psychogen) zu unterscheiden. Beim Parkieren kommen noch weitere Probleme für den Parkinsonisten dazu: die schlechte visospatiale Integration.
[xli] Einkaufen ist ein guter Trick für den Parkinsonisten: er geniesst die Verbindung mit anderen Leuten in einem freundlichen Umfeld auf oberflächliche Art (alle Verkäufer lächeln), aber ohne gefühlsmässige Vertiefung (seine Kryptothymie verliert ihre Unschuld nicht).
[xlii] Die Frauen an der Kasse lächeln weniger als die Verkäuferinnen und man muss ihnen „die Abrechnung präsentieren“: die Angst, dass die Kreditkarte irrtümlicherweise nicht akzeptiert wird, verstärkt das Zittern.
[xliii] Wir Neurologen sollten diese feinen Beobachtungen von Mark über die Unterschiede im Zittern entsprechend der Umstände zur Kenntnis nehmen. Es könnten Schlüssel zu den pathogenen Ursachen (der beteiligten Mechanismen) sein.
[xliv] Von der beruflichen Kompetenz überzeugt sein, schafft motorische Sicherheit: das sieht man in der Gestik der Führungskraft, welche ein gutes Projekt präsentiert oder in der Unverfrorenheit, mit welcher die guten Fussballer über das Feld dribbeln. Im Parkinsonisten zeigt sich das noch klarer.
[xlv] Es gibt sehr tolerante und sozial flexible Menschen und andere mehr kritische oder “wertende”. Die letzteren sind es, welche dir die Blockaden verursachten.
[xlvi] Du hast völlig recht. Das Kognitive verändert oder beseitigt das Instinktive und wird zum doppelschneidigen Schwert. Es lässt uns daran denken, was uns zum Feigling werden lässt, sagte Shakespeare (die Verwegenheit ist mit der Nachdenklichkeit verkracht). Zu viel Denken lässt den Mittelstürmer einen Penalty verschiessen, weil das viele Denken ihm die Ungezwungenheit aus den motorischen Schaltkreisen nimmt. Und im Gegensatz dazu hast du erraten, dass es der kognitive Einfluss ist, welcher gut angewendet nicht nur den Gang verbessern kann, sondern auch das Zittern und die motorischen Strategien.
[xlvii] Das bekannte Phänomen der paradoxen Kinesie ist komplexer (es sind andere Verbindungen involviert) und gleichzeitig raffinierter und einfacher zu verstehen (es wäre wie eine Übertreibung oder Karikatur von allem, was wir bisher gesagt haben).
[xlviii] Eine Kindheit ohne Dynamik: in Schwarz und Weiss, ohne Streiche und ohne Erinnerungen, die Spuren hinterlassen, harmlos … (Hat sich die emotionale Blockade schon so früh herauskristallisiert?).
[xlix] Gebt mir etwas Unterstützung und … ich werde emotional ein Mensch.
[l] Normen und Regeln sind Ansatzpunkte der Unterstützung, wenn auch künstliche.
[li] Er zeichnet sich in individuellen Disziplinen aus, zeigt jedoch Schwierigkeiten in der Gruppe. Das ist nicht exklusiv für die Parkinson-Krankheit. Genies haben dieses Verhalten auch.
[lii] Vulgäre Leute brauchen die anderen mehr, ihr Selbst löst sich in der Gesellschaft auf. Unabhängig zu sein und fähig zur Einsamkeit, zeichnet hervorragende Leute aus. Viele grosse Werke wurden realisiert, weil ihr Schöpfer sich abzusondern wusste … in freiem Willen (es ist nicht falsch, sich zurückzuziehen, ausser es aus Angst oder Unfähigkeit geschieht, sich gesellschaftlich anzuschliessen, wenn man Lust dazu hat).
[liii] Die “Chemie” impliziert, dass etwas vorhanden war, bereit, um „zu reagieren“. Mark schien wie ein “Edelmetall oder Edelgas”: Gold ist ein “edles” Element und Neon ist ein “edles” Gas, weil sie mit anderen nicht reagieren. Sie oxidieren nicht.
[liv] "Die Frauen sind unser bester Sauerstoff” würde ein Macho sagen. Klar, dass der Sauerstoff „oxidiert“ und ein Risiko darstellt. Man kann nicht von einer Beziehung verlangen, dass sie nicht eng und für die individuelle Integrität nicht „bedrohlich“ sei (im Guten oder Schlechten). Es gibt eine gewisse „emotionale Schizophrenie“ oder etymologisch „Schizothymie“.
[lv] Er spricht eher von seiner emotionalen Phobie als von einer Sozialphobie (Mark ist eine der in Gesellschaft korrektesten Personen, die ich kenne).
- Arbeit zitieren
- Mark Peter Hurni (Autor:in), 2007, Parkinson: Die verlorene Wut, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/194046
Kostenlos Autor werden






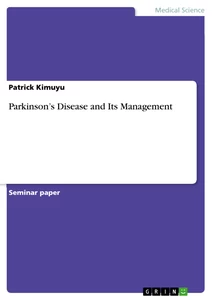




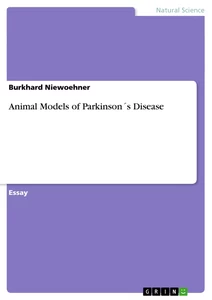


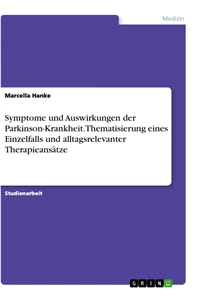







Kommentare