Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definitionen / Methodik / Fragestellung / Relevanz
2.1 Definition
2.2 Theoretische Vorüberlegungen
2.2.1 Föderalismusmodelle
2.2.2 Politikverflechtung
2.2.3 Strukturbruchhypothese
2.2.4 Dynamischer Föderalismus
2.3 Fragestellung
3. Der Länderfinanzausgleich 1949 bis zur Wiedervereinigung
3.1. Vorentscheidungen im Parlamentarischen Rat
3.2 Bis 1969
3.3 Die Finanzreform von 1969
3.4 Systematik des prä-Vereinigungsfinanzausgleich
3.4.1 Vertikale Steuerverteilung
3.4.2 Horizontale Steuerverteilung
3.4.2.1 Verteilungsprinzipien
3.5 Zwischenfazit
4. Der Länderfinanzausgleich seit der Wiedervereinigung
4.1 Die Einheit
4.1.1 Die Verhandlungen
4.1.2 Das (Zwischen-) Ergebnis
4.1.3 Bewertung der Ergebnisse
4.2 Die Integration der „neuen“ Länder in den Finanzausgleich
4.2.1 BVerfGE von 1992
4.2.2 Reformüberlegungen der Bundesländer
4.2.3 Die Meinung des Bundes
4.3 Die Verhandlungen und der Verlauf
4.4 Das Verhandlungsergebnis
4.5. Bewertung
4.6 Die Reform von 2001
4.6.1 Reformverlangen der Geberländer
4.6.2 BVerfGE 1999
4.6.3 Verhandlungsverlauf
4.7 Der Finanzausgleich und der Solidarpakt II als Ergebnis
4.7.1 Das Maßstäbegesetz
4.7.2 Der Finanzausgleich
4.8 Zwischenfazit
5. Schlussbemerkungen
6. Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Das ist schon ein schwachsinniges System “, „Das System ist ungerecht! “ „So kann es nicht weitergehen “, diese drei Zitate süddeutscher Politiker charakterisieren deutlich die Meinung über den Länderfinanzausgleich innerhalb der Bundesrepublik. Der Länderfinanzausgleich, wenngleich selten Gegenstand breiter öffentlicher politischer Debatte, ist nichtsdestotrotz eine der großen Dauerkontroversen der deutschen Politik. Aber wo kommt er her, warum gibt es ihn, wie ist er ausgestaltet und welche Zukunft hat er. All diesen Fragen soll in dieser Arbeit nachgegangen werden. Aufgezogen wird dabei ein Gemälde, das die historische Entwicklung des deutschen Finanzausgleichs nachzeichnet.
Die Arbeit beginnt mit einem methodischen Teil, in dem die theoretischen, definitorischen und untersuchungs-prozessualen Bedingungen dargestellt und vorgestellt werden. Dabei wird am Rande auch die umfängliche Literatursituation zum Thema Länderfinanzausgleich dargestellt. Die wesentliche theoretische Annahme zur Basis dieser Arbeit, die zudem die nachstehenden Äußerungen leitet, ist die Annahme, dass es eine historisch konsistente Pfadabhängigkeit gibt; diese herauszuarbeiten, wird in den nachfolgenden Abschnitten vorgenommen.
Die vorliegende Arbeit greift im dritten Teil bezüglich des Finanzausgleichs weit zurück, hier wird die Vor- und Frühgeschichte des Finanzausgleichs beschrieben. Vielfach wurde der deutsche Finanzausgleich als „spezifisch deutsch“, „kompliziert“ und chaotisch beschrieben. Die Zusammenfassung der Meinungen gipfelt in dem Professorenwitz: „Es gibt nur zwei Leute, die den deutschen Länderfinanzausgleich verstanden haben, der eine ist tot und der andere redet nicht darüber.“ Diese humoristische Zusammenfassung trifft das Problem im Kern, der Rückgriff auf die Vorgeschichte zeigt allerdings auch, dass das hohe Maß an Komplexität des deutschen Ausgleichs einer historischen Traditionslinie folgt. So wird deutlich, dass der Finanzausgleich in allen seinen Facetten eine Tradition hat, die um einiges älter ist als die Bundesrepublik. Deutlich wird dabei auch, dass die Debatteninhalte, die Vorbehalte und Einwände der Akteure, die Kritik und die Reformdebatte einer historischen Tradition folgen, die nicht 1949 begann, sondern in der Konstruktion und den spezifischen Eigenheiten der deutschen Geschichte begründet ist. Der Schwerpunkt der Arbeit wird jedoch darauf liegen, die Entwicklungen des Ausgleichs in der Bundesrepublik nachzuzeichnen, dabei geht es um die Entwicklung zwischen 1949 und 1969, die Zeit bis zur Wiedervereinigung und nach der Einheit. dies ist der wesentliche Inhalt der nachfolgenden Teile. Abschließend wird ein Ausblick auf aktuelle Herausforderungen gegeben, vor denen der föderalistische Finanzausgleich steht. Dabei wird auf die unvollendete Föderalismusreform II eingegangen, aber auch darauf, wie vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Integration ein Konstrukt wie der föderalistische Finanzausgleich leistungsfähig und effizient erhalten werden kann. In der abschließenden Zusammenfassung werden die Inhalte der vorliegenden Abschnitte zusammengefasst und der Versuch eines Transfers auf aktuelle Herausforderungen wird unternommen.
2. Definitionen / Methodik / Fragestellung / Relevanz
In diesem Abschnitt wird erklärt, was in vorliegender Arbeit unter Finanzausgleich verstanden wird. Dabei wird insbesondere erklärt, welche Schwerpunkte im Einzelnen im Aufbau gelegt werden.
2.1 Definition
Der Begriff Finanzausgleich wird in der Literatur unterschiedlich umfassend verwendet. Die umfassendste Definition versteht darunter die Verteilung der Aufgaben, der mit diesen Aufgaben verbundenen Lasten (Ausgaben) sowie der zu ihrer Finanzierung nötigen Einnahmen zwischen rechtlich selbständigen Körperschaften, die eine eigene Finanzwirtschaft führen. Diese sehr weite Begriffsbestimmung macht deutlich, dass Finanzausgleiche für sehr unterschiedliche Körperschaften eine Rolle spielen, so etwa für Kirchen und Sozialversicherungsträger ebenso wie für die Gebietskörperschaften - Staat und Kommunen im Einheitsstaat; Zentralstaat, Gliedstaaten und Kommunen im Bundesstaat (Baretti, 2001, S. 30 ff.). Daneben lässt sich ein internationaler Finanzausgleich zwischen unabhängigen Staaten abgrenzen, der zwischenstaatlich erfolgt oder als supranationaler Finanzausgleich von internationalen Organisationen ausgeht (vgl. Hausner, 2003, S. 8). Für Deutschland gewinnt dabei der Finanzausgleich innerhalb der Europäischen Union zunehmend an Bedeutung (vgl. Häde 1996).
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem föderalistischen Finanzausgleich. Im Bundesstaat kommt dem Finanzausgleich zwischen Bund und Gliedstaaten eine herausragende Bedeutung zu. In der Diskussion über den deutschen Bundesstaat werden daher mit dem Begriff Finanzausgleich meist die Finanzausgleichsbeziehungen zwischen Bund und Ländern angesprochen, während die zwischen Ländern und Kommunen unter dem Terminus kommunaler Finanzausgleich diskutiert werden. Dieser Verwendung des Begriffes Finanzausgleich folgt auch vorliegende Arbeit.
Mit der Eingrenzung auf die hier zu betrachtenden Finanzausgleichspartner ist jedoch noch nicht die Frage geklärt, welche Bereiche der komplexen Beziehungen zwischen Bund und Ländern zum Finanzausgleich zu rechnen sind. Weit gefasste Definitionen, wie sie vor allem die Finanzwissenschaft verwendet, beziehen die Verteilung der staatlichen Aufgaben und Finanzierungslasten (passiver Finanzausgleich) sowie die Verteilung der Finanzmittel (aktiver Finanzausgleich) mit ein (vgl. Häde, 1996, S. 4; Hausner, 2003, S.
6). Diese Definition betont die Wechselbeziehungen zwischen Aufgaben-, Ausgaben- und Einnahmenverteilung.
Dies ist für das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit jedoch zu umfassend, da in diesem Fall die Gestaltung sämtlicher Finanzbeziehungen und der gesamten Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern mit einbezogen werden müsste. Daher wird hier auf eine engere Definition abgestellt, welche die Aufgaben- und Ausgabenverteilung als gegeben ansieht und sich auf das Problem konzentriert, wie die öffentlichen Einnahmen zwischen Bund und Ländern verteilt werden sollen. Diese Begriffsverwendung bezieht sich auf die in Art. 106 und 107 GG geregelten Materien und umfasst damit sowohl die vertikale Dimension (Ertragsverteilung zwischen Bund und Ländern sowie distributive Zuweisungen des Bundes an die Länder) als auch die horizontale Dimension (Ertragsverteilung zwischen den Ländern und Umverteilung im Länderfinanzausgleich). In vorliegender Arbeit soll mit dem Begriff Finanzausgleich demnach die Verteilung öffentlicher Einnahmen, primär der Erträge der Gemeinschaftssteuern, auf Bund und Länder sowie die darauf aufbauende Übertragung von Finanzierungsmitteln von finanzstarken Ländern und vom Bund auf finanzschwache Länder bezeichnet werden. Die Aufgabenverteilung und die Ausgabenzuordnung werden in dieser Arbeit nicht als Teil, sondern als Voraussetzung des Finanzausgleichs angesehen, da sie den Finanzbedarf der Gebietskörperschaften bestimmen. Als solche werden sie in dieser Arbeit nur in ihren Grundzügen vorgestellt.
2.2 Theoretische Vorüberlegungen
An dieser Stelle sollen die grundlegenden Theorien zum Föderalismus dargestellt werden, diese bilden die Basis für die Entwicklung der Fragestellung, die es in dieser Arbeit zu beantworten gilt.
2.2.1 Föderalismusmodelle
Zentrales Merkmal bundesstaatlicher Ordnungen ist die Aufteilung der exekutiven und legislativen Gewalt auf den Bund und die Gliedstaaten, wobei beide über eigenständige Staatsgewalt und somit über einen jeweils nur ihnen eigenen Entscheidungsbereich verfügen. So sind in Deutschland die Länder nicht bloß Verwaltungsuntergliederungen oder Selbstverwaltungskörperschaften, sondern echte Staaten „mit eigener - wenn auch gegenständlich beschränkter - nicht vom Bund abgeleiteter, sondern von ihm anerkannter staatlicher Hoheitsmacht“ . Diese staatliche Eigenständigkeit von Bund und Ländern verlangt, dass beide Ebenen über eine Finanzausstattung verfügen, die es ihnen ermöglicht, ihre staatlichen Aufgaben sachgerecht zu erfüllen (Kilper & Lhotta, 1996, S. 63 ff.). Die Verteilung finanzieller Ressourcen entscheidet letztlich darüber, inwieweit Bund und Länder die ihnen formal zustehenden Kompetenzen zur aktiven politischen Gestaltung nutzen können. Die bundesstaatliche Finanzordnung beeinflusst damit in erheblichem Maße die Machtbalance zwischen Bund und Ländern und somit die tatsächliche Struktur des föderalistischen Staatswesens (vgl. Kesper 1998, S. 38-40). Die Föderalismustheorie unterscheidet idealtypisch zwei Modelle des Föderalismus: den interstaatlichen und den intrastaatlichen Föderalismus. Das Modell des interstaatlichen Föderalismus (Trennföderalismus) beruht auf ausgeprägter Autonomie von Bund und Gliedstaaten, die sich besonders durch einen dualistischen Staatsaufbau und eine Trennung der Kompetenzen nach Politikfeldern verdeutlicht. Normativ ist die Wahrung der Eigenstaatlichkeit und der damit verbundenen Vielfalt der Lebensbedingungen die leitende Zielvorstellung.
Dagegen setzt der intrastaatliche Föderalismus (Verbundföderalismus) auf eine funktionale, arbeitsteilige Aufgabenverteilung, so dass die staatlichen Ebenen zur Erfüllung ihrer Aufgaben intensiv miteinander kooperieren müssen. Dieses Modell ist am Ziel der Integration durch möglichst einheitliche Lebensbedingungen ausgerichtet. In der Realität liegen alle Bundesstaaten zwischen diesen beiden idealtypischen Modellen, wobei sich sowohl stark dezentral organisierte Bundesstaaten - etwa die Vereinigten Staaten von Amerika - als auch ausgeprägt zentralistisch strukturierte föderative Systeme - z.B. Österreich - ausmachen lassen. In Deutschland ist ein ausgeprägter Verbundföderalismus anzutreffen. Zentral ist dafür die funktionelle Kompetenzverteilung des Grundgesetzes, die dem Bund einen Großteil der Gesetzgebungskompetenzen zuweist, während die Länder weitgehend für die Verwaltung zuständig sind. Ergänzend hierzu ist die Finanzverfassung Deutschlands vergleichsweise stark zentralistisch konzipiert (vgl. Renzsch, 2000, S. 50-54).
2.2.2 Politikverflechtung
Das Zusammenwirken der staatlichen Ebenen im kooperativen Föderalismus wurde von der sozialwissenschaftlichen Forschung seit den 1970er-Jahren intensiv untersucht. Prägend waren dabei besonders die Arbeiten Fritz W. Scharpfs: Seine 1976 veröffentlichte Theorie der Politikverflechtung (vgl. Scharpf u.a., 1976) ist bis heute die einflussreichste Theorie zum deutschen Föderalismus. Entwickelt wurde sie in Auseinandersetzung mit den Barrieren, die das politisch-administrative System Reformpolitiken entgegensetzt (vgl. Wachendorfer-Schmidt, 2003, S. 18). Diese Theorie versucht, Ursachen und Folgen der Politikverflechtung, d.h. der kooperativen Problemverarbeitung im Verbund mehrerer Gebietskörperschaften, akteurszentriert zu erklären, wobei das Verhalten der Akteure mit spieltheoretischen Annahmen modelliert wird. Die Hauptursache der Politikverflechtung wird darin gesehen, dass fragmentierte, das bedeutet dezentrale Entscheidungssysteme neben dem Vorteil regional angepasster Politiken das Problem aufweisen, dass aufgrund von Interdependenzen und der Existenz externer Effekte die durch das Gesamtsystem produzierte soziale Wohlfahrt nicht optimal ist. Politikverflechtung stellt eine Lösung dieses Problems dar, da hier die Interessen aller Beteiligten in die Entscheidung einfließen und die interdependenten Probleme kooperativ bearbeitet werden können. Das zentrale Problem verflochtener Entscheidungssysteme ist der hohe Konsensbedarf. Dieser hängt von der Entscheidungsstruktur und der Interessenkonstellation ab und steigt in der Regel mit zunehmender Zahl an Entscheidungsbeteiligten. Um bei Interessendivergenzen dennoch zu einer Einigung zu kommen, können verschiedene Strategien eingesetzt werden. Wichtig sind hierbei vor allem solche, die an der Gestaltung der Entscheidungsverfahren und der Entscheidungsregeln ansetzen. So kann versucht werden, die Zahl der Entscheidungsbeteiligten zu verringern oder durch Segmentierung von Entscheidungen die Entscheidungsalternativen zu reduzieren. Besonders bedeutsam sind inhaltliche Entscheidungsregeln wie Strukturerhaltung, Gleichbehandlung, Besitzstandswahrung, Konfliktvertagung oder Eingriffsverzicht (vgl. Scharpf u.a., 1976, S. 54-65).
Den Kern der Politikverflechtungstheorie macht die Prognose aus, dass angesichts der Interessengegensätze der Akteure die Konfliktwahrscheinlichkeit im deutschen Verbundföderalismus sehr hoch ist und nur suboptimale, innovationshemmende Politikergebnisse erreicht werden, die am Status quo orientierte Minimalkompromisse darstellen. Die Politikverflechtungstheorie zeigt darüber hinaus auf, wie die beteiligten Akteure aufgrund institutioneller Eigeninteressen von der Politikverflechtung profitieren. Daher befindet sich das Verbundsystem in der „Politikverflechtungsfalle“ und damit in einer Entscheidungsstruktur, die „systematisch ... ineffiziente und problem- unangemessene Entscheidungen erzeugt, und die zugleich unfähig ist, die institutionellen Bedingungen ihrer Entscheidungslogik zu verändern“ (Scharpf, 1985, S. 350).
2.2.3 Strukturbruchhypothese
Eine andere Begründung für die gleiche Diagnose - Blockadetendenzen im Bundesstaat - bietet die von Gerhard Lehmbruch 1976 erstmals vorgestellte These des Strukturbruchs zwischen Parteiensystem und Bundesstaat aufgrund unterschiedlicher Konfliktregelungsformen dieser beiden Subsysteme. Er untersuchte dazu, wie sich das Verhältnis beider tragenden Elemente des politischen Systems Deutschlands seit dem wilhelminischen Kaiserreich entwickelte. Dabei stellte er fest, dass im föderalistischen System zentrale Merkmale der institutionellen Konstruktion der Bismarck’schen Verfassung bis heute überdauerten und dass im Bundesstaat weiterhin Aushandeln das dominante Konfliktregelungsmodell darstellte (vgl. Lehmbruch, 1976, S. 16). Das Parteiensystem aber war nach dem Zweiten Weltkrieg von einer Konzentrationstendenz gekennzeichnet, die von einem konkurrenzdemokratischen Vielparteiensystem immer stärker hin zu bipolarer Konkurrenz führte (vgl. Wachendorfer-Schmidt, 2003, S. 37). Die Konkurrenzdemokratie des Parteiensystems fand jedoch ihre Grenze in den Aushandlungszwängen des Bundesstaates, wodurch Lehmbruch die wesentlichen Vorteile des Parteienwettbewerbs - Verantwortlichkeit der Regierungspolitik und Innovationspotential - und damit letztlich die Legitimation des Parteienwettbewerbs gefährdet sah. Die zunehmende Verflechtung von Bund und Ländern verstärkte diese Problematik noch, da dadurch die Gefahr von Blockaden zunahm und das Innovationspotential der föderalistischen Ordnung reduziert wurde (vgl. Lehmbruch, 1976, S. 160).
So wie Scharpf und Lehmbruch kritisiert eine breite Strömung der politikwissenschaftlichen Forschung die Politikverflechtung, die für Blockadetendenzen, Innovationsstau, Ineffizienzen und Legitimationsdefizite durch Einschränkung der Einflussmöglichkeiten der Parlamente (vor allem der Landtage) verantwortlich gemacht wird. Die Entwicklung des deutschen Bundesstaates wird weitgehend als eine Geschichte zunehmender Verflechtung und Unitarisierung angesehen. Einige Autoren äußern sogar Zweifel, ob Deutschland überhaupt noch als föderalistisches System angesehen werden kann.
2.2.4 Dynamischer Föderalismus
Zu einer deutlich positiveren Einschätzung des deutschen Föderalismus kommt dagegen die Theorie des dynamischen Föderalismus von Arthur Benz (1985). Benz kritisiert, dass die Forschung sich zu sehr mit den formalen Strukturen beschäftigt, ohne das empirisch beobachtbare Verhalten der Akteure innerhalb dieser Strukturen angemessen zu berücksichtigen (vgl. Benz, 1993, S. 466 f.). Mit Lehmbruch teilt Benz die Diagnose, dass es Inkompatibilitäten zwischen den Entscheidungsprinzipien der auf Verhandlungen der Exekutiven beruhenden föderalen Arena und der vom Majoritätsprinzip strukturierten parteipolitischen Arena gibt. In diesem durch vielfältige Kooperationszwänge geprägten komplexen Verhandlungssystem (Benz 2003, S. 206) nehmen die Akteure eine besondere Stellung ein, die mehrere Rollen innehaben, durch die sie verschiedenen Ebenen und unterschiedlichen Arenen angehören.
Benz zeigt, dass die Akteure die „Dilemmata kollektiven Handelns in der Politikverflechtung“ (Benz 2003: 214) wahrnehmen können und über ein großes Repertoire an Handlungsstrategien verfügen, mit denen sie Blockaden vermeiden können. Er betont, dass die Akteure neben den bereits von der Politikverflechtungsstrategie herausgearbeiteten auch Strategien einsetzen können, welche die institutionellen Rahmenbedingungen von Verhandlungsprozessen verändern. Dies sind zwar selten formelle Strukturänderungen, da diese - wie von der Politikverflechtungstheorie gezeigt - meist durch Vetos der von Einflussverlust Betroffenen verhindert werden. Doch können viele informell festgelegte Interaktionsregeln verändert werden, womit es möglich ist, formelle Entscheidungsstrukturen zu ergänzen oder zu unterlaufen. Mögliche Strategien sind hier etwa die Informalisierung von Verhandlungen oder die von Benz als besonders konstruktiv bewertete Ebenenverlagerung.
Dabei werden Verhandlungen innerhalb der Entscheidungshierarchie von Exekutiven auf eine höhere Ebene (um durch die Bündelung von Themen Paketlösungen zu erzielen) oder auf eine niedrigere Ebene (um Verhandlungen bei stark polarisierten oder ideologisch aufgeladenen Themen zu versachlichen) verlagert (vgl. Benz 2003: 221 f.). Benz sieht auf Grundlage des konkreten Akteursverhaltens in Mehrebenenstrukturen prinzipiell „eine hohe Eigendynamik und beträchtliche Flexibilität“ (Benz 1995: 98) gegeben. Da die Gesellschaft so komplex und dynamisch ist, dass ökonomische, soziale und politische Prozesse nicht langfristig geplant und gesteuert werden können, sind für eine wirksame Modernisierung von Strukturen nicht groß angelegte Reformen geeignet. Stattdessen müssen die Akteure die Interaktionsstrukturen und Institutionen flexibel und schrittweise an sich wandelnde Rahmenbedingungen anpassen (vgl. Benz 1985). Die Leistung des deutschen Föderalismus hinsichtlich dieser prozessualen Anpassungsfähigkeit bewerten Benz und Hesse dabei in einer internationalen Vergleichsstudie positiv (vgl. Hesse/Benz 1990).
2.3 Fragestellung
Das Thema vorliegender Arbeit ist die Entwicklung des föderalistischen Finanzausgleichs. Die Vereinigung wiederum stellte den Finanzausgleich vor große Herausforderungen, weswegen darauf ein besonderes Augenmerk gelegt wird; denn mit dem Beitritt der äußerst finanzschwachen ostdeutschen Länder veränderten sich die Rahmenbedingungen, die den Finanzausgleich in der alten Bundesrepublik prägten, grundlegend. In der Arbeit soll untersucht werden, wie Bund und Länder auf diese Herausforderungen reagierten, wie die Prozesse der Entscheidungsfindung abliefen und welche Ergebnisse dabei erzielt wurden. Dabei lassen sich aus den oben vorgestellten Föderalismustheorien zwei gegensätzliche Thesen über die Fähigkeit des politischen Systems, die durch die Vereinigung umfangreicher gewordenen Probleme des Finanzausgleiches zu lösen, formulieren.
Nach der Theorie der Politikverflechtung ist zu erwarten, dass im vereinigten Deutschland Einigungen im Finanzausgleich kaum zustande kommen können: Einerseits nahm die Zahl der Entscheidungsbeteiligten zu, andererseits vertieften sich auch die Interessengegensätze zwischen den Akteuren. Beide Entwicklungen zusammen verstärken der Politikverflechtungstheorie zufolge die Tendenzen zur Selbstblockade des politischen Systems. Eine Einigung über Reformen des Finanzausgleichs ist danach sehr unwahrscheinlich, zumal sie angesichts der Finanzschwäche der neuen Länder Umverteilungen zu deren Gunsten vorsehen müssten, Umverteilungsprobleme aber wegen der institutionellen Eigeninteressen der Akteure in der Politikverflechtung nicht befriedigend bearbeitet werden können (vgl. Scharpf u.a. 1976: 236). Für den Finanzausgleich lässt sich daraus die Erwartung ableiten, dass konsensuale Entscheidungen nicht zustande kommen, der Status quo der Finanzausgleichsregelungen auch nach der Vereinigung weitgehend erhalten bleibt, die Bewältigung der Probleme der neuen Länder in erster Linie dem Bund zufällt und damit ein ausgeprägter Zentralisierungsschub verbunden ist (vgl. Hesse/Renzsch 1991: 34-36).
Aus Sicht der Theorie des dynamischen Föderalismus ist dagegen zu erwarten, dass der wachsende Problemdruck dazu führte, dass die Akteure dank Kommunikations- und Lernprozessen durchaus in der Lage sein werden, in Verhandlungen zu tragfähigen Konsensentscheidungen zu kommen (vgl. Benz 1991a). Somit wäre zwar keine radikale Reform des Finanzausgleichssystem zu erwarten, doch könnten die Regelungen in kleinen Schritten an die veränderte Situation angepasst werden. Diese beiden Thesen sollen an der tatsächlichen Entwicklung des Finanzausgleichssystems und der dort zu beobachtenden Charakteristika der Verhandlungsprozesse überprüft werden. Im Einzelnen liegen der Untersuchung der Entscheidungsprozesse folgende Leitfragen zugrunde:
1) Streitfragen:
Welche Regelungselemente des Finanzausgleichs waren inhaltlich historisch besonders umstritten? Welche Positionen vertraten die Akteure und wie wurden die Forderungen begründet? Inwiefern sind diese Interessenlagen historisch konsistent?
2) Interessenkonstellation:
Welche Interessen verfolgten die nationale und die subnationale Ebene in den jeweiligen Verhandlungen? Welche Bündnisse gab es?
3) Entscheidungsstruktur:
Wie waren die Verhandlungen strukturiert? Welche Institutionen waren im Entscheidungsprozess maßgeblich? Wurden die Entscheidungen respektiert und akzeptiert?
4) Ergebnis:
Welche Regelungen wurden beschlossen? Wie bewerteten die Akteure selbst die Ergebnisse? Welche finanziellen Auswirkungen hatte die jeweilige Regelung - wer waren die Gewinner, wer die Verlierer der gewählten Lösung? Wurde eine sachgerechte Lösung, gerade auch für die spezifischen Probleme der neuen Länder, gefunden?
Von Interesse ist ferner die Frage, welche Auswirkungen die Gestaltung des Finanzausgleichs auf das Machtverhältnis zwischen Bund und Ländern und damit auf die föderale Ordnung insgesamt hatte. Dabei wird die gesamte Thematik in ihrer Spezialisierung in die historische Dimension des Länderfinanzausgleichs eingebettet.
3. Der Länderfinanzausgleich 1949 bis zur Wiedervereinigung
3.1. Vorentscheidungen im Parlamentarischen Rat
In den Beratungen des Parlamentarischen Rats war zwar nicht die föderative Ordnung Deutschlands als solche - die auch von den alliierten Besatzungsmächten in den Frankfurter Dokumenten ausdrücklich gefordert wurde -, aber doch ihre konkrete Ausgestaltung heftig umstritten. Dabei ging es nicht nur darum, über welche Institution (Bundesrat oder Senat) die Mitwirkung der Länder organisiert werden sollte. Strittig waren zwischen Unitariern und Föderalisten auch die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern und vor allem die Finanzverfassung.
Das Grundgesetz weist in der Gesetzgebung dem Bund eine zentrale Rolle zu, indem es zwar eine Kompetenzvermutung zugunsten der Länder äußert, zugleich aber in sehr umfassenden Aufzählungen für fast alle bedeutenden Materien die ausschließliche oder konkurrierende Gesetzgebungskompetenz oder die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes festlegt. Der Bundesgesetzgeber machte, durch die weitgehend wirkungslosen Beschränkungsklauseln der konkurrierenden Gesetzgebung nicht gehindert, im Laufe der Zeit von diesen Kompetenzen sehr umfassend Gebrauch (vgl. Laufer/Münch 1998: 128), so dass heute nur noch wenige Materien, insbesondere Kultur, Polizeirecht sowie Landes- und Gemeindeverfassungsordnung, ausschließliche Regelungsbereiche der Länder sind. Anders sieht die Kompetenzverteilung für die Verwaltung aus: Art. 83 GG legt fest, dass Bundesgesetze im Regelfall von den Ländern in eigener Angelegenheit ausgeführt werden. Dabei steht dem Bund lediglich ein Aufsichtsrecht zu, er kann also den Ländern keine Weisungen erteilen. Grundsätzlich sind beim landeseigenen Vollzug auch die Behördeneinrichtung und die Regelung des Verwaltungsverfahrens Sache der Länder. In der Praxis nutzt der Bund jedoch in erheblichem Umfang die Möglichkeit, hier selbst tätig zu werden (vgl. Dästner 2001), womit allerdings das gesamte betroffene Bundesgesetz zustimmungspflichtig wird (vgl. Hömig 2003: 523f.). In deutlich weniger Bereichen gibt es dagegen die Auftragsverwaltung, bei der dem Bund ein direktes Weisungsrecht gegenüber den Länderbehörden zusteht.
Bundeseigene Verwaltungen gibt es nur für wenige eng umgrenzte Bereiche (vgl. Laufer/Münch 1998: 136). Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern wird daher als funktional bezeichnet: Die Gesetzgebung erfolgt im großen Umfang durch den Bund, wobei aber die Landesregierungen im Bundesrat ausgeprägte Mitwirkungsrechte haben. Der Vollzug ist in erster Linie Aufgabe der Länder.
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) fungiert im deutschen Bundesstaat als „föderativer Konfliktschlichter“ (Laufer/Münch 1998: 112), der im Wege der abstrakten Normenkontrolle die Vereinbarkeit von Rechtsnormen mit dem Grundgesetz überprüft und bei Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bundesorganen, zwischen Bund und Ländern oder auch unter den Ländern angerufen werden kann.
3.2 Bis 1969
Aufgabe der Finanzverfassung ist es, die Verteilung der Ausgabenverantwortung und Einnahmen zu regeln. Das Grundgesetz enthielt in seiner ursprünglichen Fassung zwar keine explizite Regelung der Lastenverteilung, implizit war aber eine Entscheidung für die Aufgabenkonnexität enthalten: Bund und Länder finanzierten ihre jeweiligen Aufgaben selbst (vgl. Pagenkopf 1981: 163). Ausgenommen davon waren allerdings die Aufwendungen für Kriegsfolgen und Sozialversicherungszuschüsse, die dem Bund zugeordnet waren. Hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz ordnete Art. 105 GG den Großteil aller Steuern - ausgenommen waren Verbrauchs- und Verkehrssteuern mit örtlich begrenztem Wirkungskreis - der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes zu. Die Regelung der Ertragshoheit über diese Steuern war im Parlamentarischen Rat sehr umstritten. Die dort favorisierte Lösung, die Aufteilung der Steuererträge auf Bund und Länder einem einfachen Bundesgesetz zu überlassen, wurde von den Besatzungsmächten abgelehnt, die eine größere finanzielle Selbständigkeit der Länder forderten (vgl. Geske 2001a: 38).
Der letztlich erzielte Kompromiss etablierte als Provisorium ein unvollständiges Trennsystem, indem die Steuererträge der verschiedenen Steuern zwar eindeutig entweder dem Bund oder den Ländern zugeordnet wurden, zugleich jedoch der Bund Anteil an einigen Ländersteuern beanspruchen konnte. Bis Ende 1952 sollte die Steuerverteilung dann endgültig geregelt werden. Im Einzelnen wurden dem Bund die Erträge von Zöllen und Finanzmonopolen, die Verbrauchssteuern außer der Biersteuer, die Beförderungs- und die Umsatzsteuer zugewiesen. Die Länder und Gemeinden erhielten die Erträge der Einkommens-, Körperschafts-, Vermögens- und Erbschaftssteuern, der Verkehrssteuern außer der Beförderungs- und Umsatzsteuer sowie der Realsteuern und der Steuern mit örtlich bedingtem Wirkungskreis. Die großen, ertragreichen Steuern (die Umsatz-, die Einkommens- und die Körperschaftssteuer) wurden also auf Bund und Länder verteilt. Jedoch sprach Art. 106 Abs. 3 GG (1949) dem Bund das Recht zu, Anteile der Einkommens- und Körperschaftssteuer zu beanspruchen. Da der Bundeshaushalt durch Kriegsfolge- und Soziallasten erheblich belastet war, nahm der Bund dieses Recht von 1951 an in Anspruch, indem er zunächst 27 Prozent, ab 1953 bereits 38 Prozent des Aufkommens dieser Steuern vereinnahmte (vgl. Pagenkopf 1981: 165 f.). Somit etablierte die Finanzverfassung des Grundgesetzes keineswegs, wie vielfach behauptet, ursprünglich ein Trennsystem, sondern sah von Beginn an Verbundelemente in der Steuerverteilung vor. Das Grundgesetz ermöglichte ferner, dass der Bund aus den Steuern der Länder Zuweisungen an steuerschwache Länder vornehmen konnte, um deren Leistungsfähigkeit zu sichern und unterschiedliche Ausgabenbelastungen der Länder auszugleichen (Art. 106 Abs. 4 GG (1949)). Auf dieser Basis führte das Länderfinanzausgleichsgesetz von 1951 einen horizontalen Ausgleich zwischen den Ländern ein, der allerdings mit einem Volumen zwischen 160 und 272 Mio. DM pro Jahr in den Jahren 1950 bis 1954 einen geringen Umfang und nur eine schwache Umverteilungswirkung hatte (vgl. Pagenkopf 1981: 168 f.). Das Bundesverfassungsgericht erklärte diesen horizontalen Finanzausgleich 1952 für verfassungsmäßig und führte aus, dass die finanzstärkeren Länder durch das bundesstaatliche Prinzip zu Hilfen für die finanzschwächeren Länder verpflichtet sind (vgl. BVerfG 1952).
Nachdem die Frist zweimal verlängert worden war, konnten sich Bund und Länder 1955 über die vom Grundgesetz geforderte endgültige Regelung der Steuerverteilung einigen. Im Wesentlichen wurde die bisherige Aufteilung bestätigt. Die wichtigste Änderung bestand darin, dass Einkommens- und Körperschaftssteuer zu gemeinschaftlichen Steuern wurden, für die im Grundgesetz eine feste Aufteilung zwischen Bund und Ländern, zunächst im Verhältnis eins zu zwei, festgeschrieben wurde (vgl. Pagenkopf 1981: 179 f.). Zudem wurde eine Revisionsklausel eingeführt, die den gleichmäßigen Anspruch von Bund und Ländern auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben als Grundsatz für eine flexible Anpassung der Aufteilungsquoten festlegte. Das Finanzverfassungsgesetz schrieb zugleich in Art. 107 GG einen horizontalen Finanzausgleich vor, der einen angemessenen Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Ländern sicherstellen sollte. Als Kann-Bestimmung wurden Ergänzungszuweisungen des Bundes benannt, die allerdings erst 1967 zum ersten Mal gewährt wurden (vgl. Pagenkopf 1981: 186).
3.3 Die Finanzreform von 1969
Die Finanzreform von 1969 stellte „den bisher gravierendsten Eingriff in die bundesstaatliche Ordnung“ dar (Laufer/Münch 1998: 210). Für die schon vorher entwickelten Formen der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern wurde dadurch eine klare verfassungsrechtliche Grundlage geschaffen. Zugleich wurde die Möglichkeit des Bundes, mit finanziellen Zuweisungen einzelne Länder zu beeinflussen, eingeschränkt (vgl. Geske 2001a: 43-48). Der Anstoß zu dieser Reform kam von den Ländern, die den Trend zur Zentralisierung von Aufgaben skeptisch betrachteten, zugleich jedoch wegen ihrer begrenzten finanziellen Ressourcen mit vielen Aufgaben überfordert waren. Maßgebliche Vorarbeit für die Finanzreform leistete eine Sachverständigenkommission, die nach ihrem Vorsitzenden als Troeger-Kommission bezeichnet wurde. Mit den Gemeinschaftsaufgaben, der gemeinsamen Bildungsplanung sowie der Forschungsförderung wurden Instrumente geschaffen, die klare Regeln für finanzielle Beteiligungen des Bundes an Aufgaben der Länder festlegten und dem Gedanken der gemeinsamen Planung staatlicher Tätigkeit verpflichtet waren (vgl. Boldt 1992: 145-153). Mit der Föderalismusreform von 1969 wurde für viele Aufgabenbereiche des Staates ein „institutionelles und prozedurales Zusammenwirken von Bund und Ländern“ (Schneider 1992: 242) festgeschrieben.
Im Bereich der Steuerertragsverteilung setzte sich die Entwicklung zu einem Verbundsystem fort, indem die Umsatzsteuer in den Steuerverbund einbezogen wurde. Die Gemeinschaftssteuern umfassten damit etwa zwei Drittel des gesamten Steueraufkommens (vgl. Pagenkopf 1981: 256), das restliche Drittel entfiel auf die weiter auf Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilten anderen Steuern. Damit sollte die Einnahmenentwicklung von Bund und Ländern gleichmäßiger gestaltet werden, da Einkommens- und Körperschaftssteuer auf der einen, Umsatzsteuer auf der anderen Seite sehr unterschiedliche Dynamiken aufweisen und verschieden stark auf konjunkturelle Schwankungen reagieren (vgl. Geske 2001a: 45 f.). Um die vertikale Steuerverteilung flexibel an sich ändernde Rahmenbedingungen anzupassen, werden die Anteile der Umsatzsteuer durch einfache Bundesgesetze festgelegt, während Einkommens- und Körperschaftssteuer seit der Finanzreform zwischenBund und Ländern hälftig geteilt werden. Auch die Gemeinden sind dabei in diesen Steuerverbund einbezogen, indem sie von der Einkommenssteuer einen bestimmten Anteil des Gesamtaufkommens bekommen. Im Gegenzug müssen sie einen Teil der Gewerbesteuer an die Länder abführen. Im Übrigen sichert das Grundgesetz den Gemeinden das Recht zur Selbstverwaltung zu, was auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit voraussetzt (Art. 28 Abs. 2 GG).
Für den Finanzausgleich sehr bedeutsam war auch die Neufassung des Art. 107 GG im Zuge der Finanzreform, da damit die bis heute geltende finanzverfassungsrechtliche Grundlage des Finanzausgleichs geschaffen wurde. Art. 107 GG legt ein mehrstufiges Finanzausgleichsverfahren fest. Die weitere Entwicklung des Finanzausgleichs vollzog sich im einfachgesetzlichen Bereich durch die jeweiligen Finanzausgleichsgesetze. In den 1980er-Jahren entzündeten sich heftige Auseinandersetzungen um die Verteilung der Bundesergänzungszuweisungen, da diese nicht mehr mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Länder übereinstimmte. Einer vorwiegend parteipolitisch zusammengehaltenen Koalition der davon begünstigten Länder mit der Bundesregierung gelang es jedoch, Anpassungen zu verhindern. Die Ausgrenzung der SPD-regierten Länder aus den Finanzausgleichsverhandlungen sowie die Benachteiligung durch die Ergebnisse veranlassten schließlich mehrere Länder, einen Normenkontrollantrag zu stellen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte 1986 Teile des Finanzausgleichsgesetzes für verfassungswidrig und nahm dabei eine umfassende Interpretation der grundgesetzlichen Bestimmungen vor, durch die es wesentliche Grundsätze für den Finanzausgleich feststellte.
Da die SPD-Länder wiederum von den Verhandlungen um das 1987 beschlossene neue Finanzausgleichsgesetz ausgeschlossen waren und sich einige Länder weiterhin benachteiligt fühlten, gab es erneut mehrere Normenkontrollanträge zu dem Gesetz. Diese Verfahren liefen zum Zeitpunkt der Einheit noch.
3.4 Systematik des prä-Vereinigungsfinanzausgleich
Nachdem nun ein knapper Überblick über die Entwicklung der Finanzverfassung und des Finanzausgleichs gegeben wurde, soll im Folgenden dargestellt werden, wie der Finanzausgleich zum Zeitpunkt des Beitritts konzipiert war. Zugleich werden dabei allgemeine Charakteristika des deutschen Finanzausgleichssystems vorgestellt. Ziel des Finanzausgleichs ist, allen Ländern eine angemessene Finanzausstattung sicherzustellen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Darin kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtsdas „bündische Prinzip des Einstehens füreinander“ (BVerfG 1986: 386) zum Ausdruck. Die Bedeutung des Finanzausgleichs wird deutlich, wenn man berücksichtigt, dass die Ausgaben der Länder durch die Aufgaben, die ihnen in Bundesgesetzen zugewiesen werden, in großen Teilen feststehen, die Länder aber wegen der fehlenden Kompetenz zur Steuergesetzgebung kaum über die Möglichkeit verfügen, ihre Einnahmendirekt zu erhöhen (vgl. Lensch 1994: 105).
3.4.1 Vertikale Steuerverteilung
Auf der ersten Stufe des Finanzausgleichs ist die Verteilung der Umsatzsteuer die zentrale Stellschraube. Das Grundgesetz legt fest, dass Bund und Länder in der Umsatzsteuerverteilung gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben haben (Art. 106 Abs. 4 Nr. 1). Die Verteilung orientiert sich am Bedarf von Bund und Ländern. In der Praxis wurde sie mit dem Deckungsquotenverfahren berechnet, bei dem für Bund und Länder jeweils das Verhältnis von laufenden Einnahmen und notwendigen Ausgaben berechnet wird. Die Umsatzsteuer soll so verteilt werden, dass die Deckungsquoten annähernd gleich sind; wenn sie sich auseinanderentwickeln, soll das Aufteilungsverhältnis neu festgesetzt werden (Art. 106 Abs. 4). Was wie eine eindeutige Regelung aussieht, war tatsächlich heftig umstritten: Bund und Länder waren sich bereits über die Definition der Begriffe „notwendige Ausgaben“ und „laufende Einnahmen“ nicht einig. Die jeweilige Aufteilung der Umsatzsteuer war daher Ergebnis des politischen Prozesses und als solches „nur bedingt durch die sachlichen Notwendigkeiten, im übrigen aber durch machtpolitische Gegebenheiten, parteipolitische Konstellationen und durch das Verhandlungsgeschick der jeweiligen Vertreter bestimmt“ (Kesper 1998: 242). 1990 erhielten der Bund 65 Prozent und die Länder 35 Prozent des Umsatzsteueraufkommens (vgl. Korioth 1991: 1050).
3.4.2 Horizontale Steuerverteilung
Die horizontale Steuerverteilung stellt die zweite Stufe des Finanzausgleichs dar, auf der gemäß Art. 107 Abs. 1 GG das ihnen insgesamt zustehende Steueraufkommen zwischen den Ländern aufgeteilt wird.
3.4.2.1 Verteilungsprinzipien
Die Verteilung des Steueraufkommens soll möglichst entsprechend der wirklichen Steuerkraft der Länder - und damit ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit - erfolgen (BVerfG 1986: 392). Wie bei den landeseigenen Steuern gilt für die Einkommens- und Körperschaftssteuer daher grundsätzlich das Prinzip des örtlichen Aufkommens, d.h., den Ländern steht zu, was von den Finanzbehörden auf dem Gebiet des jeweiligen Landes vereinnahmt wird. Bei der Körperschafts- und der Lohnsteuer führt dies jedoch zu Verzerrungen, da große Unternehmen mit Betriebsstätten in mehreren Ländern diese Steuern meist zentral am Sitz des Unternehmens entrichten. Um dem entgegenzuwirken, wird das örtliche Aufkommen für diese Steuern zerlegt, wobei für die Körperschaftssteuer das Betriebsstättenprinzip, für die Lohnsteuer dagegen das Wohnsitzprinzip Anwendung findet (vgl. Carl 1995: 34 f.). Die Umsatzsteuer kann dagegen nicht sinnvoll nach dem örtlichen Aufkommen verteilt werden, da dieses aufgrund der Erhebungstechniken stark schwankt. Die Umsatzsteuer wirkt als allgemeine Verbrauchssteuer und müsste gemäß der Konsumkraft der Bewohner der Länder verteilt werden, was jedoch mangels Daten nicht möglich ist. Daher wird die Umsatzsteuer entsprechend der Einwohnerzahl verteilt, indem die Einwohnerzahl als Hilfsmaßstab für die regionale Steuerkraft verwendet wird (vgl. Carl 1995: 40 f.). Zugleich beinhaltet diese Regelung einen abstrakten Bedarfsmaßstab, nämlich die „gleichmäßige Pro-Kopf-Versorgung mit öffentlichen Gütern“.
4.3.2.2 Umsatzsteuervorwegausgleich
Auf der Stufe der horizontalen Steuerverteilung ist der sogenannte Umsatzsteuervorwegausgleich angesiedelt. Das Grundgesetz legt fest, dass bis zu einem Viertel des gesamten Umsatzsteueraufkommens der Länder von der einwohnerzahlbezogenen Verteilung ausgenommen und als Ergänzungsanteile besonders steuerschwachen Ländern zugewiesen werden kann (Art. 107 Abs. 1 GG). Das FAG von 1987 setzte dies um, indem Länder, deren Steuereinnahmen (eigene Steuern und Anteile an den Verbundsteuern) unter 92 Prozent des Länderdurchschnitts liegen, diese an 92 Prozent fehlenden Beträge als Ergänzungsanteile erhielten. Mehrere detaillierte Zusatzregelungen stellten sicher, dass insgesamt auf dieser Stufe kein steuerschwaches Land weniger erhielt, als es bei einer reinen Verteilung nach Einwohnerzahl bekommen hätte, und kein steuerstarkes Land nach dem Umsatzsteuervorwegausgleich unter dem Länderdurchschnitt lag (vgl. Carl 1995: 45 f.).
4.3.2.3 Länderfinanzausgleich im engeren Sinne
Der Länderfinanzausgleich bildet als dritte Stufe den Kern und zweifelsohne den zwischen den Ländern am stärksten umstrittenen Teil des Finanzausgleichssystems. Er soll gemäß Art. 107 GG einen angemessenen Ausgleich der unterschiedlichen Finanzkraft der Länder herstellen und bezieht sich demnach auf die Einnahmeseite und strebt grundsätzlich einen Ausgleich der Einnahmen pro Einwohner an. Dabei werden teilweise jedoch auch besondere Bedarfe berücksichtigt. Der Länderfinanzausgleich setzt auf den vorherigen Stufen auf: Die den Ländern im horizontalen Steuerkraftausgleich zugewiesenen Steuermittel gelten im Länderfinanzausgleich als eigene Einnahmen der Länder.
4.3.2.3.1 Finanzkraftermittlung: Gemeinde und Lasten
Anders als der Umsatzsteuerausgleich setzt der Länderfinanzausgleich nicht an der Steuerkraft, sondern an der Finanzkraft an. Unterdurchschnittliche Steuereinnahmen allein stellen noch keine ausreichende Begründung für Ausgleichszuweisungen dar, da sie durch andere Einnahmen der Länder möglicherweise ausgeglichen werden können (vgl. Carl 1995: 51).
Stattdessen muss die finanzielle Leistungsfähigkeit der Länder möglichst umfassend beurteilt werden. Um den Finanzausgleich durchführen zu können, wird für jedes Land eine Finanzkraftmesszahl berechnet, die die Summe aller zu berücksichtigenden Einnahmen darstellt.
Welche Einnahmen dies im Einzelnen sein sollen, war zwischen den Ländern stets umstritten. Zum Zeitpunkt der Vereinigung wurden im Wesentlichen die landeseigenen Steuern sowie die Einnahmen der Länder aus den Gemeinschaftssteuern, der Spielbankabgabe und der Förderabgabe einbezogen. Streitig war auch, in welchem Umfang die Einnahmen der Gemeinden einbezogen werden sollten, da Art. 107 Abs. 2 die Berücksichtigung von Finanzkraft und Finanzbedarf der Gemeinden vorschreibt. Die zum Zeitpunkt der Vereinigung geltende Regelung legte fest, dass die Gemeindeeinnahmen nur hälftig eingerechnet wurden und dabei nur die Realsteuern sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer berücksichtigt wurden. Die Einnahmen aus den Realsteuern wurden nicht nach ihrem tatsächlichen Aufkommen, sondern mit normierten Hebesätzen berechnet, um Verzerrungen durch die unterschiedliche Höhe der Hebesätze auszugleichen (vgl. Carl 1995: 57-61). Wenngleich in die Ermittlung der Finanzkraft im Grundsatz nur die Einnahmen einfließen und keine Bedarfselemente einbezogen werden sollten, gab es hiervon eine Ausnahme: Sonderbelastungen für Unterhaltung und Erneuerung von Seehäfen wurden vom BVerfG als „traditioneller Bestandteil“ des Länderfinanzausgleichs anerkannt (BVerfG 1986: 400) und durften daher bereits bei der Berechnung der Finanzkraftmesszahl von den Einnahmen Bremens, Hamburgs und Niedersachsens mit bestimmten Pauschalbeträgen abgezogen werden (vgl. Carl 1995: 61 f.).
4.3.2.3.2 Ausgleichsmesszahl
Der Finanzkraftmesszahl (als Maß der Einnahmen) wird die Ausgleichsmesszahl (als Maß des Einnahmen-Solls) gegenübergestellt. Sie setzt sich aus den getrennt berechneten Messzahlen zum Ausgleich der Landessteuern und der Gemeindesteuern zusammen. Dabei wird im Grundsatz jeweils die Summe der Einnahmen aller Länder mit dem Anteil des jeweiligen Landes an der Gesamtbevölkerung multipliziert. Allerdings wurden im bei der Vereinigung geltenden Finanzausgleich besondere Gewichtungen der Einwohnerzahlen vorgenommen. Bei der Berechnung der Ausgleichszahlen für die Gemeindesteuern wurden die Einwohnerzahlen der Gemeinden je nach Gemeindegröße aufgewertet. Die ersten 5.000 Einwohner einer Gemeinde wurden einfach (100 Prozent), weitere Einwohner mit höheren Sätzen bis hin zu 130 Prozent für eine 500.000 überschreitende Einwohnerzahl gewertet.
Bei Großstädten kamen zudem noch Aufschläge je nach Einwohnerdichte hinzu. Grundlage dieser die Finanzansprüche der Länder steigernden Wertungen ist die Überlegung, dass mit steigender Einwohnerzahl der Pro-Kopf-Bedarf des öffentlichen Aufwands steigt.
Bei den Ausgleichsmesszahlen für die Landessteuern kommt die sogenannte Einwohnerveredelung für die Stadtstaaten zur Anwendung: Die Einwohner Bremens und Hamburgs wurden mit 135 Prozent gewertet, während alle übrigen Länder nur ihre tatsächliche Einwohnerzahl einbringen konnten. Beide Länder verteidigten dieses auch als Stadtstaatenprivileg bezeichnete Verfahren mit Verweis auf ihre besondere Rolle als Ballungszentrum ohne Umland, deren Pro-Kopf-Bedarf größer als in den Flächenstaaten ist. Geberländer, so etwa Baden-Württemberg in seinem Normenkontrollantrag 1983, kritisierten die Einwohnerwertung der Stadtstaaten dagegen unter anderem mit Verweis auf finanzwissenschaftliche Erkenntnisse, die die Gültigkeit des Brecht/Popitz’schen Gesetzes bezweifelten. Das BVerfG bestätigte jedoch in seinem Urteil von 1986 die Einwohnerwertungen, wobei es allerdings dem Gesetzgeber auftrug, zu prüfen, ob eine höhere Einwohnerdichte tatsächlich Mehrbedarfe auslöse (vgl. Geske 2001a: 137 f.).
4.3.2.3.3 Ausgleichstarif
Übersteigt die Ausgleichsmesszahl eines Landes seine Finanzkraftmesszahl, hat es als finanzschwaches Land Anspruch auf Ausgleichszuweisungen. Deren Höhe errechnete sich vor der Einheit nach einem gestaffelten Ausgleichstarif. Danach wurde der Betrag, der einem Land fehlte, um eine Finanzkraftmesszahl in Höhe von 92 Prozent der Ausgleichsmesszahl zu erreichen, komplett, der Betrag, der von 92 Prozent bis zu 100 Prozent fehlte, jedoch nur zu 37,5 Prozent ausgeglichen. Somit wurde sichergestellt, dass ein finanzschwaches Land mindestens 95 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft der Länder erreichte. Die Ausgleichsbeiträge mussten die Länder aufbringen, deren Finanzkraftmesszahl die Ausgleichsmesszahl überstieg. Im Regelfall wurden dabei die Beträge, die über 110 Prozent der Ausgleichsmesszahl lagen, komplett einberechnet, die Beträge zwischen 102 und 110 Prozent der Ausgleichsmesszahl nur zu 70 Prozent, während Beträge zwischen 100 und 102 Prozent als sogenannte „tote Zone“ nicht berücksichtigt wurden. Die so ermittelten Beträge wurden mit einem einheitlichen Prozentsatz abgeschöpft, der so gewählt wurde, dass die Ausgleichsbeiträge den Ausgleichszuweisungen entsprachen. Reichten die Beträge dazu nicht aus, wurde der Bereich zwischen 102 und 110 Prozent mit einem höheren Satz belastet, und schließlich wurden auch Finanzkraftbeträge zwischen 100 und 102 Prozent der Ausgleichsmesszahl ausgleichspflichtig (vgl. Carl 1995: 65 f.). An diese Berechnung der Ausgleichssätze schloss sich nun mit der sogenannten Ländersteuergarantie des Art. 10 Abs. 3 FAG ein äußerst kompliziertes Verfahren an. Danach sollten finanzschwache Länder mindestens 95 Prozent, finanzstarke Länder mindestens 100 Prozent der „Ländersteuerkraft“ erreichen, die ohne Einnahmen der Gemeinden berechnet wurden. Somit sollte ein Mindestausgleich sowie ein Überforderungsschutz auf Basis der Einnahmen, über die die Länder tatsächlich verfügen konnten, garantiert werden.
4.3.2.4 Bundesergänzungszuweisungen
Im System des Finanzausgleichs folgt auf den Länderfinanzausgleich als letzte Stufe noch ein vertikales Element in Form von Ergänzungszuweisungen des Bundes. Grundlage hierfür ist Art. 107 Abs. 2 GG, der den Bund ermächtigt, leistungsschwachen Ländern Zuweisungen „zur ergänzenden Deckung ihres allgemeinen Finanzbedarfs“ zu gewähren. Indem diese an der Leistungsschwäche ansetzen, sind sie nicht nur an der Einnahmensituation der Länder orientiert, sondern können zusätzlichen Bedarf berücksichtigen, der auf besonderen Belastungen beruht. Da die Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) die Steuerverteilung und den horizontalen Finanzausgleich lediglich ergänzen, nicht aber ersetzen sollen, war ihr Volumen auf eine bestimmte Quote des Umsatzsteueraufkommens begrenzt, die ab 1987 bei zwei Prozent lag. Vom Gesamtvolumen wurden Sonderlasten durch Vorabbeträge abgegolten, der Rest stand für finanzkraftorientierte Zuweisungen zur Verfügung.
[...]
- Arbeit zitieren
- Philipp Wiese (Autor:in), 2012, Entscheidungsprozesse im föderalen Finanzausgleich der Bundesrepublik Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/192251
Kostenlos Autor werden
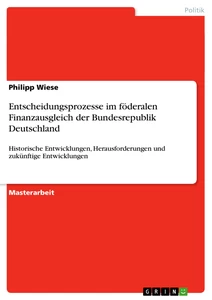
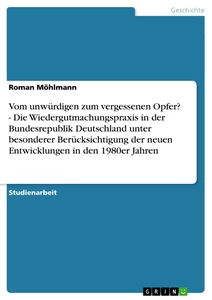



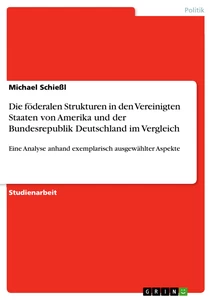
















Kommentare