Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung: Die Pluralisierung des Parteiensystems und ihre Auswirkungen auf den Föderalismus in Deutschland
2. Die Probleme des deutschen Föderalismus aus theoretischer Perspektive
2.1. Gerhard Lehmbruch: „Parteienwettbewerb im Bundesstaat"
2.1.1. Handlungslogiken
2.1.2. Die Entwicklung der Handlungslogiken seit dem Deutschen Reich
von 1871
2.1.3. Die Entwicklung der Handlungslogiken in der Bundesrepublik Deutschland
2.1.4. Der Bundesrat im Parteienwettbewerb
2.1.5. Die Pluralisierung der Parteien und die Strukturbruchthese
2.2. Fritz W. Scharpf: Die Politikverflechtung
2.2.1. Der Begriff der „Politikverflechtung"
2.2.2. Der Weg zur Politikverflechtung
2.2.3. Probleme der Politikverflechtung und Lösungsversuche der Föderalismusreform I
2.2.4. Die Auswirkungen der Pluralisierung der Parteien auf die Politikverflechtung
3. Föderalismus in Deutschland
3.1. Föderalismus als Organisationsprinzip
3.2. Funktionsweise des Föderalismus in Deutschland
3.2.1. Das Verhältnis von Bund und Ländern
3.2.2. Die Gesetzgebung von Bund und Ländern
3.2.3. Der Bundesrat
3.2.4. Der Vermittlungsausschuss
3.3. Zusammenfassung
4. Bestandsaufnahme - Der Wandel des deutschen Parteiensystems seit 1945
4.1. Die Pluralisierung der Parteien auf Bundesebene
4.1.1. Phase der Formierung zwischen 1949 und 1953
4.1.2. Konzentrationsphase 1953 bis 1976
4.1.3. Transformationsphase 1976 bis 1990
4.1.4. Zentripetale Phase 1990 bis heute 40 4.1.5. Zusammenfassung
4.2. Pluralisierung der Parteien auf der Ebene der Bundesländer
4.2.1. Allgemeine Entwicklung der Parteiensysteme der Bundesländer seit 1945
4.2.2. Sonderentwicklungen
4.2.3. Zusammensetzung der Landtage in 2009
4.2.4. Zusammenfassung
5. Analyse der Auswirkungen der Pluralisierung des Parteiensystems auf den deutschen Föderalismus
5.1. Die Pluralisierung des Parteiensystems und die Länderinteressen
5.2. Die Auswirkungen der Pluralisierung auf die Institutionen
5.2.1. Der Bundestag
5.2.2. Die Landesparlamente
5.2.3. Der Bundesrat
6. Fazit: Die Auswirkungen der Pluralisierung des Parteiensystems auf den deutschen Föderalismus
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung: Die Pluralisierung des Parteiensystems und ihre Auswirkungen auf den Föderalismus in Deutschland
Ausgangsproblem dieser Untersuchung stellt das Parteiensystem Deutschlands dar. Dieses hat sich seit den 1980er Jahren gewandelt und stärker ausdifferenziert. Nach einer langen Phase der Konzentration auf drei in den Parlamenten von Bund und Ländern vertretenen Parteien von 1960 bis 1980, folgte eine Phase der Dekonzentration im Parteiensystem. Dies hing mit dem Einzug der Grünen seit den späten 1970er Jahren in die Landesparlamente und 1983 in den Bundestag und dem Hinzukommen der SED-Nachfolgepartei PDS, die sich seit der Fusion mit der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) 2007, in DieLinke umbenannt hat, zusammen. Seitdem bildete sich fast durchgängig ein Fünfparteiensystem in Bund und Ländern aus. Damit veränderten sich zum einen die Machtpositionen der beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD durch den erhöhten Wettbewerb um die Wähler und die Verteilung der Stimmen auf mehrere Parteien. Zum anderen veränderten sich dadurch aber auch die Koalitionsmuster. Waren diese während der Konzentrationsphase in Bund und Ländern sehr homogen, so nahm die Variationsbreite seit der Pluralisierung im Parteiensystem zu.[1] Damit verstärkten sich auch die Unterschiede zwischen den Bundesländern, da die Parteiensysteme derzeit von drei (Rheinland-Pfalz, Thüringen) bis hin zu sechs (Bremen, Sachsen) im Parlament vertretenen Parteien reichen. Diese Heterogenisierung der Parteiensysteme läuft entgegen der Tendenz zur Unitarisierung, also der Angleichung der Politiken von Bund und Ländern sowie der Länder untereinander. Die Unitarisierung konnte sich in dem auf drei Parteien konzentrierten Bundesstaat, durch die Homogenität der Koalitionsmuster und Parteiensysteme ausbilden. Doch auch unter diesen Umständen kam es bereits früh zu Kritik an der Unitarisierung und den starken Verhandlungszwängen zwischen Bund und Ländern.[2]
Nun stellt sich die Frage, ob die Veränderungen im Parteiensystem seit den 1980er Jahren Auswirkungen auf den deutschen Föderalismus haben. Dieser Kernfrage soll im folgenden nachgegangen werden.
Dazu werde ich zunächst zwei wesentliche Theorien, Gerhard Lehmbruchs „Parteienwettbewerb im Bundesstaat"[3] und Fritz W. Scharpfs „Politikverflechtungstheorie"[4], zu den Ursachen der Probleme des deutschen Föderalismus vorstellen, um dann im Hinblick auf die Pluralisierung des Parteiensystems eine Einschätzung über die Auswirkungen auf die theoretischen Überlegungen Lehmbruchs und Scharpfs zu geben. Dabei steht in beiden Fällen die Frage im Vordergrund, ob es durch die Pluralisierung zu einer Verschärfung oder einer Relativierung der benannten Probleme kommt (2.1 und 2.2.).
Anschließend werde ich näher auf die Funktionsweise des Föderalismus in Deutschland eingehen und dabei den Bundesrat in den Mittelpunkt stellen (3.). Es folgt ein Überblick über die Entwicklung des Parteiensystems von Bund und Ländern seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und eine aktuelle Bestandsaufnahme der Pluralisierung (4.1. und 4.2.).
In der folgenden Analyse werden zwei Fragen betrachtet. Zum einen werde ich kurz auf die Auswirkungen der Pluralisierung der Parteiensysteme auf die Länderinteressen eingehen (5.1.). Zum anderen werden die Auswirkungen der Pluralisierung auf die Institutionen des Föderalismus untersucht. Hierbei liegt der Fokus auf dem Bundestag, den Landtagen und vor allem dem Bundesrat. Dabei werden die Auswirkungen auf die Entscheidungsprozesse, Stimmverteilung und die Mehrheits- bzw. Koalitionsbildungen näher untersucht (5.2.). Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung in einem Fazit zusammengefasst und im Hinblick auf weitere Reformen bewertet. Dabei geht es um die Frage, ob noch weitere Reformen notwendig sind, oder ob die Pluralisierung des Parteiensystems zu einer Entzerrung der Entscheidungsprobleme beiträgt (6.).
2. Die Probleme des deutschen Föderalismus aus theoretischer Perspektive
2.1. Gerhard Lehmbruch: „Parteienwettbewerb im Bundesstaat"
Eine theoretische Überlegung über die Ursachen für die Probleme des deutschen Föderalismus ist die von Gerhard Lehmbruch entwickelte „Strukturbruchthese". Diese geht davon aus, dass sich die Handlungslogiken der beiden wesentlichen Arenen des deutschen Föderalismus, das Parteiensystem und der Bundesstaat, in unterschiedlicher Weise entwickelt haben und es so zu einer Inkongruenz dieser beiden Arenen gekommen ist. So herrscht in der Arena des Parteiensystems das Modell der Konkurrenzdemokratie und in der Arena des Bundesstaates das Modell des Aushandelns vor.[5] [6] In dieser Inkongruenz sieht er ein Hauptproblem des deutschen Föderalismus.
Im Folgenden werde ich die Handlungslogiken der beiden Arenen näher erläutern. Anschließend stelle ich die Entwicklungen dieser Handlungslogiken im Parteiensystem und im Bundesstaat seit dem Deutschen Reich von 1871 vor. Es folgt ein Überblick über die Probleme die sich daraus in der Bundesrepublik Deutschland ergeben haben, um anschließend einen Ausblick zu geben, inwieweit und aufweiche Weise sich die Pluralisierung der Parteien in Deutschland auf die Handlungslogiken auswirken kann. Die erkenntnisleitende Fragestellung lautet dabei, ob es zu einer Verschärfung oder einer Relativierung der Theorie Lehmbruchs durch die Pluralisierung der Parteien kommt.
2.1.1 Handlungslogiken
Die Handlungslogiken der beiden Arenen Parteiensystem und Bundesstaat haben sich zu staatsrechtlich nicht normierten Spielregeln entwickelt, die den handelnden Akteuren nicht vollständig bewusst sind, sondern latente Handlungsmuster darstellen. Lehmbruch vergleicht sie mit „den „Spielregeln", die sich aus der Rollenverteilung in einer Familie ergeben"[7]. Die drei wichtigsten Systeme zur Konfliktregelung sind das hierarchisch-autoritäre Regelsystem, das des Parteienwettbewerbs und das des Verhandeins. Alle drei Regelsysteme dienen der friedlichen Konfliktaustragung. Sie unterscheiden sich jedoch im Hinblick auf die Art und Weise, wie die Konflikte geregelt werden. Das hierarchisch-autoritäre Regelsystem setzt auf eine übergeordnete Autorität, die Konflikte regelt und dabei die Grundsätze der Gleichbehandlung und die Autonomie der Privatsphäre achtet. Für dieses Regelsystem ist ein „hierarchisch aufgebauter Herrschaftsapparat"[8] typisch. Das Regelsystem des Parteienwettbewerbs lebt von der Konkurrenz um Machterwerb und Machterhaltung. Dabei müssen jedoch auch die Interessen von Minderheiten beachtet werden, um die Macht zu erwerben beziehungsweise zu erhalten. Die Konfliktregelung kommt durch die gegenseitige Anerkennung des Mehrheitsprinzips zustande. Das heißt, dass die Mehrheitsmeinung auch von der Minderheit akzeptiert werden muss. Das dritte Regelsystem, das des Aushandelns, tritt dort auf, wo Konflikte zu regeln sind, die nicht durch Mehrheitsentscheidungen geregelt werden können. Dies ist der Fall, wenn ein Interessenkonflikt zwischen ethnischen Gruppen oder Konfessionen besteht, bei dem die Minderheit kaum eine Chance hat, an die Regierungsmacht zu kommen, und der Interessenkonflikt allgemein als legitim anerkannt ist. Dann tritt zur Friedenssicherung an die Stelle der Mehrheitsentscheidung der ausgehandelte Kompromiss, der die Minderheitsinteressen durch die Aufteilung der Ämter nach Proporz und Parität berücksichtigt. Außerdem ist das Regelsystem des Aushandelns in Situationen wichtig, in denen keine dauerhafte und stabile Regierungsmehrheit zustande kommt, oder einer Großen Koalition eine kleine Opposition gegenübersteht.[9]
Die Regelsysteme hängen von institutionellen Rahmenbedingungen und deren Handlungslogiken ab, an deren Vorgaben sich die politischen Akteure in ihrer Handlungsweise durch Lernprozesse anpassen. Die Handlungslogiken lösen dabei jedoch nicht unmittelbar das Handeln aus, sondern sie stellen Handlungsanreize und Handlungsspielräume dar.[10] Die heutigen Demokratien weisen alle drei Regelsysteme, hierarchisch-autoritär, Parteienwettbewerb und Aushandeln, zeitgleich auf. Sie unterscheiden sich jedoch in der unterschiedlichen Gewichtung dieser Regelsysteme. Hinzu kommt, dass sich diese Gewichtung im Laufe der Zeit verlagern kann. So herrschte im bismarckisch-wilheminischen Deutschland anfangs das hierarchisch-autoritäre Regelsystem vor, doch es wurde zunehmend durch das des Aushandelns ersetzt. Das Regelsystem des Aushandelns setzte sich nach und nach in allen Teilbereichen des politischen Systems durch. Angefangen bei dem Regierungsapparat und dessen Beziehung zu gesellschaftlichen Gruppen und dem Parlament, bis hin zu Parlament, Parteiensystem und bundesstaatlichem System. In dieser Phase waren die Regelsysteme durch eine hohe Kongruenz gekennzeichnet. Doch seit der Gründung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Handlungslogiken der beiden wichtigen Arenen Parteiensystem und Bundesstaat auseinanderentwickelt, so dass es zu einer zunehmenden Inkongruenz kam. In dieser Inkongruenz sieht Gerhard Lehmbruch das Grundproblem des Föderalismus der Bundesrepublik.[11]
Die Handlungslogik des Parteiensystems ist das der Konkurrenzdemokratie. Die Konkurrenzdemokratie beruht auf dem Mehrheitsprinzip, das schnellere Entscheidungsfindungen ermöglicht. Als Idealmodell gilt das „Westminster-Modell", in dem zwei Parteien um die Regierungsmacht konkurrieren und sich die Regierungsmehrheiten abwechseln. Dabei kann zwischen der Wettbewerbsintensität und der programmatischen Distanz zwischen den Parteien unterschieden werden. Wettbewerbsintensität ist nicht zwangsläufig verbunden mit großen ideologischen Differenzen, sondern sie bezeichnet den Wettbewerb von zwei Großparteien mit Hegemonieanspruch um die Wähler die sich in der Mitte des politischen Spektrums befinden. Lehmbruch bezeichnet dies als „Polarisierung"[12]. Wie sich zeigen wird, ist die Polarisierung zwischen den beiden Großparteien CDU/CSU und SPD in der Bundesrepublik sehr ausgeprägt. Koalitionsbildungen in der Mitte des Spektrums, wie in der Weimarer Republik, führen hingegen zu einer stärkeren Betonung der programmatischen Distanzen.
Der Wettbewerb der Parteien um das Machtmonopol führt zur Entwicklung von Innovationen, die dem Machterwerb und der Machterhaltung dienen sollen. Innovationen zu bieten, ist dabei die Aufgabe der Mehrheitspartei und der Opposition gleichzeitig. Damit ist ein konkurrenzdemokratisches System stets an der Entwicklung von neuen Lösungen und Reformen und der Thematisierung von bekannten und neuen Problemen interessiert. Doch die Innovationsfunktion kann durch die eigene Logik des Wettbewerbs, der Machterhaltung und dem Machtgewinn, beschränkt werden. Das kann dazu führen, dass vielschichtige und komplexe Probleme auf eine knappe Formel gebracht werden, der die Wähler zustimmen oder nicht zustimmen können. Außerdem werden die Interessen der gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich stark beachtet und dabei vor allem die Mehrheitsinteressen berücksichtigt, da diese wahlentscheidend sein können. Die Regelmäßigkeit von Wahlen kann auch zu Entscheidungen führen, die an kurzfristigen Erfolgen orientiert sind und die nach der Wahl gegebenenfalls wieder korrigiert werden können. Auch die Lernfähigkeit von Parteien kann durch die Kurzfristperspektive beeinträchtigt werden.[13]
Die Konkurrenzdemokratie des Parteiensystems ist, trotz der durch die eigene Logik gesetzten Grenzen, der Motor der Innovation.[14]
Das Bundesstaatssystem ist, neben den Selbsteinschränkungen, eine weitere Beschränkung der Innovationsentwicklung. Es ist gekennzeichnet durch die Vorherrschaft des Regelsystems des Verhandeins. Dieses bietet dann eine Alternative zu Mehrheitsentscheidungen, wenn Minderheiten keine ausreichenden Einflusschancen haben und dadurch die Mehrheitsentscheidung ihre Legitimationskraft verliert. Außerdem ist das Verhandlungssystem dann ein wichtiges Entscheidungsverfahren, wenn die Akteure eng miteinander vernetzt sind, wie das im deutschen Verbundföderalismus und dabei vor allem im finanzpolitischen Verbundsystem der Fall ist. Die Entscheidungsfindung wird durch Vorentscheidungen in kleineren Interessengruppen vorbereitet. Die Kompromisse müssen für alle betroffenen Interessengruppen akzeptabel sein, sonst kann es zu Blockaden kommen. Um kompromissbereit sein zu können, müssen die handelnden Akteure Handlungsfreiheit besitzen. Die wichtigste Unterscheidung zwischen verschiedenen Verhandlungsstrategien ist die zwischen „Interessenausgleich (bargaining) und sachlich-adäquater Aufgabenerfüllung (problem solving)"[15]. Zu ersterem gehören Tauschgeschäfte und Zugeständnisse durch Koppelgeschäfte oder Kompensationen. Jeder Akteur verfolgt dabei seine eigenen Interessen. Beim problem solving sind die Akteure an Lösungen interessiert, die am Gemeinwohl orientiert sind. Dabei liegen meistens gemeinsame Ziele und Urteilskriterien zugrunde. So sind dauerhafte Kooperationen möglich.[16]
Durch die engen Verschränkungen der parlamentarischen Arena im Gesamtstaat und der bundesstaatlichen Arena durch das Parteiensystem, entsteht aufgrund der unterschiedlichen Handlungslogiken der beiden Arenen eine „strukturelle Spannungszone"[17]. Dies kann dazu führen, dass sich die Teilsysteme gegenseitig blockieren, vor allem dann, wenn die handelnden Akteure sich den größeren Gewinn durch eine Konfrontation versprechen. Wenn für alle Akteure jedoch eine Kooperation den größeren Nutzen bringt, können Entscheidungsblockaden vermieden werden.[18]
Durch die enge Kopplung der beiden Arenen, also die starke Verschränkung von Aufgaben und Zuständigkeiten, ergibt sich ein instabileres System als bei loser Kopplung. Störungen eines Teils des Systems setzen sich durch die enge Kopplung auf andere Teilsysteme fort. Die Akteure sind stärker an Vorentscheidungen gebunden und damit wird die Verhandlungsfreiheit, die für die Kompromissbereitschaft unerlässlich ist, weiter eingeschränkt. Aufgrund dessen sind nur mühsame Interessenausgleiche und Tauschgeschäfte möglich. Durch die verstärkte Kopplung und die konkurrenzdemokratische „Polarisierung" wurden die verhandlungsdemokratischen Elemente im Parteiensystem zurückgedrängt, während sie im Bundesstaat weiter ausgebaut wurden.[19]
Zusammenfassend kann man festhalten, dass es zwei Arenen mit je eigener Handlungslogik gibt, die auf unterschiedlichen Regelsystemen beruhen, die der friedlichen Konfliktaustragung dienen sollen. Die Regelsysteme sind zum einen die Konkurrenzdemokratie und zum anderen die Verhandlungsdemokratie. Durch die enge Kopplung der verschiedenen Elemente wird diese Inkongruenz zum Problem, da nur noch mühsame Verhandlungen möglich sind, da die Akteure aufgrund der Polarisierung auf der Parteiebene weniger kompromissbereit sind.
2.1.2. Die Entwicklung der Handlungslogiken seit dem Deutschen Reich von 1871
Das Problem der inkongruenten Handlungslogiken der beiden Arenen bestand nicht von Anfang an. Im Deutschen Reich (1871-1918) entwickelte sich im Parteiensystem bald das System des Verhandeins heraus. Dies wurde durch sozialstrukturelle und institutionelle Vorraussetzungen begünstigt. Es gab zum einen das in der Verschiedenartigkeit der Gesellschaft und den daraus resultierenden Konfliktlinien begründete Vielparteiensystem mit fünf grundlegende Gruppierungen, denen jeweils mehrere Parteien zugerechnet werden konnten. Hinzu kamen die Parteien der extremen Linken und Rechten. Dadurch wurden Verhandlungen notwendig um (kurzfristige) Mehrheiten für das Verabschieden von Gesetzesvorhaben zu erreichen. Zum Anderen führte der institutionelle Aufbau des Deutschen Reiches dazu, dass durch den geringen Einfluss des Parlamentes und das Fernhalten von Regierungsämtern kein Anreiz bestand, um die Regierungsmacht zu konkurrieren. Es wurde mit wechselnden Mehrheiten Einfluss auf die Regierungspolitik genommen und die Sicherung dieses Einflusses war das Ziel der Parteiorganisation. Im Gegenzug handelte die Regierung die Zustimmung der Parteien zu ihren Vorhaben gegebenenfalls gegen Gegenleistungen aus. Am deutlichsten zeigt sich die Verankerung des Systems des Aushandelns in der Einhaltung des Parteienproporzes bei der Besetzung wichtiger Positionen.[20]
Durch die Parlamentarisierung der Regierung in der Weimarer Republik (1918-1933), bei der die Regierung aus dem Parlament hervorgeht und von diesem kontrolliert wird, veränderten sich zwar die institutionellen Rahmenbedingungen, doch das bestehende Parteiensystem und die weiterhin konsequente Anwendung des Verhandlungssystems änderten sich nicht. Der Parteienproporz wurde sogar noch weiter ausgebaut. Die Regierung wurde ebenfalls nach Proporz der Koalitionsparteien besetzt. Wahlen dienten weiterhin nicht voranging dem Ziel des Machtgewinns, sondern sie „legten nur die Ausgangspositionen für die Koalitionsverhandlungen fest"[21]. Damit blieb das System des Aushandelns in der Arena des Parteiensystems bestehen.[22]
Ebenso wie das Vielparteiensystem war auch der Bundesstaat gekennzeichnet durch Verhandlung und Kooperation, einerseits zwischen den Ländern und andererseits zwischen Reich und Ländern. Anfangs waren die Zuständigkeiten in der Gesetzgebung noch relativ deutlich abgegrenzt, doch das Reich weitete seine Kompetenzen bald weiter aus.[23] Bereits hier zeichnete sich die Teilung nach Funktionen und nicht nach Sachgebieten ab, wie sie heute für den deutschen Föderalismus kennzeichnend ist.[24] Die Länder gaben Gesetzgebungskompetenzen an das Reich ab, waren jedoch als Kompensation für den Kompetenzverlust für die Ausführung der Gesetze zuständig. Weiterhin behielten sie die Gerichtsbarkeit und erhielten die Beteiligung an der Gesetzgebung des Reiches, durch die Zustimmungspflicht des Bundesrates[25]
Auch die finanzpolitischen Beziehungen zwischen dem Reich und den Ländern hatten ihren Ursprung im Deutschen Reich. War anfangs noch ein Trennsystem vorgesehen, bei dem die beiden Ebenen ein eigenes Besteuerungsrecht hatten, mit dessen Einnahmen sie ihre Aufgaben finanzierten, so reichte dies bald nicht mehr aus, die Aufgaben des Reiches zu finanzieren. Deswegen erhob das Reich als Übergangslösung sogenannte „Matrikular- beiträge" von den Ländern, bis zur Einführung von Reichssteuern. Doch der Versuch Bismarcks die Finanzierungslücke durch Zolleinnahmen zu füllen, scheiterte am Widerstand der Länder, die eine Obergrenze für die dem Reich davon zustehenden Einnahmen durchsetzten. Damit war das Reich weiterhin abhängig von den Einnahmen der Länder. Diese Abhängigkeit sicherte den Ländern den Einfluss auf die Verwendung der Einnahmen des Reiches.[26]
Die einflussreiche Stellung des Bundesrates, in dem die Vertreter der Länder saßen, wurde schon früh durch informelle Vorverhandlungen, vor allem mit den großen Ländern Preußen und Bayern, relativiert, so dass er nicht zu einer politischen Kraft wurde, sondern vielmehr die Koordination der Verwaltungen der Länder übernahm. Die Koordination der Interessen Preußens und Bayerns mit den Interessen des Reiches sicherte die Zustimmung des Bundesrates. Hinzu kamen weitere informelle Kooperationsgremien zwischen Reich und Ländern, in denen Gesetzentwürfe vorverhandelt wurden, so dass sie im Bundesrat nur noch beschlossen werden mussten.[27] Dabei verhinderten vor allem die Preußische Vormachtstellung und die Personalunion von Reichskanzler und Preußischem Regierungschef sowie die fehlende parteipolitische Solidarität zwischen den Gliedstaaten Blockaden des Bundesrates.[28] Solange das Parlament noch wenig direkten Einfluss auf die Regierung hatte, war die Koordination der Regierung mit dem Reichstag noch nicht so ausgeprägt. Aber mit der „vollen Parlamentarisierung"[29] der Weimarer Republik gewannen Verhandlungen zwischen der Regierung und dem Parlament an Bedeutung. Dies hatte, auch bedingt durch unitarische Kräfte im Reichstag und die außenpolitische Krisensituation durch den verlorenen Krieg, eine „beschleunigte Unitarisierung und Zentralisierung auf Kosten der Länder"[30] zur Folge. Doch trotz der verfassungsrechtlich schwachen Stellung des Reichsrates, dem Nachfolger des Bundesrates, blieb hier der Verhandlungszwang gegeben. Der Reichsrat besaß zwar nur ein Einspruchsrecht, doch konnte dies nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Reichstages oder einem Volksentscheid zurückgewiesen werden. Das machte Verhandlungen notwendig, die zumeist in informellen Gremien erfolgten.[31] Mit der Parlamentarisierung setzten sich die Regierungen der Länder aus unterschiedlichen Parteien zusammen, was die Homogenität von Reichs- und Länderregierungen nicht mehr garantierte. Damit waren Richtungsgegensätze und oppositionelle Länderallianzen denkbar. Doch es scheiterten nur selten Gesetzentwürfe im Reichsrat. Dies ist zum einen auf die relativ schwache Stellung des Reichsrates zurückzuführen, in dem man vor allem die Preußische Vormachtstellung relativiert hatte. Zum andern aber spielte das Vielparteiensystem eine entscheidende Rolle, da sich die Koalitionen überlappten und meist um die Mitte des Parteispektrums herum gebildet wurden mit „Scharnier"-Parteien[32], wie der Zentrumspartei, die nach mehreren Richtungen hin koalitionsfähig waren. Außerdem sahen sich die Länderregierungen nicht so stark als „Parteiregierungen"[33], so dass sie ihre Länderinteressen und nicht die Parteiinteressen vertraten.[34]
Im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik waren Aushandeln und Kompromissfmdung das vorherrschende Regelsystem der Konfliktaustragung in beiden Arenen, dem Bundesstaat und dem Parteiensystem. Damit bestand hier eine hohe Kongruenz zwischen den beiden Arenen. Dies machte Entscheidungsblockaden wenig wahrscheinlich. Doch seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 hat sich das Parteiensystem gegenläufig entwickelt, während das bundesstaatliche System weitgehend unverändert geblieben ist.
2.1.3. Die Entwicklung der Handlungslogiken in der Bundesrepublik Deutschland
Mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg setzte im Parteiensystem ein Wandel ein, der das Parteiensystem veränderte. Dabei standen zwei Entwicklungen im Vordergrund. Zum einen die Konzentrationsbewegung der Parteien und zum anderen die Polarisierung zwischen den beiden Großparteien.[35]
Die Konzentrationsbewegung bezeichnet dabei das Aufsaugen beziehungsweise eliminieren der kleinen Parteien durch die beiden großen Parteien.[36] Sie hat mehrere Ursachen. Zum einen die in der Folge der Ereignisse des Nationalsozialismus bedeutungsloser gewordenen gesellschaftlichen Konfliktformationen, die den Zusammenschluss der bürgerlich-konservativen und der katholischen Kräfte und die Überbrückung der Gegensätze zwischen den Konfessionen, den städtischen und den agrarisch-bürgerlichen Kräften, ermöglichten. Zum anderen war die extreme Linke geschwächt, einerseits durch die „Nachwirkung offenbar wirkungsvoller antikommunistischer Agitation des Nationalsozialismus"[37] und andererseits die Reaktion auf die sowjetische Besatzungspolitik. Dadurch hatten die CDU und die SPD einen Startvorteil. In den ersten Landtagswahlen 1946/47 konnten SPD und CDU zusammen etwas über 72 Prozent der Stimmen erreichen.[38] Bei der Wahl zum Bundestag 1949 fielen zwar auf die beiden großen Parteien nur 60,2 Prozent der Zweitstimmen, doch bereits bei der Wahl zum Bundestag 1953 nahm die Konzentration der Wählerstimmen wieder zu und sie erhielten zusammen 74 Prozent der Zweitstimmen. Die Konzentrationsbewegung setzte sich fort und erreichte ihren Höhepunkt bei der Bundestagswahl 1976 mit 91,2 Prozent der Zweitstimmen.[39] Danach nahm die Konzentrationsbewegung etwas ab, was vor allem mit dem Auftauchen der „Grünen" zusammenhing.[40]
Die Polarisierung bezeichnet den Anspruch von CDU/CSU und SPD, eine Regierung unter Ausschluss der anderen zu bilden. Die beiden Vorsitzenden der Parteien Konrad Adenauer für die CDU/CSU und Kurt Schumacher für die SPD, legten dabei den Grundstein für die Polarisierung. Auf der Ebene der Länder, die noch vor dem Bund gegründet wurden, hatte sich zunächst das Modell breiter Regierungsbündnisse und Allparteienregierungen durchgesetzt. Beide Parteivorsitzende sahen in dem sich ausbildenden Parteiensystem die Chance, die Führungsrolle zu übernehmen, da sowohl die CDU/CSU wie auch die SPD aufgrund der Konzentrationsbewegungen im Parteiensystem mit Abstand die stärksten Parteien bei den Landtags wählen der Nachkriegsjahre waren. Die Überlegungen waren jedoch unterschiedlich. Kurt Schumacher sah in der CDU kein dauerhaft bestehendes Bündnis und rechnete mit deren Auseinanderbrechen, so dass die Sozialdemokraten mit Abstand die stärkste Partei werden würden. Konrad Adenauer sah gerade in der Opposition zur SPD eine Chance, da er das Modell der Konkurrenzdemokratie als vorbildlich ansah. Mit der Entscheidung Schumachers 1947 im Wirtschaftsrat in die Opposition zu gehen, anstatt eine Große Koalition mit der CDU einzugehen, war endgültig der Weg zur Polarisierung eingeschlagen.[41] Die Polarisierung auf Bundesebene hatte zur Folge, dass im Laufe der nächsten Jahre die Großen Koalitionen und breiten Regierungsbündnisse in den Ländern auseinanderbrachen. Damit setzte sich die Polarisierung auch auf Länderebene fort.[42] Zur Großen Koalition im Bund unter Kurt-Georg Kiesinger 1966-1969 kam es, da sich nur so die notwendigen Strukturreformen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise, insbesondere in der Finanzverfassung, durchsetzen ließen. Doch das Bündnis hielt aufgrund der Logik des Parteienwettbewerbs nur so lange, bis die wichtigsten Reformprojekte abgeschlossen waren.[43]
In der auf die Große Koalition folgenden Sozialliberalen Koalition, die von 1969-1982 im Bund regierte, verstärkte sich die Polarisierung. Dies hatte seinen Ursprung bereits in der Endphase der Großen Koalition. Die Ursache bestand einerseits in der fehlenden Bereitschaft der an die Führungsrolle gewöhnten CDU, diese mit der SPD zu teilen, andererseits in dem zunehmenden Führungsanspruch der SPD. Auch rückte die anteilige Interessenvertretung, wie sie in der Weimarer Republik und dem Deutschen Reich voranging war und auch in den fünfziger und sechziger Jahren von der SPD praktiziert wurde, in den Hintergrund und das Erreichen der Mehrheit sowie die damit verbundene politische Führungsrolle rückten in den Vordergrund. Das hatte zur Folge, dass aus parteipolitischen Gründen Anträge der Opposition vom Regierungsbündnis geschlossen niedergestimmt wurden. Für die FDP bedeutete die Polarisierung, dass die bis dahin üblichen wechselnden Bündnisse in den Ländern von den großen Parteien weniger toleriert wurden, da es keine klaren Frontbildungen und eindeutigen Optionen für den Wähler bereitstellte. Die FDP geriet so auch in den Sog der Polarisierung, bei der sie sich zu einer der beiden großen Parteien bekennen musste, um nicht als „Umfallerpartei" dazustehen.[44]
In den 1980er Jahren nahm die Konzentration der Wählerstimmen ab. Konnten CDU/CSU und SPD 1976 noch etwas mehr als 91% der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen, nahm dies im Laufe der nächsten Wahlen kontinuierlich ab[45] Die Abnahme der Konzentration der Wählerstimmen lag am Auftauchen neuer Akteure im Parteiensystem. Die Grünen zogen seit 1979 in diverse Landtage ein. 1983 schafften sie den Einzug in den Bundestag. Hinzu kamen Stimmengewinne für rechtsextreme Protestparteien, die zwar nicht in den Bundestag einziehen konnten, doch in einigen Landtagen vertreten waren. Nach der Wende 1990 tauchte mit der PDS ein weiterer Akteur auf, der sich dauerhaft im Bundestag sowie vor allem in den ostdeutschen Landtagen halten konnte[46]
Diese Entwicklung hatte jedoch keine Auswirkung auf die Polarisierung zwischen den großen Parteien, so Lehmbruch.[47] Weiterhin blieben Große Koalitionen in den Ländern die Ausnahme, und wurden nur gebildet, wenn kein kleiner Koalitionspartner blieb, der verfassungspolitisch akzeptabel gewesen wäre. Dies war in Baden-Württemberg 1992 der Fall, als die rechtsextremen Republikaner 10,9 Prozent[48]
[...]
[1] Vgl.: Jun, U.: Wandel des Parteien- und Verbändesystems. APuZ, 28/2009. S.29f.
[2] Vgl. dazu exemplarisch: Scharpf, F.W.: Die Politikverflechtungs-Falle. Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich. Politische Vierteljahresschrift, 4/1985.
[3] Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000.
[4] Scharpf, F.W.: Die Politikverflechtungs-Falle. Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich. Politische Vierteljahresschrift, 4/1985.
[5] Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000.
[6] Vgl.: Ebd. S.19.
[7] Ebd. S.14.
[8] Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.15.
[9] Vgl.: Ebd. S.14-17.
[10] Vgl.: Ebd. S.17f.
[11] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.18f.
[12] Ebd. S.20.
[13] Vgl.: Ebd. S.22ff.
[14] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.22.
[15] Ebd. S.26.
[16] Vgl.: Ebd. S.24-27.
[17] Ebd. S.27.
[18] Vgl.: Ebd. S.27ff.
[19] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.29f.
[20] Vgl.: Ebd. S.31-35.
[21] Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.37.
[22] Vgl.: Ebd. S.36f.
[23] Vgl.: Ebd. S.60.
[24] Vgl.: Mayntz, R.: Föderalismus und die Gesellschaft der Gegenwart. Frankfurt/New York, 1995. S.137.
[25] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.60.
[26] Vgl.: Ebd. S.61f.
[27] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.63ff.
[28] Vgl.: Ebd. S.70f.
[29] Ebd. S.67.
[30] Ebd. S.68.
[31] Vgl.: Ebd. S.65-69.
[32] Ebd. S.75.
[33] Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.75.
[34] Vgl.: Ebd. S.74f.
[35] Vgl.: Ebd. S.37.
[36] Vgl.: Ebd. S.37.
[37] Ebd. S.39.
[38] Vgl.: Ebd. S.39.
[39] Deutscher Bundestag: Bundestagswahlergebnisse seit 1949 - Zweitstimmen. Website des Deutschen Bundestages: http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1543.html (Abrufdatum: 06.06.2009).
[40] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.38.
[41] Vgl.: Ebd. S.39ff.
[42] Vgl.: Ebd. S.42f.
[43] Vgl.: Ebd. S.43.
[44] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.45ff.
[45] Deutscher Bundestag: Bundestagswahlergebnisse seit 1949 - Zweitstimmen. Website des Deutschen Bundestages: http://www.bundestag.de/parlament/wahlen/sitzverteilung/1543.html (Abrufdatum: 06.06.2009).
[46] Vgl.: Lehmbruch, G.: Parteienwettbewerb im Bundesstaat. Wiesbaden, 2000. S.48f.
[47] Vgl.: Ebd. S.49.
[48] Eith, U.: Das Parteiensystem Baden-Württembergs. Wiesbaden, 2008. S.108.
- Arbeit zitieren
- Maike Janneck (Autor:in), 2009, Die Pluralisierung des Parteiensystems und ihre Auswirkungen auf den Föderalismus in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191780
Kostenlos Autor werden














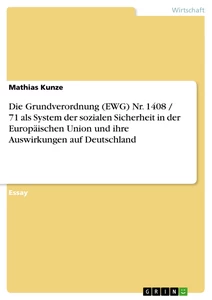








Kommentare