Leseprobe
Gliederung
- Editorial
1. Die europäische Stadt
- Stadtbaugeschichte – die Entstehung der europäischen Stadt
- Die Kompakte Stadt – Richard Rogers
- Die Rolle der Urbanität – Walter Siebel
2. Die Bedeutung der Nach- und Umnutzungen
- Die Entwicklungen des Umganges mit der alten Bausubstanz
- Gesamtgesellschaftliche Gründe für eine verstärkte Konzentration auf Umnutzungen
- Ziele und die Rolle der Denkmalpflege
- Architektonische Aufgabe „Umnutzung“
- Fazit
3. Fallbeispiel Berlin
- Die Entwicklung Berlins in Kürze – seine besonderen Bedingungen
- Berlin in den letzten 12 Jahren – Metropolenwahn und Zentrumssuche
- Das Planwerk Innenstadt
- Vorgehen der Regierung beim Umzug nach Berlin
- Exkurs in die Nachnutzungsmöglichkeiten verschiedener Bautypen
- Beispiele für Nachnutzungen
1. Die Spandauer Vorstadt – über die Phase der Aneignung
2. Weiberwirtschaft – ein nicht geschütztes Haus wird umgebaut und genutzt
3. Haus des Lehrers – Nachnutzung eines Gebäudes der Nachkriegsmoderne
- Fazit
4. Schlussfolgerungen und Ausblicke
- Ausblicke für die Denkmalpflege
- Schlussfolgerungen für Berlin
- Gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Themas
- Literaturverzeichnis
Editorial
Ein wesentlicher Bestandteil der Stadt- und Regionalplanung ist der Umgang mit dem Städtebau und den jeweiligen Stadtstrukturen. Dies gilt sowohl für die bereits vorhandene Substanz als auch für die Konzeption neu zu erschließender Gebiete. In den meisten Fällen sind diese baulichen Hüllen langlebiger als die Gesellschaftsform, in der sie entstanden sind. So existieren heute Gebäudetypologien und Stadtgrundrisse, die unterschiedlichste soziale und politische Wurzeln haben, nun aber von der jetzigen Bevölkerung z.T. zweckentfremdend genutzt werden. Man wohnt in Gründerzeitquartieren, arbeitet in Bürobauten der Postmoderne oder modernisierten Fabrikkomplexen aus der Zeit der Industrialisierung, erholt sich in Parkanlagen des Barock, nutzt die Infrastruktur aus den 20er Jahren und geht ins Konzert in einen Saal aus den 60er Jahren. Gerade in Europa gab es geschichtlich mannigfaltige Veränderungen – auch und gerade in der Anlage von Städten und ihren Nutzungsstrukturen. Nicht ohne Grund wird in letzter Zeit soviel Betonung auf den Begriff der „Europäischen Stadt“ gelegt und auf ihre Vorzüge und die geschichtlichen Hintergründe verwiesen.
Der Soziologe Walter Siebel meint mit Blick auf die Phasen des Überganges, dass „Urbanität dort am größten ist, wo neue Gesellschaftsformen alte „Hüllen“ bevölkern“. Er fügt dann das Ruhrgebiet oder die Spandauer Vorstadt in der Nachwendezeit als Beispiele an. Sehr interessant dürfte dahingehend die Auseinandersetzung mit osteuropäischen Metropolen wie Moskau oder Budapest sein - welche Effekte sich beim Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Systeme bilden und wie die kommunistische Hülle die neuen Funktionen erfüllen kann?
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll aber auf dem Fallbeispiel Berlin liegen. In der Bundeshauptstadt lassen sich unterschiedlichste Architekturen finden. Die geschichtliche Entwicklung der letzten 150 Jahre ist beispiellos und birgt u.a. die Gegenüberstellung zweier völlig gegensätzlicher politischer Systeme, u.a. auch mit ihren jeweiligen städtebaulichen Konsequenzen. Des weiteren sind hier verschiedenste Leitbilder der Stadtplanung in mehr oder weniger umfangreichen Ansätzen zu finden. Es soll also genauer dargestellt werden, wie sich das Verhältnis zwischen der jeweiligen Gesellschaft und der baulichen Hülle, die sie vorfand, darstellte. Interessant ist dabei vor allem der Umgang mit Denkmälern und alten Stadtteilen in den verschiedenen Jahrzehnten und inwiefern sie angenommen, genutzt und zu einem Identifikationsmerkmal der Bevölkerung mit der Stadt, dem Stadtteil und dem Kiez wurden.
Siebel hinterfragt indes mit einigen seiner Prämissen die europäische Stadt und das Leitbild der kompakten Stadt. So stellt er fest, dass neue Gesellschaften andere Ansprüche an Räume haben, die strukturellen Entwicklungen und Tendenzen aber nicht plan- oder steuerbar seien. Sowohl auf die Aufgaben der Stadtplanung als auch die Legitimation der Denkmalpflege bezogen bedeutet diese Aussage ja fast den Entzug der Daseinsberechtigung beider Richtungen. Außerdem stellt er für sich fest, dass die Kompakte Stadt für ihn keinesfalls ein anzustrebendes Ziel ist, da sie unmittelbar mit der damaligen Gesellschaftsform zusammenhängt und alle aktuellen Trends in die genau entgegengesetzte Richtung gehen, auch wenn Stadtplaner sich diese oft romantisierend herbeisehnen. Für eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Argumenten ergibt sich die Frage:
Kann die Nutzungsumorientierung von alten Bau- und Stadtsubstanzen eine aufkommende neue Gesellschaft in Richtung des durchaus legitimierten Leitbildes der Kompakten Stadt lenken und welchen Beitrag unternimmt die Denkmalpflege dabei?
1.) Die europäische Stadt
- Stadtbaugeschichte – die Entstehung der europäischen Stadt
- Die kompakte Stadt – Richard Rogers
- Die Rolle der Urbanität – Walter Siebel
Stadtbaugeschichte
Die Entwicklung der Städte in Europa nimmt ihren Anfang im frühen Mittelalter. Im Grunde genommen fehlten zu dieser Zeit die Voraussetzungen für eine Stadtentwicklung . Die alten Städte aus der Römerzeit gingen meist beträchtlich in ihrer Einwohnerzahl zurück oder wurden zu Wüstungen. Das Leben war auf dem Land, auf Gehöften, Bauernhöfen und kleineren Siedlungen organisiert. Es war großteils von Leibeigenschaft oder Nomadentum geprägt. Erst unter den Saliern und Staufern entstanden aus verschiedenen Wurzeln Städte, deren Bedeutung mit dem Aufblühen von Handel und Wirtschaft zunahm. Die bestimmendsten Momente dafür waren Märkte und Burgen – wirtschaftliche und politische Zentren also. Die Städte entwickelten eigene Rechtsformen und konnten zu politisch eigenständigen Gebilden werden. Seit dem 11. Jahrhundert wurden Städte planmäßig vor allem mit der Besiedlung deutscher Ostgebiete gegründet. Vor allem das Moment der Emanzipation war von vornherein bestimmend – „Stadtluft macht frei“. Städte boten Schutz sowohl gegenüber der Natur als auch militärischen Feinden. Städtebaulich äußerte sich das in einer kompakten Anordnung mit klar definierten Stadtgrenzen und Befestigungsanlagen.
In der frühen Neuzeit ging die Bedeutung der Städte im Allgemeinen zurück, nachdem sie in Deutschland in der ersten Phase der Reformation die wichtigsten Stützen der neuen Lehre gewesen waren. Auch ihre militärische Bedeutung schwand mit der Entwicklung der Kriegstechnik. Stadtmauern und Wallanlagen wurden nutzlos und wurden abgetragen. Zudem entstand mit den Residenzstädten ein auf höfische Repräsentation ausgerichteter Typ. Sowohl intern als auch im Vergleich unter den Städten traten somit größere Nutzungsdifferenzen zwischen den bürgerlichen Funktionen und der Repräsentanz des Adels auf. In der Gestaltung setzte vor allem der Barock als Stilrichtung Akzente. Dieser fand vor allem auch in Gartenanlagen ein Ausdrucksmittel. Allgemein hob sich die Regelmäßigkeit des Barocks mit seinen Erweiterungen von den kleinteilig gewachsenen Strukturen der mittelalterlichen Stadtkerne deutlich ab.
Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Industriestadt. Voraussetzung dafür waren die Neuordnung der Gesellschaft in den bürgerlichen Revolutionen, liberale Agrarreformen, Gewerbefreiheit, Industrialisierung und die Revolutionierung der Verkehrsverhältnisse. Die vielen „befreiten“ Leibeigenen und Landarbeiter hatten keine andere Wahl als in die Städte zu gehen, wo zudem ein großer Bedarf an Arbeitskraft bestand. Der Prozess dieser Aneignung der mittelalterlichen Städte durch die Industriegesellschaft fand in zwei Etappen statt: zunächst der Innenverdichtung und dann der Entwicklung nach außen. Die städtebaulichen als auch die sozialen Folgen waren gravierend. Die ausufernden Ballungsräume wurden zu Spiegelbildern der neuen Gesellschaft und gleichzeitig der Ort der sozialen Entwicklungen und Ungleichheiten. Bauliche Zeugnisse dieser Zeit sind vor allem große Industrieanlagen, Gründerzeitwohnbauten und Mietskasernen um die alten Stadtkerne herum.
Die moderne Großstadt ist meist aus der Industriestadt hervorgegangen. Sie ist gekennzeichnet durch hohen Zentralitätsgrad, Multifunktionalität, hohe Bebauungsdichte bei gleichzeitiger enormer Ausdehnung, Massenverkehr, Klimaveränderung und anschwellenden Stadtverwaltungen. Soziale Kritik an den Zuständen der steinernen Städte des 19. Jahrhunderts und ihre politische Aufbereitung bzw. starke Veränderungen dieser führten zu Reformbewegungen. Die neugesteckten Ziele nach Licht, Luft und Sonne der Charta von Athen 1933 manifestierten sich baulich mitte des letzten Jahrhunderts in den Ergebnissen des Leitbildes einer aufgelockerten modernen Stadt. Vor allem nach dem Krieg waren die Tendenzen der Funktionstrennung mit ihren autogerechten Städten und Vorortsiedlungen für den Städtebau prägend. Auch in den Kleinstädten setzte diese Entwicklung ein.
Diese Zeit stellt auch den größten Bruch mit den vorhandenen Strukturen dar. Die moderne Stadt kommt in sich ohne jeglichen Geschichtsbezug aus. Alle anderen Epochen konnten, mit Ausnahme der Neuansiedlungen der Industriezeit wie dem nördlichen Ruhrgebiet ihre baulichen Früchte nur in Abhängigkeit der vorgefunden Strukturen definieren. Entweder sie verwirklichten sie außerhalb der alten Stadtgrenzen oder nahmen Umwandlungen der Baussubstanz, nicht aber der Stadtgrundrisse in den Kernen vor. Somit waren und sind zu einem großen Teil auch noch die vorzufindenden Stadtstrukturen das Ergebnis eines langen Wachstumsprozesses. Das macht die europäischen Städte jede für sich auch einzigartig.
Die Stadt der Moderne hingegen stellt eine universale Form dar, die überall denkbar wäre. Am konsequentesten ließ sie sich in Nordamerika verwirklichen, da dort nicht auf die Baulichen Bestände einer solch langen Entwicklung Rücksicht genommen werden musste. In Europa hingegen wurden viele Strukturen radikal überplant. Des weiteren stellte sich neben den fehlenden Identifikationsmöglichkeiten und Beeinträchtigungen des sozialen Zusammenlebens durch die Funktionstrennung auch die schlechtere Umwelt- und Flächenverträglichkeit der neuen Bauweisen heraus. Deshalb wird seit den 70er Jahren wieder vermehrt Rücksicht auf die gewachsenen Strukturen und die europäische Städtebautradition genommen.
Die kompakte Stadt
In den 90er Jahren haben sich bei Planern und Politikern zwei zentrale Begriffe als Leitmotive für die zukünftige Stadt etabliert – Nachhaltigkeit und die kompakte Stadt. Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro war ein markanter Ausgangspunkt dafür. Sie führte zur Verabschiedung eines internationalen Aktionsprogramms zur Etablierung und Durchsetzung einer zukunftsbeständigen Entwicklung im Sinne der formulierten Leitbilder eines schonenden und den nachfolgenden Generationen verpflichtenden Umgangs mit den natürlichen Ressourcen und der Umwelt. Bemerkenswert daran ist, dass gerade bei der Umsetzung der AGENDA 21 ein besonderes Augenmerk auf die Ebene der Städte und Kommunen gelegt wurde.
Städte sind die Plätze, wo sich die gesellschaftlichen Entwicklungen vollziehen – sie sind also auch die Orte der großen Veränderungen, Krisen und Umweltzerstörungen (Richard Rogers; Die kompakte Stadt; 2000). Das gilt zur Zeit insbesondere für die Großagglomerationen in Afrika, Asien und Südamerika. Doch für die globale Bilanz spielen auch die Städte der westlichen Länder eine große Rolle. Mittlerweile leben 76,3% der Bevölkerung entwickelter Länder in Städten. Neben den Problemen einer extensiven Flächennutzung und umweltbelastenden Lebensstilen werden auch diese zunehmend mit sozialen und strukturellen Problemen konfrontiert. So gilt es u.a. eine drohende Gettoisierung aufzuhalten und keinen räumlichen Unterschied zwischen Armen und Reichen zuzulassen. Als Lösungsstrategien wurden die Innenentwicklung und die soziale Mischung auserkoren. Das so entwickelte Leitbild der kompakten Stadt hatte z.B. in Nordamerika die Architekturbewegung des „New Urbanism“ zur Folge.
Der Vorteil Europas ist es diese gewachsenen Städte zu haben. Punkte wie die soziale und funktionale Durchmischung waren geschichtlich bedingt von vornherein ein wesentlicher Teil ihrer Struktur. Heute wieder geforderte Merkmale wie kurze Wege, Nachnutzung alter Bestände und Urbanität waren selbstverständlich. In der Tradition des europäischen Städtebaus war bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts auch stets die Innenentwicklung eine Komponente. Erst mit den Folgen des Neuen Bauens in den 20er Jahren und der Suburbanisierung in den Nachkriegsjahren setzte eine gegenläufige Entwicklung ein. Die Ergebnisse der aufgelockerten modernen Stadt und der expansiven Siedlungsformen in Suburbia lassen nun wieder die kompakte Stadt der kurzen Wege als einen Wert erscheinen. Von vielen Seiten kommen nun Bekundungen und Strategien zur Rettung der europäischen Stadt.
Trotzdem ist eine gewisse Unfähigkeit der Planer und Politiker festzustellen (Rogers). Die immer noch immensen versteckten Subventionen für Ein-Familienhäuser und Bauten auf der grünen Wiese wirken für die erklärten Ziele der Innenstadtbelebung sehr kontraproduktiv. Entfernungspauschalen, die Politik der Deutschen Bahn und die Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen tun ihr übriges. Die Lebensstile folgen diesen strukturellen Wegbereitungen und umgekehrt. Das Ergebnis ist der mittlerweile vorherrschende Siedlungsbrei mit dem Verlust der Innenstädte und Zentren.
Richard Rogers ist Architekt. Mit Projekten wie dem Centre Pompidou in Paris oder einem alternativen Masterplan für die Neubebauung am Potsdamer Platz verdeutlichte er seine Herangehensweise an die Thematik. Die kompakte Stadt ergibt sich für ihn aus städtebaulichen Konzeptionen und nicht durch politische Umstände. Die Geschichte der europäischen Stadt nimmt er dabei nur in ihren theoretischen Grundsätzen mit auf – an alten Stadtgrundrissen oder Bauformen orientiert er sich nicht. Der Entwurf baulicher Hüllen steht in direktem Zusammenhang mit der Gesellschaft, für die sie sein sollen. Für ihn ist Barcelona ein gutes Beispiel: soziale und architektonische Erneuerung gehen dort Hand in Hand. Vor allem die veränderten gesellschaftlichen Gefüge und Lebensstile fordern neue flexible Lösungen und führen Ein-Familienhäuser etc. ad absurdum (Rogers).
Die Rolle der Urbanität
Einen anderen Blickwinkel auf die Thematik hat der Stadtsoziologe Walter Siebel. In einer wegweisenden Abhandlung hat er sich im letzten Jahr intensiv mit den Begriffen und Realitäten der kompakten und der europäischen Stadt, der Rolle der Urbanität und den darausfolgenden Deutungs- und Handlungsfeldern befasst. Er wird darin zu einem großen Kritiker des pauschalen Befolgens des Leitbildes der kompakten Stadt und hinterfragt die Steuerbarkeit der strukturellen Bewegungen. Kurioserweise gibt es von diesem Text mehrere unterschiedliche Versionen. Die Titel „Verfallsgeschichten“ und „Wesen und Zukunft der europäischen Stadt“ sind bis auf wenige Änderungen in der Reihenfolge nahezu identisch. Der Artikel „Hat die europäische Stadt eine Zukunft?“ in der DEMO, der Zeitung für Kommunalpolitik kann sozusagen als Kurzfassung angesehen werden. Bezeichnenderweise sind aber für diese Betrachtung die Ergebnisse seiner Erörterungen fast uninteressant, zumal er in allen drei Versionen unterschiedliche Prioritäten setzt. Zusammenfassend ließe sich sein Ansatz in etwa dahingehend deuten, dass sich die Urbanität als Lebensstil im Sinne der Gegenüberstellung von Öffentlichkeit und Privatheit heutzutage von der Stadt als örtliche Vorraussetzung gelöste hat und für alle Bereiche gilt. Gleichzeitig habe sich aber sowohl dieser Aspekt der Urbanität selbst als auch die örtlichen Wurzeln im Sinne von klar definierbaren Städten, Stadtbürgerschaften und zentralen Funktionen aufgelöst. Für eine mögliche Zukunft der europäischen Stadt und einen Ökologischen Umbau der Städte sind dann u.a. die Erfüllung der Integrationsfunktion der Städte ( Verfallsgeschichten) oder auch die Einsicht, dass Städte zwangsläufig sowohl Chaos als auch Organisation sein müssen (Wesen und Zukunft der europäischen Stadt) maßgeblich. Viel mehr muss aber deutlich werden, dass die Gestalt der europäischen Stadt nur noch als musealisierende Inszenierung zu haben ist, und ihre kulturelle Qualität nur noch als Qualität der ganzen Gesellschaft (Hat die europäische Stadt eine Zukunft?). Es ist zweifelhaft, ob die gemachten Versuche einer zusammenfassenden Deutung den Kern seiner Argumentationsziele auch nur annähernd treffen und überhaupt legitim sind. Relativierend kommt aber hinzu, dass die eigentlich relevanten Äußerungen für diese Abhandlung schon in seinen Ausgangspunkten und Prämissen getan werden.
Ein äußerst interessanter Aspekt ist der der Verfallsgeschichten über die nachträgliche Bewertung des Alten . Sowohl bei der Diskussion zur Zukunft der europäischen Stadt als auch der konservativen Großstadtkritik des 19. Jahrhunderts werden jene Verfallsgeschichten erzählt. Im 19. Jahrhundert die vom Verlust von Überschaubarkeit, Gemeinschaft, Ordnung und Moral und im 20. Jahrhundert die vom Verlust von Urbanität, von der Privatisierung des öffentlichen Raums und dem Verschwinden des Stadtbürgertums. Und beide Male hat die Gegenwart wenig Chancen gegenüber einer verklärten Vergangenheit. Heute hält man dem Siedlungsbrei der großen Agglomerationen die vermeintlich bessere Welt der dichten, vielfältigen, gemischten Stadt des 19. Jahrhunderts entgegen. Die konservativen Kritiker der Großstadt haben dieser die vermeintlich heile Welt der vorindustriellen Bürgerstadt entgegengehalten. Siebel führt als einfaches Beispiel die Bewertung von Burgen hinzu: zu Zeiten des Raubrittertums werden sie kaum positive Assoziationen bei der Bevölkerung freigesetzt haben. Erst nach dem Niedergang dieser Herrschaft bestand die Möglichkeit diese als Sehenswürdigkeiten romantisierend wahrzunehmen. Überhaupt lassen sich im Nachhinein die Vergangenheit und somit auch ihre baulichen Zeugnisse viel positiver bewerten. Rein psychologisch halten wir lieber an dem was verloren geht fest, denn es ist uns vertraut und deshalb haben wir dafür auch treffende Begriffe. Die Schattenseiten werden dann auch schon mal vernachlässigt. Verfallsgeschichten sind darum keineswegs falsch, aber sie erzählen eine einäugige Wahrheit, weil sie vergessen, auch die möglichen Gewinne und die unumgänglichen Notwendigkeiten des sozialen Wandels zu berücksichtigen.
Aus diesen Überlegungen heraus ergibt sich auch seine Bewertung der kompakten und der europäischen Stadt. Es muss doch stutzig machen, wenn das steinerne Berlin, gegen das nicht
nur konservative Großstadtkritiker sturmgelaufen sind, sondern auch Wohnungsreformer
und Generationen von progressiven Planern, wenn diese kompakte Stadt des 19. Jahrhunderts heute als urbane Stadt der kurzen Wege zum Leitbild erhoben wird, während die
Gegenentwürfe der Reformer – z.B. das Programm der Charta von Athen – als Sünden wider den Geist europäischer Urbanität verworfen werden. Ähnlich fragwürdig bliebe eine Kritik der Stadtentwicklung, die z. B. in der Suburbanisierung nur die Auflösung der europäischen
Stadtgestalt erkennen könnte, ohne die erweiterten Optionen in Rechnung zu stellen, die bei steigendem Wohlstand und verbesserten Transportmöglichkeiten im Zuge der Suburbanisierung realisiert werden. Man muss nach den guten Gründen fragen, die zum Wandel oder gar zum Verschwinden der europäischen Stadt beitragen. Solange man nicht analysiert, aufgrund welcher Zwänge und aufgrund welcher guten Gründe die Bewohner, die Betriebe und der Handel die Stadt verlassen, solange läuft man Gefahr, nur einer rückwärtsgewandten Utopie anzuhängen. Fast beiläufig stellt er dabei für sich fest, dass alle aktuellen Entwicklungen genau entgegen einem (für ihn zweifelhaften) Ziel der kompakten Stadt laufen und diese Trends auch in Zukunft anhalten werden, weil sie strukturelle Ursachen haben, und dies heißt auch, dass sie politisch kaum steuerbar sind. Diese Aussage bedeutet in ihrer Konsequenz ein geradezu vernichtendes Urteil für die Stadtplanung und die kompakte Stadt. Die kompakte Stadt des 19. Jahrhunderts verdankt ihre Dichte u.a. der schieren Armut. Wachsender Wohlstand erlaubt Individualisierung – Individualisierung führt zu kleinen Haushalten – kleine Haushalte beanspruchen mehr Wohnfläche und dies wiederum trägt bei zur Suburbanisierung. Aber niemand käme auf die Idee, Armenviertel gutzuheißen, weil sie besonders ressourcen- und flächensparend sind. Ähnlich argumentiert er auch bezüglich der Stadt der Dienstboten, welche ökologisch nachhaltiger als Staubsauger, Spülmaschinen und selbstreinigende Herde sind, oder der unterentwickelten Transportsysteme. Die lebendige Mischung von Wohnen und Arbeiten, Erholung und Verkehr beruhte nicht zuletzt auf der kleinbetrieblichen Struktur von Handel und Gewerbe. Ohne diese Voraussetzungen muss die europäische Stadt aufwendig musealisiert oder neu inszeniert werden. Die zu der kompakten Stadt des 19. Jahrhunderts gehörige Gesellschaft existiert schlichtweg nicht mehr und für die Urbanität im 21. Jahrhundert sei die europäische Stadt ein viel zu enges Gefäß.
Genau diese Rolle und die Arten der Urbanität sollen uns zum Schluss beschäftigen. Wenn es heute noch besondere Orte der Urbanität gibt, so sind sie inselhaft und vorübergehend. Urbanität kann als ein Spannungsverhältnis beschrieben werden zwischen physischer Nähe und sozialer Distanz, zwischen Dichte und Fremdheit. Solche produktive Spannung konzentriert sich an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten, dann und dort, wo eine neue Gesellschaft sich die Gehäuse der alten aneignet. Eine solche Phase der Urbanität ergab sich im 19. Jahrhundert, als die Industriegesellschaft die vorindustriellen Bürger- und
Residenzstädte aufbrach und umwälzte. Heute geschieht Ähnliches dort, wo die nachindustrielle Gesellschaft sich in den industriellen Stadtstrukturen einnistet oder wo die Transformation der sozialistischen Gesellschaft wie im Brennglas sichtbar wird. Deshalb sind heute so gänzlich verschiedene Orte wie Ostberlin und das Ruhrgebiet Kristallisationspunkte des Urbanen. Dabei legt Siebel ein besonderes Augenmerk auf die Nachtseiten der Urbanität. Sie sei ein unabdingbarer Bestandteil des städtischen Lebens, seiner Dynamik und seiner Weiterentwicklung. Bedürfnisbefriedigungen am Rande der Legalität und Schattenwirtschaft gehören ebenso dazu wie z.B. Hausbesetzungen.
Im Zuge der folgenden Betrachtungen kommt es nun darauf Aspekte Siebels aufzugreifen und ggf. anhand von Beispielen zu bestätigen oder auch zu hinterfragen. Es bleibt herauszufinden, wie legitimiert das Leitbild der kompakten Stadt und ihre Umsetzungsstrategien wirklich sind und welchen Beitrag Denkmalpflege und Umnutzungen dabei haben.
2.) Die Bedeutung der Nach- und Umnutzungen
- Die Entwicklungen des Umganges mit der alten Bausubstanz
- Gesamtgesellschaftliche Gründe für eine verstärkte Konzentration auf Umnutzungen
- Ziele und die Rolle der Denkmalpflege
- Architektonische Aufgabe „Umnutzung“
- Fazit
Für die Entwicklung, den Erhalt und die Wahrnehmung der europäischen Stadt spielen mittlerweile zwei Punkte eine ausschlaggebende Rolle: die Denkmalpflege und die Umnutzung von alten Gebäuden. Vordergründig haben beide zunächst nicht viel mit den von Siebel angesprochenen Prozessen höchster Urbanität bei der Aneignung alter Substanz zu tun, denn beide sind eher institutionalisierte Konstrukte – die Denkmalpflege (DMP) als ein gesellschaftlich-rechtlich legitimiertes Instrument für die Erhaltung des Alten und die Umnutzung als eine eher ökonomisch motivierte Form Altes nutzbar zu machen. Und doch hängen beide unmittelbar mit den besagten spontanen Inanspruchnahmen zusammen. Sie folgen auseinander und gleichzeitig bedingen sie sich gegenseitig. Andererseits scheinen sie oft auch gegeneinander zu arbeiten. Das eine ist im Umgang mit dem Alten eher veränderungshemmend, das andere hat die Veränderung zum Inhalt. Ein Beispiel: ein Fabrikgebäude steht leer und wird nicht anderweitig genutzt. Das bietet Künstlern die Gelegenheit das Haus zu besetzen und für sich zu nutzen. Die daraus folgende höhere Aufmerksamkeit auf das Bauwerk sensibilisiert die Bevölkerung auch für die Belange des Denkmalwertes – die DMP hat demzufolge eine gute Verhandlungsbasis bei den ebenfalls einsetzenden Investitionswünschen neuer potentieller Nachnutzer. Somit haben die kreativen Okkupierer den Weg für DMP und Umnutzung geebnet, müssen selbst aber das Feld wieder räumen. Gleich nebenan unterbindet aber die Denkmalpflege eine Umnutzung des alten Lokomotivenwerkes, da es als technisches Denkmal in seiner Ganzheit zu erhalten ist. Auch in der Entstehungsgeschichte der drei Punkte findet sich dieses Wechselspiel wieder.
Die Entwicklungen des Umganges mit der alten Bausubstanz
Zur Zeit erleben wir einen Trend der Aneignung leergewordener Bauten (ja gar Stadtteile) und der Neunutzung in Richtung Kultur, Soziales, IT und Wohnen. Die Entwicklungen, die dazu führten wurden meist von unten angeschoben (Artur Mandler; Umnutzung alter Bausubstanz als architektonische Aufgabe; 2000). Und auch für die Umnutzungen alter Gebäude gilt ähnliches. Sie fanden früher, d.h. vom Mittelalter bis in die Nachkriegsjahre des 2. Weltkrieges, einfach aus Pragmatismus heraus statt und waren alltäglich. In ihnen spiegelt sich auch der ursprüngliche Gegensatz zwischen dem handwerklichen Umgang mit der gebauten Realität und dem Schaffen der Architekten wieder. Um- und Nachnutzungen waren handwerklich und ökonomisch begründet und für die Bevölkerung unabdingbar. Die Architektur hingegen arbeitete eher in künstlerischen Sphären und hob sich nicht selten von den vorhandenen Strukturen radikal ab. Doch auch hier wurden für den Adel, die Kirche und die Obrigkeit und zuletzt die Industrie Bauwerke mit einer langen Lebensdauer verwirklicht. Zumindest stilistisch wurde sich dabei auch am Alten orientiert. Mit dem „neuen Bauen“ kommt der Bruch mit den alten Traditionen der Architektur nach Zweckmäßigkeit, Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Ökonomie. Stattdessen kommen die Ideale von „Funktionstrennung“ und Effizienzsteigerung, auf. Die bauliche und soziale Forderung lautet: „Jeder Generation ihr Haus“. Ein weiteres Beispiel ist die programmatische Entwicklung von Industrieanlagen mit bewusst kurzer Lebenszeit in den Zwischenkriegsjahren (Uta Hassler und Niklaus Kohler; Umbau – die Zukunft des Bestandes; 2000). Nicht nur für die Architektur galt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass das neue das gute und bessere ist. Nur durch die Abkehr vom Alten könne man in eine bessere Zukunft aufbrechen. Die klassische Moderne und die Zeit danach waren geprägt durch die ungetrübte Faszination der Zukunft und der modernen Technik (Johann Jessen; Umnutzung im Bestand - Städtebau-Programm-Gestalt; 2000). Und auch nach dem Krieg wurde nur die Frage nach Abriss oder Rekonstruktion gestellt. Nach der Propaganda des 1.000 Jährigen Reiches wurde in der Architekturdebatte in den 50er Jahren vor allem Wert auf Flexibilität und eine geradezu erhebliche Betonung auf das Provisorische gelegt. Dauerhaftigkeit war einfach zu negativ besetzt. Daneben haben sich vor allem der Drang nach geordneten Strukturen und Rationalisierung aus der Vorkriegsmoderne mit rübergerettet. In den 60ern knüpfte das Ideal industrieller Fertigung an diesen Strukturalismus an. Und in den 70er und 80er Jahren verlagerte sich der Rationalismus auf die Ökologie (Hassler / Kohler). Daher bestand weitgehend eine Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit der (Not)-Nachnutzungen und der sie völlig verneinenden Debatte in der Architektur (Jessen).
Auch die DMP fand ihren Ursprung kurz vor dieser Phase der Umorientierung der Architektur am Anfang des letzten Jahrhunderts. Die gravierenden Veränderungen und Auswüchse durch die Industrialisierung und den Gründerzeitboom ließen vor allem die Sorge um die ästhetisch anmutenden Zeugnisse der Geschichte aufkommen. Der theoretische Hintergrund hingegen war von Beginn an äußerst weitblickend. Die denkmalpflegerische Aufgabe formulierte John Ruskin wie folgt: „Kümmert euch um eure Denkmäler, und ihr werdet nicht nötig haben, sie wiederherzustellen. Bewacht ein altes Bauwerk mit ängstlicher Sorgfalt; bewahrt sie gut und anhängig und um jeden Preis vor dem Zerfall. Zählt die Steine wie Edelsteine einer Krone...“ (Nach John Ruskins, Die sieben Leuchter der Baukunst, in Ausgewählte Werke, Bd.1 Leipzig 1900, S. 363-368). Wegbereitend für die Arbeit und Herangehensweise der DMP sollte vor allem Georg Dehio werden. Einer seiner berühmtesten Forderungen lautet: „Konservieren nicht restaurieren!“ (Georg Dehio, Was wird aus dem Heidelberger Schloss werden?, in: Kunsthistorische Aufsätze von Georg Dehio, München/Berlin 1914, S. 249-259).
Der große gesamtgesellschaftliche Durchbruch für die DMP und der Eingang von Um- und Nachnutzungen alter Gebäude als gängige Mittel ins Bauwesen sollte aber erst Mitte der 70er Jahre folgen. Sie sind eine Folge des politischen Umbruchs und der vorangegangenen radikalen Flächensanierungen der Stadtplanung. An der Ästhetik der Formen der Nachkriegsmoderne und ihrer städtebaulichen Strukturen hatte man sich schon bald aufgerieben. Verspielte Stilelemente, Verzierungen wie Stuck, nutzlose Details - alles Punkte, die von der Moderne verdammt wurden - waren nun wieder gern gesehen. Doch der drohende Verlust des Authentischen ließ das Augenmerk auch allgemein auf den Erhalt des Bestandes richten. Die Beweggründe dafür sind aber weniger in der Ästhetik als in den sozialen Gefügen dieser Zeit zu suchen. Große Teile der Bevölkerung strebten damals die durch die Planungspraxis vorangetriebene Lebensweise mit Auto, Einbauküche und Wohnung im Grünen an. Auch die innerstädtischen Gebiete sollten entsprechend umgestaltet werden. Die jungen Menschen, denen das Leben in einer sozial und kulturell homogenen Vorstadt nicht erstrebenswert erschien, eigneten sich deshalb nach und nach die Wohngebiete des 19. Jahrhunderts an, die mit ihren niedrigen Mieten und dem teilweisen Leerstand eine Art Vakuum darstellten. In einem noch kurz zuvor unvorhergesehenen Prozess wurden Bauten, die für gänzlich andere Nutzungen errichtet worden waren, für alternative Lebensformen adaptiert. Einst für großbürgerlichen Lebensstil zugeschnittene Altbauappartements wurden zu Fünfer-WGs, Hinterhauswohnungen zu Single-Unterkünften und selbst die für rigide organisierte Produktionsabläufe gebauten Industriehallen dienten plötzlich als Orte für Kunst und Kultur (Frank Roost; Reclaim the Moderne; 2000). Diese Aneignung der alten Gebäude hatte ebenfalls eine Sensibilisierung für den zwingenden Schutz und den Erhalt dieser Stadtteile und Einzelobjekte zur Folge. Die Herausbildung von Protesten und Bürgerinitiativen gegen die radikalen Umbaumaßnahmen der bis dahin praktizierten Sanierungspolitik besiegelte dessen Ende und war der Beginn einer Rückbesinnung auf die alte Stadt seitens der Planer und Gesetzgeber. In diesem Kontext ist auch das Europäisches Denkmalschutzjahr 1975 „Zukunft für die Vergangenheit“ zu sehen. Zunächst ging es der Denkmalpflege vorrangig um „die Revitalisierung von Baudenkmälern“ (Thomas Sieverts; Konzepte und Strategien städtebaulicher Revitalisierung und Umnutzung des Gebäudebestandes und der brachgefallenen Flächen als Teil einer systematischen Kreislaufwirtschaft; 2000).
Doch vor allem rechtlich und strukturell hatte dieser Mentalitätswechsel weitreichende Folgen. Alleine die rechtliche Fixierung in den Denkmalschutz- und Städtebauförderungsgesetzen waren große Fortschritte und bestimmten maßgeblich die künftigen Planungsvorgänge. Für die in den 70ern beginnende Stadterneuerung war auch die Umnutzung alter Gebäude ein entscheidender Bestandteil. Nicht selten hatten erfolgreich umgenutzte Bauten eine große Signalwirkung. Finanziell spielten dabei die Städtebauförderungsmittel eine äußerst wichtige Rolle. Die somit in der Bundesrepublik eingeleitete behutsame Stadterneuerung war mehr als ein Wandel des städtebaulichen Leitbilds (Roost). Sie war zum einen die Abkehr des radikalen, ganzheitlichen Motivs der modernen Stadt mit seinen rücksichtslosen Pauschalsanierungen und ermöglichte einen kontinuierlichen, sozial- und denkmalverträglichen Umgang mit der vorhandenen Substanz seitens der Politik und Planung. Die entsprechenden Impulse für die Architektur setzte Mitte der 80er Jahre die IBA in Berlin. Priorität der IBA „Alt“ sowie der IBA „Neu“ hatte die Innenverdichtung. Hinzukommend waren für die vermehrte Ausweitung von Umnutzungen sowohl in der Fläche als auch in der Breite der Objekte ökologische und ökonomische Gründe mitverantwortlich. Die Strukturkrise der Montanindustrie beispielsweise machte die Nachnutzung von zahlreichen Industrieflächen erforderlich. Ein Jahrzehnt später hatte diesmal die IBA „Emscher Park“ (u.a. mit dem Thema „Nachnutzungen von Industrieobjekten“) einen Beispielcharakter für andere von der Desindustrialisierung betroffene Regionen (Jessen). Mittlerweile stellt sich die Frage nach Möglichkeiten für Nach- und Umnutzungen in fast allen Bereichen und Typologien des Städtebaus.
Neben dem Umgang mit den monofunktionalen Großsiedlungen standen in den Nachwendejahren vor allem die freigewordenen Militärflächen im Zentrum des Interesses. Hier hatten auch Tausende nicht schützenswerter Bestände in zentralen Lagen enorme Potentiale freigesetzt. Die Ausmaße der daraus folgenden Maßnahmen sind nur mit dem Schleifen von Stadtmauern und –gräben vor 200 Jahren vergleichbar (Sieverts).
In einem Blick nach vorn spricht neben den zahlreichen anstehenden Aufgaben vor allem die Statistik eine deutliche Sprache: immer noch ist ein überproportionaler Anstieg der Bauinvestitionen in den Bestand im Vergleich mit dem Neubau zu verzeichnen. In den 80er Jahren waren die Investitionssummen für Bestand und Neubau gleich, mittlerweile bindet der Bestand mehr Baugelder als Neubauten. Umnutzungen sind dabei ein zentraler Bestandteil und gewinnen vor allem durch die Diskussion über Ressourcenschonung an Bedeutung. Berücksichtigt man bei Neubauten neben den Baukosten auch die anstehenden Entsorgungskosten und die Recyclingmöglichkeiten, wird für viele Investoren der Umbau und die Umnutzung alter Gebäude oft ökonomisch attraktiver (Jessen). Zusammenfassend kann man also festhalten, dass die Wurzeln der Umnutzungen in der Denkmalpflege und der Stadtgestaltung liegen. Deren Wahrnehmung und Bewertung ist wiederum ein Resultat der gesellschaftlichen Entwicklungen in den 70er Jahren, inklusive der Okkupationen der Altbau- und Industriequartiere durch Kreative und soziale Randgruppen. Mittlerweile kann die Notwendigkeit von Denkmalpflege und Umnutzungen sehr vielfältig begründet werden.
[...]
- Arbeit zitieren
- Karsten Foth (Autor:in), 2002, Über die Aneignung alter städtebaulicher Hüllen durch neue Gesellschaftsformen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/19176
Kostenlos Autor werden

















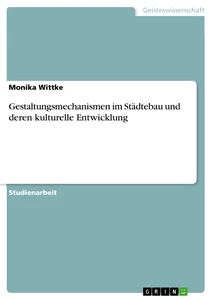




Kommentare