Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0 Zusammenfassung
1 Einleitung
2 Theoretischer Hintergrund von Stress und Burnout
2.1 Psychologische Grundlagen
2.1.1 Stress
2.1.1.1 Arbeitspsychologische Stress-Modelle
2.1.1.2 Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen
2.1.1.3 Arbeits- und gesundheitsbezogene Folgen von Stress am Arbeitsplatz
2.1.2 Burnout
2.1.2.1 Die Ursprünge des Burnout-Begriffs
2.1.2.2 Versuch einer Burnout-Definition
2.1.2.3 Entwicklung von Burnout
2.1.2.4 Einflussfaktoren von Burnout
2.1.2.5 Arbeits- und gesundheitsbezogene Folgen von Burnout
2.1.3 Verwandte Konstrukte von Burnout
2.1.3.1 VitaleErschöpfung
2.1.3.2 Depression
2.1.4 Belastungen im Erzieher-Beruf
2.2 Physiologische Grundlagen
2.2.1 Physiologische Stresstheorien
2.2.2 Physiologische Stressreaktionssysteme
2.2.2.1 Aufbau und Regulation der HHNA
2.2.2.2 Das Nebennierenrindenhormon Cortisol
2.2.2.3 Wirkung von Stress auf die HHNA
2.2.2.4 Burnout und Aktivität der HHNA
2.2.2.5 Die Cortisol-Aufwach-Reaktion (CAR)
2.2.2.6 Weitere Einflussfaktoren auf Cortisol
2.2.3 Nachweis von Cortisol im Speichel
2.2.4 Nachweis von Cortisol in den Haaren
3 Hypothesen
3.1 Subjektiv empfundener Stress und Salivacortisol
3.2 Subjektiv empfundener Stress und Haarcortisol
3.3 Salivacortisol und Haarcortisol
3.4 Subjektive Stresseinschätzungen
4 Methoden
4.1 Stichprobenbeschreibung
4.2 Untersuchungsablauf
4.3 Messung psychologischer Parameter
4.3.1 Messung von Burnout mit dem MBI
4.3.2 Messung von chronischem Stress mit dem SSCS
4.3.3 Messung von Vitaler Erschöpfung mit dem MVEQ
4.3.4 Messung von Depression mit dem HADS-D
4.3.5 Messung von beruflichen Gratifikationskrisen mit dem ERI-S
4.3.6 Messung von sozialer Unterstützung mit dem MSPSS
4.4 Messung biologischer Parameter
4.4.1 Sammlung und Analyse von Cortisol im Speichel
4.4.2 Sammlung und Analyse von Cortisol in den Haaren
5 Auswertung und Darstellung der Ergebnisse
5.1 Statistische Analyseverfahren
5.2 Ergebnisse der inferenzstatistischen Auswertung
5.2.1 Deskription der Stresssymptomatik in der Stichprobe
5.2.2 Subjektiv empfundener Stress und Salivacortisol
5.2.3 Subjektiv empfundener Stress und Haarcortisol
5.2.4 Salivacortisol und Haarcortisol
5.2.5 Subjektive Stresseinschätzungen
5.2.5.1 Korrelationen für die Gesamtstichprobe
5.2.5.2 Korrelationen für die Teilstichprobe
6 Diskussion
6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
6.2 Einordnung der Befunde in den wissenschaftlichen Kontext
6.2.1 Zusammenhang zwischen subjektiv empfundenem Stress und CAR
6.2.2 Zusammenhang zwischen subjektiv empfundenem Stress und Haarcortisol
6.2.3 Zusammenhang zwischen Speichel- und Haarcortisolspiegel
6.2.4 Zusammenhänge zwischen den subjektiven Stresseinschätzungen
6.3 Reflexion des methodischen Vorgehens
6.4 Schlussfolgerungen und Ausblick
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
8.1 AnhangA: Tabellen
8.2 Anhang B: Interview
8.3 Anhang C: Psychologische Testverfahren
8.4 Anhang D: Begleitheft zur Speichelprobensammlung
8.5 Anhang E: Einverständniserklärung
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 2.1.2: Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen (Siegrist, 1996)
Abbildung 2.1.4.3: Acht-Kategorien-System nach Golembiewski et al
Abbildung 5.2.1: Ausprägungen der Fragebogenwerte bei den Erzieherinnen
Tabellenverzeichnis
Tabelle 5.2: Deskriptive Kennwerte der Fragebögen und Cortisolwerte
Tabelle 5.2.5.1: Korrelationen zu H4 für die Gesamtstichprobe
Tabelle 5.2.5.2: Korrelationen zu H4 für die gesunde Teilstichprobe
Tabelle 6.1: Ergebnisse der Hypothesen-Prüfung
Tabelle A.1: Deskriptive Statistik der Gesamtstichprobe und der gesunden Teilstichprobe ...
Tabelle A.2: Häufigkeitstabelle: Familienstand
Tabelle A.3: Häufigkeitstabelle: Im Moment allein oder mit Partner lebend?
Tabelle A.4: Häufigkeitstabelle: Haben Sie eigene Kinder?
Tabelle A.5: Häufigkeitstabelle: Sind Sie die primäre Betreuungsperson?
Tabelle A.6: Häufigkeitstabelle: Was ist der höchste Abschluss, den Sie erreicht haben?
Tabelle A.7: Häufigkeitstabelle: Arbeiten Sie momentan Vollzeit oder Teilzeit?
Tabelle A.8: Häufigkeitstabelle: Haben Sie einen Dauerarbeitsvertrag?
Tabelle A.9: Häufigkeitstabelle: Haben Sie akute oder chronische Gesundheitsprobleme?...
Tabelle A.10: Häufigkeitstabelle: Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein?
Tabelle A.11: Häufigkeitstabelle: Liegen Organkrankheiten vor?
Tabelle A.12: Häufigkeitstabelle: Haben Sie Asthma?
Tabelle A.13: Häufigkeitstabelle: Haben Sie Neurodermitis?
Tabelle A.14: Häufigkeitstabelle: Haben Sie Allergien?
TabelleA.15: Häufigkeitstabelle: Liegen Hormonstörungen vor?
TabelleA.16: Häufigkeitstabelle: Liegen Herzerkrankungen/Bluthochdruckvor?
Tabelle A.17: Häufigkeitstabelle: Liegen neurologische/psychische Beeinträchtigungen vor?
Tabelle A.18: Häufigkeitstabelle: Rauchen Sie?
Tabelle A.19: Häufigkeitstabelle: Wie schätzen Sie Ihre Gesundheit im Allgemeinen ein?
Tabelle A.20: Häufigkeitstabelle: Wie schätzen Sie Ihre Schlafqualität im Allgemeinen ein?
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
0 Zusammenfassung
Fragestellung: Die vorliegende Arbeit beschäftigte sich mit der Frage, inwieweit sich verschiedene subjektive Stresseinschätzungen in der Aktivität der körpereigenen Stressachse - der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HHNA) - widerspiegeln. Weiterhin interessierte die subjektive Stressbelastung bei Erzieherinnen.
Methodik: Bei einer Gruppe von 43 Erzieherinnen, welche zuvor nach ihrer Gesundheit und ihren Haarpflegegewohnheiten befragt wurde, wurden Speichelproben zur Bestimmung der Cortisol-Aufwach-Reaktion (CAR) untersucht. Außerdem wurden Haarproben gesammelt, da die Haare eine Art „retrospektiven Kalender" für die Cortisolproduktion darstellen. Die subjektiven Stresseinschätzungen wurden durch das Maslach Burnout Inventar (MBI), die Screeningskala zum chronischen Stress (SSCS), eine Kurzversion des Maastricht-Vital-Exhaustion- Questionnaire (MVEQ), die Depressionsskala der Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-D), eine Kurzform des Fragebogens Effort-Reward Imbalance (ERI-S), sowie durch die Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) erfasst. Neben der Gesamtstichprobe, in der verschiedene Krankheiten angegeben wurden, wurde separat auch eine daraus gewonnene gesunde Teilstichprobe (N = 30) untersucht.
Ergebnisse: Die subjektive Stressbelastung ist bei den untersuchten Erzieherinnen gering bis mittelmäßig ausgeprägt. Zwischen den subjektiven Stresseinschätzungen und der HHNA-Aktivität wurden in dieser Untersuchung kaum signifikante Zusammenhänge gefunden. Einzig die MBI-Skala Emotionale Erschöpfung wies einen signifikanten Zusammenhang zur CAR (p = .010; nur bei Teilstichprobe) und dem Haarcortisol-spiegel (p = .025 bzw. p = .035; bei Gesamt- bzw. Teilstichprobe) auf, sowie auch der ERI-Fragebogen in signifikantem Zusammenhang zur CAR stand (p = .021; Teilstichprobe).
Diskussion: Die Studienergebnisse weisen auf eine erhöhte HHNA-Aktivität bei Erzieherinnen mit hoher Emotionaler Erschöpfung sowie Effort-Reward Imbalance hin. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen CAR und Haarcortisolspiegel konnte nicht gefunden werden, weshalb zur empirischen Absicherung weitere Untersuchungen erforderlich sind.
1 Einleitung
„Ich bin total gestresst", „Ich kann einfach nicht mehr" oder „Ich bin absolut ausgebrannt" sind Aussagen, die gegenwärtig immer häufiger zu hören sind. Die anschließend oft gestellte „Diagnose" lautet Burnout und ist inzwischen kein unbekanntes Wort mehr. Fast jeder weiß sich etwas darunter vorzustellen, kennt jemanden, der schon einmal ein Burnout hatte, oder identifiziert sich gar selbst als Betroffener. Im Jahre 2010 gab es nach Hochrechnungen der AOK ca. 100.000 Krankschreibungen aufgrund einer Burnout-Diagnose (Sigge, 2011). Dabei ist der Begriff längst noch nicht eindeutig zu definieren, geschweige denn zu diagnostizieren. Einige Kritiker behaupten gar, das Konstrukt gäbe es gar nicht, sondern wäre lediglich die gesellschaftlich akzeptierte Form einer Depression.
Wie im Laufe der vorliegenden Arbeit noch deutlich werden wird, lässt sich das Phänomen jedoch ganz gut von der Depression abgrenzen, auch wenn gewisse Überschneidungen nicht abzustreiten sind und häufig auch Koexistenzen beider Zustände anzutreffen sind. Die Symptome eines Burnouts sind individuell verschieden, wodurch sich auch die bereits erwähnten Diagnoseschwierigkeiten ergeben. Jedoch äußern sie sich häufig in einem Zustand emotionaler Erschöpfung, Gefühlen von Gleichgültigkeit und Desinteresse sowie reduzierter Leistungsfähigkeit (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Auch steht die Burnout-Symptomatik in engem Zusammenhang zu somatischen Beschwerden wie Muskel- und Skelettschmerzen, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen und Magen-DarmStörungen (Gorter, Eijkman und Hoogstraten, 2000). Die Ursache von Burnout ist meist darin zu finden, dass die Betroffenen über längere Zeit hohen Belastungen ausgesetzt waren. Häufig handelt es sich dabei um stressreiche Erfahrungen im Kontext der Arbeit, wie sie z. B. durch berufliche Gratifikationskrisen (Effort- Reward Imbalance) entstehen.
Eine Berufsgruppe, die im besonderen Maße chronischem Arbeitsstress ausgesetzt ist, ist die der Erzieher[1]. Ca. 8-14 % der Erzieher in deutschen Kindertagesstätten sind emotional erschöpft bzw. von Burnout-Symptomen betroffen (Kliche, Töppich & Koch-Gromus, 2009). Die Gründe für eine erhöhte Burnout-Anfälligkeit dieser Berufsgruppe liegen unter anderem darin, dass Erzieher häufig unter Rollenstress leiden, welcher in engem Zusammenhang mit Burnout steht (Boyd & Pas- ley, 1989), ebenso wie auch unklare Erfolgskriterien in diesem Beruf zur Burnout- Symptomatik beitragen. Nicht zuletzt wirken sich auch Lärm und Belastungen des Bewegungsapparates ungünstig auf die Gesundheitvon Erziehern aus.
Betrachtet man die durch Burnout entstehenden gesundheitlichen Störungen aus physiologischer Perspektive, so sind eine Reihe endokriner Systeme an der Stressreaktion des menschlichen Körpers beteiligt. Die biopsychologische Forschung konzentriert sich dabei insbesondere auf die Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrinden-Achse (HHNA), die Sympathikus-Nebennierenmark-Achse (SNA), und das der SNA untergeordnete Herz-Kreislauf-System (HKS). Während die SNA hauptsächlich bei kurzzeitigen Anforderungen aktiviert wird, gilt die HHNA als Langzeit-Stressreaktionssystem und spielt daher bei der Manifestation von Burnout eine größere Rolle. Im Falle chronischer Stressbelastungen reagiert die HHNA in der Regel mit einer erhöhten oder verminderten Aktivität. Derartige Veränderungen auf möglichst einfache und verlässliche Weise zu erfassen ist eine Aufgabe der biopsychologischen Forschung, in der sich mittlerweile verschiedene Verfahren etabliert haben.
Als verlässliche und simple Methode zur Erfassung der HHNA-Aktivität hat sich dabei die mehrfache Messung von Cortisol im Speichel zur Erfassung der Cortisol- Aufwach-Reaktion (CAR) etabliert. Das Nebennierenrindenhormon Cortisol ist seit Mitte der 30er Jahre als Stresshormon bekannt, da es bei Konfrontation des Körpers mit einem Stressor vermehrt produziert wird. Wenngleich diese Methode einen recht guten Einblick in die aktuelle Stresssituation eines Menschen gewährt, scheint in jüngster Zeit eine weitere Methode vielversprechend zur Erfassung chronischen Stresses zu sein: die Messung von Cortisol in den Haaren. Da bisher keine Studien existieren, die diese Methode im Zusammenhang mit der Messung von Burnout untersucht haben, soll diese Lücke mit der vorliegenden Studie geschlossen werden.
Die Arbeit gliedert sich in sechs Hauptkapitel, wobei das vorliegende Kapitel 1 den Einstieg in die Fragestellung erleichtern soll. Kapitel 2 liefert den theoretischen Bezugsrahmen der Untersuchung und führt die relevanten Begriffe ein. In Kapitel 3 werden die zu untersuchenden Hypothesen abgeleitet. Gegenstand von Kapitel 4 ist die Beschreibung der Stichprobe, des Untersuchungsablaufs sowie der für die psychologischen und physiologischen Messungen verwendeten Verfahren.
In Kapitel 5 erfolgt die Dokumentation der statistischen Auswertung sowie die Darstellung der Ergebnisse. Abschließend werden die Ergebnisse in Kapitel 6 im Kontext bisheriger wissenschaftlicher Forschung betrachtet und diskutiert.
2 Theoretischer Hintergrund von Stress und Burnout
Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden die Konstrukte Stress und Burnout zunächst aus psychologischer und anschließend aus physiologischer Perspektive betrachtet, da beide Ansätze in der nachfolgenden Untersuchung vereint werden.
2.1 Psychologische Grundlagen
Zunächst wird ein Überblick über die auf der Studie basierenden psychologischen Grundlagen gegeben. Nach der theoretischen Darstellung des Stress-Begriffs, der Beschäftigung mit arbeitspsychologischen Stress-Modellen sowie Folgen von Stress am Arbeitsplatz, wird der Blick auf den Burnout-Begriff, die Entwicklung von Burnout und seine Folgen gerichtet. Anschließend werden verwandte Konstrukte von Stress und Burnout beschrieben und Belastungen im Erzieher-Beruf vorgestellt.
2.1.1 Stress
Der Terminus Stress wurde erstmalig von Walter B. Cannon 1914 wissenschaftlich definiert. Im medizinisch-physiologischen Bereich bekannt wurde er allerdings erst 1936 durch den in Kanada forschenden Hans Selye, der Stress als unspezifische Reaktion des Körpers auf jegliche Anforderung beschrieb und seitdem als Vater der Stressforschung gilt. Er beschrieb die Folgen von Stress im Allgemeinen Adaptationssyndrom (siehe Kap. 2.2.1) als unspezifische Reaktionen des Körpers, die sich auf jede Art von Anforderung einstellen. Damit war er der erste, der eine Stress-Definition lieferte und Stress in Zusammenhang mit Krankheit brachte. Se- lyes Konzept hat die Stressforschung nachhaltig beeinflusst und einige seiner Annahmen konnte in zahlreichen Untersuchungen bestätigt werden. Allerdings wird die von Selye postulierte Unspezifität der Stressantwort kritisiert, insbesondere von John Mason, der als einer der ersten in den 1960er Jahren erkannte, dass die hormonelle Stressreaktion in unterschiedlich erlebten Situationen durchaus spezi- fisch ist und durch bestimmte situative Merkmale beeinfluss wird (siehe Kap. 2.2.1).
Nachdem Mason die Bedeutung psychologischer Faktoren hervorhob, postulierten auch Lazarus und Folkman (1984) in ihrem kognitiv-transaktionalen Modell, dass das Erleben von Stress aus einer Wechselbeziehung zwischen Individuum und Umwelt resultiert. In einem dreistufigen Prozess sollen diverse subjektive Bewertungen dazu führen, dass bei Erleben einer Diskrepanz zwischen situativen Anforderungen und individuellen Bewältigungsmöglichkeiten eine Situation zum Stressor wird. Dabei werden simultan Merkmale der Situation (primary appraisal) und eigene Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten (secondary appraisal) eingeschätzt, welche abschließend einer Neubewertung (reappraisal) unterzogen werden. Stress wird hier als situativer und subjektiver Einschätzungsvorgang verstanden, wobei objektive Gegebenheiten an Bedeutung verlieren.
Eindeutige und allgemein gültige Antworten auf die Fragen „Was ist Stress?" und „Wie entsteht Stress?" lassen sich in der bestehenden Literatur nicht finden. Ein Modell zur Entstehung von Stress lieferten Holmes und Rahe (1967) mit der Theorie der kritischen Lebensereignisse. Damit sind bedeutende Veränderungen im Laufe eines Lebens gemeint, welche von den Betroffenen häufig als Lebenskrisen (z. B. Scheidung) oder Schicksalsschläge (z. B. Tod einer nahestehenden Person) empfunden werden. Häufen sich solche Ereignisse, können sie nach Meinung der Autoren zur Entstehung von Krankheiten beitragen. Fraglich bei diesem Konzept ist, ob kritische Lebensereignisse an sich ausschlaggebend für Stress sind. Vielmehr kann angenommen werden, dass das subjektive Erleben sowie die Bewältigungsmöglichkeiten eines Individuums eine sehr zentrale Rolle spielen. Ein anderes Modell bezieht sich hingegen auf tägliche Stressoren, sogenannte daily hassles, welche diverse stresserzeugende Ärgernisse, Sorgen und Probleme des Alltags umfassen. Für dieses Konzept konnte in einigen Studien ein engerer Zusammenhang mit Stressindikatoren festgestellt werden als dies bei den kritischen Lebensereignissen der Fall ist (Hillert & Marwitz, 2006).
Levine und Ursin (1991) vereinen in ihrem Artikel „What is stress?" verschiedene Stressdefinitionen. Den Autoren zufolge handelt es sich bei Stress um ein mehrdimensionales Konstrukt, welches sich in drei Phasen gliedert: Auf einen Input bzw. die Reize einer Situation setzt ein Verarbeitungssystem ein, aus dem durch Integration der Reize ein Output bzw. die Stressreaktion resultiert. Den Input un- terteilen die Autoren in physische und psychische Belastungen, wobei sie den psychischen Belastungen eine weitaus größere Bedeutung zusprechen als den physischen. In der zweiten Subklasse, dem Verarbeitungssystem, vergleiche das Gehirn die eintreffenden Informationen mit bereits gespeichertem Wissen und erzeuge dadurch bestimmte Erwartungen. Im Output, der dritten Subklasse, erfolgen dann die Stressreaktionen des Organismus auf die Belastungen. Die Stressreaktionen kommen den Autoren zufolge auf drei Ebenen zum Ausdruck: auf der subjektivverbalen Ebene, auf der Verhaltensebene und auf der physiologischen Ebene, worunter auch die Aktivierung der HHNA (siehe Kapitel 2.2.2.3) fällt. Weiterhin heben die Autoren hervor, dass andauernde (tonische) Stressreaktionen mit erhöhten gesundheitlichen Risiken einhergehen; kurze (phasische) Stressreaktion hingegen den Organismus nicht beeinträchtigen.
Da in der vorliegenden Arbeit vor allem der Zusammenhang zwischen chronischer Arbeitsbelastung und Burnout sowie physiologischen Stressreaktionen im Mittelpunkt steht, erfolgt nun die Darstellung arbeitspsychologischer Stressmodelle sowie der Folgen von Stress am Arbeitsplatz.
2.1.1.1 Arbeitspsychologische Stress-Modelle
Die Menschen der modernen Arbeitswelt stehen heutzutage einer Reihe von Herausforderungen gegenüber, bei denen von ihnen ständige Anpassungsleistungen gefordert werden. Dabei sollen vor allem immer weniger Mitarbeiter immer mehr leisten. Als Folgen der Globalisierung sehen diese Mitarbeiter sich stetig steigendem Wettbewerbsdruck, verkürzten Produktionszyklen, Rationalisierungen und Arbeitsplatzunsicherheit gegenüber gestellt, was zu Stresserfahrungen in erheblichem Ausmaß führt. Verschiedene arbeitspsychologische Stress-Modelle versuchen hier anzusetzen und zu erklären, wie Stresserfahrungen im Beruf entstehen. Im Folgenden werden vier solcher Modelle skizziert, um einen Einblick zu vermitteln, welche Faktoren bei der Entstehung von arbeitsbedingtem Stress eine Rolle spielen können. Vorgestellt werden das Anforderungs-Kontroll-Modell, das Person- Environment-Fit-Modell, die Theorie der Ressourcenerhaltung und das Modell beruflicher Gratifikationskrisen. Letztgenanntem Modell wird in einem eigenen Kapitel besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da es eine zentrale Rolle in der vorliegenden Untersuchung spielt.
Nach dem Anforderungs-Kontroll-Modell (demand-control model) von Karasek und Theoreil (1990) führt ein geringer Grad an Kontrolle über Arbeitsabläufe (job control) im Zusammenspiel mit hohen psychischen bzw. physischen Anforderungen (job demand) zu vermehrten Stresserfahrungen (job strain). Diese treten umso häufiger auf, wenn ein sozialer Rückhalt durch die Arbeitskollegen fehlt (Johnson, 1989). Aus derartigen Stresserfahrungen resultierende gesundheitliche Folgen konnten in mehreren Studien belegt werden, wobei die Anzahl der Betroffenen je nach Beruf zwischen 10 und 30 % beträgt (Siegrist, 2002a). Einen ersten experimentellen Beweis für das Modell liefern Häusser, Mojzisch und Schulz-Hardt (2011) mit ihrer Studie, in der sie einen Puffer-Effekt hoher Job-Kontrolle auf die negativen Auswirkungen hoher Arbeitsanforderungen auf endokrine Reaktionen (in Form von erhöhtem Speichelcortisol) feststellten.
Das Person-Environment Fit-Modell, welches in den frühen 1970er Jahren entwickelt wurde, besagt, dass Belastungen dann auftreten, wenn eine Diskrepanz (misfit) zwischen den Bedürfnissen einer Person und den Bedürfnisbefriedigungen durch die Arbeit besteht, oder auch zwischen den Anforderungen der Arbeit und den Fähigkeiten der Person, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Bedürfnisse beinhalten dabei Faktoren wie Partizipation, Auslastung und Einkommen; Anforderungen umfassen beispielsweise Arbeitsbelastungen und Aufgabenkomplexität (Caplan, Cobb, French, Van Harrison & Pinneau, 1975; Van Harrison, 1978).
Kernelement der Theorie der Ressourcenerhaltung (conservation of resources theory) von Hobfoll (1988; Hobfoll & Buchwald, 2004), welche nicht nur auf den Bereich der Arbeit anwendbar ist, sind die individuellen Ressourcen einer Person. Ressourcen sind definiert als Objekte (z. B. Kleidung), persönliche Charakteristika (z. B. Selbstwirksamkeit, Verantwortung), Bedingungen (z. B. Arbeitsplatzsicherheit, Familienstand) und Energien (z. B. Wissen, Zeit, Geld), welche vom Individuum als bedeutsam erachtet werden. Grundlegend für die zentrale Annahme des Modells ist das menschliche Bestreben nach Gewinn von Ressourcen und Vermeidung von Ressourcenverlust. Kommt es zu einem Verlust von Ressourcen bzw. werden Verluste antizipiert, oder kann trotz der Investition von Ressourcen kein Gewinn erzielt werden, resultiert das in Stress.
2.1.1.2 Das Modell beruflicher Gratifikationskrisen
Ein umfassendes arbeitstheoretisches Stressmodell, welches mit Hobfolls Ressourcenerhaltungstheorie durchaus in Einklang zu bringen ist, entwickelte Siegrist (1996) mit dem Modell beruflicher Gratifikationskrisen [Effort-Reward Imbalance Model). Im Mittelpunkt des Modells steht das Verhältnis zwischen den bei der Arbeit erbrachten Leistungen und den dafür erhaltenen Belohnungen (Gratifikationen). Gratifikationen können auf verschiedene Arten erfolgen: Zum einen durch finanzielle Entschädigung in Form von Lohn bzw. Gehalt; zum anderen durch Wertschätzung oder durch Arbeitsplatzsicherheit und beruflichen Aufstieg. Stressreaktionen sind dann zu erwarten, wenn auf dauerhaft hohe Verausgabungen keine angemessenen Gratifikationen erfolgen. Diese Annahme basiert auf der sozialen Reziprozitätsnorm, welche besagt, dass auf von einer Person oder Gruppe erbrachte Vorleistungen sofort oder zukünftig durch Gegenleistungen kompensiert werden müssen. Bleiben die erwarteten Belohnungen aus, entsteht ein Gefühl der Bedrohung des eigenen Selbst und der Stabilität enger sozialer Bindungen. Dies wiederum führt nach Annahme des Modells zu intensiven emotionalen, neuronalen und neuroendokrinen Reaktionen. Bekommen Menschen (a) trotz kontinuierlich hoher Leistungserbringung keine angemessenen Entlohnungen, (b) nicht genügend Wertschätzung von Seiten ihrer Vorgesetzten und Kollegen, (c) Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes oder (d) keine Aufstiegschancen, sind Reaktionen dieser Art zu erwarten.
Zusätzlich zu den extrinsischen Komponenten des Modells, welche Anforderungen und Verpflichten auf der einen Seite und Belohnungen auf der anderen Seite beinhalten, erfasst das Modell auch eine intrinsische Komponente: die übersteigerte Verausgabungsneigung (Overcommitment). Diese wird derart in das Modell integriert, dass sich im Falle eines Ungleichgewichts zwischen Verausgabung und Belohnung sowie dem Vorhandensein einer übersteigerten Verausgabungsneigung besonders nachteilige Folgen für die Gesundheit ergeben (Siegrist, 1996). In Abbildung 2.1.2 befindet sich eine grafische Darstellung des Modells.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1.2 Das Modell der beruflichen Gratifikationskrisen (Siegrist, 1996)
Siegrist (2002b) hat für das ERI-Modell drei wesentliche Annahmen formuliert: (a) die extrinsische ERI-Hypothese, welche annimmt, dass ein hoher Aufwand in Kombination mit geringen Belohnungen das Risiko für gesundheitliche Schäden erhöht; (b) die intrinsische Overcommitment-Hypothese, in der angenommen wird, dass ein hohes Maß an Overcommitment die Gefahr von Gesundheitsschäden erhöht; und (c) die Interaktions-Hypothese, die besagt, dass Menschen mit Effort-Reward Imbalance und einem hohen Maß an Overcommitment ein besonders hohes Risiko für gesundheitliche Schäden aufweisen. In einer Überprüfung 45 empirischer Untersuchungen von Van Vegchel, de Jonge, Bosma und Schaufeli (2005) konnte allein die extrinsische ERI-Hypothese umfangreich empirisch unterstützt werden. Die Ergebnisse für Overcommitment waren hingegen uneinheitlich und die moderierende Wirkung von Overcommitment auf die Beziehung zwischen ERI und Gesundheit der Mitarbeiter wurde in den herangezogenen Studien kaum untersucht.
Dass sich bei wiederholtem Erleben beruflicher Gratifikationskrisen vermehrt gesundheitliche Folgen einstellen, konnte in einer Vielzahl empirischer Untersuchungen belegt werden (eine Übersicht liefern Tsutsumi & Kawakami, 2004; Siegrist, 2005 sowie Van Vegchel et al., 2005). Im Folgenden werden fünf Studien vorgestellt, in denen ein signifikanter Zusammenhang zwischen beruflichen Gratifikationskrisen und dem Auftreten kardiovaskulärer Erkrankungen, insbesondere der koronaren Herzkrankheit (KHK) aufgezeigt werden konnte. Es handelt sich um drei prospektive Untersuchungen, eine Follow-up-Studie und eine Fallkontrollstu- die. Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Übersicht von Studien, die das Modell mit anderen stressbedingten Erkrankungen in Zusammenhang bringt.
Im Rahmen prospektiver Untersuchungen wurden eine deutsche Stichprobe von 416 Industriearbeitern über sechseinhalb Jahren beobachtet (Siegrist & Klein, 1990), eine schwedische Kohorte mit 5720 gesunden erwerbstätigen Männern und Frauen untersucht (Peter et al., 1998), und Daten von 10308 Teilnehmern der Whitehall II Studie, welche zwischen 1985 und 1988 (Phase 1) beobachtet wurden, analysiert (Bosma, Peter, Siegrist & Marmot, 1998). Die in der Phase 1 der Whitehall II Untersuchung gefundenen Zusammenhänge konnten in einem Elfjahres- Follow-up bis Ende der Phase 5 (1997-2000) bestätigt werden (Kuper, Singh- Manoux, Siegrist & Marmot, 2002). Weiterhin konnte in einer Fallkontrollstudie von Peter et al. (2002) an 951 KHK-Patienten und 1147 Kontrollpersonen ein signifikanter Zusammenhang zwischen beruflichen Stressbelastungen und einer KHK aufgezeigt werden.
In den Untersuchungsergebnissen von Bosma et al. (1998), Kuper et al. (2002) sowie Siegrist und Klein (1990) zeigte sich ein 1.3- bis 4.5-fach erhöhtes Risiko für das Auftreten einer KHK bei denjenigen, welche eine berufliche Effort-Reward Imbalance aufwiesen, verglichen mit Personen ohne derartige Belastungen. Siegrist (2005) berichtet in seinem Übersichtsartikel einen Gesamtmittelwert von 2.0 für erhöhte gesundheitliche Risiken, was bedeutet, dass Menschen mit beruflichen Gratifikationskrisen doppelt so häufig unter gesundheitlichen Risiken leiden wie Menschen, die frei von dieser Art chronischen Stresses sind. Dabei konnte ausgeschlossen werden, dass dieses erhöhte Risiko auf andere relevante Störfaktoren zurückzuführen ist.
Auch Risikofaktoren für eine KHK wie z. B. Bluthochdruck, Hyperlipidämie, oder Diabetes mellitus stehen in Zusammenhang mit beruflichen Gratifikationskrisen. So konnten Siegrist, Peter, Cremer und Seidel (1997) bei der Untersuchung von 179 stellvertretenden Industriemeistern deutlich erhöhte Häufigkeiten von arteriellem Bluthochdruck, Hyperlipidämie und Nikotinabusus bei Personen mit gratifikationskritischen Erfahrungen am Arbeitsplatz finden. Kumari, Head und Marmot (2004), die für ihre Untersuchung Daten der zuvor erwähnten Whitehall II Studie verwendeten, stellten ein gehäuftes Vorkommen von Diabetes mellitus Typ II im Zusammenhang mit beruflichen Gratifikationskrisen fest.
Neben den erwähnten Zusammenhängen beruflicher Gratifikationskrisen mit kardiovaskulären Erkrankungen konnten auch zahlreiche andere stressbedingte Erkrankungen mit Gratifikationskrisen in Zusammenhang gebracht werden, wie beispielsweise Depression (Tsutsumi, Kayaba, Theorell & Siegrist, 2001), Muskel- und Skeletterkrankungen (Joksimovic, Starke, Knesebeck & Siegrist, 2002) und Alkoholabhängigkeit (Stansfeld, Head & Marmot, 2000). In einer Studie von Step- toe, Siegrist, Kirschbaum und Marmot (2004), in der eine Teilstichprobe der Whitehall II Studie untersucht wurde, konnte auch eine Beziehung zwischen erhöhten morgendlichen Cortisolwerten und hohem Overcommitment gefunden werden, allerdings nur bei den männlichen Probanden.
2.1.1.3 Arbeits- und gesundheitsbezogene Folgen von Stress am Arbeitsplatz
Intensive und über längere Zeit anhaltende Stressbelastungen treten heute in allen beruflichen Schichten auf und wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits als „eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts" bezeichnet (Ruess & Mai, 2007). Die gesundheitliche Gefahr liegt dabei vor allem im Auftreten stressbedingter Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck, HerzKreislauf-Erkrankungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Infektionserkrankungen, Magen-Darm-Geschwüre, Tinnitus, Depression und nicht zuletzt Burnout. Die 2010 veröffentlichten Ergebnisse der Europäischen Unternehmensumfrage über neue und aufkommende Risiken (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks, ESENER) zeigen, dass arbeitsbedingter Stress zu den größten Sicherheitsund Gesundheitsrisiken in Europa zählt: 79 % der europäischen Arbeitgeber betrachten arbeitsbedingten Stress als wichtigstes Thema.
Neben den genannten und weiteren gesundheitlichen Folgen von Stress am Arbeitsplatz sind die Folgen von Stress auch für die Organisationen relevant. Cox, Griffith und Rial-González (2005) geben in einem Bericht der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz folgende Auswirkungen auf Organisationen an: reduzierte Arbeitsfähigkeit, verbunden mit hoher Personalfluktuation, Unpünktlichkeit und Absentismus, reduzierte Produktivität und Arbeitsleistung, sowie vermehrte Kundenreklamationen und steigende Ansprüche der Arbeitnehmer auf Ausgleichsleistungen.
Neben diesen Auswirkungen liegt eine Reihe von Zahlen vor, die negative Auswirkungen auf die Arbeit und die gesamte Volkswirtschaft belegen. So ist nach einem seit 1990 zunächst rückläufigen Trend seit 2006 wieder ein kontinuierlicher Anstieg krankheitsbedingter Fehlzeiten zu verzeichnen (BKK Gesundheitsreport, 2010). Diese Entwicklung wird neben soziodemografischen Veränderungen vor allem auf die gewandelten Anforderungen in der Arbeitswelt zurückgeführt. Zu den wichtigsten Krankheitsarten, welche als ursächlich für Arbeitsunfähigkeit gelten, zählen (a) Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (21,7 % - 25,4 %), (b) Krankheiten des Atmungssystems (15,8 % - 17,2 %), (c) Verletzungen und Vergiftungen (13,5 % - 14,3 %), (d) psychische Störungen (10,7 % - 12,1 %), € Krankheiten des Verdauungssystems (6,1 % - 6,3 %) und (f) Krankheiten des Kreislaufsystems (4,4 % - 4,6 %; die prozentualen Angaben beziehen sich auf den BKK Gesundheitsreport 2010 und den DAK Gesundheitsreport 2011). Die Mehrzahl dieser Krankheiten lässt sich mit Stress in Zusammenhang bringen, denn abgesehen von eindeutigen Folgen arbeitsbezogenen Stresses kann Stress praktisch jede Krankheit, ihren Verlauf und ihre Behandlung beeinflussen (Europäische Kommission, 2000). Die volkswirtschaftlichen Kosten für arbeitsbedingte psychische Belastungen summieren sich auf jährlich 6,3 Milliarden Euro (Dettmer & Tietz, 2011).
Um den oben dargestellten Entwicklungen entgegenzuwirken, ist neben einer verbesserten Diagnostik und Behandlung stressbezogener Erkrankungen vor allem die Notwendigkeit geeigneter Präventionsmaßnahmen unverkennbar. Im Rahmen von betrieblicher Gesundheitsförderung versuchen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Gesellschaft daher mehr denn je, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen bei der Arbeit zu verbessern.
2.1.2 Burnout
Die Zahl der Burnout-Betroffenen scheint, seit sich der Begriff in der Gesellschaft etabliert hat, unaufhaltsam zu steigen. Trotz zahlreicher Symptomüberschneidungen mit verwandten psychischen Erkrankungen wie Depression oder Vitaler Erschöpfung wird Burnout mittlerweile als eigenständiges Syndrom behandelt und akzeptiert.
In den folgenden Abschnitten wird zunächst ein Überblick über die Ursprünge des Burnout-Begriffs und seine Definition gegeben. Anschließend folgt eine Darstellung verschiedener Modelle über die Entwicklung von Burnout sowie seine arbeits- und gesundheitsbezogenen Folgen.
2.1.2.1 Die Ursprünge des Burnout-Begriffs
Die nachfolgende Beschreibung der Anfänge des Burnout-Begriffs orientiert sich an der Darstellung von Hillert und Marwitz (2006).
Burn out, was aus dem Englischen übersetzt so viel wie ausgebrannt heißt, wurde 1974 zum ersten Mal von dem in New York lebenden Psychoanalytiker Herbert Freudenberger beschrieben. Er geriet selbst nach einem Übermaß an sozialem Engagement in einen Zustand völliger psychischer und physischer Erschöpfung, von dessen vielfältigen Erscheinungsformen er in einem Artikel mit dem Titel „Staff Burn-Out" berichtet. Die Bandbreite von psychischen und körperlichen Symptomen reicht danach von Müdigkeit, einem Gefühl der Verausgabung, häufigen Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Reizbarkeit und immer uneffektiver werdender Arbeit bis zu abnehmenden Kontakten zu Freunden. Das Besondere bei diesem von einem Psychoanalytiker charakterisierten Phänomen ist, dass es weder als Neurose, noch als seelische Erkrankung vermittelt wird, sondern als Kategorie ganz eigener Art, welche letztlich durch Überbelastung in einer sozialen Beschäftigung resultiert.
Bei dieser Konstruktion gilt die jeweilige außerordentlich überfordernde Tätigkeit als entscheidend, wobei den Betroffenen selbst so gut wie keine Schuld trifft. Allerdings entziehen sich die Grenzen der entsprechenden Belastungen, deren Überschreiten zu Burnout führen kann, jeglicher Verallgemeinerung und sind somit auch hochgradig abhängig von der Person. Für die Wissenschaft ergeben sich daraus einige schwierige Implikationen, und es sollte schwer fallen, vor diesem Hintergrund eine Diagnose von Burnout zu stellen. In den nachfolgenden Jahren versuchten Wissenschaftler daher, das Burnout-Konzept statistisch abzusichern und als seriöse Wissenschaft zu etablieren.
Ebenfalls im Jahre 1974 und ebenfalls in New York publizierte der Manager Sigmund Ginsburg einen kurzen Artikel mit dem Titel „The Problem of the Burned Out Executive“. In seinen Ausführungen treten dabei einige Parallelen, jedoch auch bedeutende Unterschiede zu Freudenbergers Ansichten auf. Ginsburg beschreibt Burnout als eine charakteristische Erkrankung von überwiegend höhergestellten
Managern, die sich als Folge von über einen langen Zeitraum erstreckenden Hochleistungsanforderungen einstellt. Betroffene arbeiten dabei zunehmend ineffektiv, sind energielos, ihr Entscheidungs- und Innovationspotenzial ist auf ein Minimum gesunken und sie vernachlässigen zudem ihre Familie. Eine genauere Aufklärung darüber, was Burnout überhaupt ist, fehlt bei ihm ebenso wie bei Freudenberger.
Es war die Sozialpsychologin Christina Mašiach, die den Burnout-Begriff auf den haltbaren Grund der psychologischen Wissenschaft stellte. Sie beschäftigte sich in der Zeit um 1974 mit der Frage, wie Menschen auf Belastung reagieren. Dabei führte sie zunächst Interviews mit Menschen, die in ihrem Beruf engen Kontakt zu ihren Kunden oder Klienten haben, wie beispielsweise Psychologen, Psychiater, Sozialarbeiter und Krankenschwestern. Parallel zu den Interviews wurde deren Verhalten im beruflichen Setting durch Dritte beobachtet. Anschließend galt es, Burnout zu definieren und, durch Verwendung eines Fragebogens, standardisiert messbar zu machen. So entstand das heute noch weltweit angewandte Maslach- Burnout-Inventar (MBI), welches in Kapitel 4.3.1 ausführlicher behandelt wird.
Der erste, der Burnout vor einem stresstheoretischen Hintergrund betrachtete, war der Organisationspsychologe Cary Cherniss. Er vertrat die Auffassung, dass arbeitsbedingter Stress zu negativ verändertem Erleben und Verhalten zuvor engagierter Mitarbeiter führe. In einem dreistufigen Prozess resultiere Arbeitsstress über Stressreaktionen letztlich in einem Burnout, der unter anderem durch emotionale Distanz zur Arbeit, Zynismus und defensive Strategien geprägt sei. Cherniss war auch der erste, der Burnout im Längsschnitt untersuchte. Aus seinen Ergebnissen schlussfolgerte er, dass der Ursprung von Burnout in der Arbeitsorganisation liegt.
2.1.2.2 Versuch einer Burnout-Definition
In den unzähligen seit Freudenberger veröffentlichten Burnout-Definitionen lässt sich bis heute keine finden, die sich für eine verbindliche Feststellung des Phänomens eignen würde. Burnout wird daher bisher nicht als psychiatrische Diagnose anerkannt; weder in der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (International Classification of Disease, ICD-10), noch im Diagnostischen und Statistischen Manual psychischer Störungen (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV). Weder lässt sich eindeutig sagen, ab wann ein Zustand als Symptom gilt, noch, wie viele Symptome erfüllt sein müssen, damit von Burnout gesprochen werden kann. Nichtsdestotrotz ist es notwendig, eine Definition vorzustellen, auf die im Rahmen dieser Arbeit zurückgegriffen werden kann.
Maslach definierte Burnout zunächst als „[...] a psychological syndrome of emotional exhaustion, depersonalisation, and reduced personal accomplishment that can occur among individuals who work with other people in some capacity" (Maslach, 1993, S. 20). Burnout wird hier als dreidimensionales Modell mit den Komponenten Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und Reduzierte Leistungsfähigkeit beschrieben, welches in engem Zusammenhang mit Berufen steht, die durch die Arbeit mit Menschen gekennzeichnet sind. Emotionale Erschöpfung ist dabei die Stress-Komponente des Modells; sie resultiert aus einer übermäßigen emotionalen Anspannung. Depersonalisation stellt die interpersonale Komponente des Modells dar und entsteht als Reaktion auf die emotionale Erschöpfung. Sie äußert sich in einer Distanzhaltung der Betroffenen gegenüber ihren Klienten (Patienten, Pflegebedürftigen, Schülern oder Kunden), welche durch eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber diesen Personen gekennzeichnet ist; sie werden mehr und mehr als Objekte gesehen. In weniger personenorientierten Berufen wird diese kognitive Distanziertheit ebenso durch Desinteresse und zynische Einstellungen deutlich. Aus Emotionaler Erschöpfung und Depersonalisation resultierend, oder auch als Parallelerscheinung, folgt die dritte Komponente im Burnout-Modell, die Reduzierte Leistungsfähigkeit. Sie geht als Selbstbeurteilungs-Komponente mit einem steigenden Gefühl von Inkompetenz und sinkender Leistungsfähigkeit einher (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). In einer neueren Definition von Maslach (2003) wird Burnout beschrieben als „[...] psychological syndrome that involves a prolonged response to stressors in the workplace. Specifically, it involves the chronic strain that results from an incongruence, or misfit, between the worker and the job" (S. 189). Die dreidimensionale Struktur von Burnout hat sich dabei nicht geändert, die Definition umfasst nun aber alle Berufsgruppen, bei denen chronischer Stress auftreten kann, auch solche ohne eindeutige Personenorientierung.
2.1.2.3 Entwicklung von Burnout
Wie schon im vorangegangenen Abschnitt angedeutet, lässt sich Burnout nicht primär durch das Auftreten bestimmter Symptome beschreiben, sondern vielmehr durch einen charakteristischen Prozess. Prozesse, die zur Manifestation von Burn- out führen, wurden bisher von verschiedensten Wissenschaftlern in zahlreichen Phasen-Modellen beschrieben - Einigkeit wurde dabei nicht erzielt. Einige wichtige Modelle werden nachfolgend überblicksartig dargestellt, wobei in Anlehnung an Enzmann und Kleiber (1989) zwischen individuenzentrierten und arbeits- und organisationsbezogenen Ansätzen unterschieden wird.
Exemplarisch für individuenzentrierte Ansätze werden die Modelle Freudenbergers sowie Edelwichs und Brodskys dargestellt.
Freudenberger beschreibt zwei Phasen, wobei auf ein empfindendes Stadium, gekennzeichnet durch Müdigkeit und erhöhten Energieeinsatz zur Erhaltung des alten Leistungsniveaus, das empfindungslose Stadium folgt, in welchem Gleichgültigkeit, Zynismus, Reizbarkeit, Depressionen und psychosomatische Beschwerden dominieren. Als ursächlich für das Burnoutphänomen sieht Freudenberger im Wesentlichen den schnellen gesellschaftlichen Wandel, dessen Veränderungen zu Verunsicherung und der Suche nach Anerkennung im Beruf führen (Freudenberger & Richelson, 1983).
Edelwich und Brodsky (1980) sehen die Entwicklung von Burnout in einem vierstufigen Prozess fortschreitender Desillusionierung, an dessen Anfang eine idealistische Begeisterung steht, welche mit Selbstüberschätzung, hochgesteckten Zielen sowie einer Überidentifikation mit Klienten und mit der Arbeit einhergeht. Anschließend erfolgt eine Phase der Stagnation, die durch eine Reduzierung des Lebens auf die Arbeit geprägt ist und in der erste Enttäuschungen auftreten. Dies führt zu einer Frustrations-Phase, geprägt durch Gefühle von Inkompetenz, Erfolgs- und Machtlosigkeit, oft einhergehend mit psychosomatischen Erkrankungen. Letztlich endet der Prozess in einem Stadium der Apathie, welches durch völlige Desillusionierung, Verzweiflung, Resignation und Gleichgültigkeit charakterisiert ist. Ursächlich für diesen Desillusionierungs-Prozess ist demnach eine Überidentifikation der im Sozialbereich Tätigen mit ihren Klienten.
Als Vertreter arbeits- und organisationsbezogener Ansätze seien die Konzepte von Cherniss sowie von Leiter und Maslach vorgestellt.
Cherniss (1980), dessen Burnoutkonzept sehr umfassend und theoretisch gut fundiert ist, postuliert drei Phasen. An die Eingangsphase des Arbeitsstresses (resultierend aus einem Ungleichgewicht zwischen Ressourcen und Anforderungen) schließt sich eine Phase des Stillstandes (gekennzeichnet durch Ermüdung, innere Anspannung, Reizbarkeit und Erschöpfung) an, welche letztlich zu defensiven Bewältigungsversuchen (mit Rückzug, Zynismus und emotionaler Abkopplung) führt. Die Ursachen für Arbeitsstress und damit auch Burnout sieht Cherniss hauptsächlich in der Rollen- und Machtstruktur sowie in der normativen Struktur (Arbeitsphilosophie) einer Organisation, aber auch in gesellschaftlichen Veränderungen und Einstellungen gegenüber der Arbeit.
Leiter und Maslach (1988) unterteilen, wie bereits oben beschrieben, ebenfalls drei Phasen, wobei am Anfang des Prozesses ein Zustand emotionaler Erschöpfung (Müdigkeit beim Gedanken an die Arbeit) sowie physischer Erschöpfung (Schlafstörungen, Anfälligkeit für Erkrankungen) steht, der sich in einer durch Depersonalisation geprägten Phase fortsetzt. In dieser Phase treten unter anderem zynische Einstellungen gegenüber Kollegen und negative Gefühle gegenüber Patienten bzw. Klienten auf, und die Arbeit wird auf das Allernotwendigste reduziert Das letzte Stadium ist durch einen allgemeinen Widerwillen und reduzierte Leistungsfähigkeit gekennzeichnet. Den Autoren zufolge liegen die Ursachen des Burnouts im Wesentlichen in situationalen und institutionellen Merkmalen und erst sekundär im individuellen Umgang mit den daraus resultierenden Problemen.
Ein eher quantitatives Phasenmodell entwickelten Golembiewski, Munzenrieder und Stevenson (1986) indem sie die drei MBI-Skalen (Emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und Persönliche Leistungsfähigkeit) jeweils am Median dichoto- misierten und auf diesem Wege das in Abbildung 2.1.4.3 skizzierte Acht- Kategorien-System herausbildeten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2.1.4.3 Acht-Kategorien-System nach Golembiewski et al.
Das Phasenmodell legt nahe, dass sich Depersonalisation zuerst entwickelt und von Reduzierter Leistungsfähigkeit und Emotionaler Erschöpfung gefolgt wird, wobei die acht Kategorien als fortschreitende Verschlimmerungen zu verstehen sind.
Weitere Modelle gehen von bis zu zehn Phasen aus. Allerdings beruhen all diese Phasentheorien nicht auf systematischen empirischen Studien, sondern auf intuitiven Typisierungsversuchen. Da die individuellen Entwicklungen von Burnout sich gewaltig unterscheiden, sind solche Modelle oft zum Scheitern verurteilt. Weiterhin ließen sie sich erst dann beweisen, wenn die einzelnen Stadien klar definiert wären, was sie häufig nicht sind. Auch gibt es bis heute nur wenige Untersuchungen, die solche Phasenmodelle überprüft haben, was daran liegt dass die erforderlichen Längsschnittuntersuchungen mit erheblichem Aufwand verbunden wären. Parker und Salmela-Aro (2011) untersuchten vor kurzem die Vorhersagevalidität verschiedener Phasenmodelle, worunter sich auch die Modelle von Leiter und Maslach sowie von Golembiewski et al. befanden, in einer Längsschnittstudie mit vier Wellen (in Abständen von ca. einem Jahr) bei einer Stichprobe von 852 finnischen Schülern und Schülerinnen. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass Depersonalisation mit der Zeit zu einem Gefühl reduzierter persönlicher Leistungsfähigkeit führt, wie es die Modelle von Leiter und Maslach sowie von Golembiewski et al. nahelegen. Die Modelle von Leiter und Maslach sowie von Golembiewski et al. wurden bereits von Lee und Ashforth (1993) im Längsschnitt verglichen, wobei sie eine Stichprobe von 169 Vorgesetzten und Führungskräften in zwei Wellen mit einem Zeitabstand von acht Monaten untersuchten. Dabei war der Weg von emotionaler Erschöpfung zu Depersonalisation am meisten im Einklang mit den Daten und unterstützte somit teilweise das Modell von Leiter und Maslach. Auch Savicki und Cooley (1994) untersuchten die Modelle von Leiter und Maslach sowie von Golembiewski et al. bei 64 Kinderschutz-Arbeitern, welche zu zwei Zeitpunkten im Abstand von durchschnittlich 18 Monaten befragt wurden. Ihre Ergebnisse unterstützten allerdings weder das Modell von Leiter und Maslach, noch das von Golem- biewskie et al. eindeutig. Einzig Leiters und Maslachs Annahme, dass Depersonalisation auf einen Zustand emotionaler Erschöpfung folgt, konnte bestätigt werden. Ansonsten scheinen sich emotionale Erschöpfung, Depersonalisation und eine reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit parallel zu entwickeln und signifikant von Umgebungsvariablen beeinflusst zu sein, welche im nächsten Kapitel diskutiert werden.
2.1.2.4 Einflussfaktoren von Burnout
Untersuchungen zur Entstehung von Burnout haben sich in den vergangenen 35 Jahren vermehrt mit der Rolle individueller und situationaler Faktoren beschäftigt. Situationale Faktoren, welche sich auf den Arbeitskontext beziehen, gelten als ausschlaggebend für die Entwicklung des Burnout-Phänomens. Lee und Ashforth (1996) untersuchten in einer Metaanalyse Korrelate von Arbeitsanforderungen und Arbeitsressourcen auf die drei Burnout-Dimensionen. Dabei standen sowohl Anforderungen als auch Ressourcen stärker mit Emotionaler Erschöpfung in Zusammenhang als mit Depersonalisation oder Persönlicher Leistungsfähigkeit. Sie fanden korrigierte mittlere Korrelationen von r>.50 zwischen Emotionaler Erschöpfung und Arbeitsanforderungen wie Rollenkonflikte, Rollenstress, stressreiche Ereignisse, Arbeitsbelastung und Arbeitsdruck; sowie Korrelationen von r> |.30| zwischen Emotionaler Erschöpfung und Arbeitsressourcen wie soziale Unterstützung, Unterstützung durch Vorgesetzte, Zusammenhalt, Innovation, Partizipation, unerfüllten Erwartungen und nicht-kontingente Sanktionierungen.
Borritz et al. (2005) fanden in einem 3-Jahres-Follow-up der PUMA-Studie (siehe Borritz et al., 2006) folgende psychosoziale Arbeitsmerkmale als ausschlaggebende Prädiktoren für Burnout: Eine große Bedeutung von Arbeit, geringe Möglichkeiten der Weiterentwicklung, Qualität der Führung, geringe Vorhersagbarkeit, Rollenambiguität und Rollenkonflikte. Die Effekte über die Zeit von drei Rollenstress-Variablen (Rollenkonflikte, Rollenambiguität und Rollenüberlastung) auf die drei Burnout-Dimensionen testeten Peiró, González-Romá, Tordera und Mañas (2001) bei 145 Angestellten im Gesundheitswesen, die zu zwei Zeitpunkten im Abstand von einem Jahr befragt wurden. Die Ergebnisse der Langzeitstudie legen nahe, dass alle drei Rollenstress-Variablen im Laufe der Zeit Emotionale Erschöpfung vorhersagen können. Weiterhin konnten Rollenkonflikte und Rollenüberlastung im Laufe der Zeit Depersonalisation vorhersagen, und Rollenambiguität Persönliche Leistungsfähigkeit.
Als weitere Wirkungsvariable von Burnout nennen Maslach et al. (2001) Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, Mangel an sozialer Unterstützung, insbesondere durch Vorgesetzte, eine geringe Beteiligung bei Entscheidungsverfahren, sowie die Abwesenheit von Feedback. Außerdem nennen die Autoren berufsgruppenspezifische Merkmale, die zur Entwicklung von Burnout beitragen. Bedeutsam ist dabei vor allem der Anteil von Emotionsarbeit, den ein Beruf mit sich bringt. Darunter fällt zum Beispiel die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln, Emotionen zu zeigen oder unterdrücken zu können. Nicht zuletzt tragen auch organisationale Merkmale zur Manifestation von Burnout bei. Eine herausragende Rolle wird dabei den Werten zugeschrieben, die in Organisationsprozessen und -strukturen impliziert sind, da diese Werte die emotionale und kognitive Beziehung der Menschen in ihrer Arbeit prägen.
Zu den individuellen Faktoren, mit denen sich die Burnout-Forschung beschäftigt, zählen Maslach et al. (2001) demografische Variablen, Persönlichkeitseigenschaften und arbeitsbezogene Einstellungen. So haben demografische Analysen gezeigt, dass Burnout häufiger unter jüngeren Beschäftigten als unter älteren auftritt und mehr Singles als Verheiratete davon betroffen sind.
Hinsichtlich der Persönlichkeitsmerkmale konnte Semmer (1996, zitiert nach Maslach et al., 2001) zeigen, dass geringe Widerstandsfähigkeit, ein geringes Selbstwertgefühl, externale Kontrollüberzeugungen und ein vermeidender Coping- Stil typischerweise beim Persönlichkeitsprofil stressanfälliger Personen anzutreffen sind. Allerdings variieren solche Beziehungen von Studie zu Studie und sind nicht hinlänglich groß (Maslach, 2003). Unter existenzanalytischer Perspektive betrachteten Nindl, Längle, Gamsjäger und Sauer (2006) das Burnout-Phänomen und fanden bei 105 Lehrern einen signifikanten Zusammenhang zwischen mangelnder Sinnerfüllung (gemessen mit der Existenzskala) und allen Burnout- Dimensionen (gemessen mit dem Burnout-Inventar). Innere Leere und geistige Orientierungslosigkeit standen dabei in engem Zusammenhang zu Burnout (r = .446), während sich persönliche Offenheit und ein positives Lebensgefühl prophylaktisch auf Burnout auswirkten (r = -.605). In einer Längsschnittstudie von Burisch (2002) wurden 123 Krankenpflegestudenten in Hamburg über drei Jahre insgesamt sieben Mal unter anderem zu ihrer Persönlichkeit, Erfahrungen und Burnout befragt. Dabei zeigte sich, dass die Burnout-Werte zu den Zeitpunkten T2 bis T7 sowohl durch Erfahrungen (vor allem Emotionale Erschöpfung) als auch durch dispositionelle Variablen (vor allem Persönliche Leistungsfähigkeit und Depersonalisation) vorhergesagt werden konnten.
Als weiterer Risikofaktor für Burnout haben sich im Rahmen arbeitsbezogener Einstellungen vor allem hohe (idealistische bzw. unrealistische) Erwartungen an die eigenen Leistungen oder die Organisation herauskristallisiert.
[...]
[1] Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text bei Berufsbezeichnungen, Versuchsteilnehmern etc. häufig nur die maskuline Form verwendet, auch wenn es sich hierbei um Frauen handelt.
- Arbeit zitieren
- Anne-Maren Koch (Autor:in), 2011, Stress und Burnout bei Erzieherinnen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/191326
Kostenlos Autor werden


















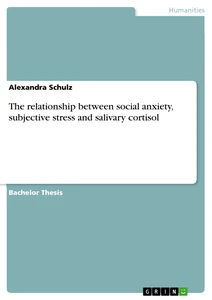

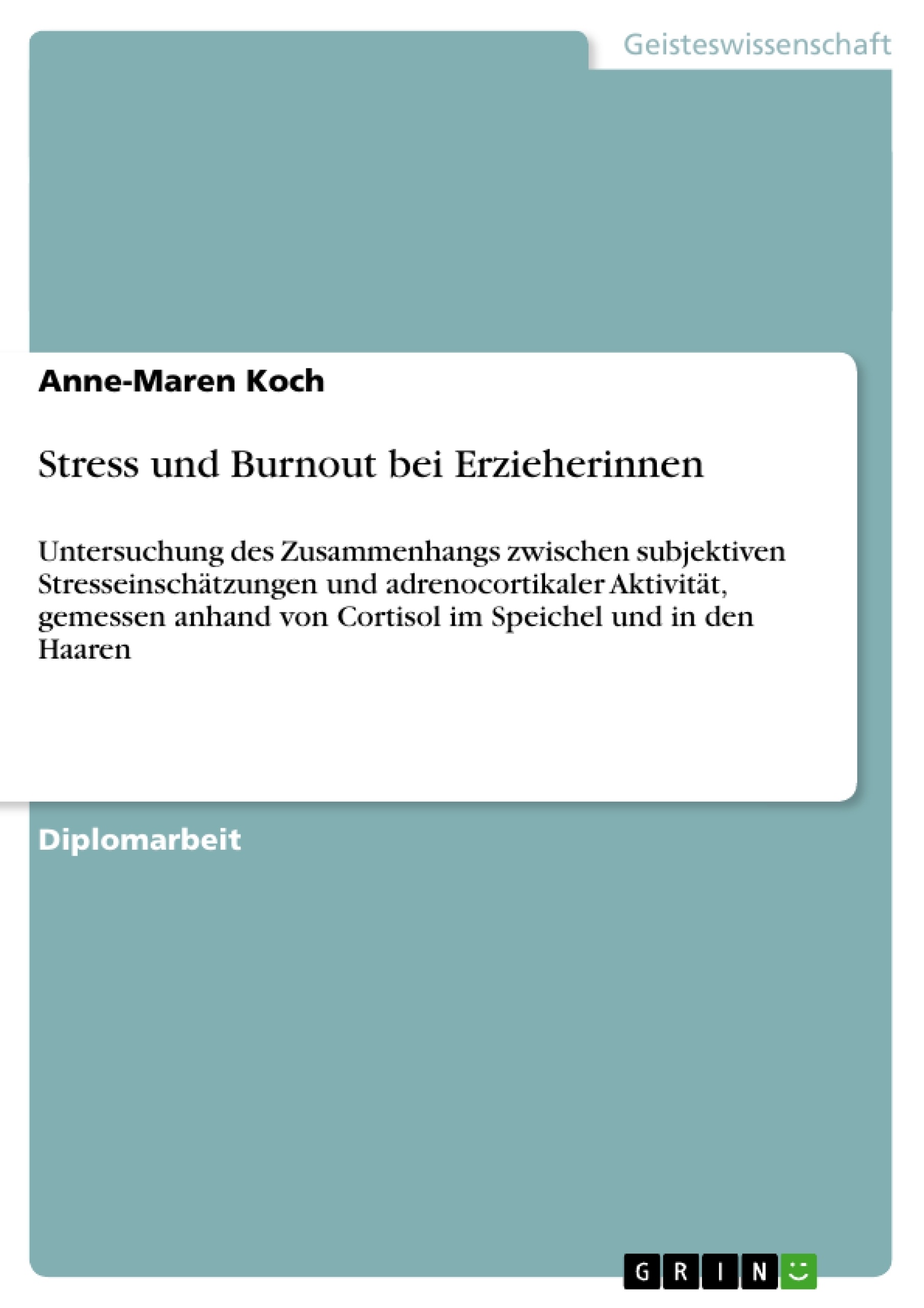

Kommentare