Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
DER MENSCH - EIN ÖKOLOGISCHES WESEN
EINLEITUNG
1. ÖKOLOGIE DES MENSCHEN
1.1 Allgemein voraussetzende Betrachtungen
1.2 Eine historische Betrachtung der Gattung Homo
1.3 Begrenzungsdruck
Begrenzung durch Hunger
Begrenzung durch aggressive Auseinandersetzung
Begrenzung durch Krankheit
1.4 Der Mensch und die Natur
2. ÖKOLOGIE DES MENSCHEN - VON DER STEINZEIT ZUM ACKERBAU
2.1 Ökologie und Ökonomie der Steinzeit
2.2 Das Beispiel der !Kung San
2.3 Begrenzungsdruck und Antwort der !Kung San
2.4 Übergang zum Ackerbau - Der neolithische Weltmodell-Wechsel
2.5 Ökologischer Ausblick
SCHLUßBEMERKUNG
DIE HYDRAULISCHE GESELLSCHAFT
EINLEITUNG
1. DER WEG ZUR HYDRAULISCHEN GESELLSCHAFT
2. NATÜRLICHE GRUNDLAGEN DER HYDRAULISCHEN GESELLSCHAFT
Mensch und Natur
Der natürliche Faktor Wasser
Weitere Faktoren
Die spezifischen Eigenschaften von Wasser
3. ZWINGENDE BEWÄSSERUNGSLANDWIRTSCHAFT?
4. BEWÄSSERUNGSLANDWIRTSCHAFT
Verschiedene Klimata
Energieertrag
5. ÖKONOMIE DER HYDRAULISCHEN AGRIKULTUR
Vorbereitungsarbeiten
Schutzarbeiten
Organisation der Arbeit
Folgen für die Führung
Regional unterschiedliche wasserbauliche Maßnahmen
Abflußregime und Astronomie
Weitere bauliche Unternehmungen
Aquädukte
Schiffahrtskanäle
Straßen
Kolossale Verteidigungsanlagen
Repräsentative Bauten
Wirtschaftliche Vormachtstellung
6. WEITERE KENNZEICHEN DER HYDRAULISCHEN GESELLSCHAFT
Manager
Buchhalter
Schriftliches Gedächtnis
Wasserverwaltung
Post
7. AUSÜBUNG DER MACHT
Macht nach außen - Das Kriegswesen
Macht nach innen
Folgen für das Individuum
8. ZUSAMMENFASSUNG
KAPITEL III
DER MENSCH - EIN KULTURELLES WESEN
EINLEITUNG
ISMAEL
GENESIS
ISMAEL
GENESIS
ISMAEL
ANHANG: GENESIS
Vorwort
Wasserbauer sind Menschen und arbeiten für Menschen.
Es sind menschliche Anstrengungen, das Wasser wissenschaftlich zu begreifen und es dann in vielerlei Form baulich zu umfassen, die den Wasserbau voranbringen. Der Mensch ist dabei das wollende und handelnde Subjekt im Wasserbau.
Er denkt, er will, er forscht, er entwirft, er plant, er setzt um, er schafft, er verwirk- licht. Immer ist der Mensch Ausgangspunkt des wasserbaulichen Tuns. Des weiteren dienen die von ihm geschaffenen wasserbaulichen Einrichtungen in erster Linie dem menschlichen Wohle. So gebraucht er, nutzt er, verbraucht er. Der Mensch ist also Ausgangspunkt und vorrangiges Ziel des Wasserbaus.1 Er hält die entscheidende Stellung inne, so gäbe es - trivialer Weise - ohne Menschen auch keinen Wasserbau.
Die nun folgenden Kapitel sind dem Menschen als Subjekt und Objekt des Was- serbaus gewidmet, sie möchten dem Menschen als Gegenstand des Wasserbaus Beachtung schenken. Allesamt gehen sie den Wurzeln des kulturellen Menschen nach. Kapitel I stellt den Menschen als ökologisches Wesen vor und folgt unseren Spuren bis in die Steinzeit, Kapitel II folgt einem anderen kulturellen Pfad, und stellt eine von den mitteleuropäischen sehr verschiedene Gesellschaftsform und deren Verflechtung mit wasserbaulichen Aktivitäten dar. Kapitel III schließlich verläßt den Weg der Wissenschaft und schafft einen doppelten literarischen Zugang zum kultu- rellen Werdegang des zivilisierten Menschen über den jüdisch-christlichen Schöp- fungsmythos, die Genesis.
Kapitel I Der Mensch - Ein ökologisches Wesen
Einleitung
Der Mensch kann der Gestalt als ökologisches Wesen betrachtet werden, in dem er mit seiner Umgebung vielerlei Wechselbeziehungen unterhält und auf Gedeih und Verderb in ein Ökosystem eingebunden ist.
War in frühen Zeiten der Wirkungsradius des Menschen auf einzelne Landstriche beschränkt, so bevölkert er seit einigen Jahrtausenden sämtliche Kontinente in zu- nehmender Zahl und besitzt heute die Möglichkeit in jeden noch so unwirtlichen Winkel der Erde vorzudringen. Als dieses Ökosystem muß somit zweifellos die ge- samte Erde mit all ihren geologischen und klimatologischen Gegebenheiten und der Gesamtheit ihrer tierischen und pflanzlichen Mitbewohner gelten. Trotz der über Jahrmillionen erlangten Fähigkeiten des Menschen, die Natur zu manipulieren und sein Lebensumfeld nach seinem Willen zu gestalten, trotz aller Bemühungen die Natur zu überwinden, bleibt ein Teil seiner Existenz in der Natur verhaften. Er ist gewissermaßen auf dreifache Weise mit der Natur verbunden:
Zuerst entstammt er ihr, ist Produkt ihrer schöpferischen Kraft. Zweitens ist er mit seinem Leben auf sie angewiesen, ist weiterhin Nutznießer ihres unablässigen Schöpfertums, nährt sich und erhält sich durch die Natur. Drittens hat sich der Mensch die Natur zunehmend Untertan gemacht, hat seinen Einfluß auf ihr Wirken durch seine zahlenmäßige und kulturelle Entwicklung enorm verstärkt. Immer mehr gerät die Natur in die Abhängigkeit des Menschen.
In der Folge soll der Mensch als eine die Erde bevölkernde Spezies, unter Berück- sichtigung seiner besonderen Stellung zur Natur, die ihn maßgeblich von anderen Spezies unterscheidet, betrachtet werden. Gleichsam aus zoologischem Blickwinkel wird der Mensch als eine Art unter Millionen von Lebewesen geschildert, wobei das Augenmerk, wie bei jeder Beschreibung einer bestimmten Spezies, auf deren Beson- derheiten liegt. Im zweiten Abschnitt wird vor dem Hintergrund eines evolutionären Weltbildes ein Abschnitt der Menschheitsgeschichte betrachtet, der sich durch seine zeitliche Ausdehnung - ca. 99% der Zeit seit Erscheinen der Gattung2 Homo - und durch seine für unsere schnellebige Zeit ausgesprochene Kontinuität auszeichnet: Die Steinzeit - ein Zeitraum zu dessen Ende hin der Mensch, oder besser gesagt ein Teil der Menschheit, sich aus der Einheit mit der Natur herauszuschälen begann und auf die ihm heute anhaftende Dreiwertigkeit seines Bezuges zur Natur zusteuerte.
Zuvor, im ersten Abschnitt werden biologische Prozesse, die für das Verständnis einer evolutionären Entwicklung des Menschen notwendig sind, sowie einige allge- meine Überlegungen zur Ökologie3 des Menschen und zum Menschen selbst erläu- tert.
Der Mensch teilt mit vielen seiner biosphärischen Mitbewohner Eigenschaften und natürliche Gegebenheiten, hat aber auch in erstaunlichem Ausmaß Fähigkeiten ent- wickelt, die ihn von anderen Lebewesen unterscheiden, und ihn zu einem wahrlich mit „ Inter-esse “ verfolgten Untersuchungsobjekt machen. Genau in diesem Interesse liegen aber auch Schwierigkeiten, die der zoologischen Betrachtung der Art Mensch, der Anthropologie, innewohnen. Zum einen ist es das Involviert-Sein, die Selbstge- richtetheit der Untersuchung, in der Betrachter und betrachtetes Objekt - als Mensch - zu einem beträchtlichen Teil identisch sind, das erschwert, Aussagen im Sinne einer objektiven Wissenschaft machen zu können. Zum anderen ist es das Interesse, die Tragweite der Fragen, die seit Jahrtausenden unseren Kulturkreis bewegen, und in großem Umfang der Anthropologie anhaften: die Frage nach unserer Herkunft, nach unserem Werdegang, nach unserer Stellung in der Natur, nach den Zusammenhängen unseres Daseins, die eine wissenschaftliche Untersuchung rasch in einer gewissen Färbung erscheinen lassen können. Die Farbpalette der Theorien ist breit und die Farben teilweise schillernd, nicht zuletzt weil die Datengrundlagen relativ dürftig und die Zusammenhänge sehr komplex sind.
Die folgenden Ausführungen versuchen ein mögliches wissenschaftliches Szena- rio des menschlichen Werdegangs zu geben. Es ist ein anthropologisches Szenario, mit dem Schwerpunkt auf der Ökologie des Menschen, immer betrachtet vor dem Hintergrund der Annahme einer evolvierenden Natur und Menschheit. Eine „menschliche“ Färbung läßt sich somit auch in diesem Bild nicht vermeiden. Aber es wird auf die vorgeschalteten Filter der Beleuchtung, die Licht in unsere graue Vor- zeit bringen soll, hingewiesen. Allzu schnell gewöhnt sich das Auge an eine Färbung. Zusätzlich werden andere Theorien, andere Färbungen angedeutet.
Blicke ins nahe Tierreich und auf unser heutiges Mensch-Sein runden das Szenario ab, geben Bezugspunkte und betten das Szenario ein in die großen Zusammenhänge, die der Mensch aufgrund seiner vielfältigen Wechselwirkungen mit der Umwelt und seiner Geschichtlichkeit unterhält.
1. Ökologie des Menschen
1.1 Allgemein voraussetzende Betrachtungen
Sämtliche hier folgende Überlegungen fußen auf der Annahme einer evolutionären Entwicklung des Lebens und mit ihm des Menschen. (vgl. Anhang A) »Alles Leben ist ein Leben in Grenzen«, so beginnt H. Markl4 seine Abhandlung über die ökologische Lage des Menschen. In der Tat ist das Leben eines jeden Orga-nismus in jeglicher Richtung beschränkt. Sein Leben erstreckt sich über eine endliche Zeitspanne, sein Lebensraum ist beschränkt und auch sein Handlungspotential end-lich. Auch seinem individuellen Vermögen sich fortzupflanzen sind Grenzen aufer-legt. Der Mensch, in seiner Eigenart als sehr erfinderischer Organismus, weitet diese Grenzen zwar in alle Richtungen, aber zu einem Aufheben derselben ist auch er nicht in der Lage. Vorzüglich ist es die Umwelt, die jedem Organismus gewisse Faktoren auferlegt und ihn somit in seiner Existenz beschränkt. Letztendlich wirken für den Organismus zu Verfügung stehende Ressourcen und immer knappe Güter als Be-schränkung seiner ungehemmten Entwicklung entgegen. Und Ressourcen, mögen sie aus der Nähe betrachtet und mit eingeschränkter Perspektive auch noch so unend-lich erscheinen, sind letzten Endes immer endlich. Mag den ersten Einwanderern des amerikanischen Kontinentes die Prärie und das weite Land auch noch so unbegrenzt vorgekommen sein, es besitzt eine endliche Ausdehnung; das wurde den Bewohnern in den später folgenden Fehden und Kriegen schmerzlich bewußt. Selbiges gilt für Energieressourcen, gleich ob organisch gespeicherte Energie für Fleisch- und Pflan-zenfresser, solare Energie für Pflanzen, oder - die für unsere Zivilisation von so grundlegender Bedeutung gewordenen fossilen Brennstoffe, Atomkraft oder Wind-Wasser- und Sonnenenergie. Es liegt einzig an der Wahl des Maßstabes, der uns die Grenzen einer Ressource aufzuzeigen vermag oder nicht, die Annahme einer Unbe-grenztheit ist aber schlicht falsch und gefährlich.
In dem 1798 erschienenen Buch »An Essay on the Principle of Population« bemerkt Thomas Malthus5, englischer Nationalökonom, über den Menschen, daß er imstande sei, mehr Nachkommen hervorzubringen, als Eltern vorhanden sind. Darwin6 und Liebig7 zeigten später, daß dies für die gesamte belebte Natur gilt. Das bedeutet jeder Organismus besitzt das Potential einer lawinenhaften Vermehrung mit exponentiel- lem Wachstum. Jede Art könnte also seinen Lebensraum in wenigen Generationen mit Artgenossen überschwemmen.8 Daß dies in der natürlichen Umwelt nicht ein- tritt, dafür sorgen zwei biologische Mechanismen. Zum einen wird dem Wachstum über kurz oder lang zwangsläufig ein Ende gesetzt, wenn die wachsende Population an die Grenze der knappsten, nicht durch andere ersetzbare Ressource stößt. Zum anderen verfügt keine Art über knappe Ressourcen, die ausschließlich von ihr benö- tigt werden, so daß es zwischen Arten zu einem Konkurrieren um das benötigte Gut kommt. Die Konkurrenz führt zu einem zusätzlichen Begrenzungsdruck, der vor dem Erreichen der Ressourcengrenze für die Konkurrenten spürbar wird. Ist ein Konkurrent besonders erfolgreich so vermag er - wie der Mensch - viele Konkurren- ten auszuschalten und deren Ressourcenanteil zunehmend einzuvernehmen.
Die absolute Ressourcengrenze bleibt dennoch erhalten. Diese Grenze ist für den einzelnen Organismus in seiner Lebensumgebung nicht statisch. Erschließung noch nicht genutzter Vorkommen, eine verbesserte Ausnutzung oder günstige Umwelt- faktoren können die Grenzen hinausschieben. Aber auch in ungünstige Richtung sind Grenzverschiebungen möglich. Man denke nur an Klimaänderungen, die Eiszei- ten oder - heute aktueller - die Versteppung. Auch vermögen Lebewesen, und hier wieder ganz besonders der Mensch, ihre Lebensgrundlage durch Übernutzung und Umweltbelastung zu zerstören, indem sie nicht nur den Produktionszuwachs ab- schöpfen, sondern darüber hinaus das natürliche Produktionskapital aufbrauchen und damit die Regeneration vereiteln. So übernutzt der Mensch beispielsweise nicht nur seine erschlossenen Trinkwasserquellen durch übermäßige Entnahme, sondern vermindert zudem die natürlichen Reinigungsmöglichkeiten des Bodens und be- lastet das Wasser zunehmend mit Schadstoffen.
Die angeführten Prinzipien sind allgemeine Existenzbedingungen, die basierend auf einem evolutionären Naturmodell, für alle Organismen Gültigkeit besitzen und inso- fern auch im speziellen für den Menschen, soweit er als Naturwesen sich in diese Lebensnatur eingliedert und von begrenzten Gütern abhängig ist, die ihm die Natur zur Verfügung stellt.
Es ist entscheidend zu begreifen, daß ökologische Krisen - und diese haben wir bei einer historischen Betrachtung der menschlichen Ökologie zu beachten - im Grunde Dichtekrisen sind. Bei dieser Dichte handelt es sich um das Verhältnis von Populati- onsgröße zu Ressourcenbasis. Eine übermäßige Erhöhung dieser Dichte führt zur Krise. Dabei reicht es im allgemeinen bei Pflanzen- und Tierarten aus, die „Kopfzahl“ im Verhältnis zur Lebensraumfläche zu betrachten, da die benötigten Ressourcen im groben Durchschnitt flächig verteilt sind und jedes Exemplar etwa gleich viel ver- braucht. Die Dichte nimmt somit bei steigender Kopfzahl gleichbleibend proportio- nal zu. Beim heutigen Menschen jedoch führt eine solche einfache Betrachtung in die Irre. Der Mensch verbraucht durch seine zivilisatorischen Tätigkeiten weit mehr Energie, Rohstoffe und Lebensraum als zur Deckung seiner biologischen Bedürfnisse vonnöten wären. Auch ist sein Ressourcenbedarf von Nationalität und sozialer Schicht abhängig, so daß innerhalb der Gesamtpopulation starke Schwankungen des Konsums auftreten. Zum Beispiel verbraucht ein Amerikaner im Durchschnitt das Sechzigfache, ein Deutscher das Dreißigfache an nicht erneuerbaren Energieressour- cen, als ein Inder. Ein Deutscher „belastet“ die Umwelt etwa in gleichem Maße wie das eine gesamte Großfamilie in einem Dritte-Welt-Land tut. Hinzu kommt, daß die flächige Gleichverteilung nicht mehr gegeben ist. Eine Stadt kann ihre Bevölkerung nicht allein mit Nahrungsmitteln und anderen Ressourcen aus der Umgebung ver- sorgen, nur Handel und der Transport von Gütern über große Distanzen - unter erheblichem Energieverbrauch, ermöglicht eine solch hohe Populationsdichte, wie sie in Städten herrscht.
1.2 Eine historische Betrachtung der Gattung Homo
Will man sich die heutige ökologische Lage der Menschheit vor Augen führen, so muß man zunächst ganz ökonomisch die Produktionsleistungen der Natur mit der Inanspruchnahme durch die Menschheit quantitativ vergleichen.
Für einen Überblick und die Einordnung der Größenordnungen des menschlichen Ressourcenbedarfs ist es zuerst nützlich die Entwicklung der Gesamtgröße der Menschheitspopulation seit dem Erscheinen der ersten menschlichen Wesen vor vier Millionen Jahren (Australopithecus), beziehungsweise vor über zwei Millionen Jah- ren (Homo habilis), zu betrachten. Man9 geht davon aus, daß die altsteinzeitliche Bevölkerung bis zum Erreichen der Homo sapiens Stufe vor 300.000 bis 400.000 Jah- ren in der Größenordnung von einer Million Menschen lag. Diese Schätzungen sind höchst ungenau und ergeben sich im wesentlichen aus Annahmen über die damalige Verbreitung des Menschen über die Erde, die erschließbaren Habitate und der Be- völkerungsdichte, die auf dieser Kulturstufe ihr Auskommen finden konnte. Ein Mensch benötigte danach zum Überleben eine minimale Fläche von 2,5 Quadratki- lometern. Am Übergang des Paläolithikums zum Mesolithikum vor einigen 10.000 Jahren dürfte die Gesamtbevölkerung auf drei bis fünf Millionen angewachsen sein, was einer Bevölkerungsdichte von einem Menschen pro 25 Quadratkilometer ent- spricht. Am Ende des Pleistozän10 und am Übergang zum Neolithikum11, der Schwel- le zur Ernährung durch Ackerbau vor 8.000 bis 10.000 Jahren betrug die Erdbevölke- rung nach Schätzungen mehrerer Autoren zwischen 5 und 15 Millionen Menschen, womit für Jäger- und Sammlerverhältnisse die Erde voll mit Menschen angefüllt gewesen sein dürfte12. Bereits am Ende des Neolithikum vor 3.500 Jahren beherbergte die Erde wohl 40 bis 50 Millionen, zu Christi Geburt werden 200 bis 300 Millionen geschätzt, 1650 betrug die Menschheit 500 Millionen Individuen und 1850 war die eine Milliarde Grenze erreicht. 1930 lebten 2 Milliarden Menschen, 1980 4,5 Milliarden und heute 6 Milliarden menschliche Wesen. Die menschliche Biomasse beläuft sich heute auf eine Summe von 270 Millionen Tonnen. Die Zuwachsrate pro Jahr liegt gegenwärtig etwa bei 1,5 Prozent. Gemessen an der Gesamtmenge, der seit Entstehung des Homo sapiens vor ca. 300.000 Jahren überhaupt existierenden Men- schen, die sich auf etwa 60 Milliarden belaufen dürfte, leben heute 10 Prozent gleich- zeitig. Anhand dieser Zahlen von einer Bevölkerungsexplosion zu reden, dürfte nicht übertrieben sein. Die Zunahme der Bevölkerung vollzog sich erst langsam, beschleu- nigte aber seit der Nutzung des Ackerbaus zunehmend rascher.
Aber die ökologische Belastung durch eine derartige Zunahme der Population wird noch um ein Vielfaches durch die kulturelle Entwicklung des Menschen erhöht. Schon allein zur Nahrungsversorgung steigt der benötigte Ressourcenbedarf mit der Zeit überproportional an. Je „zivilisierter“ der Mensch wird, desto reichlicher wählt er sich Nahrung und Getränke und desto aufwendiger wird ihre Zubereitung, so daß deren Herstellung - inklusive der Umwandlung von Pflanzen in tierisches Fleisch - schließlich das Mehrfache an pflanzlicher Primärproduktion erfordert, die für die Deckung seines rein biologischen Grundbedarfs nötig wären, ungeachtet aller ande- ren Güter, die zu seinem zivilisierten Leben beitragen. Da die Tragekapazität eines Lebensraumes für eine tierische Population zunächst vom Nahrungsangebot abhän- gig ist, diese letztendlich aber immer auf die pflanzliche Primärproduktion zurück- greift, ist es sinnvoll die Entwicklung der Menschheit unter Bezugnahme auf diese pflanzliche Primärgröße zu betrachten.
Grundsätzlich kann die Biosphäre der Erde als ein großes Solarsystem verstanden werden. Die Sonne ist mit Abstand die bedeutendste natürliche Energiequelle13. In den von ihr ausgehenden Energiefluß schalten sich die verschiedenen Spezies nach den jeweils spezifischen Merkmalen ihres Stoffwechsels ein. So wird Sonnenenergie in den Pflanzen direkt gespeichert. Diesen Energiespeicher zapfen Pflanzenfresser an, in dem sie diese fressen. Fleischfresser bedienen sich an Pflanzenfressern und die Destruenten leben sowohl von der Energie der Pflanzen als auch der Konsumenten. Die Gesamtmenge der Energie, die von allen Organismen umgesetzt wird, ist daher in der natürlichen Biosphäre der Erde von der Energiemenge abhängig, die Pflanzen photosynthetisch speichern.
Anhand der pflanzlichen Primärproduktion läßt sich der Vergleich von natürli- chem Angebot und menschlicher Nachfrage sehr gut aufstellen. Das Biowesen Mensch verbraucht bei Deckung seiner biologischen Grundbedürfnisse unter günsti- gen Klimabedingungen pro Tag etwa 10.000 Kilojoule14 Nahrungsenergie. Summiert über die gesamte Menschheit ergibt das einen Grundenergiebedarf von 2,19*1016 kJ
pro Jahr. Dies entspricht 0,7 Prozent der gesamten pflanzlichen Nettojahresproduktion auf der Erde. Bei diesem - relativ klein scheinenden - Betrag bleibt es aber nicht. Durch Veredelung pflanzlicher Rohstoffe, sei es in Form von Verfütterung an Nutztiere (wobei nur etwa 10% der pflanzlichen Kalorien dem Menschen schließlich als tierische Nahrung zur Verfügung stehen) oder Vergärung durch Mikroorganismen, sowie durch Verlust, Verschwendung und anderweitige Nutzung pflanzlicher Biomasse nimmt der Mensch schließlich ca. 7 Prozent des photosynthetischen Jahreshaushalts in Anspruch. Allerdings nimmt auch hier die Wachstumsrate überproportional zu, so daß mit einer Verdopplung in wenigen Jahrzehnten zu rechnen ist. Für mehrere Millionen anderer Tierarten bleibt der Rest.
Bis vor wenigen Jahrtausenden betrug der Bedarf des Menschen noch weniger als 0,001 Prozent. Die Vertausendfachung des menschlichen Bedarfes an der pflanzli- chen Primärproduktion mußte zwangsläufig auf Kosten anderer tierischer Konkur- renten gehen, was zu einem rapiden Rückgang der Artenvielfalt führte. Diese aber ist Voraussetzung für die Erhaltung stabiler Ökosysteme, von deren bleibender Produk- tivität wiederum auch die Zukunft des Menschen abhängt. Die Frage ob die Menschheit die Grenze des ökologisch Tragbaren bereits erreicht oder schon über- schritten hat, ist angesichts der offensichtlichen Nähe zu ihr und des andauernden Wachstums im Grunde unbedeutend.
Schon allein die Betrachtung der energetischen Basis menschlichen Lebens - der Nahrung macht deutlich, daß ein weiterer Wachstum der menschlichen Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten verheerende Auswirkungen haben würde (ganz zu Schweigen von seinem Wasserbedarf). Es kann kein Zweifel bestehen, Umdenken tut Not, die Erde benötigt einen Berstschutz.
Es genügt aber nicht, nur den Nahrungsmittelbedarf aufgrund von Pflanzenproduktion zu betrachten. Der Kulturmensch, soweit er die Stufe des einfachen Wildbeuters verlassen hat, beansprucht ja darüber hinaus viele andere, zum Teil regenerative, zum Teil nicht erneuerbare Ressourcen, angefangen vom Wasser über den Boden, die Luft, deren zunehmend anthropogene Verschmutzung alles Leben gefährdet, über die Ressource Raum bis hin zu den fossilen und atomaren Energieträgern, auf denen unser Wohlstand hauptsächlich aufbaut.
Ein besonders gut geeignetes Maß für das Anwachsen der Inanspruchnahme von Umweltressourcen durch den kulturellen Menschen stellt der Energieverbrauch dar. Jegliche technische Entwicklung und Erhöhung des materiellen Lebensstandards, angefangen bei der gesteigerten Produktion durch Ackerbau über die Gewinnung und Verwertung von nicht-biologischen Rohstoffen bis zur Steigerung des Wohn- komforts, des Konsums und Transportvorkommens hängt unmittelbar mit einem erhöhten Energiebedarf zusammen. Ein Merkmal dieser technisch-energetischen Prozesse ist, daß die zur Vollführung dieser Prozesse verwendete Energie nicht re- zyklierbar ist.15 Ein Mitglied eines Dritte-Welt-Staates, der nach westlichem Maßstab das Prädikat „unterentwickelt“ erhält, benötigt auf Agrikulturstufe für sein klägli- ches Auskommen mehr als das 25-fache dessen, was seinem biologischen Grundbe- darf an Nahrungsenergie entspricht. Ein Durchschnittseuropäer braucht für seinen Lebensstil das 2.500-fache und ein Amerikaner schließlich das 5.000-fache! In der Summe ergibt sich somit für die gesamte Erdbevölkerung ein Gesamtenergie- verbrauch von 40*1016 kJ pro Jahr. Das entspricht 13% der Gesamtenergie, die das globale Ökosystem aus geologischer und kosmischer Energie in Form pflanzlicher Primärproduktion umzuwandeln imstande ist. Keiner anderen Art Lebewesen ist es auf dieser Erde gelungen, ihren Ressourcenbedarf während ihrer Millionen Jahre dauernden Entwicklung auch nur ansatzweise in dem Maße auszudehnen wie es dem Menschen gelang.
Auch hier sind die ökologischen Grenzen deutlich ins Blickfeld gerückt. Der mo- derne Mensch muß innerhalb der nächsten Jahrzehnte, will er einem ökologischen Kollaps seiner Lebensgrundlagen (mit all seinen materiellen und sozialen Auswir- kungen, die in Form von Mangel, Krieg und Elend die Vorhut bilden) entgehen, von seinem auf Wachstum abzielenden kulturell geprägten Verhalten Abschied nehmen. Sowohl sein Vermehrungsverhalten wie auch die globale, auf Verbrauchsexpansion angelegte Wirtschaftsstrategie der letzten 10.000 Jahre führen zu einem Auszehren des Ökosystems Erde und zu einer Vernichtung der menschlichen Lebensgrundla- gen.
1.3 Begrenzungsdruck
Will man aus einer ökologisch-anthropologischen Betrachtung der Menschheitsge- schichte Erkenntnis schöpfen und für den weiteren Werdegang der Menschen Leh- ren ziehen, dann sind vor allem die folgenden zwei Fragen von Interesse: Zum einen, wie wirkt sich allgemein der ökologische Begrenzungsdruck auf biologische Popula- tionen aus? Dies bildet gleichermaßen den biologischen Hintergrund für unsere Lage, ohne die Beachtung des kulturellen Überbaus, der uns von unseren tierischen Mitbewohnern unterscheidet.16 Zum anderen, wie hat der Mensch in der Vergangen- heit seiner Entwicklung - einschließlich seiner kulturellen Potenz - auf solchen Be- grenzungsdruck geantwortet?
Es läßt sich nämlich zeigen, daß die heutige Lage der Menschheit zwar wohl in ihrer Dimension, keineswegs aber in ihrer Art einmalig ist. Auch zu früheren Zeiten mußte der Mensch, auch auf niederstem kulturellen Niveau, auf ökologischen Begrenzungsdruck reagieren. Eine Geschichte der Menschheit ist, wie die Geschichte jeder evolvierenden Art, eine Geschichte der Anpassung. Eine Geschichte - bereichert durch das planerische menschliche Moment, deren Verlauf nicht zuletzt bestimmt wurde (und wird) durch die spezifisch menschlichen Fähigkeiten seiner geistigen Leistungskraft und ihrer kulturellen Umsetzungen.
Kommen wir zur ersten Frage. Bei tierischen Populationen, wurde schon erwähnt, liegt die potentielle Reproduktionsrate weit über eins. Dies bedeutet aber keineswegs, daß diese in der Natur maximal ausgeschöpft wird. Die tatsächliche Zahl der gelegten Eier oder der geborenen Jungen in der Natur liegt meist weit unterhalb dieser Grenze. Die Selektion begünstigt nicht Organismen mit den höchsten Geburtenraten, sondern vielmehr diejenigen Organismen, die unter gegebenen Umweltbedingungen und Verhaltensmöglichkeiten möglichst viel erwachsenen, das heißt selbst wieder fortpflanzungsfähigen Nachwuchs hervorzubringen in der Lage sind (biologische Fitness, siehe Darwins Selektionstheorie).
Das Problem das dabei von diesen Organismen zu lösen ist, kann mit dem klassischen ökonomischen Allokationsproblem umschrieben werden, das heißt: die begrenzten, teuren Produktionsmittel so einsetzen, daß ein optimaler Ertrag daraus resultiert. Die Erzeugung eines neuen Organismus ist dabei je nach Art nur ein mehr oder wenig großer Anteil des Gesamtaufwandes. Die Investitionen für die Partnergewinnung, die Brutpflege, die Aufzucht, der Schutz vor Feinden und nicht zuletzt die eigene Erhaltung spielen dabei eine nicht minder große Rolle. Somit kann ein Weniger an Nachwuchs durchaus eine größere Überlebenschance für eine Art (oder auch eine menschliche Gesellschaft) bedeuten.17
Manche Organismen haben sich auch durch den Konkurrenzdruck derart auf eine bestimmte Ressourcennutzung spezialisiert, daß der Lebensraum, der ihren Bedürfnissen entspricht, sehr klein ist und ihre Zahl von dieser Grenze her klein bleiben muß. Eine rasche Vermehrung würde einen sehr großen Begrenzungsdruck auf die Art selbst ausüben und ist somit nicht erstrebenswert. Viele Arten halten eine über längere Zeiträume konstante Populationsdichte und erwecken somit den Eindruck, sich stabil an die Umweltgrenzen angepaßt zu haben. Der Schein trügt allerdings, das Potential zur Expansion besitzen sie alle.
Umgekehrt, würde es ihnen fehlen, oder käme es einer Art durch Inzuchtdefekte abhanden, wäre die betroffene Art bald zum Verlöschen bestimmt. Nur durch ein Vermehrungspotential, das gegebenenfalls auch eine Expansion ermöglicht, können Arten auf Umweltveränderungen angemessen reagieren, können ein verbessertes Nahrungsangebot nutzen, müssen im Konkurrenzfall einer anderen expandierenden Art nicht zum Opfer fallen und können eigene genetische Defekte oder eine erlittene Dezimierung ausgleichen. Am augenfälligsten wird für uns dieses Expansionspoten- tial bei unseren Schädlingen - was soviel heißt wie unseren Nahrungskonkurrenten - wie Schaben oder Ratten beispielsweise, die in der Tat von ihrem Expansionspotenti- al reichlich Gebrauch machen. Diese opportunistischen Kolonisatoren können jede sich neu bietende Ressourcenlücke rasch ausfüllen.
Wodurch werden aber die einzelnen Populationen, gleich ob sich langsam oder rasch vermehrende, letzten Endes in Grenzen gehalten? Malthus hat für unsere eigene Spezies diese Frage beantwortet. Er fand vier Faktoren, heute dichteabh ä ngige Kon- trollfaktoren von Populationen genannt, die dem grenzenlosen Wachstum einen Riegel vorschieben: Hunger, Krieg, Krankheit und moralische Selbstbeschränkung, also bewußter Verzicht auf die drohende Überbevölkerung. Ob er mit diesen vier Fakto- ren für die Menschheit richtig lag, wird die Zukunft erweisen. Für nicht-menschliche Populationen beschreiben die Faktoren, abgesehen von dem letzten, der bewußten Beschränkung, die Vorgänge - mit gewissen Ergänzungen - sehr treffend. Werfen wir einen näheren Blick auf die wachstumsbegrenzenden Faktoren von Organismen.
Begrenzung durch Hunger
Die wohl elementarste Beschränkung des Wachstums stellt wohl der Nahrungsman- gel dar. Nur eine ausreichende Nahrungsbasis kann das Überleben der Eltern wie auch der Nachkommen sichern. Sinkt das Nahrungsangebot oder steigt die Zahl der Esser, beides bedeutet einen Dichtezuwachs, geraten die Nahrungssuchenden unter Druck. Dem Konkurrenten der eigenen oder auch einer anderen Art muß zuvorge- kommen werden, oder er muß vertrieben werden. Beides bedeutet Anstrengung, das heißt Energieverbrauch. Übersteigt nun der Energieverbrauch zur Nahrungsbeschaf- fung den der erhaltenen Nahrung, so sind die Nahrungsgrenzen erreicht.
Ein Sinken des Nahrungsangebotes kann durchaus von den Lebensaktivitäten der nutzenden Art provoziert werden. Übernutzung durch Kahlfraß oder Sauerstoffzeh- rung in Gewässern können nicht nur fatale Folgen für die eigene Art haben, sondern im Extremfall ein ganzes Ökosystem kippen. Außerdem können Nahrungsressour- cen auch durch nicht-biologische Einwirkungen geschmälert werden, wie zum Bei- spiel Eiszeiten, Vulkanausbrüche, Überflutungen, Verseuchung, etc. Häufig schwankt das Nahrungsangebot periodisch und vorhersehbar (Jahreszeiten), oft aber auch unvoraussagbar. Eine Art, die jede Erweiterung des Nahrungsangebotes elas- tisch mitvollzieht und gänzlich ausschöpft, wird unumgänglich bei sinkendem An- gebot unter Hungerdruck geraten.
Begrenzung durch aggressive Auseinandersetzung
Krieg ist ein kulturspezifischer Terminus, der genaugenommen nur für menschliches Handeln zutreffen kann. Aggressive Auseinandersetzungen um Ressourcen oder ressourcenreiche Territorien findet man aber auch sehr wohl im Tier- und Pflanzen- reich. Selbst bei ortsfesten, schier unbeweglichen Organismen wie Korallenstöcken oder Pflanzen, ist diese Art der Begrenzung ein sehr wirksamer und weit verbreiteter Faktor. Wenn beispielsweise alle Reviere belegt und die Ressourcen damit verteilt sind, bleibt für die Habenichtse wenig Überlebensraum und kaum eine Chance zur Vermehrung. Nur durch Kampf oder heimliches Erschleichen kann eine Ressource erlangt werden. Artgenossen stellen im übrigen auch oftmals eine knappe Ressource dar. In ihrer jeweiligen Funktion als Geschlechtspartner, Elternteil, als Mitstreiter im Überlebenskampf oder als Arbeitsteilender sind Artgenossen sehr begehrt. (Unter diesen Malthusschen Kontrollfaktor fiele somit auch der Trojanische Krieg18.)
Begrenzung durch Krankheit
Es ist kein Geheimnis, daß Krankheiten und Parasiten sich um so effizienter ausbrei- ten können, je dichter ihre Wirte und Opfer zusammenleben. Zudem spielt die Schwächung durch Hunger und Kämpfe unter Druck geratener Populationen eine Rolle. Für Tiere (und Pflanzen) gibt es noch eine weitere krankheitsähnliche Bedrohung, die Freßfeinde. Je zahlreicher eine Beutepopulation wird, desto einfacher läßt sie sich durch Raubtiere jagen, was zudem einen Anstieg des Räuberbestandes zur Folge hat. Das etwas einseitige Verhältnis zwischen Räuber und Beute oder Parasit und Wirt kann durch seine Einseitigkeit rasch zu einem Instabilwerden des Gleichgewichtes führen, da ein zu wirkungsvoller Räuber oder Parasit sich selbst die Nahrungsgrundlage entzieht. Stehen aber Ersatzbeute oder -wirte zur Verfügung, kann auch diese Form der Begrenzung für die betroffene Art den Untergang bedeuten, wie der Räuber (oder Parasit?) Mensch mehr als einmal bewies.
Diese drei Begrenzungsfaktoren stehen im natürlichen Regelkreis oft in Beziehung zueinander, so wird Krieg aufgrund von Hunger geführt und Krankheiten können sich unter diesen Bedingungen besser ausbreiten, was wiederum die Kriegslust hemmt, usw.
Ergänzend zu den drei obengenannten Kontrollfaktoren muß hier noch die Be- grenzung durch innere Konstruktionsgrenzen genannt werden. Jede Art ist nach ihrem Körperbau und ihren spezifisch physiologischen (und psychologischen) Fä- higkeiten beschränkt. Durch ihre Seinsart ist sie an gewisse äußere Umweltbedin- gungen gebunden und ihr steht zum Überleben auch nur eine beschränkte Anzahl an Verhaltensstrategien offen. Eine hungernde Schildkröte kann sich nicht einfach in die Lüfte erheben, auch wenn es dort noch soviel Nahrung für sie gäbe. (Nein, sie muß warten bis diese vom Himmel fällt.) Je enger eine Art aber spezialisiert ist, was ihr den Vorteil intensiver Nutzung einer Nische gibt, desto unwahrscheinlicher ist es, daß sie andere, ihr bislang unzugängliche Nischen rasch besetzen kann. Generalisten nutzen zwar ihre Räume weniger effizient, können sich aber andererseits neuen Herausforderungen schneller anpassen.
Die erste der obengenannten Fragen, die nach den Auswirkungen des Begrenzungsdrucks, wäre hiermit ganz allgemein für Organismen hinreichend beantwortet und somit die biologisch-evolutionären Grundlagen für eine weitergehende Betrachtung der menschlichen Ökologie geschaffen.
Auch entwicklungsgeschichtlich gesehen bilden diese Regelmechanismen gleich- sam den natürlichen Hintergrund, aus dem der Mensch über die Entwicklung von seinen Primatenvorfahren langsam einen Schritt heraustritt und sich als Jäger und Sammler - die Natur ein Stück weit hinter sich lassend - als kulturfähiges Wesen neue Räume und neue menschliche Verhaltensweisen im Umgang mit Begrenzungs- druck erschließt. Diese neuen Möglichkeiten, die dem Menschen durch seine geistige Potenz zugänglich werden, und die er in der Folge nutzbringend in seinen Überle- benskampf einbezieht, gilt es bei einer evolutionären Betrachtung des Menschen genauso zu berücksichtigen wie die rein biologischen „geistlosen“ Prozesse. Ohne die Beachtung der geistigen Fähigkeiten und deren fundamentaler Auswirkungen auf seine Lebensumstände, muß eine Beschreibung der Entwicklung des Menschen und dessen Wechselbeziehung mit seiner Umwelt fehlschlagen.
Wenden wir unseren Blick nun auf das Verhältnis, das der Mensch zu seiner Umgebung hatte und hat. Inwiefern unterscheidet sich nun sein Verhältnis zur Außenwelt, zur Natur im Vergleich mit anderen Organismen?
1.4 Der Mensch und die Natur
Hubert Markl schreibt: »„Natürlich“ ist der Mensch ein biologisches Wesen, das heißt von Natur aus. Aber er ist es - im Gegensatz zu Tieren und Pflanzen - nicht ausschließlich, er ist es auch. Um es mit einem bekannten Wort- und Sinnspiel aus- zudrücken: Im Menschen ist seine biologische Natur auf mehrfache Weise „aufgeho- ben“. „Aufgehoben“ als aufbewahrt, da sie als wesentliche Grundbefindlichkeit seines Seins erhalten bleibt; „aufgehoben“ als emporgehoben, da sie in dem Kultur- wesen Mensch eine neue Verwirklichungsform des Lebendigen hervorgebracht hat, die zur vorhandenen Welt des physischen Seins die neue des Denkens über das Sein erschloß; „aufgehoben“ als überwunden, da die physische Natur, wiewohl Voraus- setzung allen Fühlens, Wollens und Denkens des Menschen, die Inhalte dieser geisti- gen Welt zwar beeinflußt, aber keineswegs zwingend bestimmen kann, da sie, aus der Zwangsläufigkeit natürlicher Ursache-Wirkung-Beziehungen die Möglichkeit der Freiheit des Denkens, Erfindens, Entscheidens hervorbrachte und damit diese Zwangsläufigkeit überwunden hat.«19
Die hier aufgeworfenen Fragen der Beziehung des Menschen zur Außenwelt, sei- nes Verhältnisses zur Natur und die uralte Frage nach dem „Wesen“ des Menschen sind Gegenstand verschiedener Disziplinen und haben seit Jahrhunderten unzählige Gemüter erhitzt. Man kommt buchstäblich über diese Fragen ins Philosophieren. Die Philosophie ist dann auch die klassische Disziplin, die sich mit diesen Fragen ausei- nandersetzt, und auch sie hat darauf eine Vielzahl verschiedenster Antworten gege- ben. So liegt obengenanntes Zitat wesentlich näher der Philosophie als der Biologie oder Anthropologie.
Die Notwendigkeit der Betrachtung der nicht-biologischen Seite im Bezug auf die evolvierende Art Mensch sehe auch ich gegeben, möchte aber darauf aufmerksam machen, daß diese Aussagen großteils keine empirisch gewonnenen Daten über den Menschen sind, sondern gefärbt durch in bestimmten Philosophien verhaftete Denkmodelle, die in erheblichem Maße voraussetzend die zu ziehenden Folgerungen mitbestimmen. In den gefolgerten Aussagen stecken grundlegende Annahmen über das Wesen der Welt, die den Zusammenhang Mensch-Natur je nach Annahme un- terschiedlich erscheinen lassen.20
Auch die Anthropologie und die Humanökologie beschäftigen sich mit derlei Fra- gestellungen, wenn auch in handfesterer, sprich datenlastigerer Weise. Aus ihrem Forschen ergeben sich - immer unter der Berücksichtigung eines zugrundeliegenden Weltbildes - folgende Erkenntnisse:
Die Eigenschaften, welche den Menschen zum vielseitigsten aller Generalisten machen, wurzeln in seinen hochentwickelten geistigen Fähigkeiten. Das Erdenken von Werkzeugen, die Umsetzung und ihre Anwendung ermöglichen ihm die Nut- zung von Nischen, welche ihm ohne dieselben wohl niemals zugänglich geworden wären. Dem Menschen sind im Laufe seiner Entwicklung weder Flügel, noch Flos- sen, noch Grabschaufeln gewachsen und dennoch vermag er sich in allen Elementen mit zunehmender Leichtigkeit zu bewegen. Seine Fähigkeit komplexe soziale Netze mit unterschiedlichsten Funktionen aufzubauen und vor allem sein einsichtiges Den- ken, das ihm eine Flexibilität und eine Anpassungsfähigkeit sondergleichen verlieh, ermöglichte es ihm, sich Zugang zu praktisch sämtlichen Lebensräumen auf der Erde zu verschaffen.
Markl trennt in obigem Zitat - und im Grundtenor seines gesamten Werkes scharf zwischen den natürlich-biologischen Mechanismen und den diese transzendierenden geistigen Fähigkeiten des Menschen. Bewußtsein entwickeln, Planen und abstraktes Denken sind Charakteristika des Menschen und werden allein ihm zugeschrieben. Für diese scharfe Trennung sehe ich keinen Anlaß, im Gegenteil sprechen empirische Forschungen sogar eher für eine Aufhebung dieser Trennung.
Wissenschaftliche Tatsache ist, daß „psychologische“ Untersuchungen von bei- spielsweise Papageien diesen einen „menschlichen“ Intelligenzquotienten vergleich- bar eines dreijährigen Kindes bescheinigen. Ebenfalls psychologisch muß man die Tests nennen, die klar zeigen, daß Schimpansen zu abstraktem sowie zu planeri- schem Denken in der Lage sind. Vielen anderen - meist Säugetierarten werden ähnli- che Fähigkeiten attestiert. Diese so gehegten menschlichen Charakteristika, die allzu oft als Rechtfertigung für seine exponierte Stellung und seine daraus abgeleiteten Rechte herhalten müssen, sind wohl weit weniger spezifisch menschlich, als man gemeinhin annimmt.
Naheliegend wäre, daß diese, im Umgang mit der natürlichen Umgebung so er- folgreichen, geistigen Fähigkeiten eben nur beim Menschen bisher zu einer solch eindrucksvollen Entfaltung gekommen sind, diese Fähigkeiten aber jeder Art zumin- dest potentiell, latent oder auch bis zu einem hohen Grad ausgeprägt und offensicht- lich zur Verfügung stehen. Vielleicht ist es unser Stolz, die Krone der Schöpfung sein zu wollen, der uns davon abhält, bei anderen Geschöpfen zu sehen und zu akzeptie- ren, was so einzigartig menschlich zu sein scheint. Vielleicht sind es auch die sich daraus ergebenden Konsequenzen, die Aufgabe unserer gottähnlichen oder zumin- dest gottnäheren Stellung als Beherrscher der Natur, die Zuschreibung von Rechten an die Mitgeschöpfe und die daraus erfolgende Beschränkung unserer Verfügungs- gewalt über die natürliche Umwelt, die es uns erschweren, die Augen zu öffnen. Eine Akzeptanz höher-geistiger tierischer Potenz würde ein starkes Umdenken erfordern und, eingebettet in unser westliches Ethikgebäude, uns eine größere Verantwortung unseren Mitgeschöpfen und geistigen kleinen Brüdern gegenüber aufbürden, die uns wiederum gewisse Entbehrungen abverlangen würde. Es könnte geschehen, daß die an uns so hochgeachtete Rationalität und Objektivität, die uns scheinbar aus der Tierwelt erhob, durch ihre Erkenntnisse selbst uns im Endeffekt wieder demütig in den Reihen einer evolvierenden Natur einzugliedern hat. Manch andere Kulturen, die einen wesentlich verschiedenen Naturbezug aufbauen, praktizieren (bspw. über ihre Religionen,) eine Achtung nichtmenschlicher Geschöpfe, auch ohne die Betonung derer uns so wichtigen rationalen Fähigkeiten.
»Auf der anderen Seite, dem Menschen seine geistigen Fähigkeiten abzuerkennen, ihn auf diese Weise mit seinen tierischen Verwandten gleichzustellen, hieße ihn sei- ner Würde zu berauben, ihn zum reagierenden Organismus, zum vegetierenden Mechanismus zu degradieren und ihn der unumstößlichen Welt der Fremdbestim- mung zu überlassen, sein Leben unmenschlichen Abläufen in die Hände zu spielen. Da wir das aber nicht wollen, beweisen wir jetzt mit Dringlichkeit die Wichtigkeit des menschlichen Geistes.«21
Somit zurück zu den empirisch zu gewinnenden Einsichten der menschlichen Entwicklung. Die ökologische Lage der Spezies Mensch, ihr Leben und ihr Handeln, auch in Bezug zu den evolutionären Mechanismen, wie zum Beispiel dem Begren- zungsdruck und der Beantwortung desselben, kann nicht ohne seine psychischen Fähigkeiten mitsamt seiner elaborierten sprachlichen Ausdrucksfähigkeit hinrei- chend beschrieben werden. Diese Fähigkeiten sind maßgeblich daran beteiligt, wie der Mensch auf Umwelteinflüsse reagiert, wie er sich in seine Umwelt einbindet, nämlich indem er sich der Natur anpaßt und diese an sich anzupassen sucht.
Letzten Endes ist aus biologischer Perspektive der Erfolg der menschlichen Spezies wieder mit den gleichen Maßstäben zu messen, wie der ihrer Mitlebewesen, nämlich an der biologischen Fitness. Eine Population, kulturfähig oder nicht, die es nicht fertigbrächte, daß ihre Mitglieder sich erfolgreich, das heißt bestanderhaltend fort- pflanzen, wäre zum Untergang verurteilt, was immer sie auch sonst zu leisten ver- möge.22
Das Bemerkenswerte an der Menschheit ist die Art und Weise, wie sie diesen Er- folg im Unterschied zu anderen Populationen bislang zustande brachte. Dabei spielt die dem Menschen gegebene Gabe, sich von der äußeren Welt ein inneres Abbild zu machen, sich eine geistige Repräsentationswelt zu schaffen, eine große Rolle. Er be- sitzt weiterhin die Fähigkeit in dieser Geistwelt die imaginären Gegenstände zuein- ander in Beziehung zu setzen und diese Beziehungen beliebig auszutauschen. So ist er in der Lage komplexe Szenarien zu entwerfen, sie zu erkunden, mit ihnen zu spie- len, sie zu verändern und schließlich ganz ohne physischen Aufwand aus ihnen Lehren und Anhaltspunkte für sein Verhalten in der realen Welt zu ziehen. Dem menschlichen Geist sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Damit steht ihm ein schier unerschöpfliches Werkzeug zur Verfügung, das ihm enorme Vorteile im Umgang mit seiner Umwelt verschafft. In seiner inneren Repräsentationswelt spielen ver- schiedene Aspekte eine besonders wichtige Rolle. Da wäre zunächst das Bewußtsein der eigenen Existenz, dann das Erkennen räumlicher und zeitlicher Zusammenhänge in der wahrgenommenen Außenwelt und weiterführend die Vorstellung kausaler Abhängigkeit zwischen Vorgängen, und damit das Erkennen der Möglichkeit, Hand- lungen mit kausalen Wirkungen zu initiieren. Weiter, die Übertragung gemachter Erfahrungen auf als ähnlich beurteilte Zusammenhänge, und die darauf bauende verallgemeinernde begriffliche Abstraktion solcher Erfahrungen. Mit der Abstraktion entstehen eigenständige begriffliche Realitäten wie z.B. Verwandtschaft, Recht und Pflicht, die wiederum mit der Außenwelt interagieren. Ebenso sind in der Innenwelt die Repräsentationen der eigenen Gefühle, Werturteile und Wünsche vorhanden, die sich mit der vorgestellten Außenwelt unterschiedlich verknüpfen können. Außenwelt und Innenwelt stehen in regem Kontakt zueinander und wirken rückwirkend aufeinander ein. Wahrgenommenes wird kognitiv verarbeitet und drückt sich als Handlung aus, diese Handlung bewirkt in der realen Welt eine Änderung, die wiederum wahrgenommen werden kann.
Entscheidend für die kulturelle Entwicklung des Menschen dürfte sein, daß er in der Lage ist seiner inneren Vorstellungs- und Gefühlswelt - mittels einer begrifflich- symbolischen Sprache beispielsweise - Ausdruck zu verleihen. Eröffnet sich doch dadurch die Möglichkeit, die Erfahrungen und Gedanken anderer Menschen aufzu- nehmen und zum Gegenstand eigenen weiteren Denkens und Handelns zu machen, die Möglichkeit aus privatem Denken und Wollen gemeinschaftliches Denken und Wollen zu machen, aus einem privaten Modell der Welt ein Weltmodell einer Kul- turgemeinschaft. Eine andere, später erlangte Fähigkeit wird der Sprache, dem In- formationsaustausch, zu dem auch Tiere23 in gewissem Umfang fähig sind, in ihrer Tragweite kaum nachstehen, nämlich das Bild und die Schrift. Allgemein: die Ausla- gerung und Konservierung von Wissen. Allein der Mensch hat eine Technik entwi- ckelt, mit der er in der Lage ist, individuell erfahrenes und tradiertes Wissen von seiner Person zu trennen, es beispielsweise niederzuschreiben und so von seinem Leben - und damit von seinem Tod - abzukoppeln. Diese Abkoppelung ermöglicht gegenüber der tierischen Art der Wissensvermittlung, die sich entweder über Verer- bung oder per Nachahmung vollzieht, ein um Größenordnungen erhöhtes Potential an Wissenssummierung und Verbreitung. Informationen können losgelöst von le- benden Informationsspeichern über weite Distanzen, als auch über viele Generatio- nen weitergegeben werden.
Auch in einer solchen Kulturgemeinschaft mit entwickeltem und verknüpftem geistigen Potential, kann sich menschliches Leben nur auf der Grundlage entfalten, welche die Umwelt ihm zur Verfügung stellt. Sein Handeln aber leitet er nicht nur, wie für Tiere maßgeblich, nach einem ererbten24 oder durch Erfahrung bestimmten Programm in Reaktion auf augenblicklich wahrgenommene Umwelteinflüsse (z.B. Begrenzungsdruck) ab, vielmehr ist sein Handeln von einem Weltmodell bestimmt, das sich aus vielerlei Erfahrungen, Gefühlen und Überlegungen zusammensetzt.25 Es ist ein großer Unterschied, ob Verhalten von augenblicklich empfundener Motivation geleitet wird, oder von Vorstellungen begehrter Ziele und Zwecke. Der maßgebliche Unterschied besteht darin, daß im zweiten Fall die Folgen verschiedener Verhaltens- strategien bis relativ weit in die Zukunft hinein erkennbar und abschätzbar sind. Die Fähigkeit zur sprachlichen Äußerung erhöht die Effizienz dieses Vorganges zusätzlich, da nun nicht nur auf ein Individuum beschränkt, sondern gemeinschaftlich Verhaltensstrategien erörtert werden können.
Der Mensch verläßt den Zustand des bloß reagierenden Organismus, und wird zum agierenden, vorausschauend und planend denkenden Wesen.
Markl schreibt weiter: »Gewiß könnte es auf die Dauer nicht gut gehen, wenn die- ses Weltmodell sich von der objektiven Realität und den durch sie gegebenen Mög- lichkeiten allzusehr unterschiede (was wir dann als Wahn bezeichnen). Gewiß kann der Mensch auch nicht beliebig frei darüber verfügen, welcher Antrieb ihn drängt, welches Tun ihm Lust und welches ihm Schmerz bereitet, was er erhofft und fürch- tet: Soviel „Natur“ muß allemal im Menschen wirksam bleiben, um sicherzustellen, daß dieses Begehren und Meiden in einem solchen Zusammenhang zur äußeren Wirklichkeit bleibt, damit am Ende zumindest im Durchschnitt der Angehörigen einer Kultur das Ziel des Überlebenserfolgs, der ausreichenden biologischen Fitness nicht verfehlt wird.«26
Setzt man die Existenz einer irgendwie gearteten „objektiven Realität“ voraus, mag Markl recht haben. Natürliche Bedürfnisse im Sinne einer direkten Erhaltung der biologischen Fitness wären vor allem Nahrungsbeschaffung, Reviersicherung, Fortpflanzung und Nachwuchsbetreuung. Die unmittelbare Befriedigung dieser primären Arterhaltungsziele, kann mit fortschreitender kultureller Entwicklung allerdings durch Zwischen- und Ersatzziele ersetzt werden. Diese Kulturation kann, muß aber nicht eine positive Auswirkung auf die biologische Fitneß einer so verfah- renden Art haben. Das Anstreben solcher Ersatzziele ist beispielsweise für das evolu- tionär erfolgreiche Prinzip der Arbeitsteilung elementare Voraussetzung. Manche dieser Ersatzziele können mit fortschreitender kultureller Entwicklung aber ein Ei- genleben weit ab der Erhaltungsintention einnehmen und zum Selbstzweck werden. Man denke nur an die Bedeutung die Macht, Besitz, Rang, Ehre, Geld als Ziel um ihrer selbst Willen annehmen können27, bis hin zur Aufgabe von Gesundheit und Wohlstand und somit zum totalen Verlust der biologischen Fitness.
Entfernen sich die Ersatzziele einer Gruppe zu weit von denen der biologischen Fitness, dann hat dies Fitneßdefizite der ganzen Gruppe zur Folge. Diese Defizite treten oft erst längerfristig zu Tage und sind ebenfalls oft nicht leicht einsichtig. Zivilisationskrankheiten wie Kreislaufleiden, Allergien oder auch ein erhöhtes Krebsrisiko stellen Defizite in der biologischen Fitneß dar, die unter anderem durch ersatzorientierte Handlungsweisen hervorgerufen werden. Auch Umweltbelastungen tragen nachhaltig zur Senkung der biologischen Fitneß bei, sei es durch Verlust von Wasserund Nahrungsressourcen oder wiederum durch langfristige Erhöhung von Krankheitsrisiken (Atomnutzung, FCKW-Verwendung).
Daß der Mensch in großem Umfang in der Lage ist, seine Ziele jenseits seiner „tie- rischen“ Triebbefriedigung zu stecken, also nicht nur seiner biologischen Natur Folge zu leisten hat, zeigen eindrücklich und oft erschreckend seine „Anfälligkeit“ für kulturelle Indoktrination und seine bisweilen fanatische Identifikation mit den Zielen des eigenen und kulturspezifischen Weltmodells,28 denen er mit Freuden ohne Rück- sicht auf Gesundheit bis hin zum kollektiven Selbstmord hinterherläuft. Diese aus biologischer Sicht reinen Verfehlungen einzelner kultureller Praktiken unterstreichen aber nur die Flexibilität und die vielfältigen Möglichkeiten, die der gesamten Art Mensch mit der Nutzung ihres geistigen Potentials und der gemeinsamen Ausbildung verschiedenster Kulturentwürfe zur Verfügung stehen.
Daß die Kulturfähigkeit des Menschen insgesamt gesehen bisher evolutionistisch überaus erfolgreich war, zeigen sein Populationszuwachs und sein Verbreitungs- grad. Ein weiteres Merkmal von Kulturen, das zu ihrem erfolgreichen Bestehen bis in unsere Zeit beigetragen hat, ist die Tradition. In einer Kultur sammeln sich Erfah- rungen und Vorstellungen an, die über verschiedene Kanäle an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden. Solange die Umweltbedingungen denen ent- sprechen, unter denen diese Erfahrungen gemacht und daraus vorteilhafte Folgerun- gen, wie das Überleben der Kultur bewies, für die Organisation des Lebens dieser Gemeinschaft gezogen wurden, solange besteht ein großer Vorteil darin, nicht leicht- fertig von diesen Kulturtraditionen abzuweichen. Es gibt viele Belege dafür, daß der Mensch sehr dazu neigt, an tradierten Erklärungs- und Handlungsmodellen festzu- halten, da es sich vermutlich über unendlich lange Zeiten der menschlichen Kultur- entwicklung bewährte sich so zu verhalten. In einer Welt wie der unserer Jäger- und Sammlervorfahren, die sich über viele Tausende von Generationen nur wenig änder- te, leuchtet die Vorteilhaftigkeit einer traditionsgebundenen Lebensweise wohl ein. Doch mit fortschreitender neolithischer Kulturation änderten sich die Lebensbedin- gungen zunehmend schneller und ebenso massiver.
Bot die kulturelle Evolution gegenüber der rein biologischen den Vorteil einer un- gleich schnelleren Anpassungsgabe, so schuf und schafft die in unsere westlich in- dustrielle Kultur mündende neolithische Kultur durch ihren beschleunigten Wandel Bedingungen, die sie wiederum an die Grenzen ihrer eigenen Anpassungsfähigkeit bringt. Das Leben aus der Vorstellung der Welt, wie sie in einem Kulturgefüge tra- diert wird, bringt den Menschen dann in Widerspruch zu der Erfahrung der verän- derten wirklichen Welt. Erfolgen die - in diesem Bezug meist anthropogen verur- sachten - Veränderungen seiner Umwelt zu schnell, so lastet das kulturelle Erbe nicht weniger lähmend auf den Menschen, wie biologisches Verhaltenserbe dies tun könn- te. Auch der Lern- und Anpassungsfähigkeit des denkenden Menschen sind Grenzen gesetzt. Als natürliches Maß für die Schrittweite dieser Fähigkeiten kann der Genera- tionswechsel gelten. Es spricht viel dafür, daß manches, was wir als vernunftwidri- ges und uneinsichtiges Verhalten heutiger Menschen beklagen, nicht - wie oft (auch von manchen Biologen) angenommen - Ausdruck unserer unabänderlichen biologi- schen Natur, der seit Äonen programmierten „Instinktblindheit“ ist, sondern viel- mehr Ausdruck einer angeeigneten Kultur- und Traditionsblindheit. Früher erfolg- reiche Strategien werden blind auf neue Herausforderungen angewandt. Dies bietet kein Ausweg. Die einzige Lösung ist, den neuen Gegebenheiten gemäße Wege zu finden, zu erproben und unter Bewahrung der weiterhin brauchbaren tradierten Elemente die überkommenen Vorstellungen und Handlungsweisen durch besser entsprechende zu ersetzen.
Der Mensch besitzt die Möglichkeit einen als unbefriedigend empfundenen Ist- Zustand einem als vorteilhafter vorgestellten Soll-Zustand gegenüberzustellen und sich Handlungsweisen zu erdenken, die in die gewünschte Richtung weisen.29 Das Tier erfährt seine Zukunft, der Mensch kann sie sich erdenken und zumindest ein Stück weit gestalten. Eine Garantie für den angestrebten Erfolg seiner erdachten Handlung kann es in einer nie vollständig voraussagbaren Welt nicht geben. Der höchste Preis, den der Mensch für die Fähigkeit, die Zukunft vorauszudenken, zu entrichten hat, ist aber das Wissen um seine Sterblichkeit.
2. Ökologie des Menschen - Von der Steinzeit zum Ackerbau
Wenden wir uns nun einer konkreten Betrachtung der Lebens- und Wirtschaftswei- sen unserer menschlichen Vorfahren, ihrer Stellung in der Natur und ihrem Umgang mit ihr zu; und greifen die Frage des Begrenzungsdrucks auf die menschliche Ge- meinschaft wieder auf. Dabei kommt eine Beschreibung der Ökologie des Menschen nicht ohne eine ökonomische Betrachtung der Mensch-Umwelt-Beziehung im Laufe seiner Kulturentwicklung aus; ökonomisch, nicht in Bezug auf ein modernes Geld- wirtschaftssystem, sondern im ursprünglicheren Sinne als Gestaltung der materiellen Beziehungen des Menschen zur Umwelt aufgrund planerischen Vorgehens. Dabei muß man die kognitive Interaktion zwischen Mensch und Umwelt in Rechnung stellen, um zu verstehen, wie der Mensch sein Leben unter der Begrenzung durch die Knappheit lebensnotwendiger Ressourcen meistern konnte. Werfen wir auch weiter- hin aus dieser biologisch-anthropologischen Sicht heraus von Zeit zu Zeit einen ver- gleichenden Blick ins Tierreich und in unsere heutige menschliche Lebenswelt, auf- fallende Ähnlichkeiten oder Unterschiede können aus wissenschaftlichem Blickwin- kel Auskunft über unsere heutige evolutionäre Position geben.
2.1 Ökologie und Ökonomie der Steinzeit
Die Steinzeit benennt den Zeitraum, in dem der Mensch Werkzeuge aus Stein schuf. Je nach geographischer Lage differiert dieser Zeitraum, früheste Funde lassen auf ein Alter von grob drei Millionen Jahren schließen. Die Steinzeit, untergliedert in Paläo- lithikum, Mesolithikum und Neolithikum, zog sich über Jahrmillionen bis wenige tausend Jahre vor unserer Zeitenwende hin. Erst mit dem einsetzenden Ackerbau und dem damit verbundenen Erfindungsschub im Neolithikum endet die Zeit der Steinwerkzeuge.
Von der Existenz der Steinzeitmenschen, deren Leben und Tun geben uns zahlrei- che über die ganze Welt verstreute archäologische Funde Auskunft. Skelette, steiner- ne und zu Stein gewordene Artefakte geben Hinweise auf die Lebensweise unserer als Jäger und Sammler lebenden Vorfahren. Über das gesellschaftliche Leben liegen - nicht zuletzt in Ermangelung an Aufzeichnungen - allerdings keine gesicherten In- formationen vor. Je dünner aber die Informationslage, desto weiter liegen die daraus gezogenen Schlußfolgerungen über Art und Weise des sozialen Miteinanders aus- einander. Man versucht sich deshalb mit vergleichenden Betrachtungen heute noch als Jäger und Sammler lebender Kulturen zu helfen und somit dem Leben in der Steinzeit wissenschaftlich näher zu kommen. Um einen unverzerrten Vergleich zu gewährleisten, muß man allerdings einige abweichende Tatbestände der heutig le- benden Jäger- und Sammlerkulturen in Rechnung stellen. Abweichende Lebensräu- me und Umweltbedingungen, eine zeitliche Differenz von vielen hunderttausend Jahren, Kontakt mit anderen, „moderneren“ Kulturen erschweren den direkten Ver- gleich. Zudem muß man beachten, daß gleiche oder ähnliche Bedingungen keines- falls immer zur selben kulturellen Entwicklung führen, ein und demselben Problem kann auf verschiedenste Weise kulturell begegnet werden.
Dennoch, wie auch immer man die Funde und Befunde aus Grabungsstätten und Untersuchungen noch existenter Jäger- und Sammlerstämme zu einem evolutionslogischen Szenario verbindet, im Hinblick auf das Wirtschaften des Frühmenschen in seiner natürlichen Umwelt, seiner Ökologie und Ökonomie, sind folgende Annahmen wenig umstritten. Hochentwickeltes soziales Zusammenleben kann dabei als wichtigstes tierisches Primatenerbe immer vorausgesetzt werden. Die hier genannten Daten gehen auf Markl zurück, ergänzende Quellen sind Campbell, Sieferle, sowie Tanner, Johanson und Edey, Leakey und Lewin.30
- Eine Arbeitsteilung der Geschlechter in der Nahrungsbeschaffung dürfte sich bereits sehr früh herausgebildet haben. Dies hatte eine zeitweilige räumliche Trennung der Frauen und Kinder von den Männern zur Folge: Die Frauen, belastet durch den Kleinkindertransport in ihrer Mobilität eingeschränkt, dürften sich stärker dem Sammeln pflanzlicher Nahrung im Nahbereich der Lagerplätze gewidmet haben. Die körperlich kräftigeren Männer dürften ihre Aktivitäten auf größere Bereiche ausgedehnt haben und dabei zunehmend auch tierische Nahrung, entweder selbst erbeutete oder anderen Raubtieren abgeluchste, beigebracht haben. Das weiträumige Nahrungsammeln forderte von den Sammlern, sich die räumliche und zeitliche Verteilung von Nahrungsquellen merken zu müssen. Dies mußte für das räumlichzeitliche Denkvermögen enorm förderlich gewesen sein.
- Wegen der zunehmenden Gehirn- und damit Kopfvergrößerung mußte der Nachwuchs (relativ zu seiner sonstigen körperlichen Entwicklung) immer früher geboren werden. Dadurch wurden die Säuglinge zunehmend hilfloser und sorgebedürftiger und die Nesthockerphase verlängerte sich entsprechend. Während dieses Zeitraums waren die sorgenden Mütter an ihre Lagerplätze gebunden. Verstärkt wurde die zunehmende Fokalisierung (focus lat. Herd, Feuer) des sozialen Lebens dadurch, daß der getrennte Nahrungserwerb einen verläßlichen Treffpunkt notwendig machte, und daß kranke und altersschwache Menschen und Kleinkinder gar nicht oder nur begrenzt an der Nahrungssammlung teilnehmen konnten.
- Das rollenverteilte Zusammenwirken der Geschlechter im Nahrungserwerb und in der Nachwuchsbetreuung, sowie das Zurückbleiben versorgungsbedürftiger Mit- glieder am Lagerplatz, machte für die umherschweifenden Jäger- und Sammler den Transport zumindest eines Teils der gefundenen Nahrung zum Lagerplatz anstelle des sofortigen Verzehrs notwendig. (Wobei die Männer im Wettstreit um den Zu- gang zu dem ihre Fortpflanzungsmöglichkeiten beschränkenden knappen Gut Frau sich vielleicht am wirkungsvollsten als besonders gute Versorger hervortaten.) Die Notwendigkeit des Nahrungstransports hatte wichtige psychologische Konsequen- zen, nämlich den Aufschub sofortiger Bedürfnisbefriedigung31, das Ausbilden erster Zwischenziele - eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Bildung einer kulturel- len Gemeinschaft, die Herausgestaltung von Tauscherwartung und -verpflichtung - also verbindliche Verhaltensregeln, und die Entwicklung von Vertrauen in die Ver- läßlichkeit sozialer Bindungen sowie die Sanktionierung der Verletzung dieses Ver- trauens.
Der Umgang mit Vorräten und Überschüssen, das Wirtschaften, das vielen Raubtieren vertraut ist, stellte für Primaten, auch nur für wenige Stunden oder Tage, eine Neuerung dar. Um den Transport über weite Strecken (viele Kilometer) einigermaßen effizient zu gestalten, bedurfte es Tragebehältnissen wie zum Beispiel Schlingen, Netze, Säcke oder Körbe. Markl vermutet, daß diese Hilfsmittel für die frühe Entwicklung der ökonomischen Kultur wichtiger gewesen seien als Grabstöcke oder Jagdwaffen: die Geburt der Kultur aus Rucksack oder Handtasche.
- Werkzeuge halfen bei der Nahrungsbeschaffung. Mechanische Hilfsmittel, so zum Beispiel Stöcke zum Ausgraben von unterirdischen Knollen, gefertigt aus Holz, Kno- chen, Steinen oder Pflanzenfasern, oder bald auch mit natürlichen Giften versehene Jagdwaffen und Fallen, machten den Nahrungserwerb effizienter. Wichtig waren auch Geräte zum weiteren Bearbeiten der Nahrung. Der Mörser oder Mahlstein, der durch Aufbrechen die harte Nahrung besser erschloß, mag neben den Transportbe- hältnissen ein zweites Grundrequisit menschlicher Kultur sein. Außerdem wurden Gerätschaften zur Bearbeitung von Bedarfsgegenständen hergestellt.
Die Verteilung des ökonomischen Beitrages der Geschlechter zur gemeinsamen Ernährung und damit auch der Einsatz der entsprechenden Werkzeuge wird je nach örtlichen Umweltbedingungen sehr unterschiedlich gewesen sein. In Trockengebie- ten und Trockenzeiten kann der Grabstock der Frau das überlebenswichtige Werk- zeug gewesen sein. Von den heutigen Kalahari-Buschleuten wissen wir, daß sie auf- grund ihrer Grabstöcke mit denen sie Wurzeln und Knollen aus dem Boden graben, noch in öden Gebieten leben können, welche den afrikanischen Tierprimaten, die vornehmlich dieselben Nahrungsquellen nutzen, nicht mehr zugänglich sind. In anderen Zonen und Zeiten lag das Hauptgewicht der Nahrungsbeschaffung wohl bei den Männern, ihrem Geschick die geeigneten Waffen zur Jagd herzustellen und sie erfolgreich einzusetzen.
So sah also grob die ökonomisch-ökologische Lebensweise des frühen Menschen aus: Sammeln und Jagen unter Werkzeugeinsatz nach Geschlechtern getrennt, Transport der Nahrung zum Lagerplatz, gemeinsame Nutzung durch Austausch der Nahrung und Güter in der sozial kooperierenden Gruppe, ebenso gemeinsame Aufzucht der Nachkommen in der Gruppe mit der Kernfamilie bestehend aus Mann, Frau und gemeinsamen Kindern als Ankerelement des sozialen Systems.
2.2 Das Beispiel der !Kung San
Wenn wir nun nach den ökologischen Begrenzungsbedingungen für die Steinzeit- menschen fragen, so können wir die wesentlichen Informationen nur durch das Stu- dium noch bis heute als Jäger und Sammler überlebender Kulturen erlangen. Dabei gilt es zu beachten, daß diese rasch schwindenden Kulturen, soweit sie nicht durch andere Kulturen beeinflußt oder verdrängt worden sind, ihre Lebensweise schon grundlegend geändert haben, und noch auf „steinzeitlichem Niveau“ stehen, kei- neswegs primitiv im Sinne von „auf Frühmenschenstufe stehengeblieben“ sind, sondern diese Völker und Stämme eine genauso lange Kulturevolution hinter sich haben wie wir. Auch wenn diese Kulturen nur noch in ökologisch dürftigen Biotopen übrigblieben, was Sonderanpassungen nötig machte, und ihre Lebensweise somit nicht unbedingt charakteristisch steinzeitlich ist, denn damals entwickelten sich die ersten Kulturen eher unter für sie günstigen Bedingungen, so können wir doch stu- dieren, wie sich ökologische Randbedingungen und kulturelle Eigentümlichkeiten von Jägern und Sammlern auf die Bevölkerungsentwicklung auswirken. Dabei ist vor allem der Zusammenhang zwischen den ökologischen Parametern von Ressour- cenangebot und Ressourcenbeanspruchung, den ökonomischen Parametern des Arbeitsaufwandes und den demographischen Parametern wie Geburten-, Sterbe- und Wachstumsrate, Gesundheits- und Ernährungszustand, etc. interessant.
Die meisten verbliebenen Sammler und Jägervölker sind heute - was die Ernäh- rung betrifft - in die ökologischen Armutsgebiete wie Trockenwüsten, tropischer Regenwald und polare Eisrandgebiete abgedrängt worden, so daß dem oberflächli- chen Beobachter und selbst den Anthropologen bis in neuere Zeit das Leben unter solchen Umständen widerwärtig, brutal und mühselig erschien. Doch ist dieses Bild eher Produkt einer von der eigenen Kultur gefärbten Sichtweise, wobei zur Bewer- tung des Jäger- und Sammlerdaseins unsere zivilisierten Maßstäbe angesetzt worden sind, die - da unzutreffend und somit nicht übertragbar - ganz selbstverständlich ein solches Zerrbild liefern mußten. Genauere ethnologische Feldforschungen legen jedoch ein anderes Bild nahe, nämlich daß sich unter diesen „ärmlichen“ Bedingun- gen sogar fast so etwas wie eine ursprüngliche Wohlstands- und Freizeitgesellschaft32 entwickeln kann. Der Lebensstandard definiert sich ja nicht absolut aus der Menge der verfügbaren Güter, sondern aus der Zufriedenheit der Betroffenen heraus, aus deren Bedürfnissen, ihrer Befriedigung und des dazu notwendigen und ebenfalls subjektiv empfundenen Arbeitsaufwandes.
Beispielsweise waren Jäger und Sammler was dauerhaften Güterbesitz anbelangt sehr bescheiden. Da sie zum Lebensunterhalt sehr weite Flächen ausnutzen mußten, waren sie eine sehr mobile Gesellschaft. Wer aber beim ständigen Lagerplatzwechsel sein gesamtes Hab und Gut auf den eigenen Schultern zu tragen hat, der entwickelt sicherlich kein großes Bedürfnis zur Anhäufung materieller Güter. Eine typische Jäger und Sammlergemeinschaft bestand aus 10 bis 40, meistens aus 20 bis 25 Indivi- duen, und sie benötigten je nach Produktivität des Biotops eine Fläche von 50 bis 1000 Quadratkilometern. Lag der Schwerpunkt der Nahrungsbeschaffung in der Jagd, nutzten sie eher eine größere, bei vorwiegend pflanzlicher Kost eine eher klei- nere Fläche.
Nehmen wir zum Beispiel die in der Kalahari als rezente33 Jäger und Sammler leben- den !Kung San, deren Lebensweise seit den Fünfzigerjahren eingehend untersucht wurde.
Die San-Buschmänner im Süden Afrikas umfaßten in den fünfziger Jahren etwa 53.000 Personen, von denen die größere Zahl aber schon in engem Kontakt mit der Zivilisation bzw. mit benachbarten Agrargesellschaften stand. Um 1900 lebten noch 60% von ihnen als Jäger und Sammler, 1980 waren es weniger als 5%. Eine !Kung San Frau legt im Mittel pro Tag zwischen 3 und 20 Kilometer zur Nahrungssuche zurück. Beim Lagerwechsel trägt sie ihren gesamten Besitz (5 bis 15kg) bis zu 100km weit, auf unnötiges Besitztum verzichtet man da wohl gerne. Insgesamt bewältigt sie in einem Jahr etwa 2400km.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1) Skelettfunde lassen den Schluß zu, daß die San-Völker einst ein viel größeres Gebiet in Süd- und Ostafrika bewohnten. Linguistische Befunde stützen die Vermutung, daß die San bis weit nördlich in Tansania heimisch waren (a). Als 1652 holländische Siedler am Kap eintrafen, war das San Territorium durch die von Norden und Westen vordringenden schwarzen kongoiden Völker bereits zusammengeschrumpft (b). Heute sind die San infolge der eu- ropäischen Expansion auf ein Rückzugsgebiet beschränkt, das fast aus- schließlich in der Kalahari-Wüste Botswanas, Südafrikas und Angolas liegt - ein Trockengebiet, das niemand sonst haben wollte (c). Das Erbgut der San wird überdauern, aber ihre Kultur scheint dem Untergang geweiht zu sein. (Sieferle, S.145)
Sehen wir uns nun den notwendigen Arbeitsaufwand einer Jäger- und Sammlerkul- tur bei den !Kung San an. Bei der Nahrungsbeschaffung sammeln die Frauen aus- schließlich, während die Männer sowohl sammeln als auch jagen. Kinder unter 15 Jahren, Alte über 60 Jahren und Kranke brauchen für ihren Lebensunterhalt nicht zu arbeiten, sie werden mitversorgt. Zur Nahrungsbeschaffung arbeiten die !Kung San nur zwei bis drei Tage die Woche, das ergibt für Männer Wochenarbeitszeiten von 22 und für Frauen von 13 Stunden durchschnittlich, das genügt. Zählt man die sonsti- gen anfallenden Arbeiten, die da wären: Herstellen von Gebrauchsgegenständen (Männer 7 bis 8 Std., Frauen 5 Std.), und Hausarbeit (vor allem Nahrungszuberei- tung, Kinderbetreuung, Wasser- und Feuerholzholen: Männer 15 Std., Frauen 22 Std.) hinzu, so kommt man auf eine Gesamtwochenarbeitszeit von etwa 45 Std. bei den Männern und 40 Std. bei den Frauen. Dabei handelt es sich effektiv um die ge- samte Zeit, die ein Mitglied dieser Kultur für seinen Lebensunterhalt, sowie für den Bestand der Gemeinschaft tätig ist. Übertragen auf unser heutiges modernes Leben wäre dies: Arbeitszeit zuzüglich Hausarbeit, Kinderbetreuung, Einkaufen, Behör- dengänge, etc.). Die leicht höhere Arbeitszeit der Männer wird durch die Mehrbelas- tung der Frauen durch die Kinderbetreuung ausgeglichen, dabei haben die Frauen bei ihren Sammeltouren pro Tag auf 5km etwa 9kg „Kinderlast“ mitzutragen.
Bei einer Arbeitszeit von 40 bis 45 Wochenstunden kann man schwer von einem widerwärtigen und mühsamen Leben sprechen. Wie sieht es aber mit dem Ertrag, der Arbeitsleistung aus? Diese Frage muß sich vor allem auf die Nahrungsbeschaf- fung beziehen. Sind die niedrigen Arbeitszeiten etwa erzwungen, weil sich unter den kärglichen Bedingungen der Kalahari nicht mehr erwirtschaften läßt, die Ressourcen bis zu ihren Grenzen belastet sind und somit ständiges Hungerleiden herrscht?
Geschlechterspezifisch steuern Frauen trotz geringerem zeitlichen Aufwand rund 60% der Nahrungskalorien bei, diese bestehen fast ausschließlich aus Pflanzen. Das Angebot ist reichhaltig, so sammeln sie bei ihren Streifzügen bis zu einhundert un- terschiedliche Wurzel- und Knollenarten. Männer schaffen dafür das wesentlich begehrtere Fleisch herbei. 54 einheimische Tierarten sind dabei Ziel ihrer Jagd. Nah- rungsreserven werden nicht angelegt, somit sind auch keine Methoden zur Konser- vierung entwickelt worden, denn Sammelgut, vor allem Nüsse, ist immer leicht ver- fügbar. Daß die Frauen bei der Nahrungsbeschaffung produktiver als die Männer sind (zwischen 50% und 70%), trifft auf die meisten warme Zonen bewohnende Jäger und Sammler zu. So sind sie auch im sozialen Gefüge den Männern gleichgestellt und nicht nur als Mütter, sondern auch als Mitversorger hochgeschätzt.
Die Arbeitsleistung bei der Nahrungsbeschaffung beträgt durchschnittlich 9.900kJ, davon 2.900kJ als Fleisch, pro Tag und Kopf. Das entspricht einer so ausreichenden und bekömmlichen Kost, daß den !Kung San (nach Überwinden der hohen Kindersterblichkeit) von Ärzten ein guter Gesundheitszustand bestätigt wird, von Hungerleiden keine Spur. Vor allem fehlen bei ihnen fast alle typischen Über- und Fehlernährungsleiden, wie etwa Herz- und Kreislaufkrankheiten34, die bei ackerbauenden Primitiv- und Hochkulturen viel häufiger zu finden sind. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt wegen der hohen Kindersterblichkeit (40% bis zum 15. Lebensjahr, 20% allein schon im 1. Jahr) nur bei 20 bis 30 Jahren, ist aber nicht geringer als die der Ackerbau treibenden Völker bis in die Neuzeit.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2) In allen Wildbeutergesellschaften ist die Jagd das Vorrecht der Männer. (Sieferle, S.154)
Diese Sammler und Jäger leben also recht gesund und auskömmlich bei beneidens- wert niederem Arbeitsaufwand. Wie sieht es aber mit den natürlichen Ressourcen aus, werden diese ausgeschöpft, so daß ihre Knappheit die Bevölkerungszahl be- grenzt? Dies ist nicht der Fall. Alle Beobachtungen deuten darauf hin, daß Sammler und Jäger keineswegs typischerweise am Existenzminimum vegetieren, sondern daß sie allgemein ihre Bevölkerungsdichte in sicherem Abstand von der Tragfähigkeits- grenze der Umwelt zu halten wissen. Man hat geschätzt, daß sie nur weniger als die Hälfte der durch das Nahrungsangebot möglichen Populationsdichte halten, wobei sie selbst in Mangelzeiten noch unter der Tragekapazität der Umwelt bleiben.
Sie halten ihre Polpulation also bei einer Dichte, bei der die grausamen Malthuss- chen Begrenzungsfaktoren (Hunger, Seuchen Kriege) noch keineswegs in Aktion treten müssen. Die Nahrungsbasis ist ausreichend, Hungerleiden ist für die Jäger und Sammler eine Seltenheit. Die niedrige Populationsdichte gestattet es Epidemien nicht leicht, sich auszubreiten, zudem fördert der häufige Lagerplatzwechsel die Hygiene. Und Kriege oder territoriale Streitigkeiten sind insgesamt bei Jägern und Sammlern äußerst selten. Im Gegenteil, zwischen den verstreuten Gruppen herr- schen eher friedliche Formen gemeinsamer Landnutzung und flexibler Gruppenzu- gehörigkeit vor, die ein - in schlechteren Jahren besonders wichtiges - durch Ver- wandtschaftsbeziehungen gestütztes Netzwerk zum Tausch und zur Unterstützung aufbauen. Entgegen des romantisch verklärten Bildes des „edlen Wilden“, sind Jäger und Sammler aber auch keine Heiligen. Tödlicher Streit (z.B. um Frauen) kommt vor, genauso blutige Fehden. Mord und Totschlag sind etwa so häufig wie in den „zivilisierten“ Städten. Rechnet man allerdings durch Kriege verursachte Todesopfer mit ein, bestechen die Wilden durch ihre wahrliche Friedfertigkeit. Tod durch Menschenhand (<1%) und Tod durch ein Raubtier (≈0,5%) sind für die Bevölkerungsbegrenzung im Malthusschen Sinne völlig unerheblich.
2.3 Begrenzungsdruck und Antwort der !Kung San
Wenn aber die Bevölkerung dieser „primitiven“ Kulturen nicht durch Hungersnöte, Seuchen und mörderische Kämpfe in Schranken gehalten wird, was hindert sie dann daran zu wachsen? Bei den Kalahari-Bewohnern ist man dieser Frage besonders sorgfältig nachgegangen. Die Antwort liegt irgendwo zwischen biologischer Natur und Selbstbeschränkung.
Würden die Jäger und Sammler ihr gesamtes ihnen durch ihre Umstände zur Ver- fügung stehendes Vermehrungspotential nutzen, so würde dies zu einer gewaltigen Populationsexplosion führen. Die maximale „natürliche Fruchtbarkeit“ liegt man- chen Angaben nach bei 10 bis 11 Kindern pro Frau, eine etwas vorsichtigere Progno- se dürfte bei 8 Kindern liegen. Die tatsächliche durchschnittliche Geburtenrate der !Kung San Frauen liegt jedoch nur bei 5 Kindern. Entsprechende Befunde gibt es auch von anderen Jäger- und Sammlervölkern, trotz relativ mäßiger Mortalität (auch ohne hochmoderne Medizintechnik) herrscht nahezu Nullwachstum, ihr Bevölke- rungszuwachs spielt sich unterhalb von 0,1% ab. Der momentane Bevölkerungszu- wachs global liegt über das fünfzehnfache höher. Für die paläolithischen Völker schätzt man den Zuwachs sogar nur auf 0,001%. Daß sich Menschen unter „günsti- gen“ Bedingungen weit besser vermehren können, zeigen die Zuwachsraten in der Dritten Welt, die 3 bis 4 Prozent erreichen, oder die Besiedelung des amerikanischen Kontinentes vor einigen zehntausend Jahren, der in Windeseile (wenige hundert bis tausend Jahre) komplett bevölkert wurde, was ungefähre jährliche Wachstumsraten von 1 bis 3 Prozent erforderte. Was hindert aber den Menschen als Sammler und Jäger unter normalen Bedingungen - gibt es nicht gerade eine neue Kultur oder einen neuen Kontinenten sich einzuverleiben - daran, sich ebenso rasch zu vermehren? Tatsache ist, Jäger und Sammler warten nicht bis die Sterberate unter dem Druck der Umweltbegrenzungen ansteigt, sondern beschränken die Nachwuchsrate derart, daß der Gesamtzuwachs sich in minimalen - und für sie wohl nicht wahrnehmbaren - Grenzen hält. Die Mechanismen und Mittel, die dies bewirken, sind von unterschied- lichster Art, die Konsequenzen dienen aber alle der einen Sache: das Bevölkerungs- wachstum nahe Null zu halten.
Dieses sehr beschränkte Wachstum ist rein biologisch nicht zu erklären, es aller- dings allein moralisch, das heißt durch eine bewußte Bewertung, motiviert zu ver- stehen, ginge wohl auch fehl. Jedoch wurden diese irgendwie gearteten Selbstbe- schränkungsmechanismen in den kulturellen Verhaltenskodex übernommen - und dies kann durchaus als moralischer Akt bezeichnet werden. Im konkreten Fall der !Kung San geschieht das in folgender Weise: Eine !Kung Frau gebiert nur alle vier Jahre ein überlebendes Kind, und das ist gut so, denn ein Kind wird bei den !Kung San über vier Jahre lang gestillt und die Mutter trägt es während ihrer Sammeltouren auch ständig mit sich herum. Dabei ist während den ersten drei Jahren die Mutter- milch für das Kind praktisch die einzige Nahrung. Die Belastung der Mütter ist wäh- rend dieser Zeit so groß, daß kein Neugeborenes mitversorgt werden könnte.
Wie kommt es aber zu diesem großen Geburtenabstand? Das erste Jahr nach der Geburt herrscht für die Mütter ein Tabu gegen Geschlechtsverkehr. Was aber die offensichtliche Unfruchtbarkeit in den nächsten drei Jahren betrifft, so werden ver- schiedene Theorien diskutiert. Einig ist man sich soweit, daß die überlange unfrucht- bare Phase in Zusammenhang mit der ausgedehnten Stillzeit stehen muß, die genau- en biologischen Prozesse sind allerdings unklar. Wie auch immer diese Prozesse aussehen mögen, das bemerkenswerte ist, daß im Endeffekt das Reproduktionsver- halten der !Kung San genau ihrem Produktionsverhalten als Jäger und Sammler entspricht. Zusätzlicher geburtenregelnder Eingriffe bedarf es praktisch nicht. Die Tötung eines Neugeborenen kommt nur in Ausnahmefällen in Frage, bei Geburten- fehler, bei Zwillingen, bei ausnahmsweise zu kurzem Abstand der Geburten oder wenn sich die Mutter zu schwach fühlt, das Kind aufzuziehen. Die Entscheidung liegt allein bei der Mutter, die sich ihrerseits wieder an kulturellen Normen orien- tiert.
Bei anderen Jäger- und Sammlervölkern spielen ganz andere Prozesse und Verhal- tensweisen der Zuwachskontrolle eine Rolle. Bei den Ureinwohnern Australiens ist die „Tragekapazität“ der Mutter ein wichtiger begrenzender Faktor. Bei ihnen wie bei anderen Jägern und Sammlern kann zusätzlich die Kindestötungsrate erheblich sein (manchmal bis 50%) um einen genügenden Geburtenabstand zu gewährleisten, oftmals werden bevorzugt Mädchen getötet, da eine Bevölkerungskontrolle am effi- zientesten durch den auf diese Weise erreichten Geburtenrückgang zu erzielen ist. Bei den Eskimos regelt sich die niedere Geburtenzahl hauptsächlich über die monate- lange Abwesenheit der Männer und die durch das harte Nomadenleben niedere Geburtenwahrscheinlichkeit. Auch künstlicher Schwangerschaftsabbruch ist bei einigen Völkern Usus. »Manche dieser Methoden mögen grausam wirken. Sie sind jedoch sicher weniger grausam als die Auslieferung der ganzen Bevölkerung an die Gefahr des Verhungerns.“35 Zudem muß man zur Bevölkerungskontrolle mittels Kindestötung aus unserer gewohnten ethischen Sicht heraus bemerken, daß es keine „natürliche“ Grenze zwischen „Mensch“ und „Noch-nicht-Mensch“ gibt. Die Be- stimmung des Beginns menschlichen Lebens ist allein eine kulturelle Übereinkunft und die gewählten Zeitpunkte differieren von Kultur zu Kultur sehr stark. Auch die bei uns gesetzlich geregelte Drei-Monate-Regelung für eine Abtreibung ist eine ge- sellschaftliche Konvention. Nicht einmal die Geburt setzt in vielen Kulturen eine Grenze. Vielfach wird ein Neugeborenes erst durch einen Akt der Initiation (Taufe) zu einem vollgültigen Mitglied der Gemeinschaft. Zuvor kann es einen Sonderstatus besitzen, der in gewissen Fällen die Tötung erlaubt. Allerdings gibt es keine Kultur, die eine willkürliche Tötung von Menschen, egal welchen Alters, zuläßt.
Zusammenfassend kann man für die Jäger und Sammler auf Steinzeitkulturstufe bemerken: Sie haben es geschafft, ihre Nachwuchsrate so klein zu halten, daß die Bevölkerung über lange Zeit stabil und in sicherem Abstand von der harten Begren- zung durch die ökologische Tragekapazität blieb. Welche der dabei mitspielenden Prozesse der Geburtenregelung „natürlich“ und welche „kulturell“ motiviert sind, läßt sich gar nicht trennen. Ist es natürlich oder kulturell bedingt, wenn !Kungmütter ihre Kinder jahrelang dauerstillen? Ist es ein Natur- oder ein Kulturmerkmal, wenn sie Kinder mit Geburtsfehlern töten, wie so viele Tiere auch? Entscheidend ist, daß sich diese Mütter nach bestimmten Verhaltensregeln richten, die einem gemeinsa- men, durch kognitive Prozesse mitgeformten Welt- und Handlungsmodell entsprin- gen. Dies ist in der Tat ein kulturelles und wohl auch menschliches Merkmal.
Eine Frage bleibt offen: Warum haben die Jäger und Sammler nur ein annäherndes und kein absolutes Nullwachstum, wenn dieses ihnen den sicheren Abstand von der Ressourcengrenze garantierte? Eine plausible Antwort lautet: Weder war es den Steinzeitmenschen möglich, noch ist ein Nullwachstum in einer Welt sich ändernder Umweltbedingungen und eigener Entwicklung sinnvoll.
Um einen so langsamen Anstieg der Bevölkerungszahlen überhaupt wahrzuneh- men, bedarf es in irgend einer Form Vergleichszahlen, die Jahrhunderte oder gar Jahrtausende zurückliegen müssen. Diese dürften den Steinzeitlern aber kaum vor- gelegen haben. Auch wenn dieser Vergleich zu ziehen war und der Anstieg über- haupt bemerkt wurde, wäre um eine stabile Bevölkerung zu ermöglichen, die Vorhersicht der Ressourcen- und auch der eigenen Entwicklung über viele Generati- onen vonnöten, was den Jägern und Sammlern gewiß genauso wenig gelang, wie uns heute. Sinnvoll wäre ein Nullwachstum also auch in dieser Richtung nicht gewe- sen: Da man die zukünftigen Faktoren, welche Einfluß auf die eigenen Lebensbedin- gungen nehmen werden, nicht kennt, kann ein Nullwachstum bei plötzlich sich än- dernden Bedingungen - seien diese fremd- (Umwelteinflüsse) oder auch eigenbe- stimmt (Technik) - nachteilige Folgen haben. Auch könnte man bei sich neu eröff- nenden Ressourcenquellen diese nicht nutzen und würde unter Umständen sich stärker vermehrenden Ressourcenkonkurrenten unterliegen. Außerdem stellt ein mehr an Artgenossen im Allgemeinen eine Sicherheit gegen das Aussterben dar, zum einen durch die reine Zahl, zum anderen durch die dadurch gewährleistete Vielfalt an Erbgut und Lösungsstrategien.36
Ein Nullwachstum wäre also evolutionistisch Unsinn, oder anders formuliert, eine diesen Stillstand praktizierende und den Gesetzen der Evolution gehorchende Art wäre zum Untergang verurteilt. In der Steinzeit und bei den heutigen Jägern und Sammlern herrschte ein sehr geringes Bevölkerungswachstum, das sich allerdings nicht statisch, sondern eher in dynamischen Wellen vollzog, und immer wieder ge- gen die ökologischen Grenzen anlief, um durch kulturellen und technologischen Wandel diese Grenze der Tragekapazität (aus sicherer Entfernung) langsam aber ständig weiter hinauszuschieben. Jede neue, verbesserte Waffen- und Jagdtechnik erschloß ja denen, die sie erfunden hatten, zusätzliche Nahrungsquellen und erlaubte ihnen dadurch die Expansion und neue Stabilisierung in sicherem Abstand zu den neuen Grenzen. In der Steinzeit vollzog sich allerdings Expansion und auch techni- scher Fortschritt sehr langsam. Bahnbrechende Innovationen in der Jagd- oder Ernte- technik wären nämlich für die Jäger und Sammler auf der anderen Seite evolutionär
[...]
1 Wahrig, 1994.
2 Falls der ein oder andere Chemieingenieur, Braumeister oder Installateur anhand dieses zu weit gefaßten Wasserbaubegriffes sich plötzlich bei den Wasserbauern wiederfindet, so sei er herzlich eingeladen, als solcher den Ausführungen des Autors zu folgen.
1 vgl. Kommentar 3.1.5 u. 3.3
2 Systematische Klassifizierung in der Biologie: Gattung: Homo, Art (Spezies): sapiens, Unterart: sapiens
3 Ö kologie ist eine aus der Biologie hervorgegangene Lehre, die sich mit den Wechselbeziehungen zwischen Organismen und der belebten (andere Organismen) wie unbelebten Umwelt (Klima, Boden, ...) beschäftigt.
4 Prof. Dr. rer. nat. Hubert S. Markl, geb. 1938, studierte in München, habilitierte in Frankfurt a.M. und doziert gegenwärtig im Institut für Zoologie und Verhaltensforschung an der biologischen Fakultät in Konstanz. Er hielt und hält zahlreiche wissenschaftliche Ämter inne: Präsident der Max-Planck-Gesellschaft München, Präsident der Deutschen Forschungsgesellschaft, Präsident der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Vizeprä- sident der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, u.a. 1994/95 hielt Markl die Heinrich-Hertz-Gastprofessur in Karlsruhe inne. Die in diesem Artikel gemachten Aussagen gehen zu einem großen Teil aus seinem unten genannten Werk hervor: Markl, H.: Natur als Kulturaufgabe - Über die Beziehung des Menschen zur lebendigen Natur, Stuttgart 1986.
5 Thomas Robert Malthus (1766-1834), britischer Nationalökonom und Sozialphilosoph, wurde bekannt durch seine Schrift »Über die Bedingungen und Folgen der Volksvermehrung«.
6 Charles Robert Darwin (1809-1882), britischer Naturforscher, sammelte auf seiner fünfjährigen Weltumsege- lung wichtige Daten für die Begründung seiner Selektionstheorie. Diese besagt: 1. Die Lebewesen der Erde bringen eine gewaltige Zahl an Nachkommen hervor, von denen viele vor der Erlangung der Geschlechtsreife wieder zugrundegehen. 2. Die Nachkommen weisen teils vererbbare Unterschiede auf. 3. Im Konkurrenzkampf bleiben diejenigen Individuen am Leben und können sich vermehren, die besser an die jeweils herrschenden Bedingungen angepaßt sind. Es kommt zu einer (natürlichen) Auslese. 4. Räumliche Barrieren (z.B. Wasserräume) führen zu isolierten Entwicklungsabläufen. 5. Im Verlauf der Weiterentwicklung der Lebewesen kann auch der Zufall Bedeutung erlangen.
7 Justus von Liebig (1803-1873), deutscher Chemiker lieferte bedeutende Arbeiten auf vielen Gebieten der Chemie. Auf ihn geht der Laborunterricht an Hochschulen und der Einsatz von Kunstdünger zurück.
8 So geschehen in Australien, wo 1850 ein englischer Einwanderer nicht auf seine häusliche Jagd verzichten wollte und aus diesem Grunde 24 Kaninchen aus der Heimat importieren ließ. Einmal in das neue Ökosystem entsprungen, vermehrten sich die Kleinsäuger explosionsartig und verursachten eine der folgenreichsten Plagen anthropogenen Ursprungs. Innerhalb von 100 Jahren vergrößerte sich der anfängliche Bestand von 24 trotz größter menschlicher Gegenwehr auf 1.000.000.000 Kaninchen!
9 Lee und De Vore (Hrsg.).: Man the Hunter, Chicago 1968.
10 Das Pleistoz ä n (Diluvium) kennzeichnet die erdzeitliche Epoche des älteren Quartärs. Das Quartär ist das aktuelle Erdzeitalter, es begann vor 1,7 Mio. Jahren.
11 Pal ä olithikum, Mesolithikum und Neolithikum untergliedern den zeitlich sehr ausgedehnten Bereich der Steinzeit. Die Unterscheidung der Bereiche erfolgt über die vom Menschen verwendeten Techniken.
12 Cohen, M. N.: The Food Crisis in Prehistory, New Haven 1977.
13 Die mittlere Leistungsdichte der Sonnenstrahlung in Erdnähe (im Abstand ∆s=150*106 km von der Sonne, außerhalb der Atmosphäre) beträgt 1,368kW/m2 (Solarkonstante), d.h. sie strahlt mit 174*1015 W (174.000TW) Dauerleistung auf die Erde ein. Innerhalb eines Jahres gibt sie an das „System“ Erde die Energiemenge von 5,5*1021 kJ ab. Davon werden 31% von Atmosphäre und Erdoberfläche direkt reflektiert, 69% dienen zur Erwärmung (besser Nicht-Abkühlung) von Atmosphäre und Erdoberfläche, sowie zur Unterhaltung biologischer Aktivitäten und werden sekundär als Wärmestrahlung wieder an den Weltraum abgegeben. Die Erde selbst gibt etwa 100TW aus ihrem Innern an die Oberfläche ab. Die weltweit durch Photosynthese umgesetzte Leistung beträgt gleichfalls etwa 100TW. Die global technisch für den Menschen nutzbare Leistung spielt sich (ohne Verluste) im Bereich von 13TW ab. (1J=1Ws)
14 Das heißt, bei einer Aufnahme von ca. 10.000kJ verbraucht der Mensch bei gleichbleibendem Körperzustand eine (über Tag und Nacht gemittelte) Leistung von 116 Watt.
15 Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nimmt die Entropie bei Ablauf eines energetischen Prozesses immer zu oder bleibt gleich. Der zweite Fall (adiabater Prozeß) kommt in der technischen Umsetzung niemals vor, der erste bedeutet aber, daß diese Prozesse sich nicht vollständig umkehren lassen.
16 An dieser Stelle eine Anmerkung zum Kulturbegriff: Unter Kultur ist hier zunächst die Gesamtheit aller geistigen, technischen und künstlerischen Leistungen einer menschlichen Gesellschaft gemeint. Diese Leistun- gen sind spezifisch menschlich. So wird dem Menschen Kulturfähigkeit zugesprochen, seinen nächsten biologi- schen Verwandten, den Primaten, deren Erbgut zu 97% mit dem unsrigen übereinstimmt, aber nicht. Kultur ist der Gegenbegriff zu Natur, welche die Gesamtheit aller nicht vom Menschen geschaffenen Leistungen umfaßt. Kultur ist die Abgrenzung des Menschen gegen die Natur, ist alle Nicht-Natur, wobei aus abendländischer- Kultur-Sicht (die den Kulturbegriff entwarf; lat. colere bebauen, pflegen) Kultur gleichsam die Transzendierung der Natur darstellt. Innerhalb der Menschheit haben sich eine Vielzahl unterschiedlicher Kulturen ausgebildet. Kultur bezeichnet somit auch das bindende Element einer spezifischen Gesellschaft. (zum Kulturbegriff s. a. Kommentar 3.)
17 Lack, D.: The Natural Regulation of Animal Numbers, Oxford 1954.
18 In der griechischen Mythologie ist Auslöser des Krieges die Entführung Helenas durch den trojanischen Prinzen Paris.
19 Markl, S.286.
20 Beispielsweise setzt eine Aussage über die »Zwangsläufigkeit nat ü rlicher Ursache-Wirkung-Beziehungen« voraus, daß in der Natur Ursache-Wirkung-Beziehungen überhaupt am Werke sind, und nicht wir uns diese Beziehungen nur in irgendeiner Form erdenken und zurechtlegen. Und die Aussage über die hervorgebrachte »Möglichkeit der Freiheit des Denkens« setzt voraus, daß dem Menschen - heute wie in der Steinzeit - eine irgendwie geartete Freiheit des Denkens überhaupt innewohnt, das aber wiederum läßt sich nicht empirisch belegen. Scheinen diese Aussagen für unseren rational geprägten Geschmack noch so offensichtlich und plausi- bel, grundsätzlich wird mit ihnen ein Akt des Glaubens zugrundegelegt. Die oben erfolgte Erhebung von der Zwangsläufigkeit zur Möglichkeit ist also nur denkbar, wenn man diese beiden Annahmen über die Welt (Natur) und den Menschen voraussetzt. Das sind also keineswegs unveränderliche Fakten, sondern ontologische Hypo- thesen. Auch die Zugrundelegung eines evolutionistischen Weltmodells zur Beschreibung der Entwicklung des Lebens und hier speziell des menschlichen Lebens ist ein schöpferischer Akt und keineswegs eine gesicherte Tatsache. (Man befrage nur einmal Jehovas Zeugen zu diesem Modell). (s. Anhang A, vgl. a. Kommentar 3.1 u. 3.3)
21 Maroni, Antonius: Die Welt, polemisch und tendenziös, Erzingen 1999, Kap. 3: Die Philosophie, S. 69.
22 Betrachtet man die menschliche Entwicklung auf der Zeitachse bis zur Gegenwart, so ist dieser Erfolg aller- dings leicht errungen, denn allein unsere heutige Existenz, unser Nicht-Ausgestorben-Sein verleiht ihn uns.
23 Im Tierreich gibt es eine Vielzahl teilweise hochkomplexer (und unverstandener) Laut- oder Körpersprachen. Auch das Erlernen menschlicher Sprachen steht manchen Tierarten offen, so können Schimpansen die Taubstummensprache mit einem Wortschatz bis zu 600 Wörtern erlernen und anwenden.
24 Ein eindrucksvolles Beispiel für die erbliche Programmierung im Tierreich und dem unausweichlichen Zwang, dieser Folge zu leisten, gibt der Kuckuck ab. Er macht sich für die Aufzucht seines Nachwuchses den Futtertrieb anderer Vogelrassen zunutze. Ein im Fremdnest geschlüpftes Kuckuckjunges beginnt sogleich die noch nicht geschlüpften Eier seiner Zieheltern aus dem Nest zu werfen. Die Zieheltern, unfähig den Vorgang zu begreifen, schauen tatenlos zu. Anschließend füttern sie ihrer biologischen Natur als Versorger folgend den Eindringling und Schmarotzer, wiederum unfähig etwas dagegen zu unternehmen, zumal bis auf das Vielfache der eigenen Körpergröße. Die Ziehelternvögel sind machtlos ihren Instinkten ausgeliefert, auch wenn diese im Kuckucksfall völlig fehlgeleitet und selbst- wie artschädigend sind.
25 Dasselbe trifft für den Autor dieses Textes zu (vgl. „Interesse“ in der Einleitung dieses Kapitels, oder Kapitel Wissenschaft I)
26 Markl, S.290.
27 Auch unter den Tieren gibt es Beispiele, bei denen Ressourcen zum demonstrativen Zeichen des eigenen hohen Ranges und der Verfügungsgewalt über üppige Reserven schlichtweg vergeudet werden.
28 vgl. Mensch III, Wissenschaft I u. III, Kommentar 3.1, 3.2, 4.2 u. 4.4
29 Beim heutigen Tempo des Wandels unserer Lebenswelt, bei dem oft der Generationenwechsel - als natürlicher Rhythmus zur Anpassung und Erlernung neuer kultureller Praktiken nicht mehr ausreicht, tut man meines Erachtens gut daran, neue Strategien zur Entschleunigung der technisch-wirtschaftlichen Entwicklung und für die Nachhaltigkeit unseres Tuns zu suchen.
30 Markl, H.: Natur als Kulturaufgabe - Über die Beziehung des Menschen zur lebendigen Natur, Stuttgart 1986. Campbell, B.: Ökologie des Menschen - Unsere Stellung in der Natur von der Vorzeit bis heute, Berlin 1987. Sieferle, R. P.: Rückblick auf die Natur - Eine Geschichte des Menschen und seiner Umwelt, München 1997. Johanson, D. u. Edey M.: Lucy, München 1982.
Leakey R. E. u. Lewin R.: Wie der Mensch zum Menschen wurde, Hamburg 1978.
31 Experimente mit Schimpansen zeigen, daß diese weit weniger in der Lage sind die Befriedigung biologischer Bedürfnisse aufzuschieben. Stellt man sie vor die Wahl, sofort eine kleine Menge Nahrung (Nüsse) zu bekom- men oder wenige Augenblicke später eine viel größere, so „müssen“ sie im Anblick des erstrebenswerten Gutes unmittelbar ihrem Nahrungstrieb nachgehen und greifen sofort zur kleinen Menge. Ersetzt man allerdings die Nüsse durch Symbole und läßt die Schimpansen anhand dieser ihre Wahl treffen, können sie sich über ihre Triebe hinwegsetzen und wählen in diesem Fall die zeitlich verzögerte, aber für sie vorteilhafte, große Menge an Nüssen. Dies attestiert ihnen die Fähigkeit zum abstrakten Denken (Symbole) sowie planerisch tätig zu werden (Aufschub), als auch die Beschränkung durch ihre Triebhaftigkeit.
32 Achtung Zerrbild: Wohlstand und Freizeit sind spezifisch wertende Begriffe einer modernen abendländischen Gesellschaft und damit nicht geeignet einen anderen Kulturkreis neutral zu beschreiben.
33 rezent: noch in der Gegenwart lebend.
34 Der Fettgehalt afrikanischen Wildtierfleisches liegt etwa bei 4%, bei domestizierten Nutztieren beträgt der Fettgehalt des Fleisches 25-30%.
35 Markl, S.306.
36 Hier sei nochmals betont, daß die Richtigkeit dieser Aussagen steht und fällt mit dem Erklärungsmodell der biologischen Evolution (vgl. Anhang A). Auf deren Beschreibung der Wirklichkeit, auf der Annahme, daß dieses Wirklichkeitsmodell einen für unser Wollen und Tun ausreichenden und vorteilhaften Wirklichkeitsbezug aufweist, fußen sämtliche Aussagen dieses Kapitels (vgl. Wissenschaft III u. Kommentar 3.1).
- Arbeit zitieren
- Oliver Parodi (Autor:in), 2000, Der Wasserbau - Eine Collage, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/18985
Kostenlos Autor werden



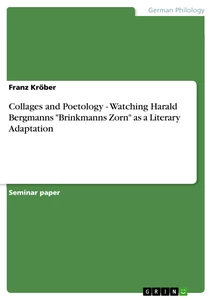







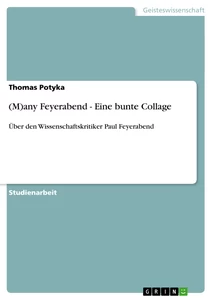





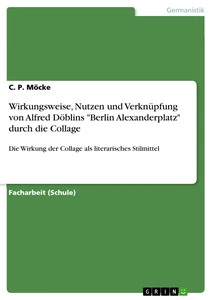




Kommentare